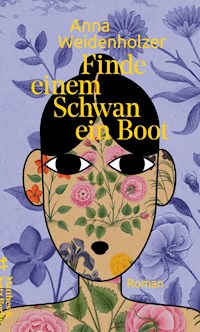Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was haben Miranda July, Markus Werner und Wilhelm Genazino gemeinsam? Lesen Sie dieses Buch und Sie wissen es. Maria hat Zeit. So sitzt sie tagsüber oft auf einer Bank am Platz vor der Kirche, beobachtet das Treiben dort, ein Kommen und Gehen, Leute, die Ziele haben und wenig Zeit. Die arbeitslose Textilfachverkäuferin kennt sich mit Stoffen aus, weiß, was zueinander passt, was Schwächen kaschiert und Vorzüge betont. In ihrem Fall ist das schwieriger: Welcher Vorzug macht ihr Alter vergessen für einen Markt, der sie nicht braucht? Alt ist sie nicht, aber ihr Leben läuft trotzdem rückwärts, an seinen Möglichkeiten, Träumen und Unfällen vorbei: Otto, den sie im Gemüsefach vergisst, Walter, den Elvis-Imitator von der traurigen Gestalt, der sie zur Witwe macht, Eduard, der mit einer anderen aus der Stadt zurückkehrt, ihre kleinere Schwester, die sosehr Mutter ist, dass sie Maria wie ein Kind behandelt. In solchen Geschichten um solche Menschen, liebenswert in ihrer skurrilen Versponnenheit, entwirft Anna Weidenholzer ein Bild von einer Frau am Rande der Gesellschaft. Und das ist immer noch mitten im Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Weidenholzer
Der Winter tutden Fischen gut
Roman
Mit freundlicher Unterstützung des Landes Oberösterreich
Die Arbeit an diesem Buch wurde durch das Wiener Autorenstipendium und das österreichische Staatsstipendium für Literatur gefördert. Die Autorin bedankt sich bei den zuständigen Stellen der Kulturabteilung der Stadt Wien und des BMUK, Wien.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4291-2
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1583-1
Inhalt
54 Der Spiegel
53 Der Markt
52 Ein Leben mit Eduard
51 Die Zukunft lesen
50 Das Universum
49 Rückwärts
48 Der Berater
47 Die Zärtlichkeit der Bärenmädchen
46 Die Hochzeit
45 Von vorn
44 Wer müde ist, hat kleine Augen
43 Das Schöne
42 Die Letzte macht das Licht aus
41 Apfelschlangen
40 Zwischen den Bäumen
39 Blumengewitter
38 Funkenschläge
37 Und jetzt
36 Raben oder Krähen
35 Dann und wann
34 Geisterbahn
33 Unter dem Schirm
32 Achtung
31 Ein Haustier
30 Brachland
29 Manchmal
28 Als ob
27 Ein Geschenk
26 Nachtbilder
25 Hinter den Bergen
24 Es ist
23 Auf Wiedersehen
22 Ein Mittwoch
21 Am See
20 Wann kommt der Regen
19 Blumen nicht vergessen
18 Das blühende Leben
17 Einsargen
16 Weltspartag
15 Unter Samthandschuhen
14 Barfuß im Regen
13 Unter Nachbarn
12 Auf der Bühne
11 Der Heilige Abend
10 Der gefallene König
9 Kronkorkenaugen
8 Alles wird leer
7 Ein Leben
6 Zuckerwatte
5 Flecken
4 Das himmlische Kind
3 Testbild
2 Wer auf Schnecken tritt, hat klebrige Füße
1 Ich bin
Material
WENN er die Tür öffnet, werde ich sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich werde sagen, mein Name ist Maria Beerenberger, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich, wird er sagen und mir einen Platz anbieten. Ich werde gewusst haben, welche Kleidung ich anziehe. Ich werde mir überlegt haben, wie ich persönlich bin. Er wird eine Krawatte tragen und eine silberne Armbanduhr. Er wird sagen, Frau Beerenberger, erzählen Sie. Gern, werde ich sagen, gern. Ich kenne mich mit der Materie aus. Zumindest habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Jetzt müssen wir warten. Wovon sprechen Sie, wird er fragen, Frau Beerenberger, was erzählen Sie da. Nun, werde ich sagen, ich sitze Ihnen gegenüber, weil ich die Sätze der Menschen kenne, die im Leben stehen, weil ich eine von ihnen sein werde. Ich habe zu wenig an mich geglaubt, wissen Sie, ich habe zu wenig an meine Zukunft geglaubt. Warum, wird er fragen, bitte, erzählen Sie. Dann wird er schweigen, sich in den Sessel zurückfallen lassen. Gut, werde ich sagen, wenn Sie möchten. Der Tag vergeht, das Licht verbrennt, sagte meine Nachbarin. Fangen wir von hinten an.
54 Der Spiegel
Die Küchenuhr hängt links über dem Herd zwischen den Küchenkästen, der Zeiger gleitet die Zahlen entlang. Acht Uhr fünfundfünfzig, liest Maria, als sie an diesem Dienstagmorgen der Uhr gegenüber am Küchentisch sitzt. Maria trägt den hellblauen Frotteebademantel, den sie jeden Morgen trägt, außer im Sommer, wenn sie im Nachthemd frühstückt, weil es im Bademantel zu warm wäre, selbst an kalten Sommertagen. Am rechten Ellbogen ist der Stoff abgewetzt, auf die rechte Hand stützt Maria ihren Kopf, wenn sie nach dem Frühstücken Zeitung liest oder in die Luft schaut, Kaffee trinkt, frischem Kaffee beim Dampfen zusieht. Kaffee trinkt Maria mit Milch und ohne Zucker. Es ist einfacher, Kaffee ohne Milch zu trinken, sagte Herr Willert, wenn Maria in der Kaffeeküche Milch in ihre Tasse schüttete und beim Umrühren darauf achtete, ob die Milch zu Flocken wurde. Man braucht dann keine Milch zu kaufen, sagte er und verrührte die Milch langsam in seinem Kaffee, bevor er mit dem Daumen gegen den Süßstoffspender drückte und zwei Stück Süßstoff in die Tasse fielen. Maria denkt an Herrn Willert an diesem Dienstagmorgen in der Küche und trinkt einen kleinen Schluck, weil nicht mehr viel Kaffee in der Tasse ist und sie nicht möchte, dass die Tasse leer wird, dass sie aufstehen, dass sie neuen Kaffee holen muss, der immer drei Schlucke zu viel ist. Drei Schlucke, die Maria trotzdem trinkt, weil sie nicht möchte, dass etwas übrig bleibt.
Das Fenster ist nicht weit vom Tisch entfernt, durch das Fenster sieht Maria in den Innenhof, der groß ist. Größer als ein Fußballfeld, sagte Walter und streckte dazu die Arme zur Seite. Im vorderen Teil haben wir unseren Gemüsegarten, im hinteren Teil spielen die Kinder; wir haben keine Kinder, wissen Sie das nicht. Die Sandkästen müssen abends abgedeckt werden, wegen der Katzen, die Fichte ist höher geworden, die Fichte hat das ganze Licht genommen und lässt es auch im Winter nicht durch.
Unter ihrem Frotteebademantel trägt Maria ein Baumwollnachthemd. Baumwolle lässt die Haut gut atmen, etwas anderes würde Maria in der Nacht nicht tragen. An diesem Dienstagmorgen trinkt sie den letzten Schluck Kaffee, setzt die Tasse danach noch einmal an, bis ein kleiner Tropfen nachkommt. Dann geht sie ins Bad, das nur von der Küche aus zu erreichen ist, rosa Fliesen, eine Sitzbadewanne, das Waschbecken daneben. Das Badezimmer hat kein Fenster, Maria wechselt ab: Zuerst das Gesicht waschen, dann den Bademantel ausziehen. Sich kämmen, beim Scheitel die Haare auseinanderziehen, sich ärgern, dass sie schon wieder gefärbt werden müssen, das Nachthemd ausziehen, die Zähne putzen, die Unterhose ausziehen, das Gesicht eincremen, die Hausschuhe ausziehen, die Augen schminken, die Unterhose anziehen. Für weitere Kleidungsstücke fehlen die Zwischenschritte, und Maria zieht sich ohne Unterbrechung an. Machen Sie konsequent, systematisch, parallel, schnell und viel. Maria zieht an diesem Dienstagmorgen weiße Socken, weiße Unterwäsche, eine hellblaue Bluse und eine weiße Hose an.
Der Spiegel hängt links neben der Eingangstür, rechts wäre kein Platz dafür. Rechts ist die Wand mit einem Schrank verbaut, darin die Jacken, die Taschen, die Wintermäntel. Der Schrank schließt bis oben hin zur Decke ab. Stauraum, sagten Maria und Walter, als sie den Schrank aussuchten, Stauraum ist wichtig. Darin hat alles seinen Platz, sagte der Verkäufer, und Maria schaute auf sein Hemd, der zweite Knopf von oben hatte sich geöffnet, oder war er schon die ganze Zeit über offen gestanden, und nickte. So kann man doch nicht verkaufen, sagte Maria später im Auto, als sie mit Walter nach Hause fuhr. Da hat sich einer zum Linksabbiegen rechts eingereiht, antwortete Walter. Beim Verkaufen muss man auf sein Auftreten achten, sagte Maria. Wie lange es noch dauern wird, bis er begriffen hat, dass er auf der falschen Seite steht, antwortete Walter und hupte. So kann man doch nicht verkaufen, sagte Maria. Doch, antwortete Walter, also doch.
Der Rahmen des Spiegels ist golden, wie die Schlüssel, die in den Schranktüren stecken, nur dass bei den Schlüsseln das Gold an einigen Stellen abgegriffen ist. Maria schaut in den Spiegel, sie lächelt und ärgert sich über die Falten, die dabei entstehen, sie beschließt, nicht mehr zu lächeln, sie zieht die Bluse an den Oberarmen ein Stück hinunter. Kundinnen mit schlaffen Oberarmen ist von ärmelfreien Oberteilen abzuraten, sagte Herr Willert, die Kundinnen dürfen dabei nicht auf ihre Oberarme angesprochen werden. Drücken Sie Begeisterung aus, wenn Ihnen etwas an der Kundin gefällt. Weisen Sie auf andere Kleidungsstücke hin, sollte eines nicht geeignet sein. Sollte Ihnen an der Kundin etwas nicht gefallen, was der Kundin gefällt, schweigen Sie. Maria sieht im Spiegel ihre Augen, die an Vormittagen trüber sind als an Nachmittagen. Mit schwarzem Augenkonturenstift hat Maria sie umrandet, ihre grünen Augen, die nach dem Aufstehen eine Weile brauchen, bis sie klar werden, die Wimpern getuscht. Mit dem Zeigefinger wischt sie unter dem linken Auge eine Wimper weg, sie fährt mit der Hand durch ihre Haare, sie richtet sich auf.
Der Rahmen des Spiegels ist breit, er bietet genügend Platz für die Zettel. Maria befestigt sie mit Klebebandstreifen, die sie zuvor gegen ihren Handrücken drückt, damit sie nicht so stark haften und die Goldfarbe ablösen. Die Sätze sind in Großbuchstaben geschrieben, sonst müsste Maria zu nahe an den Spiegel heran, wenn sie lesen möchte, was auf den Zetteln steht. An diesem Novemberdienstagmorgen betrachtet sich Maria kurzärmelig vor dem Spiegel und bemerkt, dass sich auf ihren Unterarmen die Haare aufstellen. So nicht, sagt sie und geht hinüber ins Schlafzimmer, um eine Strickjacke zu holen. Weiß passt zu Blau und Blau nicht zu Schwarz. Achten Sie auf die Farben, sagte Herr Willert. Herr Willert trug Grau und manchmal auch Dunkelblau; gedeckte Farben, wie er sagte, Männer und Frauen wirken in gedeckten Farben seriös, Frauen auch in Pastell. Im Schlafzimmer streift Maria mit der Hand über das Leintuch, schüttelt den Polster auf, legt die Bettdecke gerade hin. Auf Walters Seite zieht sie an den Enden der Decke, damit die Falten verschwinden. Auf Walters Seite wird die Bettwäsche nur alle vier Wochen gewechselt, auf Marias Seite alle zwei. In geraden Monaten holt Maria die grünen Überzüge aus dem Schrank hervor, in ungeraden die gelben. Weil bei Walter nur alle vier Wochen gewechselt wird, bleibt immer eine Reservegarnitur, für Notfälle und für Gäste, würde Maria sagen, würde sie mit jemandem über ihre Bettwäsche sprechen. An diesem Dienstagmorgen nimmt sie eine weiße Strickweste aus dem Kleiderschrank und versperrt ihn, nachdem sie ihn geschlossen hat. Den Schlüssel lässt sie stecken, sie zieht ihn niemals ab.
Vom Schlafzimmer zum Spiegel sind es wenige Schritte, auf der Vorzimmerkommode liegen die Briefe, ungeöffnet, gesammelt von Dienstag bis Freitag, Montag ist keine Post gekommen. Der Tierschutzverein hat geschrieben, der Mobilfunkanbieter, der Vorteilsclub, das Arbeitsmarktservice, der Verein zur Hilfe für an Lepra erkrankte Kinder in Ostindien, eine Boutique, bei der sich Maria beworben hat. Maria hat die Briefe nach Themen geordnet: Tiere, Rechnungen, Werbungen, Möglichkeiten, Pflichten. Sie zerreißt die Rechnungen und versteckt den Brief vom Arbeitsmarktservice in der ersten Schublade unter dem Telefonbuch. Danach beißt sie auf ihre Unterlippe, atmet tief ein und aus. Sie geht hinüber zum Spiegel und setzt ein Lächeln auf. Sie liest von links nach rechts: Ich kenne mich mit der Materie aus. Ich habe ein schönes Foto, auf dem du Tauben fütterst. Zumindest habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Als es klingelt, erschrickt sie, sie dreht sich zur Seite und greift zum Telefon, das auf der Vorzimmerkommode zwischen den Briefen liegt, sie hält es zum Ohr, sagt: Beerenberger. Eine Frau ist am anderen Ende der Leitung, sie nennt ihren Namen, den Maria gleich wieder vergessen haben wird, sie sagt: Ich rufe im Auftrag Ihrer Bankfiliale an. Es ist uns wichtig, mit unseren Kunden guten Kontakt zu halten, deshalb möchte ich Sie fragen, wie Sie mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind, Frau Beerenberger. Ich bin zufrieden, sagt Maria, es fehlt mir an nichts, bitte entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt. Darf ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt anrufen, fragt die Frau, Ihre Meinung ist uns wichtig, Frau Beerenberger. Und darf ich Sie noch kurz fragen, ob sich Ihre Adresse geändert hat. Maria wartet, bis die Anruferin eine Pause macht. Dann legt sie auf. Es hat sich ohnehin nichts geändert, denkt sie. Sollte sie noch einmal anrufen, werde ich nicht abheben, und sollte ich versehentlich abheben, werde ich sagen: Entschuldigen Sie, der Empfang war weg, ich lebe in einem Funkloch. Vor fünfundzwanzig Jahren ist Maria mit Walter in die Wohnung gezogen. Eine Genossenschaftswohnung, Halbparterre, mit Blick in den Hof und Blick auf die Straße. Walters Mutter sagte: Wir haben genug Platz, bleibt doch.
Jetzt aber, sagt Maria und stellt sich aufrecht vor den Spiegel, sie zieht die Schulterblätter zurück und beginnt von vorn: Ich kenne mich mit der Materie aus. Ich habe ein schönes Foto, auf dem du Tauben fütterst. Zumindest habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist nicht lustig. Jetzt müssen wir warten. Sie haben sich da falsch verhalten. Das wollen wir doch stark hoffen. Nein, die haben Geld über Geld. Es ist alles in Ordnung, gehen Sie weiter. Mein Herz, dich versteht niemand. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende, auch Ihren Tieren. Nach dem letzten Satz schließt Maria die Augen, sie beginnt aufs Neue, spricht lauter, beim dritten Satz stoppt sie und öffnet ein Auge. Genau, sagt sie, ich weiß es doch, und schließt es wieder. Beim zweiten Versuch braucht Maria die Augen nicht mehr zu öffnen. Gut, sagt sie und geht zur Kommode, nimmt den Brieföffner aus der Lade. Den Brieföffner hat Maria von ihren Eltern zur Lehrabschlussprüfung bekommen. Jetzt stehst du auf eigenen Beinen, sagte ihr Vater, und Maria lachte und sagte, einen Brief kann ich auch mit den Fingern öffnen. Ihr Vater schüttelte den Kopf, du musst noch viel lernen, sagte er und setzte sich auf seinen Platz, wo er seit seiner Pensionierung immer saß, auf dem Platz in der Küche mit Blick auf das Fenster. Maria setzt die Klinge am Rand des Kuverts an. Wer Arbeit möchte, der findet welche, sagte ihr Vater, wenn er über den arbeitslosen Nachbarn sprach. Was ist das für ein Mensch, sagte er. Hubert, sagte Marias Mutter, sprich leise, das Fenster ist offen. Wie lange ist er schon arbeitslos, sagte Marias Vater, und die Mutter schloss das Fenster. Denk an deinen Schwager, sagte sie, die Vorhänge ließ sie offen.
Maria fährt mit dem Zeigefinger in das offene Kuvert, betastet das Papier. Weil ich vermute, dass Einladungen zu Vorstellungsgesprächen auf qualitativ hochwertiges Papier gedruckt sind, würde Maria sagen, um ihr Verhalten zu erklären, und dann: Ich erkenne bei diesem Brief die Papierqualität leider nicht ausreichend, es ist herkömmliches Papier, aber kein billiges. Maria lässt den Finger im Briefkuvert, sie blickt in den Spiegel. Notstandshilfe, so weit ist es also mit dir gekommen, würde ihr Vater sagen. Ja, würde Maria antworten, sie würde ihm nicht erzählen, dass ihr das Geld gestrichen wurde. Aber warte ab, bis ich den Brief geöffnet habe. Ich denke positiv, das Leben ist eine Herausforderung. Man muss nur stark genug wollen, dann wird alles gut. Maria nimmt den Finger aus dem Kuvert, sie legt den Brief zur Seite, sie sagt: Ich möchte noch ein wenig an meiner Visualisierung arbeiten, und geht hinüber in die Küche.
53 Der Markt
Die Stille der fehlenden Blätter ist unerträglich, finden Sie nicht, denkt Maria, als sie unter den kahlen Platanen zum Marktplatz geht. Im November sitzt es sich schlecht auf der Bank, auch wenn sie aus Holz ist und nicht aus Metall. Marias Bank steht gegenüber der Kirche, etwas abseits, aber dennoch so, dass genügend Menschen vorüberkommen. Kevin du Hurrenkind hat jemand über Nacht auf die Lehne geschrieben, und Maria setzt sich neben den Schriftzug, weil sie befürchtet, die Farbe könnte noch nicht trocken sein. Der Platz um die Kirche ist gesäumt von Lokalen, an Freitagen verkaufen die Marktfahrer hier ihre Waren. Nicht alle kommen im Winter, aber der Mann mit den Fischen ist immer da, auch die Frau mit dem Schweinefleisch, über deren Vitrine Fotos hängen: liegende Schweine im Stall, stehende Schweine im Stall, manchmal mit einer Katze dazwischen, einmal auch ein Knäuel Katzenkinder. Maria nickt, wenn sie an der Frau mit den Schweinen und dem Mann mit den Fischen vorübergeht, auch den anderen Verkäufern nickt sie zu, wenn diese in ihre Richtung schauen. Maria kauft nichts, sie probiert nicht, wenn ihr Ware angeboten wird. Wer probiert, hat verloren, würde sie sagen, würde sie jemand fragen, warum. Es ist wie mit den schönen Pullovern, wer einmal hineinschlüpft, kommt nicht mehr heraus. Am liebsten unterhält sich Maria mit dem Fischverkäufer, er ist ein junger Mann, dessen Hände im Winter gerötet sind. Du wirst dir noch etwas abfrieren, sagt Maria zu ihm an besonders kalten Tagen. Ich friere mich wach, sagt der Fischverkäufer dann, und du, was machst du hier immer. Schauen, sagt Maria, ich schaue nur, der Winter tut den Fischen gut, sie bleiben frisch, nicht wahr. Unsere Fische sind immer frisch, sagt der Fischverkäufer, wir achten auf unsere Ware. An diesem Novemberdonnerstag ist der Platz vor der Kirche leer, die Tauben sitzen auf dem Boden vor dem Vogelhaus, sie picken auf, was die Meisen fallen gelassen haben. Würde Maria mit dem Fuß auf das Pflaster stampfen, würden die Tauben davonfliegen, aber Maria bewegt ihre Füße nicht. Sie sitzt und wartet, bis sie nach Hause gehen kann.
Nach Hause sind es fünfundzwanzig Minuten. Manchmal braucht Maria länger für die Strecke, wenn sie Bekannte trifft und stehen bleiben oder die Straßenseite wechseln muss. An kalten Tagen zieht sie den Schal über ihren Kopf, damit sie weniger leicht zu erkennen ist. Der Platz mit der Kirche liegt in einem anderen Stadtteil als Marias Wohnung, hier trifft sie niemanden, außer die Marktfahrer, die ihre Geschichte nicht kennen, außer die Tauben, die schlecht auseinanderzuhalten sind. An diesem Novemberdonnerstag hat Maria unweit ihrer Wohnung Sybille getroffen, die sie vor einigen Jahren fast jeden Tag sah, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Im Vorübergehen schaute Maria durch das Schaufenster in Sybilles Frisiersalon, und sie winkte, wenn Sybille in ihre Richtung blickte, an Sommertagen stand die Tür offen. Alle zwei Monate saß sie bei Sybille, Farbe und Schnitt, fragte Sybille dann, immer um den Fünfzehnten eines ungeraden Monats. In Sybilles Frisiersalon gab es eine Treppe, im Erdgeschoß wurden den Männern, oben im Hinterzimmer den Frauen die Haare gemacht. Maria trank Kaffee, während sie darauf wartete, dass die Farbe einwirkte, ab und zu kam Sybille vorbei, schaute auf Marias Kopf, sagte, ein bisschen noch, soll ich Ihnen etwas zu lesen bringen. Wenn Sybille sich danach wieder einer anderen Kundin widmete, kratzte Maria heimlich mit dem Zeigefinger auf der Kopfhaut, die von der Farbe juckte. Den Finger wischte sie in dem schwarzen Handtuch ab, das in den Kragen ihres Mantels gesteckt war, und vor dem letzten Schluck Kaffee aß Maria die Praline, die neben dem Löffel auf der Untertasse lag. Aus dem Erdgeschoß hörte sie dabei Männerstimmen, aber nur manchmal, wenn Kunden im Frisiersalon waren und wenn sie sprachen.
Maria, sagte Sybille, als die beiden einander an diesem Novemberdonnerstag auf der Straße trafen, und winkte. Maria, wie geht es Ihnen. Maria blickte von ihrer Handtasche auf, klemmte sie unter ihren Arm. Gut, sagte sie, ich kann mich nicht beschweren. Ich suche mein Mobiltelefon, wissen Sie, in diesen großen Taschen findet man nichts, diese großen Taschen schlucken alles, kein Wunder, wenn etwas verschwindet. Arbeiten Sie denn heute nicht, haben Sie Urlaub, fragte Sybille. Maria machte den Reißverschluss ihrer Tasche zu, langsam, damit er nicht heraus springen würde. Nein, es war an der Zeit, sich neu zu orientieren. Sie wissen ja, das Leben läuft dahin.
Sybilles Frisiersalon hieß Frisiersalon Sybille, das Schild hängt immer noch über der Eingangstür, blaue Schnörkelschrift auf weißem Grund. Sybille kommt nur noch selten in die Straße, sie wohnt in einem anderen Stadtteil, wo die Häuser weiter auseinander stehen und die Straßen breiter sind. Sybille, was machen Sie hier, hätte Maria fragen können, aber Maria wollte weiter. Entschuldigen Sie, ich muss mich beeilen, ich habe wenig Zeit, sagte sie, als Sybille erwartungsvoll lächelte, nachdem Maria erzählt hatte, es sei an der Zeit, sich neu zu orientieren. Sybille hatte ihr Erzählen-Sie-doch-Lächeln aufgesetzt, aber Maria wollte nicht erzählen.
War ich unfreundlich, denkt Maria, als sie auf der Parkbank vor der Kirche ihren Schal vom Hals nimmt und ihn neu wickelt, sodass er besser liegt und die Kälte abhält. Der Schal ist aus Wolle, gemischt mit Angora. Den dürfen Sie nicht in der Maschine waschen, sonst wird er kaputt, hätte Maria zu Kundinnen gesagt, passen Sie gut auf darauf, dann begleitet Sie das Stück ein Leben lang. Wenn ich ihn nicht verliere, antwortete eine Kundin einmal, und Maria schaute kurz böse, dann lächelte sie. Bestimmt nicht, sagte sie, so einen Schal verliert man nicht.
Vor der Kirche steht ein Mann, er steckt sein Mobiltelefon in die Manteltasche, dann öffnet er die schwere Holztür, deren Griff so hoch angebracht ist, dass Kinder ihn nicht erreichen. Maria erschrickt, sie schaut zur Seite, sie möchte ihr Gesicht verbergen, aber sie weiß nicht, wohin damit. Weil das Gesicht das Haupterkennungsmerkmal eines Menschen ist, würde sie sagen, würde sie jemand fragen, warum. Aber Maria kann ihr Gesicht nicht verbergen, sie muss den Mann ansehen. Worauf wartet er, denkt sie, und dann: Nein, er ist es nicht. Was ich gesagt hätte, wenn er es gewesen wäre. Wenn er gefragt hätte, Frau Beerenberger, warum kommen Sie nicht mehr zu uns. Haben Sie Arbeit gefunden, Sie wissen, dass Sie sich melden müssen, Sie wissen, dass Ihre Bezüge eingestellt werden, wenn Sie unentschuldigt Ihren Kontrolltermin versäumen. Frau Beerenberger, hier, ich gebe Ihnen einen Termin, bitte kommen Sie nächste Woche. Nein, das würde er nicht sagen, denkt Maria und schlägt die Beine übereinander. Was ist los mit Ihnen, warum kommen Sie nicht mehr. Nein, das würde er nicht fragen. Es ist ihm egal, ob ich komme oder nicht. Er würde mich nicht erkennen, er wüsste meinen Namen nicht. Eine weniger, würde er vielleicht denken, eine weniger, die uns auf der Tasche liegt.
Maria schaut auf die Uhr. Fünfzehn Minuten noch, denkt sie und schiebt den Ärmel wieder über das Handgelenk. Man muss den Ansturm erwarten können, sagte Herr Willert. Es ist wie mit dem Wetter: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Falsch gekleidet ist jedes Wetter schlecht. Er sagte: Was wollte ich Ihnen eben erklären – richtig, man muss den Ansturm erwarten können. Wenn man vor einem Sturm, wenn man vor einem Unwetter eine regenbeständige Windjacke aus Goretex übergezogen hat, kann es noch so blasen und schütten, es wird einem nichts geschehen. Atmen Sie durch, richten Sie Ihre Haare, trinken Sie einen Schluck Wasser, aber alles erst, wenn die Stücke an ihrem Platz sind, gerade liegen, Ecke auf Ecke, ordentlich. Dann sind Sie für den Ansturm gewappnet. Der Sturm kam aus der anderen Richtung, denkt Maria jetzt, als sie auf der Parkbank sitzt und den Tauben zusieht. Der Sturm kam aus der anderen Richtung, und er, er wusste es. Maria steckt die Hände in die Manteltaschen, in der linken findet sie ein Taschentuch, das sie in ihrer Hand knetet. Maria verwendet Taschentücher mehrmals, so lange, bis sie löchrig werden. Sie faltet sie nach dem Schnäuzen an ihren Enden zusammen, zuvor schaut sie kurz in die Mitte, aber das schnell und unauffällig. Maria mag Taschentücher mit Mentholgeruch, auch wenn sie ihren Geruch verlieren, wenn sie eine Weile im Mantel getragen werden. Als eine alte Frau mit ihrem Boxer vorbeigeht, nimmt Maria die Hände aus den Taschen und schaut weiter geradeaus. Maria und die alte Frau grüßen einander nicht, obwohl die Frau jeden Tag vor Maria stehend wartet, während der Hund gegen das Vogelhaus neben der Bank uriniert. Im Winter trägt die Frau einen braunen Pelzmantel, der den gleichen Farbton hat wie das Fell des Hundes. Die Schultern der Frau sind breit, ihr Gesicht ist zart. Erwin, sagt die Frau, wenn sie vor Maria steht, beeil dich. Erwin schnüffelt dann am Pfosten des Vogelhauses, dreht sich zwei Mal im Kreis, geht vor, geht zurück, hebt sein Bein, dreht sich einmal im Kreis, stoppt an derselben Stelle wie zuvor, hebt sein Bein erneut und markiert gegen den Pfosten. Wenn Erwin zurückkommt, gehen die beiden weiter. Maria schaut auf den Boden vor dem Vogelhaus und dann wieder weg.
Es ist kurz nach zwölf, als sich Maria etwas aufrechter hinsetzt, ein Mobiltelefon an ihr Ohr hält und beschäftigt wirkt. Sie sieht sie kommen, die Männer in ihren schwarzen und dunkelblauen Anzügen, dann und wann eine Frau unter ihnen. Sie kommen in Gruppen, in Linien, einige lachen, einige schauen böse, manche gehen abseits und telefonieren. Alle gehen sie schnell, Maria muss sich konzentrieren, um erfolgreich zu sein, sie schaut auf den Asphalt vor sich, als sich die erste Gruppe nähert, der Asphalt ist gefleckt von Kaugummiresten. Maria nickt, sie sagt laut, es ist alles in Ordnung, sie klemmt das Mobiltelefon zwischen Schulter und Kopf und holt einen Kalender aus ihrer Handtasche. Während Maria wartet, kehren die Frau und Erwin zurück. Ausnahmsweise, sagt die Frau und lässt Erwin ein zweites Mal zum Vogelhaus. Maria ärgert sich, und während sie sich ärgert, zieht die erste Gruppe vorbei in Richtung Italiener am Eck, nur ein junger Mann wird kurz langsam, bleibt bei der Frau im Pelzmantel stehen. Frau Huber, wie geht es Ihnen, fragt er, wie geht es Erwin und Rambo. Die Frau sieht den jungen Mann im Anzug lange an, dann antwortet sie, gut, es geht uns gut, Rambo schläft zu Hause auf der Fensterbank, wie geht es Ihren Tieren. Die Tiere sind wohlauf, sagt der Mann, ich bin in Eile, meine Kollegen warten auf mich, aber läuten Sie doch wieder einmal bei uns, wir würden uns freuen. Gern, sagt die Frau. Fein, sagt der Mann. Maria rückt näher an die beiden heran, sie möchte sicher sein, dass sie alles richtig versteht. Dann läute ich nächstes Wochenende bei Ihnen, wenn Sie zu Hause sind, sagt die Frau, ich bringe Apfelstrudel und Teegebäck. Auf Wiedersehen, sagt der Mann und dreht sich zur Seite, auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende, auch Ihren Tieren.
Maria lächelt, als der Mann an ihr vorübergeht, aber der Mann sieht sie nicht. In einem Jogginganzug kann niemand seriös wirken, nicht einmal der wichtigste Mann der Welt, sagte Herr Willert, ein seriöser Mann trägt Anzug. Dunkelblau, Polyester und Viskose, denkt Maria, während sie dem Mann nachsieht. Maria hat gesehen, dass die Bügelfalte der Anzughose zweimal beginnt und weiter unten in einem Bügelstrich zusammenläuft. Mischgewebe, denkt sie, die Hose sitzt nicht gut. Mittagsangebot steht auf dem Schild vor dem Italiener, Pizza Diavolo oder Lasagne al forno. Maria tippt in ihr Mobiltelefon: Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende, auch Ihren Tieren. Danach drückt sie auf Senden. Sie freut sich kurz, als das Nachrichtensymbol auf dem Bildschirm aufleuchtet. Sie liest ihre Telefonnummer, darunter den Satz des Mannes. Besser als nichts, denkt sie und steht auf. Zu Hause wird sie einen Stift nehmen, in Großbuchstaben schreiben: Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende, auch Ihren Tieren. Sie wird den Satz an den Spiegel kleben, die Augen schließen. In der Wohnung wird es warm sein, außer im Schlafzimmer, dort ist es immer kalt.
52 Ein Leben mit Eduard
Wie es sein könnte: Ich könnte jeden Morgen aufwachen, ein Mann namens Eduard neben mir. Edi würde ich ihn nennen, und wenn ich mich auf die Seite rollen würde, um danach rückenschonend aufzustehen, würde Edi schon in der Küche sein. Er könnte einen braunen Frotteebademantel tragen, dunkelbraun mit schwarzem Emblem auf der Brust. Die Fichte wäre gefällt, und die Sonne würde in die Küche scheinen. Ich würde Eduard hören, wie er in der Küche Brot schneidet, wie er den Tisch deckt, ich würde den Kaffee riechen und die Beine aus dem Bett strecken, mich rückenschonend mit den Armen aufstützen, die Bauchmuskeln und den Beckenboden anspannen, den Oberkörper aufrichten, gerade sitzen. Ich hätte keine Schwierigkeiten, ich wäre schmerzfrei. Schmerzfrei zu sein würde bedeuten, Bewegungen auszuführen, ohne daran denken zu müssen, wie. Frau Bauer würde nicht mehr vor der Wohnungstür stehen und sagen: Ich habe gehört, dass Sie die Schuhe binden. Wissen Sie, Sie jammern, dass man Sie bis vor die Wohnung hört. Sie jammern, wenn Sie sich bücken, Sie jammern, wenn Sie sich danach wieder aufrichten, wird es denn nicht besser mit Ihrem Rücken, das kommt vom vielen Heben, ich kenne das.
Ich würde aufrecht in die Küche gehen, mich strecken, ich würde lächeln und Eduard einen guten Morgen wünschen. Wir würden uns setzen, Marmeladebrote essen, zuerst Butter auf die Brote streichen, dann Marmelade, das Brot wäre schon geschnitten, gerade Schnitten, fingerdick. Ich müsste nicht sprechen, weil Eduard akzeptieren würde, dass ich an Vormittagen nicht gerne spreche, wir würden Zeitung lesen, die Butter wäre immer frisch, und Eduard würde sagen, deine Tasse ist leer, Liebes, möchtest du noch Kaffee, wir teilen ihn.
51 Die Zukunft lesen
Wenn die Wolken schnell vorüberziehen, scheint die Sonne und manchmal nicht. Maria bückt sich, um den Himmel zu sehen. Von der Wohnung im Halbparterre ist das nur möglich, wenn sie in die Knie geht. Maria versucht in die Knie zu gehen und sich dabei gerade zu halten, aber sie denkt nicht immer daran. Wechselhaft, denkt Maria, als sie an diesem Septembersamstag in den Himmel schaut, es ist heute wechselhaft. Wechselhaftes Wetter bedeutet, von allem ein bisschen, vor allem aber Wind, der die Blätter verweht, die Nadeln der Fichte bleiben. Ein bisschen Grün muss auch im Winter sein, sagte der Hausmeister, wenn er über den Stamm der Fichte strich. Wissen Sie, Frau Beerenberger, eine Fichte verliert ihre Nadeln nicht, sechs bis dreizehn Jahre hält sie der Baum, nur wenn er gestresst ist, lässt er sie früher fallen. Was stresst Bäume, fragte Maria und öffnete den Deckel der Mülltonne im Hof. Schlechte Umwelteinflüsse, sagte der Hausmeister, als Maria den Müll fallen ließ. Maria fragte: Was haben Sie gesagt, Herr Popovic, ich habe Sie nicht verstanden. Die Umwelt, sagte der Hausmeister und: War da etwa Papier dabei.
Die Fichte wuchs und der Hausmeister musste gehen, eine Firma erledigt seither seine Arbeit. In die Hausmeisterwohnung zog ein junges Paar, das nicht lange blieb, weil in die Hausmeisterwohnung noch weniger Licht fällt als in Marias Wohnung, weil die Hausmeisterwohnung im Erdgeschoß liegt. Nach dem jungen Paar lebte ein alleinstehender Mann in der Wohnung, er wurde beobachtet, wie er Kupfernägel in die Fichte schlagen wollte. Kupfernägel in die Fichte zu schlagen, sind Sie verrückt, was hat Ihnen der Baum getan, sagte Herr Schneiderhahn, der ein guter Freund des Hausmeisters gewesen war, Bäume töten, wo kommen wir hin. Frau Schneiderhahn schüttelte den Kopf, wenn der alleinstehende Mann an ihr vorüberging, sie schüttelte den Kopf und grüßte ihn nicht. Wissen Sie, wie ein Baum an einem Nagel stirbt, sagte sie zu Maria, als sie zufällig nebeneinander bei den Postkästen standen und der Mann aus seiner Wohnung kam. Qualvoll stirbt er, ganz qualvoll. Frau Schneiderhahn hat leicht reden, dachte Maria, sie wohnt ganz oben, dort, wo der Baum keinen Schatten mehr wirft. Maria nickte, der alleinstehende Mann ging vorüber und grüßte leise, sein Grüßen wurde nicht erwidert. Der alleinstehende Mann kündigte nach Ablauf der Mindestmietdauer, und das neue junge Paar, das nach ihm einzog, kündigte nach Ablauf der Mindestmietdauer, zuerst zog die Frau aus, dann der Mann. Eine Yuccapalme ließen sie auf dem Fensterbrett zurück. Sie verlor zuerst die unteren Blätter, die Blätter wurden gelb, dann braun, und Milica riss sie aus, sodass der Stamm der Yuccapalme länger wurde. Ich habe es versucht, sollte Milica später sagen, nachdem sie die Palme zwei Monate gegossen hatte und die Blattläuse gekommen waren. Die Yuccapalme fand unter der Fichte im Innenhof einen Platz. Damit die Sonne die Blätter nicht verbrennt, sagte Milica und ließ die Palme verdursten.