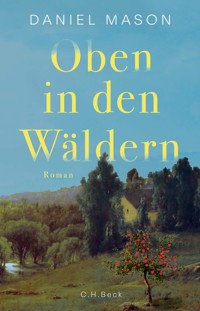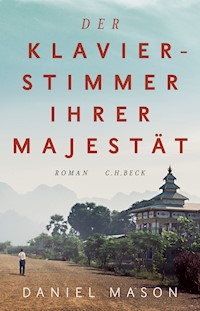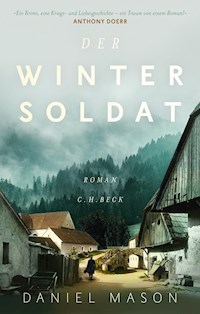
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Dieser Roman überzeugt mit jedem Satz."
Pulitzer-Preisträger Anthony Doerr
Der hochbegabte Wiener Medizinstudent Lucius meldet sich beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges freiwillig und landet im eisigen Winter 1914 in einem Behelfslazarett in den Karpaten, wo ihm die junge Nonne Margarete erst alles beibringen muss. Als ein schwer traumatisierter, aber äußerlich unverletzter Soldat eingeliefert wird, begeht Lucius einen gravierenden Fehler. Daniel Masons aufwühlender Roman erzählt eine Geschichte von Krieg und Heilung, von unverhoffter Liebe, von verhängnisvollen Irrtümern und von Sehnsucht und Sühne.
Lucius ist zweiundzwanzig Jahre alt und ein hochbegabter Medizinstudent in Wien, als der Erste Weltkrieg ausbricht. In der Vorstellung, an ein gut ausgestattetes Lazarett zu kommen, meldet er sich freiwillig. Tatsächlich landet er im eisigen Winter 1914 in einem abgelegenen Dorf in den Karpaten, in einer zum Behelfshospital umfunktionierten Kirche. Allein mit einer rätselhaften, jungen Nonne namens Margarete, muss er die schwer Verletzten versorgen, er, der noch nie ein Skalpell geführt hat. Margarete bringt ihm alles bei und als sie sich verlieben, auch das. Aber wer ist sie wirklich?
Eines Tages bringt man ihnen einen bewusstlosen Soldaten, der äußerlich keine Verletzungen aufweist, aber so traumatisiert ist, dass er zu sterben droht. Ein bislang unbekanntes Krankheitsbild, Folge des ununterbrochenen Granatenbeschusses. Lucius entdeckt eine Heilungsmethode, auf die der Soldat anspricht. Aber als ein Aushebungskommando kommt und den Mann wieder an die Front schicken will, trifft Lucius gegen den Rat von Margarete eine folgenschwere Entscheidung. Daniel Masons großartig geschriebener, aufwühlender Roman erzählt eine Geschichte von Krieg und Heilung, von Liebe gegen alle Wahrscheinlichkeit, von verhängnisvollen Fehlern und von Sehnsucht und Sühne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Daniel Mason
DER WINTERSOLDAT
Roman
Aus dem Englischen von Sky Nonhoff und Judith Schwaab
C.H.Beck
Zum Buch
Lucius ist zweiundzwanzig Jahre alt und ein hochbegabter Medizinstudent in Wien, als der Erste Weltkrieg ausbricht. In der Vorstellung, an einem gut ausgestatteten Lazarett schnell Erfahrung sammeln zu können, meldet er sich freiwillig. Tatsächlich landet er im eisigen Winter 1914 in einem abgelegenen Dorf in den Karpaten, in einer zum Behelfshospital umfunktionierten Kirche. Allein mit einer rätselhaften, jungen Nonne namens Margarete, muss er die schwer Verletzten versorgen, er, der noch nie ein Skalpell geführt hat. Margarete bringt ihm alles bei und als sie sich verlieben, auch das. Aber wer ist sie wirklich?
Eines Tages bringt man ihnen einen bewusstlosen Soldaten, der äußerlich keine Verletzungen aufweist, aber so traumatisiert ist, dass er zu sterben droht. Ein bislang unbekanntes Krankheitsbild, Folge des ununterbrochenen Granatenbeschusses. Lucius entdeckt eine Heilungsmethode, auf die der Soldat anspricht. Aber als ein Aushebungskommando kommt und den Mann wieder an die Front schicken will, trifft Lucius gegen den Rat von Margarete eine folgenschwere Entscheidung.
Daniel Masons großartig geschriebener, aufwühlender Roman erzählt eine Geschichte von Krieg und Heilung, von Liebe gegen alle Wahrscheinlichkeit, von verhängnisvollen Fehlern und von Sehnsucht und Sühne.
Über den Autor
Daniel Mason, 1976 geboren, ist Schriftsteller und Psychiater, arbeitet als Assistenzprofessor für Psychiatrie an der Universität Stanford. Sein Debütroman «Der Klavierstimmer Ihrer Majestät» (dt. 2003) wurde in achtundzwanzig Sprachen übersetzt und auch fürs Theater und die Oper adaptiert. Eine Verfilmung ist geplant. «Der Wintersoldat» wurde ebenfalls in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Über den Übersetzer
Sky Nonhoff ist Kulturjournalist, Autor und Kolumnist beim MDR. Er hat u.a. Bücher von Dennis Lehane, Alix Ohlin, Caitlin Doughty, Daniel Magariel, Souad Mekhennet und Kent Nerburn ins Deutsche übertragen.
Über die Übersetzerin
Judith Schwaab war viele Jahre Verlagslektorin für Belletristik. Seit 2003 hat sie u.a. Romane von Chimamanda Ngozi Adichie, Anthony Doerr, Robert Goolrick, Lauren Groff, Jojo Moyes, Maurizio de Giovanni und Carol O’Connell übersetzt.
Inhalt
Motto
Karte
1 – Nordungarn Februar 1915
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DANKSAGUNG
Für Sara
Motto
Gewisse Erkrankungen nehmen einen misslichen Verlauf.
André Leri, 1918, Commotions et émotions de guerre
Karte
1
Nordungarn Februar 1915
Sie befanden sich fünf Stunden östlich von Debrecen, als der Zug auf der menschenleeren Ebene am Bahnhof hielt.
Es gab keinen Ausruf, nicht einmal ein Pfiff ertönte. Wäre da nicht das von Schnee bedeckte Schild mit dem Namen des Orts gewesen, hätte er ihre Ankunft nicht einmal bemerkt. Da er befürchtete, dass der Zug schnell weiterfahren würde, griff er hastig nach Tasche, Mantel und Säbel und drängte sich zwischen den Passagieren auf dem Gang hindurch. Er war der Einzige, der hier ausstieg. Weiter hinten luden Schaffner zwei Kisten auf den schneebedeckten Bahnsteig, klatschten in die Hände, um sich aufzuwärmen, bevor sie wieder an Bord sprangen. Dann setzten sich die Waggons rasselnd in Bewegung. Die Schöße seines Wintermantels begannen zu flattern, als die Bahn Fahrt aufnahm; Schnee wirbelte um seine Knie.
Im Bahnhofsgebäude wartete der Husar mit den Pferden auf ihn. Ihre Ohren berührten die niedrige Decke; ihre langen Gesichter hingen über einer Bank, auf der drei Bäuerinnen hockten. Sie verschränkten die gefalteten Hände über ihren Blähbäuchen wie fette Männer nach einem opulenten Mahl. Ihre Füße baumelten knapp über dem Boden. Frau, Pferd, Frau, Pferd, Frau. Der Husar blickte ihn schweigend an. In Wien hatte Lucius paradierende Regimenter mit federbuschbewehrten Helmen und farbenprächtigen Schärpen gesehen, doch dieser Mann trug lediglich einen dicken, grauen Mantel und eine zerschlissene, mehrfach geflickte Pelzmütze. Er winkte Lucius zu sich und drückte ihm die Zügel des einen Pferdes in die Hand, ehe er das andere nach draußen führte; sein Schweif fegte über die Frauen, als es unter dem Habsburger Doppeladler über der Tür nach draußen trabte.
Lucius zog an den Zügeln, doch sein Pferd rührte sich nicht vom Fleck. Mit der einen Hand – seiner gebrochenen – strich er über den Hals des Tieres, während er mit der anderen am Zaum zog. «Komm», flüsterte er, erst auf Deutsch, dann auf Polnisch, während das Pferd die Hinterhufe aus dem gefrorenen Pferdemist löste. Zu dem Husaren, der in der Tür stand, sagte er: «Sie haben lange genug gewartet.»
Mehr sagte er nicht. Draußen zog sich der Husar eine Ledermaske mit Schlitzen für Augen und Nase über das Gesicht und hievte sich auf sein Ross. Lucius folgte ihm, den Rucksack auf dem Rücken, und versuchte sich den Schal vors Gesicht zu schlingen. Die Frauen blickten zu ihnen hinaus, bis der Husar sein Pferd herumriss und die Tür zutrat. Eure Söhne werden nicht kommen, hätte er ihnen am liebsten zugerufen. Jedenfalls nicht in dem Zustand, in dem ihr sie wiedersehen möchtet. Es gab kaum einen Mann mit zwei Beinen, der dieser Tage nicht versuchte, die russische Belagerung von Przemyśl zu beenden.
Wortlos trabte der Husar Richtung Norden, den Säbel an der Seite; das lange Gewehr lag quer über seinem Sattel. Lucius sah zu den Gleisen zurück, doch der Zug war verschwunden. Frischer Schnee lag auf den Schienen.
Lucius ritt hinter ihm. Die Hufe seines Pferdes klapperten auf der gefrorenen Erde. Der Himmel war grau, und in der Ferne ragten die Berge auf. Irgendwo dort lag Lemnowice, lag das Regimentslazarett der Dritten Armee, in dem er dienen sollte.
***
Er war zweiundzwanzig Jahre alt, ruhelos und hatte eine natürliche Abneigung gegen Autorität. Voller Ungeduld sah er dem Ende seiner Ausbildung entgegen. Drei Jahre hatte er in Bibliotheken über seinen Studien zugebracht, sich mit geradezu mönchischem Ernst der Medizin gewidmet. Die Ränder seiner Bücher wimmelten von unzähligen Peküre-Papieren, dünnen Lesezeichen, die er mit der Hand eingeklebt hatte. In den großen Hörsälen hatte er auf Laternendias gesehen, was Typhus, Scharlach, Tuberkulose und Pest anrichten konnten. Er hatte sich die Symptome von Kokainismus und Hysterie eingeprägt, wusste, dass der Atem bei Blausäurevergiftungen nach Bittermandeln roch und man das Geräusch einer Aortenklappenstenose am Hals hören konnte. Mit Krawatte und frisch gebügelter Jacke hatte er stundenlang aus schwindelerregender Höhe in das Amphitheater der chirurgischen Akademie gestarrt, sich den Hals verdreht, um zwischen seinen Kommilitonen hindurchsehen zu können, über die akkurat gekämmten Köpfe der älteren Studenten, der Juniorprofessoren, der Assistenten des Chirurgen hinweg einen Blick auf das Operationstuch, die Inzision zu erhaschen. Als der Krieg ausgebrochen war, hatte er jede Nacht von dem riesigen Saal in der Universität geträumt, endlose, zermürbende Träume, in denen er unmögliche Organe, halb vom Menschen, halb vom Schwein stammend, aus Leibern operierte (sie hatten an Fleischerabfällen geübt). Eines Nachts, als er von der Exstirpation einer Gallenblase geträumt hatte, war ihm die feuchte, bleiern warme Leber so echt vorgekommen, dass er mit dem Gedanken erwacht war, eine solche Operation problemlos selbst durchführen zu können.
So groß seine Hingabe auch sein mochte, ihr Ursprung blieb ein Rätsel. Als Kind hatte er die Wachsleichen im anatomischen Museum bestaunt, aber seine Brüder hatten das genauso getan, und trotzdem hatte sich keiner der Kunst des Hippokrates zugewandt. In seiner Familie gab es keine Ärzte, weder unter den Krzelewskis Südpolens noch in der Verwandtschaft seiner Mutter. Zuweilen war er gezwungen, sich bei irgendeinem unerträglichen Empfang von einem hochnäsigen Dämchen anzuhören, dass die Medizin eine edle Berufung sei und er eines Tages für seine Güte belohnt werden würde. Doch Güte war nicht sein Motiv. Was ihn antrieb, war die Freude am Studieren selbst, jedenfalls war das seine Antwort. Religiöse Hingabe war ihm fremd, und doch fand er die Worte in der Religion: Offenbarung, Epiphanie, das Wunder Gottes in der Schöpfung und, weitergedacht, die Katastrophe, wie Gottes Geschöpfe gescheitert waren.
Am Studium selbst: Zumindest war das die Antwort, die er sich in Momenten größter Euphorie zu geben pflegte. Doch gab es noch einen anderen Grund, warum er sich der Medizin zugewandt hatte, auch wenn er sich diesen nur in Stunden des Selbstzweifels eingestand. Nämlich zwei andere Studenten, die er seine Freunde nannte, Feuermann, den Sohn eines Schneiders, und Kaminski, der, um älter zu wirken, eine Brille ohne Gläser trug und mit einem Stipendium der Barmherzigen Schwestern studierte. Auch wenn sie nie darüber sprachen, wusste Lucius, dass sie Medizin studierten, weil sie sich – beide aus dem Elendsviertel Leopoldstadt – davon sozialen Aufstieg versprachen. Lucius’ Vater hingegen entstammte einer alten polnischen Familie, deren Mitglieder sich als Nachfahren des Japhet, Sohn des Noah (ja, jenes Noah), betrachteten, und durch die Adern seiner Mutter floss das blaue Blut von Jan Sobieski, dem großen Befreier von Wien und Retter der westlichen Zivilisation, Jan Sobieski, König von Polen, Großfürst von Litauen, Ruthenien, Preußen, Masowien, Samogitien, Livland, Smolensk, Kiew, Wolhynien etc. etc.; weshalb ein derartiger «Aufstieg» für Lucius nichts anderes als ein Abstieg war.
Nein, von Anfang an hatte er sich ihnen nicht zugehörig gefühlt – als ungewolltes sechstes Kind geboren, Jahre nachdem der Arzt seiner Mutter erklärt hatte, dass sie keine Kinder mehr empfangen konnte. Wäre er nicht das Ebenbild seines Vaters gewesen – hochgewachsen, mit Riesenpranken und einer Haut weiß wie Alabaster, einem blonden Haarschopf, der eines Isländers würdig gewesen wäre, und den buschigen Augenbrauen eines alten Mannes, die er schon als kleiner Junge gehabt hatte –, hätte er sich womöglich gefragt, ob er nicht von jemand anderem stammte. Doch die Flecken auf den Wangen, die seinem Vater die Aura eines Recken verliehen, der gerade seinen Turnierhelm abgenommen hatte, wirkten bei Lucius stets, als wäre ihm etwas furchtbar peinlich. Und die Anmut, die Ungezwungenheit, die Energie, mit der sich seine Brüder und Schwestern auf den Empfängen seiner Mutter bewegten, blieb ihm völlig fremd; jegliche Form von Spontaneität ging ihm komplett ab, und es half auch nichts, wenn er sich vorab Themen zum Plaudern notierte oder sich einen Stein in die Hosentasche steckte, der ihn daran erinnern sollte, freundlich zu lächeln. Vor den Abendgesellschaften schlich er durch den Salon, verknüpfte mit jedem Kunstgegenstand einen Gesprächsstoff, mit dem Porträt von Sobieski die kommenden Ferien, mit der Chopin-Büste die Frage nach dem werten Befinden seines Gesprächspartners. Doch ganz gleich, wie minutiös er sich vorbereitete, war da doch immer dieser winzige Moment, dieser Sekundenbruchteil des Zögerns, bevor er etwas über die Lippen brachte. Mühelos glitt er durch das Hin und Her sich bauschender Kleider und Feldmarschallhosen mit messerscharfen Bügelfalten, doch sobald er sich einer Gruppe anderer Kinder näherte, erstarb ihr Gelächter.
Er fragte sich, ob man sein Unbehagen bemerkt hätte, wäre er an einem anderen Ort aufgewachsen, in einer anderen, stilleren Zeit, unter anderen, leiseren Menschen. Doch in Wien, unter den Schwatzhaften, wo man die Oberflächlichkeit zum Glaubensbekenntnis erhoben hatte, sah man ihm sofort den Zauderer an. Lucius: Schon der Name, den sein Vater ihm gegeben hatte, nach den legendären Herrschern Roms, war der blanke Hohn; er war alles andere als ein lichtes Gemüt. Schließlich – um seinen dreizehnten Geburtstag herum – schüchterte ihn der Unmut seiner Mutter, mehr noch, sein immer stärker werdendes Zagen so sehr ein, dass sich seine Unsicherheit im Beben seiner Lippen, dem nervösen Zucken seiner Finger und zuletzt einem Stottern manifestierte.
Zunächst bezichtigte sie ihn, das Stammeln nur vorzuschützen. Nur Kinder würden stottern, hatte sie gesagt, aber nicht mehr Jungen seines Alters. Tatsächlich stotterte er nicht, wenn er allein war, auch nicht, wenn er von seinen Wissenschaftsjournalen oder dem Vogelnest vor seinem Fenster erzählte, und ebenso wenig im Aquarienhaus des Tiergartens Schönbrunn, wo er stundenlang die Grottenolme betrachtete, blinde, aus dem Süden des Kaiserreichs stammende Salamander mit durchscheinender Haut, in deren Adern man das Blut pulsieren sehen konnte.
Zuletzt aber schien sie ihm doch zuzubilligen, dass womöglich etwas nicht stimmte, und ließ einen Sprachexperten aus München kommen, berühmt für sein Lehrbuch der Sprach – und Sprechstörungen und eine Vorrichtung aus Metall, den sogenannten Zungenapparat, der Labial-, Palatal- und Glottallaute voneinander isolierte und Heilung versprach.
Der Doktor traf an einem warmen Sommermorgen ein; er kaute an einem Niednagel herum, nahm den Jungen in Augenschein, tastete seinen Hals ab und spähte in seine Ohren. Lucius saß still da, während der Doktor irgendwelche Messungen anstellte, mit sauren Fingern seinen Gaumen untersuchte; seine Mutter begann sich zu langweilen und ließ sie allein. Schließlich kam der Apparat zum Einsatz, und der Doktor instruierte ihn, «Mein Vater war ein Wandersmann» zu singen.
Er versuchte sein Bestes. Eine Klammer riss an seiner Unterlippe, und die Zungenhalter zerschnitten ihm den Mund, sodass er Blut spuckte. «Lauter!», rief der Doktor. «Es funktioniert!» Als seine Mutter zurückkam, bellte Lucius wie ein Hund, roten Schaum vor dem Mund. Sein Blick wanderte zwischen den beiden hin und her – Mutter, Doktor, Mutter, Doktor –, während seine Mutter mit jeder Sekunde größer und zornesröter, der Doktor kleiner und blasser zu werden schien. Tja, die Suppe dürfen Sie jetzt schön auslöffeln, dachte er, den Blick auf den Kerl gerichtet. Und dann begann er zu kichern – gar nicht so leicht, wenn man in einem Zungenapparat steckte –, während der Doktor seine Utensilien zusammenkramte und die Flucht ergriff.
Ein zweiter Arzt versuchte vergeblich, ihn zu hypnotisieren, und verschrieb Hering, um den Mund feucht zu halten. Ein dritter schloss die Hand um seine Hoden, erklärte sie für zureichend entwickelt, doch als der Junge angesichts der sinnenfrohen Leibesübungen in einer illustrierten Ausgabe von Die wahren Geheimnisse der Klosterschülerinnen keine Reaktion zeigte, griff er nach seinem Notizbuch und kritzelte «Unterfunktion der Genitalia» hinein. Dann tuschelte er mit Lucius’ Mutter.
Diese wiederum sorgte dafür, dass sein Vater ihn eine Woche später in ein Haus brachte, das, von Amts wegen als syphilisfrei erklärt, auf Jungfrauen spezialisiert war, wo er in die luxuriöse Ludwig-II.-Suite gesperrt wurde, zusammen mit einem kroatischen Bauernmädchen, das wie eine Sängerin aus der Opera buffa ausstaffiert war. Da sie aus dem Süden stammte, fragte Lucius sie, ob sie schon einmal vom Grottenolm gehört hatte, und schon hellte sich ihr verängstigtes Gesicht auf. Ihr Vater hatte die kleinen Salamander einst gefangen und an Aquarien im ganzen Kaiserreich verkauft. Und dann staunten die beiden über diese zufällige Übereinstimmung ihrer Leben, während Lucius erzählte, dass just in jener Woche eins seiner Lieblingsexemplare in Schönbrunn gelaicht hatte.
Als sein Vater hinterher fragte, ob er es getan habe, erwiderte Lucius: «Ja, Vater.» Worauf sein Vater sagte: «Ich glaube dir nicht. Was hast du getan?» Lucius: «Das, was ich tun sollte.» Sein Vater: «Nämlich was?» Lucius: «Was ich gelernt habe.» Sein Vater wiederum: «Und was hast du gelernt, Junge?» Worauf Lucius, der sich an einen Roman von einer seiner Schwestern erinnerte, antwortete: «Glutvoll und leidenschaftlich, so muss es sein.»
«Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm», sagte sein Vater.
Schweigend ertrug er die Empfänge seiner Eltern, bis sie ihm zu gehen erlaubten. Am liebsten wäre er überhaupt nicht hingegangen, doch seine Mutter wandte ein, die Gäste würden sonst denken, sie sei wie Walentyna Rozorowska, die ihre verkrüppelte Tochter in einer Holzkiste versteckte, weshalb Lucius brav an ihrer Seite verharrte, während sie die Gäste begrüßte. Sie war überaus stolz auf ihre schmale Taille, und zuweilen argwöhnte er, dass sie ihn deshalb so gern vorführte, weil sie nichts lieber hörte, als wenn eine andere Frau sagte: «Agnieszka, sechs Kinder und immer noch so gertenschlank! Wie ist das denn nur möglich?»
Fischbein!, wäre Lucius dann am liebsten herausgeplatzt. Diese Art der Konversation war ihm zutiefst zuwider. Derartige Bemerkungen über seine Geburt fand er schlicht vulgär; es war, als würden die anderen Frauen Lobgesänge auf die Genitalien seiner Mutter anstimmen. Was für eine Erleichterung, wenn sie dann auf Musik und Architektur zu sprechen kam, sich angeregt mit Fabrikantengattinnen über die letzten Reisen ihrer Gemahle unterhielt; erst Jahre später hatte er begriffen, wie berechnend, ja skrupellos ihre Fragen gewesen waren.
Der König ist stets auf der Jagd und die Königin stets guter Hoffnung, lautete, frei nach Goethe, ein Bonmot über seine Familie. Tja, aber in so mancher Hinsicht ist die Königin beides, dachte er. Sein naschsüchtiger Vater, Major bei den Ulanen, war bei der Schlacht von Custozza durch einen Schuss in die Hüfte verwundet worden und hatte eigentlich vorgehabt, sich für den Rest seines Lebens auf seinem Standort in Krakau einen schönen Lenz zu machen, Sliwowitz zu trinken und Handschatten zu üben, mit denen er seine Kinder erschrecken konnte. Das Ende seines beschaulichen Daseins fürchtend, hatte der Kriegsheld die brachliegenden Bergwerke seiner Familie Lucius’ Mutter gegenüber ein gutes Jahrzehnt lang als nicht weiter erwähnenswert heruntergespielt. Eisen? Dort? Außer Fledermausdung gibt’s da nichts zu holen. Kupfer? Ach, Liebling, das ist nichts weiter als ein albernes Gerücht. Zinkvorkommen? Wer hat dir denn das erzählt?
Er kannte seine Frau nur allzu gut. Und kaum hatte sie die Bilanzen der Minen in die Finger bekommen, begann es in südpolnischer Erde schwer zu rumoren. Hatten die Bergwerke der Krzelewskis die Armee bis dahin mit Uniformknöpfen und Messing für Trompeten versorgt, lieferten sie drei Jahre später Eisen und Stahl für die neue Bahn nach Zakopane. Auf ihr Betreiben waren sie dann nach Wien gezogen, um vom Herzen des Kaiserreichs aus zu operieren. Das war nur passend, wie sie zu sagen pflegte. Wien war ihrer Familie einiges schuldig – schließlich hatte Sobieski Österreich von den Türken befreit.
Derartiges gab sie natürlich nur hinter vorgehaltener Hand von sich. In der Öffentlichkeit erwarb sie bedenkenlos den unerlässlichen kaiserlichen Nippes, und bald wimmelten ihre Kaminsimse nur so von franz-josephschen Gedenktellern. Sie ließ sich von Klimt porträtieren, zuerst mit Lucius an ihrer Seite, ließ ihn dann aber überpinseln, hin und weg von den Blattgoldauflagen auf seinem Ölgemälde Adele Bloch-Bauers. Ihre Dynastie irischer Wolfshunde – Puszek I. (1873-81), Puszek II. (1880-87), Puszek III. (1886-96), Puszek IV. (1895-1902) etc. – stammte geschlossen von niemand anderem als Kaiserin Sisis geliebtem Shadow ab.
Außer ihrem Ältesten waren all ihre Kinder in Wien zur Welt gekommen. Władysław, Kazimierz, Bolesław, Sylwia und Regelinda – Namen, die wie eine Prozession polnischer Heiliger daherkamen. In seinem zweiten Lebensjahrzehnt verstreuten sie sich in alle Winde; später fand Lucius heraus, dass sie zerstritten waren, tief zerstritten, obwohl er sie immer für unzertrennlich gehalten hatte. Seine Brüder tranken, seine Schwestern spielten erstklassig Klavier. Tatsächlich tranken seine Brüder – oft gingen sie mit seinem Vater auf ihren Ländereien in Polen und Ungarn vor Anbruch der Dämmerung auf die Jagd – geradezu unmäßig.
***
Daher erstaunte es ihn nicht sonderlich, dass seine Mutter nur mit den Worten abgewinkt hatte, das sei ein Beruf für Emporkömmlinge, als er ihr eröffnet hatte, Medizin studieren zu wollen.
Er erwiderte, viele Söhne Adeliger würden ihren Doktor machen. Auch wenn er ihre Antwort schon wusste, bevor sie über ihre schmalen Lippen kam.
«Ja, natürlich. Aber nicht den Doktor, den du zu machen gedenkst.»
Schließlich aber lenkte sie ein, sich seiner beschränkten Talente bewusst. Anfangs unwillkommen in den deutschen Studentenverbindungen, hatte er sich dann den ähnlich ausgegrenzten Feuermann und Kaminski angeschlossen, die ebenso wie er ihr Missbehagen zu verbergen suchten, während sich die anderen Studenten untereinander amüsierten.
Vom ersten Tag an hatte sich Lucius mit Feuereifer in sein Studium gestürzt. Seine zwei Gefährten hatten die eher naturwissenschaftlich orientierte Realschule besucht, während Lucius’ Hauslehrerinnen mehr Wert auf Griechisch und Latein gelegt hatten. Seinen Freunden erklärte er, dass er botanisch und zoologisch bei Plinius stehengeblieben war. Ihr herzliches Lachen erstaunte ihn, da er das ernst gemeint hatte. Danach tat er so, als hätte er von Darwin noch nie gehört, und scherzte gern: «Tja, diese Sache mit der Schwerkraft – wer glaubt denn so was?» Gern besuchte er die Propädeutika; die choralartigen Rezitationen der linnéschen Klassifikation hatten etwas Magisches an sich, ebenso wie die leuchtenden crookschen Röhren, die bei physikalischen Experimenten zum Einsatz kamen, oder die Erlenmeyerkolben, in denen bunte Flüssigkeiten brodelten.
Obwohl er die Medizin liebte – ja, das war das richtige Wort für dieses schwindelerregende Gefühl, die eifersüchtige Abwehr von Nebenbuhlern, seine hingebungsvolle Erforschung ihrer zarten Geheimnisse –, hatte er keineswegs damit gerechnet, dass sie seine Gefühle erwidern würde. Anfangs war ihm nur eins aufgefallen: Wenn er von ihr sprach, verschwand sein Stottern. Bis zum Ende seines zweiten Studienjahrs standen keine Prüfungen an, und so erfuhr er erst an einem kalten Dezembertag während des dritten Semesters, dass er «ein außerordentlich scharfes Gespür für die Wahrnehmung des Verborgenen» habe, wie es sein Dozent Grieperkandl formuliert hatte.
Der große Anatom gehörte zu jener Spezies von Emeriti, die der Überzeugung waren, dass die meisten medizinischen Innovationen (etwa das Händewaschen) Weiberkram waren. Seine Vorlesungen wurden von den Studenten nur mit leisem Grauen besucht, da Grieperkandl jede Woche einen von ihnen (stets männlichen Geschlechts; an seiner Vorlesung nahmen auch sieben Frauen teil, die er jedoch durchweg als künftige Krankenschwestern betrachtete) nach vorn rief, den jeweiligen Namen in sein kleines Notizbuch schrieb und ihn dann einer Befragung über derart abwegige Arkana unterzog, dass die meisten ihrer Professoren dabei gescheitert wären.
Bei der Vorlesung, während der Lucius nach vorn gerufen wurde, ging es um die Anatomie der menschlichen Hand. Grieperkandl fragte, ob er sich auf das Thema vorbereitet habe – das hatte er –, ob ihm die Namen der Knochen geläufig seien – das waren sie – und ob er sie wiedergeben könne. Der alte Professor stand so nah bei ihm, dass Lucius der Naphthalin-Geruch seines Gehrocks in die Nase stieg. Grieperkandl griff in seine Rocktasche, in der es leise klapperte; offenbar befanden sich ein paar Knochen darin. Ob Lucius hineingreifen und den erstbesten benennen wolle? Lucius zögerte; von den Rängen drang nervöses Gelächter an seine Ohren. Vorsichtig ließ er die Hand in die Tasche gleiten; seine Finger bekamen den längsten und dünnsten der Knochen zu fassen. Als er ihn herausziehen wollte, packte der Professor sein Handgelenk. «Gucken kann jeder», sagte er. Lucius schloss die Augen, sagte Scaphoideum und förderte ihn zutage. «Noch einen», sagte Grieperkandl, und Lucius sagte Capitatum und zog ihn ebenso heraus. Worauf Grieperkandl sagte: «Das sind die zwei größten – das kann jedes Kind», und Lucius fortfuhr, Lunatum, Hamatum, Triquetrum, Metacarpale, bis zum Schluss nur ein winzig kleiner, eigenartiger Knochen übrig blieb, zu stummelig für ein Finger-, selbst für ein Daumenglied.
«Das ist ein Zeh.» Erst jetzt bemerkte Lucius, dass sein Hemd nass geschwitzt war. «Ein kleiner Zeh.»
Der gesamte Hörsaal war verstummt.
Und Grieperkandl, auf dessen Miene sich unwillkürlich ein gelbes Lächeln breitmachte (später sollte er sagen, dass er siebenundzwanzig Jahre lang darauf gewartet hatte, den Witz loszuwerden), sagte: «Ausgezeichnet, mein Junge. Aber wem gehört er?»
Ein außerordentlich scharfes Gespür für die Wahrnehmung des Verborgenen. Er schrieb die Worte in sein Tagebuch, auf Polnisch, Deutsch und Lateinisch, als hätte er seine Grabinschrift gefunden. Für einen Jungen, dem schon die simpelsten Verhaltensweisen anderer Leute Rätsel aufgegeben hatten, war das ein äußerst beflügelnder Gedanke. Was, wenn seine Mutter falschgelegen hatte, was, wenn er bereits die ganze Zeit tiefer gesehen hatte? Als nach zwei Jahren das erste Rigorosum kam, erhielt er in allen Fächern die höchsten Beurteilungen; nur in Physik wurde er von Feuermann übertrumpft. Er konnte es nicht glauben. Griechisch mit seiner Hauslehrerin hatte er fast gänzlich aufgegeben; die Gründe für den Österreichischen Erbfolgekrieg interessierten ihn nicht, Kaiser Friedrich Wilhelm verwechselte er mit Kaiser Wilhelm und Kaiser Friedrich, und seiner Meinung nach schuf Philosophie nur Probleme, wo vorher keine existiert hatten.
Mit großer Vorfreude ging er das fünfte Semester an. Er hatte sich für Pathologie, Bakteriologie und klinische Diagnostik eingeschrieben, und im Sommer würden die ersten Vorlesungen in Chirurgie beginnen. Seine Hoffnungen, endlich die Bücher beiseitelegen und sich mit echten, lebenden Patienten beschäftigen zu können, waren verfrüht. Stattdessen sah er seinen Professoren aus denselben Höhen zu, aus denen er einst die Vorlesungen über organische Chemie verfolgt hatte. Und wenn ein Patient in den Hörsaal gebracht wurde – aber selbst das passierte in den Einführungsvorlesungen nur selten –, gelang es Lucius kaum, einen Blick auf ihn zu erhaschen, geschweige denn zu lernen, wie man eine Leber oder geschwollene Lymphknoten abtastete.
Zuweilen wurde er nach vorn gerufen. In der Neurologie-Vorlesung stand er neben dem Patienten des Tages, einem zweiundsiebzigjährigen Schlosser aus Tirol mit so schwerer Aphasie, dass er nur noch «da» nuscheln konnte. Seine Tochter übersetzte die Fragen des Arztes ins Italienische. Als der Mann zu antworten versuchte, öffnete und schloss sich sein Mund wie der Schnabel eines Jungvogels. «Da, da!», stammelte er mit hochrotem Gesicht, während von den Rängen staunendes und anspornendes Gemurmel ertönte. Von den aggressiven Fragen des Dozenten angetrieben, diagnostizierte Lucius einen Schläfenlappentumor, während er sich darauf konzentrierte, rein wissenschaftlich vorzugehen und sich nicht von der Trauer der Tochter des Alten ablenken zu lassen. Sie hatte zu weinen begonnen, griff nach der Hand ihres Vaters. Der Professor schlug ihr auf die Finger. «Unterlassen Sie das!», herrschte er sie an. «Sie stören die Vorlesung!» Lucius’ Gesicht brannte. Er verabscheute den Professor dafür, dass er derartige Fragen in Gegenwart der Tochter stellte, und er hasste sich für seine Antworten. Doch ebenso wenig gefiel ihm, dass ihm die Schwäche, die Sprachlosigkeit des Patienten zu Herzen ging, weshalb er sich jegliches Mitgefühl versagte. Auf seine Diagnose einer beginnenden Kompression des Hirnstamms mit unweigerlicher Folge eines Tods durch Atemstillstand folgte donnernder Applaus.
Nach seinem Auftritt sprachen ihn diverse andere Studenten an, forderten ihn auf, sich ihren Verbindungen anzuschließen. Doch Lucius hatte keine Zeit für ihre Unzulänglichkeiten. Er war auf dem Weg in die Zukunft, bereit, sich seinen Patienten zu widmen, sie aufzuschneiden und von ihren Krankheiten zu befreien. Selbst die Krankenhäuser frustrierten ihn, wo achtzig angehende Ärzte ihrem gefeierten Professor hinterhertrabten und gerade mal zehn, vielleicht zwanzig von ihnen erlaubt wurde, einen Leistenbruch oder einen Mammatumor zu untersuchen. Einmal – nur dieses eine Mal – war er mit einem Patienten allein gelassen worden, einem Mann aus Dalmatien mit feinem, weißem Haar, dessen Gehörgänge so viel Schmalz verstopfte, dass es problemlos für eine kleine Votivkerze gereicht hätte. Sein Patient, der seit fünfzehn Jahren als taub galt, starrte Lucius an, als wäre Jesus Christus höchstpersönlich gerade zurückgekehrt. Doch sein überschwänglicher Dank, die Gott-segne-Sie-Ergüsse, die tränenreichen Handküsse waren Lucius peinlich. Dafür hatte er sich so ins Zeug gelegt? Um Grabungen in anderer Leute Ohren vorzunehmen? Dass sein von ihm so hochgeschätzter Professor die «Taubheit» des guten Mannes auf Schwachsinn zurückgeführt hatte, deprimierte ihn nur noch mehr.
Er widmete sich wieder seinen Lehrbüchern.
Inzwischen konnte nur noch Feuermann mit ihm mithalten. Bald ließen sie die anderen links liegen und studierten für sich, trieben sich gegenseitig zu diagnostischen Höchstleistungen an. Sie lernten Intoxikationssymptome und die Manifestationen obskurer, tropischer Parasiten auswendig und wandten obsolet gewordene physiologische Klassifikationssysteme wie Phrenologie oder Humoralismus augenzwinkernd auf ihre Kommilitonen an. Als Feuermann behauptete, er könne ein Dutzend gesundheitlicher Leiden allein am Gang eines Patienten erkennen, konterte Lucius, dergleichen könne er schon am Gang eines Patienten hören; worauf die beiden anschließend einen verlassenen Korridor aufsuchten und Lucius sich mit dem Gesicht zur Wand stellte, während Feuermann hinter ihm auf und ab schritt. Schlapp, machten seine Schritte, dann schlapp-schlapp, schlurf-bums, schlurf-schlurf und plop-plop. Lucius’ Antworten lauteten: sensorisch-ataktische Neuropathie, spastische Hemiparese, Parkinson und Plattfüße.
«Und das?» Jetzt klangen Feuermanns Schritte nach pitter-pitter-plop.
Aber das war billig.
«Tanzen in seiner erbärmlichsten Form, chronisch, höchstwahrscheinlich letal.»
«Ja, ja, hast gewonnen!», dröhnte Feuermann, worauf Lucius, überaus zufrieden mit sich, selbst einen kleinen Steptanz hinlegte.
Gelegentlich kam es ihm vor, als wäre Feuermann der einzige Mensch, der ihn verstand, und nur in Gesellschaft Feuermanns fühlte er sich locker und entspannt. Und es war auch sein gut aussehender Freund, dem unter den Laienschwestern ein Ruf als Charmeur vorauseilte, der ihn dazu überredete, gemeinsam mit ihm das Bordell in der Alser Straße zu besuchen, mit dem Argument, dass es einst von den legendären Ärzten Billroth und Rokitansky frequentiert worden war; unter Bezugnahme auf Aufbau und Funktion der weiblichen Genitalien (Leipzig, 1824) erläuterte ihm Feuermann zudem das Prinzip der titillatio clitoridis. Dennoch hatten sie in den vergangenen zwei Jahren nie über etwas gesprochen, das nicht zumindest partiell mit Medizin zu tun hatte. Nicht ein einziges Mal hatte Feuermann eine Einladung in Lucius’ feudales Elternhaus in der Cranachgasse angenommen. Und Lucius’ fragte nie, weshalb Feuermanns Eltern aus ihrem Dorf nahe der russischen Grenze geflohen waren, als sein Freund noch ein Baby gewesen war, oder warum er keine Mutter hatte. Er wusste lediglich, dass Feuermanns Vater von Beruf Schneider war und seinen Sohn mit perfekt geschnittenen Anzügen ausstattete, die er aus Stoffresten zusammennähte.
Nach dem Koitus, erzählte Feuermann, pflegte Billroth saure Gurken zu verspeisen; Rokitansky hatte seinen Laborkittel stets anbehalten. Die Titillatio war einst von dem großen van Swieten verschrieben worden, um die Frigidität von Maria Theresia zu behandeln; damit hatte er das Kaiserreich gerettet. Einmal sagte Feuermann aus heiterem Himmel: «Vielleicht sollten wir irgendwann mal Schwestern heiraten.» Lucius erwiderte, er halte das für eine gute Idee, und fragte, ob er Klamms Schrift über die Verabreichung von Natriumbromid bei Palpitationen unbekannten Ursprungs gelesen habe.
***
Doch von allen Krankheitsbildern, die Lucius studierte, faszinierten ihn die neurologischen am meisten. Weiß Gott, das Gehirn war ein gar seltsam Ding! Dass es Menschen gab, die ein amputiertes Körperglied noch Jahre später spürten! Die Geister neben ihrem Bett sahen! Die allein aus unbewusstem Wunsch alle Symptome einer Schwangerschaft (Zunahme des Bauchumfangs, Amenorrhoe) entwickelten! Es war eine fast sexuelle Erregung, die er empfand, wenn er besonders komplizierten Fällen auf den Grund ging. Den charakteristischen Ausformungen wohnte eine wunderbare Klarheit inne, und so ließ sich ein Tumor etwa ganz einfach anhand dessen lokalisieren, ob er Sprache oder Sehkraft zerstörte; so komplex Persönlichkeiten auch sein mochten, am Ende lief alles auf die Architektur ihrer Zellen hinaus.
An der Universität lehrte auch ein Professor namens Zimmer, der in den Siebzigerjahren durch seine Sektionen des Thalamus Berühmtheit erlangt und später ein Buch mit dem Titel Radiologische Diagnostik neurologischer Erkrankungen publiziert hatte. Feuermann war darauf gestoßen, und Lucius konnte es nicht aus der Hand legen. Bald hatte er so viele Stunden mit dem Bibliotheksexemplar verbracht, dass er sich schließlich ein eigenes zulegte.
Seite um Seite reihten sich Röntgenbilder von Köpfen; kleine Pfeile wiesen auf Tumoren und feine Knochenfissuren. Er lernte, die dünnen, gewundenen Knochennähte auszumachen, den von den dunklen Tiefen der Schädelbasis umgebenen «Türkensattel», der die Hypophyse stützte. Doch sein Hauptaugenmerk galt der sanften Kuppel des Schädeldachs. Dort herrschte eine Art Nebel, so als hätte jemand Rauch ins Schädelinnere geblasen. Nichts war zu erkennen … nur wolkengraue Schemen, mal heller, mal dunkler, ein Schattenspiel, das vorgaukelte, aber nichts preisgab. Und trotzdem befand sich dort das Gedächtnis; in jenem grauen Nebel lagen Furcht und Liebe, war die Erinnerung an die Gesichter geliebter Menschen gespeichert, der Geruch der feuchten Zellulose, selbst der Anblick des Technikers, der die Aufnahmen gemacht hatte. Dr. Macewen aus Glasgow, einer seiner Götter, hatte das Gehirn den dunklen Kontinent genannt. Vor der Erfindung des Röntgenapparats hatte man das Gehirn nur durch die winzige Perle des Sehnervs erblicken können.
Lucius schaute unangemeldet bei Zimmer in der Neurologischen Abteilung vorbei.
Im Büro des alten Professors türmten sich Kartons mit Präparaten und Röntgenaufnahmen. Mit allem Respekt, Herr Professor Doktor, sagte Lucius, als er ihm gegenübersaß, was mir in Ihrem Buch fehlt, sind Aufnahmen der Blutgefäße. Wenn jemand ein Elixier finden würde, das Röntgenstrahlen absorbiert, eine Lösung, die man dem Patienten injizieren könnte … dann würde es uns vielleicht auch gelingen, diesen Nebel zu lichten …
Zimmer – er hatte das strähnige Haar und den wuchernden Backenbart eines Dozenten, der schon vor Langem aufs Altenteil hätte geschickt werden müssen – leckte etwas von seinem Monokel, ehe er es polierte und sich wieder vors Auge klemmte. Er blinzelte, als könne er die Unverfrorenheit des jungen Studenten nicht fassen. An der Wand hinter ihm hingen Porträts von Zimmers Professor, dem Professor seines Professors und wiederum von dessen Professor, ein geradezu royaler Stammbaum, wie Lucius dachte, während er darauf wartete, achtkantig hinausgeworfen zu werden. Doch irgendetwas an der hemdsärmligen Taktlosigkeit des jungen Mannes schien den alten Mann aufhorchen zu lassen. «Leichen injizieren wir Quecksilber, um ihre Blutgefäße sichtbar zu machen», sagte er. «Aber bei lebenden Patienten ist das eben leider nicht möglich.»
«Und Calcium?», fragte Lucius spontan, um gleich fortzufahren: «Jod, Brom … Ich habe ein wenig dazu gelesen … Könnten wir Adern und Venen sichtbar machen, wären wir auch dazu in der Lage, das Blut fließen zu sehen. Und dann würden wir die Umrisse von Tumoren sehen, verengte Arterien, die Ursache von Schlaganfällen …»
«Mir ist durchaus bewusst, was wir sehen könnten», gab Zimmer scharf zurück.
«Das Gedächtnis», sagte Lucius, während der alte Mann ihm mit hochgezogener Augenbraue zu verstehen gab, dass ihr Gespräch beendet war, das Monokel aus dem Auge fallen ließ und mit der Hand auffing.
Doch zwei Wochen später rief ihn Zimmer zu sich.
«Lassen Sie uns mit Hunden anfangen. Die Lösung bereiten wir hier vor und injizieren sie ihnen dann in der Radiologie.»
«Mit Hunden?»
Zimmer sah offenbar seine Irritation. «Nun ja, wir können schlecht Professor Grieperkandl hernehmen, nicht wahr?»
«Professor Grieperkandl? Ähm, nein, Herr Professor.»
«Ansonsten wären unsere Erkenntnisse aber nur schwerlich auf die Allgemeinheit übertragbar, nicht wahr?»
Lucius zögerte. Dass ein Professor von Zimmers Format einen Witz über einen Professor von Grieperkandls Kaliber machte, war derart unvorstellbar, dass er die Frage im ersten Moment für bare Münze nahm. Doch was sollte er antworten? Mit einem Ja würde er einer Vivisektion seines alten Lehrmeisters zustimmen. Und mit einem Nein wiederum stillschweigend unterstellen, dass der große Anatom nicht ganz bei Trost war …
«Nein, wir werden Professor Grieperkandl nicht als Versuchskaninchen missbrauchen», sagte Zimmer.
«Selbstverständlich nicht, Herr Professor!»
Nervös verschränkte er die Hände. Sichtlich amüsiert öffnete Zimmer eine auf seinem Schreibtisch stehende Dose und steckte sich ein Bonbon in den Mund. Er hielt Lucius die Dose hin.
«Ein Karamell?»
Zimmers Finger waren tabakfleckig und rochen nach Chloroform; im selben Moment erblickte Lucius ein offenes Glas auf dem Schreibtisch, in dem ganz offensichtlich ein Hirnstamm schwamm.
Einen Augenblick lang irrte Lucius’ Blick zwischen dem Glas und der Dose hin und her.
«Gern, Professor», sagte er dann. «Vielen Dank, Herr Professor Doktor.»
***
Das Krankenhaus war einen knappen Kilometer von Zimmers Labor entfernt. Zwei Wochen lang brachte Lucius die Hunde dorthin. Da kein Fiaker die Hunde mitnehmen wollte, schob er sie in einem Rollwagen dorthin. Auf der Straße neigten die Hunde – diejenigen, die die Prozedur überlebt hatten – zu Anfällen. Passanten wandten sich um, musterten neugierig den blassen jungen Mann in seinem locker sitzenden Anzug und die zuckenden Hunde im Wägelchen. Um Kinder machte er einen großen Bogen.
Der Röntgenapparat war häufig defekt, zudem standen die Leute Schlange. An einem Tag musste er fünf Stunden lang warten, weil die kaiserliche Familie sich in vollem Ornat röntgen ließ.
Er kehrte zu seinem Professor zurück. «Was kostet ein Röntgengerät eigentlich?», fragte er.
«Sie meinen, eins zu kaufen? Ha! Das würde unser Budget bei Weitem übersteigen!»
«Verstehe, Herr Professor Doktor.» Lucius senkte den Blick. «Und was, wenn wir eine Zuwendung erhalten würden – eine Spende von einer Familie, die die Mittel besitzt?»
In den folgenden Wochen ging er nur zum Schlafen nach Hause. Je drei Stufen auf einmal nehmend, eilte er die große Treppe hinauf, passierte die Chopin-Büste und das Sobieski-Porträt, marschierte durch den Saal mit den mittelalterlichen Wandteppichen und dem vergoldeten Klimt, auf dem kein Lucius mehr zu sehen war.
Er stand vor Morgengrauen auf, injizierte den Hunden Quecksilbersalze und Kalziumlösungen, doch die Aufnahmen ließen sehr zu wünschen übrig. Durch Ölsuspensionen erhielt man brillante Bilder der Venen, doch verursachten sie Embolien. Jod und Brom erwiesen sich als erfolgversprechender, zu hohe Dosierungen aber führten zum Tod der Tiere, während zu niedrige nichts brachten. Doch je mehr ihn die Frustration packte, desto enthusiastischer wurde der Professor. Zimmers Elixier, so nannte der Alte die Substanz, die sie erst noch finden mussten, und begann zu spekulieren, ob eine geringfügig erhöhte Blutzirkulation sich womöglich auf Röntgenaufnahmen des Gehirns nachweisen lassen würde. Wenn jemand den Arm hebt, sehen wir vielleicht ein korrespondierendes Leuchten im Motorcortex, wenn jemand spricht, vielleicht ein Flimmern im Schläfenlappen. Eines Tages, bei Menschen.
Und Lucius dachte: Genau meine Worte bei unserem ersten Treffen.
***
Das Einzige, was ihm Auftrieb gab, war sein Traum, die Gedanken eines anderen Menschen sehen zu können.
Bald war klar, dass sie von einem Durchbruch meilenweit entfernt waren. Die paar Aufnahmen, die sie zustande gebracht hatten, waren zu verschwommen, um von großem Nutzen zu sein, und Zimmer weigerte sich, sie zu veröffentlichen, aus Angst, ein anderer Mediziner könnte aufgrund seiner Forschungen schließlich die Lorbeeren einheimsen. Nun bereute Lucius, je mit seiner Idee bei ihm vorstellig geworden zu sein. Es ging ihm gegen den Strich, die armen Hunde umzubringen – im Frühling waren es bereits acht. Zu Hause ergriff Puszek (VII.) umgehend die Flucht, wenn er ihn sah, als wüsste er genau, was Lucius trieb. Er hatte seine Zeit vergeudet. Und zu allem Überfluss zog Feuermann ihn auch noch auf, all das erinnere ihn daran, wie sie seinerzeit bei mikroskopischen Untersuchungen von Gehirngewebe so getan hatten, als könnten sie die schlangengleiche Windung des Neids oder die schimmernde Kurve der Begierde sehen.
«Die Idee war hervorragend, Krzelewski. Aber man muss wissen, wann Schluss ist.»
Doch Lucius wollte immer noch nicht aufgeben.
Die meisten seiner Kommilitonen machten die mangelnde praktische Erfahrung damit wett, dass sie während der Semesterferien in Provinzhospitälern aushalfen. Melkerinnenpickel aufpieksen nannte Lucius’ Mutter diese Praktika, weshalb Feuermann allein aufbrach, gebrochene Beine schiente, eine Heugabelwunde versorgte, einen Todesfall durch Tollwut diagnostizierte und neun Babys zur Welt brachte, allesamt von gebärfreudigen Bauernmädels, die so vor Gesundheit strotzten, dass sie von der Feldarbeit direkt auf die Entbindungsstation kamen. Drei Wochen später, als sie wieder an ihrem Tisch im Café Landtmann saßen, lauschte Lucius seinem Freund, während der ihm alles bis ins kleinste Detail erzählte, dabei mit seinen braungebrannten, entbindungserfahrenen Unterarmen und Fingern in der Luft herumfuchtelte. Er wusste nicht, was ihn neidischer machte: die Festmahle, die die dankbaren Bauern für Feuermann aufgefahren, oder die sonnengebräunten Mädchen, die ihm die Hände geküsst hatten. Oder die Gelegenheit, einen Säugling zur Welt zu bringen; bislang hatte er nur an der Satinvagina eines Körpermodells geübt. Den ganzen Monat hatte er damit zugebracht, einer bestimmten Mischung von Jod und Brom hinterherzujagen, und schließlich herausgefunden, dass Zimmer ein paar Fläschchen falsch etikettiert hatte.
«Es war wirklich unglaublich, mit Worten nicht zu beschreiben.» Feuermann warf eine Münze auf das Silbertablett des Kellners. «Nächsten Sommer kommst du mit. Solange du nicht eins in den Armen gehalten hast, hast du nicht gelebt.»
«Ein Bauernmädel?», scherzte Lucius müde.
«Ein Baby, rosig, gesund und munter. Einen echten Wonneproppen.»
***
Im Mai 1914 war Ende der Fahnenstange.
An einem Nachmittag rief Zimmer ihn auf ein vertrauliches Gespräch in sein Büro. Er benötige Lucius’ Hilfe in einem äußerst seltsamen Fall.
Einen Moment lang verspürte Lucius die alte Erregung. «Worum geht es?»
«Um ein wirklich verblüffendes Phänomen.»
«Ah ja?»
«Ein ausgesprochen mysteriöses obendrein.»
«Sie spannen mich ganz schön auf die Folter, Herr Professor.»
«Es geht um einen Fall von kokzygealer Ichthyodisierung.»
«Pardon, Herr Professor?»
Nun konnte Zimmer sein Kichern nicht mehr bezähmen. «Meerjungfrauen, Krzelewski. In der Sammlung der medizinischen Universität.»
Seit Beginn seines Studiums hatte Lucius immer wieder von den Gerüchten gehört. Unter den unbezahlbaren Artefakten der Sammlung, die auch Objekte aus der berühmten Wunderkammer Rudolfs II. beherbergte, befanden sich dem Hörensagen nach auch zwei Zwerge, drei in Formalin konservierte Engel und mehrere Meerjungfrauen, die an fremden Küsten angespült und dem Kaiser geschenkt worden waren. Doch kein Student hatte diese Räumlichkeiten je betreten.
«Herr Professor haben einen Schlüssel?»
Die Antwort war ein spitzbübisches Lächeln, das Zimmers kieselsteinartige Zähne entblößte.
Am Abend verschafften sie sich Zutritt, nachdem der Verwalter gegangen war.
Das Gewölbe lag im Dunkeln. Sie passierten Tische mit Folterwerkzeugen, Gläsern, in denen sich missgebildete Föten befanden, eine Kollektion von Dodoschnäbeln, eingelegte Schildkröten und einen Schrumpfkopf aus dem Amazonas-Regenwald. Schließlich standen sie vor einem Regal am anderen Ende des Raums. Da waren sie. Doch handelte es sich keineswegs um zwei schöne Meerjungfrauen, die in einem Aquarium planschten, wie Lucius es sich immer vorgestellt hatte, sondern um zwei verschrumpelte, säuglingsgroße Körper, deren getrocknete Gesichtshaut über die Zähne zurückgewichen war und deren Torso sich elegant verjüngte, ehe er in einen geschuppten Schwanz überging.
Zimmer hatte einen Rucksack mitgebracht. Er öffnete ihn und hieß Lucius mit einer Handbewegung, einen der Körper darin zu verstauen. Sie würden ihn in die Radiologie mitnehmen und untersuchen, ob die Lendenwirbelsäule durch ein Gelenk mit dem Schwanz verbunden war.
«Bei allem Respekt, Herr Professor.» Lucius merkte, wie ein Anflug von Verzweiflung in seiner Stimme widerklang. «Ehrlich gesagt habe ich da starke Zweifel.»
«Warum? Ich sehe jedenfalls nirgendwo Nähte oder verklebte Stellen.»
«Es ist eben ein sehr guter Schwindel, Herr Professor.»
Doch Zimmer hatte sich das Monokel ins Auge geklemmt und spähte in den Mund der einen Meerjungfrau.
«Halten Sie es wirklich für klug, sie zu entwenden, Herr Professor? Sie sehen ziemlich … zerbrechlich aus. Was, wenn eine kaputtgeht?»
Zimmer klopfte mit dem Körper gegen das Regal, als hielte er einen Hammer in der Hand. «Absolut stabil», gab er zurück.
Vorsichtig nahm Lucius das Ding entgegen. Es war leicht; die Haut fühlte sich an wie getrocknetes Leder. Die Kreatur schien die Augen zusammenzukneifen. Aufgebracht sah sie aus.
Zimmer ließ die Meerjungfrau in den Rucksack gleiten. «Kommen Sie.»
Die Sammlung der medizinischen Universität befand sich im Keller. Sie stiegen die Treppe hinauf und gingen durch den Hauptkorridor zurück, dessen Wände von den Statuen berühmter Wiener Ärzte gesäumt waren. Nur in der Ferne brannte eine Lampe. Lucius war dankbar dafür, dass es Abend war und seine Kommilitonen nach Hause gegangen waren. Der Körper der Meerjungfrau schabte an der Leinwand des Rucksacks – ein Geräusch, das sogar seine Schritte zu übertönen schien.
Sie hatten den Ausgang fast erreicht, als eine Stimme an ihre Ohren drang. «Herr Professor Zimmer!» Sie wandten sich um, und Lucius erkannte den Rektor, der von einer kleinen, dunkelhaarigen Frau begleitet wurde.
Mit breitem Lächeln und ausgestreckter Hand trat der Rektor auf Zimmer zu.
Zimmer schien ihn gar nicht richtig wahrzunehmen. Stattdessen ergriff er die Hand der Frau.
«Ah, Madame Professor. Was führt Sie nach Wien?»
«Eine Vorlesung, Herr Professor», erwiderte sie in akzentgefärbtem Deutsch. «Immer dasselbe – Vorlesungen, Vorlesungen, Vorlesungen.»
Nun bemerkte der Rektor auch Lucius und wandte sich an die Frau: «Das ist einer unserer begabtesten Studenten – Kerzelowski … ähm … Kurslawski …»
«K-sche-lew-ski», entfuhr es Lucius. «Das Krze spricht man im Polnischen …»
«Aber natürlich!» Der Rektor blickte zu der Frau. «Von Madame Professor Curie haben Sie sicher schon einmal gehört.»
Lucius erstarrte. Madame Marie Sklodowska Curie. Er verneigte sich. «Es ist mir eine große Ehre», murmelte er ehrerbietig. Zwei Nobelpreise: In der polnischen Gemeinde von Wien war sie eine Heilige.
Madame Curie lächelte. Auf Polnisch sagte sie: «Krzelewski – Sie sind Pole?»
«Ja, Madame Professor.»
Sie neigte sich vertraulich zu ihm. «Sie schickt der Himmel! Mein Gott, wie satt ich es habe, ständig Deutsch reden zu müssen.»
Lucius warf den beiden Männern einen unbehaglichen Blick zu, doch die schienen hocherfreut, dass Madame Curie einen Gesprächspartner gefunden hatte. Da er nicht recht wusste, was er antworten sollte, sagte er: «Polnisch ist eine wunderschöne Sprache.»
Die große Chemikerin schien seine Verlegenheit nicht mitbekommen zu haben. Sie wandte sich auf Deutsch an den Rektor: «Hätten Sie etwas dagegen, wenn uns die Herren beim Abendessen Gesellschaft leisten? Ich freue mich, einen Landsmann zu treffen.» Dann, auf Polnisch zu Lucius: «Diese alten Knacker! Sie langweilen mich schier zu Tode!»
Lucius sah zu Zimmer, darauf hoffend, dass der Professor intervenieren würde, damit sie erst einmal den Rucksack loswerden konnten, doch Zimmer schien vergessen zu haben, dass Lucius ihn nach wie vor unter dem Arm trug.
***
Sie beschlossen, im Meissl und Schadn zu Abend zu essen. Madame Curie wollte sich ein wenig die Beine vertreten, und so gingen sie zu Fuß. Auf der Ringstraße wurden sie von zwei räudigen Hunden verfolgt, die Lucius’ Rucksack hungrig anwinselten. An der Tür erbot sich der Maître d’hôtel, ihm den Rucksack abzunehmen, doch Lucius lehnte höflich ab und verstaute ihn flink unter seinem Stuhl. Während der Vorspeise berichtete Zimmer ein wenig langatmig von seiner radiologischen Forschungsarbeit, während Madame Curie knappe Fragen über Kontrastmittel einwarf, deren Beantwortung Zimmer an Lucius delegierte. Sie hatten gerade mit dem Dessert begonnen, als die berühmte Chemikerin die beiden Professoren fragte, ob es ihnen etwas ausmachen würde, wenn sie sich ein wenig auf Polnisch unterhielt.
«Aber keineswegs! Ganz und gar nicht!»
Sie wandte sich zu Lucius. «Was ist in dem Rucksack?»
«Im Rucksack, Madame Professor?»
«Stellen Sie sich nicht dumm, junger Mann. Wer bringt einen Rucksack mit zu Meissl und Schadn und versteckt ihn dann unter seinem Stuhl? Was schleppen Sie für Kostbarkeiten mit sich herum?» Sie zwinkerte ihm zu. «Ich taste Ihren Rucksack schon seit einer halben Stunde mit dem Fuß ab.»
«Es ist eine Meerjungfrau, Madame Professor», sagte Lucius, weil ihm schlicht nichts Besseres einfiel.
Sie hob die Augenbrauen. «Tatsächlich? Eine ausgetrocknete?»
«Ähm, ja, Madame Professor. Woher wissen Sie das?»
«Offenbar lag sie nicht in Formalin, das würde man ja riechen. Und wäre sie lebendig, würde sie wohl versuchen, sich zu befreien, richtig? Ich würde es jedenfalls tun. Eine Meerjungfrau also. Seltsam, wie viele exotische Kreaturen weiblich sind, nicht wahr?»
Lucius sah sich besorgt um. «Das kann ich Ihnen nicht bestätigen, Madame Professor. Ich bin mit der Anatomie bislang nicht vertraut.» Im selben Augenblick ging ihm siedend heiß auf, wie missverständlich er sich ausgedrückt hatte. Aber Gott sei Dank war es halb dunkel in dem Restaurant. «Ich habe noch nie eine Meerjungfrau gesehen», fügte er rasch hinzu.
«Würden Sie sie mir zeigen?», fragte sie leise.
«Jetzt, Madame Professor?», platzte Lucius heraus.
«Später», erwiderte sie.
Als sie fertig waren, sagte sie: «Kann mich Ihr Student nach Hause begleiten?»
Der Rektor, der diese Aufgabe offensichtlich gern selbst übernommen hätte, stimmte zögernd zu. Zimmer war ohnehin bereits schwer angetrunken und scheuchte ihn winkend fort.
Sie wohnte im Metropol. Als sie im Foyer auf den Lift warteten, spürte Lucius den Blick des Pagen, der offenbar ein Schäferstündchen witterte. Oh, von wegen Rendezvous, dachte Lucius, wenn auch ein wenig geschmeichelt. Wir sehen uns bloß eine Meerjungfrau an, und das war’s dann auch schon …
Auf ihrer Etage angekommen, führte sie ihn ins Badezimmer, wo eine Badewanne mit vier Füßen stand. Lucius öffnete den Rucksack, und sie nahm die Kreatur heraus.
«Du liebe Güte», sagte sie, während sie das vertrocknete Wesen ins Licht hielt. Im Spiegel erhaschte Lucius einen Blick auf das seltsame Trio, das sie bildeten. «Wie hässlich!», fuhr sie fort. «Das Gesicht sieht aus wie der alte Theodore Roosevelt, finden Sie nicht? Stellen Sie sich vor, sie hätte einen kleinen Schnäuzer und eine Brille auf.»
«Ja, Madame Professor. Ein mumifizierter Mr Roosevelt mit Schnäuzer, Brille und Fischschwanz – er würde ihr wohl recht ähnlich sehen.»
Lucius – wie so viele Studenten hatte er sich angewöhnt, in ganzen Sätzen zu antworten, die die Frage rekapitulierten und in die Breite zogen – hatte eigentlich keinen Witz machen wollen, doch Madame Curie begann zu lachen. Dann schüttelte sie den Kopf. «Warum, um Himmels willen, schleppen Sie dieses Ding mit sich herum?»
«Professor Zimmer wollte es … nun ja, röntgen. Es stammt aus der Sammlung Rudolfs II. Ein Geschenk des Sultans. Der Professor wollte untersuchen, ob Rückenwirbel und Schwanzflosse …»
«Was? Er hält diese ‹Jungfrau› ernstlich für echt?»
«Nun ja, er … Wir haben zumindest die Möglichkeit in Betracht gezogen.» Im Spiegel sah Lucius, wie er knallrot wurde. «Der Röntgenapparat erlaubt die Untersuchung von Phänomenen, die …»
«Und Sie?», unterbrach sie ihn scharf. «Was glauben Sie?»
«Ich halte es für einen Schwindel, Madame Professor. Für ein Konstrukt aus Affe und Schwanzflosser.»
«Und warum?»
«Weil ich die Naht sehen kann, Madame Professor. Sehen Sie? Hier, unter diesen Schuppen.»
«Du lieber Himmel», sagte sie. «Da sitzen Sie aber ganz schön in der Tinte.» Sie gab ihm die Meerjungfrau zurück. «Der Rektor spricht voller Bewunderung von Ihnen. Wenn Sie nichts gegen einen persönlichen Rat haben, unter Landsleuten: Nehmen Sie schleunigst Reißaus, junger Freund. Genie ist ein Privileg der Jugend. Und Ihnen läuft die Zeit davon.»
***
Und doch war es alles andere als einfach, seinem Professor den Rücken zu kehren.
Nach wie vor verspürte er eine nachgerade kindliche Zuneigung zu Zimmer; nachts träumte er manchmal davon, wie sie sich duzten. Aber dann fand er doch noch den Absprung: Als Zimmer einräumte, bislang seien ihre Röntgenexperimente «ergebnislos» verlaufen, erklärte er dem alten Mann, dass er erst einmal wieder mehr Zeit in der Bibliothek verbringen würde, um ein zweckdienlicheres Präparat zu finden.
Er begann sein Studium fortzusetzen.
Pathologische Anatomie, Laborpraktika und Vorlesungen.
Pathologische Histologie, Laborpraktika und Vorlesungen.
Pathologische Anatomie einschließlich Obduktionen (Feuermann: «Ein Patient! Dass ich das noch erleben darf!»).
Allgemeine Pharmakologie; endlose Medikamentenlisten zum Auswendiglernen, ohne auch nur eins verschreiben zu können.
Zurück im Amphitheater, starrte er angestrengt auf die Operationsbühne.
Und so ging es weiter. Bis zum Sommer seines dritten Studienjahrs – es verblieben noch vier Semester, und er vermochte seine Ungeduld kaum zu bezähmen –, als ihm das Schicksal zu Hilfe kam, in Gestalt zweier Kugeln aus dem Lauf der Pistole eines gewissen Gavrilo Princip, die in Sarajewo den Erzherzog und seine Gemahlin trafen.
2
Zunächst konnte Lucius dem im Juli erklärten Krieg ganz und gar nichts abgewinnen. Die Mobilmachung gefährdete sein Studium, so sah er es; er fürchtete, dass Seminare und Vorlesungen abgesagt werden könnten. Er verstand den Patriotismus seiner Kommilitonen nicht; sie waren trunken von der Schicksalhaftigkeit der Ereignisse, strömten in Scharen aus den Bibliotheken auf die Straße, um an den Aufmärschen teilzunehmen oder sich freiwillig zu melden. Er hielt sich abseits, wenn sie sich um Karten versammelten, die das Vorrücken der kaiserlichen und königlichen Armee in Serbien, den deutschen Vormarsch in Belgien oder die Schlacht an den Masurischen Seen zeigten. Die Leitartikel, die «das Ende des Stillstands» und «die Verjüngung der deutschen Seele» feierten, ließen ihn völlig kalt. Als ihm sein zwei Jahre jüngerer Cousin Witold, der kürzlich aus Krakau nach Wien gekommen war, mit Tränen in den Augen erzählte, dass er sich als Fußsoldat verpflichtet hatte, weil ihm der Krieg das Gefühl gab, Österreicher zu sein, erwiderte Lucius auf Polnisch, dass der Krieg ihn offensichtlich auch in einen Kretin verwandelt habe; er jedenfalls werde es ganz bestimmt nicht darauf anlegen, sich umbringen zu lassen.