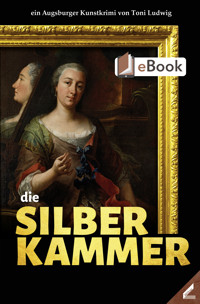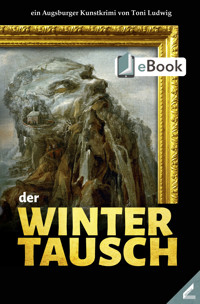
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wißner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Peter Schramms zweiter Fall Ein Gemälde ist verschwunden, aber es ist noch da. Besser gesagt: Das ausgefallene barocke Winter-Bild wurde gegen ein fast identisches Original von der Hand desselben Meisters vertauscht. Ist der Augsburger Sammler also bestohlen worden oder besitzt er jetzt nur ein anderes Bild als vorher? Welcher Dieb ersetzt schon ein Original durch ein gleichwertiges? Und weshalb? Bei der Augsburger Polizei herrscht Ratlosigkeit, und so wird der Kunstermittler Dr. Peter Schramm hinzugezogen. Eine Vielzahl an Spuren tut sich auf, die in unterschiedlichste Richtungen führen. Was haben die vier verschrobenen Herren des »Kunstkreises« mit dem Bildertausch zu tun? Warum stößt Peter immer wieder auf Relikte aus dem Dritten Reich? Er und sein bester Freund Moritz haben alle Hände voll zu tun, die Mosaiksteinchen des Falls zusammenzufügen, trotzdem ergibt sich kein sinnvolles Bild. Und dann kommt es auch noch zu einem plötzlichen Todesfall auf den vereisten Hängen eines winterlichen Berges … Ein Krimi wie eine Spurensuche im Schnee!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
EPILOG
Bereits in dieser Reihe erschienen
Impressum
Als ich erwacht’, da schimmert’
Der Mond vom Waldesrand;
Im falben Scheine flimmert’
Um mich ein fremdes Land,
Und wie ich ringsher sehe:
Die Flocken waren Eis,
Die Gegend war vom Schnee,
Mein Haar vom Alter weiß.
aus: Winterlied, Joseph von Eichendorff (1788–1857)
KAPITEL 1
Schon lange war Peter Schramm nicht mehr früh schlafen gegangen. Gestern war es so weit. Dass es aber nichts genutzt hatte, zeigte sich, als er frühmorgens aufwachte. Es war noch dunkel, ein Montag Anfang Januar 2018, kurz nach Dreikönig, und es war einer jener Morgen, bei denen so ziemlich alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Peter ging ins Bad, nahm seine elektrische Zahnbürste zur Hand, drückte etwas Zahnpasta auf den Bürstenkopf und begann, seine Zähne zu putzen. Keine drei Sekunden später versagte die Bürste; der Akku war leer. Das Jahr fing gut an. Danach betätigte Peter den Seifenspender, hatte aber – ohne seine Brille auf der Nase – nicht den Winkel des Drückhebels im Auge, aus dem die Flüssigseife herauskam, sodass die Seife horizontal gegen seinen Schlafanzug schoss. Fluchend rubbelte er heftig mit dem Handtuch, um denselben wieder trocken zu bekommen. In der Küche ging es so weiter: Die Kaffeemilch war sauer geworden und Peter fiel ein Messer zu Boden. Aufgrund dieser Pechsträhne war er nun besonders achtsam beim Hantieren mit dem Toaster. Er schaffte es aber immerhin zu verhindern, dass die Toastscheibe verkohlte, was durchaus hätte passieren können, da die Zeitautomatik seines Toasters schon seit über einem Jahr defekt war. Peter bestrich die geröstete Toastscheibe mit etwas Butter, nahm von seiner selbstgemachten Quittenmarmelade, die er erst vor Kurzem gekocht hatte, und achtete peinlich darauf, dass der Toast nicht mit der bestrichenen Seite auf seiner Hose landete – was ihm zuletzt kurz vor dem Aufbruch zu einem wichtigen Kongress passiert war, wo er die Eröffnungsrede zu halten hatte … Am liebsten wäre Peter ja wieder ins Bett gegangen, doch er hatte eine vielversprechende Verabredung mit einem Klienten in einem Bistro am St. Johanner Markt, nur zwei Minuten von seinem Haus entfernt.
Nachdem er das Frühstück, das ohne weitere Komplikationen verlief, mit einer gewissen angespannten Ruhe beendet hatte, ging Peter zum Briefkasten, öffnete den Metalldeckel und entnahm die Post – einen Stapel Briefe sowie einige in Plastikfolie eingeschweißte Werbeprospekte, obenauf ein dickerer Prospekt des größten Saarbrücker Möbelhauses, dessen Schriftzug, noch in gut gestalteten 70er-Jahre-Lettern in Sparkassenrot, inzwischen wieder modern wirkte. Auf dem Titel waren schwere klobige Schrankwände zu günstigen Preisen abgebildet, wie sie seine Großmutter geliebt hatte und wie er sie als Jugendlicher ganz in der Nähe in der Möbel-Martin-Filiale an der Saarbrücker Römerbrücke in einer »modernen« Jugendausgabe für sein eigenes Zimmer hatte aussuchen müssen. Er mochte schwere, die Wände verkleidende Möbel schon damals nicht, aber er wollte seiner Großmutter den Gefallen tun und entschied sich letztlich für eine kleine jugendliche Ausgabe, die sogar ihr Wohlgefallen erregte. Bei diesen eingeschweißten Werbeprospekten fragte er sich immer wieder, ob man sie so unausgepackt ins Altpapier tun dürfe. Vermutlich nicht, was ihn jedoch nicht daran hinderte, sie mit besonders schlechtem Gewissen doch in die Kiste fürs Altpapier zu werfen.
Der oberste Brief auf dem Stapel, den Peter auf den Küchentisch ablegte, war von Frau Albiger aus Heidelberg, der Exfrau seines ehemaligen Klienten, des Kunsthändlers Norbert Metzinger, der durch einen absichtlich herbeigeführten Unfall zu Tode gekommen war. Peter nahm seinen Brieföffner mit der Augsburger Zirbelnuss, den er kürzlich von Museumsdirektor Prof. Dr. Benno Beinhardt geschenkt bekommen hatte, machte den Briefumschlag auf und entnahm eine Postkarte mit einer Ansicht des Heidelberger Schlosses sowie ein gefaltetes Blatt Papier. Auf der Karte stand folgender handgeschriebener, gut lesbarer Text:
Lieber Herr Dr. Schramm,
ich hoffe, dass Sie Ihr Augsburger Abenteuer gut überstanden haben und Sie wieder vollkommen genesen sind. Ich bin inzwischen intensiv damit beschäftigt, den Nachlass meines Exmannes zu sichten und die Auflösung der Lagerhalle in die Wege zu leiten. Das ist alles ziemlich anstrengend. Dürfte ich Sie bitten, mich bei den fachlichen Fragen einzelner Objekte etwas zu unterstützen? Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ihre Viola Albiger
Frau Albiger will bestimmt, dass ich mir ihre Silberschätze anschaue, dachte sich Peter. Sie hatte schließlich ein Faible für Augsburger Silber. Dann faltete Peter das beiliegende Papier auseinander. Es handelte sich um das Material- und Wertgutachten zu seinem barocken Goldring, den Peter als Honorar für seine erbrachten Recherchen erhalten hatte. Sein Augsburger Abenteuer vom vergangenen Sommer, auf das Viola Albiger anspielte, war das aufregendste Erlebnis seines Lebens gewesen. Es hatte ihn ganz schön außer Atem gebracht. Begonnen hatte damals alles mit einem außergewöhnlichen Gemälde, dem atemberaubenden Porträt der Magdalena Koepff, einer Augsburger Patrizierin aus dem 18. Jahrhundert, die auf dem Gemälde den besagten Ring vor sich hielt. Das Verschwinden des Bildes hatte Peters Forscher- und Entdeckergeist herausgefordert. Gemeinsam mit seinem Mitstreiter, seinem alten Freund Moritz, war es ihm gelungen, das Rätsel des verschwundenen Bildes zu lösen. Mehr noch: Sie entdeckten eine secret silbercamera, einen geheimen Silbertresorraum im Haus der Koepffs, der jahrhundertelang verborgen geblieben war. Dramatisch gestaltete sich sein Abenteuer dadurch, dass er bei der Entdeckung der geheimen Silbercamera von einem Angreifer hinterrücks niedergeschlagen worden war, wobei Moritz mit dem Aggressor glücklicherweise kurzen Prozess machte, diesen niederstreckte, knebelte und dann der Polizei übergab. Den wunderschönen barocken Saphirring der Frau Koepff hatte Peter wie eine Reliquie verwahrt, da sich in dem Schmuckstück die Lebensgeschichte der Patrizierin eingeschrieben hatte. Doch kürzlich hatte er sich dazu entschlossen, dieses Kleinod dem Augsburger Maximilianmuseum als Dauerleihgabe zu überlassen, da so einerseits viele Besucherinnen und Besucher an der herzzerreißenden Lebensgeschichte dieser faszinierenden Dame teilhaben konnten und Peter andererseits das Stück in Sicherheit wusste. Schließlich besaß er selbst keinen Tresor und ihm war bei seinen längeren Recherchereisen immer ein wenig mulmig gewesen, wenn er das wertvolle Schmuckstück ungesichert zu Hause wusste. Zwar hatte Peter auch viele andere wertvolle Kunstgegenstände in seinem Besitz, aber der Durchschnittsdieb suchte nun mal nach Bargeld und schnell verwertbarem Schmuck. Nicht auszudenken, wenn der wertvolle Ring wegen seines Goldwertes in einer Scheideanstalt landen und damit für immer zerstört werden würde! In Peters Augen war die Museumsleihgabe daher eine echte Win-win-Situation.
Dr. Peter Schramm war Kunsthistoriker, der sich darauf spezialisiert hatte, Probleme mit Kunstwerken zu lösen. Es war kein echter Beruf, den man erlernen konnte; seine Tätigkeit basierte auf einer Mischung aus kunsthistorischem Wissen, Spürsinn, Hartnäckigkeit und einer Portion Glück. Vor allem Letzteres spielte Peter immer wieder interessante Fälle zu. Die attraktive Frau Albiger aus Heidelberg würde er gerne unterstützen. Er liebte es, in alten Lagerhallen mit Antiquitäten zu stöbern. Als er im Sommer nach dem Tod von Frau Albigers Exmann Heidelberg aufgesucht hatte, hatte er sich gemeinsam mit dem zuständigen Kriminalkommissar namens Müller die verschiedenen Lager- und Depoträume des Opfers angeschaut. Sie hatten dort nach dem Porträtgemälde der Magdalena Koepff gesucht, das kein Geringerer als der berühmte Barockmaler Johann Evangelist Holzer gemalt hatte. Dieses Bildnis war nicht nur ein virtuoses Malerstück, sondern auch eine brillante und psychologisierende Erfassung des Charakters und der Persönlichkeit der Frau Koepff, wie Peter aus zeitgenössischen Dokumenten herausgefunden hatte. Holzer war ein Genie, was das Präsentmachen von Menschen anging. Frau Koepff wirkte auf dem Porträt außergewöhnlich real und gegenwärtig. Mit ihren melancholischen graugrünen Augen blickte sie den Betrachter wie durch einen Zeitschleier hindurch an. Selbstbewusstsein und Schwermut, das waren die beiden Pole, zwischen denen sich der Charakter der patrizischen Dame auspendelte.
Peter war Anfang fünfzig, mittelgroß und hatte schütteres braunes Haar. Heute trug er einen dunkelblauen Anzug, schwarze Anzugschuhe und einen dunkelblauen Mantel. Bevor er sein Haus schräg gegenüber der Basilika St. Johann verließ, steckte er sein iPhone in seine rechte Jackettinnentasche, in die andere ließ er sein kleines weißes Büchlein gleiten. In Letzteres schrieb Peter alles Mögliche nieder, was ihm dann bei entsprechenden Gelegenheiten immer wieder wichtige Dienste leistete. Dazu hatte er einen Kugelschreiber parat, den er auf der Straße im Vorbeigehen geschenkt bekommen hatte, ein Werbegeschenk einer großen Volkspartei mit rotem Schriftzug. Peter war im Bistro Oro mit seinem neuen Klienten verabredet und schon sehr neugierig, was dieses Treffen bringen würde. Solche neuen Fälle konnten es in sich haben …
Es war kurz vor zehn Uhr und ziemlich kalt, vermutlich um die null bis drei Grad. Gott sei Dank war der Dezember schneefrei über die Bühne gegangen und der Wetterbericht verkündete bei seinen täglichen Prognosen einen ebensolchen Jahresbeginn. Peter mochte das matschige Schneewetter überhaupt nicht, da man beständig aufpassen musste, wo man hintrat und dass man sich nicht die Hose schmutzig machte. Auch sonst war alles schmuddelig. Außerdem hatte er derzeit kein geeignetes Schlechtwetterschuhwerk. Seine letzten Winterstiefel waren schmählich zugrunde gegangen, als er vor zwei Jahren im verschneiten Schwarzwald in einer Schnapsbrennerei nach einem verschollenen Teppich gesucht hatte und dort in einen Nagel getreten war. Glücklicherweise hatte er sich damals nicht verletzt, aber durch das Loch in der Sohle war immer wieder Wasser eingedrungen, sodass Peter noch auf der Rückfahrt seine Stiefel kurzerhand auf einer Autobahnraststätte entsorgt hatte. Sie waren zudem schon über zehn Jahre alt und ziemlich durchgelaufen gewesen – eine seiner Spezialitäten, das Durchlaufen von Schuhsohlen. Seither hatte er keine Muße gehabt, sich neue robuste »Schneeschuhe«, wie er sie selbst nannte, zu kaufen. Die meisten gefielen ihm einfach nicht, waren zu klobig, unelegant und noch dazu unbequem, obwohl sie einen anderen Eindruck erweckten. Ansonsten missfiel ihm bei den wuchtigen Schneetretern, dass die zumeist stark profilierten Sohlen jeden rußigen Matsch optimal konservierten und man diese Überreste des Trottoirs überall mit hineintragen konnte. Wenn man beispielsweise mittags in ein Restaurant ging, um ein kleines Pfännchen mit Schnecken und Kräuterbutter sowie etwas frische Focaccia zu essen, dann sah es anschließend unter dem Tisch aus, als hätte man eine Schaufel Streusalz mit etwas Schnee angemischt, schwarzbraunes Pigment untergerührt und dann wie ein informelles Relief à la Bernard Schultze rücksichtslos auf dem steinernen Boden verteilt.
Peter stutzte. Es war ungerecht, so dachte er, Schultzes vielfarbige und unheimliche Migof-Schöpfungen mit dieser abscheulichen Wasserdeformation zu vergleichen. Gerne hätte er aber einmal einen Fall mit Kunst aus dem Sektor der informellen Malerei bearbeitet. Hatten Sammler dieser Kunstgattung denn keine Probleme? Oder engagierten sie ganz andere »Kunstdetektive«, da es dann in der Regel um sehr teure und wertvolle Bilder ging? Peter vermutete, dass die Kunstversicherungen maßgeblich ihre Finger im Spiel hatten und dem freien Kunstermittler das Geschäft vermasselten. Jedenfalls waren die Summen, die man bei diesen Kunstwerken ansetzte, ganz andere als bei der sogenannten »alten Kunst«. Peters neuer Fall schien sich in seinem angestammten Terrain des »alten Gelumpses«, wie seine Großmutter gesagt hätte, abzuspielen. So hatte sie historische Gegenstände im Allgemeinen bezeichnet; je nachdem, wie sie das Wortpaar betonte, konnten damit Antiquitäten gemeint sein, aber auch Trödel mit der Tendenz zum Sperrmüll.
Zwischen den Jahren hatte Peter jedenfalls eine kurze E-Mail folgenden Inhalts zu »altem Gelumps« erreicht:
Sehr geehrter Herr Dr. Schramm,
wie bereits bei meiner letzten E-Mail im Sommer angekündigt, erlaube ich mir nun, Ihnen mein Anliegen vorzutragen: Sie wurden mir von einem Freund aus Nürnberg empfohlen. Meine verstorbene Tante aus den USA hat mir kurz vor ihrem Tod ein Päckchen zukommen lassen. Darin fand ich einen seltsamen Silberbecher, ein altes, lädiertes Foto und einen Brief der Tante. Sie schrieb mir, dass ihr Mann diesen Becher nach dem Zweiten Weltkrieg aus München mitgebracht habe und das gute Stück solle nun wieder an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Das habe ihr Mann schon immer so gewollt und jetzt, nachdem er bereits ein Jahr tot sei, habe sie sich endlich zu diesem Schritt entschließen können. Sie habe aber keine Ahnung, wie sie das bewerkstelligen könne.
Könnten Sie mir helfen, den Eigentümer zu ermitteln, um das Vermächtnis meiner Tante zu erfüllen? Ich bin gebürtiger Saarländer, aber ich lebe und arbeite aktuell in Rothenburg ob der Tauber und bin nächste Woche in Saarbrücken, dann könnte ich Ihnen das Objekt mitbringen. Über eine Nachricht von Ihnen würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Paul Gensheimer
Peter hatte die E-Mail ein weiteres Mal durchgelesen, dann hatte er sofort zu seinem iPhone gegriffen und die Nummer seines besten Freundes Moritz gewählt. Dieser lebte in Nürnberg und unterstützte Peter immer wieder bei seinen Recherchen. Während des Augsburger Falls hatte Moritz ihm wahrscheinlich sogar das Leben gerettet, als Peter im Koepffhaus hinterrücks niedergestreckt worden war. Die spektakuläre Entdeckung der Silbercamera hatte sich für beide dann auch in finanzieller Hinsicht als lukrativ erwiesen, denn der Eigentümer des Hauses hatte ihnen als Finderlohn zusammen 120.000 Euro überwiesen. Das war mehr als anständig, sogar großzügig, und hatte dazu geführt, dass Peter vorerst seine finanziellen Sorgen los war. Für Moritz war der Geldsegen allerdings eher ein Danaer-Geschenk, denn er war seit zwei Jahren geschieden und musste dementsprechend einen Großteil des Finderlohnes an seine Ex durchreichen. Nun ja. Wenigstens Moritz’ pubertierende Tochter fand die Entdeckung der Silbercamera und die Rolle, die ihr Vater dabei gespielt hatte, total cool, was Moritz bei ihr einige Pluspunkte eingebracht hatte.
Das iPhone hatte dreimal durchgeläutet, dann meldete sich eine etwas verschlafene Stimme: »Hallo, Peter, schön dich zu hören.«
Es war Moritz, der offensichtlich gerade erst aufgestanden war. Man konnte ihn als phasenweise nachtaktiv beschreiben; in diesen Zeiten wurde er erst dann richtig fit, wenn normale Menschen wie Peter ins Bett gingen, und erledigte allerhand Dinge, die während des Tages von den lästigen Alltagsnotwendigkeiten überlagert wurden.
»Was gebbds?«, schob Moritz noch hinterher.
Der saarländische Nachsatz umfasste im Prinzip mehrere Bedeutungsnuancen innerhalb einer sehr knappen Frage. Es war damit gemeint: Was ist dein Anliegen? Wie kann ich dir behilflich sein? Oder: Wie kann ich dich unterstützen? Brauchst du meine Hilfe? Welches Problem steht im Raum?
»Kennst du einen Paul Gensheimer, der in Rothenburg ob der Tauber arbeitet?«, fragte Peter.
»Da muss ich nachdenken, kannst du mir etwas auf die Sprünge helfen?«
Peter berichtete von der eben eingegangenen E-Mail und der darin enthaltenen Aussage, dass Gensheimer ihn »auf Empfehlung eines Freundes aus Nürnberg« kontaktieren würde. Peter hätte nun zu gerne gewusst, ob Moritz dieser Freund gewesen war. Dem schien aber nicht so zu sein, denn Moritz meinte zögernd: »Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen.«
Nach kurzem Nachdenken fügte er an: »Was ist denn ein ›seltsamer Silberbecher‹?«
Moritz hatte zwar auch Kunstgeschichte studiert, aber er befasste sich mehr mit der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Die ältere Kunstgeschichte und vor allem auch Kunstgewerbe waren eher Peters Metier.
»Nun ja«, meinte dieser, »bestimmte im 18. Jahrhundert gängige Formen sind heutzutage vollkommen unbekannt. Auf ganz einfacher Ebene zum Beispiel der Kugelfußbecher, ein zylindrischer Becher, der auf mindestens drei Silberkugeln ruht. Ich denke aber auch an komplexere Gefäße, nämlich allerlei Scherzgefäße, Pokale in Birnen- oder Ananasform, Rhinozerosse, Affen, Hirsche und, nicht zu vergessen, Elefanten. Man kann aus allen trinken. Manchmal sind es sogar Automaten, die über die Tafel fahren und sich einen Gast aussuchen, der das Gefäß auszutrinken hat. Die Silberschmiede waren sehr kreativ; es gibt vielerlei Trinkspäße aus der Renaissance- und Barockzeit!«
»Wo du gerade Trinkspäße erwähnst. Vor einiger Zeit habe ich mit unserem Freund Dr. Markus Nillert in einer Kneipe aus einem riesigen dunkelgrünen Glasrömer aus dem 19. Jahrhundert etliche Schlucke Silvaner getrunken. Wie du weißt, betreibt er eine große Anwaltskanzlei hier in Nürnberch.« Moritz veränderte absichtlich das G in ein CH, um sich über den fränkischen Dialekt etwas lustig zu machen. »Dabei hat er mir erzählt, dass ein Bekannter, der als Pharmavertreter arbeitet, einen Kunstgegenstand geerbt hätte. Vermutlich hat mir der Silvaner die Sinne etwas vernebelt, aber ich meine, er hätte erwähnt, dass der in Rothenburg arbeiten würde. Ganz genau weiß ich es nicht mehr.«
»Vielleicht könntest du Markus noch mal fragen? Ich treffe Gensheimer nächste Woche.« Peter hatte stets gerne einige Informationen über seine Klienten in petto; man wusste ja nie, ob und wie man diese einmal gebrauchen konnte. Außerdem stand stets die Frage der Liquidität seiner Auftraggeber im Raum.
Im Anschluss tauschten sich die beiden Freunde noch über ihre neuesten Aktivitäten aus und verabschiedeten sich dann. Peter setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und antwortete Herrn Gensheimer, dass sie sich gerne am folgenden Montag treffen könnten. Dieser saß offenbar auch gerade am PC und antwortete prompt. Sie verabredeten sich also um zehn Uhr im Oro am St. Johanner Markt.
Als sich Peter dem St. Johanner Marktbrunnen näherte, blickte er linkerhand zur Alten Brücke, die ihn schon seit seiner Kindheit faszinierte, da deren sandsteinerne Bögen plötzlich aufhörten und in einen unansehnlichen Steg übergingen. Er blieb kurz stehen und folgte mit seinem Blick dieser Sichtachse, die der nassau-saarbrückische Generalbaudirektor Friedrich Joachim Stengel mit städteplanerischer Absicht konzipiert hatte; das wusste Peter aus seinem Studium. Ziel Stengels war es gewesen, die hiesige St. Johanner Seite mit ihrem Marktbrunnen optisch mit der damaligen protestantischen Hofkirche, der Ludwigskirche auf der Saarbrücker Seite, zu verbinden. Vom Brunnen aus sah man nämlich genau den Turm dieses großartigen Bauwerks. Heute war allerdings nur noch das oberste Glockengeschoss zu erkennen, da die wenig geistreichen Stadtplaner der Nachkriegszeit genau in diese Achse den modernen Riegel des Wirtschafts- und Finanzministeriums gesetzt hatten. Eine wahrhaft brillante Staatsidee, einen Riegel der obersten Geldverwaltung vor die Kirche zu schieben, dachte sich Peter und schüttelte den Kopf über diese Form von städtebaulichem Unsinn. Die Nachkriegsignoranten hatten zudem auch den Steg an der Alten Brücke verbrochen, denn sie hatten doch tatsächlich einen großen Teil des historischen Schlossfelsens wegsprengen lassen, um eine Autobahntrasse zu bauen, sodass die Brücke nun im Nichts endete. Ein unglaublicher Vorgang! Ebenso unglaublich wie die Tatsache, dass die nunmehr sogenannte »Stadtautobahn« auf Saarniveau gelegt wurde. Daraus entstand das Rätsel: Nebenfluss der Saar mit dreizehn Buchstaben: S-t-a-d-t-a-u-t-o-b-a-h-n. Es war in der Tat die einzige Autobahn weit und breit, die Schranken an den Zufahrtstraßen besaß, welche man bei Hochwasser herunterließ. Ein besonders schlimmes Hochwasser – an das sich Peter erinnerte – ereignete sich kurz nach der Jahreswende 1993, als das Wasser auf einen Höchststand von 9,36 Meter stieg! Damals war der halbe St. Johanner Markt abgesoffen, überall stand das Wasser kniehoch, sämtliche Keller liefen voll. Man musste Slalom um die vielen ausgelegten Schläuche und die aus dem Keller geräumten Dinge – überwiegend Sperrmüll – laufen. Peter hatte zu jener Zeit an der Saarbrücker Universität Kunstgeschichte sowie Klassische Archäologie studiert und mit einem gewissen Schauder das chaotische Treiben in der Stadt beobachtet. Besonders schockierte ihn, dass das kleine Antiquariat nahe dem Brunnen ebenfalls heftig zu kämpfen hatte. Dort schwammen schon wertvolle Grafiken im Wasser. Peter entschloss sich spontan zu helfen und trug gemeinsam mit dem Inhaber und einigen anderen Freiwilligen Bücherkisten, Schubladen aus Planschränken und vieles mehr in den ersten Stock. Zum Dank bekam er einen Holzschnitt von Hans Schäuffelein aus dem 16. Jahrhundert mit einer Darstellung der Heiligen Veronika und den Heiligen Petrus und Paulus geschenkt. Er mochte die Kleinteiligkeit der Darstellung und die ikonenhafte Archaik der sakralen Komposition sehr.
Peter erreichte das Oro. Das Bistro war in einer Ecke des St. Johanner Marktes gleich neben dem großen Gebäudekomplex Zum Stiefel gelegen, dem Stammhaus einer alten Brauerei. Früher war hier einmal Haucks Weinstube gewesen, das letzte Weinlokal in der Innenstadt, das von einem freundlichen Holländer betrieben worden war. Viele Saarländer tranken aber lieber Bier, was Peter nicht nachvollziehen konnte. Er betrat den mit dunklem Holz ausgestatteten Innenraum um kurz vor zehn, ging mehrere Stufen nach links in den Nebenraum und setzte sich dort an einen kleinen Tisch am Fenster, sodass er alle Eintretenden im Auge haben konnte. Gestern Abend hatte ihn Moritz gegen zwanzig Uhr nochmals angerufen und ihm mitgeteilt, dass er, Moritz, mit seiner Vermutung richtig gelegen hatte.
»Gensheimer ist Pharmavertreter«, hatte er ausgeführt. »Er muss wohl ganz gut verdienen. Sein Steckenpferd sind historische Kräuterbücher, die das medizinische Wissen der Renaissancezeit erstmals zwischen zwei Buchdeckel brachten. Die Gründerväter der medizinisch-botanischen Wissenschaft sind Otto Brunfels, Leonhard Fuchs und Hieronymus Bock. Letzterer scheint Gensheimer besonders zu interessieren, da dein potenzieller neuer Klient auch der erste Vorsitzende der Deutschen Hieronymus-Bock-Gesellschaft ist.«
Peter hörte interessiert zu und wunderte sich über Moritz’ exakte Kenntnisse. Als würde dieser seinen Gedanken ahnen, meinte er: »Das habe ich alles im Internet nachgelesen. Interessanterweise tangiert Hieronymus Bock übrigens auch Saarbrücken. Nachdem er im Herzogtum Zweibrücken und dem Kloster Hornbach gewirkt hatte – er stand dem Protestantismus nahe – kam er um 1550 als Leibarzt zu Graf Philipp II. von Nassau-Saarbrücken. Er legte das Kräutergärtchen am alten Saarbrücker Renaissanceschloss an. 1539 erschien dann bei Wendel Rihel in Straßburg erstmals sein Kreutter Buch, das in den folgenden Jahren viele Auflagen erfuhr.«
Er würde viel Gesprächsstoff mit Gensheimer haben, dachte sich Peter und notierte schnell die Fakten in sein kleines weißes Büchlein. Nach einer kurzen Pause fuhr Moritz fort: »Gensheimer muss ein juristisches Problem haben. Mehr wollte Markus nicht sagen. Gensheimer habe ihn beiläufig nach einem Kunsthistoriker, einem Spezialisten, gefragt, der sich mit Silber auskennt. Da hatte sich Markus an unsere Geschichte erinnert und deinen Namen genannt. So kam Gensheimer also auf dich.«
Froh über dieses Hintergrundwissen, verabschiedete sich Peter mit der auf viele etwas irritierend wirkenden saarländischen Formulierung »ala«, was so viel meint wie »à la prochaine«, »bis zum nächsten Mal«, die Moritz prompt erwidert hatte.
Peter bestellte einen Cappuccino bei einem zurückhaltenden jungen Kellner, den er schon öfter im Oro gesehen hatte, nahm sein iPhone aus der rechten Jackettinnentasche und legte es auf den Tisch. Dabei schaute er kurz auf die Uhr und wollte sich gerade um seine E-Mails kümmern, als er einen schlaksigen, großen Herrn mit grauen, etwas längeren Haaren und einem silbernen Brillengestell der 80er-Jahre auf der Nase bemerkte. Der Herr sah sich mit ausladender Gestik im Bistro um, als wolle er zeigen, dass er seine Verabredung suchte. In seiner linken Hand trug er eine altmodische, ziemlich ausgebeulte lederne Aktentasche, die er leicht pendelnd entlang der Bistrotische schwang. Als er Peter erblickte, riss er seine Augenbrauen fragend empor, senkte sein Kinn ein wenig ab und kam dann schnurstracks auf ihn zu.
»Heureka!«, rief er aus. »Gensheimer mein Name.«
Er hievte seine Tasche auf einen freien Stuhl, streifte seinen dunkelbraunen Mantel umständlich ab und streckte Peter seine Hand entgegen. Dieser antwortete gelassen: »Schramm, guten Morgen.«
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, ich habe bereits viel von Ihnen gelesen, die Zeitungen waren ja voll davon! Was für eine Entdeckung, so ein Silberschatz, der Jahrhunderte unberührt vor sich hinschlummerte. Nur schade, dass Sie nicht auch noch eine versteckte Bibliothek gefunden haben! Solche Patrizierhaushalte hatten immer auch gut ausgestattete Bibliotheken. In Augsburg sind viele dieser Bestände glücklicherweise in die Staats- und Stadtbibliothek gewandert, deren Gründung in die Renaissancezeit zurückgeht. Sie beherbergt großartige Schätze, unter anderem auch Kräuterbücher, die Vorläufer unserer medizinischen Literatur.« Hier machte Gensheimer eine Pause, setzte sich auf einen Bistrostuhl Peter gegenüber und rückte seine Brille gerade, indem er mit dem Zeigefinder das Gestell knapp unter dem Querbügel hochschob. »Solche Sternstunden erlebt man selten …«
»In der Tat, die Entdeckung der silbercamera war eine unglaubliche Überraschung. Es war überwältigend.«
Gensheimer gehörte zu derjenigen Spezies von Leuten, das wurde Peter schon nach diesem Intro klar, die am liebsten ununterbrochen redeten und stets bestrebt waren, ihr ganzes Wissen auszubreiten und wem auch immer mitzuteilen – zumeist ohne Rücksicht auf Verluste und potenzielle Opfer. Peter kannte einige Exemplare dieser Gattung, allen voran seinen Vater, den Kunstgeschichtsprofessor – Gott habe ihn selig. Daher wusste er nur zu gut, dass es solche Personen sozial gesehen recht schwer hatten, da sich nur wenige Menschen mit ihnen abgaben oder nur noch diejenigen, die ein fachliches Interesse mit dem Kontakt verknüpften und daher die Tortur des Wortergusses bereitwillig hinnahmen. Für Peter war diese Persönlichkeitsstruktur sofort erkennbar und das, obwohl Gensheimer ihn erst einmal hatte zu Wort kommen lassen, was sonst eher untypisch für diesen Menschenschlag war. Gensheimers Interesse am Gegenüber diente dazu, eine Reflexion auf sich zu erzeugen; insofern dauerte es keine zwei Sekunden nach Peters Wortmeldung und er legte los.
»Hören Sie!«, begann er im Imperativ seine Geschichte, die er in groben Zügen schon in seiner E-Mail umrissen hatte. Neu waren aber folgende Informationen:
Der Mann der verstorbenen amerikanischen Tante hieß Jimmy Ross und war bei Kriegsende in München im Einsatz gewesen. Ab Juni 1945 war er als Fahrer tätig und wurde bei den Kunsttransporten eingesetzt, mit denen die aus ganz Süddeutschland zusammengetragenen Schätze nach München gebracht wurden. Der Munich Central Collecting Point, die zentrale Sammelstelle für Süddeutschland, war damals sinnigerweise im ehemaligen Führerbau und im ehemaligen Verwaltungsbau der NSDAP am Königsplatz untergebracht; später kam das Prinz-Carl-Palais am Englischen Garten hinzu. Dort wurden all diejenigen Kunstschätze zusammengeführt, die die Nazis in Bunkern und Stollen verborgen hatten, um sie vor den Luftangriffen zu schützen. Sie stammten aus den unterschiedlichsten privaten und öffentlichen Sammlungen, waren zusammengeraubt oder gekauft, räuberisch erpresst oder sonst irgendwie dort hingekommen. Bei einem dieser Transporte aus Berchtesgaden hatte Ross den besagten Becher an sich genommen und in seiner Brotzeittasche versteckt.
Inzwischen hatte die dezente Bedienung, ein fast schüchtern wirkender junger Mann, der einen kurz geschnittenen Bart und kammartig gegeltes schwarzes Haupthaar trug, es geschafft, die Aufmerksamkeit der beiden Herren auf sich zu lenken. Gensheimer bestellte wie Peter einen Cappuccino und dazu kam ein Croissant, das im Oro wirklich ausgezeichnet schmeckte. Spontan schloss sich Peter an.
Dann fuhr Gensheimer ohne Punkt und Komma fort: »Stellen Sie sich vor, was waren das für unruhige Zeiten! Mein Onkel musste durch ganz Bayern fahren, Stollen und geheime Verstecke aufsuchen und die dort verbliebenen Kunstwerke einladen. Diese Orte waren zum Teil nichts anderes als feuchte Löcher! Den Nazis war doch jedes Versteck recht. Da ist sicher viel kaputtgegangen, denn Nässe ist für so gut wie jedes Material pures Gift. Die Leinwand oder Holzträger der Gemälde sind wie sensible pharmazeutische Substanzen, sie quellen bei Feuchtigkeit wie Schwämme auf, auch Holzskulpturen sind sehr wasseraffin, selbst für Metallobjekte ist Feuchtigkeit pures Gift. Eisen rostet schneller weg, als man zuschauen kann. Insofern hatte sich mein Onkel zu einer kleinen Rettungsaktion hinreißen lassen.«
Peter stutzte ein wenig über diese seltsame Form der Beschönigung eines Diebstahls. Er hatte inzwischen in aller Seelenruhe sein kleines weißes Büchlein aus seinem Jackett gezogen. Nun schlug er es auf, nahm den weißen Kugelschreiber mit der roten Aufschrift zur Hand und begann, sich einige Notizen zu machen.
»Sie meinen also, Ihr Onkel hätte den Becher vor den Unbilden der unsicheren Zeiten und der schlimmen Lagerzustände gerettet?«, warf er mit unschuldigem Blick ein und dachte bei sich, dass diese Darstellung an Dreistigkeit kaum zu überbieten war.
»Nun ja, ich meine, er hatte den Becher …«, Gensheimer zögerte ein wenig, »aus einem feuchten Stollen entnommen.«
Er rudert also immerhin ein klein wenig zurück, dachte Peter.
»In einem der Dokumente, die mein Onkel hinterlassen hat, beschreibt er einen halb zusammengestürzten Stollen, der nur noch verschimmelte Leinwandfetzen und Bruchstücke von Goldrahmen enthielt. Am Ende dieses ziemlich kurzen Stollens fand er eine verrottete Holzkiste, in der ein eingewickelter Gegenstand lag. Er ließ das Ding, von dem er gar nicht genau wusste, was es war, einfach in seinen Rucksack gleiten.«
Peter notierte sich die Einzelheiten des Diebstahls. Es würden wohl keine weiteren Informationen zu den Fundumständen mehr folgen. Er brachte daher in einer kleinen rednerischen Verschnaufpause, die daraus resultierte, dass Gensheimer in sein Croissant biss, das Gespräch auf das Fundobjekt.
Gensheimer griff den Ball sofort auf und verkündete recht pathetisch: »Also werde ich Ihnen jetzt das kostbare Objekt im Original zeigen!«
Er wartete noch ein wenig ab, sodass Peter sich von seinen Worten beeindruckt zeigen konnte, dann griff er zu der ausgebeulten Aktentasche, die oben mit einem Zahlenschloss gesichert war. Gensheimer stellte in schneller Folge die Kombination von vier Zahlen ein, wobei die Eile offenbar daher rührte, dass er vermeiden wollte, dass sich Peter die Kombination einprägte, woran dieser natürlich nicht im Entferntesten dachte. Ein Zahlenschloss bei einer Ledertasche war sowieso ziemlich überflüssig. Dann ließ Gensheimer das Schloss aufspringen und entnahm mit einem Griff das in ein leichtes Packpapier eingeschlagene Objekt, legte es auf den Tisch, stellte die Tasche zu Boden und begann, das Papier langsam aufzuwickeln. Peter schob in der Zwischenzeit die Cappuccino-Tassen und die Teller für die Croissants etwas beiseite.
Zuerst konnte er nur einen silbernen Bügel erkennen, dann erschien eine Frauengestalt mit langem Rock. Sie hatte ihre Arme erhoben und hielt mit ihren Händen einen kleinen Becher, der lose bzw. beweglich zwischen ihren beiden Armen eingehängt war. Peter erkannte das Objekt sofort: Der »seltsame Becher« war ein sogenannter »Brautbecher« oder auch »Jungfernbecher«. Dieser bestand aus zwei Gefäßen oder Bechern, die so miteinander verbunden waren, dass Braut und Bräutigam gleichzeitig trinken konnten. Die Frauengestalt mit dem langen Rock war dabei der große Becher für den Herrn, der zweite, deutlich kleinere Becher, der von ihr frei schwebend über dem Kopf gehalten wurde, war für die Dame. Peter war fasziniert von diesem Trinkspiel, das in früheren Jahrhunderten offenbar sehr beliebt gewesen war. Solche Becher, so wusste er, wurden aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt; besonders gern wurden Silber, Glas und Zinn verwendet. Hier also ein Silberbecher in sehr guter Qualität. Peter ergriff den Becher, erläuterte dessen Funktion und nahm seine Brille ab, um nach den Silbermarken am unteren Rand des großen Bechers zu suchen. Es fanden sich ein Nürnberger Stadtbeschauzeichen sowie ein Meisterzeichen, ferner war ein Tremolierstich zu erkennen. Das Stadtbeschauzeichen war in Nürnberg ein »N«, das Meisterzeichen undeutlich; es sah aus wie ein Rad. Der Tremolierstich war üblicherweise eine Zickzacklinie, da er die Entnahme eines kleinen Spans andeutete, der dazu diente, die Wertigkeit des Silbers zu prüfen. Solche zackigen Linien entwickelten sich im Laufe der Zeit zum Qualitätskriterium von Silber schlechthin.
»Dürfte ich mir ein Arbeitsfoto machen?«, fragte Peter, woraufhin Gensheimer antwortete, dass dies doch ganz selbstverständlich sei.
Peter griff in seine rechte Jackettinnentasche, zog sein iPhone hervor und fotografierte den Becher, dann stellte er die Makrofunktion ein, um die Markenlandschaft, die sich recht dominant am Saum des Rockes ausbreitete, zu dokumentieren. Anschließend erkundigte er sich nach dem historischen Foto, das dem Becher in dem Paket beigefügt gewesen war, wie Gensheimer in seiner E-Mail erwähnt hatte. Was hatte es damit wohl auf sich?
Sein neuer Bekannter griff erneut in die Aktentasche und kramte ein ziemlich ramponiertes Foto hervor, etwa in den Maßen fünfzehn mal fünfundzwanzig Zentimeter. Es zeigte einen Innenraum mit einem Tisch und zwei Biedermeierstühlen, links war eine barocke Schrankaufsatzvitrine erkennbar. In dieser Vitrine befand sich eine Vielzahl von verschiedenen kunstgewerblichen Objekten. Peter fotografierte die Abbildung und studierte dann das Original genauer. Die Vitrine stand in einem großbürgerlichen Raum mit Parkett und hoher Decke, das Fenster neben der Vitrine war offen und man sah auf eine breite, großstädtische Straße, die von Bäumen gesäumt war; weit im Hintergrund waren einige Laternen und eine historistische Häuserzeile zu sehen. Diese Straße müsste man identifizieren können, dachte sich Peter, ohne aber eine Idee zu haben, in welcher Großstadt das Foto wohl gemacht worden sein könnte. Dann drehte er es um, während Gensheimer ausführlich über historische Fotografien schwadronierte. In einer Ecke des Bildes fand Peter einen undeutlichen Schriftzug, den man nicht richtig lesen konnte. Einzig …vuestraße war halbwegs deutlich erkennbar.
Peter war nun einigermaßen überrascht. Das Foto zeigte in der Vitrine eindeutig den Becher aus dem Stollen. War das also die Wohnung des Vorbesitzers? War dies eine erste Spur? Sicher waren Becher und Foto nicht gemeinsam im feuchten Stollen aufbewahrt worden, sonst wäre Letzteres vermutlich vergammelt. Beide Objekte mussten zu einem späteren Zeitpunkt zueinander gefunden haben. Vielleicht hatte ja Ross, Gensheimers Onkel, selbst schon eine Spur aufgenommen, um den Vorbesitzer des Bechers zu finden?
»Woher stammt eigentlich das Foto?«, wollte Peter nun mit einem Seitenblick auf Gensheimer wissen, doch dieser ließ sich in seinem Vortrag über fotografische Techniken nicht beirren.
»Haben Sie eine Idee, welche Straße hier wohl gemeint sein könnte?«, warf Peter hartnäckig ein. Wieder ohne Erfolg. Statt eine Antwort zu geben, setzte Gensheimer einfach seinen Vortrag über die Rückseiten der vielfältig bedruckten Kartons der Carte-de-Visite-Fotografien aus dem vorletzten Jahrhundert fort, deren Firmensignets oft künstlerische Qualitäten hätten, wie er meinte.
Peter kapitulierte; er wusste, dass von seinem Klienten keine weiteren Sachinformationen zu erhalten waren. Das vorliegende Foto hatte keine bedruckte Rückseite, da es sich eben nicht um einen auf Karton montierten Abzug handelte, so wie das bei den Carte-de-Visite-Fotografien der Fall war. Vielmehr lag ihnen hier ein Abzug vor, der von einem professionellen Fotografen angefertigt worden sein musste, da dem Foto jedes Schnappschussmäßige fehlte, bei dem jemand eine Ortsangabe auf der Rückseite notiert hätte.
Während Peter darüber sinnierte, zählte sein »Gesprächspartner« eine Reihe berühmter Fotografen auf, darunter das Münchner Atelier Elvira, das in Augsburg ebenfalls tätig war, aber auch das Saarbrücker Fotostudio Rembrandt fand Erwähnung. Peter hatte nun Mühe zu folgen. Er würde Gensheimer später nochmals zur Herkunft des Fotos befragen.
Schließlich krönte dieser seinen Vortrag mit den Worten: »Das Gebiet der Carte-de-Visite-Fotografie ist bis heute vollkommen unerforscht. Viele nutzen die kleinen Pretiosen gerne als Quellen für ihre Forschungen, aber wer hat denn dieses Feld unter wissenschaftlichen Kriterien, seien es kunsthistorische, technik- oder sozialgeschichtliche Fragestellungen, bisher untersucht? Es sind vor allem die Familienforscher, die daran Interesse haben, aber immer nur dann, wenn der Abgebildete auch zu identifizieren ist. Was ist mit den Tausenden anonymer Fotos, die kursieren? Auch die haben doch eine historische Relevanz. Die Familienforscher bauen die Gesichter nur gerne in ihre ausufernden Stammbäume ein, sodass ihre Datenwüsten etwas anschaulicher werden. Aber ich sollte mich nicht allzu negativ über diese Forscherspezies äußern, sie sind auch sehr hilfreich …«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Peter.
»Mir ist es nämlich gelungen, den Stammbaum des berühmten Botanikers Hieronymus Bock zu rekonstruieren! Und in diesem Zusammenhang sind auch einige unbekannte Carte-de-Visite-Fotografien aufgetaucht. Kennen Sie Hieronymus Bock, man nannte ihn auch Trágos?«
Peter war insgeheim froh, dass Gensheimer nun zu einem Thema kam, das ihn wirklich interessierte. Natürlich hatte er den Namen des Botanikers nicht zum ersten Mal gehört, als Moritz ihn am Telefon erwähnt hatte. Den Spitznamen Trágos konnte er sich allerdings nicht erklären. Hörte sich irgendwie griechisch an.
»Der Ziegenbock«, sagte Gensheimer, der anscheinend Peters verwirrten Blick bemerkt hatte, triumphierend und grinste derart breit, dass seine gelblichen, schräg stehenden Zähne sichtbar wurden. »Gelehrte gaben sich im 16. Jahrhundert gerne gräzisierende Spitznamen. Bock studierte in Heidelberg, wo er sich 1519 immatrikulierte. 1522 erhielt er eine Anstellung als Lehrer und Botaniker in Zweibrücken, später wurde er Leibarzt Herzog Ludwigs, der ein alter Säufer war und den Bock nicht mehr aus seiner Sucht erretten konnte. Dann ging Bock nach Hornbach, wo er Prediger an der ehemaligen Benediktinerkirche St. Fabian wurde und auch heiratete. Sein Kräuterwissen war legendär. Er reiste quer durch ganz Europa, immer auf der Suche nach Pflänzchen, die er nicht kannte. Das alles fasste er in seinem berühmten Kräuterbuch zusammen.«
»… das 1539 bei Wendel Rihel in Straßburg in deutscher Sprache erschien«, ergänzte Peter die Ausführungen. »Es war aber ohne Illustrationen gedruckt worden. Ein echter Ladenhüter«, setzte er recht lapidar nach und aß den letzten Zipfel seines Croissants genüsslich auf.
Wenn Gensheimer von Peters Detailwissen überrascht war, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken, sondern fuhr einfach fort, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass man über die Druckausstattung von frühen Büchern Bescheid wusste.
»In der Tat konnte dieses Manko recht schnell in der zweiten Auflage behoben werden. Die erschien jedoch erst sieben Jahre später, 1546. Bock beschreibt in seinem Buch achthundertsechs Pflanzen, einfach phänomenal, davon vierundzwanzig ausländische und zweihundertsiebenundzwanzig kultivierte Pflanzen. Dabei ging er unglaublich breit angelegt vor, er beschrieb die Morphologie der Pflanzen, damit man sie auch gut erkennen konnte, manchmal nannte er sogar Fundorte. Ganz wichtig war ihm die ›krafft und würckung‹ der Kräuter, also deren medizinisch-pharmazeutische Relevanz. Er hatte viele Erkenntnisse der Volksmedizin einfließen lassen, also das Wissen der einfachen Bauern, Tagelöhner und Landarbeiter. Als Naturwissenschaftler misstraute er jedoch jedem Aberglauben und war sehr skeptisch bei solchen Überlieferungen. Das Buch wurde in den nächsten Jahrzehnten immer wieder nachgedruckt, verändert und aktualisiert.«
Peter blickte nachdenklich zum St. Johanner Marktbrunnen, wo sich eine Touristengruppe versammelt hatte. Der kahlköpfige Führer sprach offenbar sehr enthusiastisch von der Geschichte St. Johanns und war gerade dabei, das Stengel’sche Sichtachsensystem zu erläutern, was seinen ausschweifenden Gesten zu entnehmen war. Peter war froh, dass solche historischen Informationen weitertransportiert wurden. Vielleicht blieb ja bei dem einen oder anderen Touristen etwas hängen?
Aber er durfte seinen neuen Klienten nicht vergessen. Peter wandte den Blick von den Touristen ab und fügte elegant an: »Das Bock’sche Kräuterbuch war eine erste botanische Enzyklopädie, die sich an die Allgemeinheit richtete, eine neue Käuferschicht, die es satthatte, nur lateinische Schriften lesen zu müssen. Für mich stellt sich vor allem die Frage, welche Beziehung die Illustrationen zur Wirklichkeit haben. Illustration kommt aus dem lateinischen illustrare, was so viel wie ›erhellen‹ oder ›ans Licht bringen‹ meint. Der Künstler hatte mit dem Zwiespalt zwischen Naturtreue und künstlerischem Empfinden zu kämpfen. Die Frage ist doch: Kannte der ausführende Illustrator die Pflanzen wirklich und vermochte er diese dann auch entsprechend ihrer Morphologie und ihres ganzen Habitus wiederzugeben? Oder nahm er sich ältere Zeichnungen, Arbeiten von Kollegen und schon vorhandene Illustrationen zum Vorbild?«
»Das ist in der Tat eine sehr interessante Überlegung. Die Illustrationen wurden von David Kandel hergestellt, es waren Holzschnitte, die sicherlich nicht immer der Wirklichkeit entsprachen, da sie zum Teil auch sehr stark idealisiert waren. Das haben mir schon einige Botanikerkollegen bestätigt.« Gensheimer machte eine kleine Pause. »Manchmal wurden die Pflanzen und die Textabschnitte auch vertauscht, was fatale Folgen haben konnte. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Fingerhut oder andere giftige Pflanzen, weil Sie denken, dass sie eine ganz andere Wirkung hätten. Das konnte ziemlich schiefgehen!«
Peter überlegte, wie viele Menschen Hieronymus Bock wohl auf dem Gewissen hatte. Darüber nachsinnend, winkte er dem Kellner und ließ noch einen kleinen Vortrag über das in Basel 1543 gedruckte New Kreutterbuch von Bocks Zeitgenossen Leonhard Fuchs, der auf dessen Wissen aufbaute, über sich ergehen. Dann zahlte er und trennte sich nach einigen wortreichen Verabschiedungsfloskeln von Gensheimer. Zuvor allerdings gab dieser Peter noch seine Visitenkarte und sie verabredeten, dass sie demnächst telefonieren wollten.
Als er über den St. Johanner Markt zurückging, musste Peter erst einmal durchatmen. Er genoss die Ruhe und war froh, den anstrengenden Zeitgenossen wieder losgeworden zu sein – natürlich nur vorübergehend, denn der Fall war ja grundsätzlich interessant, sodass er ihn selbstverständlich angenommen hatte. Über das Honorar waren sie sich ohne größere Diskussion einig geworden. Die Summe war vollkommen in Ordnung. So spannend wie die Suche nach der Silbercamera würde die Sache mit dem Becher sicher nicht werden, aber das war ja vielleicht auch ganz gut so.
Gemütlich schlendernd bog Peter in die Katholisch Kirchgasse ein und blickte nun frontal auf die Fassade der Basilika St. Johann, der katholischen Pfarrkirche, die eigentlich gar keine Basilika war. Es handelte sich vielmehr um eine barocke Saalkirche, die architektonisch weit von einer echten Basilika entfernt war, denn eine solche verfügte über mehrere Kirchenschiffe, wobei das mittlere die anderen überragen und einen sogenannten Obergaden ausbilden musste. Ferner brauchte eine Basilika einen längs gerichteten Grundriss. Die St. Johanner Pfarrkirche hatte außer der Längsgerichtetheit des Saals keines dieser Merkmale aufzuweisen. Sie war 1975 von Papst Paul VI. zur »Basilika« ernannt worden, das wusste Peter, und es verwunderte ihn natürlich. Der Papst konnte offenbar architektonische Grundsätze außer Kraft setzen. Somit war St. Johann eine Basilika ehrenhalber, honoris causa.
Nebenbei handelte es sich auch um das katholische Hauptwerk im evangelischen Fürstentum Nassau-Saarbrücken, erbaut durch den nassau-saarbrückischen Generalbaudirektor Friedrich Joachim Stengel und 1758 mit großem Pomp eingeweiht. Der Fürst ließ eine top organisierte Promo-Aktion durchführen, um Spenden von und für die Katholiken einzusammeln. Sogar der französische König Ludwig XV. spendete 20.000 Franken und der Papst führte in Rom eine Kollekte durch, bei der 5.367 Franken zusammenkamen. Diverse geistliche Kurfürsten sowie verschiedene katholische Städte spendeten insgesamt 16.108 Franken, der Deutsche Orden gab 2190 Franken, die Herzogin von Polen 2.000 Franken; nicht zu vergessen der Bischof von Metz, der brachte allerdings nur 1.000 Franken zusammen, obwohl das Vorgängerkirchlein im 7. Jahrhundert immerhin mutmaßlich durch Bischof Arnulf von Metz gegründet worden war. Das war alles in allem ganz praktisch für den protestantischen Kleinherrscher Wilhelm Heinrich; so brauchte er selbst nur das Holz zu spenden, das zudem aus seinen Privatwaldungen kam. Ganz schön clever, der protestantische Fürst.
Peter mochte den gut proportionierten Turm mit den beiden flankierenden Figuren der Fides und Spes und vor allem den rot geflammten Sandstein – ein Voltzien-Sandstein, wie ihm ein Professor für Mineralogie einmal erklärt hatte. Vor allem die Unruhe, die dieser gemusterte Sandstein in die Fassade einbrachte, bewunderte Peter sehr, denn die Gliederungselemente der Pilaster wirkten so ganz verschwommen. Die Klarheit der Architekturgliederung wurde wie mit einem Radiergummi verwischt. Großartig, dachte sich Peter beim Anblick der seitlichen Streifen im Sonnenlicht.
In Gedanken noch ganz bei diesem Phänomen, griff Peter in seine rechte Hosentasche, zog seinen kleinen Schlüsselbund hervor und bog rechts ab, um seine hölzerne Haustür zu öffnen. Er klopfte seine Schuhe an der schmalen Stufe ab, die in sein mittelalterliches Häuschen führte, trat in den kleinen, quadratischen Flur, hängte seinen Mantel an die Garderobe und begann dann mit der Essenszubereitung. Es gab »Roschdische Ritter« nach einem Neunkircher Familienrezept und dazu Kartoffelsuppe, ein sehr einfaches und schmackhaftes Arbeiteressen. Peter hatte gestern bereits zwei Milchbrötchen gekauft, bei denen er nun erst einmal die Kruste mit einer Reibe abrieb. Dann weichte er die Brötchen in einem flachen Suppenteller in etwas Milch ein. In der Zwischenzeit stellte er die mittlere Gasflamme an, um die Kartoffelsuppe, die er gestern bereits zubereitet hatte, aufzuwärmen. Als Nächstes nahm er die Brötchen aus dem Suppenteller, mischte Paniermehl mit dem Brötchenabrieb und wendete die Brötchen darin. Seine aus Neunkirchen stammende Großmutter hatte diesen Vorgang als »wenzeln« bezeichnet – »wenzel die Breedscher im Panniermähl«, hätte sie ihm zugerufen. Nun setzte Peter eine Pfanne auf, zerließ etwas Butter darin, gab ein wenig Sonnenblumenöl dazu und briet die panierten Milchbrötchen kräftig an. Währenddessen nahm er einen Teller aus dem Schrank, mischte etwas Zucker und Zimt und stellte diese Mischung griffbereit neben den Herd.
Inzwischen waren die Brötchen schön braun, er nahm sie aus der Pfanne und »wenzelte« sie in der Zucker-Zimt-Mischung, bis sie ordentlich rostig aussahen. »Roschdische Ritter« hießen in anderen Regionen auch »arme Ritter«. Hier war das Saarländische wieder einmal präziser und beschreibender, denn der »rostige Ritter« meinte einen Ritter, dessen Rüstung verrostet war – und er damit auch arm. Es duftete jedenfalls köstlich, genau wie bei Großmutter, die dieses Gericht gerne samstags zubereitet hatte. Peter öffnete einen feinherben Riesling von Van Volxem, jenem Weingut in Wiltingen an der Saar, das durch Roman Niewodniczanski, der der Bitburger Bier-Dynastie entstammt, wieder zur Blüte geführt worden war. Das Weingut hatte schon nach der Säkularisation einem Bierbrauer gehört, dem Trierer Brauer Gustav van Volxem. Bier und Wein schienen sich bei diesem Weingut immer wieder zu kreuzen. Jedenfalls harmonierte die Restsüße des Rieslings ganz ausgezeichnet mit den gezuckerten Milchbrötchen. Es schmeckte einfach klasse!
Während Peter aß, schlug er die aktuelle Saarbrücker Zeitung auf und entdeckte auf Seite vierzehn ein Foto des ehemaligen Sportfunktionärs und Gourmands Reiner Calmund. Ihn hatte er als Letzten auf seiner Liste der bekannten Saarländer ergänzt, da Calmund vor ein paar Jahren nach Saarlouis gezogen war. Auf der Liste standen aber auch so illustre Namen wie Frank Farian, der Produzent von Boney M. und Milli Vanilli; Cindy und Bert; Heinz Becker alias Gerd Dudenhöfer; Erich Honecker und die vielen saarländischen Bundespolitiker von Heiko Maas über Simone Peter bis hin zu Peter Altmaier. Peter hatte sich jedoch noch nicht dazu durchringen können, auch Patrizia Kaas auf die Liste zu setzen. Diese war als Bergarbeitertochter im lothringischen Forbach aufgewachsen, also in der nahen Grenzstadt, und hatte als Kind ihre ersten Auftritte in einem Saarbrücker Jazzclub gehabt, doch Peter wollte eigentlich nur gebürtige Saarländer und Saarländerinnen aufnehmen. In diesem Falle würde er aber vermutlich ein Auge zudrücken und Patrizia Kaas kurzerhand zur Saarländerin machen. Schließlich war Reiner Calmund auch nicht im Saarland geboren, er war ein »Zugezogener«.
Peter aß einen zweiten »Roschdischen Ritter«, schöpfte sich noch etwas Suppe in seinen weißen, tiefen Teller von Villeroy & Boch, schenkte den Van Volxem nach und wollte gerade weiter Zeitung lesen, da ging das altmodische, aber schon schnurlose Tastentelefon. Peter nahm es in die Hand und drückte die grüne Softtaste.
»Müller hier«, meldete sich der Kriminalkommissar aus Heidelberg, den Peter bei seinen Ermittlungen im Fall Metzinger kennen und schätzen gelernt hatte.
Peter freute sich, Müllers Stimme zu hören. Sie tauschten sich angeregt über ihre aktuellen Fälle aus und dann überraschte Müller mit der Nachricht, dass er nach Augsburg ziehen würde, da seine Frau eine Lehrerstelle am Gymnasium in Gersthofen, einer der reichsten bayerischen Gemeinden im sogenannten Speckgürtel Augsburgs, angeboten worden war. Müllers Frau war gebürtige Gersthoferin und hatte in Heidelberg schon immer Heimweh gehabt. Nun ergab sich die Möglichkeit für eine Rückkehr nach Hause. Für Müller selbst spielte es keine große Rolle, wo er arbeitete. Das Schicksal wollte es jedoch, dass der Augsburger Kriminalkommissar Oberhammer aus Krankheitsgründen frühpensioniert worden war und Müller so die Gelegenheit bekam, von Baden-Württemberg nach Bayern zu wechseln. Zum 15. Januar würde er offiziell in Augsburg in einem Sonderermittlungsbereich anfangen.
»Alles zusammengenommen ist es eine echte Fügung des Schicksals«, erklärte Müller abschließend.
Peter gratulierte ihm und freute sich mit ihm für diese Chance auf einen Neuanfang.
»Und stellen Sie sich vor, der erste Fall, den ich noch vor Dienstantritt zur Aufklärung übermittelt bekommen habe, ist ein mysteriöser Kunstdiebstahl!« Müller stoppte kurz. »Da musste ich sofort an Sie denken und deswegen rufe ich Sie an. Ich denke, dass Ihre Wimsey-Spürnase uns bei unseren Ermittlungen sehr von Nutzen sein kann.«
Müller spielte auf Lord Peter Wimsey an, den ermittelnden Adligen von Dorothy L. Sayers, denn beide mochten die köstlichen Krimis der englischen Autorin der 1920er-Jahre. Sie waren Fans dieser heute als ziemlich altmodisch empfundenen Schriftstellerin und liebten die Komplexität der Fälle sowie die kulturhistorischen Zusammenhänge, in denen sich die Geschichten um Lord Peter Wimsey, seinen Butler Bunter und Inspektor Parker verstrickten und entwickelten.
Dann fuhr der Kriminalkommissar fort: »Aus einer Privatsammlung ist ein wertvolles Gemälde verschwunden. Das Bemerkenswerte dabei ist allerdings, dass das Bild eigentlich gar nicht weg ist.«
Müller legte eine dramatische Pause ein, um seine Worte wirken zu lassen – mit Erfolg. Wie kann das sein, überlegte Peter. Das klang vollkommen verrückt! Wie konnte man ein Bild stehlen, das dann doch nicht weg war? Und was hatte die Polizei damit zu tun? Wenn der Dieb das Bild wieder zurückgebracht hatte – welches Delikt lag denn überhaupt vor? War es eine widerrechtliche Ausleihe? Vielleicht hatte der Dieb Fenster und Türen beschädigt oder andere Dinge im Haus ramponiert, sodass es nur um eine Sachbeschädigung ging? Peter war sofort elektrisiert von der Geschichte und sehr gespannt, was Müller nun weiter berichten würde. Also tat er dem Kriminalkommissar den Gefallen und stellte eine entsprechende Frage.
»Der Besitzer des Bildes ist ein fanatischer Sammler von niederländischen Gemälden des 17. Jahrhunderts, er hat sicher einige hundert Bilder im Haus«, erläuterte dieser. »Ein zentrales Werk seiner Sammlung hängt oder hing im Esszimmer seiner alten Augsburger Villa aus den 1920er-Jahren, die sich in der Nähe des MAN-Geländes befindet. Als der Besitzer aus seinem Weihnachtsurlaub zurückkam, merkte er zunächst eine Woche lang gar nichts, dann aber glaubte er, aus allen Wolken zu fallen. Das besagte Bild hing zwar noch an derselben Stelle an der Wand, es war aber nicht mehr sein Bild, sondern es war ein anderes mit dem gleichen Motiv und dem gleichen Rahmen.«
Müller machte wieder eine Pause.
»Wie alt ist der Herr denn?«, fragte Peter, um sich zu vergewissern, dass es sich nicht um eine altersbedingte Ausfallerscheinung handelte, die dem Besitzer des fraglichen Gemäldes eine Halluzination beschert hatte.
»Er ist Ende fünfzig und bei bester Gesundheit und klarem Verstand. Hält sehr gerne kunsthistorische Vorträge und hat ein brillantes Gedächtnis«, entgegnete Müller. »Ich habe im ersten Moment auch an so eine Möglichkeit gedacht, aber …«
»Sie meinen also, er geht davon aus, dass sein originales Gemälde durch ein ebenso originales Bild desselben Künstlers mit dem gleichen Motiv ausgetauscht wurde?« Peter brummte der Kopf ein wenig, da er sich überhaupt keinen Reim auf die Sache machen konnte.
»Ganz genau!«
»So etwas habe ich noch nie gehört. Offenbar ging es dem Dieb des Bildes nicht um dessen Wert, denn dann hätte er ja eine Kopie oder eine Fälschung hingehängt. Hat denn diese zweite Fassung vielleicht einen geringeren Wert?«
»Das habe ich mich auch gefragt und die Versicherung kontaktiert, die mir dann bestätigte, dass beide kompositionsgleichen Bilder auch denselben Wert hätten, in diesem Fall etwa 70.000 Euro. Aktuell bestünde damit auch kein Grund, den Wert des Bildes zu ersetzen, da der Dieb diesen ja selbst ersetzt hätte.«
Beide schwiegen eine Weile. Dann fragte Müller: »Könnten Sie mir hier fachlichen Beistand leisten und das Bild etwas genauer unter die Lupe nehmen?«
»Sehr gerne«, antwortete Peter, »das wäre mir ein Vergnügen.« Dann setzte er sofort hinzu: »Um welches Gemälde geht es denn, ich meine, welcher Maler hat das wertvolle Bild gemalt?«
Peter hörte, wie Müller mit seinen Papieren herumhantierte, dann las der Kriminalkommissar etwas ungelenk vor: »Joos de …«
Er machte eine Pause, da er offenbar seine Handschrift nicht richtig lesen konnte, und wiederholte dann: »Joos de Momper heißt der Maler. Kennen Sie ihn?«
Nun wäre es falsch gewesen zu behaupten, dass Peter den Maler oder dessen Œuvre genauer gekannt hätte. Sein Vater hatte Momper gelegentlich einmal erwähnt und ein charakteristisches Werk von ihm hing in der Alten Sammlung des Saarlandmuseums, daran kann Peter sich gut erinnern – auch wenn es schon etwas länger her war, dass er das Bild bewusst betrachtet hatte. Momper gehörte jedenfalls zu einer Gruppe von niederländischen Landschaftsmalern aus dem 17. Jahrhundert, die sich mit dem Thema der Weltlandschaften befassten und den Betrachter in eine Art Vogelschauperspektive katapultierten. Genaueres würde Peter aber in seiner Bibliothek nachrecherchieren können.
»Wie heißt denn der Besitzer des Bildes?«, fragte er nun weiter.
»Sein Name ist Dr. Maximilian Hohmann.«
Auch hier meinte Peter, den Namen schon einmal gehört zu haben.
»Ich schlage vor, dass wir uns übermorgen gleich in Augsburg treffen, am besten um elf Uhr im Pantheon am Herkulesbrunnen, da, wo wir uns beim Fall Metzinger auch getroffen haben. Sie wissen ja, wo das ist«, sagte Müller und legte auf.
Nachdem Peter sein altmodisches Telefon beiseitegelegt hatte, empfand er zunächst eine große Genugtuung. Als freiberuflich tätiger Kunstermittler musste er sich stets um Aufträge bemühen. Im letzten Jahr war es in dieser Hinsicht zunächst nicht besonders gut gelaufen; eine Provenienz-Recherche zu einem Monet war ihm durch die Lappen gegangen, den Augsburger Fall hatte er auf eigene Faust betrieben. Was auch gut so gewesen war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hatte. Von den 60.000 Euro Finderlohn konnte er in der nächsten Zeit gut leben und wieder in ordentlichen Hotels übernachten. Sein Geschäft der Kunstermittlung lief momentan wirklich gut, dachte Peter. Aber so eine verrückte Geschichte hatte er noch nie gehört. Es schien kniffelig zu werden. Das war besonders spannend für ihn. Wer in Gottes Namen kam auf die Idee, ein Originalbild durch ein Original zu ersetzen? Da musste es einen ganz klar zu definierenden Grund, ein spezielles Anliegen, einen emotionalen Bezug oder etwas Ähnliches geben. Aber was?
Nach einiger Überlegung, die ihn aber natürlich nicht weiterbrachte, beschloss Peter, sich erst einmal wieder der Saarbrücker Zeitung zu widmen. Dort fand er die Mitteilung, dass der Künstler Alexander Karle von einem Saarbrücker Gericht verurteilt worden war. Im vergangenen Jahr war Karle in den mit einer Kordel abgesperrten Altarraum der Basilika St. Johann eingedrungen und hatte auf der Altarmensa dreißig Liegestütze durchgeführt. Die Kunstaktion, die er Pressure to perform