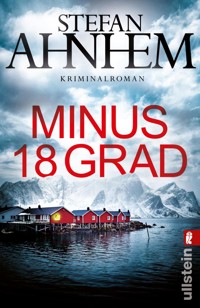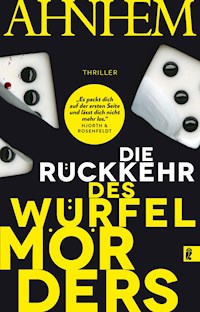9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine grausame Mordserie. Ein unlösbares Rätsel. Fabian Risks härtester Fall. Ein Mörder wählt seine Opfer scheinbar zufällig aus. So hinterlässt er keine Spuren. Kommissar Fabian Risk und das Helsingborger Kommissariat stehen vor einem Rätsel. Helsingborg ist nicht mehr der idyllischen Ort an der schwedischen Küste, der er mal war. Während eine Reihe von Morden die Stadt erschüttert, kämpft Kommissar Fabian Risk gegen sein ganz persönliches Leid: Seine Familie droht an seiner Arbeit als Mordermittler zu zerbrechen. Aber sein Job ist sein Leben. Er kann nicht anders und nimmt sich der Aufklärung der Morde an, doch er findet keine Spur. Risk und seine Kollegen ahnen nicht, dass der Täter seine Opfer durch ein Würfelspiel rein zufällig auswählt, genau wie die Mordwaffe und den Tatort. So lassen sich keinerlei Verbindungen zu ihm herstellen. Wird dieser Fall ungelöst bleiben? Wie es weitergeht, erfahren Sie in "Die Rückkehr des Würfelmörders" – dem spannungsgeladenen Finale des Würfelmörders. "Der Roman fesselt von der ersten bis zur letzten Seite!" In Touch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Würfelmörder
Der Autor
STEFAN AHNHEM ist einer der erfolgreichsten Krimiautoren Schwedens. Seine Bücher sind allesamt Bestseller und preisgekrönt. Bevor Ahnhem begann, selbst Krimis zu schreiben, verfasste er Drehbücher, unter anderem für die Filme der Wallander-Reihe. Er lebt mit seiner Familie in Kopenhagen.
Das Buch
Fabian Risks Leben ist ein Scherbenhaufen. Seine Familie droht zu zerbrechen, noch immer weiß Risk nicht, ob sein Sohn an einem Mord beteiligt war. Da wird ein syrischer Flüchtlingsjunge in einem Flüchtlingsheim brutal ermordet. Risks Kollegin Irene Lilja vermutet einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Rassistische Übergriffe stehen in Helsingborg an der Tagesordnung. Doch die Wahrheit ist verworren. Und eine Reihe weiterer Morde lässt Risk und Lilja an allem zweifeln, was sie zu wissen glaubten.
Stefan Ahnhem
Der Würfelmörder
Thriller
Aus dem Schwedischen von Katrin Frey
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die schwedische Originalausgabe erschien 2018unter dem Titel Motiv X bei Forum, Stockholm.
ISBN 978-3-8437-2323-7
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019/Ullstein Verlag. Der Roman ist zuvor unter dem Titel 10 Stunden tot erschienen. © Stefan Ahnhem 2018. Titel der schwedischen Originalausgabe: Motiv X (Forum, Stockholm)Published by agreement with Salomonsson AgencyUmschlaggestaltung: Bürosüd, MünchenTitelabbildung: © GettyImages / Thomas J PetersonAlle Rechte vorbehaltenE-Book Konvertierung powered by pepyrus.com
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
VORSPANN
PROLOG
TEIL I
13. – 16. Juni 2012
TEIL II
17. – 24. Juni 2012
Anhang
Danke
Leseprobe: Die Rückkehr des Würfelmörders
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
VORSPANN
VORSPANN
PROLOG
24. August 2007
Inga Dahlberg versuchte, an etwas anderes zu denken. Wenigstens für ein paar Minuten. An den wolkenlosen Augusthimmel oder an die Musik, die so laut aus ihren Kopfhörern dröhnte, dass das Gezwitscher der Vögel in den Bäumen nicht zu ihr durchdrang. An die Tatsache, dass sie kein bisschen erschöpft war, obwohl sie schon zum dritten Mal die blaue Runde lief, oder daran, dass der Ramlösa Brunnspark so grün und so dicht belaubt war, dass man in jede Richtung nur einige Meter weit sehen konnte.
Doch ebenso wie Ameisen immer einen Weg zum Zucker in der Küche finden, ließen sich auch ihre Gedanken nicht davon abhalten, wieder und wieder um den Plan zu kreisen, dem sie in den vergangenen Wochen einen Großteil ihrer Zeit gewidmet hatte. Diesen Plan, der in weniger als drei Stunden in die Tat umgesetzt werden und ihr Leben verändern sollte.
Diesmal durfte nichts schiefgehen. Beim geringsten Zucken der Lider oder einer winzigen Unsicherheit in der Stimme wäre sie verloren. Nach all den Jahren kannte sie Reidar gut genug. Er würde einen Riss in ihrer Fassade sofort ausnutzen, die Kontrolle übernehmen und sie kleinmachen, bis sie ihm wieder gehorchte wie ein dressierter Hund.
Doch was auch passieren und wie auch immer er reagieren würde, sie wusste, was sie zu tun hatte, damit er zum Stift griff und unterschrieb. Und sobald das überstanden war, würde sie sich den gepackten Koffer schnappen und zur Haustür gehen.
Sie wagte kaum zu glauben, dass die Abreise nur noch wenige Stunden hin war. Und noch dazu Paris. Die romantischste Stadt von allen. Die Heimlichtuerei endlich hinter sich lassen. All die verschlüsselten Textnachrichten, die ständige Sorge, auf frischer Tat ertappt zu werden. Ganz zu schweigen von der Angst, jeden Abend mit dem falschen Mann ins Bett gehen zu müssen.
Schon heute Abend würden sie sich draußen frei bewegen. Sie könnten sich auf eine Bank setzen und sich einfach umarmen. Sie könnte den Kopf auf seinen Schoß legen und zugleich sein Gesicht und die Sterne sehen.
Sie und ihr Geliebter.
Sie ließ sich das Wort auf der Zunge zergehen. Geliebter. Es gefiel ihr. Es klang nach Zärtlichkeit und Sünde zugleich. Und was hatten sie gesündigt. Bei ihm und bei ihr zu Hause, unter der Dusche und im Auto. Ganz zu schweigen von dem versteckten Stück Strand in der Nähe von Råån, wo sie Dinge getan hatten, die sie nicht für möglich gehalten hatte.
Und nun war dieses Kapitel zu Ende. Bald wäre er nicht mehr ihr Liebhaber, sondern ihr Liebster. Sie würden Kastrup hinter sich lassen, mit Sekt anstoßen und sich freuen, dass der Traum endlich Wirklichkeit geworden war.
Doch es sollte ihr niemand kommen und sagen, es wäre leicht gewesen. Anfangs war sie auf Widerstand gestoßen, er hatte nicht zuhören wollen, und sie war sich vorgekommen wie ein quengeliges Kind. Erst als sie damit gedroht hatte, alle Betroffenen in ihre kleine Affäre einzuweihen, war er zur Vernunft gekommen.
Eigentlich war es überhaupt nicht ihr Stil, zu drohen und hysterisch zu werden, aber sie konnte doch nicht ewig in einer Lüge leben. Und im Nachhinein war deutlich geworden, dass es ihm genauso ging. Plötzlich nahm er die Sache in die Hand und schmiedete konkrete Pläne.
Paris war ihre Entscheidung gewesen, aber um die Tickets hatte er sich gekümmert, sogar Businessclass hatte er gebucht, und wenn sie jetzt daran dachte, dass sie in wenigen Stunden Hand in Hand und mit viel Beinfreiheit nebeneinandersitzen würden, musste sie sich kneifen, um ganz sicher zu sein, dass sie nicht träumte.
Aber noch hatte sie nicht alle Vorbereitungen getroffen. Sobald sie zu Hause war, würde sie duschen und die letzten Reste wegräumen. Die Fenster waren bereits geputzt, und die Blumen hatten extra viel Wasser bekommen. Die Bettwäsche war gewaschen und musste nur noch gemangelt werden, bevor sie die Betten beziehen konnte. Das Bœuf Bourguignon, Reidars Lieblingsgericht, schmorte unter dem Deckel und wartete darauf, abgeschmeckt zu werden und den letzten Pfiff zu bekommen.
Es war Freitag, und er würde nach der Arbeit ein Bier trinken, bevor er um kurz vor sieben nach Hause käme und duschte, während sie zum letzten Mal seine stinkenden Arbeitsklamotten sortierte und in die Waschmaschine steckte. Anschließend würde sie das Abendessen auf den Tisch stellen und warten, bis er sich setzte.
Wenn alles ablief wie geplant, würde er ungefähr zu diesem Zeitpunkt merken, dass nicht alles war wie immer, und wissen wollen, warum sie sich ihm nicht gegenübersetzte und auch etwas aß. Eventuell würde er eine höhnische Bemerkung über die vielen gescheiterten Diäten machen, von denen sie seiner Meinung nach noch dicker geworden war, obwohl sie in Wirklichkeit zwölf Kilo abgenommen hatte, seit sie joggte.
Doch diesmal würde sie sich seinen Spott nicht anhören. Stattdessen würde sie ihm ruhig und gefasst mitteilen, dass sie ihn verlassen wollte.
Natürlich wäre es leichter gewesen, ihm einfach einen Zettel auf den Küchentisch zu legen und das Haus zu verlassen. Aber um ihn zur Unterschrift zu bewegen, musste sie es richtig machen. Ihm in die Augen sehen und ihm klarmachen, dass sie nie wieder zusammen zu Abend essen würden.
Je nachdem wie sein Arbeitstag verlaufen war, würde er möglicherweise vom Stuhl aufspringen und handgreiflich werden. Verletzen würde er sie nicht. Nicht in dem Moment. Allerdings könnte er auf die Idee kommen, mit seinem Teller zu werfen oder den Tisch umzukippen. Wahrscheinlicher war jedoch, dass sich eine Wut bis in die kleinsten Blutgefäße seines Gesichts ausbreiten würde, während er sie mit der Ruhe eines Dampfkochtopfs fragte, wo um alles in der Welt sie denn hinwollte. Wie sie so naiv sein könnte, auch nur für einen Moment zu glauben, dass sie ohne ihn klarkäme.
Anschließend würde er sich ins Abseits manövrieren, indem er sie an den Ehevertrag erinnerte und sie fragte, ob ihr benebeltes kleines Erbsenhirn etwa vergessen habe, dass das Auto, das Haus und die meisten Möbel de facto ihm gehörten.
Reidar sagte leidenschaftlich gern de facto. Es schien ihn einen halben Meter größer zu machen und seinen Behauptungen etwas Unwiderrufliches zu verleihen. Genau dann, wenn er glaubte, Oberwasser zu haben, und pures Adrenalin durch seine Adern strömte, würde der Scheidungsantrag auf den Tisch kommen.
Anfangs begriff sie nicht, warum ihr die Kopfhörer, die mit dem kleinen iPod verbunden waren, aus den Ohren gerissen wurden. Geschweige denn, woher der Druck kam, mit dem etwas in ihre Brüste und dann auch in Schlüsselbeine und Hals schnitt. Erst als sie rücklings zu Boden fiel, sah sie die gespannte Angelschnur im Licht aufblitzen.
Der Himmel war schön, so strahlend blau und wolkenlos, wie er schon den ganzen Sommer über gewesen war. Abgesehen von ihrem eigenen Herzschlag hörte sie das Zwitschern Tausender Vögel, die sich irgendwo außerhalb ihres Gesichtsfelds aufhielten. Moment mal, hatte sie nicht eben noch Musik gehört? Und warum lag sie mitten auf der Laufstrecke auf dem Rücken?
Sie griff sich an den schmerzenden Hals und setzte sich auf. Ihr Hinterkopf pochte. Vermutlich hatte sie höchstens eine Minute verloren und würde noch alles erledigen können, bevor Reidar nach Hause kam.
Sie hatte sich gerade mit Mühe aufgesetzt, als schräg hinter ihr Zweige knackten. Sie drehte sich um und sah, wie sich das dichte Laub bewegte.
»Hallo? Ist da jemand?«, rief sie, obwohl daran kein Zweifel bestand. »Habt ihr die Schnur gespannt? Hallo!« Sie war wütend geworden und wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen, obwohl sie keine Zeit zu verlieren hatte.
Als der Mann aus der Blätterwand hervortrat, verflüchtigte sich ihr Zorn, und sie begriff, dass sie so schnell wie möglich auf die Beine kommen und sich aus dem Staub machen sollte. Aber es ging nicht. An der Stelle, an der sie saß, schien die Schwerkraft besonders stark zu wirken. Und ihr Blick wurde geradezu magisch von dem Mann angezogen, der mit einem Spaten in der Hand aus dem Gebüsch kam.
Trotz des wolkenlosen Sommerhimmels trug er eine dunkelgraue Regenjacke und Stiefel, die bis weit über die Knie reichten und in eine Hose übergingen. Unter der Kapuze seiner Regenjacke trug er eine Sturmhaube, die nur die Augen frei ließ.
Sie holte tief Luft, aber bevor sie um Hilfe schreien konnte, hob er den Spaten, und sie erblickte an seinem Handgelenk die Armbanduhr. Es war eine Omega Speedmaster. Für so eine Uhr hatte sie ein ganzes Monatsgehalt ausgegeben.
Es war stockfinster, und das Klebeband auf ihrem Mund saß so straff, dass sie befürchtete, ihre Lippen könnten zerreißen, wenn sie zu schreien versuchte. Andererseits fühlte sich ihr Gesicht ohnehin zerfetzt und angeschwollen an. Gott im Himmel, er musste sie mit dem Spaten geschlagen haben.
Sie konnte noch immer nicht glauben, dass er derjenige gewesen war, der die Angelschnur gespannt, sie bewusstlos geschlagen und ausgezogen hatte. Wenn diese Omega nicht gewesen wäre. Oder hatte sie sich getäuscht? Vielleicht hatte der Verkäufer nur den Preis in die Höhe treiben wollen, als er ihr versicherte, dieses Apollo-Modell sei ungemein selten. Natürlich, so war es gewesen.
Allerdings war fraglich, welche Rolle es im Moment überhaupt spielte, zu wissen, wer ihr das angetan hatte. Sie lag hier nackt und gekrümmt, Klebeband über Mund und Augen, und hatte keine Ahnung, was sie erwartete. Oder hatte sie es bereits hinter sich? Hatte er erledigt, was er vorgehabt hatte, und sie einfach hier zurückgelassen?
Sie befand sich immer noch unter freiem Himmel, so viel stand fest, aber sie war nicht mehr auf ihrer Laufstrecke im Brunnspark, sondern in der Nähe von Wasser. Trotz des Tapes auf ihren Ohren hörte sie es plätschern.
Eigentlich lag sie nicht, sondern kniete eher in einer zusammengesunkenen, vornübergebeugten Yogaposition, beide Arme nach vorn ausgestreckt. Eine merkwürdige Haltung, vor allem in Anbetracht der harten und rauen Unterlage.
Sie versuchte zu verstehen, was das alles zu bedeuten hatte. Wieso hatte er sie ausgerechnet nackt und in dieser Position zurückgelassen?
Sie fühlte kaum Schmerz. Weder im Gesicht noch am restlichen Körper. Alles an ihr schien wie betäubt. Als ob ihr Körper ihr nicht mehr gehörte. Er musste ihr ein Medikament verabreicht haben. War sie etwa längere Zeit bewusstlos gewesen? Vielleicht Stunden?
Wie auch immer, jetzt musste sie hier weg und so schnell wie möglich nach Hause und unter die Dusche, damit sie mit allem fertig war, wenn Reidar von der Arbeit kam. Hoffentlich war sie nicht zu weit weg von zu Hause und die Verletzung im Gesicht nur halb so schlimm.
Er würde natürlich wissen wollen, was passiert war. Aber es spielte keine Rolle. Unter keinen Umständen durfte das ihren Plan durchkreuzen. Jetzt musste sie erst einmal das Klebeband abziehen, ohne dass sich die Verletzungen verschlimmerten.
Doch als sie versuchte, einen Arm zu heben, schlug von irgendwoher der Schmerz zu. Sie schrie direkt ins Klebeband. Der Schmerz schoss vom Handrücken in die Hand und blitzschnell den Arm hinauf. Außerdem schien die Hand arretiert zu sein. Was hatte er gemacht? Sie versuchte, die andere Hand zu bewegen, aber da war es genauso. Es tat so weh, dass ihr schlecht wurde. Als sie versuchte, die Beine zu bewegen, strahlte von den Waden ein noch heftigerer Schmerz aus, falls das überhaupt möglich war.
Sie saß fest. Wie hatte er … Es wollte ihr nicht in den Kopf. An was für ein Monster war sie geraten?
»Sieh mal einer an. Das wurde aber auch Zeit«, ertönte eine Stimme. »Wurde auch Zeit.«
Er war wieder da. Oder war er die ganze Zeit hier gewesen? Und klang die Stimme nicht genau wie seine?
»So. Hoch mit dir. Auf alle viere.«
Sie überwand den Schmerz und gehorchte.
»Prima. Geht doch, du musst nur wollen.«
Es klang wirklich nach ihm. Aber er durfte es nicht sein. Vielleicht lag es am Klebeband auf ihren Ohren.
Sie spürte seine behandschuhte Hand auf ihrer Hüfte, als wäre sie ein Pferd, das begutachtet wird. Dann strich die Hand über ihren unteren Rücken und zwischen ihre Beine.
»Jetzt musst du nur aufpassen, dass du nicht wieder umfällst. Sonst bist du wirklich am Arsch.«
Er war es. Eindeutig.
Es war Ingvar. Ingvar Molander, der Mann, den sie über alles liebte und den sie endlich dazu gebracht hatte, sie in wenigen Stunden nach Paris zu bringen.
Als sich die Unterlage, auf der sie befestigt war, in Bewegung setzte, schoss der Schmerz aus Händen und Waden. Sie schrie, so laut sie konnte, brachte aber nur ein dumpfes Murmeln hervor.
Kurz darauf begann die Unterlage in verschiedene Richtungen zu kippeln, und sie musste jeden Muskel ihres Körpers anspannen, um sich auf allen vieren zu halten. Als kaltes Wasser über ihre Hände spülte, ging ihr allmählich auf, was sie erwartete.
TEIL I
13. – 16. Juni 2012
Es spielt keine Rolle, wo du gräbst.
Wenn du tief genug gekommen bist, stinkt es.
1
Molly Wessman nahm die leise Melodie nur flüchtig wahr, begriff aber mit zunehmender Lautstärke der Harfenklänge, dass sie fünf Minuten Zeit hatte, um aufzuwachen und einen klaren Kopf zu bekommen, bevor sie aufstehen musste. Fünf Minuten konnte sie die Augen noch geschlossen halten und sich strecken.
Sie fühlte sich ausgeruht und war in der Nacht nicht ein einziges Mal aufgewacht, was angesichts der Präsentation, die sie am Nachmittag vor dem Vorstand halten musste, unglaublich war. Unter normalen Umständen hätte sie die ganze Nacht nicht schlafen können und wäre als Wrack zur Arbeit gekommen. Diesmal war sie überzeugt, dass der Vorstand ihre Vorschläge absegnen und ihr die letzten und absolut notwendigen Einsparungen genehmigen würde, damit sie endlich die erwünschten Ergebnisse erzielten.
Das hatte sie alles dieser Schlaf-App auf ihrem Smartphone zu verdanken. Früher hatte sie nie mehr als vier Stunden pro Nacht geschlafen. Sie war permanent müde gewesen und hatte sich so oft krankgemeldet, dass sogar Kollegen mit Kleinkindern stutzig geworden waren.
Schließlich hatte ihr damaliger Chef sie in sein Büro bestellt und ihr gesagt, was sie sich selbst nicht eingestanden hatte. Dass sie geradewegs auf einen Zusammenbruch zusteuerte. Dann hatte er ihr die Nummer eines Therapeuten gegeben und ihr eine App empfohlen, die mithilfe von Klängen und verschiedenen Arten von Rauschen das Gehirn dabei unterstützte, sich zu entspannen, um auf diese Weise die Schlafqualität zu verbessern.
Diese App war ein Segen und hatte außerdem nur einen Bruchteil dessen gekostet, was der Therapeut für ein paar sinnlose Gespräche verlangte. Seitdem sie die App hatte, konnte sie sich sogar wieder aufraffen, Sport zu machen.
Sie atmete tief ein, füllte die Lungenflügel genau so, wie sie es beim Yoga gelernt hatte, und streckte die Hand nach dem Smartphone auf dem Nachttisch aus. Sie schaltete den Wecker aus, und in der Sekunde, bevor das Display wieder schwarz wurde, fiel ihr etwas Merkwürdiges auf.
Eigentlich durfte sie im Bett nicht auf das Smartphone schauen. Das Ein- und Ausschalten der Alarmfunktion war die Ausnahme. In ihrem neuen Leben war das Bett, genau wie Badezimmer und Esstisch, eine bildschirmfreie Zone. Trotzdem konnte sie es sich nicht verkneifen, das Kennwort einzugeben.
Erneut betrachtete sie das Display und begriff überhaupt nichts.
Für jemanden, der nicht wusste, wie es normalerweise aussah, hatte es vermutlich weder etwas Seltsames noch etwas Beunruhigendes an sich. Aber sie wusste es, und je länger sie hinsah, desto panischer wurde sie. Bald war der Druck auf der Brust so stark, dass sie schwer Luft bekam.
Ihr erster Gedanke war, es sei nicht ihr Handy. Doch der Sprung oben links war noch da, und die Home-Taste war locker.
Alles stimmte.
Alles außer dem Bildschirmhintergrund.
Es hätte ein Bild von Smilla, ihrem weiß-braunen Boston Terrier, sein sollen, der vor drei Jahren an hypertropher Kardiomyopathie gestorben war. Aber da war kein Bild von Smilla.
Sondern ein Foto von ihr selbst.
Ein Foto, auf dem sie schlafend in ihrem eigenen Bett lag und jenes T‑Shirt trug, das sie gerade anhatte. Sogar der Zahnpastaklecks vom Abend zuvor war zu sehen. Das Foto musste in der Nacht gemacht worden sein. Es war also jemand in ihre Wohnung eingedrungen.
Vielleicht war es nur ein technischer Fehler. Oder eine neue Kamerafunktion, die sie versehentlich angeklickt hatte, als sie ins Bett gegangen war. Nein, das Foto war von oben gemacht worden. Es musste jemand hier gewesen sein.
Trieb da jemand einen Scherz mit ihr? Einer der vielen nächtlichen Besucher, die in den vergangenen Jahren ihre Schlüssel nachgemacht hatten? Wie auch immer das unbemerkt möglich gewesen war. Oder sollte das die Warnung eines Mitarbeiters sein, weil sie zu rücksichtslos vorging?
Die Fragen wirbelten in ihrem Kopf herum wie Lottokugeln. Sicherlich gab es unter den Angestellten Verbitterte, aber ihr fiel nicht einer ein, der gestört genug gewesen wäre, um so etwas zu tun.
Plötzlich kam ihr ein Gedanke.
Was, wenn er noch in der Wohnung war? Wenn er direkt vor der Schlafzimmertür stand und auf sie wartete. Oder sogar im Schlafzimmer …
Sie versuchte, sich davon zu überzeugen, dass sie überreagierte. Aber es ging nicht. Sie würde nur wagen aufzustehen, wenn sie sich mit irgendetwas verteidigen konnte. Und zwar nicht nur mit Kissen und Decke. Vielleicht mit der Nachttischlampe. Dem einzigen Gegenstand in Reichweite.
Als ob sie eine Chance gehabt hätte, sich gegen einen wildfremden Mann zur Wehr zu setzen. Wem wollte sie hier eigentlich etwas vormachen? Sie, die bereits beim Anblick einer Spinne schauderte. Jemandem im Meeting mit sachlichen Argumenten über den Mund zu fahren war eine Sache. Physische Gewalt eine ganz andere.
Aber was blieb ihr übrig?
So vorsichtig und leise wie möglich drehte sie sich um und packte mit beiden Händen den Lampenschirm. Die beiden Schrauben lösten sich, und etwas Gips rieselte aus der Wand und auf ihr schwarzes Kopfkissen. Anschließend zog sie den Stecker aus der Steckdose, wickelte sich das Kabel um die linke Hand und nahm die Halterung der Lampe in die rechte Hand, bevor sie sich aus dem Bett wagte.
Sie spürte ihren Puls, als sie in die Hocke ging und unters Bett schaute. Aber dort standen nur wie üblich die Waage und die mit Rollen versehene Kiste voller Sexspielzeug. Sie konnte einfach nicht glauben, dass sie wirklich im Lauf der Nacht mit ihrem eigenen Handy fotografiert worden war.
Sie stand auf, ging zum Putzschrank auf der linken Seite hinüber und riss die Tür auf, aber auch hier versteckte sich niemand. Nachdem sie die Lampe durch das Staubsaugerrohr ersetzt hatte, durchsuchte sie die übrigen Kleiderschränke.
Wer auch immer derjenige war, in ihrem Schlafzimmer befand er sich nicht, was sie merkwürdigerweise erleichterte. Als ob sich alles in Wohlgefallen auflösen würde, solange sie nur im Schlafzimmer blieb.
Sie hatte natürlich ihr Smartphone und konnte jemanden anrufen. Aber wen? Mit Gittan, die einst ihre beste Freundin gewesen war, hatte sie seit dem vorletzten Weihnachten nicht gesprochen, weil sie damals endgültig die Nase voll gehabt hatte von Gittans Rat, sie solle sich zusammenreißen und einen Mann suchen, der mit ihr zusammenzog. Bei der Arbeit hatte sie auch niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte. Dort wäre es nur als Zeichen von Schwäche interpretiert worden, und Schwäche war das Letzte, was sie sich momentan erlauben konnte.
Im Prinzip hätte sie die Polizei rufen können. Aber die hätte bestimmt als Erstes gefragt, ob der Täter noch in der Wohnung sei. Daher stupste sie mit einem Fuß an die Schlafzimmertür, die sich daraufhin lautlos öffnete.
Es war überhaupt sehr still. Ungewöhnlich still. Es schien, als wäre nicht nur der Verkehr auf der einige Straßen entfernten Järnvägsgata zum Erliegen gekommen, sondern als hätte der alte Mann unter ihr zum ersten Mal den Fernseher ausgeschaltet. Alles nur, um den Ernst der Lage zu unterstreichen und ihr noch mehr Angst einzujagen.
Sie betrat das Wohnzimmer und sah sich um. Das Ecksofa drüben vorm Fenster stand an derselben Stelle wie immer. Das Gleiche galt für den Sessel, das Bücherregal und den Esstisch in der anderen Ecke. Da es hier keine Möglichkeit gab, sich zu verstecken, wagte sie sich in den Flur und weiter in die Küche.
Auch hier sah alles so aus wie am Abend zuvor. Das Geschirr vom Abendessen stand auf dem Abtropfgestell, und die Tüte mit den ausgespülten Plastikverpackungen lag zugeknotet auf dem Fußboden und wartete darauf, dass sie sie auf dem Weg zum Auto in den Müllraum brachte. Den Vorratsschrank öffnete sie, um nichts zu übersehen.
Danach machte sie Licht im Badezimmer und stellte fest, dass der Slip, den sie gestern getragen hatte, auf dem Fußboden lag und der Duschvorhang vor der Badewanne zugezogen war. Hatte sie ihn zugezogen, oder versteckte sich jemand dahinter?
Sie machte sich mit dem Staubsaugerrohr bereit und riss den Vorhang zur Seite.
Niemand.
Vielleicht hatte sie ja doch versehentlich ein Selfie im Schlaf gemacht. Irgendwie wäre das typisch für sie. Seit sie das neue Smartphone mit der zweiten Kamera auf der Vorderseite besaß, hatte sie schon so viele Selfies ausgelöst, dass sie regelmäßig Warnungen erhielt, ihr Speicher sei bald voll. Es gab mit Sicherheit eine logische Erklärung, und vermutlich hatte ihre Anspannung aufgrund der bevorstehenden Präsentation das Ganze unverhältnismäßig aufgebauscht.
Endlich normalisierte sich ihr Puls, und schließlich konnte sie ruhig ein- und ausatmen, das Metallrohr weglegen, das T‑Shirt ausziehen und in die Badewanne steigen. Anschließend zog sie den Duschvorhang wieder zu, drehte den Wasserhahn auf und wartete, bis die Temperatur von eiskalt zu sehr heiß übergegangen war, bevor sie den Strahl in den Brausekopf lenkte.
Sie liebte das Brennen auf der Haut und stellte das Wasser noch etwas heißer. So konnte sie ewig dastehen, und an diesem Morgen brauchte sie es mehr denn je. Es schien, als würde jeder Tropfen einen Teil ihrer Angst abspülen.
Bevor sie die Badewanne verließ, trocknete sie sich grob ab. Der Spiegel war wie immer beschlagen, und obwohl sie wusste, dass es Streifen hinterlassen würde, wischte sie mit dem Handtuch darüber.
Wie aus dem Nichts ertönte ein Schrei, der so laut war, dass er in den Ohren schmerzte. Erst nach einer Weile begriff sie, dass sie selbst schrie. Es war ein intuitiver Schrei, der nicht enden wollte. Gleichzeitig eroberte der Dunst die Scheibe zurück und ließ ihr Spiegelbild verschwimmen.
Trotzdem war immer noch deutlich zu erkennen, dass ein Großteil ihres Ponys abgeschnitten war.
2
Du bist schuld …
Das Geräusch der Kugel, die pfeilartig durch die Luft geschossen war. Ein Sausen, dem kein Knall vorausgegangen war, sondern nur ein Vakuum, das sich wieder gefüllt hatte. Ein unschuldiger und kaum hörbarer Luftzug, als würde man eine neue Dose Tennisbälle öffnen.
All das hier …
Matilda, seine eigene Tochter, die sich an den Bauch gegriffen und auf den wachsenden dunkelroten Fleck auf ihrem Pulli gestarrt hatte. Ihr verständnisloser Blick und die zunehmend verschmierten Hände, als sie auf dem weißen Teppich zusammensackte.
Du und sonst niemand …
Es war alles so furchtbar schnell gegangen, und trotzdem konnte Fabian Risk noch immer jede Sequenz des Geschehens einzeln abrufen.
Seine Hände, denen es endlich gelang, die Pistole zu halten, zu zielen und abzudrücken. Das Blut, das aus dem Loch in der Stirn des Täters quoll, und gleichzeitig die Erkenntnis, dass alles vorbei war. Zu spät. Und zuletzt die Worte seines eigenen Sohns, die ihn für immer verfolgen würden.
Er war an allem schuld. Er und sonst niemand.
Nichts hätte wahrer sein können.
Der Schuss, der Matilda das Leben rettete, war trotz der Warnungen vollkommen überraschend gekommen. Er hatte es geschafft, alle Warnsignale zu übersehen und die Ermittlungen voranzutreiben, ohne einen Gedanken an die Folgen zu verschwenden.
Jetzt saß er hier in seinem Anzug, den er seit der Beerdigung des jungen dänischen Mädchens namens Mette Louise Risgaard vor zwei Jahren in der Kirche in Lellinge nicht mehr angehabt hatte. Er saß zwischen Theodor und Sonja in der ersten Reihe. Diesmal war es seine eigene Tochter, die unter einem Berg von Blumen in den viel zu kleinen Sarg gesperrt war.
Doch der Schuldige war derselbe.
Er.
Neben ihm weinte Sonja, und auf der anderen Seite hörte er Theodor mit den Tränen kämpfen. Er selbst fühlte nichts. Es schien, als hätte er während der Achterbahnfahrt aus Hoffnung und Verzweiflung, die er während der vier Wochen durchlebt hatte, in denen er und Sonja an Matildas Bett saßen, all seine Gefühle aufgebraucht.
Seine Tochter war direkt vor seinen Augen ermordet worden, aber alles, was er fühlen konnte, war die Angst, nichts zu fühlen. Er hörte nicht einmal, was die Pastorin sagte. Trotz Mikrofon und Lautsprechern prallten die Worte an ihm ab und waren nicht voneinander zu unterscheiden.
»Du weißt, dass das hier deine Schuld ist, oder?«
Die Stimme war so leise, dass er nicht erkennen konnte, woher sie kam. Er drehte sich zu Theodor um. »Entschuldige, was hast du gesagt?«
»Hörst du schlecht? Ich habe gesagt, es ist deine Schuld!« Theodor sprach so laut, dass die Pastorin verstummte.
»Nicht jetzt, Theodor«, bekam er schließlich heraus. »Wir reden später darüber.«
»Wieso später?« Das war Sonja, und nun hörte die ganze Gemeinde zu. »Es ist doch schon zu spät. Hast du gar nichts begriffen? Unsere Tochter gibt es nicht mehr.« Sie brach in Tränen aus.
»Sonja, bitte …« Fabian nahm sie in die Arme, aber sie stieß ihn weg.
»Es ist so, wie Theodor sagt. Das alles hier ist deine Schuld!«
»Ganz genau. Also versuch nicht, die Schuld auf uns zu schieben«, ertönte eine weitere Stimme hinter ihm.
Er wandte sich um und sah, dass sie seiner Chefin Astrid Tuvesson gehörte, die mit seinen Kollegen Ingvar Molander, Klippan und Irene Lilja da war. Er wollte sie gerade fragen, warum sie sich einmischte, wurde aber von der Orgel unterbrochen, auf der das nächste Kirchenlied erklang, woraufhin sich die Gemeinde erhob und zu singen begann.
Er selbst blieb kraftlos sitzen und ließ seinen Blick über diejenigen schweifen, die um ihn herumstanden und sangen. Alle außer Molander, der zwar stand, aber nur die Lippen bewegte. Ohne zu singen. Vielmehr schien er etwas zu sagen. Zu ihm?
Fabian zeigte auf sich selbst. Molander nickte, beugte sich nach vorn und flüsterte in sein Ohr: »Hör auf.«
»Womit soll ich aufhören?« Fabian verstand kein Wort.
»Du wirst sowieso niemals etwas beweisen können.« Molander streckte die Zunge heraus und tat, als würde er sich erhängen, woraufhin er in ein Lachen ausbrach, das von einer schrillen Rückkopplung aus dem Mikrofon der Pastorin übertönt wurde.
Der Alarm drang immer tiefer in Fabians Unterbewusstsein. Ein Tinnituspiepen, das ihn schließlich dazu brachte, die Augen zu öffnen und zu begreifen, dass er sich nicht in einer Kirche, sondern in dem Krankenhauszimmer befand, in dem er und Sonja seit einem Monat abwechselnd Wache hielten. Das Einzige, was er nicht wiedererkannte, war der schmutzig weiße Vorhang vor Matildas Bett.
Dahinter waren Stimmen zu hören. Er stand vom Sessel auf, riss den Vorhang zur Seite und sah die eine der drei Krankenschwestern an den Knöpfen des piependen Messgeräts herumdrücken und drehen. Die beiden anderen standen rechts und links vom Krankenbett und kontrollierten Matildas Puls und Augen.
»Was ist passiert?«, fragte er, bekam aber keine Antwort. »Entschuldigung, aber kann mir mal jemand erklären, was zum Teufel hier los ist?«
Das durchdringende Piepen verstummte und hinterließ quälende Stille. Die drei Krankenschwestern wechselten Blicke, und Fabian fragte sich, ob sie die Situation unter Kontrolle hatten.
Dann hustete Matilda und schlug die Augen auf. Seine geliebte kleine Tochter, die eine Ewigkeit lang abwesend gewesen war, sah sich endlich mit fragendem Blick im Zimmer um. Nun kamen die Tränen. Es schien, als hätten sie diesen Moment sehnsüchtig erwartet.
»Hallo, Matilda. Wie geht es dir?«, fragte eine Krankenschwester freundlich lächelnd.
Matilda sah sie alle wortlos an.
»Du bist aufgewacht, Matilda.« Fabian drängelte sich vor bis an die Bettkante und nahm ihre Hand. »Du bist wieder da. Verstehst du das? Du hast überlebt.« Er drehte sich zu einer der Krankenschwestern um. »Oder? Sie wird doch durchkommen?«
»Auf jeden Fall«, sagte sie und erntete zustimmendes Nicken der beiden anderen. »Die Werte sehen gut aus.«
»Hast du das gehört, Matilda? Es sieht alles gut aus.« Er strich über ihre Wange, aber sie drehte sich weg. »Matilda, was ist? Hast du nicht gehört? Du wirst durchkommen.«
Matilda schüttelte den Kopf und sah aus, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen.
3
Kriminalinspektorin Irene Lilja spürte immer noch ein Pochen da unten, als sie den Helm aufsetzte, sich breitbeinig auf die frisch gewartete Ducati setzte und über die Bremsschwellen des Wohngebiets bretterte. Wenn der Versöhnungssex nicht wäre, hätte sie Hampus längst verlassen. Nie war er so leidenschaftlich, so feurig und gleichzeitig so zärtlich und aufmerksam wie nach einem Streit.
Aber sie stritten sich zu oft. Egal, worüber sie redeten, hinter der nächsten Ecke lauerte Knatsch. Es spielte keine Rolle, dass sie im Grunde einer Meinung waren, sie bildeten immer Gegenpole, auch wenn es, wie bei diesem Streit, um Themen ging, über die sie lange nachgedacht hatte.
Hampus war kein Alkoholiker, aber am Wochenende kam immer öfter der Whisky zum Einsatz, und sobald er abends von der Arbeit kam, klammerte er sich an dieses gottverdammte Volksbier.
Natürlich war er rasend geworden, und es hatte nicht lange gedauert, bis auch sie im roten Bereich gewesen war, aber erst als sie eine Bierdose nach der anderen in den Ausguss leerte, zeigte er sein wahres Gesicht.
Er hatte sie noch nie geschlagen, aber gestern Abend hatte sie zum ersten Mal Angst vor ihm gehabt. Angesichts der Wut in seinen Augen, als sie sich ihm widersetzte und ein weiteres Bier ausschüttete, hatte sie sich gefragt, wie sie endgültig aus dieser Beziehung kommen sollte.
Der Anruf auf dem Handy war in dem Moment eingegangen, als sie auf dem Weg zur Dienststelle in Helsingborg an Kvidinge vorbeifuhr. Sie hatte sich auf dreißig ungestörte Minuten Fahrtwind auf ihrer Ducati gefreut. Doch wenn in Bjuv ein elfjähriger Syrer auf dem Schulweg spurlos verschwunden war, hatte sie keine Wahl.
Wenn es doch bloß ein schwedischer Junge gewesen wäre, dachte sie, während sie einen Prius überholte, der sich stur knapp unterhalb des Tempolimits fortbewegte. Dann hätte sie ihn in der Gewissheit, dass das Kind lediglich die Schule schwänzte und mit seinem Kumpel hinter irgendeinem Gebüsch saß und rauchte, den Uniformierten überlassen können.
Aber seit dem brutalen Mord vor zwanzig Jahren in der Nachbargemeinde Klippan hatten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit mit jedem Tag zugenommen. Damals hatte der Neonazi Pierre Ljunggren wie zufällig den dunkelhäutigen Gerard Gbeyo ins Visier genommen, hatte ihn mit Hakenkreuzbinde an seinem Oberarm und Butterflymesser in der Hand gejagt und auf offener Straße einfach so niedergestochen.
Neonazis und Rechtsextreme gab es zwar überall im Land, aber in Schonen war es wohl am schlimmsten. Da konnten die Kommunalpolitiker in dem Versuch, den rassistischen Makel zu verschleiern, noch so oft betonen, Schonen sei buchstäblich die grünste Landschaft in Schweden. In den Augen der Allgemeinheit war diese Region eher die braunste.
Sie selbst teilte diese Ansicht, und als Hampus sie an ihrem Geburtstag mit einem unterzeichneten Kaufvertrag für das Haus überrascht hatte, war sie total ausgeflippt. Es lag zwar in Perstorp, aber für sie machte das keinen großen Unterschied. Allein bei dem Gedanken, in einer Einfamilienhausgegend zu wohnen, in der alle in Tennissocken herumliefen, die Flagge von Schonen hissten und der Meinung waren, die steigenden Einwandererzahlen wären eine Bedrohung für die Nation, bekam sie schlechte Laune.
Außerdem hatte sie niemals ein Haus kaufen wollen, und dass ihr Hampus seine Anzahlung als Geschenk an sie verkaufen wollte, machte sie noch wütender. Er hatte sie nicht nur hintergangen, sondern versuchte auch, ihr seinen Traum vom Haus mit Garten aufzuzwingen.
Nachdem sie nun seit einem Jahr darin wohnten, war ihre Einstellung nicht mehr ganz so negativ, obwohl der rote Bungalow noch immer das hässlichste Haus war, das sie je gesehen hatte. Dass Hampus mit der Heckenschere Amok gelaufen war und jeden Wacholder entweder in eine Kugel, einen Strich oder, in den völlig missglückten Fällen, in ein männliches Geschlechtsorgan verwandelt hatte, machte es nicht viel besser.
Aber die Nachbarn in der Straße waren, soweit sie das nach den wenigen Begegnungen beurteilen konnte, eigentlich ganz nett, bis jetzt hatte sie weder Tennissocken zu Gesicht bekommen noch sich fremdenfeindliches Geschwafel anhören müssen. Perstorp war anscheinend eine der wenigen Gemeinden, in denen rechtsextreme Aktivitäten im Lauf der vergangenen Jahre abgenommen hatten. Wie es in Bjuv aussah, wusste sie nicht, aber viel schlimmer als in Sjöbo, Trelleborg oder Landskrona konnte es nicht sein.
Trotzdem hatte sie ein mulmiges Gefühl, als sie in den Gunnarstorpsväg einbog und die Maschine direkt gegenüber dem dreistöckigen weißen Haus an der Abzweigung Vintergata abstellte.
Es war alles ruhig. Bis auf einen Mann in Jogginghose und schwarzer Kapuzenjacke, der neben einem Laternenpfahl stand und auf Arabisch telefonierte, während er darauf wartete, dass der Hund an der Leine sein Geschäft erledigte. Ein Stück entfernt überquerte ein schlaksiger Mann mit etwas zu weit hochgezogener Hose am Fußgängerüberweg die Straße und eilte an einer jungen Mutter mit Kinderwagen vorüber, die vermutlich auf dem Weg zum Einkaufszentrum von Bjuv war, das einen Wettbewerb der deprimierendsten Orte in Schweden mit links gewonnen hätte.
Die weiße Wandfarbe im Eingangsbereich war mit verschiedenen Farben gesprenkelt, als hätte der Maler den Auftrag gehabt, dem frischen Anstrich von vornherein einen schmutzigen Touch zu verleihen. Auf der dort angeschlagenen Tafel waren ebenso viele schwedisch wie ausländisch klingende Namen verzeichnet.
Moonif Ganem wohnte oben im zweiten Obergeschoss mit Aimar, Adena, Bassel, Jodee, Ranim, Rosarita und Nizar zusammen. Das stand zumindest in einer Schrift aus Bügelperlen an der Wohnungstür.
Nach einigen vergeblichen Versuchen mit der Klingel öffnete sie die Tür und betrat den Flur, in dem ein Chaos aus Schuhen und Jacken herrschte. Aus einem der hinteren Zimmer war eine Mischung aus erbosten Stimmen und Schluchzern zu hören.
Die Eltern saßen in der vollgestopften Küche am Esstisch. Die Mutter, die ein langes dunkles Kleid und ein violettes Kopftuch trug, weinte trotz der Versuche ihres Mannes, sie zu trösten. Zwischen den Saftgläsern und anderem Frühstücksgeschirr auf dem Tisch lagen Tarotkarten, und auf einer Wolldecke auf dem Fußboden spielte ein Baby mit verschiedenen Messbechern.
»Hallo. Sie müssen von der Polizei sein.«
Lilja drehte sich um und sah eine Frau um die sechzig mit kurzem grauem Haar und energischem Blick in die Küche kommen.
»Ingrid Samuelsson.« Die Frau gab ihr die Hand. »Ich habe angerufen und den Jungen als vermisst gemeldet. Ich wohne in der Wohnung gegenüber.«
»Dann können Sie mir vielleicht erzählen, was passiert ist.«
Die Frau warf der Mutter einen Blick zu, diese nickte. »Um halb neun kam Adena außer sich vor Sorge zu mir. Da hatte Moonifs Lehrer gerade angerufen und gefragt, warum er nicht in der Schule war.«
»Und wieso sind Sie sich so sicher, dass etwas Ernstes vorgefallen ist? Er könnte doch auch schwänzen.«
»Schwänzen? Ich verstehe nicht.« Die Mutter rang um Fassung.
»Sie meint, Moonif wäre einfach nicht zur Schule gegangen.«
Die Mutter schien nicht zu begreifen, was sie meinte. »Mein Moonif würde niemals … Er ist sehr gut in der Schule. Schule macht ihm großen Spaß.«
Die Frau nickte und wandte sich wieder an Lilja. »Adena hat recht. Das weiß ich, weil ich selbst Lehrerin gewesen bin und ihm manchmal bei den Hausaufgaben helfe.«
»Verstehe. Aber er ist ja erst elf. Vielleicht ist er mit einem Schulkameraden unterwegs und hat die Zeit vergessen.«
»Die Karten sagen was anderes«, sagte die Mutter.
»Was für Karten?«
»Die Karten auf dem Tisch.« Die Mutter tippte auf die Karte, auf der ein Skelett in einem zerrissenen Umhang abgebildet war. »Sie sagen, dass etwas sehr Schlimmes passiert ist.« Sie hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht zu weinen.
»Nur damit ich das richtig verstehe. Sie haben also die Polizei gerufen, weil diese Karten da –«
»Verzeihung, darf ich auch mal was sagen?«, fiel die ältere Frau ihr ins Wort und stellte sich zwischen Lilja und die Mutter. »Unter uns gesagt, glaube ich auch nicht, dass etwas Schlimmes passiert ist. Genau wie Sie vermutet haben, geht er gemeinsam mit Samira aus dem Nachbarhaus zur Schule. Nichts gegen sie, aber sie kommt ständig auf Ideen, die ganz und gar nichts mit Schule zu tun haben, um es vorsichtig auszudrücken.«
»Trotzdem rufen Sie die Polizei. Als ob wir sonst nichts zu tun hätten.«
»Was hätte ich denn tun sollen? Sie war außer sich vor Sorge. Das sehen Sie doch selbst.« Die Frau drehte sich zu der Mutter um, die noch immer leise weinte. »Wir geben ihnen ein Dach über dem Kopf und das Nötigste zum Leben. Aber wie wollen wir erreichen, dass sie sich hier zu Hause fühlen, wenn wir nicht ab und zu ein bisschen Mitgefühl zeigen? Genau das hatte ich gehofft. Dass jemand von euch kommt und beweist, dass sie uns nicht egal sind.«
Lilja schämte sich. Nicht vor der Frau, sondern vor sich selbst. Weil sie nur aktiv wurde, indem sie die Linken wählte und Geld an Hilfsorganisationen spendete, wenn etwas besonders Schreckliches in den Nachrichten kam. In Wirklichkeit war sie genauso untätig wie alle anderen. »Sie haben recht.« Sie nickte. »Es tut mir leid.«
Dann zog sie ihren Notizblock aus der Tasche, ging zu den Eltern hinüber und hockte sich neben sie. »Mein Name ist Irene Lilja. Ich arbeite bei der Polizei Göteborg und werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit Moonif wieder nach Hause kommt.«
»Vielen Dank.« Die Mutter wischte sich die Tränen ab. »Aimar spricht nicht gut Schwedisch, aber er ist auch sehr froh, dass Sie da sind.«
Sie lächelte den Vater an. »Erst einmal brauche ich ein Foto von Ihrem Sohn.«
»Darum kümmere ich mich.« Die Nachbarin verschwand.
»Können Sie beschreiben, was er anhatte, als er die Wohnung verließ?«
»Seine rote Hose und die blaue Jacke mit den Spiderman-Knöpfen.«
»War heute Morgen irgendetwas anders an ihm?«
»Nein, es war alles wie immer. Er ist so ein braver Junge.« Die Mutter schüttelte den Kopf.
Der Vater sagte etwas auf Arabisch.
»Moonif wollte das Altglas nicht mitnehmen. Aber alle müssen mithelfen, habe ich gesagt. Die Schweden sortieren alle ihren Müll, und deshalb machen wir es auch. Schließlich hat er das Altglas mitgenommen, obwohl er keine Lust hatte.«
»Und wo wohnt diese Samira?«
»Im Haus gegenüber im ersten Stock.« Die Frau zeigte aus dem Fenster.
»Hat der Lehrer gesagt, ob sie da war?«
»Ich weiß nicht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass ich vergessen habe zu fragen.«
Lilja nickte und legte der Mutter eine tröstende Hand auf den Arm, als die Nachbarin mit einem Schulfoto zurückkam, auf dem der ordentlich gekämmte Junge in einem weißen Hemd mit Weste und Fliege steckte.
»Mir hat er erzählt, er hätte sich den Aufzug selbst ausgesucht und sich so fein gemacht, um Samira zu gefallen«, sagte die Frau leise, während die Mutter ein Räucherstäbchen anzündete und die Tarotkarten mischte. »Ich glaube, die beiden sind ein bisschen verliebt.«
Lilja hastete die Treppe hinunter. Sie brauchte frische Luft. Von dem Räucherstäbchen war ihr übel geworden, und als die Mutter auch noch die Karten fragte, wie die Polizei am besten vorgehen sollte, hatte sie das Gespräch beenden müssen.
Der Statistik zufolge würde der Junge in Kürze von selbst wieder auftauchen, und das Ganze würde sich aufklären. Trotzdem hatte sie versprochen, sowohl die Schule als auch Samira und ihre Eltern zu kontaktieren und, falls dabei nichts herauskam, die örtliche Polizei in Bjuv zu einer Fahndung zu veranlassen.
Das Schild an der Stahltür, die einen Spalt offen stand, brachte sie auf andere Gedanken. Anstatt hinauszugehen und frische Luft zu atmen, öffnete sie die schwere Tür neben der Kellertreppe.
Recyclingstation.
Laut seiner Mutter war Moonif mit dem Altglas dorthin gegangen, und vielleicht hatte er eine Spur hinterlassen.
Als sie den Raum betrat, ging an der Decke automatisch eine Neonröhre an. Abgesehen von mehreren rollbaren Containern, die in einer Reihe vor den schmutzigen Betonwänden standen, war es hier ebenso leer wie still. Es war niemand da. Trotzdem beschloss sie, einen Müllcontainer nach dem anderen zu öffnen und in den Tetrapaks, Zeitungen und klebrigen Plastikverpackungen zu wühlen.
Einen Hinweis auf den verschwundenen Jungen konnte sie jedoch nicht entdecken. Das tat sie erst, als sie die Lampe an ihrem Handy einschaltete und unter einen der Müllcontainer leuchtete. Im selben Moment begriff sie, dass sie einem furchtbaren Irrtum erlegen war und die Mutter und ihre Tarotkarten recht gehabt hatten.
Der kleine Knopf mit dem blau-roten Superhelden lag unter dem Behälter für Weißglas. War er lose gewesen, oder hatte jemand mit Gewalt an dem Jungen gezerrt? Jemand, der zufällig zur selben Zeit wie der Junge mit seinem Altglas in den Müllraum gekommen war und seine Chance gewittert hatte. Jemand, der auch im Haus wohnte.
Sie ging zurück in den Eingangsbereich, stellte sich vor die blaue Filztafel mit den Namen der Hausbewohner und wählte die Nummer von Sverker »Klippan« Holm.
»Hallöchen. Wie läuft’s? Ich habe gehört, du hast in meinem netten kleinen Heimatort haltgemacht.«
»Wie nett er ist, wird sich zeigen. Bis dahin brauche ich deine Hilfe bei einer kurzen Überprüfung der Bewohner dieses Hauses.«
»Kein Problem. Um welche Adresse geht es?«
»Vintergata 2 A.«
»Oh, da bist du wirklich in meiner Heimatgegend. Weißt du, dass ich meine ersten wackligen Schritte im Garten der Trumpetgata 8 gegangen bin, wenige Minuten entfernt von dort? Es hat sich natürlich alles verändert, aber –«
»Nicht jetzt, Klippan«, unterbrach ihn Lilja und sah ein, dass sie besser Astrid Tuvesson oder Ingvar Molander angerufen hätte.
»Okay, aber sag Bescheid, wenn ich dir einen guten Mittagstisch empfehlen soll, denn wenn du mich fragst, isst man immer noch am besten bei Schnitzel & –«
»Klippan, verdammt noch mal!« Ihre Stimme hallte durchs gesamte Treppenhaus. Sie bemühte sich, leiser zu sprechen. »Ich habe den Verdacht, dass er noch im Haus ist, bei irgendwelchen Nachbarn, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich möchte auf keinen Fall zu spät kommen.«
»Ein vorbestrafter Pädophiler wohnt jedenfalls nicht in dem Haus.« Klippans Ton war deutlich anzumerken, dass er sich auf den Schlips getreten fühlte.
»Im Moment würde mir ein potenzieller auch reichen«, erwiderte Lilja in einem Ton, der nicht verhehlte, wie egal ihr das war.
»Haben wir da auch nicht. Aber im ersten Obergeschoss gibt es einen Erzieher, der in einer Kindertagesstätte namens Solrosen arbeitet, das ist nicht weit …«
»Hast du den Namen? Ich brauche einen Namen.«
»Da müsstest du mich mal ausreden lassen. Er heißt Björn Richter, ist zweiunddreißig Jahre alt und lebt, soweit ich sehe, allein mit all seinen …«
»All seinen was?« Liljas Blick fiel auf einen kleinen rostfarbenen Fleck an der Wand neben der Kellertreppe.
»Moment, ich muss kurz nachschauen, ob er das ist.«
Es war nicht so, dass sie ihn vorher nicht bemerkt hätte. Sie hatte ihn nur für einen der scheußlichen Sprenkel gehalten.
»Doch, stimmt. Wenn das nicht creepy ist …«
»Klippan, was machst du da?«
Dieser Fleck war jedoch einen Tick größer als die anderen und auf der einen Seite auf eine Weise verwischt, die dafür sprach, dass er später hinzugekommen war.
»Ich, ich will nur erst …«
Sicher konnte sie sich natürlich nicht sein. Dafür musste sie ihn von Molander analysieren lassen. Aber es sah zumindest aus wie Blut. Falls es von dem Jungen stammte, deutete die Stelle darauf hin, dass der Junge nicht durch die Haustür nach draußen, sondern in den Keller gegangen war, und deshalb ging sie die Treppe hinunter, als sie plötzlich merkte, dass es am anderen Ende der Leitung so still war, weil das Gespräch unterbrochen worden war.
Genau wie bei der Recyclingstation stand die Kellertür einen Spalt offen, und auch hier reichte ihre bloße Anwesenheit aus, um die Neonröhren an der Decke zum Flackern zu bringen.
»Lager« stand auf der grau lackierten Metalltür auf der linken Seite, »Elektrizität« auf der Tür geradeaus. Beide waren abgeschlossen. Rechts gab es zwei weitere Türen. Eine davon stand offen.
Auf dem Weg dorthin kam sie an einer Wandtafel vorbei, auf der die Bewohner mithilfe eines persönlichen Chips Waschmaschinen buchen konnten. Natürlich befand sich hinter der Tür der Waschkeller, und den Geräuschen nach zu urteilen, lief mindestens eine Maschine.
Die Neonröhren sprangen an, und sie registrierte auf den ersten Blick, dass der Waschkeller genauso eingerichtet war wie der in dem Mietshaus in Helsingborg, in dem Hampus und sie gewohnt hatten, bis sie den Bungalow in Perstorp bezogen hatten. Drei Waschmaschinen in einer Reihe, ein Trockner, ein Trockenschrank und eine alte Mangel, die niemand benutzte.
Die hinterste Maschine lief. Sie war um einiges größer als die beiden anderen und hatte genug Fassungsvermögen für einen größeren Flickenteppich oder die Bettwäsche von drei Personen auf einmal. In Helsingborg hatten sie auch so eine gehabt, und allein das wäre Grund genug gewesen zurückzuziehen.
Blutflecken oder andere Hinweise auf den Jungen konnte sie hingegen nicht entdecken. Sie ging zurück in den Gang und beschloss, es noch einmal mit der Tür zum Lager zu versuchen. Sowohl die Eltern des Jungen als auch die Nachbarin mussten ja einen Schlüssel dazu haben.
Als jedoch die Waschmaschine einen Gang hochschaltete und zu schleudern begann, begriff sie, was hier nicht stimmte, blieb stehen und betrachtete die Wandtafel. Es war Mittwoch, der 13. Juni, aber in keinem einzigen Schlitz unter der Ziffer dreizehn steckte ein Chip.
Mit anderen Worten: Es hatte heute niemand eine Waschmaschine gebucht.
4
In seinem Headset tutete es in so großen Abständen, dass er das Gefühl hatte, jemand hätte das Telefon absichtlich umprogrammiert, um ihn zu stressen. Beim ersten Versuch vor zwei Minuten war das Tuten in einen Besetztton übergegangen, doch diesmal schleppte es sich dahin, und Fabian musste auf dem Krankenhausflur auf und ab gehen, um Ruhe zu bewahren.
»Hallo.«
Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er tatsächlich Sonjas Stimme und nicht ein weiteres Klingelzeichen gehört hatte. »Weißt du, was passiert ist, Sonja?«
»Äh, was?«
»Setz dich hin und hör mir zu, denn es ist –«
»Entschuldige, Fabian, aber ich bin gerade beschäftigt. Ist es wichtig?«
»Das kann man wohl sagen. Es ist nämlich so …«
»Sind wir jetzt fertig, oder was? Ich muss los«, hörte er Theodor im Hintergrund.
»Du musst nichts dringender als hierbleiben.«
»Wozu denn? Wenn Papa und du euch sowieso …«
»Theo, du gehst nirgendwohin!«
»Was ist passiert, Sonja?«
Ein lang gezogenes müdes Seufzen ertönte. »Ich war in seinem Zimmer, um die Schmutzwäsche einzusammeln und sein Bett frisch zu beziehen, mein Gott, wenn du wüsstest, wie es da aussieht. Wie auch immer, beim Aufräumen fand ich zwei …« Sie verstummte. »Du, ich glaube, wir sollten später darüber sprechen … Erzähl mir lieber, was so wichtig ist.«
Fabian hatte den Faden verloren, aber als er sich umdrehte und die Krankenschwestern links und rechts von Matildas Bett sah, die vollauf damit beschäftigt waren, Werte zu messen, fiel ihm wieder ein, warum er angerufen hatte. »Sie ist aufgewacht. Matilda ist endlich aufgewacht.«
»Was, wirklich? Aber … Ist das wahr? Wie geht es ihr?«
»Gut. Glaube ich. Jedenfalls den Umständen entsprechend. Die Werte sehen angeblich gut aus, aber wenn du mich fragst …« Er suchte nach den richtigen Worten.
»Soll das heißen, es geht ihr nicht gut? Fabian, wovon redest du?«
»Vielleicht liegt es an mir, aber …«
»Ich komme sofort vorbei.«
Bevor Fabian klar war, dass Sonja aufgelegt hatte, war eine der drei Krankenschwestern bei ihm.
»Wir lassen euch jetzt in Ruhe. Wenn was ist, braucht ihr nur zu klingeln.«
Fabian nickte und wartete, bis alle den Raum verlassen hatten. Erst dann steckte er sein Handy in die Hosentasche und ging zurück zu Matilda, die im Krankenbett lag und ins Nichts starrte. Er räusperte sich, erntete aber keine Reaktion. Er versuchte es noch einmal, aber sie schien nicht einmal seine Anwesenheit zu bemerken. Wenn sie nicht hin und wieder geblinzelt hätte, wäre er überzeugt gewesen, dass irgendetwas furchtbar schiefgegangen war.
Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich an die Bettkante. »Hallo, Matilda.« Er griff so vorsichtig wie möglich nach ihrer Hand, um die Kanüle nicht zu berühren, die mit Pflaster an ihrem Handrücken befestigt war. »Wie geht es dir?«
Nach einer Weile wendete sie den Kopf in seine Richtung, als ob allein das eine Kraftanstrengung wäre, und sah ihn wieder so an wie in dem Moment, als sie gerade aufgewacht war. Ihr Blick war ebenso ruhig wie ernst und hatte nicht das Geringste mit der aufgekratzten und wissbegierigen Matilda zu tun, die er kannte. Genau das beunruhigte ihn.
Es war zweifelsohne Matilda, die in diesem Bett lag. Trotzdem hatte er nicht das Gefühl, dass sie diejenige war, die ihn ansah.
»Ich weiß nicht, ob du irgendeine Ahnung hast, was passiert ist«, sagte er, ohne genau zu wissen, wie er fortfahren sollte.
»Ich kann mich erinnern«, antwortete sie, und ihm war sofort klar, dass sie ebenso detaillierte Bilder des Geschehens im Kopf hatte wie er selbst.
Der Täter musste sich Zugang zum Haus verschafft und sie und ihre Freundin Esmeralda überrascht haben. Vielleicht waren sie gerade mitten in einer ihrer spiritistischen Sitzungen unten im Keller gewesen. Er hatte sie gezwungen, ihn nach oben zu begleiten, sich zu Sonja auf das Sofa zu setzen und abzuwarten, bis er nach Hause kam.
Er, ihr eigener Vater, der sie eigentlich beschützen sollte, aber oft weit weg war. Sogar wenn er zu Hause war. Er, der, als er endlich auftauchte, nicht auf die erste Warnung reagierte, sondern den Ernst der Lage erst begriff, als es zu spät war. Als die Kugel ihren Bauchraum zerfetzt hatte und sie blutend auf den Teppich gesackt war.
»Verzeih mir«, sagte er, bereute es aber gleich. Wie sollte sie ihm jemals verzeihen?
»Du hast dein Bestes getan«, sagte sie leise. »Mehr hättest du doch gar nicht machen können.«
Hatte er gerade richtig gehört? War das wirklich seine Matilda?
»Es ist auch gar nicht das Problem.« Sie schien wieder wegzudämmern.
»Nein? Was denn dann? Sprich mit mir, Matilda, damit ich dir helfen kann.«
»Du kannst mir nicht helfen. Wie so vieles steht es nicht in deiner Macht.«
»Das verstehe ich nicht. Was ist denn das Problem? Du lebst, und die Ärzte sagen, du wirst wieder ganz gesund.« Er nahm auch ihre andere Hand. »Allein dass du hier liegst und mit mir redest, ist wundervoll.«
»Genau das ist das Problem.« Seufzend schloss sie die Augen. »Dass ich überlebt habe.«
»Jetzt hör mir mal zu, Matilda. Du glaubst doch wohl nicht, ich … Mama, die übrigens auf dem Weg hierher ist, und ich, wir lieben dich über alles. Das weißt du hoffentlich. Nichts könnte uns glücklicher machen als deine Rettung.«
Matilda schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht.«
»Okay.« Er suchte ihre Augen, aber sie war zu müde. »Könntest du mir nicht vielleicht erzählen, was los ist?«
»Du wirst es sowieso nicht verstehen.«
»Warum gibst du mir nicht wenigstens eine Chance?« Sosehr er sich wünschte, sie würde sich ihm anvertrauen, konnte er ihr Schweigen verstehen. Er war derjenige gewesen, der das Monster hereingelassen hatte.
»Greta.« Ihr Flüstern war so leise, dass Fabian sich unsicher war, ob er sich verhört hatte.
»Greta?«
Matilda schluckte. »Wasser … Kann ich Wasser haben?«
Fabian eilte zum Waschbecken, füllte einen Plastikbecher und reichte ihn ihr. »Nur damit ich das richtig verstehe. Diese Greta. Ist das dieser Geist, den du und Esmeralda unten im Keller konsultiert habt?«
»Kein Geist.« Matilda schüttelte den Kopf. »Ein geistiges Wesen. Sie hat gesagt, jemand aus unserer Familie würde sterben.«
Fabian hatte die spiritistischen Spielchen von Anfang an für eine schlechte Idee gehalten, und nun war ihr das Ganze so zu Kopf gestiegen, dass sie beim Aufwachen als Erstes daran dachte. »Aber, meine Süße, du hast doch überlebt.«
»Aber wenn ich nicht … Dann wird einer von euch …«
»Matilda, hör mir zu. Was passiert ist, hätte niemals passieren dürfen. Trotzdem war es so, und dafür bist weder du noch ein Geist namens Greta oder irgendein anderes Wesen, das ihr mit eurem Hokuspokus beschworen habt, verantwortlich. Die Verantwortung trage ich. Ich bin derjenige, der –«
»Niemand ist schuld«, unterbrach ihn Matilda mit einem leisen Seufzer. »Sie weiß einfach nur, was passieren wird, das ist alles.« Eine einzelne Träne lief ihr über die Wange.
Fabian nahm sie in den Arm. »Matilda, es ist nicht so, als würde ich deine Sorge nicht verstehen. Im Gegenteil. Du glaubst offenbar daran. Aber versuch doch bitte, es als Traum zu betrachten.«
»Als Traum? Es ist kein Traum.«
»In gewisser Hinsicht schon. Nur kannst du das nicht erkennen. Und wie solltest du auch? Woher soll man wissen, dass man eigentlich im Bett liegt und schläft?«
Ihre Lider wurden immer schwerer, aber ihr Mund bewegte sich. Um sie zu verstehen, beugte er sich zu ihr hinunter.
»Und was, wenn du im Bett liegst und schläfst?«
5
Trotz der Neonröhren an der Decke warfen die Kamerablitze ein so starkes Licht auf sie, dass sich ihr Schatten auf der weißen Betonwand abzeichnete. In den sechs Jahren bei der Mordkommission hatte sie Dinge gesehen, die selbst extrem abgebrühten Menschen den Schlaf geraubt hätten: von verwesten Leichen, die vom Boden geschabt werden mussten, bis zu Folteropfern, deren Anblick allein Schmerzen verursachte.
Leichen.
Als das hatte sie sie immer betrachtet, wenn sie sich in der Rechtsmedizin oder, wie jetzt, an einem Tatort befand. Leichen. Keine Menschen mit echten Leben, Träumen und Hoffnungen, sondern leblose Körper. Eine Ansammlung von Atomen, die in der Summe eine Masse bildeten. Nur so konnte sie ihre Gefühle auf Abstand halten, einen kühlen Kopf bewahren und logisch denken.
Doch nun ging das nicht mehr. Der Schock hatte sie noch immer so fest im Griff, dass sie lediglich auf einem Hocker sitzen und die Wand anstarren konnte. Allerdings waren dort abgesehen von ihrem Schatten, der sich jedes Mal zeigte, wenn einer von Molanders Assistenten ein Foto machte, auch einige eingeritzte Hakenkreuze und rassistische Kampfbegriffe zu sehen, die jedoch zu alt wirkten, um mit dem Mord in Verbindung gebracht zu werden.
Zum ersten Mal befand sie sich an einem Tatort, ohne das Mordopfer ansehen zu können. Nicht einmal für einen Augenblick.
Es war nämlich nicht nur eine Leiche. Es war ein elfjähriger Junge mit schönem Namen, einer Jacke mit Spiderman-Knöpfen und Freunden. Ein Junge, der sein ganzes Leben noch vor sich gehabt hätte. Dem eine Einkaufstüte voller Altglas in die Hand gedrückt worden war, das er auf dem Weg zur Schule in den Recyclingkeller bringen sollte. So weit war er jedoch nicht gekommen. Er war überfallen und in den Waschkeller geschleppt worden.
Obwohl sich Molander und seine beiden Gehilfen mehr als deutlich ausgedrückt hatten, konnten sie noch immer nicht begreifen, was genau sich danach abgespielt hatte.
»Ich weiß nicht, Ingvar. Ich habe kein gutes Gefühl.«
»Fredrik, deine Gefühle solltest du mit deinem Therapeuten oder deiner Freundin besprechen«, sagte Molander so trocken und sachlich wie immer. »Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, die Leiche da rauszukriegen. Oder wolltest du die Waschmaschine in diesem Zustand zur Benutzung freigeben?«
»Nein, aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie wir das machen sollen. Ohne die Leiche noch mehr zu beschädigen.«
»Alright.« Molander seufzte. Es knackte, als er in die Knie ging. »Ich schlage vor, wir montieren die Trommel ab und öffnen sie mit einem Winkelschleifer. Was sagen deine Gefühle dazu?«
»Hier habt ihr euch also versteckt.«
Lilja drehte sich um, und als sie Klippan in der Tür stehen sah, atmete sie ein wenig auf.
»Wie läuft es bei euch?«, fuhr er fort, während Molanders Assistenten die Rückwand der Waschmaschine abschraubten.
»Es ist aus naheliegenden Gründen nicht ganz einfach, ihn da rauszukriegen.« Molander stand auf und streckte den Rücken durch. »Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben.«
»Gibt es denn mehr als einen Grund?«, fragte Lilja, hauptsächlich, um zu signalisieren, dass sie wieder voll dabei war.
»Das kann man wohl sagen. Um genau zu sein, tausendfünfhundert Umdrehungen pro Minute.«
»Scheiße …« Klippan schüttelte den Kopf. »Bei so was fragt man sich allmählich, was aus dieser Welt werden soll.«
»Allmählich? Ich frage mich das schon lange«, ächzte Molander, während er seinen Assistenten half, die zylinderförmige Waschtrommel aus dem Gerät zu heben und auf eine Decke zu legen. »Wenn ihr die Trommel an dieser Schweißnaht durchtrennt, müsstet ihr sie problemlos in zwei Hälften brechen können. Okay?« Die Assistenten nickten, und Molander wendete sich wieder Klippan und Lilja zu. »Es wird gleich ziemlich laut. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt es lieber jetzt.«
»Habt ihr etwas Interessantes gefunden?«
»Nicht direkt. Ein paar Blutspuren, vermutlich von dem Jungen. Und Fingerabdrücke von mindestens fünfzig Personen, darunter einige an recht merkwürdigen Stellen, wenn man bedenkt, dass man hier eigentlich nur wäscht.«
»Zwei Uniformierte aus der Dienststelle hier in Bjuv klappern die Wohnungen im Haus ab und sammeln Fingerabdrücke«, sagte Lilja. »Mal sehen, ob wir Übereinstimmungen finden.«
»Du hast also einen der Mieter in Verdacht?«, fragte Klippan.
Lilja zuckte mit den Achseln. »Ich denke nur, dass jemand, der die Gemeinschaftsräume und die große Waschmaschine hier kennt und außerdem über einen Schlüssel zu allen Räumlichkeiten verfügt, es leichter hat.«
»Er könnte auch den Schlüssel des Opfers benutzt haben«, sagte Molander. »Interessanter wäre es, wenn ihr Fingerabdrücke findet, die nicht mit den Hausbewohnern übereinstimmen.«
»Und das Hakenkreuz da.« Klippan zeigte auf die Wand hinter Lilja.
»Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.«
»Trotzdem könnte dasselbe Motiv dahinterstecken«, sagte Lilja.
»Na, nun wollen wir mal keine übereilten Schlüsse ziehen.« Klippan sah sich um.
»Natürlich nicht, wir müssen uns ja alle Türen offen halten bla, bla, bla. Aber wenn jemand einen Jungen, der aus Syrien geflohen ist, dazu zwingt, sich in eine Waschtrommel zu zwängen, kann dahinter doch nur Rassismus und …«
Das schrille Geräusch, mit dem sich der Winkelschleifer durch das Metall fraß, dass die Funken flogen, übertönte alles andere, und Lilja und den anderen blieb nichts weiter übrig, als sich die Ohren zuzuhalten und abzuwarten, bis die Assistenten die Trommel vorsichtig öffnen konnten.
Nachdem Lilja vorher nicht in der Lage gewesen war hinzusehen, konnte sie den Blick nun nicht mehr von dem Jungen losreißen. Wenn man nur das Gesicht betrachtete, ahnte man kaum, was passiert war. Den geschlossenen Augen hinter dem verfilzten Haar nach zu urteilen, schien er zu schlafen.
Doch Moonif schlief nicht.
Nacken und Rücken waren gebeugt wie bei einem missgebildeten Fötus und beschrieben einen nahezu perfekten Bogen. Auch die Beine waren gebeugt, aber von den Knien an in die falsche Richtung, und verliefen rechts und links vom Kopf bis hinter die Schultern, wo sich die Füße an den Körper pressten.
Der Anblick bohrte sich durch alle Schichten von Berufserfahrung und ließ jeden im Raum innehalten. Sogar Molander wirkte erschüttert. Niemand sagte etwas. Klippan, der bis jetzt ruhig geblieben war, stand mit offenem Mund da, sodass der herzzerreißende Schrei von ihm zu stammen schien.
Es war jedoch nicht Klippans Stimme, sondern die einer Frau.