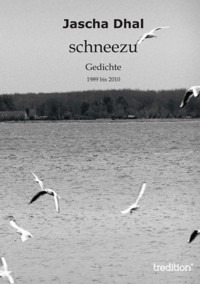14,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der schwule Lehrer Groth wird im Frühjahr 1988 plötzlich mit dem Tod seines Freundes David konfrontiert, den er aus Kindertagen kennt. Sein erstes gemeinsames Bild mit ihm erinnert er als das Schlachten eines Schweines, dem beide Kinder zusehen. Langsam erkennt er, dass er sein Leben lang Gewalt erdulden musste. Groth erinnert sich jener Zeit in vielen Rückschauen und kommt zu dem Schluss, sein Leben ändern zu müssen. Er will nicht mehr lügen und stellt sich im Unterricht gegen die offizielle Geschichtsschreibung in der DDR. Dadurch gerät er in Konflikt mit Schulleitung und Staatssicherheit, wird 1989 aus dem Schuldienst entlassen und arbeitet als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Die Gewalt gegen ihn hört jedoch nicht auf. Erinnerungsfetzen zeigen seine wachsende Unruhe. 1990 erlebt Groth den Fall der Mauer, ist aber unschlüssig, kann keine Haltung zu den Vorgängen und der Nachwendezeit beziehen. Auch seine Beziehungen zerbrechen nacheinander zumeist mit Gewalt, und Groth glaubt, daran schuld zu sein. So sieht er nur noch einen Ausweg für sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jascha Dhal
Der zugefrorene Traum
Ein Wände-Roman
Hamburg 2013
© 2013 Jascha Dhal
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-7262-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Figuren dieses Romans, außer Personen des öffentlichen Lebens, sind – wie die Handlung – frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.
1
Mauern
oder
Tauben scheißen nicht im Flug
1.
DIE MÖWEN fliegen über die Mauer, die grau drohend deine Wege versperrt, übers Niemandsland in die fremde Welt. Bornholm, Bornholm. Und aus dem Osten weht ein schneidend-kalter Wind, der Groths grüne Haare in wildem Takt tanzen, seine sieben Häute sich kräuseln lässt, denn die dünne Lederjacke bietet kaum Schutz. Der Wind biegt die noch kahlen Bäume auf der Bornholmer und die in der Kolonie. Groth, du gehst einfach los, hast kein Ziel, du machst diesen Schnitt. Und es wird hell hinter den Häusern im feindlich-westlichen Wedding. Der Wind legt sich, die Sonne wärmt, als sei schon Sommer inmitten der vor kurzem noch eiskalten Welt. Die Bäume belauben sich beängstigend schnell und die Wiesenblumen recken ihre Buntheit ins Licht. Du probst den Flug. Und dir fällt ein: du hast dich nicht verabschiedet in dieser letzten Nacht von ihm, der da eben noch neben dir schlief. Dann breitest du deine Arme aus, die werden zu Flügeln. Und du fliegst, die Mauer unter dir wird zu einem Felsen. Und die Mauerspitze mit den Stacheldrähten, die tief ins Land hineinragen, aus dem du kommst, dem halben, eingezäunten Land, hat sich in deinem Traum, den du träumst, zur mächtigen Felsspitze gewandelt. Bedrohlich sticht sie in den Himmel. Und du weißt: Der schneebedeckte Gipfel, das ist Taubendreck, denn Tauben scheißen nicht im Flug. Tauben setzen sich auf die Mauerspitze und scheißen das Bauwerk weiß.
Du aber fliegst über den Berg, der eine Mauer ist, und dahinter tut sich eine Wiese auf. Und da ist da unten dieser glasklare Bergsee. Und in diesem Bergsee schwimmt eine kleine Insel, die will an Land. Aber die Wasser lassen die kleine Insel nicht an das Land. Und die Wellen toben nicht. Still liegt dieser See, eingebettet in einen tiefen, finsteren Wald aus Kiefern und Tannen. Und du ahnst, in deinem Traum, dass niemand diese Mauer aus Wald bezwingen kann, aber du weißt, diesen See irgendwann einmal durchschwimmen, die Insel aus ihrem Inseldasein befreien zu können. Irgendwann, in einem anderen Leben. Irgendwann, wenn du nicht mehr über die Mauer fliegen musst.
Und als du, immer tiefer und tiefer sinkend, fast schon die Spitzen der Tannen mit deinem nackten Leib berührst, kommt eine hauchfeine Bö, die schmiegt sich um dich und hebt dich empor. Dann, über der Insel, in einem Augenblick, in welchem du an daheim denkst und nicht mehr genau zu wissen scheinst, wie dein Bett aussieht und dein Leben, als der andere, der darin immer noch schläft, sich gerade auf die andere Körperseite legt, in einem Augenblick der Unachtsamkeit also setzt dich diese Bö sanft auf einer Wiese inmitten der kleinen Insel inmitten des glasklaren Sees ab.
Und die Bö ist lange schon fort, als du, immer noch sitzend zwischen seltsamen Bergblumen, weißt, du kommst nicht mehr von dieser kleinen Insel herunter: Du bist gefangen in der Idylle. Und du erinnerst dich deines Freundes, der in dieser kalten Wohnung im Prenzlauer Berg zurückgeblieben ist.
Da wachst du auf. Und du begreifst, dass Menschen eine Orientierung brauchen, selbst im Untergang noch, dem du zuströmst.
DIE MÖWEN fliegen über die Mauern der Stadt. Und du stehst am Fenster und siehst ihnen nach. Eben noch standest du unter der Dusche und empfandest das warme Wasser, das in dünnem Strahl deine Haut nässte, als angenehm. Kurz musstest du an den letzten Freitag denken, der alles veränderte, daran, dass der Schock auf der S-Bahnbrücke in der Leninallee dich so plötzlich ereilte. Eine Ewigkeit hast du nur an das Heute und vielleicht an den nächsten Tag gedacht, hast du die Bilder der Vergangenheit tief in dir eingeschlossen. Und es ist gut so gewesen, denn diese stagnierte Gesellschaft, in der du lebst, verträgt sich nicht mit deinen Bildern in dir.
Du ziehst dich an, machst dich fertig für den Tag. Denn heute ist Montag, der Alltag nimmt dich gefangen, der du ein Gefangener bist dieses Lands.
Und der andere, den du manchmal David nennst, wobei dieser jedes Mal resignierend abwinkt, der da immer noch reglos in deinem Bett liegt und leise schnarcht, wird noch eine Weile liegen bleiben, während dich das alte Schulgebäude aus gelben und roten brandenburgischen Backsteinen erwartet. Du musst fort.
Groth, du setzt das Kaffeewasser auf. Alle Arbeiten, die zu tun sind, bis sich der Schlüssel im Schlüsselloch dreht, verrichtest du mechanisch, ohne nachzudenken. Das Leben ist ein Traum an diesem Morgen. Noch ist es trübe, aber bald soll es klar werden, einen schönen Tag hat der Wetterbericht vorhergesagt. Lange noch sitzt du, das Frühstückstoast ist halb schon verdaut, und hörst wie abwesend die Nachrichten. Der SFB 2 warnt vor Smog, dabei hat die „Aktuelle Kamera“ gestern die Sonne versprochen. Du bist ganz gelassen. Es wird sich noch im Verlaufe des Tages herausstellen, wer hier lügt: der Osten oder der Westen dieser geteilten Stadt Berlin.
„Die alte Mutter Zeit macht uns zu Staubkörnern“, sagst du in Richtung des Bettes. „Und ihr großer Bruder, der ewige Wind, fegt uns zurück ins All. Markus, ach, Markus. Deine Zärtlichkeiten erreichen mein Herz nicht. Meine Seele liebt nur in der Vergangenheit. Dahin, dahin. David, den Seelenbruder Siams, finde ich nicht in dieser grauen, kargen Hölle.“
Und Markus blinzelt in den beginnenden Tag.
„Was redest du“, kommen die Worte aus trockener Kehle zu dir herübergeweht. Und heftig setzt Markus sich auf. Er springt plötzlich aus dem Bett zu dir und küsst dir deinen Zweifel fort, den kalten, blauen Zweifel. Und du beginnst erneut, ihn zu begehren, das Bild Davids scheint vergessen. Mit dem Geruch des Geliebten auf deiner Haut verlässt du das Haus.
DIE MÖWEN fliegen über die Mauern dieser Stadt. Du steigst an der S-Bahnstation Leninallee aus und siehst den Möwen nach und es riecht entsetzlich nach Exkrementen, hinter der Mauer des Schlachthofes schreien die Schweine. Jenseits von Eden, jenseits der Mauer. Und die Schlächter halten die Messer schon erwartungsvoll in den Händen und schreiten zur Exekution. Du verharrst. Über dir wölbt sich ein tiefblauer Himmel, neben dir laufen die Passanten durch den Wind in den beginnenden Tag. Die Bäume an der Leninallee schwingen leicht im Takt der Schreie schlachtreifer Schweine.
Groth genießt Markus’ Geruch auf der Haut, obwohl er ihm den gestrigen Morgen kaum verzeihen kann. Er verlangt eine Liebe ohne Bedingungen, und so, wie er sich zu ihm bekennt, muss Markus sich bekennen. Groth will sich öffentlich bekennen dürfen zu dem Menschen, den er liebt. Aber die gesellschaftlichen Verhältnisse sind nicht so. Das ist Markus’ Meinung, nicht seine. Und er sehnt sich in die Umarmungen Davids.
Und da sind wieder die Bilder vom Freitag und Groth beginnt wieder und wieder, seine Vergangenheit zu suchen, die ihm irgendwann abhandengekommen ist. Diese Geräusche, diese Schreie auf der Brücke begleiten ihn schon seit seinen Kindertagen. Er hat lange nicht daran gedacht, das erste Mal am Freitag, und nun wieder heute, in diesem Wind und unter diesem Himmel, an der Seite der düster dreinblickenden Passanten auf dem Gehsteig, fällt es ihm wieder ein, das Schlachten der Schweine als Ritual. Die Opferung des Tiers. Das rinnende, spritzende Blut. Damals hat alles begonnen: Davids Tod, Groths Sterben.
Du fühlst das Messer an der Kehle, das Messer. Die Schweine schreien hinter der Mauer, über die die Möwen hinweg fliegen, und es riecht entsetzlich nach Exkrementen. Dies übertönt – ein Schrei in dir – Markus’ Geruch und warme Haut. Du verharrst. Kurz würgt es dir den Hals. Und es ist ein Kloß, der wächst wie ein Hefeteig. Und es ist kein Sonntag.
Es sind die Bilder dieser Gewalt, die sich gegen dich richtet, die du so lange verdrängt hast. Aber dieses Bild vermischt sich in dir mit dem deiner wundervollsten ersten Liebe und zugleich mit dem Missbrauch deiner damals kindlichen Seele durch extensive Gewalt, das macht Verdrängung nötig. Sonst kann man nicht leben.
Und das erste Gewaltbild deiner Kindheit ist zunächst keins, und das erlebst du später tausendfach in dem kleinen Dorf deiner Kindheit und Jugend. Ein kalter, schneearmer Winter hat euch erreicht, der Kastanienbaum inmitten des Dreiseitenhofs reckt seine knorrigen, kahlen Äste in den lichtblauen Himmel. Es ist der Winter 1959. Du sitzt auf der eiserstarrten Schaukel, beobachtest David, den du liebst, beim Erforschen des toten Springbrunnens, zwei Schritte weiter. Dann plötzlich kommen sie, zwei Männer mit Schürzen. Sie tragen Messer und Werkzeug in den Händen und werden erwartet. Die langen Messer glitzern silbern im Licht. Schlächter schlagen, das Tier schreit, stumm sinkt es in den beigefarbenen Kies. Sie schneiden der Sau den Hals auf. Und das Blut strömt in den Emaileimer. Und der Schrei des Tieres hallt in dir nach, erreicht deinen Bauch. Und das Blut fließt rhythmisch, der Takt des Herzens, bis es ausgeblutet ist. Und es ist kein Sonntag. Denn am Sonntag sollst du ruhn. Und der Schrei des Tiers erstirbt.
Und du würgst. Und das Erbrochene fließt gegen den Kastanienbaum, dessen Schaukel, von der du eben abgesprungen bist, deinen Schädel stößt und du aufschreist und alle denken, du hättest dich verletzt und die Retter schon nahen, um den Schmerz fort zu pusten. Aber der Schmerz lässt sich nicht fortjagen wie ein streunender Hund.
Der Schmerz ist ein streunender Hund. Ihn kann auch David nicht verscheuchen mit seinen streichelnden Händen.
Und niemand weiß, dass du der toten Sau nachweinst. Nur David weiß es, David weiß alles von dir, und schaut, den Schrecken im Gesicht. Du spürst: Das Beige des Emaileimers besudelt sich mit Blut. Und das Blut versickert im Kies, langsam. Und der Vater nimmt den Eimer mit fort und trägt ihn in die Küche hinter der verglasten Veranda. Schwer steigt er dafür die riesige Freitreppe empor, tritt schlurfend die harten, granitenen Stufen. Und im Kies prangt eine kleine, kaum wahrnehmbare, blutende Sonne. Und die Sonne weint. Und die Sonne blutet. Und du blutest. Und du weinst. Und du siehst. Und David sieht. Und du ängstigst dein Herz. Und David ängstigt sein Herz. Und die unergründbare Tiefe deiner Seele, die sich rot einfärbt, schaust du mit geschlossenen Augen zur Sonne, zur roten im Kies und zur grellen am Himmel. Und die kleinen Abdrücke der Sau bleiben im Kies, die kleinen Vertiefungen, die bleiben, nachdem der Leichnam fortgeschleppt wurde, bis ein Fuhrwerk oder ein Menschentritt sie verwischen wird oder eine Bö darüber hinweg fegt. Oder David und du die Kuhle nutzen, um darin mit Murmeln zu spielen.
Und die unergründliche Tiefe deiner Seele. Die Welt, die sich nur scheinbar rot einfärbt vom Blute der Kreatur, ist in dir, aber nur, wenn du mit geschlossenen Augen in die Sonne blickst. Das Spiel deiner Kindheit. Die Passanten auf dieser dir endlos lang erscheinenden Brücke, dem Ort des Übergangs über imaginäre Grenzen hinweg in imaginäre Welten, sie bemerken von all dem nichts. Achtlos enteilen die Ohren den Schreien, vorbei an den Toren des Schlachthofes und der Freibankverkaufsstelle an der Ecke Hausburgstraße, hinüber auf die andere Straßenseite in die Fritz-Riedel-Straße die einen, geradeaus in Richtung Dimitroff-Straße die anderen. Einige biegen auch in die immer dunkle, enge, von Bäumen umstandene Hausburgstraße ein oder haben in der etwas lichteren Ebertystraße ihr Ziel erreicht. Niemand achtet auf den, der neben dem anderen geht. Jeder hat sein Ziel, das er stumm verfolgt. Seltsam still ist es in der Menschenwelt, während von fern die Schweine um Hilfe rufen. Unruhe bringen nur die stets ähnlich aussehenden Personenkraftwagen, die ein- oder auswärts auf der Leninallee fahren. Es existiert keine Hektik in diesem kleineren Teil der Stadt. Gleichmütig und grau liegt der Prenzlauer Berg inmitten der grauen halben Stadt.
Groth hat seine Schultasche unter den Arm geklemmt und sich eingereiht. Wer es nicht besser wüsste, könnte glauben, dass die Menschen, zu denen er gehört, ein sich ständig bewegendes Spalier für die Automobile bilden, die achtlos an ihnen vorbeifahren. Als erwarteten sie die schwarze, gepanzerte Limousine aus Wandlitz. Doch die fährt hier nicht entlang. Und niemand dieser Passanten spürt das Bedürfnis, sie zu sehen, ihm zu huldigen, der da einsam im Fond sitzt.
Groth macht sich Sorgen, denn er weiß nicht, ob Markus, der Mann in seinem Bett, bleiben oder gehen wird. Und er hofft, dass er bleibt nach diesem blauen, blauen Morgen. Nur die Schreie der Schweine machen ihn nervös, unruhig.
Und der Eimer ist längst fort und der Leichnam ist längst fort und der Mord wird gefeiert am Abend. Das gemordete Tier wird zweigeteilt, an eine Leiter gebunden, aufgehängt und in die Kälte des Winters gestellt. Irgendwann holt man den ausgekühlten Kadaver ins Haus. Und das Schreien hallt in dir nach, während die Mutter das Blut rührt in der Küche und es an die Wände spritzt, als du die Mutter schubst und sie dir drohend die rote Kelle vors Gesicht hält und es dich würgt. Groth, mach’s Maul auf. Aus dem Blut wird sie Grütze machen und Blutwurst. Man wird ihm auftischen, dem Kind. Und du erinnerst: Man tischt dir auf. Und du erinnerst das Blut, das gerührte, und die Gesichter schauen freundlich: Iss. Iss, freundlich. Und man hält dir die Gabel vor den Mund. Und du schüttelst den Kopf. Du kannst nichts sagen. Du kannst deinen Mund nicht öffnen.
Fast fünf Jahre bist du gerade alt in diesem Winter.
Öffnest du den Mund, schieben sie dir den Bissen hinein. Du kannst jetzt nicht essen. Du kannst jetzt nicht essen. Du kannst. Während der Gabelbissen im Schein der Lampe glänzt und du erinnerst den dampfenden Tierkörper, hängend an der Leiter, und der Vater wird schreien, gleich. Seine Stirn ist gerötet und du hörst den eruptiven Aufschrei, bevor er ausgestoßen ist, und du drückst dich vor den geröteten Augen des Vaters und vor der noch nicht erhobenen Hand.
„Mach’s Maul auf.“ Der Vater schreit: „Ver-stocktes Kind. Verstock-tes Kind, ver-stock-tes Kind.“ Und der Vater schreit. Und du siehst seinen riesigen, leeren Mund. Und du duckst dich. Mit kraftvoller Hand sperrt er dir’s Maul auf und schiebt den Gabelbissen hinein und dich würgt ’s und dich würgt ’s und die Mutter schreit. Und der Vater sitzt und schaut dich zornig an. Und die Mutter schreit. Und die Schwester sitzt verängstigt neben dir. Und der Vater sitzt zufrieden: „Na, bitte, es geht doch.“ Und du würgst und speist in hohem Bogen alles aus. Der Vater schlägt zu.
„Das Muttersöhnchen, dem werd ich’s geben, kotzt die Tischdecke … Dem werd ich’s aber geben! Dem Muttersöhnchen, dem, bekotzt die weiße Tischdecke.“
Und du liegst auf den Knien des Vaters und er schlägt dich mit seinen Hausschuhen auf deinen Hintern und entehrt dich. „Hast du denn keine Ehre im Leib“, und deine Ehre fließt aus deinen Augen, Groth, während deine Wangen brennen von den Schlägen, und deine Backen von den Schlägen und während dein Herz brennt von den Schlägen, während du Rache schwörst: Meine Ehre heißt Rache. Diese Bilder, Groth, gehen dir nicht aus dem Kopf, die bleiben bis zum Tod in dir. Und deine Schwester lachte, als du sie ihr später beschriebst. Und du hattest das erste Mal diese körperliche Gewalt gespürt: Und da wusstest du, wie gering du unter den Geringen bist.
Und du läufst fort, läufst, bis der Schmerz in der Lungengegend dich ausbremst. Da bist du am Wasser. Um dich ist Nacht. Und der Leuchtturm der Insel Walfisch liest dich vom Strand auf und bildet mit deinem Leib diese Pieta, dieses Kreuz aus Mensch und Licht, als er dich an das jenseitige Ufer trägt.
Die Möwen fliegen über den Strand hin zum Eiland inmitten der Lübecker Bucht. Und du liegst am Strand und sonnst dich, der kalte Winterwind macht dich frösteln. Aber du sitzt auf dem angestammten Baumstamm, lang ist die Sonne hinter dem Dorf aufgegangen. Sie kommen dich holen. Du hörst ihre Rufe, ihre Schritte. Du schweigst. Sind dir die Worte genommen. Die Schläge brennen nicht auf der Haut. Und ein höhnendes Lachen hallt in dir nach.
Decken haben sie mitgebracht, die Schläge werden folgen, du bist dir sicher. Die Angst weicht nicht von deiner Seite. Aber der heiße Tee tut dir gut, den sie aus einer Thermoskanne in einen Becher abfüllen und dir reichen. Sie umstehen dich, und es ist fast das halbe Dorf. Die Schwester hinter den massigen Leibern der Erwachsenen feixt. Auch daran wird sie sich später nicht mehr erinnern. David, der ein Jahr jüngere Freund, hat einen erkennenden Blick. Er läuft zu dir und bietet dir seine warmen Hände an.
Ganz ruhig liegt die See da, wie erfroren, nur an deinen Füßen lecken zärtlich-kalt die Wellen. Sie scheinen etwas müde geworden zu sein nach diesem stürmischen Herbst, in diesem schneelosen Winter, bahnen sich ihren Weg nur mühsam gegen das steinverkrustete Ufer. Du willst einen Stein aufnehmen, der sieht aus wie Bernstein im Wasser, aber dein Körper ist ganz durchgekühlt. David nimmt ihn für dich. Du versuchst, nicht auf die Erwachsenen um dich herum zu schauen, du siehst nicht auf die Schwester. Du siehst hinüber zur Insel Walfisch. Scheinbar reißt sie das riesige Maul auf, aber es ist doch nur die Steilküste. Nach Osten hin wird das Eiland ganz schmal, dann verschwindet es im Wasser. Der Leuchtturm schweigt von der Nacht.
Und sie nehmen dich fort aus der Stille des Paradieses, fort von David, der trottet an der Hand seiner rothaarigen Mutter. Du hast keine Kraft, dich zu wehren. Du hast jetzt, in diesem winzigen Augenblick, keine Angst vor den Händen des Vaters, die dich schützen für den Moment des Heimgangs. Du hast keine Angst vor den doppelmannshohen Weiden am Rande des Hohlwegs, durch den sie dich tragen. Denn du hast keine Kraft und die Weiden grüßen gespenstisch.
Bald hatten sie dich.
Bald fährt die breite Hand der Mutter durch deine Haare, bald hörst du ihre beruhigende Stimme: „Alles ist gut; schlaf.“
Bald verschließen sie die Tür, denn bald bist du ein Gefangener. Allmorgendlich wirst du die Haferschleimsuppe hinunterwürgen, die viel zu heiß sein wird, allmittäglich das karge Mahl probieren, allabendlich wird es Grützwurstbrot geben, wenn der Vater, du weißt es, vom Feld oder aus dem Stall gekommen ist.
„Der Junge wird lernen, das zu essen, was auf den Tisch kommt“.
Und die Mutter wird dir Leberwurst servieren und Käse und wortlos das nicht angerührte Grützwurstbrot mit in die Küche nehmen, es selbst essen.
Dein Zimmer ist unbeheizbar und es liegt direkt neben der guten Stube, und das Haus liegt kurz hinter der Ostsee, nur einen Hohlweg und ein kleines Feld lang vom Gewässer entfernt. In deinem Zimmer ist es kalt, nur das übermächtige Federbett wärmt dich in diesen kalten Tagen deiner Kindheit. Das Zimmer ist halb abgedunkelt, es ist ein Verlies, und die Schatten der Möbel werden zu Monstern, die rufen nach dir. Und dein Federbett wird zum Versteck, zur warmen, winzigen Höhle, in der du Zuflucht findest, wann immer du sie brauchst. Und die Stille schreit in deinen Ohren. Irgendwann aber ist dein Fieber vorbei und du bist kein Gefangener mehr. Dann siehst du David wieder, und alles ist gut. Und er streicht dir sanft über den Kopf und streichelt deine Wange. Wochenlang hast du die Lungenentzündung auskuriert, anfangs im Fieberwahn, in dem die Wände deinem Bett immer näher und erst kurz vor dir zu stehen kamen. Nach einer Weile deformierten sich auch die Möbel nicht mehr, ließ die Hitze in dir nach, hörte das Brennen in deinen Lungen auf. Und nun sind die ersten warmen Tage gekommen und du darfst wieder hinaus.
DAVID, auf dem Kutschbock des Pferdefuhrwerkes, die zweite Erinnerung an deine große Liebe. Er bittet dich, ihm beim Entflechten einer Leine behilflich zu sein, und du bist ihm dankbar. Rückwärts gehst du den hinteren Teil der Ladefläche entlang. Die Leine ist zu lang. Bange wird dir. Aber nichts wird dich aufhalten, so sehr vertraust du David, der vorn auf dem Kutschbock steht und dir zusieht. Du ahnst Gefahr, aber du schweigst. Ich brauche mehr Leine, ruft David von vorn und du gehst einen Schritt zu weit zurück, schlägst hart mit dem Hinterkopf auf das Kopfsteinpflaster des Dreiseitenhofes. Ein dumpfer Knall. Vorn steht David, seine dunkle Gesichtshaut wird aschgrau, seine Brunnenaugen trüben sich. Schnell schwingt er sich vom Bock und ist bei dir, legt seine linke Hand unter deinen Kopf, spürt etwas Feuchtes, zieht seine Hand wieder hervor, eine seiner Tränen netzt deine Stirn. Du willst sagen, alles sei gut, aber du bekommst kein Wort aus deinem Hals. Und David schreit, ruft um Hilfe, sieht den Rest Schnee, der sich unter dir rot einfärbt, und schreit, aber das hörst du nicht mehr. Du wachst erst wieder in deinem Zimmer auf, fühlst den Verband um deinen Kopf.
Wochen später steht dein Vater vor dir. Deine Gehirnerschütterung ist überstanden, deine Wunde verheilt.
„Leicht hättest du dir den Hals brechen können“, sagt er. Und er verbietet dir, fortan mit David zu spielen.
„Ich spiele nicht“, sagst du, aber er weiß nicht, wovon du sprichst und du siehst ihn an und sehnst dich, David zu sehen. An diesem Tag, spürst du, hat sich dein Leben gewandelt. Seither ist nichts, wie es war. Die Verbote stehn drohend, Felsen gleich, und behindern die Sicht auf die Ebenen deiner flachbrüstigen Heimat. Deshalb musst du dich zu erinnern versuchen, weil dir die Liebe verboten worden ist, stattdessen Gewalt und ein daraus resultierender, unbestimmbarer Hass dich erreichte, der dich fremd macht gegen dich und gegen die dich umgebende Welt.
DIESER sonnige Montag auf der Brücke. Eben war es noch so, als behielte der SFB Recht und der Smog käme über die Mauer nach Ostberlin. Aber anscheinend macht er Halt vor dem Respekt einflößenden Bauwerk, das du aus der Leninallee nur ahnen kannst. Denn die Mauer ist weit entfernt, und sie ist in jedem von uns. Und du gehst, Groth, mit den anderen den Weg, den alle gehen, die aus der S-Bahn ausgestiegen sind, gleichgültigen Blicks an den Schreien vom Schlachthof vorbei.
Und du würgst. Und die Schweine hinter der Mauer brüllen. Und dein Unterleib beginnt zu schmerzen. Es sind die Erinnerungen, die dir Schmerzen bereiten, die sich nur widerwillig hervorzerren lassen aus den Tiefen deiner Seele. Memory, memories. Remember me. Die memories weichen dir aus. Die memories beugen dir den Rücken. Du erschrickst in Erwartung der Schläge der Väter, der Söhne, der Leiter, der Direktoren, der Diktatoren und ihrer Schergen, ja, der Nachbarn, der Freunde, der Freunde. Schläge zählend doppelt – in dir.
Und eine Wolke schiebt sich sanft vor die Sonne. Langsam gehst du über die Brücke. Dein Leib bildet keinen Schatten. Tauben sitzen auf der Mauer des Schlachthofes Berlin und scheißen sie voll. Und gurren aus seltsam tiefer Kehle.
NICHTS wiederholt sich, wie das Leben spielt: Du sahst die Waggons am frühen Vormittag des letzten Freitag ankommen auf dem Betriebsbahnhof des Schlachthofs am S-Bahnhof, als die SBahnen vorbeifuhren und das Schreien der Tiere nicht übertönten, als die Loks vorbeifuhren und das Schreien der Tiere nicht übertönten, als die schwere Diesellok, die einen D-Zug hinter sich herzog, das Schreien der Schweine übertönte. Zehn Waggonladungen Schlachtvieh. Wann haben sie zuletzt waggonweise gezählt. Und du hattest am Vormittag Geschichtsunterricht in der 9. Klasse und spürtest den Drang, endlich die Wahrheit sagen zu müssen, die nicht in den Geschichtsbüchern stand. Und du erzähltest ihnen von den Schweinen, deren Schreie deinen Schulweg begleitet hatten. Aber sie kannten das ja. Sie wuchsen auf in diesem Kiez rund um den Schlachthof Berlin. Und dann stelltest du diese Frage: Wann haben sie zuletzt waggonweise gezählt. Aber du wartetest die Antworten nicht ab.
Tief in Sibirien, tief im Buchenwald deutscher Kleinstädte, sibirischer Kiefernschonungen, sagtest du. Während die Schweine sich wehrten gegen den Tod, während die Menschen sich nicht wehrten gegen den Tod. Während die Menschen sich einreihten vor den Gaskammern Treblinkas und Ausschwitz’, und sich nicht wehrten, als hofften sie auf Hilfe im letzten Moment, gläubig, dass sie kein Schlachtvieh wären, denn das wehrte sich, wenn es auch keine Chance hatte gegen die Gewalt der Schlächter. Die Menschen wehrten sich nicht, als glaubten sie den Vorgängen nicht, als stünden sie voll Ehrfurcht vor den Requisiten der Macht tief in Sibirien, als der Zug plötzlich anhielt und die NKWD-Leute befahlen:
„Raus aus dem Waggon, ausziehen!“
Und die Volksfeinde es noch für einen Irrtum hielten. Sie sollten ins GULAG, sie wollten ins GULAG, sie wollten ihre Schuld abarbeiten. Wenn sie ihre Schuld auch nicht erkannten, erkannten sie doch die Requisiten der Macht: die Karabiner, hier hatte jeder NKWD-Mann eine Waffe, an der Front nur jeder vierte Soldat. Und Väterchen Stalin, der saß im Kreml und wusste nicht, was die NKWD-Leute mit seinen Gefangenen vorhatten. Stalin, der Stählerne, saß Tag und Nacht in seinem Arbeitszimmer im Kreml und kümmerte sich um sein Land. Im Kreml brennt noch Licht: „Stalin arbeitet!!!“, sagen die Leute und senken ehrfurchtsvoll das Haupt, wenn sie nächtens vorbeigehen am Tor vor dem Roten Platz. Und sie ziehen die Mützen und verbeugen sich und beten für Stalin.
Stalin schläft am Tage, weil er Angst vor Berija hat. Man wird ihn töten, glaubt er, wenn er nachts schläft. Also arbeitet er mit Beginn der Dämmerung und unterschreibt die Deportationspläne: Das GULAG braucht Menschenfleisch. Aber dieses Mal ist etwas anders. Launig ist Stalin und leitet den Zug um. Er hatte heut Morgen einen Anfall von Angst. Sie kommen nicht an, diese Volksfeinde. In Viehwaggons gepfercht, warten sie geduldig im langsam fahrenden Zug.
Der Zug, der sie ins GULAG bringen sollte, hielt plötzlich inmitten einer schneeweißen Schneewüste, die reichte bis hinter den Horizont. Mütterchen Russland ist groß, und die Volksfeinde beim Blick durch die Bretterwände wussten, dass es hinterm Horizont noch viel weiter ging. Schnee, überall Schnee. Der gleißte in den Augen, als die Sonne darauf schien. Und die schneidenden Stimmen der Wächter brüllten:
„Ausziehn!“
Und sie zogen sich aus auf der einsamen Bahnstation im sibirischen Norden, als die Kälte sie angriff, und die NKWD-Leute wollten auch ihren Spaß mit den Frauen, die ihre Brüste festhielten, als könnte ein Aufseher sie ihnen entreißen. Und die Männer lächelten schamhaft und hielten die Hände vor ihre Schwänze, da hielten die Wachleute schon die vollen Schläuche auf die nackten Leiber: Duschen nannten sie das und hielten voll drauf, auf die Brüste und Schwänze und auf die Köpfe, und jeder bekam die Dusche ab, der sie nicht wünschte, und sie froren bei minus 40 Grad im tiefsten Sibirien. Und sie wimmerten nackt neben den Viehwaggons auf der einsamen Bahnstation in den Tod.
Und am Morgen – es war ein schöner kalter Morgen – kamen die Henker mit ihren Äxten und spalteten den steifgefrorenen Körpern die Köpfe. Und es herrschte Frieden im Land. Irgendwo oben flog ein Vogel und sah auf die gespaltenen Köpfe der Leiber mitten im Schnee, bis ein Hügel aus Eis sie bedeckte. Das erzählte Groth in der Geschichtsstunde seinen Schülern, die noch nie so schweigsam in seinem Unterricht saßen. Und, forderte er sie auf, nun lest die entsprechenden Seiten in eurem Geschichtsbuch nach. In der Stunde am Montag wollen wir darüber reden, über offizielle und inoffizielle Geschichtsschreibung. Dann ließ er die Jugendlichen allein. Vorher aber erinnerte er sie an den Sonntag, an den Stellplatz zum Ersten Mai.
War das zu hart? War das zu schockierend für fünfzehn- und sechzehnjährige Jugendliche? Du warst zweifelnd hinausgegangen und die Stille im Klassenraum hallte lange in dir nach.
Den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik erinnerte Groth noch im Flur: Die Entropie eines abgeschlossenen Systems wird nie von allein kleiner. Entropie bezeichnet die Unordnung. Ein geordnetes System hat einen kleinen Entropiewert. Dieses abgeschlossene System aber in der Sowjetunion war in größter Unordnung. Bei jedem natürlichen Vorgang nimmt die Entropie zu, sagte Clausius. Unmöglich ist es, Wärme von einem kälteren auf einen wärmeren Körper zu übertragen. Und es ist nur folgerichtig, die Unordnung gewaltsam aufzuhalten. Mit Äxten aber wird Entropie nur vergrößert und die Unordnung in den Köpfen wird zum gewaltigen Chaos. Wärmetod. Kältetod.
2.
IRGENDWANN wird die Direktorin in seinem Unterricht hospitieren und sagen:
„Sehr interessant, lieber Kollege, sehr interessant.“
Und sie wird von ihrem Vater berichten, der im Exil in der Sowjetunion gelebt hat, ein Antifaschist gewesen war. Und du wirst sie nach dem geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes fragen und danach, ob er seinen Inhalt gekannt und ob er deswegen seine innere Haltung verändert habe. Und sie wird wissen: Du kennst ihn, dich kann sie nicht belügen. Und dann wird sie sagen:
„Sehr interessanter Unterricht und … Aber“, wird sie sagen, „muss man Schülerinnen und Schülern Fragen beantworten, die sie nicht gestellt haben?“
Und du wirst sagen: „Ja, man muss ihnen sagen, dass sie das Wort, das geschriebene Wort und das gesprochene Wort, hinterfragen müssen, um die Lüge von der Wahrheit trennen zu lernen.“
Und sie wird dich im Flur stehen lassen. Und am nächsten Tag werden die Kollegen vom Bezirksamt mit dir sprechen wollen. Aber das wird sein. Sie werden dir die Lehrbefähigung erteilen und es wird die letzte Hospitation gewesen sein. Und du wirst dich fragen, warum? Es werden die letzten Tage vor den Ferien kommen. Der Tag wird sonnig sein, die Schüler abwesend im Geiste, weil sie der Schule entfliehen wollen. Aber bis dahin gab es noch einige Lektionen zu lernen.
ZEHN Waggonladungen Schlachtvieh auf der Bahnstation im tiefsten Berlin und die Schweine wehrten sich am Morgen, als du den Weg am Freitag gingst, Groth, und es war kalt draußen, deine Finger froren und von der Bahnstation drang Dampf der dampfenden Körper herauf und der Geruch nach Exkrementen. Und es stank, und es stank, und die Schweine rannten gegen die Mauern und gegen die Zeit. Und die Todeskämpfenden in den Gaskammern rannten gegen die Wand und krümmten sich und wimmerten und rissen die Augen auf und krümmten sich und kotzten sich die Lunge aus dem Leib und wimmerten, die Kinder und Frauen und Greise, während die Henker noch zusahen, wie man Ratten zusieht auf der Experimentalstation, ob das Gift wirkt, das die Lungen ausbrennt, und das vielfache kleine Universum in den Köpfen ersterben ließ, dass es nur noch Nacht war. Und auch das erzähltest du deinen Schülern, nichts sollte verborgen sein, nichts verborgen bleiben. Denn sie belogen ihre Bürger in diesem kleinen, halben Land und wenigstens die Kinder sollten die Wahrheiten erkennen lernen, wieder und wieder. Und wenn es nur einige waren, denen du die Wahrheit verkündetest vom Berge.
Und du würdest am Abend zur Wurst greifen, als wäre nichts geschehen, und deine Schüler würden am Abend zur Wurst greifen, denn es war Alltag. Es war wie jeden Tag, nichts im Leben wiederholt sich, nur der Alltag bleibt scheinbar gleich. Und du, Groth, wirst durstig sein auf alles, auf das Leben, und nur das schlecht gebraute Bier bekommen, aber das Leben nicht.
EINGEWEIHT bist du seit deiner Kindheit, Groth, in die Praktiken der Schlächter: Sie halten eine Pistole gegen die Schläfen der Tiere und drücken ab: das Genick, das Genick. Treiber mit Stöcken achten, dass sie nicht ausbrechen und auf die Geleise geraten, die Schweine vom Schlachthof. Das Gedächtnis wird träge mit der Zeit. Ein aufgeschlitzter Hals, das Fließen des Blutes, die gewaschenen Leiber, die Schlächter, die den aufgeschlitzten Bauch fühlen und jemand greift mit beiden Händen hinein und holt die Innereien heraus, die Nieren, Gedärme, den Magen, das Herz, die Lungenflügel, mit denen du das Fliegen nicht lernst. In diesem halben Land nicht, nicht auf dieser Insel, die sich eingemauert hat gegen den Ozean der Welt. Die Leichname werden aufgehängt, die Lungenflügel, die dich das Fliegen nicht lehren, auf einen Stapel gepackt: Leber zu Leber, Herz zu Herz, Hirn zu Hirn, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und du fühlst dich in den Staub gedrückt, während die Kadaver in zwei Hälften gesägt werden, und bald siehst du nur noch Fleisch, das entstammt keinem Tier, das ist nur Fleisch, ein Schulterbiss wird Schnitzelfleisch, Rippen ähneln nur noch Rippchen. So wie du es kennst aus den Auslagen in der Fleischerei. Koteletts, auf beiden Seiten bekloppt, paniert, goldbraun gebraten. Hinter den Koteletts die Filets, das Feinste vom Feinen. Und sie nahmen die erstickten vergasten Leiber und luden sie auf Karren und brachten sie in die Krematorien und dort verbrannten sie und schwarz stieg der Rauch auf und verbreitete einen süßlichen Duft. Und die Asche, wohin gelangte sie. Und die Kleider, wohin gelangten sie. Wohin gelangten die Goldzähne, wohin die Schuhe. Wo hinterblieben die Sehnsüchte, die Millionen Träume der Gehenkten, die sich menschlich fügten in ihren Tod, als käme das Wetter der Retter rechtzeitig: all we can do ist sit and wait – all I can do. Auch das verschwiegst du nicht vor deinen Schülern.
Aber des Todes durch Gas oder Schuss bedurfte es nicht. Auf deiner Insel sperrten sie die Sprache einfach ein, verschlossen die Münder, aus der heraus sie geboren wurde, indem sie Mauern um sie herum bauten. Und so schwieg sie sich tot.
Medaillons fertigt man aus Schweinefilets: 600 Gramm, grob in Scheiben geschnitten, vorher häuten wir das Filet, schneiden das Fleisch hinterm Kopf, sanft, zärtlich.
STREICHLE es, streichle sanft es, sanft, und befreie es von der Sehne mit dem spitzen Messer, befreiendes mageres Fleisch vom Fett, von allem, was dick macht, und reibe das Fleisch ein mit Knoblauch – Stress gestresst Stress geschwächt Lächeln schädlich – merke dir, merke, zum Mitschreiben: Sex hundert Gramm Filet, Knoblauch, Rosmarin, Rose-Marie, Salz, Pfeffer. Kipp die Brühe dazu und in Butter braten, in Butter, in guter deutscher Markenbutter, und gieß die Brühe hinzu und brate die Filets, gieß die Brühe hinzu, und riechst du es, das Schweinefilet, nach Rosmarin und Knoblauch, Pomm-Fritz, fetttriefend, und Erbsen kullernd in ’n Bauch und Weißbrot, Anna nas, banale Banane, Champignons Glace.
Groth, hörtest du die Schreie noch am Freitag der vorigen Woche – wie jeden Werktag – als du, auf dem Weg von der Schule nach Hause, dich jener Zeit erinnertest, in der du so alt warst wie deine Schüler heute: Da warst du dreizehn und Schüler der polytechnischen Oberschule und hattest eine Betriebsbesichtigung im Schlachthof deiner Heimatstadt, als du das mit ansehen musstest und – Gott sei Dank – gibt es keine Gutachterkommission für Literatur mehr, aber als es sie noch gab, sagte auch ein Fleischer: Das sind die Ängste der Autoren, so sind doch unsere Fleischer nicht. Aber Groth, du hast sie gesehen: verkrachte Existenzen. Beschreiben heißt, die Wirklichkeit besudeln.
Groth, auf dem Weg nach Haus, atmete den Geruch nach Kot und Jauche ein, Groth sah Passanten die Nase rümpfen, Groth erinnerte jene Zeit, in welcher er den Schlachthof in Wismar betrat, vielleicht schau ich beim Lesen jetzt gerade aus dem Fenster, vielleicht blüht der Ginster oder der Schnee fällt oder die Birken blühen und ihre Samen streuen durchs offene Fenster und ich achte nicht des Geschwätzes eines Einsamen, und die Kinder bauen vor dem Haus einen Schneemann, und die Wirklichkeit entführt mich, wird nicht besudelt von den Fieberfantasien eines paranoiden Erzählers. Ich gehe also fort und lass den anderen Erzähler erzählen, und mich tragen meine Fieberfantasien fort.
Aber diese Welt! Hält sie noch Harmonien bereit für mich und für dich und für den Stasimann, der um die Ecke geht, als sei nichts geschehen? Wo liegen die Paradiese? Another day in paradise. Wenn die Kinder greinen und die Hungrigen hungern und sich Deutsche in Ost und West streiten, wie viel Geld sie in marode Wirtschaftssysteme einspeisen wollen, während die Kinder hungern, schalte ich ab, lass den anderen Erzähler erzählen. Oder wer auch immer diese Instanz ist, die aus Buchstaben Worte kreiert und aus Worten Texte und aus Texten Bücher.
Vielleicht wird man die Mühsal des Schreibens irgendwann einmal erleichtern durch Technik. Technische Errungenschufte.
ERINNERUNGEN, Groth weiß das, sind das verlogenste Zeug der Welt, aber Leben heißt Erinnern, Leben heißt Lügen. Lügen. Und die achte Klasse stand in der großen Halle und ein herumstehender Schlächter stellte sich neben Groth und hielt ihm die Schultern und Groth, während die Kuh das Stadion betrat, erhobenen Hauptes und stolz, wo war das rote Tuch, Fiesta olé, die Todgeweihte stand, geführt an einem Strick von einem Schlächter und blickte mit sanften Augen um sich, es waren so kastanienbraune Augen und Groth erschrak, erkannte das Kommende, erkannte in den braunen sanften Augen mit den langen, schwarzen Wimpern die seines toten Freunds. Er erinnerte das Über-den-Kopfstreicheln, die Liebkosungen. Und die Kuh flehte, schaute in deine Richtung, und dein Leib spiegelte sich in den Augen des Viehs, die Wimpern schlugen nach unten, jungfräulich. Keusch. Die Kuh zerrte an dem Strick, etwas beunruhigte sie. Die Halbwüchsigen schauten, lüstern und scheu und ängstlich, auf die Kuh. Da hielt ihr jemand die Pistole an die Schläfe und drückte ab, der Schlächter. Der fasste Groth so zärtlich bei den Schultern, fasste zu. Groth wollte ausbrechen, der Aufprall des schweren Tieres ließ den Zementfußboden vibrieren, die Beine federten, auf und nieder, auf. Der Lärm verhallte, noch schlug das Herz, und der Schlächter stand neben Groth, sein Griff schmerzte und Groth hatte die Augen geschlossen und der Griff im Genick zwang ihn, die Augen zu öffnen, noch schlug das Herz und Groths Schrei erstickte im Lärm der Maschinen und Groth brach aus, entwand sich dem Griff des Schlächters, verschwand.
Draußen, hinter der schweren Holztür, schöpfte er Luft, als er, vom Schlächter am Arm gepackt, „Ich gehe nicht hinein“, schrie, bis der Schmerz ihn verstummen ließ. So war das immer, rekapitulierte Groth. Seitdem. Angst vor Gewalt ist die Angst vor noch einer größeren Gewalt als der, die man erleiden muss. Und so fügten sich die Menschen in ihr Los und fügten sich und erduldeten und erlitten ihr Leben in Erwartung der immer größer werdenden Gewalt. Und der Schlächter fasste Groth beim Oberarm und führte ihn zurück. Und die Gewalt hatte noch einmal gesiegt. Und gerade siegte sie im Stadion Schlachthof: zwei ungleiche Partner, der Torero führte das Messer und blutete den Stier aus: Hasta la vista. Die Kuh, deren Euter rosa zwischen den Beinen herausquoll. Hier, ängstigte Groth, sollte er arbeiten am Unterrichtstag in der Produktion, und seine Angst nahm zu. Die Mitschüler starrten gebannt auf das Schauspiel. Nur einer noch neben ihm befand sich in der Gewalt eines Schlächters, die anderen standen hinter ihnen und griffen zu, wenn es nötig war. Nein, die Klasse weigerte sich: das nicht. Nicht das: alle vierzehn Tage.