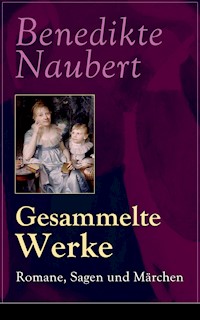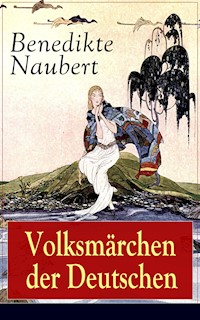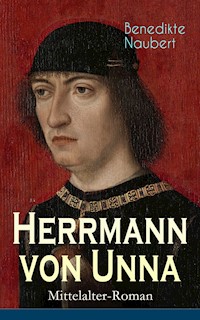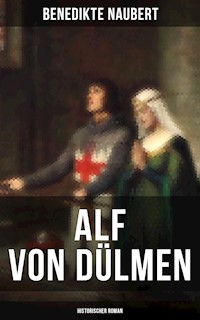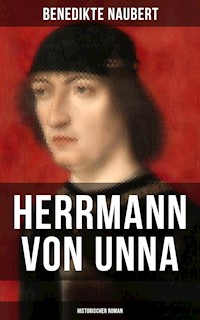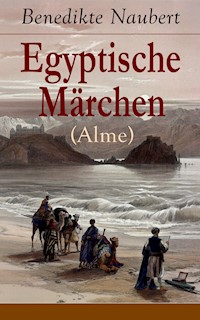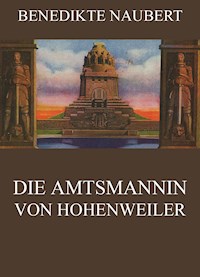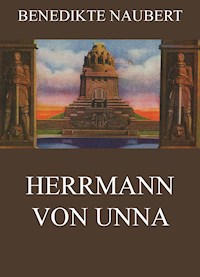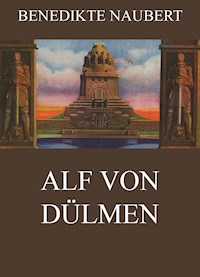Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fans von traditionellen Volksmärchen und Liebhaber deutscher Literatur sollten "Deutche Volksmärchen" unbedingt lesen. Das Buch bietet eine einmalige Gelegenheit, in die faszinierende Welt der deutschen Folklore einzutauchen und die zeitlosen Geschichten zu erleben, die Generationen von Menschen fasziniert haben. Benedikte Nauberts sorgfältige Sammlung und Interpretation der Märchen machen dieses Werk zu einem unverzichtbaren Schatz für jeden Leser, der auf der Suche nach magischen Erzählungen und kultureller Vielfalt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deutche Volksmärchen von Benedikte Naubert
Inhaltsverzeichnis
Volksmärchen der Deutschen
Erdmann und Marie, eine Legende von Rübezahl
Erster Abschnitt
Ungeachtet der Spukereien, welche der gefürchtete Berggeist in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, – in welche unsere Legende fällt – ungescheuter trieb als in unsern jetzigen lichtvollen Zeiten, wagte es doch einst ein kühner Mann, sich mitten in Rübezahl's Gebiet häuslich nieder zu lassen. Dieser Held war weder Kriegsmann noch Philosoph, weder Freidenker noch Geisterbanner, war nichts als ein schlauer, speculativer Gastwirth, dessen Gewinnsucht größer war als seine Furchtsamkeit, und der sich deshalb entschloß, in dem wüstesten, schauerlichsten Theile des Riesengebirges eine Wirthschaft anzulegen.
Der Einfall war so übel nicht, denn an begüterten Reisenden, welche diese Straße zogen, fehlte es nimmer, und die Freuden eines wohlbereiteten Mahles, nebst einem bequemen Nachtlager, hatten für die Pilger, vornehmlich zu Anfang des löblichen Institutes, etwas so überraschend Angenehmes, daß man kein Bedenken trug, sie aufs theuerste zu bezahlen; auch die ärmeren Wanderer gaben für Sicherheit und Obdach, die sie hier so erwünscht vorfanden, willig etwas mehr, als man ihnen sonst bei ihrer sparsamen Zehrung mit Billigkeit hätte abfordern können, wie denn überhaupt Billigkeit die Sache unsers Gasthalters eben nicht war.
Die neuerrichtete Wirthschaft zog, wie alle neuen Dinge, mehr Pilger herbei, als vielleicht außerdem diese Gegend betreten haben würden; wüst und schauerlich war sie damals noch mehr als heut zu Tage – man weiß, was Jahrhunderte für Veränderungen auf der Erdrinde anrichten – und wer sonst vor dem bloßen Namen des Geistergebirges zitterte, wagte sich jetzt nur darum eher hindurch, weil man – Dank sei es der Kühnheit des Wirthes zum Riesen, – nun endlich fand, daß es nicht ganz unbewohnbar sei.
Das Hausschild, welches Meister Melchiors Hotel den Namen gab, war ein wichtiges Problem für Alle die es sahen; die Meinungen darüber waren unzählig, doch theilten sie sich in zwei Hauptclassen: die eine Hälfte der Muthmaßer hielt den schwarzen Giganten mit der Schürstange am Frontespiz des Hauses – Rübezahls leibhaftiges Ebenbild – für eine hohnsprechende Herausforderung des Originals, seine Identität zu beweisen, und prieß den Mann, der so viel wagte. Die Andern sagten sich ins Ohr, jene ungeheure Figur sei nichts Geringeres als ein Meister Melchiorn vom Gebirgsherrn persönlich verliehenes Schutz- und Trutzbild, gleich einem kaiserlichen oder königlichen Wappen, um unter dessen Schirm zu handeln und zu wandeln, und das Monopol solches zu thun, gegen Jedermann zu behaupten.
Der Gastwirth, wie schon gesagt, ein schlauer Fuchs, wußte sich sehr geschickt in Alles zu fügen, was ihm von beiden Meinungen zu Ohren kam; gegen die Anhänger der ersten, – meistens starke Geister und Gespensterläugner, deren es selbst damals in den höheren Ständen nicht wenige gab, – nahm er das Ansehen eines Bravo an, der aller Furcht Trotz bietet, und bei den armen Pilgern aus dem niedern Volke, welche die zweite Klasse ausmachten, gewann er eben so viel, wenn er sie in dem Glauben erhielt, er sei der Vertraute und Begünstigte seines Territorial-Herrn.
Daß er dieses nicht war, das wußte Niemand besser als er; da er aber bei aller kühnen Wagniß, die wirklich in seinem Unternehmen lag, noch nicht vermerkt hatte, daß dasselbe von dem uralten Eigner des Bezirkes ungnädig aufgenommen würde, so war er ruhig, und begann sich endlich auf die Seite der Ungläubigen zu neigen und der verderblichen Meinung beizupflichten, daß der, welcher sich bei so viel gegebener Ursache zu strenger Ahndung, doch müßig erzeigte, nichts als ein Geschöpf der Phantasie sei, an welches nur die Thoren glaubten; eine Art von Logik, die wirklich dem achtzehnten Jahrhunderte Ehre gemacht haben würde, und die Meister Melchiorn für das Seinige auf einen sehr eminenten Posten stellte.
Melchiors hoher Muth, der im Anfange seiner Wirthschaft nicht selten in kühne Worte und Werke ausbrach, dauerte indeß nur eine kurze Zeit, und schon im zweiten Jahre kam es dahin, daß er Rübezahls Namen, den er zuvor so oft profanirt hatte, nie nannte, des Nachts bei verschlossenen Thüren vor dem bloßen Gedanken an den Berggeist so gut zitterte, als der verirrte Wanderer draussen im wilden Gebirge, und daß er nicht selten davon sprach, wie die Nahrung immer schlechter zu werden beginne, und wie er nicht abgeneigt sei, die ganze Wirthschaft aufzugeben, und wieder wie andere Christen unter Menschen zu wandeln und zu wirken.
Diesen Versicherungen wurde jedoch keineswegs unbedingt Glauben geschenkt; namentlich berechnete das Hausgesinde allein aus den Trinkgeldern, daß die einsiedlerische Gasthalterei im Riesengebirge so gar uneinträglich nicht sein könne, und daß es also mit Melchiors veränderten Gesinnungen wohl seine verborgenen Bewandnisse haben möge. Ein Jeder hatte für die muthmaßlichen Geheimnisse seines Herrn eine eigne Erklärung. Der Eine behauptete, daß unserm Melchior, als er einst nach Schweidnitz geritten sei, um eine Bestellung von allerlei Wirthschaftsbedürfnissen zu machen, dicht vor der Stadt auf dem kahlen Berge1 Rübezahl in Gestalt einer Eule erschienen sei, von welchem er wohl Dinge erfahren haben möge, die er Niemand gestehen würde. Ein Anderer wußte, daß der vornehme Herr, der am letzten Feste hier abgestiegen und der von Niemand als von Meister Melchiorn selbst habe bedient sein wollen, die erste Veranlassung zu den Dingen gegeben, die man sich nicht erklären könne; denn als der dienstfertige Gastwirth selbst Hand angelegt habe, dem hohen Reisenden den Stiefel auszuziehen, so sei ihm nebst demselben der ganze hochgräfliche Fuß in den Händen geblieben, und am andern Tage, bei Ueberreichung der Morgensuppe, habe er den Grafen ohne Kopf im Bette liegend gefunden. Obgleich nun der Fremde, Kopf und Fuß, die aus Versehen bei der Toilette vergessen worden waren, schnell wieder angelegt, und wegen der unziemlichen Gestalt, in welcher er sich betreffen lassen, höflichst um Entschuldigung gebeten habe, so wäre doch der Eindruck von solchen Seltsamkeiten nicht bei Jedermann so leicht zu verwischen, und man könne die Niedergeschlagenheit, welche Herr Melchior seit diesen Geschichten blicken ließe, so sehr eben nicht bewundern.
»Ihr möget sagen was ihr wollt,« rief eine von den Mägden, »so ist der schlimmste Possen, welchen ihm der Herr von Berge – Gott bewahre mich, daß ich ihn nicht beim rechten Namen nenne! – gespielt hat, immer der, welcher vor einem halben Jahre bald uns allen, wie wir hier versammelt sind, das Leben gekostet hätte. Frau Else hat mir im Vertrauen gestanden, daß jene Feuersbrunst, die durch die Wachsamkeit des wackern Erdmann noch zeitig genug gedämpft wurde, aus ihres Vaters Chatoulle losgebrochen sei. Heiliger Andreas! nachdem sich der Herr so oft an Rübezahls glühenden Thalern die Hände verbrannt, so hätte er doch wohl so klug sein sollen, dergleichen Teufelswaare nicht in einen hölzernen Kasten zu legen.«
»Metten,« erwiederte einer von den ältesten Knechten »eure Reden sind kühn und verwegen, und ihr bedenkt nicht, daß der, den wir alle ungern nennen, nicht gleich andern Geistern an Zeit und Ort gebunden ist, daß er sowohl drei Stunden nach Sonnenuntergang als um Mitternacht und in Zwielichten, sowohl in der verriegelten Gesindestube als auf seinen Bergen sich zeigen kann; und was wollen wir thun, wenn in diesem Augenblicke – – – –«
»O schweige, schweige!« riefen Alle und das Gespräch hatte ein schnelles Ende; indessen trug es, so wie seine Vorgänger und Nachfolger, viel dazu bei, die Hausgenossenschaft in beständiger Scheu vor einem Wesen zu erhalten, welches eben darum, weil es allen unbekannt war, ihnen desto fürchterlicher dünkte.
In Meister Melchiors Hause diente unter andern ein junger Knecht, – eben jener Erdmann, dessen Metten bei Gelegenheit der Feuersbrunst mit Ehren gedacht hatte. Ein rüstiger Bursche von neunzehn Jahren, auf welchen der Hausherr sehr viel hielt, ohne ihm jedoch thätige Beweise seines Wohlwollens zu geben, und welchen alle Weiber des Hauses, von Melchiors Tochter, Frau Elsen an, bis auf die schmutzige Küchenmagd Metten, gern sahen, ohne daß sie ihm abmerken konnten, ob er auch eine von ihnen gern sähe. Erdmann war fleißig und unverdroßen bei der Arbeit, – wie weiland Rübezahl selbst, so lange er als Ackerknecht diente, – kühn und furchtlos, als ob er weder an Gespenst noch Teufel glaubte, und vorsichtig in Worten und Werken, als ob er sich überall unter Geistergewalt fühlte. Die übrige Dienerschaft im Gasthofe hatte sich schon dreimal verändert, und Erdmann hielt bei geringem Lohne noch immer unter Melchiors wunderlicher Herrschaft aus. Es gab Stunden und Zeiten, wo Niemand vom Gesinde sich getraute, nur Wasser aus dem nächsten Felsenbrunnen zu holen; dem muthigen Erdmann war Tag für Nacht gleich. Seit Jahr und Tag zog Meister Melchior nicht mehr nach Schweidnitz, um Vieh für seine Küche einzukaufen, oder nach Hirschberg, um seine dort durchpassirenden Weine frei zu machen, aber Erdmann lag unablässig, zu Roß oder zu Fuß, auf der Straße, besorgte was ihm aufgetragen ward, gut und treulich, und hatte in Summa das ganze Departement der auswärtigen Angelegenheiten unter sich. Trotz allem Eifer konnte er dennoch Meister Melchiorn nichts zu Danke machen und wenn er auch sein Geschäfte bestens besorgt hatte, so wurde er doch bei der Nachhausekunft regelmäßig getadelt, erhielt schlechte Kost, – denn da er selten zu gehöriger Tafelstunde im Hause war, so bekam er immer nur das Uebergebliebene – und nur Frau Else war es, die ihm zur Entschädigung für alle diese Unbilden holde Blicke zuwarf. Niemand wußte, was ihn noch in dem Hause, wo so viele Mühseligkeiten, so wenig Nutzen auf seinen Antheil kam, fest hielt, wenn es nicht die schönen Augen ebengedachter Dame waren. Aber welche Wahrscheinlichkeit, daß ein blühender Jüngling, wie Erdmann, eine fast dreißigjährige, wohlbekinderte Wittwe beachten sollte, die überdieß in Gestalt, Anstand, Thun und Wesen, mehr Aehnlichkeit mit einem pariser Fischweibe, als mit dem Ideale hatte, mit welchem jeder junge Mensch, von dem Prinzen bis auf dem Hirtenknaben, sich hinsichtlich der ersten Liebe zu schmeicheln pflegt!
Wenn Leidenschaft für diese Rahel es nicht war, was dem armen Erdmann seine saueren Dienstjahre leicht machte, wenn der Gedanke, Frau Else daheim zu sehen, ihm nicht seine mühseligen Reisen versüßte, so mußte seine Geduld, wie jede andre Tugend, ihren eignen Lohn mit sich führen, der nicht Jedermann in die Augen fiel. Und in der That, so war es; was uns davon kund geworden ist, wollen wir unsern Lesern mittheilen.
Der junge Knecht Meister Melchiors zog seit geraumer Zeit nicht leicht den Weg durch das Gebirge, ohne einen Anblick zu haben, der ihn gleich das erstemal mit innigem Wohlbehagen erfüllte, und der ihm in der Folge so theuer ward, daß er ihn nie ohne Schmerzen missen konnte. – Wenn er den engen Bergweg herab in die Gegend des Rumpelbrunnens kam, aus dessen Schooße sich die Weistritz ins Thal ergießt, da zeigte sich immer nah oder fern eine holde weibliche Gestalt, die Alles in sich vereinigte, was nur zu Erdmanns einfachen Vorstellungen von weiblicher Vollkommenheit paßte. Schön war die Dame so wenig, als stolz und vornehm gekleidet, blendende Reize sowohl, als blendende Tracht, würden die Augen des Jünglings eher zurückgeschreckt als angezogen haben. Ein junges, wohlgewachsenes Mädchen, mit der Blüthe der Gesundheit auf den Wangen, und dem Blicke der Unschuld und Gutherzigkeit im Auge, in einer Kleidung, welche Armuth verrieth, die unter Reinlichkeit und ein wenig weiblichem Hange zum Putze sich versteckte; – ein solches Mädchen war es, die Erdmanns Augen nach und nach so fesselte, daß er sie von dem Gegenstande seiner Liebe weder losreißen konnte noch wollte.
Geraume Zeit glaubte Erdmann, daß jenes Mädchen in dieser wüsten Gegend wohne, und als ihm Jedermann versicherte, daß Niemand hier hause, hielt er sie gar so lange für ein neckendes Gespenst, bis er sie einst vor sich her den Weg nach Schweidnitz gehen sah. Aus der Eile, mit welcher sie nach der Stadt zutrippelte, schloß er, daß sie dort zu Hause gehöre und im Näherkommen überzeugte ihn die Festigkeit ihrer Figur bald, daß hier von keiner täuschenden Geistergestalt die Rede sei.
Einholen konnte er sie diesesmal nicht, aber an einem der nächsten Tage, da er des Weges zog, war er glücklicher; er trabte vor ihr vorbei, zog seinen Hut und wünschte einen guten Abend. – Der Anfang war gemacht, man wurde bekannter und Erdmann wagte schon bei dem nächsten Zusammentreffen eine Bemerkung über das Wetter. Nur einsilbig wurde sie von dem schüchternen Mädchen beantwortet, und als Erdmann einige Wochen später, nach mehreren Begegnungen, sich die Frage erlaubte, ob er der Jungfer, da der Weg so böse sei und sie Beide einen Weg gingen, wohl seinen Arm und seinen Stab anbieten dürfe, so erfolgte von ihrer Seite ein deutliches, klares Nein. –
Erdmann konnte nicht begreifen, weshalb er abgewiesen wurde, und frug daher nach dem Grunde ihrer Weigerung.
»Ich diene,« sagte das Mädchen, »bei einer Herrschaft, die es mir nicht verzeihen würde, wenn ich mich von einem jungen Gesellen auf der Straße führen ließe.«
»Ihr dient? und bei wem?«
»Bei einer Herrschaft, die nicht viel reicher ist als ich. Meine Frau und ich ernähren uns mit Spinnen.«
»Und welches Geschäft treibt euch so oft in diese wüste Gegend?«
»Ich trage unsere Arbeit zu den Klosterjungfern im Walde.«
»Aber der Ort, wo ich euch so oft sah, liegt ziemlich abwärts vom Marienkloster.«
Das Mädchen erröthete, und sprach nach einer kleinen Pause von dem guten Flachse, den man in dem Dorfe jenseit des Gebirges habe, und von welchen sie ein ziemliches Bündel unter dem Arme trug. Indem sie dies mit großer Bereitwilligkeit aufknüpfte, schien sie sich dadurch bei unserm Erdmann vor jedem Verdachte einer Unwahrheit schützen zu wollen und ihm somit gleichsam ein Recht, sie auszuforschen, zuzuerkennen.
Das Gespräch, das nun schon soweit geführt hatte, konnte nicht so schnell abgebrochen werden. Erdmann erfuhr von seiner Begleiterin noch Manches, erfuhr unter Andern, wie sie an den beiden Hauptpersonen des vorhingenannten Jungfernklosters, nämlich an der Schutzheiligen und an der Domina, ein paar hohe Patroninnen habe, indem die Erste ihre Namensschwester sei, und die Andere, eine Gräfin von Würban, oft selbst mit ihr zu reden pflege und ihr jüngst gar Hoffnung gemacht hätte, sie könne einst als Aufwärterin in dem von ihren Vorfahren2 gestifteten Kloster aufgenommen werden.
In Folge dieser so sehr ausgesponnenen Unterhaltung erlangte Erdmann ungefragt das, was man ihm Anfangs geradezu abgeschlagen hatte, nämlich die Ehre seine Dame zu begleiten. Zwar bediente sie sich weder seines Armes, noch seines Wanderstabes zur Erleichterung des bösen Weges, duldete es aber doch, daß er gemächlich neben ihr herschlenderte, und verabschiedete ihn erst diesseit des letzten Berges, welcher die Stadt versteckte, weil Erdmann in dem niederen Theile von Schweidnitz seine Geschäfte hatte und sie angeblich in der Oberstadt wohnte.
So wußte nun also Erdmann viele wichtige Dinge von der Person, die seine Gedanken seit einiger Zeit so sehr beschäftigte; auch waren ihm Mariens entfernteste und höchste Hoffnungen bekannt, die sich auf die Gnade und Versprechungen der Aebtissin des Marienklosters gründeten. Gerade dieser Theil von der erhaltenen Kunde war es jedoch, der ihm am wenigsten behagte. In dem Gedanken, der hübschen Schweidnitzer Spinnerin einst nicht mehr auf seinen einsamen Wanderungen zu begegnen und sie wohl gar in irgend einem Kloster, und wäre es das Vornehmste von der Welt, als Nonne zu wissen, lag für ihn so viel sein Herz Beängstigendes, daß er immer trauriger ward und nicht eher einige Beruhigung verspürte, bis er Marien, die er mehrmals vergebens aufgesucht hatte, wieder begegnete, und mit ihr von der Sache sprechen konnte.
Erdmann traf jetzt zwar oft mit Marien zusammen, und hätte Alles weitläuftig mit ihr bereden können, was ihm auf dem Herzen lag, aber er wußte selbst nicht recht, wie er es einkleiden sollte; auch fehlte es ihm, so bald er sie sah, an Muth, nur den zehnten Theil von dem auszusprechen, was er sich, wenn er sie nicht sah, ausgedacht hatte. Die schöne Jahreszeit ging darüber hin, und es kam der Winter, in welchem er zwar den mühseligen Weg über das Gebirge in den Geschäften seines Herrn oft machte, aber Marien niemals erblickte.
Der Dienst bei dem wunderlichen, selten mit sich selbst einigen Meister Melchior ward immer schwerer; der größte Theil des Hausgesindes konnte es nicht länger aushalten, und der einsame Gasthof sah wiederum einmal lauter neue Gesichter. Die Abgehenden riethen unserem Erdmann, ihrem Beispiele zu folgen, aber er wußte wohl warum er blieb; der harte Winter war ja nun fast überstanden, und es nahte der Frühling, wo mildere Witterung ihm Hoffnung gab, seine gute Freundin wieder auf den bekannten Wegen zu treffen. Oft fürchtete er freilich auch, daß Marie vielleicht auf immer für ihn verloren sein könnte, daß sie den Ort ihres Aufenthalts verändert, ins Kloster gegangen, oder gar gestorben sein könnte. Denn seltsam war es, daß er, der Schweidnitz so genau kannte, bei allen seinen Streifereien durch die Stadt, bei allen Bemühungen, sie aufzufinden, sie weder am Fenster, noch auf der Straße, noch endlich in der Kirche erblickte, und allemal traurig und hoffnungslos heimkehren mußte.
Das Frühjahr kam; die Tannen und Fichten des Riesengebirges kleideten sich in helleres Grün, der Erdboden schmückte sich mit blühenden Gesträuchen, auf den Spitzen der Berge begann der Schnee zu schmelzen und die Weistritz sprudelte entfesselt aus ihrer Höhle; die meiste Zeit des Jahres ein stiller, friedlicher Bach, der den Waldnymphen einen klaren Spiegel vorhielt, – jetzt durch die fremden Gewässer, die sie in ihren Schoos aufnahm, ein fürchterlicher Strom, welcher der ganzen umliegenden Gegend Verheerung drohte.
Erdmann kannte die Tücke dieses falschen Wassers, das oft in wenig Stunden stieg und fiel, und den unvorsichtigen Wanderer ins Verderben riß, aber er wußte sich zu hüten. Er scheute keinen Umweg, um die Gegenden zu vermeiden, wo an einer ausgetretenen Stelle der Wiederschein der Berge den nahen Grund vorspiegelte, und wo der, welcher es wagte, hindurch zu waden, sein Grab fand; auch vermied er die schlüpfrigen, dem Anscheine nach nur mit wenig Wasser bedeckten Stege und den von den heimtückischen Fluthen ausgewaschenen Rand des Weges, der den Strom entlang mit täuschendem Grün prangte, und oft von dem leisesten Fußtritte einstürzte und den Wanderer in die Fluthen begrub.
Nie hatte sich Erdmann weniger nach Mariens Begegnung gesehnt, als in dieser Zeit. Ach! seufzte er, wenn sie noch lebt und in dieser Gegend weilt, so möge sie doch ja ihr guter Engel vor Gefahren schützen, die sie entweder nicht kennt, oder die für sie fast unvermeidlich sind!
In solchen Gedanken ging er einst an der Stelle vorüber, wo er Marien im vorigen Jahre so oft getroffen hatte, ohne eigentlich von ihr erfahren zu können, was sie hier mache. Die alten Bäume, welche damals die Höhle beschatteten, aus der sich die Weistritz sonst als ein kleiner Bach hervordrängt, standen jetzt bis fast an die Wipfel in der Fluth; das Ganze war eine große, unabsehbare Wasserfläche, auf welcher hier und da ausgerissene Felsstücke, hergeschwemmtes Holz, oder andere Merkmale von der Gewalt des Stromes schwammen. Mitten unter mancherlei Trümmern schwebte eine kleine Masse, wie ein Häufchen blendender Schnee; Erdmann stützte sich auf seinen Stab, und schaute von der sichern Anhöhe, auf welcher er stand, in die Tiefe hinab, auf den kleinen hellen Punkt, der, er wußte selbst nicht warum, sein einziges Augenmerk war. Jetzt trieb die Fluth den weißen Punkt einer Gegend zu, wo das Wasser einen schnellen Abfall nahm, – da erkannte Erdmann deutlich eine Menschengestalt, erkannte, ach! – Mariens blendend weißes Gewand, und das blaßrothe Band, womit sie es aufzuschürzen pflegte.
Beinahe hätte sich der arme Erdmann in der ersten Verzweiflung in die Fluthen gestürzt; nur der Gedanke, hier sei vielleicht noch Rettung möglich, verhinderte eine rasche, unglückliche That. Ohne zu wissen wie, ehe er noch überlegen konnte, was hier zu thun sei, war er schon unten, wo der Strom in niedrigern Ufern ging, hatte die schnelle Fluth eingeholt, und wartete an einer Stelle, wo das Ufer das Wasser einengte, um die Schwimmende, die er nun in der Nähe ganz deutlich für Marien erkannte, mit einem unterweges aufgegriffenen Baumaste anzuhalten und auf das Ufer zu ziehen. Es galt Lebensgefahr, ehe dieses glückte, allein was ist der Liebe unmöglich? Auch schien ihn eine unsichtbare Hand zu unterstützen und mit ihrer Hilfe lag das geliebte Mädchen bald gerettet auf dem grünen Boden, in der milden Frühlingssonne. Ja, gerettet! denn nachdem der erfahrene Erdmann Alles versucht hatte, was in jenen Zeiten zur Rettung der Ertrunkenen angewendet wurde, schlug sie die Augen auf, und erholte sich in kurzer Zeit so völlig, daß ihr Schutzengel es wagen konnte, sie zum Weitergehen aufzufordern, obgleich er noch nicht wußte, wohin sie sich wenden sollten. Das schwache Mädchen in ihren nassen Kleidern nach ihrer Wohnung in die Stadt zu bringen, schien unmöglich; das Wirthshaus zum Riesen war zwar näher, aber Erdmann kannte seine Herrschaft zu gut, als daß er sich für seine Gefährtin eine freundliche Aufnahme hätte versprechen können. Herr Melchior war hart und geizig, und Frau Else unfreundlich und eifersüchtig gegen jedes erträgliche Mädchen, welches die Aufmerksamkeit dessen erregen konnte, auf den sie allmählig sehr ernstliche Absichten zu äußern begann. Nicht die geringste Handreichung hätte Marie von ihr zu hoffen gehabt, und alle Wünsche Erdmanns gingen nur dahin, sein blasses, zitterndes Mädchen heimlich ins Haus zu bringen, und daselbst von den Mägden, die ihm gewogen waren, einige trockene Kleidungsstücke und etwas warme Suppe für Marien zu erbitten, damit er sie am andern Tage, vor Aufgang der Sonne, mit einer sich darbietenden Gelegenheit in ihre Heimath schaffen könnte. – Bei diesem in der Stille gefaßten Entschlusse blieb es. Marie kam durch das Hinterpförtchen ins Haus, Metten wärmte und trocknete sie in ihrem schmutzigen Bette, und vor Tagesanbruch, ehe Frau Else im Hause zu rumoren begann, hatte Marie schon auf einem sichern Fuhrwerke den halben Weg nach Schweidnitz zurückgelegt. –
Daß dieses Abenteuer die beiden jungen Leute einander näher brachte, als sie es zuvor waren, läßt sich errathen. Mariens Herz floß von Dankbarkeit gegen ihren Retter über, und Erdmann bekam Muth, von Manchem, was ihm auf dem Herzen lag, vertraulich gegen sie zu reden. Begegnete man sich im Gebirge, so ward Erdmanns Arm und Wanderstab nicht mehr mit schüchterner Sprödigkeit ausgeschlagen, und begegnete man sich nicht, so scheute sich Marie nicht, zu gestehen, daß sie den vergebens erwartet und gesucht habe, mit dem sie schon so oft zusammengetroffen.
»Ach,« setzte sie einmal mit Erröthen hinzu, »das Verlangen, die Stunde nicht zu versäumen, in welcher ich dir vor einem Jahre im schmalen Bergwege zu begegnen pflegte, hat mir schon beinahe das Leben gekostet!«
»Wie so, Marie?«
»Du weißt es so gut als ich, du hast mich ja aus den Fluthen gerettet!«
»Wie? um meinetwillen wärest du in diese Gefahr gerathen?«
»Ja, Erdmann! die Thorheit war unverzeihlich, um so viel mehr, als ich gewarnt war.«
»Du sprichst Räthsel! Wo warst du? Wer warnte dich? Und überhaupt was machst du immer in jenem wüsten, grauenvollen Theile des Gebirges, den Niemand gern besucht, und den selbst ich scheue?«
Marie schwieg. »Mein Freund,« fing sie nach einer langen Pause an, »ich that Unrecht, eine Neugier in dir zu erregen, die ich nicht befriedigen darf; wirst du mir verzeihen, wenn ich dir mein Geheimniß nicht vertraue?«
»Wenn du versprichst, mir ein Opfer zu bringen.«
»Welches?«
»Deine Hoffnungen auf eine Versorgung im Kloster.«
»Lieber Erdmann! welche Aussicht bleibt mir außer diese? Meine alte Herrschaft ist todt, ihre Erben sagen mir den Dienst auf. Mein Spinnrocken kann mich nicht ernähren, was soll ich thun? Betteln? Stehlen? Oder durch die Gnade und unter dem Schutze der ehrwürdigen Domina des Marienklosters ein ruhiges und anständiges Leben führen?«
»Was du thun sollst, Marie? Heirathen sollst du!«
»Und wen? Etwa dich? – Ja, wenn ich dir mit dieser Hand so ein paar tausend Gulden, oder ein hübsches Bauerngut zuzubringen hätte! Aber Armuth! Den Bettelstab! – Nein, Erdmann! du bist mir zu lieb, um dir eine solche Mitgift zu gönnen; du hast Nichts, ich habe Nichts, so bleiben wir am besten von einander!«
»Du irrst, Marie, wenn du mich für so arm hältst; wäre ich es auch, so habe ich doch reiche Freunde!«
»Freunde? – Ja, Frau Elsen im Gasthofe! – Heirathe sie, heirathe sie! Bei ihres Vaters Geldkasten wirst du die arme Marie bald vergessen!«
»Marie, laß uns aufrichtig reden: so wenig als ich je eine Andere nehmen werde als dich, so wenig wünschest du, daß dieses geschehen möge; die Thränen, die dir, da du so etwas in den Tag hinein schwatzest, in die Augen kommen, bezeugen es mir, wenn ich es auch sonst nicht wüßte. Daß ich aber andere Freunde habe, als Meister Melchiorn und seine Tochter, könnte ich dir beweisen, wenn ich mich nicht scheute, dir Dinge zu entdecken, die dich auf einmal von diesen Gegenden zurück schrecken, und mich um die einzige Freude meines Lebens, um deinen Anblick bringen könnten.«
»Und gleichwohl, Freund Erdmann, muß ich es wissen, wenn ich mich von dir geliebt halten soll!«
Diese Worte, mit allem Nachdruck gesprochen, den ein Mädchen, welches sich geliebt weiß, ihren Forderungen zu geben pflegt, schreckten dem armen Erdmann sein Geheimniß ab; er vergaß ganz, daß ihm vor einigen Minuten ein ähnliches Gesuch hartnäckig abgeschlagen ward, und daß es ihm, so gut als Marien, erlaubt gewesen wäre, mit der nämlichen Beschwörung auf die Befriedigung seiner Neugier zu dringen.
»Du forderst es,« sagte er nach kurzem Bedenken, »du verlangst die Offenbarung meines Geheimnisses als einen Beweis meiner Liebe, und deshalb gebe ich nach. Wisse also, wir wandeln hier im Schatten eines Geistergebirges, Alles rund um uns her ist heilig, vom Gipfel jener himmelhohen Berge bis auf das Moos, das den Stamm dieser Fichte bekleidet; ein mächtiges Wesen ist Beherrscher dieser Gegenden, welches –«
»Erdmann, stimme den hohen Ton ein wenig für meine Einfalt herab, und sage mir mit klaren Worten, daß hier das Riesengebirge ist, in welchem der muthwillige Gnome, Rübezahl genannt, hausen soll; Dinge, die mir schon längst bekannt sind, und die, da ich so oft bei Tag und bei Nacht hier ungehöhnt und ungeschreckt gegangen bin, so wenig Einfluß auf meinen Muth haben, daß du sehr irrst, wenn du glaubst, daß ich darum diese Gegenden fürchten würde.«
»Wie, Marie? leugnest Du Etwas, wovon alle Welt überzeugt ist?«
»Ich leugne Nichts, aber ich vermuthe, daß dieses Wesen, an welches du so fest zu glauben scheinst, entweder keinen Theil an mir habe, oder mich gern in seinen Gebieten dulde, und mir darum freien Aus- und Eingang in denselben gestatte.«
»O, Marie! wäre das Letztere, dann wohl dir und mir! Dann hätten wir Beide einen gemeinschaftlichen Patron an dem guten Berggeiste, denn auch ich glaube mich seiner Gnade rühmen zu können, und vielleicht noch in höherem Grade als du; denn wirst du blos geduldet, so kann ich mich noch höherer Begünstigungen rühmen, und dieß ist eben das Geheimniß, das du mir entreißest, und das ich dir nicht anders entdecken kann als durch Mittheilung meiner ganzen Lebensgeschichte.«
Marie schüttelte schweigend den Kopf und der Erzähler fuhr fort:
»Mein Name ist Erdmann Erdmannsdorf; meine Vorfahren waren mächtige Ritter und Edle, die zwischen ihren Tauf- und Geschlechts-Namen jenes bedeutende Wörtlein einzuschalten pflegten, um welches mich Armuth und Mißgunst gebracht haben. Bei meinen Urahnen kam, wie bei so vielen Menschen, Stolz vor dem Falle. Vor hundert und mehr Jahren ließ sich einer von ihnen, durch die damalige Sucht des Adels, Burgen zu erbauen, verleiten, ein stolzes Schloß auf jenen Berg setzen zu wollen, in dessen Schatten wir nun bald kommen werden. Er wurde gewarnt, man sagte ihm, daß der Herr dieser damals wüsten Gegend, in diesem Punkte so empfindlich sei, als der Bischof von Bamberg, der Herzog von Schwaben und der Graf von Tyrol, die damals um ähnlicher Dinge willen beständig Fehden hatten; aber mein Ahnherr bestand auf seinem Sinne. Man weissagte ihm, daß nicht der erste Schlag zur Ausrottung des wilden Waldes, der auf der gewählten Stelle stand, würde ungehindert gethan werden können, daß Bauleute und Baugeräth dem Grundherrn verfallen wären, und daß Feuer die Gebäude verzehren würde, ehe sie eine Elle hoch über der Erde hervorragten. Diese Prophezeiungen gingen indeß nicht in Erfüllung und mein Ahnherr wurde um so sicherer. Als aber nun die Burg mit ihren fünf stolzen Thürmen in, all ihrer Pracht dastand, da hob sich der unterirdische Reise auf dessen Schultern sie erbaut war, ein wenig empor, die Erde zitterte und das ganze Pigmäenwerk stürzte zusammen.
Es bedurfte Jahre, um den Schaden, den das Erdbeben angerichtet hatte, wieder auszubessern, doch ward der stolze Edelmann, der nun einmal auf jenem Berge ein Schloß haben wollte, und der, um seinen Eigensinn zu befriedigen, keine Kosten scheute, endlich mit seinem Baue fertig. Er hatte gebaut, um im nächsten Jahre eine neue Verheerung zu erfahren. Aus dem Schooße jenes höher liegenden Gebirges stürzten wilde Bergströme hervor, welche den Grund unterwuschen und das neue Schloß in Trümmern davontrugen. Was sie unversehrt ließen, ward vom Wetterstrahl zerstört, denn die Erdgeister stehen mit den Bewohnern der Lüfte in gutem Vernehmen, so daß es dem Gebirgsherrn ein Leichtes war, sie zur Rache seines Schimpfes anzufeuern. Der Gnom war wüthend, und um seinem Feinde alle Möglichkeit zu benehmen, den Eingriff in seine Rechte zu wiederholen, so borgte er noch ein halbes Dutzend Donnerkeile von seinen ätherischen Bundesverwandten, welche in einem Tage alle Besitzungen des Herrn von Erdmannsdorf in Asche verwandelten, und ihn zum Bettler machten. Das weitere Schicksal dieses unglücklichen Mannes habe ich nie umständlich erfahren können, und weiß nur, daß er mit den Seinigen zur tiefsten Niedrigkeit des bürgerlichen Standes herabsank, so daß mein Vater, aus dessen Munde ich alle diese Dinge habe, nichts war, als ein armer Köhler. Oft pflegte dieser, wenn er seinen Meiler geschürt hatte und nun der gethanen Arbeit gegenüber saß, mich von jenen Dingen zu unterhalten, doch konnte er mir den Ort, wo die Rache des Berggeistes wider unsern Ahnherrn begonnen hatte, nicht näher bezeichnen, weil unsere Hütte von der Gegend, wo der Gnom sein Wesen trieb, etwas entfernt lag.
Ohne die fürchterliche Stelle, wo die Größe unseres Hauses begraben war, zu kennen oder zu suchen, hatte ich sie schon gefunden. Wenn ich mit den Kindern aus dem Dorfe, das etwa eine Viertelstunde weit von unserer Hütte entfernt lag, im Gebirge spielte, wählte ich immer jene Höhen, die, ich wußte selbst nicht warum, einen besondern Reiz für mich hatten. Ich war der Jüngste unter meinen Gespielen, und doch, als der Muthigste, in Allem, was wir vornahmen, ihr Anführer. Sie folgten mir gern, wohin ich wollte, und achteten es nicht, daß ihre Eltern, wenn sie ihnen sagten, wo wir gespielt hatten, ihnen immer verboten, diese Gegend wieder zu besuchen, weil dort, wie sie sich ausdrückten, der Rübezahl die Leute gern zu necken pflege.
Die Gegend ward uns allen nach und nach so lieb, daß wir trauerten, wenn die Jahreszeit uns den Zugang dahin verschloß, und allemal von dem Tage an den Frühling rechneten, an dem wir zuerst wieder weiße Steine, die wir im Thale gesammelt hatten, hinauf tragen, und mit denselben das allgemein bekannte Knabenspiel des Anschlagens treiben konnten. Die in die Höhe ragenden schroffen Felsen, und einige Ueberbleibsel von alten Gemäuer, das wir hier fanden, kamen uns bei unserem Spiele sehr zu Statten, und ein allgemeines Jauchzen entstand, wenn Einer von uns, was nicht selten geschah, statt der hingeworfenen Steine, kleine Silbermünzen im Sande fand. Keiner von uns sah etwas Befremdendes in diesem Funde, Keiner wußte ihn zu schätzen, oder kam auf den Einfall, hier mehr suchen, als uns der Zufall in die Hände spielte; wir waren Alle in dem Alter, wo Habsucht, Neugier und unnützes Forschen der Seele noch fremd sind.
Auch das fanden wir nicht außerordentlich, daß sich oft bei unsern Spielen eine Person zu uns gesellte, die weder mit uns hinaufgekommen war, noch mit uns herabstieg, – ein Mann, dessen Aeußeres zwar nicht besonders auffiel, den aber, obgleich wir ihn fast täglich sahen, Keiner von uns recht zu beschreiben wußte, und den wir seiner Kleidung wegen den Langmantel zu nennen pflegten. Langmantel war oft unter uns, und wir hatten uns bald so an ihn gewöhnt, daß wir ihn ungern mißten, und wenn er einmal nicht da war, ihn unruhig erwarteten, bis er dann meistens, wir wußten selbst nicht wie, plötzlich in unserm Kreise stand, und mit seiner gewohnten Emsigkeit an unsern Spielen Theil nahm. Er trieb Alles, was wir vornahmen, so eifrig, als wir Kinder selbst, erfand kleine Vortheile, die er uns zeigte, las mehr Silberpfennige im Sande auf, als wir Alle zusammen, die er denn unter uns vertheilte, so daß wir nichts an ihm auszusetzen hatten, als daß er nie mit uns sprach, und uns immer auf einmal aus den Augen verschwand, ehe wir es uns versahen, was dann meistens auch für uns eine Veranlassung zum Nachhausegehen war.
›Kommt Kinder, der Langmantel ist fort!‹ dies war immer bei uns die Losung zum Abzug, und wenn wir uns einmal verspäteten, so wurde uns auch wohl der Weg durch einen Steinregen von unsichtbarer Hand gewiesen.
Unser Spielgefährte, den wir für Unsersgleichen hielten, ungeachtet er ganz die Gestalt eines Erwachsenen hatte und über uns hervorragte, wie eine Fichte über das niedrige Gesträuch, war nicht immer verträglich; wenn Einer von uns dem Andern Unrecht that, da ermangelte er nicht, derbe Stöße auszutheilen, und zuweilen fiel es ihm auch wohl ohne alle gegebene Ursache ein, die Buben auf einmal den Berg hinabzujagen, und nur mich, den er nie beleidigte, allein oben zu behalten. – Dies war der erste merkliche Vorzug, dessen ich mich von ihm rühmen konnte. War ich mit ihm allein, so führte er mich tiefer zwischen die Klippen und Trümmer, winkte mir, im Sande zu suchen, und ich verließ ihn selten, ohne beide Hände voll ziemlich großer Münzen gesammelt zu haben, die zu meiner Verwunderung nicht, wie unser gewöhnlicher Fund, weiß, sondern gelb und glänzend waren. Jauchzend verließ ich ihn dann, und kaum hatte ich meine unten wartenden Gespielen erreicht, so wurde der ganze Schatz unter sie ausgetheilt. Ein Steinwurf in den Rücken vom Berge herab, oder ein anderes Zeichen des Unwillens vom Geber war meistens mein Lohn; demohngeachtet aber waren er und ich, sobald wir uns wiedersahen, aufs Neue die besten Freunde. Ich blieb gern bei ihm allein, wenn er die Andern fortjagte, und ersetzte sein Stillschweigen mit meinem kindischen Geschwätze, oder ich erfüllte die Luft mit meinem Geschrei, wenn er plötzlich verschwand und ich ihn hinter allen Klippen vergebens suchte. Von den aufgefundenen Münzen brachte ich nie ein Stück mit nach Haus, und glaube auch, daß lange Zeit Keiner von meinen Gespielen hierin glücklicher war als ich.
Der Weg nach dem Dorfe war weit, und der gefundene Schatz, dessen Werth Keiner von uns kannte, blieb sicherlich unterweges zwischen Büschen und Hecken zerstreut liegen, wohin ihn Muthwille und Unachtsamkeit geworfen hatte; denn wäre dieses nicht der Fall gewesen, so wüßte ich nicht, wie das so spät hätte geschehen können, was doch endlich erfolgte. – Einer von den Knaben mochte einmal zufällig einen von unsern kostbaren Spielpfennigen mit nach Hause gebracht und erzählt haben, auf welche Weise er dazu gekommen war. Die Sache erregte Aufsehen. Man zeigte das Gefundene so lange im Dorfe herum, bis es endlich an Jemand kam, der Gehalt und Gepräge kannte, Ersteren für lauteres Gold, und Letzteres für Kaiser Konrads aus Schwaben Bild und Ueberschrift erklärte. Von nun an hatten unsere Wallfahrten nach dem Gebirge und die Spielparthieen mit dem freundlichen Langmantel ein Ende. Die Kinder, – Gott weiß durch welche fürchterliche Erzählungen geschreckt, – wollten nicht mehr hinauf, und ging ich allein dahin, so war es nicht mehr die stille, friedliche Gegend, die mir behagte. Männer mit Spaten und Schaufeln hatten Besitz davon genommen und durchwühlten den Grund, um die verborgenen Reichthümer mühsam aufzusuchen, welche ihre Kinder nicht zu schätzen gewußt hatten. Wahrscheinlich fanden sie Nichts, und noch wahrscheinlicher wurde der Inhaber des gesuchten Schatzes endlich ungeduldig, und trieb sie den Berg hinab, so wie er es mit uns zuweilen gemacht hatte, daß sie das Wiederkommen vergaßen; denn es dauerte nicht lange, so traf ich auf meinem Lieblingsberge wieder die vorige Ruhe und Ordnung, und obgleich ich die Gesellschaft meiner Gespielen daselbst vermißte, weil Keiner mich mehr begleiten wollte, so nahm ich mir doch vor, die mir so lieb gewordene Gegend täglich zu besuchen.
Der Eintritt des Winters verhinderte lange Zeit mein Vorhaben und als ich im nächsten Frühjahre jene Höhen wieder bestieg, fand ich den Erdboden mit schönerem Grün als je bekleidet, und kam auf den Gedanken, hier Blumen zu ziehen, wie ich es meinem Vater in seinem kleinen Garten thun sah. Bei dem nächsten Besuche hatte ich eine Hand voll Saamen mitgebracht und ausgestreut, und kurze Zeit darauf fand ich das Gesäete schon aufgegangen und der Blüthe nah. Voll kindischer Freude stand ich bei meiner künftigen Blumenflur, und bemerkte nicht, daß sich Jemand neben mir befand, bis mich auf einmal die Worte: ›Was machst du hier?‹ aus meinem Traume weckten. Sie waren eben nicht in dem freundlichsten Tone gesprochen, als ich mich aber umwandte und meinen alten Bekannten neben mir erblickte, da überwand die Freude über ihn den kleinen Schrecken, und ich hing mich mit dem Ausrufe: ›ach seyd ihr es, lieber Langmantel!‹ an seinen Arm, und sah lachend zu ihm auf. – Er schleuderte mich ziemlich unsanft von sich, und wiederholte seine Frage. – ›Blumen habe ich gesäet, lieber Herr!‹ rief ich mit weinender Stimme. – ›Rüben hast du gesäet,‹ erwiederte er, indem er mir mit geballter Faust drohte, ›und wüßte ich, daß du es mit Absicht oder aus Spott gethan hättest, den Hals sollte es dir kosten!‹ Seine fürchterlichen Gebärden schreckten mich so sehr, daß ich schweigend davon lief, aber sein Arm erreichte mich bald, und er zog mich zurück. – Mit Entsetzen mußte ich nun sehen, wie er meine wohlgediehen Saat mit Rumpf und Stiel ausrottete, und jetzt weinte ich bitterlich. ›Hüte dich,‹ sagte er, indem er auf die Stelle wies, ›jemals hier wieder Rüben zu säen, aber merke dir den Ort, und wenn einst durch deine Hand jenes Schloß wieder aus seinen Trümmern hervorsteigt, so grabe auf dieser Stelle nach; wo du gesäet hast, sollst du erndten; ich sehe jetzt ein, daß du mich nicht aus Bosheit beleidigtest, und will dir den Schaden vergüten, den in der Vorzeit deine Ahnen durch mich erlitten haben.‹
Ich verstand nicht, was der Mann sagen wollte, auch fragte ich ihn so wenig, als ich zu Hause darüber nachdachte. Aber ich unterließ nicht, fleißig wieder hinauf zu kommen, und verzieh es dem Langmantel, daß er mich damals so sehr geängstigt und gekränkt hatte. Ich traf ihn jedesmal auf dem Berge, aber was er sprach, war kurz und unverständlich; ich erinnere mich nie, wieder eine so lange Rede von ihm gehört zu haben, als er mir zuerst hielt. Er sprach oft mit mir von einem schönen Schlosse, das ehemals hier gestanden habe, und das einst, wenn ich klug und verschwiegen wäre, durch meine Hand wieder hier stehen solle; auch redete er von unterirdischen Goldadern, die der Boden enthalte, und die mich, wenn ich einst als Eigenthumsherr an der bezeichneten Stelle nachgraben ließe, reicher machen würden als einen Fürsten. Ich hörte den Schall der Worte und merkte sie, aber sie ganz zu verstehen oder zu beherzigen, dazu war ich zu jung; ach! ich sollte ihren Sinn erst dann begreifen lernen, als es für mich zu spät war. Etwas besser beachtete ich seine Geschenke, doch nur weil mir ihr Glanz gefiel, nicht weil ich ihren Werth erkannte. Ein Haufen Goldflittern würde mir eben so großes Vergnügen gemacht haben, als die geränderten goldnen Konrads, von denen er mir immer beim Abschied einige verehrte. Er schärfte mir jedesmal hart ein, sie für mich zu behalten, sie Niemand, – auch meinen Vater nicht – zu zeigen, und überhaupt über Alles, was zwischen uns vorgehe, ein tiefes Stillschweigen zu beobachten, wenn ich nicht seiner Gnade und seines Umganges auf immer verlustig gehen wolle.
So verstrich ein ganzer Sommer. Der Winter kam, und so sehr ich mich auch anstrengte, die immer mühseliger werdenden Wanderungen zu meinem seltsamen Freunde noch länger fortzusetzen, so konnte und durfte ich mich doch nach dem ersten Schnee nicht mehr hinauswagen.
Ein trauriger Winter stand mir bevor. Mein Vater hatte bei dem Schüren seiner Meiler Schaden genommen und obwohl ihn der Schäfer aus dem benachbarten Dorfe heilte, so konnte er ihm doch seine verlornen Kräfte nicht wieder geben. Hans Erdmannsdorf welkte sichtlich dahin, und sprach so oft von Tod und Grab, daß ich den guten Vater, an dem mein Herz so sehr hing und dessen Leiden ich so gut zu lindern suchte, als meine kindlichen Kräfte gestatteten, mir schon entrissen glaubte. Große Erleichterungen hätte ich ihm verschaffen können, wenn mir der Werth der Goldpfennige bekannt gewesen wäre, die ich aufgehäuft hatte. Da nämlich die Arbeit gänzlich darnieder lag, so schien uns oft Mangel zu bedrohen, doch kam es nie dazu, daß wir ihn wirklich fühlten. Bald brachte ein alter Schuldner, auf den mein Vater sich nicht mehr besinnen konnte, statt des Geldes einigen Vorrath ins Haus, bald fanden sich in einem längst ausgeleerten Beutel noch einige Groschen, und als mich der Vater einst mit dem einzigen Viehe, das wir besaßen, – einer alten Ziege, – in das nächste Dorf schickte, um sie bei einem Bekannten gegen baares Geld oder Lebensmittel zu verkaufen, da begegnete mir ein noch unerwarteter Glücksfall, welchen ich wegen des Einflusses, den er auf unser Schicksal hatte, nicht unerwähnt lassen darf. Ich ging weinend den Weg nach jenem Dorfe und führte das gute Thier, welches ich so sehr liebte, und von welchem ich mich nun trennen sollte, am Stricke hinter mir her. Da kam mir ein alter Mann entgegen, welcher mich fragte, ob die Ziege mir feil wäre. ›Feil!‹ sagte ich, indem ich mir die Thränen aus den Augen wischte, ›ist sie mir nicht, ich gäbe sie euch nicht um hundert Groschen; aber verkaufen soll ich sie freilich, weil mein Vater und ich sonst morgen kein Brod haben.‹ – ›Gieb mir das Thier!‹ fuhr er fort, ›hier sind zwei Goldstücke!‹ Ich hielt meine Hand hin, und er legte mir ein paar solche glänzende Münzen hinein, wie ich sie oft aus der Hand meines Freundes vom Berge erhalten hatte. ›Nein, Herr!‹ sagte ich, indem ich den Kopf schüttelte, und ihm sein Gold zurück gab, ›solche Dinger habe ich viele daheim, und weiß wohl, daß man sie nur zum Spielen gebrauchen kann.‹ – ›Kleiner Thor!‹ erwiederte er, ›mache die Probe! Hier ist ein Groschen, und hier ein Goldstück; gehe ins Dorf, und versuche, für welches von Beiden du das meiste Brod empfängst.‹ Ich gehorchte und überließ ihm in meiner Einfalt einstweilen die Ziege, unbesorgt, daß er, da er mir doch erst die Hälfte des gebotenen Geldes gezahlt hatte, mit meinem Viehe davon gehen, und mich um die andere Hälfte betrügen könne. Das Schicksal führte mich im Dorfe gleich zu dem einzigen Goldkenner, welcher ehrlich oder schlau genug war, mich von dem Werthe des Goldstückes zu unterrichten, es gegen Silbermünze einzutauschen, und mir für einen kleinen Theil derselben die wichtigsten Hausbedürfnisse einkaufen zu helfen. Er packte sie mir in einen Korb, klagte, daß ich nicht mehr tragen könne, und schalt auf meinen Vater, daß er einem so kleinen Knaben dergleichen schwere Kommissionen aufgetragen habe. Wohl beladen kehrte ich nach Hause zurück, und das Erste, was mir zu Gesichte kam, war meine Ziege, die mir lustig entgegen sprang. – ›Ein fremder Mann,‹ erzählte mein Vater, ›habe sie hergebracht und gesagt, daß er sie im Walde weidend gefunden, und in der Meinung, sie gehöre in dieses Haus, hierher abgeliefert.‹ Ich erzählte dagegen mein Abentheuer, zeigte meinem Vater den mitgebrachten Vorrath und den Ueberschuß des Geldes, und erregte dadurch bei ihm ebenso große Freude, als ich über die Anwesenheit meiner alten Gespielin fühlte, von welcher ich geglaubt hatte, mich auf ewig trennen zu müssen. Mein Vater hatte seine eignen Gedanken über diesen seltsamen Vorfall, der jedoch keineswegs meine Verwunderung erregte, weshalb ich auch gar nicht darüber nachdachte. Vielleicht wäre ich dennoch klug genug gewesen, mich meines heimlichen Schatzes zu erinnern und den Werth desselben zu erkennen, wenn mir nicht Dinge bevorgestanden hätten, die meinen Gedanken eine andere Richtung gaben.
Mein Vater wurde nämlich bald darauf finster und schwermüthig; eine geheime Unruhe vermehrte seine körperliche Schwäche und brachte ihn dem Tode nah. Seine Bekannten aus dem benachbarten Dorfe kamen, ihn in seinen letzten Stunden beizustehen; auch der Goldkenner fand sich ein, und sein Erstes war, mich, der das Haus mit seinen Klagen erfüllte, zu entfernen. ›Geh hinaus, mein Kind,‹ sagte er, ›erhole dich einige Stunden in der freien Luft; dein Vater wird besser werden, und sollte er sterben, so will ich dein Vater sein.‹
Weinend und händeringend durchstrich ich die umliegende Gegend. Unwillkührlich trugen mich meine Füße an den Ort, wo mir oft in Langmantels stiller Gesellschaft so wohl gewesen war, und ich lag bald auf einer meiner Lieblingsstellen im Grase, ohne daß ich wußte, wie ich auf den Berg gekommen war. Es war Frühling so wie heute. Die Sonne lächelte mild herab, an den Ufern der Weistritz, die bereits ruhig, und von den wilden Gewässern gereinigt dahin floß, blühten Tausende von frühzeitigen Blumen, und aus den schwellenden Knospen am Gesträuch drängten sich die jungen Blätter hervor. Ich war nicht blind gegen alle diese Reize der Natur, aber sie erregten in meiner Seele keine Freude, sondern eine unnennbar bittere Empfindung, und lockten einen neuen Thränenstrom hervor.
›Was weinst du denn?‹ fragte auf einmal meines Gespielen wohlbekannte Stimme an meiner Seite. Ich schlug meine von Thränen getrübten Augen nach ihm auf, vermochte aber nicht zu antworten. ›Steh auf!‹ sprach er weiter, ›und sage mir, was dir fehlt; vielleicht kann ich helfen.‹
›Ach,‹ schluchzte ich, ›hier ist Alles so schön und in unserer Hütte ist es so traurig! Hier lebt Alles, und in unserer Hütte ist der Tod!‹
›Thor!‹ erwiederte er, der mich nicht verstand oder nicht verstehen wollte, ›unten im Thale wird es später Frühling als hier! Vor zwei Monaten lag hier auch noch Eis und Schnee, wo jetzt Blumen blühen, und wenn die Sonne höher steigt, wird der Tod auch aus deiner Hütte weichen müssen.‹
›Ach, mein lieber Herr, Blumen sehe ich wohl wieder blühen und verdorrte Bäume wieder grünen, aber – mein Vater! mein guter Vater! er wird sterben, ehe ich ihn wiedersehe! O könnte ich machen, daß Jugend und Kräfte ihm zurückkehrten, wie diesem wilden Rosenstrauche, der im vorigen Winter verdorrte, und der nun so jung und schön dasteht, wie die Blumen, die sich erst heute entfalteten.‹
›Glaubst du nicht, daß auch Menschen wieder blühen können?‹ fragte er, indem er den Rosenstrauch von allen seinen jungen Blättern entblößte und sie in seinen Mantel sammelte, ›oder fürchtest du, daß die sonst so gütige Natur nur dein Geschlecht stiefmütterlich behandele? – Nimm dieses Laub, bestreue damit deines Vaters Lager, und du wirst sehen, was erfolgt; aber eile solches zu thun, denn verloren gegangene Kräfte lassen sich wohl wieder ersetzen, aber die einmal entflohene Seele kehrt nie zurück!‹
Ich verstand sehr wohl, was der Berggeist damit sagen wollte, und ohne zu danken, schüttelte ich das Rosenlaub in meine Mütze, und flog mit Windesschnelle den Berg hinab nach unserer Hütte, wo mein Vater im Sterben lag.
An der Thüre kamen mir unsere Bekannten aus dem Dorfe entgegen, die wieder nach ihrer Heimath gingen, weil es mit dem Kranken, wie sie zu einander sagten, nun doch bald aus sei, und er also ihres Trostes nicht mehr bedürfe.
Ich achtete so wenig auf sie, als sie auf mich, und flog zu dem Bette meines Vaters, bei welchem ich Niemand fand als den Goldkenner, dessen ich schon oft gedacht habe. ›Armes Kind!‹ rief dieser mir entgegen, ›du kommst kaum noch zeitig genug, um deinem sterbenden Vater die Augen zuzudrücken! Betrübe dich indeß nicht so sehr, denn wenn du mir Gehorsam versprichst, so will ich Vaterstelle bei dir vertreten.‹
Ich hörte nicht auf diese Rede, sondern fing an aus meiner Mütze das junge Rosenlaub mit vollen Händen über den Kranken auszustreuen. Es duftete ungewöhnlich stark, der Kranke nießte dreimal und schlug die Augen auf. Der Goldkenner, der meines Vaters Seele schon auf dem Wege nach einer andern Welt geglaubt hatte, erstaunte, – ich aber fuhr fort, die wohlriechenden Blätter auf den sich wieder belebenden Körper des schon halb Entschlafenen auszubreiten, und hatte bald die Genugthuung, einen leisen Druck von seiner Hand zu fühlen, und ihn das Wort ›Erquickung‹ stammeln zu hören.
Von diesem Augenblicke an trat in dem Zustande des Kranken Besserung ein, die durch ihre schnellen Fortschritte den Goldkenner mehr in Verwunderung setzte als mich, der mit dem, was in der Welt möglich und gewöhnlich ist, noch zu wenig bekannt war, um irgend Etwas außerordentlich zu finden. Ich suchte nur das kostbare Rosenlaub sorgfältig zu hüten, damit kein Blättchen davon verloren ginge, und trug es meinem Vater, der am andern Tage schon außer dem Bette sein konnte, überall nach, bis auch das letzte Blättchen davon verwelkte und geruchlos wurde.
›Was ist mit mir vorgegangen?‹ fragte mein Vater, als er am dritten Tage mit mir und dem klugen Manne aus dem Dorfe, der noch immer bei uns verweilte, ins Freie ging. ›Wodurch ist meine Krankheit, mein Schmerz und meine Schwäche verschwunden? Ich fühle mich um dreißig Jahre verjüngt, und stehe hier in der gleichfalls wiedererwachten Natur mit dem vollen Gefühle der Kraft und Gesundheit!‹
›Daß etwas Außerordentliches mit euch vorgegangen ist,‹ erwiederte der Andere, ›das sehe ich so gut, als ihr es fühlt; aber um das Wie und Wodurch müßt ihr euren Sohn befragen, der euch wahrscheinlich bessere Auskunft darüber geben kann als ich.‹
›Das junge Laub, mein Vater,‹ antwortete ich, ›das ich auf euer Lager streute! – –‹
›Gut, mein Kind,‹ fiel dieser ein, ›wie kamst du aber zu dieser Wunderarznei? Wer gab sie dir? Wer entdeckte dir ihre geheimen Kräfte?‹
Ich schwieg; eine innere Stimme verbot mir, diese Fragen aufrichtig zu beantworten, und lügen hatte ich nicht gelernt.
›Mein Sohn‹ fuhr mein Vater fort, indem er mich in seine Arme schloß, ›solltest du vor mir ein Geheimniß haben?‹
›Vater,‹ rief ich, indem mir plötzlich die Worte meines geheimen Freundes einfielen, die sich, wie mir dünkte, hier gut wiederholen ließen, ›seht, wie Alles rund umher grünt und blüht! Glaubt ihr nicht, daß auch Menschen wieder blühen können? Fürchtet ihr, daß die sonst so gütige Natur nur unser Geschlecht stiefmütterlich bedenke?‹
Die Männer sahen sich voll Erstaunen über meine Rede an, die ihnen fast zu hoch war, und die in meinem Munde auch gar seltsam klingen mochte.
›Ist das die Sprache eines siebenjährigen Kindes?‹ sagte mein Vater zu seinem Freunde.
›Wie ich euch schon erklärte,‹ war die Antwort, ›es muß mit eurem Sohne verborgene Bewandnisse haben. Dieser kleine Knabe, der oft für die gewöhnlichsten Dinge im menschlichen Leben nicht genug Verstand und Nachsinnen zeigt, spricht bei andern Gelegenheiten oft höher als der gelehrteste Abt. Wäre der Junge mein, ich müßte hinter seine Geheimnisse kommen. Er hat vielleicht Verbindungen, die zuletzt ihm und euch schädlich werden können, so viel äußerlichen Vortheil sie auch Anfangs zu bringen scheinen.‹
›Erdmann,‹ rief mein Vater, ›willst du mir nicht deinen geheimen Freund entdecken, damit ich mit dir vereint ihm für meine wiedererlangte Gesundheit danken kann?‹
Ich stürzte mich zu seinen Füßen und weinte.
›Es wird wohl dieselbe Person sein,‹ fiel der Andere ein, ›die ihm neulich die Ziege mit schwerem Golde abkaufte, und ihm das Vieh obendrein wiedergab.‹
›Nein,‹ sagte ich in meiner Einfalt, ›den Mann kannte ich gar nicht, ich habe ihn weder zuvor noch nachher gesehen!‹
›Aber desto besser,‹ fuhr der Inquisitor fort, ›wirst du den Herrn kennen, der dir den hübschen Vorrath von Goldstücken verehrte, die du in der Hütte verwahrst.‹
›Mein Sohn soll so viel Gold besitzen,‹ – rief hier mein Vater mit Erstaunen – ›ohne mich damit in meiner Armuth zu unterstützen?‹
›Vater, mit jenen Goldpfennigen kann man ja nichts Anderes machen, als damit spielen!‹
›Daß man sie besser gebrauchen kann,‹ versetzte der Goldkenner, ›das mußt du wenigstens seit der Zeit wissen, da ich dich eines Bessern belehrte.‹
Ich wußte auf diese Rüge nichts zu antworten, denn seit die Krankheit meines Vaters gefährlicher geworden war, hatte ich an meine goldnen Spielpfennige gar nicht mehr gedacht.
›Was du auch gethan haben magst, es sei dir verziehen,‹ – sprach jetzt mein Vater in einem mildern Tone – ›nur gestehe mir Alles!‹
›Vielleicht gewinnt er eher Muth dazu,‹ sagte der Andere, ›wenn ich euch erzähle was ich theils von der Sache weiß, theils darüber muthmaße. Vor ungefähr einem Jahre brachten einige Kinder aus meinem Dorfe, als sie einst vom Spielen heimkehrten, goldene Münzen mit, die sie auf einem Berge, wohin sie euer Sohn immer zu führen pflegte, von einem Unbekannten erhalten haben wollten. Was die Kinder uns von den Dingen erzählten, die ihnen dort oben begegnet sein sollten, schien uns so lange unglaublich, bis wir uns erinnerten, daß der alte Bewohner dieser Gegenden – Rübezahl – gern auf jenem Berge sein Spiel treibe. Unsere Kinder durften von jetzt an den Berg nicht mehr besuchen, wo wir Alten nun vergebens nach den Schätzen des Berggeistes gruben. Euer Sohn ist jedoch, wie ich aus sicherer Hand weiß, nach wie vor auf dem Berge ab und zu gegangen, und mag der arge Versucher ihm wohl schon ganz bethört haben. Durch schnödes Gold hat er den Samen des Geizes in sein Herz gestreut, und dieses, wie der Erfolg ausweißt, sogar gegen seinen eignen Vater verhärtet. Daß euer Sohn heimliche Schätze habe, ward mir schon längst kund, denn man hat ihn an Orten, wo er sich unbemerkt glaubte, mit den Goldmünzen spielen sehen. Noch klarer ward mir die Sache, als er ein Goldstück bei mir verwechselte, und völlig kam ich hinter sein Geheimniß, als ich das aufgehäufte Sündengold einst, – ich versichere euch, von ungefähr und ganz ungesucht – in einem Winkel eurer Hütte fand. Seht nun zu, wie ihr von dem Buben genauere Auskunft über das schreckliche Geheimniß erhaltet! Ich gehe in die nächste Stadt, um der Obrigkeit anzuzeigen, was ich mit gutem Gewissen nicht länger verschweigen kann.‹
Mein Vater starrte mich mit Erstaunen an; ich weinte, und mein Verräther, der die Wahrheit seiner Aussage durch den Augenschein bekräftigen wollte, holte aus der Hütte meinen kleinen Schatz, der sich auf ungefähr drittehalb hundert Stück goldene Konrads belief, und legte ihn meinem Vater vor.
Jetzt drang mein Vater nicht mehr mit Fragen in mich, und suchte sich den Mann, den er sicherlich so sehr verabscheute, als ich, mit einer Hand voll Gold vom Halse zu schaffen. Des Mannes Habgier war jedoch damit noch nicht befriedigt, und erst durch eine zweite und dritte Gabe konnte von ihm das Versprechen, die Sache zu verschweigen, erkauft werden.
Endlich verließ er uns und wir waren allein. Aber anstatt daß meine Prüfung vorbei sein sollte, wie ich gehofft hatte, so ging dieselbe nun erst recht an. Mich gegen das ungestüme, unbefugte Ausforschen eines Fremden zu vertheidigen, dabei leistet mir schon der jedem Knaben angeborne Starrsinn gute Dienste, und Verschwiegenheit gegen einen solchen Inquisitor war eben keine Heldentugend zu nennen; aber was für Waffen hatte ich, um einem Vater zu widerstehen, den ich so sehr liebte und den ich unbedingt Gehorsam zu leisten gewohnt war?
Mein Vater fragte nicht, – er bat, er sah mich liebevoll und bekümmert an, er gestand mir, daß schon der seltsame Handel mit der verkauften und wiedergebrachten Ziege ihn nachdenkend gemacht, und daß Besorgniß über Etwas, das er nicht zu nennen gewußt, ihn selbst dem Grabe nahe gebracht habe. Wenn ich auf meinem Stillschweigen noch länger beharrte, so würden Gram und Furcht ihn bald wieder auf das Krankenlager werfen, und dann dürfte ich nicht hoffen, ihm abermals zu helfen, denn er würde solche unnatürliche Hilfe bestimmt zurückweisen!
Es hätte nicht die Hälfte von diesen Ermahnungen bedurft, um mir mein Geheimniß zu entreißen. Mein Vater erfuhr Alles, und zitternd stand ich vor ihm, das Urtheil zu hören, das er über mein Verhalten fällen würde.
›Ich weiß dich in keiner Beziehung zu tadeln,‹ sagte er nach einer langen Pause, ›dein kindischer Unverstand entschuldigt es, daß du deinem unheimlichen Bekannten so großes Vertrauen schenktest.‹
›Und werde ich den Mann auf dem Berge wiedersehen, werde ich seine Geschenke behalten dürfen?‹
›Das Wichtigste derselben, meine Gesundheit, können wir ihm doch nicht zurückgeben; was bleibt uns also übrig als Dank?‹
›Und danken wollen wir ihm gleich, Vater! Kommt mit mir, ihr sollt ihn sehen, sollt ihm selbst danken!‹
›Kannst du noch wünschen, ihn wieder zu sehen, da du doch jetzt weißt, wer er ist? – Ein Geist, ein Gespenst, allem Vermuthen nach der berüchtigte Rübezahl!‹
›Ein Geist? – Was ist denn ein Geist?‹
›Wunderliche Frage! Ein Geist ist – ist – Kurz ein Geist ist ein ganz anderes Geschöpf als wir!‹
›Aber meine Ziege und die Vögel im Walde sind ja auch ganz andere Geschöpfe als ich, und doch halten wir gute Freundschaft!‹
›Diese Vergleichung paßt nicht, mein Sohn; der mächtige Berggeist ist ein höheres Wesen als du, ist ein Wesen von so zweifelhaftem Rufe, daß es von den meisten Menschen unter die bösen Geister gezählt wird.‹
›Und doch hat sich dieser Geist immer so gütig gegen mich gezeigt! Er wird auch euch nichts zu Leide thun. Kommt, kommt, laßt uns nur auf den Berg gehen!‹
Und wir gingen; ich hüpfte singend voran, und mein Vater folgte ängstlich nach.
Er erstaunte, als ich ihm den Berg zeigte, der das Ziel unserer kleinen Reise war. ›Was sehe ich?‹ rief er, ›die nämliche Stelle, wo einst die Burg unserer Ahnen stand, die Rübezahl zertrümmerte! – Sollte hier eine höhere Schickung im Spiele sein? Sollte hier dem Enkel vielleicht das ersetzt werden, was die Voreltern verloren?‹
Bei diesen Worten erinnerte ich mich der ähnlichen Rede des Berggeistes, von der ich gegen meinen Vater noch nichts erwähnt hatte, und erzählte ihm daher nun, wie mein seltsamer Freund davon gesprochen habe, daß ich einst an dieser Stelle ein Schloß erbauen würde, und daß unter der zerstörten Rübensaat Goldadern verborgen lägen, deren Besitz mich reicher als einen Fürsten machen würde.
Mein Vater sah mich mit Erstaunen an; ›du armes, kleines, einfältiges Geschöpf,‹ rief er, ›du solltest von dem Schicksale zu so großen Dingen bestimmt sein?‹
Ich konnte nicht begreifen, weshalb sich mein Vater über die Prophezeihung des Berggeistes, die ich zwar wörtlich wiederholt, deren Sinn ich aber nie ganz verstanden hatte, so sehr verwunderte. Ohne daher zu antworten, trieb ich meinen Vater nur zur Eile an, damit wir den Berg zeitig genug erbeichen und wieder verlassen könnten, denn ich fürchtete, daß uns sonst der Langmantel von dem Berge verjagen würde.
Schon begann es im Walde zu dämmern, und obgleich wir tüchtig zuschritten, so blieb das Gebirge doch immer gleichweit von uns entfernt, als ob wir uns nicht von der Stelle bewegt hätten, bis uns endlich ein schreckliches Unwetter nöthigte, für heute gänzlich von unserm Vorhaben abzustehen.
Am andern Tage wanderten wir abermals nach dem Berge und kamen auch glücklich hinauf. Hier fanden wir jedoch Alles öde und grausend; die von mir so sehr geliebte Gegend schien sich ganz verändert zu haben, und nur die Ruinen des Schlosses, und der von Rübezahl entblätterte, nunmehr ganz verdorrte Rosenstrauch, waren mir noch kenntlich. Wir warteten einen ganzen Tag vergebens auf unsern Wohlthäter, bis wir, weil wir uns verspätet hatten, endlich durch einen Steinregen nach Hause gewiesen wurden.
Mein Vater verlangte nicht, diese Stelle wiederzusehen; ich besuchte sie täglich, indem ich hoffte, der Berggeist würde sich mir eher zeigen, wenn ich allein wäre; aber ich schien die Gnade meines Freundes auf ewig verscherzt zu haben und sollte ihn nie wieder erblicken.
Dennoch beharrte ich auf meiner Vorliebe für den Berg, und die Stunden, die ich daselbst zubrachte, waren die seligsten meines Lebens. Eines Tages, als ich an der Seite des verdorrten Strauches, mit dessen Blättern ich meinem Vater das Leben gerettet hatte, entschlummert war, träumte ich, der Berggeist stehe an meiner Seite, und betrachte mich mit zärtlichen, kummervollen Blicken. ›Wie ich dich liebte!‹ flüsterte er, als cede er mit sich selbst. ›Welch ein Loos ich dir bestimmte! Und dies ist Alles nun vorüber! Doch die Prüfungen, die ich dir sandte, waren für deine Jahre zu hart; du bist zu entschuldigen. Ganz verlassen werde ich dich nie, und einen Schatz wirst du noch immer in meinen Gebirgen finden, – aber jetzt: fliehe, fliehe!‹
Mit Schrecken erwachte ich bei den letzten Worten, und weil ich an der sinkenden Sonne sah, daß wirklich die verbotene Stunde nahte, eilte ich nach Hause.
Als ich meinem Vater den wunderbaren Traum erzählt hatte, meinte er nur, es sei gut, daß ich die Ermahnungen zur Flucht eilend benutzt habe, und noch besser würde es sein, wenn ich mir für die Zukunft einen andern Spaziergang wählte.