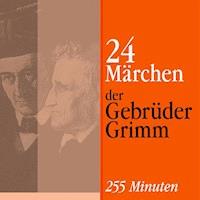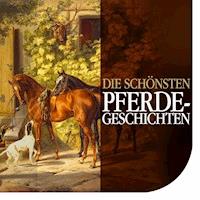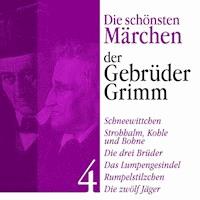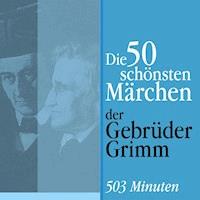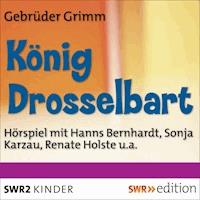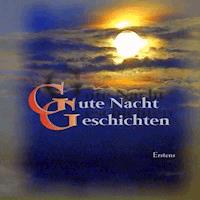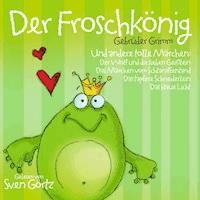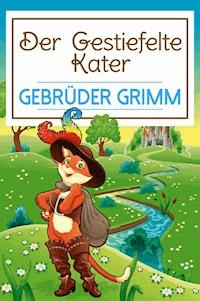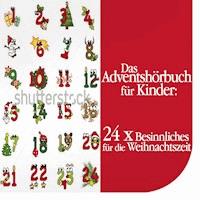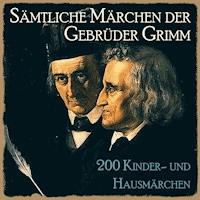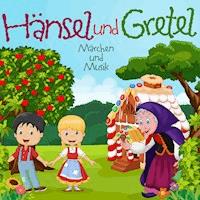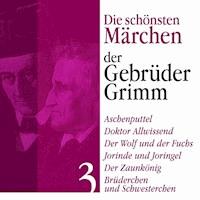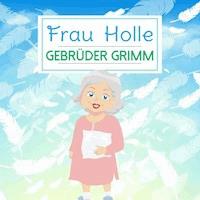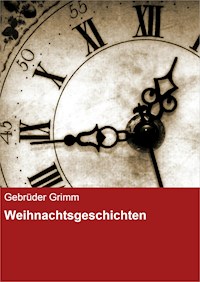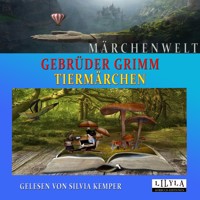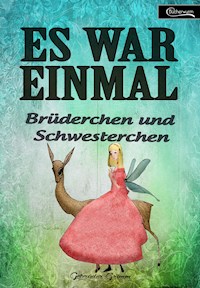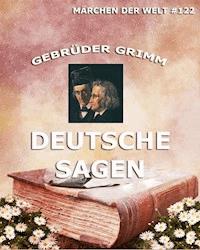
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Über 580 deutsche Sagen im Volltext, darunter die folgenden: Die drei Bergleute im Kuttenberg Der Berggeist Der Bergmönch im Harz Frau Hollen Teich Frau Holla zieht umher Frau Hollen Bad Frau Holla und der treue Eckart Frau Holla und der Bauer Die Springwurzel Fräulein von Boyneburg Der Pielberg Die Schloßjungfrau Die Schlangenjungfrau Das schwere Kind Der alte Weinkeller bei Salurn Hünenspiel Das Riesenspielzeug Riese Einheer Riesensäulen Der Köterberg Geroldseck Kaiser Karl zu Nürnberg Friedrich Rotbart auf dem Kyffhäuser Der Birnbaum auf dem Walserfeld Der verzauberte König zu Schildheiß Kaiser Karl des Großen Auszug Der Untersberg Kaiser Karl im Untersberg Der Scherfenberger und der Zwerg Das stille Volk zu Plesse Des kleinen Volks Hochzeitfest Steinverwandelte Zwerge Zwergberge Zwerge leihen Brot Der Graf von Hoia Zwerge ausgetrieben Die Wichtlein Beschwörung der Bergmännlein Das Bergmännlein beim Tanz Das Kellermännlein Die Ahnfrau, von Rantzau Herrmann von Rosenberg Die Osenberger Zwerge Das Erdmännlein und der Schäferjung Der einkehrende Zwerg Zeitelmoos Das Moosweibchen Der wilde Jäger jagt die Moosleute Der Wassermann Die wilden Frauen im Untersberge Tanz mit dem Wassermann Der Wassermann und der Bauer Der Wassermann an der Fleischerbank Der Schwimmer Bruder Nickel Nixenbrunnen Magdeburger Nixen Der Döngessee Mummelsee ... und viele mehr ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 902
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deutsche Sagen
Jakob und Wilhelm Grimm
Inhalt:
Jakob Ludwig Karl Grimm – Biografie
Wilhelm Karl Grimm – Biografie
Vorrede
Erster Band
Die drei Bergleute im Kuttenberg
Der Berggeist
Der Bergmönch im Harz
Frau Hollen Teich
Frau Holla zieht umher
Frau Hollen Bad
Frau Holla und der treue Eckart
Frau Holla und der Bauer
Die Springwurzel
Fräulein von Boyneburg
Der Pielberg
Die Schloßjungfrau
Die Schlangenjungfrau
Das schwere Kind
Der alte Weinkeller bei Salurn
Hünenspiel
Das Riesenspielzeug
Riese Einheer
Riesensäulen
Der Köterberg
Geroldseck
Kaiser Karl zu Nürnberg
Friedrich Rotbart auf dem Kyffhäuser
Der Birnbaum auf dem Walserfeld
Der verzauberte König zu Schildheiß
Kaiser Karl des Großen Auszug
Der Untersberg
Kaiser Karl im Untersberg
Der Scherfenberger und der Zwerg
Das stille Volk zu Plesse
Des kleinen Volks Hochzeitfest
Steinverwandelte Zwerge
Zwergberge
Zwerge leihen Brot
Der Graf von Hoia
Zwerge ausgetrieben
Die Wichtlein
Beschwörung der Bergmännlein
Das Bergmännlein beim Tanz
Das Kellermännlein
Die Ahnfrau, von Rantzau
Herrmann von Rosenberg
Die Osenberger Zwerge
Das Erdmännlein und der Schäferjung
Der einkehrende Zwerg
Zeitelmoos
Das Moosweibchen
Der wilde Jäger jagt die Moosleute
Der Wassermann
Die wilden Frauen im Untersberge
Tanz mit dem Wassermann
Der Wassermann und der Bauer
Der Wassermann an der Fleischerbank
Der Schwimmer
Bruder Nickel
Nixenbrunnen
Magdeburger Nixen
Der Döngessee
Mummelsee
Die Elbjungfer und das Saalweiblein
Wasserrecht
Das ertrunkene Kind
Schlitzöhrchen
Die Wassernixe und der Mühlknappe
Vor den Nixen hilft Dosten und Dorant
Des Nixes Beine
Die Magd bei dem Nix
Die Frau von Alvensleben
Die Frau von Hahn und der Nix
Frau von Bonikau
Das Streichmaß, der Ring und der Becher
Der Kobold
Der Bauer mit seinem Kobold
Der Kobold in der Mühle
Hütchen
Hinzelmann
Klopfer
Stiefel
Ekerken
Nachtgeist zu Kendenich
Der Alp
Der Wechselbalg
Die Wechselbälge im Wasser
Der Alraun
Spiritus familiaris
Das Vogelnest
Der Brutpfennig
Wechselkind mit Ruten gestrichen
Das Schauen auf die Kinder
Die Roggenmuhme
Die zwei unterirdischen Weiber
König Grünewald
Blümelisalp
Die Lilie
Johann von Passau
Das Hündlein von Bretta
Das Dorf am Meer
Die verschütteten Silbergruben
Die Fundgrübner
Ein gespenstiger Reiter
Der falsche Eid
Zwölf ungerechte Richter
Die heiligen Quellen
Der quillende Brunnen
Hungerquelle
Der Liebenbach
Der Helfenstein.
Die Wiege aus dem Bäumchen
Hessental
Reinstein
Der stillstehende Fluß
Arendsee
Der Ochsenberg
Die Moorjungfern
Andreasnacht
Der Liebhaber zum Essen eingeladen
Die Christnacht
Das Hemdabwerfen
Kristallschauen
Zauberkräuter kochen
Der Salzknecht in Pommern
Jungfer Eli
Die weiße Frau
Taube zeigt einen Schatz
Taube hält den Feind ab
Der Glockenguß zu Breslau
Der Glockenguß zu Attendorn
Die Müllerin
Johann Hübner
Eppela Gaila
Der Blumenstein
Seeburger See
Der Burgsee und Burgwall
Der heilige Niklas und der Dieb
Riesensteine
Spuren im Stein
Der Riesenfinger
Riesen aus dem Untersberge
Der Jettenbühel zu Heidelberg
Riese Haym
Die tropfende Rippe
Jungfrausprung
Der Stierenbach
Die Männer im Zottenberg
Verkündigung des Verderbens
Das Männlein auf dem Rücken
Gottschee
Die Zwerge auf dem Baum
Die Zwerge auf dem Felsstein
Die Füße der Zwerge
Die wilden Geister
Die Heilingszwerge
Der Abzug des Zwergvolks über die Brücke
Der Zug der Zwerge über den Berg
Die Zwerge bei Dardesheim
Schmied Riechert
Grinkenschmidt
Die Hirtenjungen
Die Nußkerne
Der Soester Schatz
Das quellende Silber
Goldsand auf dem Untersberg
Goldkohlen
Der Brunnen zu Steinau
Die fünf Kreuze
Der Schwerttanz zu Weißenstein
Der Steintisch zu Bingenheim
Der lange Mann in der Mordgasse zu Hof
Krieg und Frieden
Rodensteins Auszug
Der Tannhäuser
Der wilde Jäger Hackelberg
Der wilde Jäger und der Schneider
Der Höselberg
Des Rechenbergers Knecht
Geisterkirche
Geistermahl
Der Dachdecker
Die Spinnerin am Kreuz
Buttermilchturm
Der heilige Winfried
Der Hülfenberg
Das Teufelsloch zu Goslar
Die Teufelsmühle
Der Herrgottstritt
Die Sachsenhäuser Brücke zu Frankfurt
Der Wolf und der Tannenzapf
Der Teufel von Ach
Die Teufelsmauer
Des Teufels Tanzplatz
Die Teufelskanzel
Das Teufelsohrkissen
Der Teufelsfelsen
Teufelsmauer
Teufelsgitter
Teufelsmühle
Teufelskirche
Teufelsstein bei Reichenbach
Teufelsstein zu Köln
Süntelstein zu Osnabrück
Der Lügenstein
Die Felsenbrücke
Das Teufelsbad zu Dassel
Der Turm zu Schartfeld
Der Dom zu Köln
Des Teufels Hut
Des Teufels Brand
Die Teufelshufeisen
Der Teufel führt die Braut fort
Das Glücksrad
Der Teufel als Fürsprecher
Traum vom Schatz auf der Brücke
Der Kessel mit dem Schatz
Der Werwolf
Der Werwolfstein
Die Werwölfe ziehen aus
Der Drache fährt aus
Winkelried und der Lindwurm
Der Lindwurm am Brunnen
Das Drachenloch
Die Schlangenkönigin
Die Jungfrau im Oselberg
Der Krötenstuhl
Die Wiesenjungfrau
Das Niesen im Wasser
Die arme Seele
Die verfluchte Jungfer
Das Fräulein von Staufenberg
Der Jungfernstein
Das steinerne Brautbett
Zum Stehen verwünscht
Die Bauern zu Kolbeck
Der heilige Sonntag
Frau Hütt
Der Kindelsberg
Die Semmelschuhe
Der Erdfall bei Hochstädt
Die Brotschuhe
Das taube Korn
Der Frauensand
Brot zu Stein geworden
Der Binger Mäuseturm
Das Bubenried
Kindelbrück
Die Kinder zu Hameln
Der Rattenfänger
Der Schlangenfänger
Das Mäuselein
Der ausgehende Rauch
Die Katze aus dem Weidenbaum
Wetter und Hagel machen
Der Hexentanz
Die Weinreben und Nasen
Festhängen
Das Nothemd
Fest gemacht
Der sichere Schuß
Der herumziehende Jäger
Doppelte Gestalt
Gespenst als Eheweib
Tod des Erstgeborenen
Der Knabe zu Kolmar
Tod des Domherrn zu Merseburg
Die Lilie im Kloster zu Korvei
Rebundus im Dom zu Lübeck
Glocke läutet von selbst
Todesgespenst
Frau Berta oder die weiße Frau
Die wilde Berta kommt
Der Türst, das Posterli und die Sträggele
Der Nachtjäger und die Rüttelweiber
Der Mann mit dem Schlackhut
Der graue Hockelmann
Chimmeke in Pommern
Der Krischer
Die überschiffenden Mönche
Der Irrwisch
Die feurigen Wagen
Räderberg
Die Lichter auf Hellebarden
Das Wafeln
Weberndes Flammenschloß
Der Feuerberg
Der feurige Mann
Die verwünschten Landmesser
Der verrückte Grenzstein
Der Grenzstreit
Der Grenzlauf
Die Alpschlacht
Der Stein bei Wenthusen
Die Altenberger Kirche
Der König im Lauenburger Berg
Der Schwanberg
Der Robbedisser Brunn
Bamberger Waage
Kaiser Friedrich zu Kaiserslautern
Der Hirt auf dem Kyffhäuser
Die drei Telle
Das Bergmännchen
Die Zirbelnüsse
Das Paradies der Tiere
Der Gemsjäger
Die Zwerglöcher
Der Zwerg und die Wunderblume
Der Nix an der Kelle
Schwarzach
Die drei Jungfern aus dem See
Der tote Bräutigam
Der ewige Jäger
Hans Jagenteufel
Des Hackelnberg Traum
Die Tut-Osel
Die schwarzen Reiter und das Handpferd
Der getreue Eckhart
Das Fräulein vom Willberg
Der Schäfer und der Alte aus dem Berg
Jungfrau Ilse
Die Heidenjungfrau zu Glatz
Der Roßtrapp und der Kreetpfuhl
Der Mägdesprung
Der Jungfernsprung
Der Harrassprung
Der Riese Hidde
Das Ilefelder Nadelöhr
Die Riesen zu Lichtenberg
Das Hünenblut
Es rauscht im Hünengrab
Tote aus den Gräbern wehren dem Feind
Hans Heilings Felsen
Die Jungfrau mit dem Bart
Die weiße Jungfrau zu Schwanau
Schwarzkopf und Seeburg am Mummelsee
Der Krämer und die Maus
Die drei Schatzgräber
Einladung vor Gottes Gericht
Gäste vom Galgen
Teufelsbrücke
Die zwölf Johannesse
Teufelsgraben
Der Kreuzliberg
Die Pferde aus dem Bodenloch
Zusammenkunft der Toten
Das weissagende Vöglein
Der Ewige Jud auf dem Mutterhorn
Der Kessel mit Butter
Trauerweide
Das Christusbild zu Wittenberg
Das Muttergottesbild am Felsen
Das Gnadenbild aus dem Lärchenstock zu Waldrast
Ochsen zeigen die heilige Stätte
Notburga
Mauerkalk mit Wein gelöscht
Der Judenstein
Das von den Juden getötete Mägdlein
Die vier Hufeisen
Der Altar zu Seefeld
Der Sterbensstein
Sündliche Liebe
Der Schweidnitzer Ratsmann
Regenbogen über Verurteilten
Gott weint mit dem Unschuldigen
Gottes Speise
Die drei Alten
Zweiter Band
Der heilige Salzfluß
Der heilige See der Hertha
Der heilige Wald der Semnonen
Die Wanderung der Ansivaren
Die Seefahrt der Usipier
Wanderung der Goten
Die eingefallene Brücke
Warum die Goten in Griechenland eingebrochen
Fridigern
Des Königs Grab
Athaulfs Tod
Die Trullen
Sage von Gelimer
Gelimer in silberner Kette
Ursprung der Hunnen
Die Einwanderung der Hunnen
Sage von den Hunnen
Das Kriegsschwert
Die Störche
Der Fisch auf der Tafel
Theoderichs Seele
Urajas und Ildebad
Totila versucht den Heiligen
Der blinde Sabinus
Der Ausgang der Langobarden
Der Langobarden Ausgang
Sage von Gambara46 und den Langbärten
Die Langobarden und Aßipiter
Die sieben schlafenden Männer in der Höhle
Der Knabe im Fischteich
Lamissio und die Amazonen
Sage von Rodulf und Rumetrud
Alboin wird dem Audoin tischfähig
Ankunft der Langobarden in Italien
Alboin gewinnt Ticinum
Alboin betrachtet sich Italien
Alboin und Rosimund
Rosimund, Helmichis und Peredeo
Sage vom König Authari
Autharis Säule
Agilulf und Theudelind
Theodelind und das Meerwunder
Romhild und Grimoald der Knabe
Leupichis entflieht
Die Fliege vor dem Fenster
König Liutprands Füße
Der Vogel auf dem Speer
Aistulfs Geburt
Walter im Kloster
Ursprung der Sachsen
Abkunft der Sachsen
Herkunft der Sachsen
Die Sachsen und die Thüringer
Ankunft der Angeln und Sachsen
Ankunft der Pikten
Die Sachsen erbauen Ochsenburg
Haß zwischen den Sachsen und Schwaben
Herkunft der Schwaben
Abkunft der Bayern
Herkunft der Franken
Die Merowinger
Childerich und Basina
Der Kirchenkrug
Remig umgeht sein Land
Remig verjagt die Feuersbrunst
Des Remigs Teil vom Wasichenwald
Krothilds Verlobung
Die Schere und das Schwert
Sage von Attalus, dem Pferdeknecht, und Leo, dem Küchenjungen
Der schlafende König
Der kommende Wald und die klingenden Schellen
Chlotars Sieg über die Sachsen
Das Grab der Heiligen
Sankt Arbogast
Dagobert und Sankt Florentius
Dagoberts Seele im Schiff
Dagobert und seine Hunde
Die zwei gleichen Söhne
Hildegard
Der Hahnenkampf
Karls Heimkehr aus Ungerland
Der Hirsch zu Magdeburg
Der lombardische Spielmann
Der eiserne Karl
Karl belagerte Pavia
Adelgis
Von König Karl und den Friesen
Radbot läßt sich nicht taufen
Des Teufels goldnes Haus
Wittekinds Taufe
Wittekinds Flucht
Erbauung Frankfurts
Warum die Schwaben dem Reich vorfechten
Eginhart und Emma
Der Ring im See bei Aachen
Der Kaiser und die Schlange
König Karl
Der schlafende Landsknecht
Kaiser Ludwig bauet Hildesheim
Der Rosenstrauch zu Hildesheim
König Ludwigs Rippe klappt
Die Königin im Wachshemd
Königin Adelheid
König Karl sieht seine Vorfahren in der Hölle und im Paradies
Adalbert von Babenberg
Herzog Heinrich und die goldne Halskette
Kaiser Heinrich der Vogeler
Der kühne Kurzbold
Otto mit dem Bart
Der Schuster zu Lauingen
Das Rad im Mainzer Wappen
Der Rammelsberg
Die Grafen von Eberstein
Otto läßt sich nicht schlagen
König Otto in Lamparten
Der unschuldige Ritter
Kaiser Otto hält Witwen- und Waisengericht
Otto III. in Karls Grabe
Die heilige Kunigund
Der Dom zu Bamberg
Taube sagt den Feind an
Der Kelch mit der Scharte
Sage von Kaiser Heinrich III.
Der Teufelsturm am Donaustrudel
Quedl, das Hündlein
Sage vom Schüler Hildebrand
Der Knoblauchskönig
Kaiser Heinrich versucht die Kaiserin
Graf Hoyer von Mansfeld
Die Weiber zu Weinsperg
Der verlorene Kaiser Friedrich
Albertus Magnus und Kaiser Wilhelm
Kaiser Maximilian und Maria von Burgund
Sage von Adelger zu Bayern
Die treulose Störchin
Herzog Heinrich in Bayern hält reine Straße
Diez Schwinburg
Der geschundene Wolf
Die Gretlmühl
Herzog Friedrich und Leopold von Österreich
Der Markgräfin Schleier
Der Brennberger (erste Sage)
Der Brennberger (zweite Sage)
Schreckenwalds Rosengarten
Margareta Maultasch
Dietrichstein in Kärnten
Die Maultasch-Schutt
Radbod von Habsburg
Rudolf von Strättlingen
Idda von Toggenburg
Auswanderung der Schweizer
Die Ochsen auf dem Acker zu Melchtal
Der Landvogt im Bad
Der Bund in Rütli
Wilhelm Tell
Der Knabe erzählt's dem Ofen
Der Luzerner Harschhörner
Ursprung der Welfen
Welfen und Giblinger
Herzog Bundus, genannt der Wolf
Heinrich mit dem güldenen Wagen
Heinrich mit dem goldenen Pfluge
Heinrich der Löwe
Ursprung der Zähringer
Herr Peter Dimringer von Staufenberg
Des edlen Möringers Wallfahrt
Graf Hubert von Calw
Udalrich und Wendilgart und der ungeborne Burkard
Stiftung des Klosters Wettenhausen
Ritter Ulrich, Dienstmann zu Wirtenberg
Freiherr Albrecht von Simmern
Andreas von Sangerwitz, Komtur auf Christburg
Der Virdunger Bürger
Der Mann im Pflug
Siegfried und Genofeva
Karl Ynach, Salvius Brabon und Frau Schwan
Der Ritter mit dem Schwan
Das Schwanschiff am Rhein
Lohengrin zu Brabant
Loherangrins Ende in Lothringen
Der Schwanritter
Der gute Gerhard Schwan
Die Schwanringe zu Plesse
Das Oldenburger Horn
Friedrich von Oldenburg
Die neun Kinder
Amalaberga von Thüringen
Sage von Irminfried, Iring und Dieterich
Das Jagen im fremden Walde
Wie Ludwig Wartburg überkommen
Ludwig der Springer
Reinhartsbrunn
Der hartgeschmiedete Landgraf
Ludwig ackert mit seinen Adligen
Ludwig baut eine Mauer
Ludwigs Leichnam wird getragen
Wie es um Ludwigs Seele geschaffen war
Der Wartburger Krieg
Doktor Luther zu Wartburg
Die Vermählung der Kinder Ludwig und Elisabeth
Heinrich das Kind von Brabant
Frau Sophiens Handschuh
Friedrich mit dem gebissenen Backen
Markgraf Friedrich läßt seine Tochter säugen
Otto der Schütze
Landgraf Philips und die Bauersfrau
In Ketten aufhängen
Landgraf Moritz von Hessen
Brot und Salz segnet Gott
Nidda
Ursprung der von Malsburg
Ursprung der Grafen von Mansfeld
Henneberg
Die acht Brunos
Die Eselswiese
Thalmann von Lunderstedt
Hermann von Treffurt
Der Graf von Gleichen
Hungersnot im Grabfeld
Der Kroppenstedter Vorrat
So viel Kinder als Tag' im Jahr
Die Gräfin von Orlamünde
Deutsche Sagen, Gebrüder Grimm
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:
Jakob Ludwig KarlGrimm – Biografie
Begründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft, geb. 4. Jan. 1785 in Hanau (wo ihm und seinem Bruder Wilhelm 1896 ein Denkmal errichtet worden ist), gest. 20. Sept. 1863 in Berlin, wurde in Steinau erzogen, wohin sein Vater 1791 als Amtmann versetzt worden war, kam 1798 mit seinem Bruder Wilhelm auf das Lyzeum in Kassel und bezog 1802 die Universität Marburg, um sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen. Durch Wachlers Vorträge wurde indes seine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf den deutschen Sprachstamm und die Schätze der deutschen Literatur hingewendet, wozu ihn schon Savignys rechtshistorische Forschungen veranlaßt hatten. Als letzterer 1804 behufs wissenschaftlicher Studien nach Paris ging, ließ er G. bald nachkommen, um sich seiner Hilfe bei literarischen Arbeiten zu bedienen. Im September 1805 nach Kassel, dem Wohnort seiner Mutter, zurückgekehrt, erlangte er hier mit vieler Mühe den Posten eines Akzessisten beim Sekretariat des Kriegskollegiums, nahm aber noch vor Ablauf eines Jahres seine Entlassung. Durch Johannes v. Müller dem damaligen Kabinettssekretär des Königs von Westfalen empfohlen, erhielt er im Juli 1808 eine Anstellung als Bibliothekar des Königs und wurde im Februar 1809 außerdem zum Auditor im Staatsrat ernannt. Die viele Muße, die ihm die amtlichen Geschäfte ließen, verwendete er auf das Studium altdeutscher Poesie und Sprache. Die ersten Resultate seines Fleißes legte er in der Schrift »Über den altdeutschen Meistergesang« (Götting. 1811) nieder, der bald der 1. Band der allbekannten, aus dem Volksmund geschöpften »Kinder- und Hausmärchen« (Berl. 1812) folgte. Dieses Werk, von dem der zweite Band 1815 und der dritte, die Märchenliteratur enthaltend, 1822 erschien (3. Aufl. 1856), während vom ersten und zweiten neue Ausgaben (30. Aufl. 1899) und vom Ganzen eine kleinere Ausgabe (die fortwährend in neuen Auflagen erscheint) nötig wurden, fand sofort den ungeteiltesten Beifall. Im folgenden Jahre gab G. die »Altdeutschen Wälder« (Kassel 1813–16, 3 Bde.) heraus, denen »Die beiden ältesten deutschen Gedichte, das Lied von Hildebrand und Hadubrand und das Weißenbrunner Gebet« (das. 1812) vorhergegangen waren. Mit Ausnahme der Schrift über den Meistergesang hatte G. die übrigen in Verbindung mit seinem Bruder Wilhelm bearbeitet und herausgegeben. Beim Einpacken der reichhaltigen königlichen Bibliothek zu Kassel zur Versendung nach Paris wußte G. manche wertvolle Handschrift als unwichtig darzustellen und zurückzuhalten. Nach der Rückkehr des Kurfürsten wurde G. zum Legationssekretär des hessischen Gesandten Grafen Keller ernannt und begab sich mit diesem ins Hauptquartier der Verbündeten. In Paris war er Mitglied der Kommission, welche die entführten literarischen Schätze zurückforderte. Im Sommer 1814 nach Kassel zurückgekehrt, ging er alsbald zum Kongreß nach Wien, wo er bis Juni 1815 blieb. Um jene Zeit begann er sich mit den slawischen Sprachen bekannt zu machen, deren Studium er später, bei mehr Muße, wieder aufnahm. Eine Frucht dieser Beschäftigung war, wenn wir von den anderweitigen Ergebnissen für die allgemeine linguistische Vergleichung absehen, »Wuk Stephanowitsch' Kleine serbische Grammatik, verdeutscht mit einer Vorrede« (Leipz. 1824). Von Kassel aus, wohin er sich nach Erledigung seiner Wiener Aufträge begeben hatte, mußte er auf Requisition der preußischen Regierung wieder nach Paris eilen, um dort die aus verschiedenen Gegenden Preußens geraubten Handschriften zu ermitteln und zurückzuverlangen. Diese Aufträge brachten ihn mit dem preußischen Geheimen Kammergerichtsrat Eichhorn, dem spätern Unterrichtsminister, zusammen, mit dem er ein dauerndes freundschaftliches Verhältnis anknüpfte. Gegen Ende 1815 nach Kassel zurückgekehrt, wurde er 16. April 1816 zum zweiten Bibliothekar an der Bibliothek daselbst ernannt, an der sein Bruder Wilhelm das Jahr vorher Sekretär geworden war. Schon 1815 hatte er zu Wien »Irmenstraße und Irmensäule« und »Silva de romances viejos« und zu Berlin gemeinschaftlich mit seinem Bruder Wilhelm »Der arme Heinrich von Hartmann von Aue« und »Lieder der alten Edda« (neue Ausgabe der deutschen Übersetzung von Hoffory, Berl. 1885) erscheinen lassen. Nach ihrer Anstellung an der Bibliothek veröffentlichten die Bruder gemeinschaftlich: »Deutsche Sagen« (Berl. 1816–18, 2 Bde.; 3. Aufl. 1891) und »Irische Elfenmärchen« (Leipz. 1826), eine Übersetzung von Crofton Crokers »Fairy legends and traditions of the South of Ireland«, der sie eine treffliche Einleitung vorausschickten. Zwei der wichtigsten Arbeiten Grimms, die in der deutschen Altertumswissenschaft Epoche machen, fallen in diese Zeit des Aufenthalts zu Kassel: die »Deutsche Grammatik« (Götting. 1819, Bd. 1, 2. Aufl. 1822, 3. Aufl. 1840; Bd. 2–4, 1826–37, 2. Abdruck 1853; neuer vermehrter Abdruck des 1. u. 2. Bandes durch Scherer, Berl. 1870 u. 1878, des 3. u. 4. Bandes durch Roethe u. Schröder, Gütersloh 1890 u. 1898) und »Deutsche Rechtsaltertümer« (Göttingen 1828; 4. Aufl. von Heusler u. Hübner, Leipz. 1900, 2 Bde.). In seiner »Deutschen Grammatik« hat G. den ersten wesentlichen Schritt zur Begründung tieferer Erkenntnis des deutschen Altertums getan. Die Grammatik erscheint in diesem Werk nicht mehr als trockne Schematisierung; G. wußte »ein historisches Leben mit allem Fluß freudiger Entwickelung in sie zu zaubern« und hat dadurch zu dem Bau unsrer nationalen Philologie einen neuen Grund gelegt. Was die »Rechtsaltertümer« für das innigere Verständnis des ältesten Rechtslebens sind, das leistete für die Religion der alten Deutschen Grimms »Deutsche Mythologie« (Götting. 1835, 3. Aufl. 1854; 4. Aufl. durch E. H. Meyer, Berl. 1875–78), ein Werk von nicht minder großer Tragweite für die germanistische Wissenschaft. Da nach dem 1329 erfolgten Tode Völkels, des Oberbibliothekars, die Gebrüder G. ihren Anspruch auf Beförderung nicht berücksichtigt sahen, folgten sie in demselben Jahr einem Ruf nach Göttingen, und zwar Jakob als ordentlicher Professor und Bibliothekar und Wilhelm als Unterbibliothekar. Hier wurde die »Deutsche Grammatik« vollendet und die schon erwähnte »Mythologie« ausgearbeitet. In jene Zeit fallen auch Grimms kleinere Werke. »Hymnorum veteris ecclesiae XXVI interpretatio theotisca« (Götting. 1830), »Die angelsächsischen Dichtungen Andreas und Elene« (Kassel 1840); von größern Arbeiten noch »Reinhart Fuchs« (1834), worin G. nebeneinander den mittelhochdeutschen Reinhart, den niederländischen Reinaert und andre deutsche und lateinische Gedichte der mittelalterlichen Tierfabel veröffentlichte und mit umfassenden Untersuchungen über die Tiersage begleitete. Da G. mit seinem Bruder Wilhelm die bekannte Protestation der Göttinger Sieben gegen die Aufhebung des hannoverschen Staatsgrundgesetzes von 1833 unterschrieb, wurden beide Ende 1837 ihres Amtes entsetzt und begaben sich zurück nach Kassel (vgl. Jakob Grimms Schrift: »Über meine Entlassung«, Basel 1838). 1840 gleichzeitig mit seinem Bruder zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin mit dem Recht, Vorlesungen an der Universität zu halten, ernannt, eröffnete Jakob 30. April 1841 seine Vorlesungen über Altertümer des deutschen Rechts. Er war Vorsitzender der Germanistenversammlungen zu Frankfurt (1846) und Lübeck (1847) und saß 1848 kurze Zeit in der Nationalversammlung zu Frankfurt, tagte auch 1849 mit zu Gotha. 1848 erschien seine »Geschichte der deutschen Sprache« (Leipz., 2 Bde.; 4. Aufl., das. 1880). Schon früher hatte er im Anschluß an seine »Rechtsaltertümer« eine Sammlung deutscher »Weistümer« (Götting. 1840–63, 4 Bde.) unternommen, von denen nach seinem Tode noch 2 Bände (das. 1867–70, Registerband 1878) erschienen. Viele besondere Untersuchungen legte G. in Haupts »Zeitschrift für deutsches Altertum«, in Pfeiffers »Germania« und in den Abhandlungen der Berliner Akademie nieder; von letztern erschien in besonderm Abdruck die Schrift »Über den Ursprung der Sprache« (Berl. 1852, 7. Aufl. 1879). In der Vorrede zu Merkels »Lex salica« (Berl. 1850) behandelte er ausführlich die Malbergische Glosse. In Gemeinschaft mit seinem Bruder begann er endlich noch in hohem Alter die umfassendste Arbeit seines Lebens, das »Deutsche Wörterbuch« (Leipz. 1852 ff.), das den gesamten neuhochdeutschen Sprachschatz von der Mitte des 15. Jahrh. bis zur Gegenwart darzulegen bestimmt ist, und dessen Weiterführung nach seinem Tode Hildebrand und Weigand übernahmen, denen sich später Moritz Heyne, M. Lexer, Ernst Wülcker, H. Wunderlich und Karl v. Bahder anreihten. Eine Sammlung von Abhandlungen, Rezensionen, Reden etc. von Jakob G. erschien u. d. T.: »Kleinere Schriften« (Berl. 1867–90, 8 Bde.; Auswahl daraus, 2. Ausg. 1875), worin auch seine Selbstbiographie enthalten ist. Ein lebendiges Bild seiner Persönlichkeit geben seine in großer Anzahl veröffentlichten Briefe, so: der »Briefwechsel zwischen Jakob G. und J. D. Graeter aus den Jahren 1810–1813« (Heilbr. 1877); »Freundesbriefe von Wilh. und Jakob G.« (das. 1878); »Briefwechsel des Freiherrn v. Meusebach mit Jakob und Wilh. G.« (das. 1880); »Briefwechsel zwischen Wilhelm und Jakob G. aus der Jugendzeit« (Berl. 1.881); »Briefe an Hendrik Willem Tydeman« (Heilbr. 1882); »Briefwechsel der Gebrüder G. mit nordischen Gelehrten« (Berl. 1885); »Briefwechsel zwischen Jakob und Wilhelm G., Dahlmann und Gervinus« (das. 1885–86, 2 Bde.); »Briefe der Brüder Jakob und Wilhelm G. an Georg Friedrich Benecke« (Götting. 1889); »Emil Brauns Briefwechsel mit den Brüdern G. und Jos. v. Laßberg« (Gotha 1891); »Briefwechsel Friedrich Lückes mit den Brüdern Jakob und Wilhelm G.« (Hannov. 1891). Vgl. Scherer, Jakob G. (2. Aufl., Berl. 1885); Berndt, Jakob Grimms Leben und Werke (Halle 1884); A. Duncker, Die Bruder G. (Kassel 1884); Schönbach, Die Brüder G. (Berl. 1885); Stengel, Private und amtliche Beziehungen der Brüder G. zu Hessen (Marb. 1886, 2 Bde.); Steig, Goethe und die Brüder G. (Berl. 1892); R. Hübner, Jakob G. und das deutsche Recht (Götting. 1895); C. Franke, Die Brüder G. Leben und Wirken (Dresd. 1899).
Wilhelm KarlGrimm – Biografie
Ausgezeichneter deutscher Altertumsforscher, geb. 24. Febr. 1786 in Hanau, gest. 16. Dez. 1859 in Berlin, genoß mit seinem Bruder Jakob gleiche Erziehung und gleichen Unterricht, besuchte, wie dieser, das Lyzeum zu Kassel und 1803 die Universität Marburg und erfreute sich ebenfalls des Wohlwollens Savignys, der ihn bestimmte, sich der Rechtswissenschaft zuzuwenden. Asthmatische Beschwerden und eine Herzkrankheit, zu deren Heilung er 1809 zu Reil nach Halle ging, verboten ihm längere Zeit, sich um ein Amt zu bewerben. Er genas nur langsam, doch vollständig. Er wurde 1814 zum Bibliotheksekretär in Kassel ernannt, wo er sich auch 15. Mai 1825 verheiratete, und folgte Anfang 1830 seinem Bruder nach Göttingen, wo er die Stelle eines Unterbibliothekars und 1835 eine außerordentliche Professur in der philosophischen Fakultät erhielt. Seine übrigen Lebensschicksale sind aufs engste mit denen seines Bruders Jakob verflochten: auch er gehörte zu den Sieben, die gegen die Aufhebung des Staatsgrundgesetzes protestierten, und wurde infolgedessen seines Amtes entsetzt, durfte aber noch bis Oktober 1838 in Göttingen bleiben, worauf er sich zu seinem Bruder nach Kassel begab. Mit diesem ging er 1841 nach Berlin. Die Gemeinsamkeit und gegenseitige Ergänzung der beiden Brüder in Hinsicht auf deutsche Wissenschaft und Politik, Überzeugungstreue, Arbeitskraft und Richtung ihres Wirkens steht als ein seltenes Beispiel da. Mit liebevoller Hingabe hat Wilhelm G. seine Forschungen besonders der Poesie des Mittelalters zugewendet. Außer einer Anzahl mit seinem Bruder Jakob bearbeiteter Werke (so der »Kinder- und Hausmärchen«, an deren Bearbeitung ihm der Hauptanteil gebührt) veröffentlichte er allein: »Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen«, übersetzt (Heidelb. 1811); »Über deutsche Runen« (Götting. 1821; Nachtrag: »Zur Literatur der Runen«, 1828); Ausgaben des »Grave Ruodolf« (das. 1828, 2. Aufl. 1844; Bruchstücke eines Gedichts aus dem 12. Jahrh.), des »Hildebrandsliedes« (Faksimile, das. 1830), des »Freidank« (das. 1834,2. Ausg. 1860), des »Rosengarten« (das. 1836), des »Rolandsliedes« (das. 1838), des »Wernher vom Niederrhein« (das. 1839), der »Goldenen Schmiede« (Berl. 1840) und des »Silvester« von Konrad von Würzburg (Götting. 1841), des »Athis und Prophilias« (das. 1846, Nachtrag 1852), der »Altdeutschen Gespräche« (Berl. 1851, Nachtrag 1852). Sein Hauptwerk ist »Die deutsche Heldensage« (Götting. 1829; 3. Aufl., Gütersl. 1889), eine Zusammenstellung der Zeugnisse für sie, nebst einer Abhandlung über ihren Ursprung und ihre Fortbildung. Außerdem sind zu erwähnen: die in der Berliner Akademie gelesene Abhandlung »Exhortatio ad plebem christianam« (Berl. 1848), mit der eine Abhandlung über die »Glossae Casselanae«, die zu den ältesten Denkmälern der deutschen Sprache gehören (Nachtrag hierzu 1855), sowie eine andre »über die Bedeutung der deutschen Fingernamen« verbunden ist; ferner die gelehrte Untersuchung über »Die Sage vom Ursprung der Christusbilder« (das. 1843); die Abhandlung »Über Freidank« (das. 1850, mit 2 Nachträgen 1852 u. 1856); »Zur Geschichte des Reims« (das. 1852) und »Die Sage von Polyphem« (das. 1857). Seine »Kleinern Schriften« (hrsg. von Hinrichs, Berl. 1881–86, 4 Bde.) enthalten eine Sammlung seiner Rezensionen und zerstreuten Abhandlungen, darunter seine Selbstbiographie. G. veranstaltete 1839 auch eine Ausgabe der Werke Achim v. Arnims. Vgl die bei Jakob G. (s. oben) angeführte Literatur (Briefwechsel etc.).
Vorrede
1. Wesen der Sage
Es wird dem Menschen von Heimats wegen ein guter Engel beigegeben, der ihn, wann er ins Leben auszieht, unter der vertraulichen Gestalt eines Mitwandernden begleitet; wer nicht ahnt, was ihm Gutes dadurch widerfährt, der mag es fühlen, wenn er die Grenze des Vaterlandes überschreitet, wo ihn jener verläßt. Diese wohltätige Begleitung ist das unerschöpfliche Gut der Märchen, Sagen und Geschichte, welche nebeneinander stehen und uns nacheinander die Vorzeit als einen frischen und belebenden Geist nahezubringen streben. Jedes hat seinen eigenen Kreis. Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer; jenes stehet beinahe nur in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollendung; die Sage, von einer geringern Mannigfaltigkeit der Farbe, hat noch das Besondere, daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem hafte, an einem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherten Namen. Aus dieser ihrer Gebundenheit folgt, daß sie nicht, gleich dem Märchen, überall zu Hause sein könne, sondern irgendeine Bedingung voraussetze, ohne welche sie bald gar nicht da, bald nur unvollkommener vorhanden sein würde. Kaum ein Flecken wird sich in ganz Deutschland finden, wo es nicht ausführliche Märchen zu hören gäbe, manche, an denen die Volkssagen bloß dünn und sparsam gesät zu sein pflegen. Diese anscheinende Dürftigkeit und Unbedeutendheit zugegeben, sind sie dafür innerlich auch weit eigentümlicher; sie gleichen den Mundarten der Sprache, in denen hin und wieder sonderbare Wörter und Bilder aus uralten Zeiten hangengeblieben sind, während die Märchen ein ganzes Stück alter Dichtung sozusagen in einem Zuge zu uns übersetzen. Merkwürdig stimmen auch die erzählenden Volkslieder entschieden mehr zu den Sagen wie zu den Märchen, die wiederum in ihrem Inhalt die Anlage der frühesten Poesien reiner und kräftiger bewahrt haben, als es sogar die übriggebliebenen größeren Lieder der Vorzeit konnten. Hieraus ergibt sich ohne alle Schwierigkeit, wie es kommt, daß fast nur allein die Märchen Teile der urdeutschen Heldensage erhalten haben, ohne Namen (außer wo diese allgemein und in sich selbst bedeutend wurden, wie der des alten Hildebrand), während in den Liedern und Sagen unseres Volks so viele einzelne, beinahe trockene Namen, Örter und Sitten aus der ältesten Zeit festhaften. Die Märchen also sind teils durch ihre äußere Verbreitung, teils ihr inneres Wesen dazu bestimmt, den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbetrachtung zu fassen, sie nähren unmittelbar, wie die Milch, mild und lieblich, oder der Honig, süß und sättigend, ohne irdische Schwere; dahingegen die Sagen schon zu einer stärkeren Speise dienen, eine einfachere, aber desto entschiedenere Farbe tragen und mehr Ernst und Nachdenken fodern. Über den Vorzug beider zu streiten wäre ungeschickt; auch soll durch diese Darlegung ihrer Verschiedenheit weder ihr Gemeinschaftliches übersehen, noch geleugnet werden, daß sie in unendlichen Mischungen und Wendungen ineinandergreifen und sich mehr oder weniger ähnlich werden. Der Geschichte stellen sich beide, das Märchen und die Sage, gegenüber, insofern sie das sinnlich Natürliche und Begreifliche stets mit dem Unbegreiflichen mischen, welches jene, wie sie unserer Bildung angemessen scheint, nicht mehr in der Darstellung selbst verträgt, sondern es auf ihre eigene Weise in der Betrachtung des Ganzen neu hervorzusuchen und zu ehren weiß. Die Kinder glauben an die Wirklichkeit der Märchen, aber auch das Volk hat noch nicht ganz aufgehört, an seine Sagen zu glauben, und sein Verstand sondert nicht viel darin; sie werden ihm aus den angegebenen Unterlagen genug bewiesen, das heißt, das unleugbar nahe und sichtliche Dasein der letzteren überwiegt noch den Zweifel über das damit verknüpfte Wunder. Diese Eingenossenschaft der Sage ist folglich gerade ihr rechtes Zeichen. Daher auch von dem, was wirkliche Geschichte heißt (und einmal hinter einen gewissen Kreis der Gegenwart und des von jedem Geschlecht Durchlebten tritt), dem Volk eigentlich nichts zugebracht werden kann, als was sich ihm auf dem Wege der Sage vermittelt; einer in Zeit und Raum zu entrückten Begebenheit, der dieses Erfordernis abgeht, bleibt es fremd oder läßt sie bald wieder fallen. Wie unverbrüchlich sehen wir es dagegen an seinen eingeerbten und hergebrachten Sagen haften, die ihm in rechter Ferne nachrücken und sich an alle seine vertrautesten Begriffe schließen. Niemals können sie ihm langweilig werden, weil sie ihm kein eiteles Spiel, das man einmal wieder fahrenläßt, sondern eine Notwendigkeit scheinen, die mit ins Haus gehört, sich von selbst versteht und nicht anders als mit einer gewissen, zu allen rechtschaffenen Dingen nötigen Andacht, bei dem rechten Anlaß, zur Sprache kommt. Jene stete Bewegung und dabei immerfortige Sicherheit der Volkssagen stellt sich, wenn wir es deutlich erwägen, als eine der trostreichsten und erquickendsten Gaben Gottes dar. Um alles menschlichen Sinnen Ungewöhnliche, was die Natur eines Landstrichs besitzt oder wessen ihn die Geschichte gemahnt, sammelt sich ein Duft von Sage und Lied, wie sich die Ferne des Himmels blau anläßt und zarter, feiner Staub um Obst und Blumen setzt. Aus dem Zusammenleben und Zusammenwohnen mit Felsen, Seen, Trümmern, Bäumen, Pflanzen entspringt bald eine Art von Verbindung, die sich auf die Eigentümlichkeit jedes dieser Gegenstände gründet und zu gewissen Stunden ihre Wunder zu vernehmen berechtigt ist. Wie mächtig das dadurch entstehende Band sei, zeigt an natürlichen Menschen jenes herzzerreißende Heimweh. Ohne diese sie begleitende Poesie müßten edele Völker vertrauern und vergehen; Sprache, Sitte und Gewohnheit würde ihnen eitel und unbedeckt dünken, ja hinter allem, was sie besäßen, eine gewisse Einfriedung fehlen. Auf solche Weise verstehen wir das Wesen und die Tugend der deutschen Volkssage, welche Angst und Warnung vor dem Bösen und Freude an dem Guten mit gleichen Händen austeilt. Noch geht sie an Örter und Stellen, die unsere Geschichte längst nicht mehr erreichen kann, vielmehr aber fließen sie beide zusammen und untereinander; nur daß man zuweilen die an sich untrennbar gewordene Sage, wie in Strömen das aufgenommene grünere Wasser eines anderen Flusses, noch lange zu erkennen vermag.
2. Treue der Sammlung
Das erste, was wir bei Sammlung der Sagen nicht aus den Augen gelassen haben, ist Treue und Wahrheit. Als ein Hauptstück aller Geschichte hat man diese noch stets betrachtet; wir fodern sie aber ebensogut auch für die Poesie und erkennen sie in der wahren Poesie ebenso rein. Die Lüge ist falsch und bös; was aus ihr herkommt, muß es auch sein. In den Sagen und Liedern des Volks haben wir noch keine gefunden: es läßt ihren Inhalt, wie er ist und wie es ihn weiß; dawider, daß manches abfalle in der Länge der Zeit, wie einzelne Zweige und Äste an sonst gesunden Bäumen vertrocknen, hat sich die Natur auch hier durch ewige und von selbst wirkende Erneuerungen sichergestellt. Den Grund und Gang eines Gedichts überhaupt kann keine Menschenhand erdichten; mit derselben fruchtlosen Kraft würde man Sprachen, und wären es kleine Wörtchen darin, ersinnen, ein Recht oder eine Sitte alsobald neu aufbringen oder eine unwirkliche Tat in die Geschichte hinstellen wollen. Gedichtet kann daher nur werden, was der Dichter mit Wahrheit in seiner Seele empfunden und erlebt hat und wozu ihm die Sprache halb bewußt, halb unbewußt auch die Worte offenbaren wird; woran aber die einsam dichtenden Menschen leicht, ja fast immer verstoßen, nämlich an dem richtigen Maß aller Dinge, das ist der Volksdichtung schon von selbst eingegeben. Überfeine Speisen widerstehen dem Volk, und für unpoetisch muß es gelten, weil es sich seiner stillen Poesie glücklicherweise gar nicht bewußt wird; die ungenügsamen Gebildeten haben dafür nicht bloß die wirkliche Geschichte, sondern auch das gleich unverletzliche Gut der Sage mit Unwahrheiten zu vermengen, zu überfüllen und überbieten getrachtet. Dennoch ist der Reiz der unbeugsamen Wahrheit unendlich stärker und dauernder als alle Gespinste, weil er nirgends Blößen gibt und die rechte Kühnheit hat. In diesen Volkssagen steckt auch eine so rege Gewalt der Überraschung, vor welcher die überspannteste Kraft der aus sich bloß schöpfenden Einbildung zuletzt immer zuschanden wird, und bei einer Vergleichung beider würde sich ein Unterschied dargeben wie zwischen einer geradezu ersonnenen Pflanze und einer neu aufgefundenen wirklichen, bisher von den Naturforschern noch unbeobachteten, welche die seltsamsten Ränder, Blüten und Staubfäden gleich aus ihrem Innern zu rechtfertigen weiß oder in ihnen plötzlich etwas bestätiget, was schon in andern Gewächsen wahrgenommen worden ist. Ähnliche Vergleichungen bieten die einzelnen Sagen untereinander sowie mit solchen, die uns alte Schriftsteller aufbewahrt haben, in Überfluß dar. Darum darf ihr Innerstes bis ins kleinste nicht verletzt und darum müssen Sachen und Tatumstände lügenlos gesammelt werden. An die Worte war sich, soviel tunlich, zu halten, nicht an ihnen zu kleben.
3. Mannigfaltigkeit der Sammlung
Das zweite, eigentlich schon im ersten mitbegriffene Hauptstück, worauf es bei einer Sammlung von Volkssagen anzukommen scheint, bestehet darin, daß man auch ihre Mannigfaltigkeit und Eigentümlichkeit sich recht gewähren lasse. Denn darauf eben beruhet ihre Tiefe und Breite, und daraus allein wird ihre Natur zu erforschen sein. Im Epos, Volkslied und der ganzen Sprache zeigt sich das gleiche wieder; bald haben jene den ganzen Satz miteinander gemein, bald einzelne Zeilen, Redensarten, Ausdrücke; bald hebt, bald schließt es anders und bahnt sich nur neue Mittel und Übergänge. Die Ähnlichkeit mag noch so groß sein, keins wird dem andern gleich; hier ist es voll und ausgewachsen, dort stehet es ärmer und dürftiger. Allein diese Armut, weil sie schuldfrei, hat in der Besonderheit fast jedesmal ihre Vergütung und wird eine Armutseligkeit. Sehen wir die Sprache näher an, so stuft sie sich ewig und unendlich in unermeßlichen Folgen und Reihen ab, indem sie uns ausgegangene neben fortblühenden Wurzeln, zusammengesetzte und vereinfachte Wörter und solche, die sich neu bestimmen oder irgendeinem verwandten Sinn gemäß weiter ausweichen, zeigt; ja es kann diese Beweglichkeit bis in den Ton und Fall der Silben und die einzelnen Laute verfolgt werden. Welches unter dem Verschiedenen nun das Bessere sei und mehr zur Sache gehöre, das ist kaum zu sagen, wo nicht ganz unmöglich und sündlich, sofern wir nicht vergessen wollen, daß der Grund, woraus sie alle zusammen entsprungen, die göttliche Quelle, an Maß unerhört, an Ausstrahlung unendlich, selber war. Und weil das Sonnenlicht über groß und klein scheint und jedem hilft, soweit es sein soll, bestehen Stärke und Schwäche, Keime, Knospen, Trümmer und Verfall neben- und durcheinander. Darum tut es nichts, daß man in unserm Buch Ähnlichkeiten und Wiederholungen finden wird; denn die Ansicht, daß das verschiedene Unvollständige aus einem Vollständigen sich aufgelöst, ist uns höchst verwerflich vorgekommen, weil jenes Vollkommene nichts Irdisches sein könnte, sondern Gott selber, in den alles zurückfließt, sein müßte. Hätten wir also dieser ähnlichen Sagen nicht geschont, so wäre auch ihre Besonderheit und ihr Leben nicht zu retten gewesen. Noch viel weniger haben wir arme Sagen reich machen mögen, weder aus einer Zusammenfügung mehrerer kleinen, wobei zur Not der Stoff geblieben, Zuschnitt und Färbung aber verlorengegangen wäre, noch gar durch unerlaubte, fremde Zutaten, die mit nichts zu beschönigen sind und denen der unerforschliche Gedanke des Ganzen, aus dem jene Bruchstücke übrig waren, notwendig fremd sein mußte. Ein Lesebuch soll unsere Sammlung gar nicht werden, in dem Sinn, daß man alles, was sie enthält, hintereinander auszulesen hätte. Jedwede Sage stehet vielmehr geschlossen für sich da und hat mit der vorausgehenden und nachfolgenden eigentlich nichts zu tun; wer sich darunter aussucht, wird sich schon begnügen und vergnügen. Übrigens braucht, sosehr wir uns bemühten, alles lebendig Verschiedene zu behüten, kaum erinnert zu werden, daß die bloße Ergänzung einer und derselben Sage aus mehrern Erzählungen, das heißt die Beseitigung aller nichtsbedeutenden Abweichungen, einem ziemlich untrüglichen kritischen Gefühl, das sich von selbst einfindet, überlassen worden ist.
4. Anordnung der Sammlung
Auch bei Anordnung der einzelnen Sagen haben wir am liebsten der Spur der Natur folgen wollen, die nirgends steife und offenliegende Grenzen absteckt. In der Poesie gibt es nur einige allgemeine Abteilungen, alle andern sind unrecht und zwängen, allein selbst jene großen haben noch ihre Berührung und greifen ineinander über. Der Unterschied zwischen Geschichte, Sage und Märchen gehört nun offenbar zu den erlaubten und nicht zu versäumenden; dennoch gibt es Punkte, wo nicht zu bestimmen ist, welches von dreien vorliege, wie zum Beispiel Frau Holla in den Sagen und Märchen auftritt oder sich ein sagenhafter Umstand auch einmal geschichtlich zugetragen haben kann. In den Sagen selbst ist nur noch ein Unterschied, nach dem eine äußerliche Sammlung zu fragen hätte, anerkannt worden; der nämlich, wonach wir die mehr geschichtlich gebundenen von den mehr örtlich gebundenen trennen und jene für den zweiten Teil des Werks zurücklegen. Die Ortssagen aber hätten wiederum nach den Gegenden, Zeiten oder dem Inhalt abgeteilt werden mögen. Eine örtliche Anordnung würde allerdings gewisse landschaftliche Sagenreihen gebildet und dadurch hin und wieder auf den Zug, den manche Art Sagen genommen, gewiesen haben. Allein es ist klar, daß man sich dabei am wenigsten an die heutigen Teilungen Deutschlands, denen zufolge zum Beispiel Meißen Sachsen, ein großer Teil des wahren Sachsens aber Hannover genannt, im kleinen, einzelnen noch viel mehr untereinander gemengt wird, hätte halten dürfen. War also eine andere Einteilung, nicht nach Gebirgen und Flüssen, sondern nach der eigentlichen Richtung und Lage der deutschen Völkerstämme, unbekümmert um unsere politischen Grenzen, aufzustellen, so ist hierzu so wenig Sicheres und Gutes vorgearbeitet, daß gerade eine sorgsamere Prüfung der aus gleichem Grund verschmähten und versäumten Mundarten und Sagen des Volks erst muß dazu den Weg bahnen helfen. Was folglich aus der Untersuchung derselben künftig einmal mit herausgehen dürfte, kann vorläufig jetzo noch gar nicht ihre Einrichtung bestimmen. Ferner: Im allgemeinen einigen Sagen vor den andern höheres Alter zuzuschreiben möchte großen Schwierigkeiten unterworfen und meistens nur ein mißverständlicher Ausdruck sein, weil sie sich unaufhörlich wiedergebären. Die Zwerg-und Hünensagen haben einen gewissen heidnischen Anstrich voraus, aber in den so häufigen von den Teufelsbauten brauchte man bloß das Wort Teufel mit Thurst oder Riese zu tauschen oder ein andermal bei dem Weibernamen Jette sich nur der alten Jöten (Hünen) gleich zu erinnern, um auch solchen Erzählungen ein Ansehen zu leihen, das also noch in andern Dingen außer den Namen liegt. Die Sagen von Hexen und Gespenstern könnte man insofern die neuesten nennen, als sie sich am öftersten erneuern, auch, örtlich betrachtet, am lockersten stehen; inzwischen sind sie im Grund vielmehr nur die unvertilglichsten, wegen ihrer stetigen Beziehung auf den Menschen und seine Handlungen, worin aber kein Beweis ihrer Neuheit liegt. Es bewiese lediglich, daß sie auch alle anderen überdauern werden, weil die abergläubische Neigung unseres Gemüts mehr Gutes und Böses von Hexen und Zauberern erwartet als von Zwergen und Riesen; weshalb merkwürdigerweise gerade jene Sagen sich beinahe allein noch aus dem Volk Eingang unter die Gebildeten machen. Diese Beispiele zeigen hinlänglich, wie untunlich es gewesen wäre, nach dergleichen Rücksichten einzelne Sagen chronologisch zu ordnen, zudem fast in jeder die verschiedensten Elemente lebendig ineinander verwachsen sind, welche demnächst erst eine fortschreitende Untersuchung, die nicht einmal bei der Scheidung einzelner Sagen stehenbleiben darf, sondern selbst aus diesen wiederum Kleineres heraussuchen muß, in das wahre Licht setzen könnte. Letzterer Grund entscheidet endlich auch ganz gegen eine Anordnung nach dem Inhalt, indem man zum Beispiel alle Zwergsagen oder die von versunkenen Gegenden und so weiter unter eigene Abschnitte faßte. Offenbar würden bloß die wenigsten einen einzigen dieser Gegenstände befassen, da vielmehr in jeder mannigfaltige Verwandtschaften und Berührungen mit andern anschlagen. Daher uns bei weitem diejenige Anreihung der Sagen am natürlichsten und vorteilhaftesten geschienen hat, welche, überall mit nötiger Freiheit und ohne viel herumzusuchen, unvermerkt auf einige solcher geheim und seltsam waltenden Übergänge führt. Dieses ist auch der notwendig noch überall lückenhaften Beschaffenheit der Sammlung angemessen. Häufig wird man also in der folgenden eine deutliche oder leise Anspielung auf die vorhergehende Sage finden; äußerlich ähnliche stehen oft beisammen, oft hören sie auf, um bei verschiedenem Anlaß anderswo im Buch von neuem anzuheben. Unbedenklich hätten also noch viele andere Ordnungen derselben Erzählungen, die wir hier mitteilen, insofern man weitere Beziehungen berücksichtigen wollte, versucht werden können, alle aber würden doch nur geringe Beispiele der unerschöpflichen Triebe geben, nach denen sich Sage aus Sage und Zug aus Zug in dem Wachstum der Natur gestaltet.
5. Erklärende Anmerkungen
Einen Anhang von Anmerkungen, wie wir zu den beiden Bänden der Kinder- und Hausmärchen geliefert, haben wir dieses Mal völlig weggelassen, weil uns der Raum zu sehr beschränkt hätte und erst durch die äußere Beendigung unserer Sammlung eine Menge von Beziehungen bequem und erleichtert werden wird. Eine vollständige Abhandlung der deutschen Sagenpoesie, soviel sie in unsern Kräften steht, bleibt also einer eigenen Schrift vorbehalten, worin wir umfassende Übersichten des Ganzen nicht bloß in jenen dreien Einteilungen nach Ort, Zeit und Inhalt, sondern noch in anderen versuchen wollen.
6. Quellen der Sammlung
Diese Sammlung hatten wir nun schon vor etwa zehn Jahren angelegt (man sehe Zeitung für Einsiedler oder Trösteinsamkeit, Heidelberg 1808, Nr. 19 und 20), seitdem unablässig gesorgt, um für sie sowohl schriftliche Quellen in manchen allmählich selten werdenden Büchern des XVI. und XVII. Jahrhunderts fleißig zu nutzen und auszuziehen, als auch vor allen Dingen mündliche, lebendige Erzählungen zu erlangen. Unter den geschriebenen Quellen waren uns die Arbeiten des Johannes Prätorius weit die bedeutendsten. Er schrieb in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts und verband mit geschmackloser, aber scharfsichtiger Gelehrsamkeit Sinn für Sage und Aberglauben, der ihn antrieb, beide unmittelbar aus dem bürgerlichen Leben selbst zu schöpfen, und ohne welchen, was er gewiß nicht ahnte, seine zahlreichen Schriften der Nachwelt unwert und unfruchtbar scheinen würden. Ihm dankt sie zumal die Kenntnis und Beziehung mannigfacher Sagen, welche den Lauf der Saale entlang und an den Ufern der Elbe, bis wo sich jene in diese ausmündet, im Magdeburgischen und in der Altmark bei dem Volke gehn.
Den Prätorius haben Spätere, oft ohne ihn zu nennen, ausgeschrieben, selten durch eigene mündliche Zusammlung sich ein gleiches Verdienst zu erwerben gewußt. In den langen Zeitraum zwischen ihm und der Otmarischen Sammlung (1800) fällt kein einzig Buch von Belang für deutsche Sagen, abgesehen von bloßen Einzelheiten. Indessen hatten kurz davor Musäus und Frau Naubert in ihren Verarbeitungen einiger echten Grundsagen aus Schriften, sowie teilweise aus mündlicher Überlieferung, die Neigung darauf hingezogen, wenigstens hingewiesen. In Absicht auf Treue und Frische verdient Otmars Sammlung der Harzsagen so viel Lob, daß dieses den Tadel der hin und wieder aufgesetzten unnötigen Bräme und Stilverzierung zudeckt. Viele sind aber auch selbst den Worten nach untadelhaft, und man darf ihnen trauen. Seitdem hat sich die Sache zwar immer mehr geregt und ist auch zuweilen wirklich gefördert, im ganzen jedoch nichts Bedeutendes gesammelt worden, außer ganz neuerlich (1815) ein Dutzend Schweizer Sagen von Wyß. Ihr Herausgeber hat sie geschickt und gewandt in größere Gedichte versponnen; wir erkennen neben dem Talent, was er darin bewiesen, doch eine Trübung trefflicher einfacher Poesie, die keines Behelfs bedarf und welche wir unserm Sinn gemäß aus der Einkleidung wieder in die nackende Wahrheit einzulösen getrachtet haben, darin auch durch die zugefügt gewesenen Anmerkungen besonders erleichtert waren. Dieses, sowie daß wir aus der Otmarischen Sammlung etwa ebensoviel, oder einige mehr aufgenommen, war für unsern Zweck und den uns seinethalben vorschwebenden Grad von Vollständigkeit unentbehrlich; teils hatten wir manche noch aus andern Quellen zu vergleichen, zu berichtigen und in den einfachen Stil zurückzuführen. Es sind außerdem noch zwei andere neue Sammlungen deutscher Volkssagen anzuführen, von Büsching (1812) und Gottschalk (1814), deren die erste sich auch auf auswärtige Sagen, sodann einheimische Märchen, Legenden und Lieder, selbst Vermutungen über Sagen, wie Spangenbergs, mit erstreckt, also ein sehr ausgedehntes, unbestimmtes Feld hat. Beide zusammen verdanken mündlicher Quelle nicht über zwölf bisher ungekannte deutsche Sagen, welche wir indessen aufgenommen haben würden, wenn nicht jede dieser Sammlungen selbst noch im Gang wäre und eigene Fortsetzungen versprochen hätte. Wir haben ihnen also nichts davon angerührt, übrigens, wo wir dieselben schriftlichen Sagen längst schon aus denselben oder verschiedenen Quellen ausgeschrieben hatten, unsre Auszüge darum nicht hintanlegen wollen; denn nach aufrichtiger Überlegung fanden wir, daß wir umsichtiger und reiflicher gesammelt hatten. Beide geben auch vermischt mit den örtlichen Sagen die geschichtlichen, deren wir mehrere Hunderte für den nächsten Teil aufbehalten. Wir denken keine fremde Arbeit zu irren oder zu stören, sondern wünschen ihnen glücklichen Fortgang, der Gottschalkischen insbesondere mehr Kritik zur Ausscheidung des Verblümten und der Falschmünze. Die Dobeneckische Abhandlung endlich von dem Volksglauben des Mittelalters (1815) breitet sich teils über ganz Europa, teils schränkt sie sich wieder auf das sogenannt Abergläubische und sonst in anderer Absicht zu ihrem Schaden ein; man kann sagen: sie ist eine mehr sinnvolle als reife, durchgearbeitete Ansicht der Volkspoesie und eigentlich Sammlung bloß nebenbei, weshalb wir auch einige Auszüge aus Prätorius, wo wir zusammentrafen, nicht ausgelassen haben; sie wird inzwischen dem Studium dieser Dichtungen zur Erregung und Empfehlung gereichen. Ausdrücklich ist hier noch zu bemerken, daß wir vorsätzlich die vielfachen Sagen von Rübezahl, die sich füglich zu einer besonderen Sammlung eignen, sowie mehrere Rheinsagen auf die erhaltene Nachricht, Voigt wolle solche zu Frankfurt in diesem Jahr erscheinen lassen, zurücklegen.
7. Zweck und Wunsch
Erster Band
1.*
Die drei Bergleute im Kuttenberg
In Böhmen liegt der Kuttenberg, darin arbeiteten drei Bergleute lange Jahre und verdienten damit für Frau und Kind das Brot ehrlich. Wann sie morgens in den Berg gingen, so nahmen sie dreierlei mit: erstens ihr Gebetbuch, zweitens ihr Licht, aber nur auf einen Tag mit Öl versehen, drittens ihr bißchen Brot, das reichte auch nur auf einen Tag. Ehe sie die Arbeit anhuben, taten sie ihr Gebet zu Gott, daß er sie in dem Berge bewahren möchte, und darnach fingen sie getrost und fleißig an zu arbeiten. Es trug sich zu, als sie einen Tag gearbeitet hatten und es bald Abend war, daß der Berg vornen einfiel und der Eingang verschüttet wurde. Da meinten sie begraben zu sein und sprachen: »Ach Gott! Wir armen Bergleute, wir müssen nun Hungers sterben! Wir haben nur einen Tag Brot zu essen und einen Tag Öl auf dem Licht!« Nun befahlen sie sich Gott und dachten bald zu sterben, doch wollten sie nicht müßig sein, solange sie noch Kräfte hätten, arbeiteten fort und fort und beteten. Also geschah es, daß ihr Licht sieben Jahr brannte, und ihr kleines bißchen Brot, von dem sie tagtäglich aßen, ward auch nicht all, sondern blieb ebenso groß, und sie meinten, die sieben Jahre wären nur ein Tag. Doch da sie sich nicht ihr Haar schneiden und den Bart abnehmen konnten, waren diese ellenlang gewachsen. Die Weiber hielten unterdessen ihre Männer für tot, meinten, sie würden sie nimmermehr wiedersehen, und dachten daran, andere zu heiraten.
Nun geschah es, daß einer von den dreien unter der Erde so recht aus Herzensgrund wünschte: »Ach! Könnt ich noch einmal das Tageslicht sehen, so wollt ich gerne sterben!« Der zweite sprach: »Ach! Könnt ich noch einmal daheim bei meiner Frau zu Tische sitzen und essen, so wollt ich gerne sterben!« Da sprach auch der dritte: »Ach! Könnt ich nur noch ein Jahr friedlich und vergnügt mit meiner Frau leben, so wollt ich gerne sterben!« Wie sie das gesprochen hatten, so krachte der Berg gewaltig und übermächtig und sprang voneinander, da ging der erste hin zu dem Ritz und schaute hinauf und sah den blauen Himmel, und wie er sich am Tageslicht gefreut, sank er augenblicklich tot nieder. Der Berg aber tat sich immer mehr voneinander, also daß der Riß größer ward, da arbeiteten die beiden andern fort, hackten sich Treppen, krochen hinauf und kamen endlich heraus. Sie gingen nun fort in ihr Dorf und in ihre Häuser und suchten ihre Weiber, aber die wollten sie nicht mehr kennen. Sie sprachen: »Habt ihr denn keine Männer gehabt?« – »Ja«, antworteten jene, »aber die sind schon sieben Jahre tot und liegen im Kuttenberg begraben!« Der zweite sprach zu seiner Frau: »Ich bin dein Mann«, aber sie wollt es nicht glauben, weil er den ellenlangen Bart hatte und ganz unkenntlich war. Da sagte er: »Hol mir das Bartmesser, das oben in dem Wandschrank liegen wird, und ein Stückchen Seife dazu.« Nun nahm er sich den Bart ab, kämmte und wusch sich, und als er fertig war, sah sie, daß es ihr Mann war. Sie freute sich herzlich, holte Essen und Trinken, so gut sie es hatte, deckte den Tisch, und sie setzten sich zusammen hin und aßen vergnügt miteinander. Wie aber der Mann satt war und den letzten Bissen Brot gegessen hatte, da fiel er um und war tot. Der dritte Bergmann wohnte ein ganzes Jahr in Stille und Frieden mit seiner Frau zusammen; als es herum war, zu derselben Stunde aber, wo er aus dem Berg gekommen war, fiel er und seine Frau mit ihm tot hin. Also hatte Gott ihre Wünsche ihrer Frömmigkeit wegen erfüllt.
2.*
Der Berggeist
Der Berggeist, Meister Hämmerling, gemeiniglich Bergmönch genannt, zeigt sich zuweilen in der Tiefe, gewöhnlich als Riese in einer schwarzen Mönchskutte. In einem Bergwerk der Graubündner Alpen erschien er oft und war besonders am Freitage geschäftig, das ausgegrabene Erz aus einem Eimer in den andern zu schütten; der Eigentümer des Bergwerks durfte sich das nicht verdrießen lassen, wurde aber auch niemals von ihm beleidigt. Dagegen als einmal ein Arbeiter, zornig über dies vergebliche Hantieren, den Geist schalt und verfluchte, faßte ihn dieser mit so großer Gewalt, daß er zwar nicht starb, aber das Antlitz sich ihm umkehrte. Im Annaberg, in der Höhle, welche der Rosenkranz heißt, hat er zwölf Bergleute während der Arbeit angehaucht, wovon sie tot liegengeblieben sind, und die Grube ist, obgleich silberreich, nicht ferner angebaut worden. Hier hat er sich in Gestalt eines Rosses mit langem Hals gezeigt, furchtbar blickende Augen auf der Stirne. Zu Schneeberg ist er aber als ein schwarzer Mönch in der St.-Georgen-Grube erschienen und hat einen Bergknappen ergriffen, von der Erde aufgehoben und oben in die Grube, die vorzeiten gar silberreich war, so hart niedergesetzt, daß ihm seine Glieder verletzt waren. Am Harz hat er einmal einen bösen Steiger, der die Bergleute quälte, bestraft. Denn als dieser zu Tage fuhr, stellte er sich, ihm unsichtbar, über die Grube, und als er emporkam, drückte ihm der Geist mit den Knien den Kopf zusammen.
3.*
Der Bergmönch im Harz
Zwei Bergleute arbeiteten immer gemeinschaftlich. Einmal, als sie anfuhren und vor Ort kamen, sahen sie an ihrem Geleucht, daß sie nicht genug Öl zu einer Schicht auf den Lampen hatten. »Was fangen wir da an?« sprachen sie miteinander, »geht uns das Öl aus, so daß wir im Dunkeln sollen zu Tag fahren, sind wir gewiß unglücklich, da der Schacht schon gefährlich ist. Fahren wir aber jetzt gleich aus, um von Haus Öl zu holen, so straft uns der Steiger, und das mit Lust, denn er ist uns nicht gut.« Wie sie also besorgt standen, sahen sie ganz fern in der Strecke ein Licht, das ihnen entgegenkam. Anfangs freuten sie sich, als es aber näher kam, erschraken sie gewaltig, denn ein ungeheurer, riesengroßer Mann ging, ganz gebückt, in der Strecke herauf. Er hatte eine große Kappe auf dem Kopf und war auch sonst wie ein Mönch angetan, in der Hand aber trug er ein mächtiges Grubenlicht. Als er bis zu den beiden, die in Angst da stillstanden, geschritten war, richtete er sich auf und sprach: »Fürchtet euch nicht, ich will euch kein Leids antun, vielmehr Gutes«, nahm ihr Geleucht und schüttete Öl von seiner Lampe darauf. Dann aber griff er ihr Gezäh und arbeitete ihnen in einer Stunde mehr, als sie selbst in der ganzen Woche bei allem Fleiß herausgearbeitet hätten. Nun sprach er: »Sagt's keinem Menschen je, daß ihr mich gesehen habt«, und schlug zuletzt mit der Faust links an die Seitenwand; sie tat sich auseinander, und die Bergleute erblickten eine lange Strecke, ganz von Gold und Silber schimmernd. Und weil der unerwartete Glanz ihre Augen blendete, so wendeten sie sich ab, als sie aber wieder hinschauten, war alles verschwunden. Hätten sie ihre Bilhacke (Hacke mit einem Beil) oder sonst nur einen Teil ihres Gezähs hineingeworfen, wäre die Strecke offengeblieben und ihnen viel Reichtum und Ehre zugekommen; aber so war es vorbei, wie sie die Augen davon abgewendet.
Doch blieb ihnen auf ihrem Geleucht das Öl des Berggeistes, das nicht abnahm und darum noch immer ein großer Vorteil war. Aber nach Jahren, als sie einmal am Sonnabend mit ihren guten Freunden im Wirtshaus zechten und sich lustig machten, erzählten sie die ganze Geschichte, und montags morgen, als sie anfuhren, war kein Öl mehr auf der Lampe, und sie mußten nun jedesmal wieder, wie die andern, frisch aufschütten.
4.*
Frau Hollen Teich
Auf dem hessischen Gebirg Meißner weisen mancherlei Dinge schon mit ihren bloßen Namen das Altertum aus, wie die Teufelslöcher, der Schlachtrasen und sonderlich der Frau Hollen Teich. Dieser, an der Ecke einer Moorwiese gelegen, hat gegenwärtig nur vierzig bis fünfzig Fuß Durchmesser; die ganze Wiese ist mit einem halb untergegangenen Steindamm eingefaßt, und nicht selten sind auf ihr Pferde versunken.
Von dieser Holle erzählt das Volk vielerlei, Gutes und Böses. Weiber, die zu ihr in den Brunnen steigen, macht sie gesund und fruchtbar; die neugeborenen Kinder stammen aus ihrem Brunnen, und sie trägt sie daraus hervor. Blumen, Obst, Kuchen, das sie unten im Teiche hat und was in ihrem unvergleichlichen Garten wächst, teilt sie denen aus, die ihr begegnen und zu gefallen wissen. Sie ist sehr ordentlich und hält auf guten Haushalt; wann es bei den Menschen schneit, klopft sie ihre Betten aus, davon die Flocken in der Luft fliegen. Faule Spinnerinnen straft sie, indem sie ihnen den Rocken besudelt, das Garn wirrt oder den Flachs anzündet; Jungfrauen hingegen, die fleißig abspinnen, schenkt sie Spindeln und spinnt selber für sie über Nacht, daß die Spulen des Morgens voll sind. Faulenzerinnen zieht sie die Bettdecken ab und legt sie nackend aufs Steinpflaster; Fleißige, die schon frühmorgens Wasser zur Küche tragen in reingescheuerten Eimern, finden Silbergroschen darin. Gern zieht sie Kinder in ihren Teich, die guten macht sie zu Glückskindern, die bösen zu Wechselbälgen. Jährlich geht sie im Land um und verleiht den Äckern Fruchtbarkeit, aber auch erschreckt sie die Leute, wenn sie durch den Wald fährt, an der Spitze des wütenden Heers. Bald zeigt sie sich als eine schöne weiße Frau in oder auf der Mitte des Teiches, bald ist sie unsichtbar, und man hört bloß aus der Tiefe ein Glockengeläut und finsteres Rauschen.
5.*
Frau Holla zieht umher
In der Weihnacht fängt Frau Holla an herumzuziehen, da legen die Mägde ihren Spinnrocken aufs neue an, winden viel Werg oder Flachs darum und lassen ihn über Nacht stehen. Sieht das nun Frau Holla, so freut sie sich und sagt:
»So manches Haar,
so manches gutes Jahr.«
Diesen Umgang hält sie bis zum großen Neujahr, das heißt den heiligen Dreikönigstag, wo sie wieder umkehren muß nach ihrem Horselberg; trifft sie dann unterwegens Flachs auf dem Rocken, zürnt sie und spricht:
»So manches Haar,
so manches böses Jahr.«
Daher reißen feierabends vorher alle Mägde sorgfältig von ihren Rocken ab, was sie nicht abgesponnen haben, damit nichts dran bleibe und ihnen übel ausschlage. Noch besser ist's aber, wenn es ihnen gelingt, alles angelegte Werg vorher im Abspinnen herunterzubringen.
6.*
Frau Hollen Bad
Am Meißner in Hessen liegt ein großer Pfuhl oder See, mehrenteils trüb von Wasser, den man Frau Hollen Bad nennt. Nach alter Leute Erzählung wird Frau Holle zuweilen badend um die Mittagsstunde darin gesehen und verschwindet nachher. Berg und Moore in der ganzen Umgegend sind voll von Geistern und Reisende oder Jäger oft von ihnen verführt oder beschädiget worden.
7.*
Frau Holla und der treue Eckart
In Thüringen liegt ein Dorf namens Schwarza, da zog Weihnachten Frau Holla vorüber, und vorn im Haufen ging der treue Eckart und warnte die begegneten Leute, aus dem Wege zu weichen, daß ihnen kein Leid widerfahre. Ein paar Bauernknaben hatten gerade Bier in der Schenke geholt, das sie nach Haus tragen wollten, als der Zug erschien, dem sie zusahen. Die Gespenster nahmen aber die ganze breite Straße ein, da wichen die Dorfjungen mit ihren Kannen abseits in eine Ecke; bald nahten sich unterschiedene Weiber aus der Rotte, nahmen die Kannen und tranken. Die Knaben schwiegen aus Furcht stille, wußten doch nicht, wie sie ihnen zu Haus tun sollten, wenn sie mit leeren Krügen kommen würden. Endlich trat der treue Eckart herbei und sagte: »Das riet euch Gott, daß ihr kein Wörtchen gesprochen habt, sonst wären euch eure Hälse umgedreht worden; gehet nun flugs heim und sagt keinem Menschen etwas von der Geschichte, so werden eure Kannen immer voll Bier sein und wird ihnen nie gebrechen.« Dieses taten die Knaben, und es war so, die Kannen wurden niemals leer, und drei Tage nahmen sie das Wort in acht. Endlich aber konnten sie's nicht länger bergen, sondern erzählten ihren Eltern von der Sache, da war es aus, und die Krüglein versiegten. Andere sagten, es sei dies nicht eben zu Weihnacht geschehen, sondern auf eine andere Zeit.
8.*
Frau Holla und der Bauer
Frau Holla zog einmal aus, begegnete ihr ein Bauer mit der Axt. Da redete sie ihn mit den Worten an, daß er ihr den Wagen verkeilen oder verschlagen sollte. Der Taglöhner tat, wie sie ihm hieß, und als die Arbeit verrichtet war, sprach sie: »Raff die Späne auf und nimm sie zum Trinkgeld mit;« drauf fuhr sie ihres Weges. Dem Manne kamen die Späne vergeblich und unnütz vor, darum ließ er sie meistenteils liegen, bloß ein Stück oder drei nahm er für die Langeweile mit. Wie er nach Hause kam und in den Sack griff, waren die Späne eitel Gold. Alsbald kehrte er um, noch die andern zu holen, die er liegengelassen; sosehr er suchte, so war es doch zu spät und nichts mehr vorhanden.
9.*