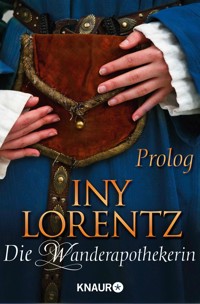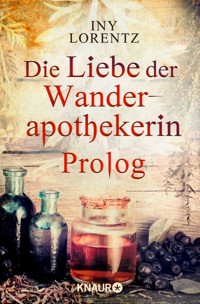9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Preussen-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der historische Roman »Dezembersturm« ist die spannende Geschichte einer gescheiterten Schiffreise, eine bewegende Familiensaga und nicht zuletzt ein erwärmender Liebesroman. Die dreiteilige historische Familiensaga des Bestseller-Duos Iny Lorentz, aus dessen Feder bekannte Historienromane wie "Die Wanderhure" stammt, beginnt mit der turbulenten Reise einer jungen mutigen Frau von Ostpreußen in die Neue Welt. Ostpreußen 1875: Die junge Lore lebt nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrem Großvater Nikolaus von Trettin in Ostpreußen. Lore hält diesen für verarmt und ahnt nicht, dass er sein Geld beiseite geschafft hat, um es ihr nach seinem Tod zu vererben – sehr zum Ärger seines Neffen, der nur einen Gedanken hat: Er muss die Rivalin aus dem Weg schaffen. Um Lore zu retten, schmiedet der Großvater einen tollkühnen Plan: Lore soll nach Amerika auswandern und so ihrem geldgierigen Verwandten entkommen. Doch auf ihrer Reise von Ostpreußen in die Neue Welt lauern viele Gefahren auf die junge Frau – ungewohnte Herausforderungen, die plötzliche Verantwortung für ein kleines Waisenmädchen und vor allem Menschen, die es nicht gut mit ihr meinen. Lore lernt, in der Fremde zu überleben, verliert unterwegs ihr Hab und Gut und erleidet mehr als ein Mal "Schiffbruch", aber auch die erste große Liebe wartet in der Ferne auf die junge Frau aus Ostpreußen.... Dezembersturm ist große Familiensaga, einfühlsamer Liebesroman und spannender Historienroman in einem – ein Muss für alle Fans guter Unterhaltung! »Erfrischende Abwechslung im gewohnten Lorentz-Stil.« Bild und Funk »Das Ehepaar Lorentz hat wieder einmal gründlich recherchiert und lässt die Kaiserzeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts farbenprächtig auferstehen.« Radio ZuSa Alle drei Bände der bewegenden historischen Familiensaga aus Ostpreußen: - Band 1: Dezembersturm - Band 2: Aprilgewitter - Band 3: Juliregen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Iny Lorentz
Dezembersturm
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue Bestseller von der Autorin der »Wanderhure«!
Ostpreußen 1875: Die junge Lore lebt nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrem Großvater Nikolaus von Trettin. Lore hält diesen für verarmt und ahnt nicht, dass er sein Geld beiseitegeschafft hat, um es ihr nach seinem Tod zu vererben – sehr zum Ärger seines Neffen, der nur einen Gedanken hat: Er muss die Rivalin aus dem Weg schaffen. Um sie zu retten, schmiedet Nikolaus einen tollkühnen Plan: Lore soll nach Amerika auswandern und so ihrem geldgierigen Verwandten entkommen. Doch auf ihrer Reise in die Neue Welt lauern viele Gefahren auf das junge Mädchen …
Exklusiv im Taschenbuch!
Inhaltsübersicht
Erster Teil◆Das Unglück
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Zweiter Teil◆Die Flucht
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Xii.
XIII.
XIV.
XV.
Dritter Teil◆Tod in der Themsemündung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Vierter Teil◆Die Entführung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Fünfter Teil◆In London
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Sechster Teil◆Ruppert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Siebter Teil◆Bremen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Achter Teil◆Wieder zu Hause
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Nachwort
Die Personen
Erster Teil◆Das Unglück
I.
Die Finger ihres Großvaters bohrten sich in Lores Schulter.
Sie stöhnte vor Schmerz auf, hob den Kopf und sah sein bleiches, zornverzerrtes Gesicht über sich. Erschrocken fragte sie sich, womit sie den alten Herrn so sehr verärgert haben mochte. Dann erst bemerkte sie, dass er angestrengt durch das Fenster blickte. Dort teilte ein schnurgerader, scheinbar endlos langer Karrenweg den vom Licht der tiefstehenden Abendsonne beschienenen Forst. In einer halben Stunde würde die Dämmerung den Wald in Schatten tauchen, aber noch war es hell genug, um die stattliche Kutsche des Freiherrn von Trettin auf Trettin zu erkennen, die sich, von vier Pferden gezogen, dem alten Jagdhaus näherte.
Der alte Herr ließ Lores Schulter ebenso überraschend los, wie er sie gepackt hatte, drehte sich um und eilte in sein Zimmer. Beklommen folgte sie ihm und sah, wie er den Gewehrschrank öffnete, eine Doppelflinte herausnahm und sie mit zitternden Händen lud.
»Großvater, tu’s bitte nicht!«, flehte sie und vergaß in ihrer Angst ganz, dass sie ihn mit »Euch« hätte anreden müssen. Zu jeder anderen Zeit wäre sie scharf gerügt worden, doch nun starrte der alte Herr auf die Waffe und stellte sie mit einer bedauernden Geste zurück in den Schrank.
»Du hast recht, Lore! Eine Ratte erschlägt man, aber man vergeudet keine Patrone an sie.« Er kehrte zum Fenster zurück und blickte der näher kommenden Kutsche entgegen. Dabei erschien eine scharfe Kerbe über seiner Nase, und er stieß eine leise Verwünschung aus. »Der Kerl will sich wohl mit eigenen Augen überzeugen, ob ich bereits ganz am Boden liege. Aber diesem ehrlosen Lumpen werde ich heimleuchten!«
Wolfhard Nikolaus von Trettin legte sich bereits die Worte zurecht, die er seinem Neffen an den Kopf werfen wollte, als sein Blick auf Lore fiel. »Ich glaube, es ist besser, du gehst nach Hause. Ottokars Konversation war noch nie amüsant und ist auch nicht für Kinderohren geeignet.«
Lore wollte den alten Herrn schon daran erinnern, dass sie vor vier Wochen ihren fünfzehnten Geburtstag gefeiert hatte und in diesem Alter sich andere Mädchen bereits ihr eigenes Brot verdienen mussten, doch nach einem Blick in sein versteinert wirkendes Gesicht besann sie sich eines Besseren und versuchte ihn auf einem anderen Weg umzustimmen.
»Es ist schon spät, Herr Großvater, und ich werde nicht vor Einbruch der Nacht zu Hause ankommen.«
Der alte Herr schnaubte verärgert. »Hat Elsie dir wieder Schauergeschichten erzählt und dir Angst vor Waldgeistern gemacht? Aber die gibt es nur in der Phantasie dieser dummen Pute.«
»Nein, Herr Großvater«, versicherte Lore. »Das ist es gewiss nicht!«
Ungeduldig versetzte er ihr einen leichten Stoß. »Mach jetzt, dass du verschwindest! Ottokars Kutsche hält bereits vor der Tür, und ich will nicht, dass er dich hier sieht.«
Lore meinte zwar, sie könne sich ebenso gut auf dem Dachboden oder im Keller verstecken, damit der neue Freiherr auf Trettin sie nicht bemerkte, doch kannte sie ihren Großvater gut genug, um ihm nicht zu widersprechen. Daher knickste sie und verschwand im selben Moment durch die Hintertür, in dem der Besucher von vorne ins Haus kam und breitbeinig in das Zimmer ihres Großvaters trat.
Ottokar Freiherr von Trettin hatte keine Ähnlichkeit mit seinem hochgewachsenen, trotz seines Alters noch stattlichen Onkel. Das, was ihm an Körpergröße fehlte, machte er an Umfang wett und wirkte daher fast so breit wie hoch. Sein rundes Gesicht war von gesunder Farbe, die kleinen Augen standen eng zusammen, und die Nase glich einer Kartoffel. Seine schwindende braune Haartracht wurde von einem Zylinder aus geschorenem Biberpelz bedeckt, und auch die anderen körperlichen Mängel suchte er durch übertrieben elegante Kleidung wettzumachen: Sein Rock und seine Hose stammten gewiss aus einem hochmodischen Schneidersalon. So ausstaffiert wirkte er neben seinem in einen schlichten Lodenanzug gekleideten Onkel wie ein gutgemästeter Pfau.
Auf dem hageren Gesicht des alten Herrn wechselten Ekel, Hass und Zorn in rascher Folge, doch das schien den Besucher wenig zu stören.
Ottokar von Trettin trat auf den Hausherrn zu und hielt ihm den vergoldeten Knauf seines Gehstocks unter die Nase, als wollte er ihm Schläge androhen. »Ich habe mit dir zu reden, Oheim!«
Obwohl er gedämpft sprach, verriet seine Stimme, dass nicht nur Lores Großvater seine Wut im Zaum halten musste.
»Was willst du denn noch von mir? Du hast mir mit Hilfe deiner guten Freunde bereits alles außer dieser erbärmlichen Hütte hier weggenommen. Oder sind die Kerle zur Einsicht gekommen und haben dir Gut Trettin wieder abgesprochen?«
»Das Gut gehört mir! Es war mein Recht, es dir abzufordern. Die Hausgesetze schreiben vor, dass Grundbesitz und Vermögen der Familie ungeschmälert als Majorat weitergegeben werden müssen. Statt dich danach zu richten, hast du alles verlottern lassen und damit mich, deinen Erben, um das bringen wollen, was mir von Rechts wegen zustand!« Ottokar von Trettins Stimme überschlug sich vor Erregung.
Zwar hatte er seinen Onkel vor zwei Monaten durch einen Gerichtsbeschluss von Gut Trettin vertrieben und den Besitz selbst übernommen, doch für ihn galt es noch einige Dinge zu klären.
Das Gesicht des alten Herrn verdüsterte sich, und er trat einen Schritt auf den Gewehrschrank zu, in dem die geladene Flinte steckte. Doch dann ließ er die ausgestreckte Hand wieder sinken. Ottokars Tod konnte an der Situation nichts mehr ändern. Nach dessen Ableben würde das Gut Trettin nicht an ihn zurückfallen, sondern an dessen Frau und die ungezogenen Bengel übergehen. Außerdem wollte er seinen Namen nicht durch den Skandal beschmutzen, von der Polizei verhaftet und nach Königsberg oder gar nach Berlin geschleppt zu werden.
Da sein Onkel nicht antwortete, stieß Ottokar von Trettin seinen Stock auf den Boden. »Ich habe inzwischen die Bücher durchgesehen und entdeckt, dass deine Ausgaben in einem eklatanten Missverhältnis zu den eingetragenen Einnahmen stehen. Zudem ist das Gut massiv mit Hypotheken belastet. Es war tatsächlich höchste Zeit, dir die Verfügungsgewalt zu nehmen.«
»Gestohlen hast du es mir! Es war mein Eigentum und hätte es bis zu meinem Tod bleiben müssen«, brüllte Wolfhard von Trettin und gab sich keine Mühe, seine Abscheu gegen diese vollgefressene Kröte zu verbergen, die er den Majoratsregeln zufolge als seinen Erben ertragen musste.
Ottokar ballte die freie Hand zu Faust. »Ich glaube, du hast mich nicht verstanden, Onkel. Ich will wissen, wo das Geld hingekommen ist, das du eingenommen hast. Wenn Trettin richtig geführt wird, ist es eine Goldgrube!«
Der alte Freiherr machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich war nie ein Bauer, der die Ähren auf seinem Feld zählt, so wie du es anscheinend machst, und da mir ein Sohn versagt geblieben ist, hatte ich keinen Grund, jeden Taler herumzudrehen.«
Ottokar knirschte mit den Zähnen. »Du hast das Geld für deine Tochter und ihren lumpigen Ehemann beiseitegeschafft. Gib es doch zu! Doch es gehört zum Gut, und ich werde es mir zurückholen!«
»Viel Glück«, spottete der Alte. »Aber du darfst es mir schon glauben: Ich habe stets auf großem Fuß gelebt und mir keinen Genuss versagt.«
Das konnte Ottokar nicht abstreiten. Der exzentrische Lebenswandel seines Onkels war seit Jahren in aller Munde, und nicht wenige der heimischen Honoratioren hatten ihre Erleichterung geäußert, dass die Lotterwirtschaft auf Trettin endlich ein Ende nehmen würde. Aber trotz aller Kapriolen des alten Herrn hätte nach seinem Dafürhalten deutlich mehr Geld auf den Konten des Gutes vorhanden sein müssen.
»Wenn das fehlende Geld nicht innerhalb dieses Monats an das Gut zurückfließt, werde ich dich verklagen, Onkel. Deine Tochter und ihre Bälger haben kein Anrecht darauf.«
»Du hast es doch nur auf das Jagdhaus und das Stückchen Wald abgesehen, das ich noch besitze! Aber selbst mit Hilfe deiner guten Freunde vom Gericht wird es dir nicht gelingen, es mir abzunehmen. Diesen Besitz hat mir mein Schwiegervater vererbt, also zählt er nicht zum Majorat.«
Obwohl er einen Stock in der Hand hielt, wich Ottokar von Trettin zurück, aus Angst, sein Onkel könne handgreiflich werden. Als dieser sich jedoch nicht rührte, schob er angriffslustig das Kinn nach vorne. »Du missverstehst mich absichtlich. Ich sprach nicht von dieser halbverfallenen Hütte und den paar Morgen Wald, die sich, mit Verlaub, in einem entsetzlichen Zustand befinden. Mir geht es um das Geld, das du heimlich beiseitegeschafft hast, um es deiner Tochter zuzustecken. Sie wird keinen Taler davon bekommen, das schwöre ich!«
»Du bist ein Narr, Ottokar, genauso wie dein Vater einer war. Um Geld zur Seite legen zu können, habe ich viel zu flott gelebt.« Wolfhard von Trettin war ruhig geworden und lachte seinem Neffen nun ins Gesicht. Dieser mahlte mit den Kiefern wie eine wiederkäuende Kuh und stieß dann einen gotteslästerlichen Fluch aus.
»Dann sehen wir uns vor Gericht wieder! Beklage dich aber nicht, wenn dir der Richter auch noch das letzte Hemd nimmt. Schließlich hätte deine Tochter es auch anders haben können. Doch sie musste ja diesen lächerlichen Lehrer mir vorziehen. Der Kerl ist ein Hungerleider, der niemals auf einen grünen Zweig kommen wird!«
Sein Onkel erinnerte sich mit Grausen an die Zeit, in der Ottokar seine Leonore in einer Weise bedrängt hatte, dass er mehrmals hatte eingreifen müssen. Bis heute wusste er nicht, ob seine Tochter den Dorfschullehrer Claus Huppach wirklich geliebt oder sich ihm nur deswegen zugewandt hatte, um vor weiteren Nachstellungen ihres Vetters sicher zu sein. Leonore hatte sich dieses gutmütige Schaf von einem Mann ausgesucht und ihm weisgemacht, ihr ganzes Lebensglück hinge von dieser Verbindung ab. Da zu Wolfhards Verwunderung außer Ottokar kein Freier aus seinen Kreisen an ihn herangetreten war, hatte er schweren Herzens seine Zustimmung zu dieser Heirat gegeben.
Inzwischen hatte er sich mit seinem Schwiegersohn abgefunden und freute sich an der munteren Rasselbande, die im Lehrerhaus aufwuchs, auch wenn die Kinder in seiner Gegenwart so still wie Mäuschen wurden. Da von vorneherein klar gewesen war, dass Gut Trettin als Majorat an seinen widerwärtigen Neffen gehen würde, hatte er getan, was noch möglich gewesen war, um Leonore und seinen Enkelkindern auch nach seinem Tod ein gutes Leben zu bieten. Davon würde er sich auch durch Ottokars Drohungen nicht abhalten lassen.
Daher sah er mit einem spöttischen Lächeln auf seinen Neffen hinab. »Tu, was du nicht lassen kannst. Allerdings bezweifle ich, dass du Erfolg haben wirst.«
Ottokar stieß wütend die Luft aus der Lunge. »Ich weiß, dass du Geld hast! Immerhin hast du im letzten Jahr zweitausend Taler zum Fenster hinausgeworfen, um Fridolin vor dem Schuldgefängnis zu bewahren.«
»Es war das letzte Bargeld, über das ich verfügen konnte, und ich habe es lieber für Fridolin ausgegeben, als es irgendwann einmal dir zu überlassen.«
Der Spott in Wolfhard von Trettins Stimme ließ Ottokars Gesicht hochrot anlaufen. Er wollte dem Alten seine Wut ins Gesicht schreien, kannte seinen Onkel aber gut genug, um zu wissen, dass dieser nur darauf lauerte, ihm weitere boshafte Antworten zu geben. Daher bezähmte er sich, holte ein paarmal tief Luft und versuchte, dem Alten ruhig ins Gewissen zu reden.
»Du hättest die Scheine besser ins Feuer gesteckt, als sie für Fridolin zu vergeuden. Der Kerl ist bis ins Mark verderbt! Trotz seiner Jugend spielt er, säuft und treibt sich mit zweifelhaften Frauenzimmern herum. Er ist eine Schande für unsere Familie, und jeder Taler, den du für ihn ausgegeben hast, müsste dir in der Seele weh tun.«
»Ha! Ich habe in meiner Jugend ebenfalls gespielt, gesoffen und mich mit Weibern herumgetrieben. Und ich bereue das bis heute nicht.« Bei diesen Worten lachte Wolfhard von Trettin seinem Neffen ins Gesicht.
Ottokar wurde klar, dass er weder mit guten Worten noch mit Drohungen etwas erreichen konnte, und so schüttelte er wutschäumend seinen Stock gegen den alten Mann. »Du wirst noch von mir hören!«, brüllte er und verließ ohne ein Wort des Abschieds das Haus.
Wolfhard von Trettin schloss die Tür hinter ihm und sagte sich, dass es wirklich klüger gewesen war, Lore nach Hause zu schicken. Das Mädchen hätte sich wegen des Streites geängstigt und ihren Eltern davon erzählt. Doch es gab Dinge, die auch seine Tochter nicht zu wissen brauchte.
II.
Ottokar von Trettin bestieg schwungvoll seine Kutsche, ließ sich in die Polster fallen und klopfte mit dem Stock gegen das Dach. »Fahr los, Florin, und spare nicht mit der Peitsche. Ich will bald zu Hause sein.«
Während der Kutscher die Pferde antrieb und der Wagen Geschwindigkeit aufnahm, ließ Ottokar das Gespräch mit seinem Onkel Revue passieren und erkannte zu seinem Ärger, dass er gegen den alten Herrn erneut den Kürzeren gezogen hatte.
»Der soll mich kennenlernen! Vor Gericht werde ich ihm zeigen, wer hier das Sagen hat«, schwor er sich und drohte mit der Faust in die Richtung, in der das alte Jagdhaus stand.
Doch es war bereits außer Sicht, denn die Kutsche schoss, von den schnellen Pferden gezogen, über den von dichten Tannen gesäumten Forstweg, als sei dieser eine breite, gepflasterte Allee, und legte die halbe deutsche Meile bis zu der Straße nach Bladiau in kürzester Zeit zurück. Wenig später bog der Wagen bei dem Dorf Trettin zum gleichnamigen Gutshof ab. Inzwischen war es dunkel geworden, und der Kutscher wagte es nicht mehr, die Pferde zu sehr anzutreiben. Es mochten Äste oder andere Gegenstände auf der Straße liegen, über die ein Gaul stolpern und zu Schaden kommen konnte. Stieß den Tieren etwas zu, war er schuld, und es setzte ein Donnerwetter.
Kurz hinter dem Dorf kamen die schattenhaften Umrisse eines Hauses in Sicht. Ottokar starrte durch das offene Kutschenfenster auf das tief heruntergezogene Reetdach und knirschte mit den Zähnen. Es war das Lehrerhaus, in dem seine Base mit ihrer Familie lebte. Hinter den Fenstern war kein Funken Licht mehr zu erkennen. Die Bewohner waren wohl bereits zu Bett gegangen.
»Halt an!«, befahl Ottokar dem Kutscher, denn es würde ihm Genugtuung bereiten, Leonore Huppach und ihren vertrottelten Mann zu wecken und ihnen zu sagen, dass er seinen Onkel lieber im Gefängnis sehen wollte, als auf das ihm zustehende Vermögen zu verzichten. Vielleicht konnte er die beiden so einschüchtern, dass sie freiwillig bekannten, wo der Alte das unterschlagene Geld versteckt hielt. Wenn er sie ebenfalls vor Gericht zerrte und sie als Diebe verurteilen ließ, würden sie das Wohnrecht im Lehrerhaus verlieren und auf der Straße stehen, und das gebührte diesem Pack.
»Herr, die Kutsche steht«, meldete Florin missmutig, als sein Herr sich nicht rührte. Warum musste er ausgerechnet vor dem Lehrerhaus anhalten, in dem ohnehin keiner mehr wach war? In der Gutsküche wartete eine deftige Abendmahlzeit auf ihn, und die Pferde sehnten sich nach ihrer Futterkrippe im Stall.
Zu Florins Bedauern öffnete Ottokar von Trettin schließlich den Schlag und stieg aus. Er atmete ein paarmal tief durch, trat einige Schritte auf das reetgedeckte Haus zu und hob den Knauf seines Stockes, um gegen die Tür zu schlagen. Dabei überlegte er sich, was er sagen sollte, und zögerte. Würde er das Gesindel da drinnen zur Rede stellen, warnte er sie nur und gab ihnen die Möglichkeit, das Geld, das sein Onkel dem Gut entnommen hatte, verschwinden zu lassen. Nachdenklich schlenderte er bis zu dem kleinen Ziegenstall, der an das Wohnhaus angebaut war, und zog sein Zigarrenetui heraus. Während er sich eine Zigarre auswählte und sie anzündete, wuchs sein Ärger, weil an diesem Tag rein gar nichts so lief, wie er es gerne gesehen hätte.
Als das Schwefelhölzchen flatternd zu Boden fiel und erst nach ein paar Augenblicken erlosch, verzog Ottokar von Trettin seine Lippen zu einem zufriedenen Grinsen. Ganz ungestraft wollte er Leonore Huppach nicht davonkommen lassen. Daher ging er zum Heuschober hinüber, der nur wenige Schritte vom Wohnhaus entfernt stand, und öffnete die Tür. Der würzige Duft des Heus schlug ihm entgegen, und er erinnerte sich, seine Cousine im letzten Herbst bei der Mahd beobachtet zu haben. Diese hatte genug Heu eingelagert, so dass ihre Ziegen bei den in diesem Landstrich unvermeidlichen Kälteeinbrüchen nicht auf die Weide getrieben und dort von den Kindern gehütet werden mussten. Den Vorteil würde er seiner Cousine in diesem Jahr versalzen, sagte er sich und lachte hämisch. Er blies auf die Zigarre, bis sie hell aufglühte, und warf sie in den Heuschober.
Noch während er sich umdrehte, um zu seiner Kutsche zurückzukehren, entzündete sich das trockene Heu in einer Stichflamme, und Sekunden später brannte der Schober lichterloh. Ottokar von Trettin wurde von der Wucht des Feuers überrascht und bekam es plötzlich mit der Angst zu tun. So rasch, wie man es ihm bei seiner Körperfülle niemals zugetraut hätte, sprang er in die Kutsche und befahl dem Mann auf dem Bock, sofort weiterzufahren.
Florin gehorchte und ließ die Pferde antraben. Sein Herr steckte unterdessen den Kopf aus dem Kutschenfenster und starrte auf das Feuer, dessen Flammen jetzt schon höher schlugen als das Reetdach des Wohnhauses. Ein kühler Windstoß fegte über das Land und trieb die Funken des brennenden Heuschobers auf das Haus zu. Das Reetdach entzündete sich sofort, und die immer rascher hereinbrechenden Böen fachten das Feuer an, bis das ganze Haus einer hell lodernden Fackel glich.
Ein Teil seines Verstands sagte Ottokar von Trettin, dass er anhalten und seine Base wecken musste, damit sie und ihre Familie noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus kamen. Er klopfte gegen das Kutschendach, um den entsprechenden Befehl zu geben, hörte sich stattdessen aber rufen: »Peitsche die Pferde, Florin! Ich will so schnell wie möglich nach Hause.«
III.
Lore stolperte durch den Wald und schimpfte mit sich selbst, weil sie die Abkürzung genommen hatte anstatt den längeren, aber in der Dunkelheit besser zu bewältigenden Forstweg. Zweimal war sie nun schon über eine Wurzel gestolpert, die sie in der Dunkelheit nicht gesehen hatte, und nun hatte sie sich auch noch den Saum ihres Kleides aufgerissen. Dabei handelte es sich um eines ihrer beiden guten Kleider, die sie nur dann anzog, wenn sie zu ihrem Großvater ging.
Früher hatte sie den alten Herrn regelmäßig im Gutshaus besucht, und auch nachdem er in das kleine, ganz aus Holz gebaute und schon etwas schäbige Jagdhaus gezogen war, das ihm als einzige von all seinen Liegenschaften noch gehörte, hatte sie mit dieser Gewohnheit nicht gebrochen. Allerdings lag es mitten in einem ausgedehnten Waldgebiet, das fast bis an das Dorf Trettin reichte und nur zu einem kleinen Teil zum Gutsbesitz gehörte. Ihre feinen Kleider waren dort ein wenig fehl am Platz, doch ihr Großvater bestand darauf, dass sie sich wie eine Dame von Stand kleidete und auch so benahm. Nun tat es ihr leid um das beschädigte Kleid, und sie hoffte, es so nähen zu können, dass man den Schaden nicht sah.
Für einen Augenblick dachte sie an die Frau des früheren Pastors, bei der sie nähen und sticken gelernt hatte. Bedauerlicherweise war die alte Frau nach dem Tod ihres Mannes nach Königsberg zu Tochter und Schwiegersohn gezogen. Den Kontakt zur Familie des neuen Pastors hatte der Großvater ihr verboten, weil der Geistliche vor dem neuen Gutsherrn auf Trettin liebedienerisch den Nacken beugte.
Ein weiterer Fehltritt und ein stechender Schmerz im Knöchel rissen Lore aus ihrem Sinnieren, und sie humpelte weiter. Wenn sie nicht achtgab, verirrte sie sich noch in dem ausgedehnten Forst, der an manchen Stellen in Moor überging. Zudem gab es noch ganz andere, reale Gefahren für ein Mädchen ihres Alters. An die Waldgeister, mit denen das Dienstmädchen ihres Großvaters ihr Angst einjagen wollte, glaubte sie jedoch nicht.
Als Lore den Stumpf einer im letzten Sommer vom Blitz getroffenen Buche entdeckte, atmete sie erleichtert auf. Sie war noch auf dem richtigen Weg. Kurz darauf wurde das Kronendach lichter, und sie konnte wieder den Boden zu ihren Füßen erkennen. Sie beschleunigte ihre Schritte trotz des schmerzenden Knöchels, denn sie hoffte, zu Hause könne noch jemand wach sein. Wahrscheinlicher war es, dass ihre Eltern und Geschwister bereits im Bett lagen. Sie hatte mehrere Tage bei ihrem Großvater bleiben sollen, und daher wartete niemand auf sie. Wieder einmal ärgerte sie sich, dass sie als Älteste von vier Geschwistern keinen Schlüssel besaß, so würde ihr nichts anderes übrigbleiben, als ihre Eltern zu wecken. Doch wie sollte sie ihnen ihr nächtliches Erscheinen erklären?, fragte sie sich. Ottokars Besuch bei dem alten Herrn musste sie verschweigen, um ihre Angehörigen nicht aufzuregen, und sie wollte auch nicht den Anschein erwecken, ihr Großvater hätte sie im Zorn nach Hause geschickt.
Noch während sie darüber nachsann, entdeckte sie vor sich einen hellen Lichtschein über dem Horizont und vernahm laute, panikerfüllte Stimmen. Angst drohte ihr die Luft abzuschnüren, und sie begann zu rennen. Nach kurzer Zeit traf sie auf die Straße und sah ihr Elternhaus vor sich – hell auflodernd wie ein riesiger Scheiterhaufen.
Menschen liefen gestikulierend hin und her oder schleppten Eimer, die sie am nahe gelegenen Bach füllten, um den Brand zu löschen. Doch die Hitze der hoch aufzüngelnden Flammen war so groß, dass das meiste Wasser verdampfte, bevor es das Dach oder die Fenster erreichte.
Lore taumelte näher und hielt nach ihren Eltern und ihren Geschwistern Ausschau, sah aber nur Dorfnachbarn um sich, die zum Lehrerhaus geeilt waren und nicht weniger verzweifelt wirkten als sie.
Eine Frau entdeckte sie und kreischte auf, als sähe sie ein Gespenst vor sich. Dann aber blickte sie zum Wald hinüber, in dem, ein gutes Stück entfernt, das Jagdhaus des alten Trettin lag. »Du warst wohl wieder bei deinem Großvater.«
Das Mädchen nickte und deutete auf das Haus, dessen Dach nun in einer Wolke aufstiebender Funken einbrach. »Mama und Papa! Wo sind sie? Und wo …?« Das Gesicht der Frau aus dem Kolonialwarenladen verriet ihr genug.
Ein Mann kam auf sie zu, fasste sie um die Schultern und drückte sie an sich. Lore blickte auf und erkannte den alten Kord, den ehemaligen Vorarbeiter auf Gut Trettin, der von dem neuen Herrn wegen seiner Treue zu ihrem Großvater entlassen worden war. Die hoch auflodernden Flammen beleuchteten ein vor Entsetzen verzerrtes Gesicht.
»Bete zu Gott, mein Kind! Das ist das Einzige, was du noch tun kannst. Es ist keinem von deinen Angehörigen gelungen, das Haus zu verlassen.«
»Nein! Nein! O Gott! So grausam kannst du doch nicht sein!« Lore riss sich los und stolperte auf das brennende Gebäude zu.
Sofort packten einige Leute sie und zerrten sie zurück.
»Du kannst ihnen nicht mehr helfen, Kind!«, beschwor Kord sie.
»Danke Gott, denn er hat an dir ein Wunder getan, Lore!«, sagte die Ladenbesitzerin. »Zwar nahm er dir deine Eltern und Geschwister, aber er ließ dich am Leben.«
»Ich wollte, ich wäre tot!«, brach es aus Lore heraus.
Die alte Miene, deren Kate dem Lehrerhaus am nächsten lag, murmelte etwas vor sich hin. Zwar verstand Kord nur ein paar Wortfetzen, doch es riss ihn wie ein Peitschenschlag herum.
»Sag das noch einmal, Miene!«
»Die Tochter des alten Trettin und ihre Familie könnten noch leben. Als das Feuer aufloderte, habe ich zum Fenster hinausgeschaut und gesehen, wie der neue Gutsherr am Lehrerhaus vorbeigefahren ist. Er hätte nur anhalten und rufen müssen, dann wären sie gerettet worden. Ich bin zwar noch zum Lehrerhaus gelaufen und habe geschrien, so laut ich konnte, aber es war zu spät.«
»Das ist doch dummes Geschwätz! Behaupte so etwas nicht noch einmal, du alte Hexe!«, klang eine harte Stimme auf.
Die Leute drehten sich erschrocken um, sahen den Pastor auf die Brandstelle zukommen und wichen zurück. Niemand von ihnen mochte den Mann. Sein Vorgänger war von echtem Schrot und Korn gewesen und hatte mit den Menschen geredet, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Der neue Pfarrer hingegen sprach nur Schriftdeutsch und versuchte nicht einmal, auf den Dialekt der Landbevölkerung einzugehen. Außerdem war er gut Freund mit dem neuen Herrn auf Trettin, und der hatte sich in den zwei Monaten, in denen er das Gut besaß, wie Kaiser Wilhelm persönlich aufgeführt und sich bei fast allen von ihm abhängigen Bauern und Dienstboten verhasst gemacht.
Der Anblick niederbrechender Balken und der aufstiebenden Funken erinnerte den Pastor daran, dass es hier mehr zu tun gab, als den neuen Gutsherrn zu verteidigen.
»Was ist geschehen?«, fragte er Kord.
Der alte Mann wies mit der rechten Hand auf das Feuer. »Gebrannt hat es, und die Leute vom Lehrerhaus sind bis auf die Lore mausetot.«
Der Blick des Pastors wanderte über die Menschen, bis er auf dem Mädchen haftenblieb. Dann trat er auf sie zu und zitierte einen frommen Spruch. Die Worte rauschten an Lore vorbei, die wie zur Salzsäule erstarrt dastand, und die Umstehenden machten hinter dem Rücken des Pastors verächtliche Gesten. Zu sagen wagte jedoch niemand etwas, denn neben dem Gutsherrn war der Pastor der mächtigste Mann im Kirchspiel, und sie hatten bereits bitterlich erfahren, dass er unbedachte Aussprüche an Ottokar von Trettin weitertrug.
Auch die alte Miene zog jetzt den Kopf ein. Wenn der Pastor dem Gutsherrn steckte, was sie vorhin gesagt hatte, würde dieser sie aus ihrer Kate jagen lassen. Dann blieb ihr nur noch das Armenhaus, und in das ging keiner freiwillig.
Als die Dorfbewohner sahen, dass sie nichts mehr retten konnten, wandten sie den Resten des niedergebrannten Hauses den Rücken zu und schlurften zu ihren Hütten zurück. Kord blieb noch stehen, weil er nicht wusste, was mit Lore geschehen sollte. In diesem Zustand konnte das Mädchen unmöglich allein zum alten Jagdhaus laufen.
Der Pastor nahm ihm die Entscheidung ab, indem er Lore zu sich winkte. »Du bleibst diese Nacht bei mir, und morgen bringe ich dich dann zum Gutshof.«
Lore, der erst nach und nach bewusst wurde, was sie in dieser Nacht verloren hatte, nahm unter der Wucht der Verzweiflung und ihres Schmerzes, die sie innerlich auffraßen, kaum etwas von ihrer Umgebung wahr. Das Wort Gutshof aber drang in ihr Bewusstsein, und sie riss abwehrend die Hände hoch. »Dorthin gehe ich nicht! Mit dem neuen Herrn auf Trettin habe ich nichts zu tun.«
»Da hat das Mädchen recht, Herr Pastor«, stimmte Kord ihr zu. »Wenn es nach dem Tod der Eltern jemanden gibt, der sich um Lore kümmert, dann ist es ihr Großvater.«
Dagegen konnte auch der Pastor nichts einwenden. »Also gut, dann werde ich Lore morgen früh zum alten Herrn von Trettin bringen«, erklärte er, obwohl es ihn nicht gerade danach drängte, dem ehemaligen Gutsherrn zu begegnen. Dieser nahm im Gespräch mit ihm kein Blatt vor den Mund und warf ihm dieselben rüden Flüche an den Kopf wie einem Stallknecht.
Kord überlegte derweil, ob er seinen alten Herrn aufsuchen und ihm von dem Unglück berichten sollte. Doch schon nach wenigen Schritten blieb er stehen. Dieser Aufgabe fühlte er sich wahrlich nicht gewachsen, und er sagte sich, dass der Pastor als studierter Mann sicher bessere Worte finden würde als er.
IV.
Die Nacht verbrachte Lore in einem Gästezimmer des Pastorenhauses, doch sie hätte am nächsten Morgen nicht zu sagen vermocht, ob sie nun geschlafen hatte oder nicht. Von der Frau des Pastors hatte sie ein viel zu weites Nachthemd erhalten, das wie ein Sack an ihr herabhing und am Boden schleifte. Am Morgen brachte ihr das Dienstmädchen Waschwasser und ihr ausgebürstetes Kleid, dessen Riss mit ein paar groben Stichen zusammengeheftet worden war.
»Du solltest dich beeilen, denn der Herr Pastor will gleich mit dir zu deinem Großvater fahren. Das Frühstück steht bereits auf dem Tisch«, drängte die junge Frau.
Frühstück war etwas, das für Lore zu einem anderen Leben zu gehören schien. Ihr Magen lag wie ein harter Klumpen in ihrem Bauch, und sie verspürte weder Hunger noch Durst. Vor ihren Augen sah sie nur die Flammenhölle, die einst ihr Heim gewesen war, und sie fragte sich wieder und wieder, wieso es ihren Eltern und Geschwistern nicht gelungen war, vor dem Feuer ins Freie zu fliehen.
Dabei kam ihr der Ausspruch der alten Miene in den Sinn, der neue Herr auf Trettin hätte ihre Familie vor dem Schlimmsten bewahren können. Warum war er einfach vorbeigefahren? Das schien unbegreiflich. Auch wenn er mit ihrem Großvater verfeindet war, hätte die Menschlichkeit es doch verlangt, anzuhalten und die Bewohner vor dem Feuer zu warnen. Vielleicht, sagte sie sich, hatte Ottokar nach seinem Besuch bei ihrem Großvater vor Ärger nicht auf seine Umgebung geachtet und daher das brennende Haus übersehen. Doch so richtig mochte sie daran nicht glauben. Zumindest Florin auf dem Kutschbock hätte das Feuer bemerken und seinen Herrn darauf aufmerksam machen müssen. Also war ihr Verwandter absichtlich weitergefahren.
»Lore! Trödle nicht, sondern komm endlich zu Tisch«, hörte sie die Stimme der Pastorin ins Zimmer schallen, als sei sie kein Gast, sondern eine faule Magd.
Sie krümmte sich unter dem Tonfall wie unter einem Hieb, wusch sich mit dem kalten Wasser rasch Hände und Gesicht, flocht ihre aufgelösten Zöpfe neu und schlüpfte in ihr Kleid. Als sie wenig später das Speisezimmer betrat, stand der Pastor bereits an der Tür und sprach mit seinem Kutscher. Bei Lores Anblick drehte er sich herum.
»Iss rasch etwas! Ich will gleich losfahren.«
Lore schüttelte schaudernd den Kopf. »Ich kann nichts essen, Herr Pastor.«
Die Pastorin, die noch am Tisch saß und dem Dienstmädchen zusah, das ihre beiden Kinder fütterte, krauste die Stirn. »Unsinn! Essen hält Leib und Seele zusammen und vertreibt den Schmerz.«
So fett, wie du aussiehst, hast du schon viele Schmerzen vertrieben, fuhr es Lore durch den Kopf. Bereits in der Nacht hatte die Frau keinen Hehl daraus gemacht, dass sie den Brand des Lehrerhauses als ein Zeichen Gottes ansah, der die Feinde des neuen Gutsherrn mit seinem Zorn strafe. Daher war ihre Beileidsbekundung arg knapp und ohne jedes Mitgefühl ausgefallen. Lore biss sich auf die Lippen, um der Frau nicht ins Gesicht zu schreien, was sie von ihr hielt, und warf einen kurzen Blick auf das opulente Frühstück, das aus hellem Brot, goldgelb glänzender Butter, einem großen Stück Käse und einer fettigen Leberwurst bestand, und fühlte, wie es in ihrer Kehle würgte.
Rasch wandte sie dem Tisch den Rücken zu und sah den Pastor an. »Ich möchte zu meinem Großvater.«
Der Pastor brummte etwas, das so klang, als wolle er sie überreden, sich doch ins Gutshaus bringen zu lassen. Aber nach einem Blick auf ihre Miene nickte er nur. »Gut. Fahren wir!«
Er winkte ihr, ihm zu folgen, und verließ das Haus. Es war wie alle anderen im Ort mit Reet gedeckt, aber größer als das Lehrerhaus und sehr viel besser eingerichtet. Hier konnte jeder sofort erkennen, dass der Pastor an Wichtigkeit gleich nach dem Gutsherrn kam, und der Mann trat entsprechend selbstbewusst auf. Als der Kutscher den Landauer durch das Dorf lenkte, nahmen die einfachen Knechte und Arbeiter die Mützen vom Kopf, und die meisten Frauen knicksten. Der Blick des Pastors glitt jedoch über die Leute hinweg, und seine Mundwinkel zogen sich verächtlich herab.
Obwohl der Schmerz um ihre Familie in ihr tobte, ärgerte Lore sich über die Gutsherrenallüren des Seelsorgers. Sein Vorgänger hatte für jedermann ein gutes Wort gehabt und offene Ohren für die Sorgen der Leute. Der neue Geistliche aber schien die Arbeiter und Knechte nicht einmal als Menschen anzusehen. Auch für sie hatte er kein Wort des Trostes gefunden, sondern sie nur wiederholt aufgefordert, sich doch besser in die Obhut Ottokar von Trettins und Malwines zu begeben, als zu ihrem Großvater zu gehen. Daher war sie froh, als das Gefährt auf den Forstweg zwischen den hohen Tannen einbog und der Brandgeruch, der immer noch in der Luft zu liegen schien, dem Duft des Harzes wich. Doch in Sicherheit fühlte sie sich erst, als sie das Jagdhaus vor sich auftauchen sah.
Wolfhard Nikolaus von Trettin hörte den näher kommenden Wagen, trat vor die Tür und runzelte beim Anblick des ihm verhassten Pastors die Stirn. Noch mehr wunderte er sich jedoch, seine Enkelin auf dessen Wagen zu sehen. Das Mädchen war bleich wie ein Leinentuch, und ihr Blick erinnerte ihn an eine sterbende Hirschkuh. Sofort war ihm klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste.
Der Pastor ließ seinen Kutscher anhalten und stieg aus, ohne sich um Lore zu kümmern. »Gott zum Gruß, Herr von Trettin!«
»Guten Tag, Pastor«, antwortete dieser mit der ganzen Arroganz eines ostpreußischen Junkers und verschränkte die Arme vor der Brust.
Der Pastor beschloss, die Unhöflichkeit des alten Mannes zu übergehen, und setzte eine wohlwollende Miene auf. »Mein lieber Trettin, ich bedaure sehr, heute hier stehen und Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen zu müssen. Es hat Gott, dem Allmächtigen, gefallen, Ihre Tochter, Ihren Schwiegersohn und alle Enkel bis auf dieses Mädchen hier zu sich zu nehmen.«
Lores Großvater stand einen Augenblick lang wie erstarrt, dann packte er den Pastor mit einem harten Griff. »Was sagst du da, du Kretin?«
»Mama, Papa, Wolfi, Willi und Ännchen sind tot! Es gab ein Feuer, und sie sind …« Lores Stimme klang dünn und versagte ihr schon bald den Dienst.
Wolfhard von Trettin stieß einen Schrei aus, der nichts Menschliches an sich hatte. »Mein Kind, meine Enkel tot? Und dieser Pfaffe sagt auch noch, es hat Gott so gefallen?«
»Versündigen Sie sich nicht!«, rief der Pastor mahnend. »Gottes Ratschluss ist unergründlich und kann von uns Menschen nicht begriffen werden. Wer weiß, welche Sünden Ihres Geschlechts durch dieses Feuer gesühnt wurden.«
Der Blick, mit dem er Lores Großvater maß, ließ keinen Zweifel daran, wem der Pastor diese Sünden zuschrieb.
Der alte Freiherr spürte, wie die Wut auf den Kirchenmann ihm das Blut in den Kopf steigen ließ und für den Augenblick selbst die Trauer um Tochter, Schwiegersohn und Enkel verdrängte. »Was ist das für ein Gott, von dem du sprichst? Ein gerechter Gott lässt nicht unschuldige Frauen und Kinder für die Sünden anderer im Feuer umkommen! Keiner meiner Enkel hat je eine größere Untat begangen, als zu Weihnachten heimlich ein Plätzchen zu essen! Warum also hätte Gott sie zu sich nehmen sollen? Es gibt genug arge Sünder im Land, die ein behagliches Leben führen, obwohl sie den Schlund der Hölle verdient hätten!« Wolfhard von Trettins Blick glitt dabei in die Richtung, in der sein verlorener Gutshof lag.
Der Pastor legte ihm besänftigend die Hand auf die Schulter. »Nehmen Sie es als Mahnung des Himmels, Herr von Trettin, und reichen Sie Ihrem Erben die Hand zur Versöhnung. Dann wird Gott es Ihnen danken.«
Der Alte fuhr wie von der Tarantel gestochen herum und starrte den Pastor an, als habe dieser den Verstand verloren. »Was soll ich? Den Räuber meines Eigentums an mein Herz drücken? Das kann nicht einmal Gott von mir verlangen!«
»Der neue Herr auf Trettin hätte alle retten können. Aber er ist an dem brennenden Haus vorbeigefahren, ohne sie zu wecken und zu warnen.« Erst als das Gesicht ihres Großvaters auf einen Schlag schneeweiß wurde, begriff Lore, dass sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hatte.
Der Pastor warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »Hören Sie nicht auf das dumme Mädchen, Herr von Trettin! Ihre Enkelin wiederholt nur das haltlose Geschwätz einer verrückten alten Frau. Wäre der Gutsherr tatsächlich am Lehrerhaus vorbeigekommen, hätte er selbstverständlich angehalten und die Leute herausgerufen.«
Wolfhard von Trettin dachte an den Besuch seines Neffen, der am Vorabend bei Anbruch der Dunkelheit vom Jagdhaus weggefahren war. Dann warf er einen traurigen Blick auf Lore, die zu Fuß unterwegs gewesen war und das Lehrerhaus erst erreicht haben konnte, als es bereits in Flammen stand, und lachte mit einem Mal grässlich auf.
»Du bist kein Pfarrer, sondern ein Diener dieses Teufels, der sich auf meinem Gut eingeschlichen und es mir weggenommen hat! Das Kind sagt die Wahrheit! Mein Neffe ist letzte Nacht am Haus meiner Tochter vorbeigefahren, ohne sie zu warnen, und damit ist er an ihrem Tod und dem der anderen ebenso schuld, als hätte er sie eigenhändig ermordet.«
Der Pastor bedachte den alten Herrn mit einem missbilligenden Blick. »Jetzt mäßigen Sie sich! Es ist eine Sünde, einen geachteten Mann so zu beschuldigen.«
Mit einem wüsten Fluch ballte Wolfhard von Trettin die Fäuste und ging auf den Pastor los. Dieser wich zurück und sprang fluchtartig in seinen Wagen.
»Fahr los!«, herrschte er den Kutscher an. Der Mann schien den Zorn des alten Freiherrn ebenso zu fürchten wie sein Herr, denn er trieb die Pferde so stark an, dass der Wagen wie ein Ball über den unebenen Platz vor der Jagdhütte hüpfte. Gekränkt hockte der Pastor auf der gepolsterten Bank im Fond und drehte sich nicht mehr nach dem alten Herrn um. Hinter ihm erscholl noch ein zornerfüllter Fluch, der mitten im Wort erstarb und einer Stille Platz machte, die nur vom Rauschen des Windes in den Zweigen durchbrochen wurde.
V.
Lore sah ihren Großvater noch ein paar Schritte hinter dem Wagen des Pastors herrennen. Plötzlich aber blieb er stehen, wandte sich erschrocken um und griff sich mit der Rechten an die Stirn. Gleichzeitig wurde sein Gesicht so dunkel wie schwerer Burgunderwein. Er versuchte, noch etwas zu sagen, brachte aber nur noch gurgelnde Laute heraus. Dann fiel er wie ein leerer Jutesack in sich zusammen und stürzte zu Boden.
»Herr Großvater, was ist mit Euch?« Lore eilte an seine Seite und beugte sich über ihn. Voller Angst blickte sie in seine verdrehten Augen, in denen nur noch das Weiße zu sehen war, und vernahm rasselnde Atemzüge. Als der alte Herr nicht auf ihre verzweifelten Worte reagierte, rief sie laut nach dem Dienstmädchen.
»Elsie! Komm schnell! Hilf mir! Mein Großvater ist gestürzt.« Einige bange Augenblicke starrte sie auf die Tür des Hauses. Doch es rührte sich nichts. Sie erinnerte sich daran, dass Elsie bei Verwandten im Dorf schlief und schon öfter zu spät zum Jagdhaus gekommen war. Doch um diese Zeit hätte sie eigentlich schon bei der Arbeit sein müssen.
»Elsie, wo bist du?«, schrie Lore so laut, wie ihre Kehle es zuließ.
»Was ist denn los?«, scholl es verärgert zurück. Es vergingen noch einige Minuten, die sich für Lores Gefühl schier zu Jahren dehnten, bis die dralle Magd zwischen den Bäumen auftauchte.
Elsie biss gerade von einem Apfel ab, der vom letzten Jahr übrig geblieben war, als sie Lore neben dem Herrn von Trettin knien sah. »Ist er tot?«, fragte sie erschrocken.
Lore schüttelte heftig den Kopf. »Nein, aber er ist nicht mehr bei Bewusstsein. Ich habe solche Angst! Hilf mir! Wir müssen ihn ins Haus tragen und dann Doktor Mütze rufen.«
Doch anstatt näher zu kommen, wich Elsie mit bleichem Gesicht zurück. »Ich lange ihn nicht an, sonst wird er uns unter den Händen sterben.«
Lore begriff, dass sie von der Dienstmagd keine Hilfe zu erwarten hatte, und stand auf. »Dann bleib wenigstens hier und achte auf ihn, während ich zum Arzt laufe. Wie du weißt, bin ich schneller als du.«
Dazu war Elsie ebenfalls nicht bereit. »Bleiben Sie bei ihm, Fräulein! Ich hole den Arzt.«
Ehe Lore etwas sagen konnte, hatte sie sich umgedreht und rannte los. Das Mädchen sah sie zwischen den Bäumen verschwinden und biss vor Schmerz die Zähne zusammen.
Da Doktor Mütze in Heiligenbeil wohnte, das fast zwei deutsche Meilen entfernt lag, vergingen Stunden, in denen Lore neben ihrem Großvater saß und sich nicht zu rühren wagte. Sollte Gott wirklich so grausam sein, dass sie nun auch noch den letzten Menschen verlor, dem etwas an ihr lag? Hatte sie ihr Maß an Leid nicht bereits in der Nacht bis zur Neige ausschöpfen müssen? Sie weinte und wünschte sich, alles wäre nur ein schlimmer Traum, aus dem sie bald erwachen würde. Doch der bewusstlose Mann und der harte Boden, auf dem sie kniete, zeugten überdeutlich davon, dass dies alles Wirklichkeit war.
Als sie bereits nicht mehr daran glaubte, dass Hilfe käme, hörte sie den Hufschlag rasch trabender Pferde und die Stimme des Arztes, der seinen Knecht aufforderte, die Gäule schneller laufen zu lassen. Kurz darauf bog der Landauer auf den Platz vor dem Jagdhaus ein, und sie sah Schaumfetzen von den Mäulern der Tiere stieben.
Doktor Mütze sprang ab, eilte zu dem Kranken und untersuchte ihn. Als er aufblickte, war sein schmales Gesicht außerordentlich ernst. »Es tut mir leid, mein Kind, aber es sieht nicht gut aus. Dein Großvater hat einen Schlaganfall erlitten, und wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.«
Der Arzt hätte Lore gerne einen anderen Bescheid gegeben, aber das Mädchen hatte innerhalb eines Tages so viel Leid erlebt, dass er ihr keine Hoffnungen machen wollte, die sich höchstwahrscheinlich in Luft auflösen würden.
»Binde die Pferde irgendwo fest und hilf mir, den alten Gutsherrn ins Haus zu tragen«, befahl er seinem Kutscher. Der Mann war gewöhnt, seinem Herrn zur Hand zu gehen, und trat sogleich an seine Seite. Gemeinsam schleppten sie den Bewusstlosen in das Schlafzimmer und legten ihn auf das Bett.
»Bring uns ein frisches Nachthemd und warte dann vor der Tür«, wies Doktor Mütze Lore an.
Sie eilte zum Wäscheschrank, legte eines der mit der Freiherrenkrone bestickten Nachtgewänder heraus und lief dann in die Küche, in der Elsie bleich am Tisch hockte und jammerte.
»Wenn der Herr stirbt, weiß ich nicht, was ich tun soll!«, schluchzte sie. »Auf dem Gut gibt man mir gewiss keine Arbeit, das hat die neue Herrin bereits gesagt. Ich werde in die Stadt gehen müssen und …« Sie brach ab und starrte Lore so vorwurfsvoll an, als sei diese an allem schuld.
»Großvater wird nicht sterben!«, fuhr Lore auf.
Das Dienstmädchen machte eine verächtliche Handbewegung und stimmte eine weitere Jeremiade an.
Es dauerte, bis der Arzt aus dem Schlafzimmer des Alten kam. Kopfschüttelnd, als könne er nicht glauben, was er gesehen hatte, wandte er sich an Lore. »Dein Großvater ist zäher als eine Katze und scheint mindestens neun Leben zu haben. Vorhin hätte ich keinen Heller mehr auf ihn verwettet, doch jetzt ist er wieder bei Bewusstsein und droht mir, weil ich ihm eine Spritze geben will.«
»Großvater ist wieder gesund?« Lore wollte aufspringen und zu dem alten Herrn eilen, doch Doktor Mütze fasste sie am Arm und hielt sie zurück.
»Ich sagte, er ist wach. Gesund wird er wahrscheinlich nie mehr werden, obwohl mich das bei ihm auch nicht wundern würde.« Noch immer verblüfft über das Erwachen seines Patienten aus der tiefen Bewusstlosigkeit, bat er Lore um warmes Wasser zum Händewaschen und ein Handtuch.
»Kann ich zu ihm?«, fragte das Mädchen.
Der Arzt verneinte. »Es ist besser, du wartest, bis ich mit ihm fertig bin. Versuche bitte, ruhig zu bleiben! Ihn hat der Schlag getroffen, und er wird wahrscheinlich nie mehr laufen können. Seine linke Körperseite ist gelähmt. Erschrick also nicht, wenn dir sein Gesicht wie eine groteske Maske vorkommt.«
Dann legte er ihr die Hand auf die Schulter und lächelte traurig. »Es tut mir leid um deine Familie, Lore. Wir haben vorhin das niedergebrannte Haus durchsucht und ihre sterblichen Überreste gefunden. Meine Hoffnung, jemand hätte sich noch rechtzeitig ins Freie retten können und würde im Schock durch den Wald irren, hat sich leider nicht erfüllt.«
Lore schlug die Hände vor das Gesicht und versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Tief in ihrem Inneren hatte sie gewusst, dass alle tot waren. Gleichzeitig spürte sie, wie der Schmerz über den Verlust ihrer Eltern und Geschwister von der Angst um ihren Großvater in den Hintergrund gedrängt wurde. Sie durfte sich nicht verkriechen und ihrer Trauer hingeben, sondern musste sich nun Tag und Nacht um ihn kümmern. Wenn er starb, gab es keinen Menschen mehr auf der Welt, dem sie etwas bedeutete und der sie vor ihren Verwandten auf dem Gutshof schützte.
»Kopf hoch, Kind! Auch für dich wird irgendwann wieder ein Licht leuchten«, sagte Doktor Mütze, klopfte ihr aufmunternd auf den Rücken und kehrte zu seinem Patienten zurück.
Wolfhard von Trettin hatte die rechte Hand um einen hölzernen Zapfen an der Rückseite der Bettwand gekrallt und versuchte sich aufzurichten, obwohl ihm die linke Körperseite den Dienst versagte.
»Lass diesen Unsinn, Nikas! Oder willst du unbedingt noch heute in die Grube fahren?«, fuhr der Arzt ihn an.
Der alte Trettin, den seine Freunde nach seinem zweiten Namen Nikolaus Nikas nannten, schüttelte mühsam den Kopf. »Ich darf nicht sterben, nicht jetzt!«
Die Worte klangen zwar verwaschen, doch zu seinem Erstaunen konnte der Arzt sie verstehen. Er begriff durchaus, was seinen Patienten bewegte, wollte aber keine Diskussion mit ihm beginnen, sondern half ihm, sich so hinzulegen, wie es am bequemsten war.
»Ich werde dir jetzt eine Spritze geben. Danach wirst du schlafen und, so Gott will, in einem besseren Zustand wieder aufwachen als jetzt«, sagte er, während er die Spritze aus seinem Koffer holte und aufzog.
Trettin streckte die Rechte, die ihm noch gehorchte, nach dem Arzt aus. Da dieser jedoch links neben ihm stand, konnte er ihn zunächst nicht erreichen. Mit einer schier übermenschlichen Anstrengung gelang es ihm dann doch, seine Finger in den Ärmel seines Freundes zu krallen.
»Ich muss mit dir reden, alter Knochenflicker! Danach kannst du mich meinetwegen betäuben. Aber zuerst hörst du mir zu.«
Es klang so drängend, dass Doktor Mütze in seinen Vorbereitungen innehielt. »Also gut, Nikas, ich gebe dir ein paar Minuten. Aber danach bist du ein braver Bursche und lässt dich ohne einen Mucks von mir piksen.«
»Versprochen!« Wolfhard von Trettin nickte und zog dann den Arzt näher zu sich heran. »Das mit meiner Tochter und ihrer Familie war nicht nur ein übler Traum, nicht wahr?«
Der Arzt senkte betroffen den Kopf. »Leider nein! Wir haben heute Morgen alle fünf gefunden. Der Pastor kümmert sich jetzt darum, dass sie ordnungsgemäß eingesargt und begraben werden.«
»Der Pastor, sagst du?« Die gesunde Gesichtshälfte des alten Trettin wurde zu einer Grimasse des Zorns. »Der Kerl ist schuld daran, dass ich hier so liege! Wagte er mir doch ins Gesicht zu sagen, der Tod meiner Tochter wäre die Strafe für meine Sünden und ich solle mich mit Ottokar versöhnen, obwohl dieser die Toten auf dem Gewissen hat.«
»Ich habe das Gerücht gehört, er sei am Lehrerhaus vorbeigefahren, ohne anzuhalten. Der Pastor hat allen verboten, noch einmal davon zu sprechen. Seinen Worten zufolge sei der Gutsherr nach Königsberg gefahren und könne daher gar nicht im Dorf gewesen sein.« Doktor Mütze wollte noch mehr sagen, doch der Kranke unterbrach ihn mit einem zornigen Laut.
»Ottokar ist durch das Dorf gefahren, denn er kam von mir. Wir haben uns gestritten, wie immer, und aus Rache hat er keine Hand gerührt, um meine Tochter zu retten.«
Der Arzt starrte seinen Freund erschrocken an. »Das wäre … das ist ja ungeheuerlich!«
»Ebenso ungeheuerlich wie die Worte des Pastors, der sich zu seinem Handlanger macht! Ich will nicht, dass der Kerl meine Toten begräbt«, stieß der Kranke erregt hervor.
»Daran wirst du ihn nicht hindern können. Bei Gott, du darfst froh sein, wenn du in ein paar Wochen in einem Rollstuhl sitzen und von der Terrasse des Jagdhauses aus den Sonnenuntergang beobachten kannst.« Der Arzt legte dem alten Freiherrn die linke Hand auf die Schulter und nahm mit der rechten die Spritze.
Wolfhard von Trettin schloss das gesunde Auge und stöhnte gequält auf. »Meine Tochter wird er vielleicht noch begraben können, aber mich wird er nicht unter die Erde bringen, das schwöre ich dir. Eher gebe ich die Religion auf.«
»Das kannst du nicht tun! Du musst auch an Lore denken. Was wäre das für ein Leben für sie – ohne Gott?«
»Du hast recht! Ich muss an Lore denken. Gott, gib mir nur die Zeit, das zu tun, was notwendig ist. Du wirst mir dabei helfen müssen, verstehst du? Sie darf nicht unter die Vormundschaft Ottokars geraten. Dessen Angetraute würde sie zu ihrer Magd erniedrigen. Aber sie ist meine Enkelin und hat das Anrecht, als solche behandelt zu werden. Versprich mir, dass du mir hilfst!«
»Ich helfe dir«, versprach der Arzt und setzte die Spritze an. Noch während er den Kolben langsam nach vorne drückte, huschte der Anschein eines grimmigen Lächelns über die gesunde Gesichtshälfte seines Patienten.
»Wir werden Ottokar schon ein Schnippchen schlagen, alter Freund! Er soll nicht auch noch für den Tod meiner Tochter und Lores Geschwister belohnt werden. Das schwöre ich!« Dann musterte Trettin den Arzt nachdenklich, und während das betäubende Mittel bereits zu wirken begann, äußerte er eine letzte Bitte.
»Es darf aber niemand etwas von meinen Plänen erfahren, verstehst du?«
»Ich werde schweigen«, antwortete der Arzt, verwundert über die Lebenskraft, die der Kranke aufbrachte. Dabei wusste er, dass er alles tun musste, um weitere Aufregung von ihm fernzuhalten.
VI.
Ottokar von Trettin hatte das Gut noch in der Unglücksnacht verlassen, um, wie er sagte, an einer Versammlung des Gutsbesitzerverbandes in Königsberg teilzunehmen. Doch das, was geschehen war, ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Als er nach mehr als zwei Wochen nach Trettin zurückkehrte, wirkte sein Teint fahl, und sein Blick wanderte unstet umher.
Seine Frau Malwine, eine mittelgroße, schlanke Erscheinung mit früher recht hübschen, nun aber scharf geschnittenen Zügen, betrachtete ihn spöttisch. »Du siehst aus wie das leibhaftige schlechte Gewissen, mein lieber Ottokar. Hast du in Königsberg Dinge getrieben, die ich besser nicht wissen sollte?«
»Natürlich nicht!«, fuhr der Gutsherr sie an. »Es geht um meinen Onkel. Standesgenossen, mit denen ich mich in Königsberg getroffen habe, haben mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie mir einen weiteren Prozess gegen den Alten verargen würden. Der arme Mann wäre durch den Verlust seines Gutes und den Tod seiner Tochter bereits genug gestraft, meinen sie.«
»Du vergisst den Schlaganfall, der ihn am Tag deiner Abreise niedergeworfen hat«, antwortete seine Frau mit einem zufriedenen Lächeln.
Ottokar starrte sie überrascht an. »Dann stimmt es also! Ich habe zwar davon gehört, es aber für bloßes Gerede gehalten.«
»Es ist Tatsache, dass dein Onkel im Krankenbett liegt und es wohl kaum noch lebend verlassen wird.«
Während Frau Malwines Stimme beinahe vergnügt klang, hieb ihr Mann ärgerlich mit der Faust durch die Luft. »Wenn er so schwer krank ist, wie du behauptest, kann ich ihn sowieso nicht mehr verklagen, ohne endgültig in unseren Kreisen scheel angesehen zu werden. Außerdem wissen wir nicht einmal, ob der alte Bock das vom Gut abgezweigte Geld überhaupt noch besitzt. Es kann genauso gut mit allem anderen im Haus seiner Tochter verbrannt sein.«
Malwine maß ihn mit einem schiefen Blick, als zweifele sie an seinem Verstand. »Du solltest deinen Onkel besser kennen. Der gibt doch keinen Taler her, bevor ihn der Teufel geholt hat. Zudem hat ein so altmodischer Mensch wie er sein Vermögen sicher nicht in Aktien oder Renten angelegt, sondern in Gold. Im Schutt des niedergebrannten Lehrerhauses hat man jedoch nichts gefunden.«
Ottokar von Trettin atmete auf. »Dann gibt es ja noch Hoffnung, ihm das unrechtmäßig an sich gebrachte Vermögen entreißen zu können. Dieser alte Lump muss im Lauf der Jahre Tausende von Talern auf die Seite geschafft haben. Mich packt die Wut, wenn ich bloß daran denke.«
»Und mich packt die Wut, wenn ich sehe, wie kleinmütig du bist!«, schalt seine Frau. »Wärst du nicht so überstürzt abgereist, aus Angst, man könne dich mit dem Brand in Verbindung bringen, hättest du bei den Behörden durchsetzen können, als Lores Vormund eingesetzt zu werden.«
»Was soll ich mit dem Balg?«, fragte Ottokar missmutig.
Für einen Augenblick verzerrte sich das Gesicht seiner Frau zu einer entnervten Grimasse. »Du bist ja noch dümmer, als ich dachte! Nach dem Tod ihrer Mutter und ihrer Geschwister ist Lore die einzige Erbin, die der alte Wolfhard noch hat. Daher wird er ihr das unterschlagene Geld zukommen lassen wollen.«
Bei diesen Worten atmete Ottokar von Trettin erleichtert auf. »Du hast recht, meine Liebe! Dieses bedauerliche Unglück hat die Situation zu unseren Gunsten gewandelt. Jetzt müssen wir nur noch auf Lore achten.«
»War es wirklich ein Unglück? Dein Kutscher machte letztens Andeutungen, die besser nicht unter die Leute kommen sollten«, sagte Malwine, die ihn lauernd beobachtete.
»Florin ist ein Narr! Es war ein Unglück«, antwortete Ottokar mit viel zu schriller Stimme.
Seine Frau nahm es mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. »Dann sorge dafür, dass der Kerl den Mund hält und du nicht in ein schlechtes Licht gerätst.«
Ihr Mann nickte und fragte sich, womit er seinen Kutscher eher zum Schweigen bringen mochte, mit Drohungen oder dem Angebot einer gewissen Summe.
Seine Frau hing ganz anderen Überlegungen nach. »Du hast dich doch vor Gericht verpflichten müssen, deinem Onkel vierteljährlich eine gewisse Summe für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung zu stellen. Wenn du diese Zahlungen einstellst, wird der Alte gezwungen sein, auf seine Reserven zurückzugreifen, und wir haben genug Freunde, die uns Bescheid geben werden, wenn er Rentenpapiere bei der Bank verkauft oder Goldbarren einlöst.«
»Und wenn er wegen des Geldes vor Gericht geht?«, fragte Ottokar.
Seine Frau seufzte, als verliere sie langsam die Geduld. »In seinem Zustand kann dein Onkel niemanden mehr verklagen!«
VII.
Die Pflege ihres Großvaters ließ Lore nur wenig Zeit, um ihre Eltern und Geschwister zu trauern. Der alte Mann haderte mit seinem Schicksal und verfluchte Gott für das Unglück, das über ihn hereingebrochen war. Manchmal lag er stundenlang stumm in seinem Bett und starrte die hölzerne Decke des Zimmers an, dann wiederum hetzte er seine Enkelin und das Dienstmädchen mit widersprüchlichen Anweisungen umher, so dass sie kaum zum Luftholen kamen.
An diesem Tag war es besonders schlimm, daher stahl Elsie sich fort, nachdem sie das Mittagessen im Stehen verschlungen hatte, und ließ die ihr übertragene Arbeit einfach liegen. Kurz darauf sah Lore durch das Fenster, dass sich ein Fußgänger vom Dorf her dem Jagdhaus näherte, und fragte sich, wer es sein mochte. Doktor Mütze kam stets mit dem Wagen, und Kord, der seinen alten Dienstherrn regelmäßig besuchte, hätte sie von weitem erkannt. Doch da der Weg hier am Jagdhaus endete, musste es das Ziel des Fremden sein.
»Herr Großvater, Ihr erhaltet gleich Besuch!«, rief sie dem Kranken zu.
»Wenn es der Pastor ist, so sage ihm, er soll sich zum Teufel scheren!«, bellte der Alte.
Lore zog den Kopf zwischen die Schultern und wagte nicht, eine Antwort zu geben.
»Jetzt geh schon und schau nach, wer es ist«, setzte ihr Großvater grimmig hinzu.
Gehorsam lief Lore zur Haustür und sah hinaus. Der Wanderer war nun so nahe, dass sie ihn wiedererkannte.
»Onkel Fridolin! Welch eine Überraschung.« Sie eilte dem jungen Mann entgegen und ergriff seine Hände.
Fridolin von Trettin blieb stehen und blickte sie erstaunt an. In seiner Erinnerung war Lore noch ein spindeldürres, flinkes Ding mit langen, blonden Zöpfen. Zöpfe trug sie zwar immer noch, aber ihr Haar leuchtete jetzt wie ein erntereifes Weizenfeld. Sie wirkte auch noch recht schlank, doch lag das mehr an ihrer Größe. Immerhin reichte sie ihm jetzt bis zur Nasenspitze, dabei war er nicht gerade klein. Sanfte Rundungen verrieten ihre erwachende Weiblichkeit, und ihr Gesicht erschien ihm trotz der Trauer in den großen, braunen Augen gleichermaßen lieblich und schön. Die Mädchen aus Hedes Etablissement würden sie um ihr Aussehen und ihre natürliche Eleganz sicher beneiden, fuhr ihm unziemlicherweise durch den Kopf.
»Sag bloß, du bist die Lore? Bei Gott, wie die Zeit vergeht! Du bist ja direkt eine junge Dame geworden.«
»Ich bin schon fünfzehn«, antwortete Lore und musterte ihren mit ausgesuchter Eleganz gekleideten Verwandten.
Fridolin trug einen leichten hellgrauen Rock, eine Hose aus demselben Stoff und einen gleichfarbigen Zylinder. Sein rüschenbesetztes Hemd glänzte im Licht der Sonne, und in seiner gefällig gebundenen Krawatte steckte eine goldene Nadel.
Er nahm ihren bewundernden Blick wahr und lächelte traurig. »Eigentlich hätte ich in Schwarz kommen sollen, aber ich besitze keinen geeigneten Anzug – und mein Schneider wollte mir keinen Kredit geben.«
Er lachte, als hätte er eben einen guten Witz erzählt, wurde aber rasch wieder ernst und legte Lore die Rechte auf die Schulter. »Mein Beileid, Kleines! Es muss schrecklich für dich gewesen sein, auf diese Weise deine Familie zu verlieren. Und dann ist auch noch der Onkel krank geworden! Wie geht es ihm denn?«
»Besser, als der Arzt es ihm prophezeit hat! Aber er ist gelähmt und kann das Bett nicht mehr verlassen«, antwortete Lore kummervoll.
»Und wer pflegt ihn?«, hakte Fridolin nach.
»Elsie und ich. Das heißt, meistens ich.«
»Elsie? Hieß nicht so das Dienstmädchen, das mir bei meinem letzten Besuch auf Trettin die Manschetten versaut hat?« Fridolin schüttelte sich bei dieser Erinnerung und bat Lore anschließend darum, ihn zu seinem Onkel zu führen.
Lore ging voran, öffnete ihm die Tür zum Krankenzimmer und eilte selbst in die Küche, um einen kleinen Imbiss für den Gast vorzubereiten.
Wolfhard von Trettin wartete bereits ungeduldig auf den Besucher und lächelte, als er den Sohn seines jüngsten Bruders eintreten sah. »Bei Gott, Fridolin! Welcher Wind weht dich hierher nach Ostpreußen?«
»Zuerst einmal einen guten Tag, lieber Onkel. Doch um auf Eure Frage zurückzukommen: Ich wäre wohl ein arg aus der Art geschlagener Verwandter, wenn ich nicht auf die Nachricht von Leonores Tod und Eurer Erkrankung hierhergekommen wäre.«
Fridolin rückte einen Stuhl aus der Zimmerecke neben das Bett und setzte sich. Während er den alten Herrn betrachtete, konnte er sein Erschrecken nicht verbergen. Sein Onkel, der bei seinem letzten Besuch noch der Gutsherr auf Trettin gewesen war und so gesund und kräftig gewirkt hatte wie eine Eiche, glich nun dem Schatten seines früheren Selbst.
Spontan fasste der junge Mann die Hände des Alten. »Soll ich Ottokar zum Duell fordern und ein Loch in seine Brust stanzen, Onkel?«
Wolfhard von Trettin lachte zum ersten Mal seit Wochen herzhaft auf. »Das würdest du fertigbringen, Fridolin, nicht wahr? Aber es würde mir nichts nützen, denn Ottokars Frau, die sich ach so vornehm gibt und doch nur eine geborene Lanitzki ohne edle Abstammung ist, würde dann immer noch mit ihrer Brut auf dem Gut sitzen. Bei Gott, warum konntest du nicht der Sohn meines nächstgeborenen Bruders sein? Dann wäre es nie so weit gekommen.«
»In dem Fall hätte ich Euch nur noch öfter um einen Zuschuss angebettelt«, spottete der junge Mann.
Der Alte keuchte, da ihm das Lachen schwerfiel. »Ich hätte dir schon die Ohren langgezogen und dich dazu gebracht, deinen Lebenswandel zu ändern. Aber sag, wie geht es dir so?«
Über Fridolins Gesicht huschte ein Schatten. »Wie Ihr an meinem Anzug ersehen könnt, der in einem Trauerhaus völlig unpassend ist, bin ich wieder einmal blank. Die Fahrt hierher hat meine letzten Taler gefressen. Deswegen musste ich den Weg von Heiligenbeil bis Bladiau auf dem Gemüsekarren eines Bauern zurücklegen und auf dem letzten Stück bis hierher meine eigenen Beine bemühen.«
»Ich wollte, ich könnte dir wenigstens ein paar Taler geben. Doch Ottokar hat die Zahlungen eingestellt, die er mir laut Gerichtsurteil leisten müsste. Wie es aussieht, will der Kerl mich so rasch wie möglich unter der Erde sehen.« Wolfhard von Trettin warf einen düsteren Blick in die Richtung, in der sein einstiger Gutshof lag, und ballte die Faust.