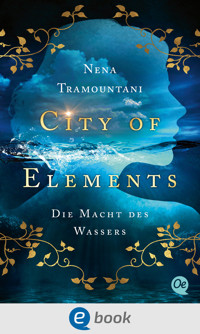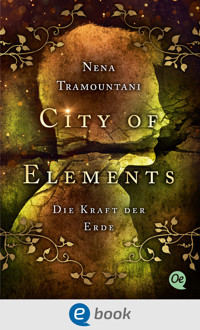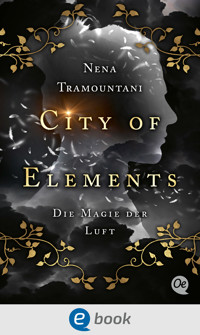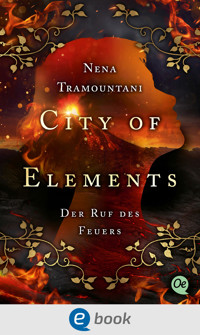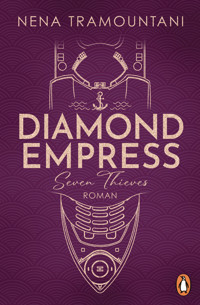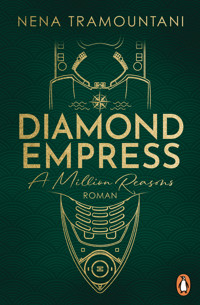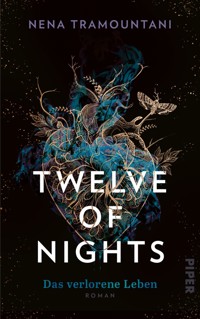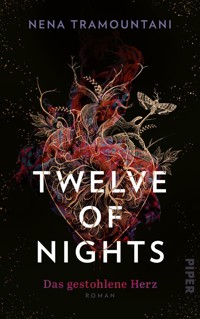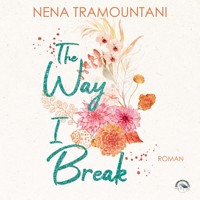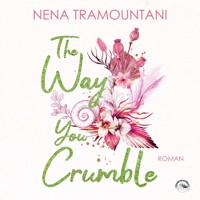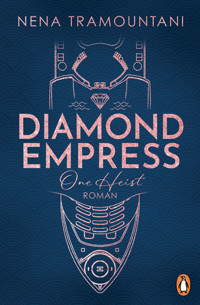
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stolen Dreams
- Sprache: Deutsch
Das Ziel? Den Safe ausrauben. Die Erfolgschancen? Gering. Die Motivation? EAT THE RICH.
Fesselnde Spannung trifft auf unwiderstehlichen Spice – Nena Tramountanis hochkarätige Heist-Reihe auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff!
Sie ist ein Profi darin, andere zu täuschen. Doch ihrem Herz kann sie nichts vormachen.
Mit Diebstählen kennt Seraphina sich aus. Und damit, steinreichen Leuten etwas vorzuspielen. Als Freundin von Adrian Montpellier trinkt sie an Bord der Diamond Empress täglich Champagner zum Frühstück und schmiedet dabei heimlich Pläne. Sie spielt die Rolle des It-Girls schon so lange, dass sie beinahe glaubt, tatsächlich dieser gefühlskalte Mensch geworden zu sein. Wäre da nicht die Diebescrew und vor allem Zoe, ihre Achillesferse. Zoe, deren Gefühle Seraphina entweder ignoriert oder in schwachen Momenten erwidert, wohl wissend, dass sie sich von ihrem Vorhaben nicht abhalten lassen darf. Denn auf der glamourösen Diamantengala will sie sich an der Person rächen, die ihr alles genommen hat. Und noch ein anderer Plan soll endlich in die Tat umgesetzt werden: der seit Wochen vorbereitete Raub. Die Crew ist bereit. Bereit, alles zu riskieren. Auch wenn sie dabei alles verlieren könnte.
Funkelnde Diamanten, heiße Emotionen, elektrisierende Cliffhanger
Das spektakuläre Finale an Bord der DIAMOND EMPRESS!
Die Stolen-Dreams-Reihe im Überblick:
1. Diamond Empress. A Million Reasons
2. Diamond Empress. Seven Thieves
3. Diamond Empress. One Heist
Entdecke auch die anderen Reihen von Nena Tramountani:
Die Soho-Love-Reihe:
1. Fly & Forget * 2. Try & Trust * 3. Play & Pretend
Die Hungry-Hearts-Reihe:
1. The Way I Break * 2. The Way You Crumble * 3. The Way We Melt
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
NENATRAMOUNTANI begeistert ihre Leserschaft mit ihren New-Adult- und Fantasyromanen. Nach ihrer Soho-Love- und Hungry-Hearts-Reihe schlägt sie ein neues spannendes Kapitel ihrer Autorinnenkarriere auf: In ihrer Stolen-Dreams-Reihe voller heißer Emotionen und elektrisierender Cliffhanger verbindet sie drei unwiderstehliche Lovestories mit dem Nervenkitzel einer fesselnden Heist-Geschichte und lässt ihre Fans bis zur letzten Seite atemlos mitfiebern. Nena Tramountani lebt in Stuttgart.
Außerdem von Nena Tramountani lieferbar:
Die Soho-Love-Reihe:
Fly & Forget
Try & Trust
Play & Pretend
Die Hungry-Hearts-Reihe:
The Way I Break
The Way You Crumble
The Way We Melt
www.penguin-verlag.de
Nena Tramountani
Diamond Empress
One Heist
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Lektorat: Melike Karamustafa
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Innenillustration: Christin Neumann
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31845-1V001
ISBN 978-3-641-31845-1V001
Playlist
Billie Eilish – LUNCH
Sigrid – Everybody Knows
CHINCHILLA – MF Diamond
Nessa Barrett – PINSANDNEEDLES
Dove Cameron – Lethal Woman
Livingston – Gravedigger
CHINCHILLA – Fingers
CHINCHILLA – Cut You Off
Cage The Elephant – Mess Around
Cameron Whitcomb – Love Myself
CHINCHILLA – Little Girl Gone
Austin Giorgio – No Mercy
CHINCHILLA – Trigger
Sam Short – Hooked
Doja Cat – Paint The Town Red
Gotts Street Park, Olive Jones – Tell Me Why
TALK – A Little Bit Happy
Chandler Leighton, DEZI – Witch Hunt
SkyDxddy – Pretty Distraction
Stephen Sanchez – High
Teddy Swims – Devil in a Dress
Måneskin – THELONELIEST
Yeah Yeah Yeahs – Heads Will Roll
t. A. T. u. – All The Things She Said
Lord Huron – Meet Me In The Woods
Francis and the Lights – See Her Out (That’s Just Life)
Alex Warren – Ordinary
ABBA – Money, Money, Money
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell belastende Inhalte.
Deshalb findet sich hier eine Contentwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Handlung.
Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Nena Tramountani und der Penguin Verlag
Für alle, die nicht gesprungen sind.
1. KapitelZoe
Baby, I think you were made for me
An dem Tag, an dem ich sterben sollte, begegnete ich einem Engel. Oder einem Teufel, so sicher war ich mir da nicht. Wenn man es genau nahm, war Luzifer ja auch vom Himmel in die Hölle gestürzt, also machte das wohl keinen großen Unterschied.
Sie stand drei Meter hinter mir. Die Tür, die aufs Dach führte, war soeben mit einem Knall zugefallen. Ihre schwarz gefärbten Haare wehten im Wind, und obwohl der November in Minnesota erbarmungslos war, trug sie nichts als ein zerknittertes weißes T-Shirt, das ihr knapp über den Hintern reichte, und rote Cowboystiefel.
Ich war vor einer halben Stunde übers Geländer geklettert, saß seitdem auf dem Dachvorsprung und starrte wie hypnotisiert in die Tiefe – die Autos und Menschen wirkten wie Spielzeuge.
Zweifel hatte ich keine. Ich wollte einfach den richtigen Moment abpassen. Es war echt widerlich, bei Tageslicht zu Matsch zu werden. Nicht, weil ich irgendjemandem dort unten den Anblick ersparen wollte – sondern weil ich die Vorstellung nicht ertrug. Ich würde genau in dem Moment springen, in dem die Sonne untergegangen war.
Leider hatte ich die Rechnung ohne Seraphina Leventis gemacht.
»Du bist die Neue, oder?«, rief sie in gelangweiltem Tonfall, als hätte sie mich nicht gerade dabei überrascht, wie ich von einem zwanzigstöckigen Hochhaus springen wollte.
Sie schlurfte auf mich zu und zündete sich dabei eine Selbstgedrehte an.
Ja, ich war die Neue. Das war so etwas wie eine Charaktereigenschaft von mir. Länger als ein paar Monate hielt es keine Pflegefamilie mit mir aus (oder besser gesagt: ich mit ihr), also war ich eine Spezialistin darin geworden, meine Sachen zusammenzupacken und einen weiteren Ort mein – vorübergehendes – Zuhause zu nennen.
»Komm in zehn Minuten wieder, dann hast du deine Ruhe«, rief ich über die Schulter und hasste mich ein bisschen dafür, wie weinerlich meine Stimme klang. Dabei hatte ich seit Wochen nicht geheult. Oder waren es Monate?
Als hätte ich nichts gesagt, lief sie weiter, bis sie am Geländer angekommen war. Mit dem Rücken zu mir setzte sie sich genau hinter mich auf die schmale Mauer, die unterhalb des Geländers entlang des Dachs verlief.
Ich hasste den Geruch von Marihuana – den Geschmack wollte ich mir nicht mal ausmalen. Dennoch streckte ich nach ein paar Sekunden Stille eine Hand durch die Gitterstäbe nach hinten. Inzwischen war sowieso alles egal.
Wortlos reichte sie mir den Joint, wobei sich unsere Finger streiften. Ihre Haut war warm und trocken, meine eisig.
Ich hustete nicht, als ich den ersten Zug nahm. Ich hatte noch nie geraucht, weder Zigaretten noch Gras, denn es hatte bisher niemanden gegeben, für den ich cool sein wollte, aber ich hatte genug Leuten dabei zugesehen und das Prinzip war kinderleicht.
Es war nicht halb so ekelhaft, wie ich immer angenommen hatte. Die Schärfe in meiner Lunge war irgendwie spannend. Vielleicht war es aber auch einfach nur spannend, überhaupt etwas anderes als Taubheit zu empfinden.
»Wer hat gesagt, dass ich Ruhe will?«, mischte sich ihre Stimme unter das Brausen des Windes und den Verkehrslärm in den Straßenschluchten tief unter uns. »Ich kann meinen Plan nicht allein in die Tat umsetzen. Du kommst also wie gerufen.«
Ich will Ruhe, dachte ich.
Aber ich war sechzehn Jahre alt, und ich spürte die Wärme dieses ebenfalls sechzehnjährigen Mädchens an meinem Rücken. Ja, ich war suizidal, aber auch neugierig. Ein Widerspruch in sich.
Das war es, was sie von nun an in mir auslösen würde: Ambivalenz. Gleichzeitig sterben und leben wollen. In diesem Moment wusste ich das natürlich noch nicht. In diesem Moment verstand ich nur, dass ich allein sein wollte und zugleich hoffte, sie würde bleiben.
Ich hatte bereits bei einigen Pflegefamilien gelebt, in denen mehrere Teenager untergebracht waren, schwierige, stille, fiese Teenager. Aber dieses Mädchen redete nicht wie ein Teenager. Jedes ihrer Worte strotzte nur so vor Selbstbewusstsein.
»Was für ein Plan?«, fragte ich.
»Hank hat ein altes Familienerbstück in seinem Aktenschrank – ein wirklich hässliches Medaillon. Wir werden es klauen.«
Ein Lachen brach aus mir hervor. Das Geräusch war mir so fremd geworden, dass ich zusammenzuckte und dabei den Joint fallen ließ. Er segelte in die Tiefe, und mein Herz setzte einen Schlag aus.
»S-Sorry.«
»Nicht entschuldigen«, erwiderte sie prompt, ohne sich nach mir umzudrehen, als hätte sie Augen im Hinterkopf.
Das war ihre erste Lektion für mich:
»Bedanke dich, wenn dir ein Fehler unterläuft, dann schiebe die Schuld von dir. So nimmst du den Leuten den Wind aus den Segeln und erniedrigst dich nicht vor ihnen.«
»Was?«
»Sag: ›Danke für den Joint, Seraphina. Es war mir eine Ehre, ihn mir mit dir zu teilen. Der Wind hat ihn davongetragen.‹«
Gegen meinen Willen verzogen sich meine Lippen zu einem Grinsen. »Danke, Seraphina.«
»Gerne, Zoe.«
Sie sprach meinen Namen seltsam aus, machte eine Pause zwischen dem O und E und betonte den letzten Buchstaben. Aus irgendeinem Grund bescherte es mir eine Gänsehaut, ihn aus ihrem Mund zu hören. Sie musste ihn von Hank und Margaret Sullivan erfahren haben – ihren, jetzt unseren Pflegeeltern, nach heute Nacht wieder nur ihren. Wahrscheinlich suchten sie schon nach mir. Um sechs sollten wir gemeinsam Abendessen, das hatte Margaret mir vorhin gesagt, als sie mir mein Zimmer gezeigt hatte, in dem ich mich auf der linken Seite einrichten durfte. Auf der rechten schlief Seraphina, hatte sie mir mitgeteilt, und für einen Augenblick hatte ich mich gefragt, wieso ihre Seite genauso kahl wie meine aussah, obwohl sie schon länger bei ihnen wohnte. Dann hatte mir Margaret die knochigen Hände auf die Schultern gelegt. »Wir sind jetzt eine Familie. Du kannst hier heilen, Zoe.« In ihren Augen hatten Tränen geglänzt, und ich hatte mich davon abhalten müssen, ihr ins Gesicht zu spucken.
Ah, ja, sie ist diese Art von Pflegemutter, war mir durch den Kopf geschossen. Das war die Sorte, die ich inzwischen anzog: diejenigen, die nach den verkorkstesten Fällen suchten, weil es ihnen einen Ego-Push verschaffte, sie zu retten.
»Auf Griechisch bedeutet Zoe Leben, wusstest du das? Es wäre also eine Schande, dich umzubringen. Zumindest bevor du mir bei meinem Plan geholfen hast.«
»Ich will mich nicht umbringen.« Die Worte kamen reflexartig. Es war nicht das erste Mal, dass ich sie aussprechen musste. Das wollten alle Leute hören, die es mit Menschen wie mir zu tun hatten: Es ist alles nicht so schlimm, keine Sorge. Ich wollte nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe es nicht ernst gemeint. Nicht wirklich.
»Du bist eine grauenhafte Lügnerin. Daran sollten wir arbeiten.«
Trotz meiner Neugier überrollte mich jetzt auch Wut. Warum redete sie im Plural von sich und mir? Wir kannten uns nicht. Und wir würden uns auch nicht kennenlernen – dafür würde ich gleich sorgen.
»Danke für dein Angebot«, erwiderte ich nüchtern. »Aber du musst dir jemand anderes suchen. Und jetzt solltest du das Dach verlassen.«
Im nächsten Moment löste sich ihr Rücken von meinem, und ich hörte, wie sie sich aufrichtete. Doch statt meinen Worten Folge zu leisten, kletterte sie ebenfalls übers Geländer und setzte sich neben mich auf den schmalen Vorsprung.
Mein Herz raste wieder los. Sie bewegte sich mit Leichtigkeit und viel zu schnell. Hatte sie keine Angst? Machte sie das nicht zum ersten Mal? War sie genauso lebensmüde wie ich?
Ihr Shirt rutschte hoch, als sie sich neben mich setzte, während sie sich an den Stäben festhielt, und entblößte einen Slip in der Farbe ihrer Stiefel. Ich schaute weg, streckte aber gleichzeitig eine Hand nach ihr aus, um sie zu stützen. Sie griff danach, umklammerte sie und ließ sie erst los, nachdem sie wenige Zentimeter neben mir saß und ihre Beine neben meinen in die Tiefe baumeln ließ.
»Geht’s noch?«, zischte ich.
Seraphina schenkte mir ein strahlendes Lächeln. Es verpasste mir einen Stich. Ihr Gesicht aus der Nähe zu betrachten, war ein Schock. Sie hatte dunkle Augen, die zu nah beieinander standen, eine Höckernase und eine dicke Oberlippe, die den Eindruck erweckte, dass sie unaufhörlich schmollte.
Ich hatte bisher hauptsächlich Zeit mit Jungs verbracht, sie gaben die besseren Verbündeten ab, wenn man an Orten aufwuchs, an denen man nicht sicher war. Sie betrachteten mich als eine von ihnen, während die Mädchen mich abstoßend fanden. Ich hatte kein Problem damit, zuzuschlagen, wenn jemand es wagte, mir zu nahe zu kommen. Das verschaffte mir Respekt bei den einen und Misstrauen bei den anderen. Ich war nicht direkt Furcht einflößend, aber man hielt gesunden Abstand zu mir. Außerdem sah ich nicht wie ein Mädchen aus. Ich hasste Make-up und Kleider. Ich versteckte den Ansatz meiner Brüste unter einem Sport-BH, der mir eine Nummer zu klein war. Ich trug nur Baggy-Klamotten. Und dann war da noch die Dunkelheit in meinem Kopf.
Jedenfalls war es schon lange nicht mehr vorgekommen, dass ein Mädchen freiwillig so lange mit mir sprach. Vor allem nicht so eines.
Sie war zu schön. Nein, das stimmte nicht. Sie verhielt sich nur so. Diese Selbstsicherheit von Mädchen in meinem Alter kannte ich sonst nur von den bildhübschen mit den perfekten Gesichtszügen und Körpern. Seraphina war nicht perfekt. Nichts an ihr passte zusammen, und trotzdem hatte noch nie etwas so viel Sinn für mich ergeben wie ihr Anblick.
»Wie oft?«, fragte sie, immer noch grinsend.
Ich konnte sie nur anstarren.
»Wie oft hast du’s schon versucht?«
Statt einer Antwort presste ich die Lippen zusammen. Wieso klang sie amüsiert?
Im nächsten Moment hatte sie meinen Unterarm gepackt und zog meinen Pulloverärmel hoch. Ich wollte mich losreißen, doch ihre abrupte Bewegung jagte die nächste Panikwelle durch meinen Körper. Wir saßen ungesichert auf einem Dach. Und so wenig mir diese Tatsache vor ihrer Ankunft etwas ausgemacht hatte, so sehr raste mein Puls jetzt.
Sekundenlang schauten wir beide auf meinen narbenübersäten Arm. Die Schnitte verliefen kreuz und quer, der größte – entlang der Pulsschlagader – leuchtete selbst in der Dämmerung scharlachrot.
Seraphina fuhr beinahe zärtlich darüber.
Ich schluckte hart. Die Berührung von Margaret hatte vorhin einen Würgereiz in mir ausgelöst, Seraphinas war das komplette Gegenteil. Sie berührte mich, und plötzlich fühlte ich mich vollkommen klar im Kopf. Vielleicht lag es am Schmerz, der nach wie vor unter dem Schnitt pochte. Ihr schwarzer Nagellack war abgesplittert und offenbarte den Schmutz unter den Nägeln. Ihre Hände waren größer als meine, die Finger lang.
»Ich finde, es gibt nichts Mutigeres, als seinem Leben ein Ende zu bereiten«, sagte sie, ohne von mir abzulassen. »Aber nur, wenn man es wirklich ernst meint.«
Mit diesen Worten zog sie ihre Hand zurück, griff blitzschnell hinter sich, hielt sich an den Gitterstäben fest und richtete sich auf.
Alles in mir zog sich zusammen.
Sie kickte sich einen der Cowboystiefel von den Füßen, und er fiel, fiel, fiel durch das Lichtermeer in die Tiefe, bis er aus unserem Sichtfeld verschwand. Ihr Kichern klingelte in meinen Ohren.
Dann folgte der nächste.
»Du entscheidest.« Ihre Füße steckten in löchrigen schwarzen Socken. Sie hob den linken an und ließ ihn in der Luft schweben. »Sag, du bringst dich nicht um, bis wir das Medaillon haben, oder ich lass los.«
Sie hatte den Verstand verloren.
»Das … ist Erpressung«, brachte ich hervor, während sich Übelkeit in mir ausbreitete.
Auf einmal beherrschte ein einziger Gedanke meine Sinne: Ich musste sie vom Dach runterbringen.
»Ich weiß.« Erneut lachte sie. »Also? Soll ich loslassen oder nicht?«
»Wehe, du lässt los.«
»Sicher?« Sie beugte sich ein Stück vor, und mein Magen schlug Saltos. »Bist du dir ganz sicher, Zoe?«
»Ich bin sicher!«, schrie ich.
»Wie sicher?« Auf einen Schlag war sie todernst. Ihr intensiver Blick durchbohrte mich erbarmungslos, jeglicher Schalk war aus ihren Zügen gewichen. »So sicher, dass du übers Geländer kletterst und zur Tür läufst?«
Ich dachte nicht mehr nach. Alles in mir verlangte danach, sie in Sicherheit zu bringen. Wie ferngesteuert richtete ich mich auf, packte die Gitterstäbe, drehte mich in Zeitlupe um und stieg über das Geländer zurück aufs Dach. Rückwärts lief ich zur Tür, ohne sie aus den Augen zu lassen.
Seraphina drehte sich ebenfalls um. »Gut.« Inzwischen lag ein grimmiger Ausdruck auf ihrem Gesicht. »Und jetzt schwöre es mir.«
In meinem Kopf herrschte nach wie vor absolute Stille. Ich öffnete den Mund und klappte ihn wieder zu.
»Schwöre mir, dass du es nicht mehr versuchst, bis ich mit dir fertig bin.«
»Ich schwöre es«, hörte ich mich sagen.
Ihr Grinsen war so schön, dass ich schreien wollte. Ihre Haare wurden vom Wind nach hinten geweht.
Sie kletterte ebenfalls übers Geländer und lief barfuß auf mich zu. Sie war zwei Köpfe kleiner als ich, um die 1,60. Ich war ihr körperlich eindeutig überlegen, dennoch hatte sie mich innerhalb weniger Sekunden außer Gefecht gesetzt. Mein Herz hörte nicht auf zu rasen.
Als sie nur noch eine Armlänge von mir entfernt war, überkam mich der Impuls, sie zu schlagen. Nicht nur eine Ohrfeige. Ich wollte meine Hände in ihren Haaren vergraben und daran zerren, bis ihr die Tränen kamen. Ich wollte auf ihr beschissenes Gesicht einhämmern, bis Blut floss. Ich wollte blaue Flecken auf ihrer Haut hinterlassen.
Doch bevor ich irgendetwas davon tun konnte, griff sie nach meiner Hand, verschränkte unsere Finger miteinander und öffnete die schwere Metalltür. »Komm, ich hab Hunger.«
Ich riss mich nicht los, sondern ließ mich widerstandslos von ihr ins Treppenhaus und zum Aufzug ziehen. Wir sprachen kein Wort. Seraphina hielt meine Hand fünfzehn Stockwerke lang fest umklammert, während mir Tränen über die Wangen strömten und mein hässliches Schluchzen den engen Raum füllte.
Wie überzeugt ich davon gewesen war, dass ich heute sterben würde. Ich hatte fünf Suizidversuche hinter mir, und dieser hätte mein letzter sein sollen. Stattdessen war ich einem Engel begegnet. Oder einem Teufel, so sicher war ich mir da nicht.
Nach diesem Tag versuchte ich nie wieder, mir das Leben zu nehmen.
2. Kapitel Zoe
Everybody knows that the boat is leaking
Zehn Jahre später, und ich war immer noch eine grauenhafte Lügnerin. Deshalb hatte ich mir angewöhnt, wenn möglich nur noch die Wahrheit zu sagen und Unbequemes auszulassen. Eine Taktik, die ich mir natürlich auch von Seraphina abgeguckt hatte.
Die Wahrheit: Ich hatte in den letzten Wochen die Handyaktivitäten von Noemi, Viktor und Fin getrackt.
Was ich ausgelassen hatte: Ich hatte sie schon lange, bevor sie einen Fuß auf die Diamond Empress gesetzt hatten, ausspioniert.
Die Wahrheit: Sera hatte den Alarm im Casino ausgelöst, der dazu führte, dass das Security Department das Bargeld der Passagiere in einen anderen Safe verlegte. Ohne es mit Ernie und mir abzusprechen.
Was ich ausgelassen hatte: Das war bei Weitem nicht das größte Geheimnis, das wir vor unseren drei – jetzt vier – Heist-Mitgliedern verborgen hatten.
Die Wahrheit: Ich fand es abscheulich, dass wir Fin trotz ihres Traumas dazu gezwungen hatten, mit einem Mann anzubandeln.
Was ich ausgelassen hatte: die Tatsache, dass Rafael Demir von Anfang an Teil des Plans gewesen war. Dass es keineswegs ein Zufall war, dass er sich auf diesem Schiff befand – oder im Architekturbüro gearbeitet hatte, das für das Innendesign verantwortlich gewesen war. Obwohl weder Ernie noch Seraphina oder ich damit gerechnet hätten, dass Fin und er … Tja, was waren Fin und er?
Egal. Eins nach dem anderen.
Mit zitternden Fingern gab ich den Code für den Notruf in mein Funkgerät ein. Es rauschte, dann ertönte ein leises Klicken.
»Cantellow hier«, rief ich. »Ich benötige dringend einen Notarzt in Crew Cabin 333. Wiederhole, dringender medizinischer Notfall in Crew Cabin 333!«
Es rauschte eine unerträglich lange Weile, dann ertönte eine tiefe Stimme: »Verstanden. Ein Notarzt ist unterwegs zur Kabine 333 und müsste in spätestens drei Minuten dort eintreffen. Bleiben Sie vor Ort und leisten Sie Erste Hilfe, bis das medizinische Team eintrifft.«
Ich bin nicht vor Ort!, wollte ich brüllen. Ich befinde mich am anderen Ende dieses gottverdammten Schiffs, weil ich für eine VIP-Begleitung eingeteilt bin!
Doch die Stimme fuhr bereits fort: »Können Sie den Zustand der Person näher beschreiben? Atmung? Blutung?«
Nein, kann ich nicht!
Fin hatte mich gerade eben angerufen. Ihre Worte waren keine Überraschung gewesen – sie hatte nach einem Notarzt in Ernests Kabine verlangt. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das passierte. Ernie hatte mich schon vor langer Zeit darauf vorbereitet; außerdem war er während unseres letzten Treffens vor wenigen Stunden in seiner Kabine völlig neben der Spur gewesen. Seraphinas Angst um ihn hatte mich fast dazu gebracht, meine Wut auf sie zu vergessen. Fast.
Was allerdings sehr wohl eine Überraschung war: dass sich ausgerechnet Fin bei ihm befand. Fin, die in den letzten Tagen richtig große Scheiße gebaut hatte. Fin, die ich nie allein mit Rafael in seiner Kabine hätte lassen dürfen.
Ich hatte immer angenommen, dieser Anruf würde von Seraphina kommen, und hatte mir mit Ernie schon eine Strategie überlegt, wie ich sie in dem Fall beruhigen würde. Vielleicht war es Glück im Unglück, dass mir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit blieb.
»Rufen Sie direkt in der Kabine an«, verlangte ich jetzt. »Die Person leidet unter Amyotropher Lateralsklerose und hatte bei unserer letzten Interaktion vor vier Stunden Sprachprobleme und Atemnot.«
Mit diesen Worten ließ ich das Funkgerät sinken und steckte es in meine Hosentasche.
Mir blieb noch knapp eine Stunde bis zu meinem Schichtende. Ich befand mich am Eingang des Meridian Room, einer kleinen Privatbar mit halbkreisförmigem Thekenbereich aus dunklem Holz, Ledersesseln und überdimensionalen Pendelleuchten.
Ich vergewisserte mich, dass der reiche Schnösel, für dessen Personenschutz ich heute gebucht worden war, ins Gespräch mit seinem noch reicheren Geschäftspartner vertieft war, zückte mein Handy und rief Fin zurück.
Es klingelte mehrmals, bis es in der Leitung klickte.
»Der Notarzt ist gleich da«, teilte ich ihr mit. »Das Telefon in seiner Kabine wird …«
»Er atmet nicht.«
Ich erstarrte. Das war nicht Fin.
»Wusstest du es?« Seraphinas Stimme klang unnatürlich hoch. In den zehn Jahren, in denen wir uns kannten, hatte ich sie noch nie die Fassung verlieren sehen, obwohl wir uns schon in den abgefucktesten Situationen befunden hatten. Doch jetzt schien ihre Selbstbeherrschung in Sekundenschnelle zu bröckeln.
»Wusstest du es, Zoe?«
Natürlich wusste ich es. Die Frage ist: Wie konntest du es übersehen?
Die Antwort darauf kannte ich bereits. Seraphina war eine Meisterlügnerin. Es war vermutlich unausweichlich gewesen, dass sie irgendwann damit anfing, auch sich selbst zu belügen.
»Nein«, sagte ich ruhig, obwohl mir klar war, dass es zwecklos war. Selbst wenn ich besser im Lügen gewesen wäre – diese Frau hätte ich bei einer direkten Konfrontation niemals täuschen können.
Scharf sog sie die Luft ein. »Das verzeihe ich dir nie.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, legte sie auf.
Ich hasste mich dafür, dass mir bei ihren Worten schlecht wurde. Denn was war mit all den Dingen, die ich ihr verziehen hatte? Was war mit ihren Lügen und bewussten Auslassungen?
Kopfschüttelnd steckte ich das Handy weg. Darum ging es jetzt nicht. Es ging um Ernests …
»Wichser!«
Mein Kopf ruckte nach links, wo mein Schützling gerade dabei war, sich abrupt von seinem Stuhl zu erheben. Sein Geschäftspartner tat es ihm gleich. Ihre Körper waren angespannt. Der Barkeeper im Hintergrund warf mir einen besorgten Blick zu. Sonst war kein Mensch in Reichweite – die beiden Männer hatten die Lounge für ein privates Businessgespräch gebucht. Ich nickte dem Barkeeper zu und setzte mich unauffällig in Bewegung.
Während der Typ, der mich gebucht hatte, klein und drahtig war, hatte die Gestalt seines Gegenübers Ähnlichkeit mit einem Schrank.
Letzterer ballte die Hände zu Fäusten. »Ich mach dich fertig«, hörte ich ihn über die sanften Pianoklänge, die aus den Lautsprechern drangen, hinweg zischen. Dann machte er Anstalten, um den Tisch herumzugehen.
»Hey!«, rief ich. »Treten Sie zurück.«
Der Kerl lockerte mit einer aggressiven Bewegung seine Krawatte, während sein Kopf kurz zu mir herumruckte. Wie ein lästiges Insekt sah er mich an, bevor er den anderen an den Schultern packte und zurückstieß.
Es war klar, dass er nur provozieren wollte. Und mein Schützling ging natürlich sofort darauf ein und stieß ihn ebenfalls zurück, sobald er sich gefangen hatte.
Gott, was für Kinder …
In Sekundenschnelle war ich bei ihnen und stellte mich zwischen sie. »Beruhigen Sie sich beide«, sagte ich sanft, obwohl ich sie am liebsten angeschrien hätte, ob sie wirklich nichts Besseres zu tun hatten, als mir ausgerechnet heute den letzten Nerv zu rauben.
»Für wen arbeitest du?«, fauchte der Kleine. »Für dieses Arschloch oder für mich?«
»Ich arbeite für Diamond Enterprise«, gab ich höflich zurück.
»Werden wir uns von einer Frau in die Schranken weisen lassen?«, klinkte sich der Breite mit einem süffisanten Grinsen ein.
Ausdruckslos sah ich ihn an. »Das ist meine letzte Aufforderung an Sie, Abstand zu halten.«
»Und wenn nicht?«
Ein kurzer Blick zu meinem Schützling verriet mir, dass er schon keinen Bock mehr auf die Auseinandersetzung hatte. Ungeduldig schaute er auf seine Armbanduhr.
Dafür hatte ich nun Feuer gefangen. »Dann werden Sie herausfinden, wie es sich anfühlt, von einer Frau in die Schranken gewiesen zu werden.«
Ein Glitzern trat in die Augen des Schrankes.
Grundsätzlich war es nicht Teil meines Jobs, Drohungen gegen Gäste auszusprechen. Ich war hier, um deeskalierend zu wirken und die allgemeine Sicherheit zu gewährleisten. Aber mein Geduldsfaden war überspannt. Die Sorge um Ernest und Seraphina heizte mich zusätzlich an. Und dann gab es noch einen weiteren verdammt guten Grund, den Mann zu provozieren.
Als er sich auf mich stürzte, war ich vorbereitet.
3. Kapitel Zoe
Everybody knows that the captain lied
»Wir werden das Medaillon noch heute Abend klauen«, teilte Seraphina mir damals mit.
Kurz bevor der Aufzug im richtigen Stock gehalten hatte, drehte sie sich zu mir und starrte mir erbarmungslos in die Augen. »Jetzt reicht es«, sagte sie und meinte damit offenbar meinen Zusammenbruch. »Die Tränen brauchst du noch für später.« Ihre Worte klangen kalt, doch sie strich währenddessen mit dem Daumen über meinen Handrücken, worauf meine Tränen sofort versiegten. »Nach dem Essen wirst du darauf bestehen, dich zurückzuziehen. Hank wird ein NFL-Spiel ansehen, Margaret Zeit mit dir verbringen wollen, aber du wirst ablehnen, egal, wie sehr sie versucht, dich davon zu überzeugen.«
Gesagt, getan. Nach dem Abendessen – es gab knusprigen Braten mit Schmorgemüse, ich schlug mir den Bauch voll, denn mein Lebenswille war zurück – verschwand Seraphina in unser Zimmer und Hank setzte sich aufs Sofa und schaltete den Fernseher an, während Margaret mir gegenüber am Küchentisch sitzen blieb.
»Wollen wir eine Spritztour machen, damit ich dir die Nachbarschaft zeigen kann?«, fragte sie mit einem warmen Lächeln.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin müde.«
Ihr Lächeln wurde breiter. »Es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wir können Dessert besorgen. Es gibt einen ganz wunderbaren Cherry Pie bei …«
»Nein, danke.«
Ihr Blick verhärtete sich, und sie stand abrupt auf. »Wie du möchtest.« Sie stellte sich an die Spüle und begann mit dem Abwasch. Als ich Anstalten machte, ihr dabei zu helfen, umschloss sie meinen Oberarm schraubstockfest mit einer Hand. »Du bist müde«, sagte sie beinahe höhnisch. »Geh auf dein Zimmer.«
Ich war zu abgelenkt vom Gedanken an Seraphina, die auf mich wartete, um mir den Kopf über Margarets plötzlichen Stimmungsumschwung zu zerbrechen.
»Danke für alles«, brachte ich noch hervor, doch sie wandte mir nur wortlos den Rücken zu. Hank brummte etwas Unverständliches, als ich an ihm vorbei in den Flur lief.
Sobald ich die Tür zu Seraphinas und meinem Zimmer öffnete, zog sie mich grinsend ins Innere.
»Na?«, wisperte sie. »Wie eingeschnappt war die gute Margaret?«
Ich zuckte nur mit den Schultern und wollte die Tür schließen, doch Seraphina schüttelte den Kopf und lehnte sie lediglich an. »Keine geschlossenen Türen. Da drehen sie richtig durch.«
Bevor ich nachhaken konnte, fuhr sie im Flüsterton fort:
»Der Aktenschrank befindet sich im Schlafzimmer der beiden. Du musst sie ablenken, während ich angeblich unter der Dusche bin.«
»Aber wieso sollte ich dann ablehnen, Zeit mit Margaret zu verbringen? Wäre es nicht das bessere Ablenkungsmanöver, wenn ich mit ihr rausgehe?«
Mit funkelnden Augen legte sie den Kopf schief. »Hank wirkt auf den ersten Blick vielleicht wie ein Typ, den nichts außer das Footballspiel juckt, aber er achtet auf jedes ungewöhnliche Geräusch in der Wohnung. Er würde sofort auf mich aufmerksam werden, wenn wir allein sind.«
»Na schön, und wie soll ich sie ablenken?«
»Was du im Aufzug gemacht hast, mach das noch mal«, sagte sie, als hätte ich ein besonderes Kunststück vorgeführt – nicht mir die Seele aus dem Leib geschluchzt.
Ich hob die Augenbrauen, widersprach aber nicht.
»Sobald du das Wasser im Bad hörst, legst du los. Es muss laut sein.«
Vergiss es, wollte ich sagen. Ich kann nicht heulen. Auf Knopfdruck wird das sowieso nichts. Das vorhin war eine absolute Ausnahme.
Doch Seraphina wartete meine Bestätigung nicht ab. Ohne ein weiteres Wort schob sie sich an mir vorbei und verließ das Zimmer. Dabei stieg mir ihr Duft in die Nase. Es roch nach verwelkten Rosen.
Wo war ich hier nur reingeraten?
Mir blieb nichts anderes übrig, als mich auf mein Bett zu setzen, die Augen zu schließen und mich mit aller Macht auf die Dunkelheit zu konzentrieren, die mich vorhin aufs Dach getrieben hatte. Meine Erfahrung in der letzten Pflegefamilie. Oder in der davor. Schreiende, rotzverschmierte Kleinkinder. Verzweiflung. Chaos. Bittere Kälte. Überforderung der Erwachsenen. Hilflosigkeit in jeder staubigen Wohnungsritze.
Nein, das würde nicht helfen. Alles, was ich empfand, war Leere. Die Trostlosigkeit würde mich garantiert nicht zum Heulen bringen.
Was war vorhin der Auslöser gewesen? Die Erleichterung darüber, dass Seraphina nicht gesprungen war?
Die Erleichterung darüber, dass sie mich davon abgehalten hatte?
Die Erleichterung darüber, dass es irgendjemanden interessierte, ob ich lebte oder nicht?
Wie kannst du es wagen?, schrie eine Stimme in meinem Hinterkopf, die verdächtig nach Moms klang. Wie konntest du uns auch nur eine Sekunde lang vergessen?, fügte Dad hinzu, leiser, aber genauso schmerzverzerrt.
Jetzt kannte ich die Antwort.
Meine Schuldgefühle. Sie waren der Auslöser gewesen.
Es gab zwei Sorten von Pflegekindern: diejenigen, die vor ihrem Eintritt ins Foster-System eine liebende Familie gehabt hatten, und diejenigen, denen das nie vergönnt gewesen war. Ich gehörte zu Ersteren – und wünschte mir immer öfter, zu Letzteren zu gehören. Die ersten zehn Jahre meines Lebens hatte ich nämlich ein Zuhause gehabt. Zwei Menschen, die mir Wärme und Sicherheit schenkten. Was bedeutete, ich erinnerte mich noch in allen Details daran, wie mein Leben gewesen war, bevor sie ins Gefängnis gekommen waren. Wäre es nicht einfacher gewesen, nie die Alternative gekannt zu haben? Nie an die Vergangenheit zurückdenken zu müssen und sich danach zu sehnen, die Zeit umkehren zu können?
Wie aus weiter Ferne drang das Geräusch von prasselndem Wasser an meine Ohren. Genau in dem Moment, in dem das heiße Nass auf meine Wangen traf.
Ich habe euch nicht vergessen!, schrie ich in Gedanken zurück. Ich wünschte, ich könnte es! Ich darf euch nicht sehen, nicht mal mit euch sprechen. Trotzdem sucht ihr mich jede Nacht heim. Ich kann das nicht mehr. Ich will nicht so leben. Wie kann man so leben? Wie haltet ihr es aus?
Es dauerte nicht lang, bis laute Schluchzer den Raum erfüllten. Sobald es begann, konnte ich nicht mehr aufhören. Ich wurde geschüttelt, während die Gesichter meiner Eltern gestochen scharf vor mir erschienen.
Wie viele Geheimnisse passten in ein Lächeln? Wie viele Lügen in einen Blick?
Hätten sie mich wenigstens vorgewarnt. Aber ich war ja nur ein unwissendes Kind gewesen. Ein Kind, das in einer einzigen Nacht gezwungen worden war, erwachsen zu werden.
»Und du?«, würde ich Seraphina später fragen. »Zu welcher Sorte Pflegekind gehörst du? Warst du schon immer allein auf dieser Welt?«
»Jeder Mensch ist allein«, würde sie antworten. »Wir werden allein geboren, und wir sterben allein. Alles dazwischen ist die Flucht vor dem Unausweichlichen.«
Meinen Fragen mit Plattitüden auszuweichen, war ihr Lieblingstrick. Damals verstand ich noch nicht, dass ich nicht auf ihre Worte achten musste, sondern auf ihre Hände. Seraphinas Hände verrieten sie. Während sich Gesicht und Stimme ihrem Willen beugten, schaffte sie es nie ganz, das Zittern ihrer Finger zu unterdrücken. Im Aufzug hätte es mir auffallen müssen. Als nicht nur meine Hände, sondern auch ihre bebten, und zwar nicht nur die eine Hand, die meine umklammert hielt. Doch damals war ich zu beschäftigt mit anderen Fragen gewesen, um auf die Nuancen zu achten.
Wie beispielsweise: Wieso gehorchte ich diesem fremden Mädchen, obwohl ich seit der Festnahme meiner Eltern keiner Menschenseele mehr gehorcht hatte?
Die Tür flog mit einem Quietschen auf, und Margaret stürzte herein. »Oh, du Armes!«
Mit zwei großen Schritten war sie bei mir, setzte sich neben mich aufs Bett und umarmte mich. Ich wollte sie wegstoßen und zum Teufel schicken, stattdessen heulte ich nur noch lauter. Je mehr Drama ich schob, desto mehr Zeit verschaffte ich Seraphina. Also versuchte ich, durch den Mund zu atmen, damit ich ihren seifigen Geruch nicht riechen musste, versuchte, nicht darauf zu achten, wie sich ihr kratziger Strickpullover an meinem Hals anfühlte, versuchte, ihre Stimme auszublenden, die mir beruhigende Worte ins Ohr murmelte. Denn es war mir egal, ob sie lieb oder manipulativ oder launisch war – sie war nicht meine Mutter. Das war der Grund, aus dem ich es nie länger als wenige Monate bei einer Pflegefamilie aushielt. Nicht, weil sie alle so schrecklich waren, sondern weil sie mich daran erinnerten, was ich für immer verloren hatte.
»Alles wird gut«, versicherte mir Margaret. »Lass es raus. Du bist hier sicher.«
Keine Ahnung, wie viel Zeit verging. Ich übergab mich der Finsternis, bis polternde Schritte aus dem Flur ertönten und schließlich ein Wutschrei.
Margaret ließ von mir ab und sprang auf. Ich folgte ihr und trat genau in dem Moment aus dem Zimmer, als Hank, die Hand in Seraphinas Haarschopf gekrallt, sie an uns vorbei ins Wohnzimmer zerrte.
»Du!«, blaffte er über seine Schulter. »Mitkommen.«
Bevor ich reagieren konnte, gab mir Margaret einen sanften Schubs von hinten, und ich stolperte ihnen hinterher.
Gewalt war mir nicht fremd. Es gab keinen gefährlicheren Ort für Frauen und Kinder als die eigenen vier Wände – dazu zählten selbstverständlich auch Pflegefamilien. Im Gegensatz zu anderen verlorenen Seelen, denen ich begegnet war, hatte ich jedoch größtenteils Glück gehabt. Bisher.
Nachdem ich das Wohnzimmer betreten hatte, schloss Margaret die Tür hinter mir. Wenige Sekunden später war zu hören, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel.
Was zur Hölle?
Doch mir blieb keine Gelegenheit, ihr Verhalten zu hinterfragen. Mein Fokus lag allein auf Seraphina, die gerade von Hank aufs Sofa gestoßen wurde. Eisige Kälte breitete sich in mir aus. Alarmglocken begannen in meinem Kopf zu schrillen. Sein schwerer Atem hallte in meinen Ohren wider.
Seraphina sah mich nicht an – ihr Blick war auf ihn gerichtet. Trotzig. Beinahe triumphierend. Sie richtete sich auf, strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr und schlug die Beine übereinander.
»Interception!«, plärrte der NFL-Kommentator aus dem Fernseher. »Das war eine riskante Entscheidung, und die Defense ist zur Stelle! Das könnte das Momentum ändern.«
»Sie hat nichts damit zu tun«, sagte Seraphina und klang beinahe gelangweilt.
»Halt den Rand!« Mit einer kontrollierten Bewegung, die kein bisschen dazu passte, wie rasend wütend er mir erschien, öffnete er seinen Ledergürtel und zog ihn aus den Schlaufen. »Zieh das Shirt aus.«
Mir wurde schlecht. Die Geräusche aus dem Fernseher schienen lauter zu werden. Publikumslärm, Stadionmusik, das Schiedsrichterpfeifen.
Seraphina legte den Kopf schief und grinste. »Mir ist kalt. Zoe, würdest du Tee aufsetzen gehen?«
Noch immer sah sie mich nicht an.
»Bleib, wo du bist«, zischte Hank mir zu, und zu ihr: »Ausziehen!«
Theatralisch verdrehte sie die Augen, dann schlüpfte sie aus ihrem T-Shirt, faltete es ordentlich und legte es neben sich aufs Sofa.
Ich wollte wegsehen, aber mein Blick haftete auf ihrem von Muttermalen übersäten Rücken, auf dem mehrere rote Striemen zu sehen waren. Kreuz und quer, wie die Narben auf meinen Unterarmen.
»Nein.«
Das Wort war mir entwischt, bevor ich darüber nachgedacht hatte. Meine Stimme war nicht besonders laut, aber fest. Weißes Rauschen in meinem Kopf.
Ich machte einen Schritt auf Hank zu, dann noch einen und noch einen, bis uns kein halber Meter mehr trennte.
Zum ersten Mal nahm er mich richtig ins Visier. »Du wirst zusehen. Und du wirst den Mund halten.«
»Nein«, wiederholte ich.
Sein Teint wurde dunkler. Drohend hob er die Hand, doch bevor sie mich erreichen konnte, bekam ich sie in der Luft zu fassen. Seit meine Eltern nicht mehr bei mir waren, hatte ich meinen Körper nicht mehr auf diese Weise eingesetzt. Wenn ich mich in den letzten Jahren zur Wehr gesetzt hatte, dann nur auf die rohe, direkte Art. Faust ins Gesicht. Tritt zwischen die Beine. Nicht auf die Art, die sie mir beigebracht hatten.
Und obwohl ich mir Mühe gegeben hatte zu vergessen, erinnerte sich mein Körper.
Blitzschnell drehte ich Hanks Hand nach unten und zwang ihn so in eine gebeugte Position. Ehe er die Chance hatte, darauf zu reagieren, rammte ich ihm mein Knie in den Bauch, und er ging mit einem Ächzen zu Boden, wobei ich ihm den Gürtel aus der anderen Hand zog.
Er versuchte, sich aufzurichten, aber schon beim Abendessen hatte er zwei Bier getrunken, und auf dem Wohnzimmertisch stand das dritte. Seine Reflexe waren verlangsamt.
Ich schlang den Gürtel wie ein Lasso um seinen Hals, zog ihn straff und hielt die Spannung.
Seine Augen traten leicht hervor. Die Wut in seinem Gesicht wich Entsetzen. Sein Röcheln erfüllte die Luft.
Adrenalin jagte durch meinen Körper. Margarets Stimme schien von allen Seiten auf mich zuzukommen: »Du bist hier sicher.«
»Wenn du sie noch einmal anrührst, mache ich dich kalt«, sagte ich. »Hast du verstanden?«
Keine Reaktion. Nur noch mehr Röcheln.
Ich übte mehr Druck auf seine Kehle aus. »Ob du verstanden hast?«
Mit sichtlicher Anstrengung rang er sich ein Nicken ab.
Noch ein paar Sekunden hielt ich ihn auf diese Weise gefangen, dann ließ ich von ihm ab, worauf er wie ein nasser Sack in sich zusammensank.
Ich schmiss ihm seinen Gürtel hin und wandte mich Seraphina zu. »Jetzt habe ich Lust auf eine Spritztour. Du auch?«
Mit einem breiten Grinsen nickte sie und tastete nach ihrem Shirt.
Fünf Minuten später hatten wir die Wohnung verlassen – mit Hanks Autoschlüssel in der Tasche. Eine halbe Stunde später heizten wir mit seinem Truck über die Shepard Road entlang des Mississippi Rivers. Ich saß am Steuer und konnte nicht aufhören zu lachen, Seraphina streckte ihren Kopf aus dem Beifahrerfenster und schrie »Wir sind am Leben!« in den Fahrtwind, während uns schon bald ein Hupkonzert verfolgte.
Drei Stunden später kehrten wir in die dunkle, stille Wohnung zurück und legten uns Schulter an Schulter in Seraphinas Bett. Kurz bevor ich einschlief, erklang ihre Stimme an meinem Ohr, kaum ein Hauchen: »Es gibt überhaupt kein Medaillon. Ich wollte dich nur vom Springen abhalten.«
Eine Woche später meldete ich mich bei einem Kampfsportstudio in der Nachbarschaft an und heulte vor Glück, als ich die erste Trainingssession seit Jahren hatte.
Einen Monat später kam es zur nächsten Eskalation mit Hank. Diesmal brach ich ihm fast den Kiefer, und er musste sich für eine Woche bei der Arbeit krankmelden.
Drei Monate später fragte ich mich zum ersten Mal, wie es sich anfühlen würde, meinen Mund auf Seraphinas zu pressen und nie wieder damit aufzuhören.
Fünf Monate später stellte sie mir Ernest und Gregori vor, und ich verstand, dass Familie nicht nur Blutsverwandtschaft bedeutete.
Sechs Monate später hatten die Sullivans genug von uns, und wir wurden in unterschiedliche Pflegefamilien gesteckt.
Sieben Monate später hatte ich einen Breakdown, nachdem ich eine Woche lang nichts von Seraphina gehört hatte, und lieferte mich selbst in eine psychiatrische Klinik ein, weil ich lernen wollte, auch ohne sie zu überleben.
Zwei Jahre später begann ich meine Ausbildung als Sicherheitsfachkraft in New York – der Stadt, in der die Frau meiner Träume gerade dabei war, die High Society zu infiltrieren. Ich musste lernen, wie ich sie noch besser beschützen konnte.
Zehn Jahre später würde ich ihr immer noch überallhin folgen. Selbst wenn sie mich geradewegs in den Abgrund führte.
4. Kapitel Seraphina
I run my life like a master, but when I love, I disaster
Das letzte Mal, dass ich derart die Kontrolle verloren hatte, war die Nacht gewesen, in der mein Vater abgeführt worden war. Aber damit war jetzt Schluss.
Das penetrante Klopfen an der Kabinentür war ein Weckruf.
Ich erhob mich und packte Rafaels Handgelenk, um ihn hochzuziehen. »Komm mit«, formte ich stumm mit den Lippen.
Sein Blick zuckte zu Josefin, die auf dem Boden neben ihm kauerte und sich das Kabinentelefon ans Ohr presste. Ich hatte nicht auf sein Klingeln reagiert. Ich wusste auch nicht, wie viel Zeit seitdem verstrichen war. Oder was Fin zum Notarzt gesagt hatte. Jegliche Geräusche schienen runtergedreht. Die Umgebung war wie weichgezeichnet.
Ich verstärkte meinen Griff um Rafaels Handgelenk. »Wenn sie uns hier alle zusammen sehen, sind wir erledigt«, zischte ich.
Das schien ihn aufzurütteln. Er erhob sich und folgte mir humpelnd ins Bad, während Josefin zur Kabinentür lief. Während ich die Badtür schloss, hörte ich, wie sie die Kabinentür öffnete.
Polternde Schritte. Routinierte Fragen. Etwas Schweres landete auf dem Boden.
Ich presste mich mit dem Rücken gegen die Tür, während mich der fast zwei Meter große, dunkelhaarige Mann mir gegenüber fassungslos anstarrte.
Es war nervtötend gewesen, ihm die letzten Wochen auf der Diamond Empress aus dem Weg zu gehen. Obwohl es über fünfzehn Jahre zurücklag, dass wir in Berlin in einer Schulklasse gewesen waren, war ich auf Nummer sicher gegangen. Rafael Demir war schon als Kind der perfekte Beobachter gewesen. Er merkte sich vermeintlich unwichtige Details, die anderen entgingen. In einem ersten Impuls hatte ich ihn damals, nachdem ich beschlossen hatte, dass er meine Aufmerksamkeit doch wert war, »Falke« getauft. Aber der Mimik-Oktopus passte deutlich besser zu ihm – es war eine Weiterentwicklung des Falken. Denn Rafael beobachtete andere Menschen nicht nur derart genau, um sie zu verstehen, wie sich später herausstellte, sondern auch um sich ihre Eigenschaften anzueignen und dann zu ihrem Spiegelbild zu werden. In vielerlei Hinsicht waren wir uns ähnlich. Nur dass er sich nicht bewusst war, was er da tat und weshalb.
Jedenfalls hatte ich recht behalten – ein Blick in mein Gesicht, und er hatte sich erinnert. Er hatte mich als Eleni bezeichnet. Das war der Name, unter dem ich damals bekannt gewesen war. Ursprünglich hatte ich mich ihm erst morgen in Oslo offenbaren wollen. Doch ursprünglich war es auch nicht Teil des Plans gewesen, dass Ernest erst das Bewusstsein und dann seinen Puls verlor. Oder dass er seine Krankheit vor mir geheim hielt.
Ich wusste nicht, was Rafael in dieser Kabine verloren hatte. Aber wenn ich hätte raten müssen, dann hätte meine Vermutung gelautet: weil er Josefin Korhonen mit Haut und Haar verfallen war.
So berechenbar. Alle miteinander.
Alle außer einer.
Ich griff an Rafael vorbei und öffnete die verspiegelte Tür des Badschranks. Hinter Rasierwasser, Ohropax, Zahnseide und Mundspülung fand ich zwei Medikamentendosen. Riluzol und Edaravone, las ich an den Etiketten ab. Beide verschreibungspflichtig für Ernest Ramon Ariel Walker-Petrakis ausgestellt.
Er litt unter dem Guillain-Barré-Syndrom – oder: hatte darunter gelitten –, deshalb hatte er mich damals weggegeben. Eine Erkrankung, die Muskelschwäche und Atemnot hervorrufen konnte. Ich war als Teenagerin Zeugin seiner Symptome gewesen. Doch nach jahrelanger Behandlung war die Krankheit abgeklungen und schließlich nie wieder aufgetreten. Das hatte er mir zumindest erzählt. Ich wusste alles über die Erkrankung. Kannte jede mögliche Behandlungsform. Jede Verlaufsoption. Und ich wusste auch, dass weder Riluzol noch Edaravone dabei eingesetzt wurden.
Was bedeutete, ich hatte einen absoluten Anfängerfehler begangen. Indem ich mich auf das Wort eines anderen Menschen verlassen hatte.
Ich schloss die Augen, während ich mich auf die Stimme hinter der Badtür konzentrierte.
»Ich intubiere. 7.5er Tubus. Laryngoskop, bitte.«
»Wer bist du wirklich?«, wisperte Rafael nach einer halben Ewigkeit, als weitere – undefinierbare – Geräusche aus der Kabine zu hören waren.
Statt einer Antwort legte ich nur meinen Zeigefinger an die Lippen.
Wer war ich wirklich?
Tja, das war die Millionenfrage. Die 33-Millionen-Frage, um genau zu sein.
Wer war Seraphina Leventis?
Eine Diebin. Eine Lügnerin. Die Freundin von Adrian Montparnasse. Ein Miststück. Eine Fantasie.
Wer war sie nicht?
Jemand, der man vertrauen sollte. Jemand, die vertraute. Jemand, die man lieben sollte. Jemand, die liebte. Jemand, die die Fassung verlor.
Wer war sie definitiv nicht?
Ihr Vater.
Ich bin schlimmer.Und ich werde sein Werk vollenden, wie es schon immer der Plan war.Scheiß auf dich, Ernie. Scheiß auf Zoe. Scheiß auf diese ganze Crew aus erbärmlichen, rührseligen Mitteln zum Zweck.
Denn das war alles, was sie jemals sein würden. Nicht nur sie. Jeder einzelne Mensch, der das Pech hatte, mit mir in Berührung zu kommen.
Die Kabinentür fiel zu, und Rafaels Mund klappte auf, doch ich war bereits herumgewirbelt und tastete nach dem Knauf.
»Wir reden in Oslo«, sagte ich zu ihm, ehe ich das Bad verließ.
Josefins Gesicht war kalkweiß. Ihre Haare klebten an den schweißnassen Schläfen, ihre Brust hob und senkte sich hektisch.
»Was haben sie gesagt?«, verlangte ich zu wissen.
»Die Herzdruckmassage und die Intubation waren erfolgreich. Sie … Sie bringen ihn auf die Krankenstation, wo er für den Transport vorbereitet wird. Es ist ein Helikopter unterwegs, der ihn ins nächste Krankenhaus in Oslo bringen soll.«
Erfolgreich.
Ich wollte ihr das Wort um die Ohren schlagen.
Wieso waren sie erfolgreich gewesen? Damit ich in ein paar Stunden, Tagen, Wochen, Monaten erneut die Fassung verlor, wenn er zu atmen aufhörte?
»Du wusstest von Ernests Krankheit«, stellte ich fest.
Ungläubig erwiderte sie meinen Blick. »Du nicht?«
In dem Moment kam Rafael aus dem Bad, und ich verlor sofort ihre Aufmerksamkeit.
»Kann mir endlich mal jemand sagen, was zum Teufel hier vor sich …«
Ich fixierte Josefin, beschwor sie, sich auf mich zu konzentrieren und nicht auf ihn zu achten. »Erzähl mir alles, was du weißt.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist nicht viel. Ernest … Er hat mit Viktor darüber geredet, und der hat es Noemi erzählt. Wir wissen nur, dass er seit Jahren unter Amyotropher Lateralsklerose leidet und …« Sie schluckte hörbar. »Und nicht mehr lange zu leben hat. Das waren seine Worte.« Ihre Augen wurden schmal. »Wie kannst du das nicht wissen? Ich dachte, er hat dich damals weggegeben, weil er krank …«
Den Rest hörte ich nicht. Bereits seit langer Zeit beherrschte ich die Kunst, nur das wahrzunehmen, was ich hören wollte. Eine Fähigkeit, die mir auch jetzt zugutekam. Hätte ich die Menschen in meinem Umfeld nicht von Zeit zu Zeit ausgeblendet, hätte ich längst einen Mord begangen. Es war bemerkenswert, wie viel unbrauchbaren Bullshit die meisten Leute tagtäglich von sich gaben. Ich brauchte Platz in meinem Kopf. Platz für die wirklich nützlichen Informationen, die ich über andere sammelte. Diesen schuf ich, indem ich den Rest ganz bewusst ignorierte. Josefins Überlegungen waren nicht nur überflüssig, sie lösten Wut in mir aus. Kein Gefühl, dem ich mich gerade stellen konnte. Um genau zu sein, gab es nur eines, was mir im Moment weiterhelfen würde. Was ich brauchte, war kühle Taubheit.
Also wandte ich mich ab und verließ Ernies Kabine. Nur ganz leise und gedämpft durch das weiße Rauschen drang mein alter Name an meine Ohren, bevor die Tür hinter mir zufiel.
»Eleni!«
Die Erinnerung kroch aus den Tiefen meines Gedächtnisses hervor, und ich hieß sie mit offenen Armen willkommen. Während ich den Crew-Bereich hinter mir ließ, kehrte ich willentlich in eine Zeit zurück, in der ich diesen Namen getragen hatte.
5. Kapitel Seraphina
Hand on the stove, I barely feel it
Mein Vater brachte mir bei, Menschen als Objekte zu betrachten.
»Du bist das Subjekt«, bläute er mir ein. »Du findest heraus, wie sie dir von Nutzen sein können, und dann bringst du sie dazu, es freiwillig zu tun.«
Sobald ich jemanden gefunden hatte, sollte ich mir ein passendes Tier aussuchen, um mir klarer vor Augen zu führen, welche Eigenschaften für mich brauchbar waren. Am Anfang war ich zu oberflächlich. Ich entschied mich zu früh für ein Tier, wartete nicht lang genug ab und übersah dadurch wichtige Charakterzüge.
Mein Vater brachte mir auch Geduld bei. Geduld war in seinen Augen die wichtigste Tugend. Dicht gefolgt von Gier. Gier ohne Geduld war ihm zufolge eine Todsünde, die Menschen wie uns nicht vergeben wurde.
Die Jagd nach Objekten war von diesem Moment an meine Priorität. Egal, in welcher Stadt wir sesshaft wurden, in was für einer Schule ich eingeschrieben war, in welchen Kreisen ich mich bewegte. Es war außerdem die beste Beschäftigung, Zeit totzuschlagen, bis mein Vater wieder auftauchte. Manchmal verschwand er nur für eine Nacht, manchmal für eine ganze Woche. Ich hasste diese Phasen, aber sie waren notwendig, das verstand ich. Immerhin war ich noch nicht bereit, um meinem Vater auf seinen Missionen zu helfen. Ich musste erst perfekt werden. Also übte ich.
Zuerst kategorisierte ich die Leute in meiner Umgebung in brauchbar und nutzlos. Mit Letzteren gab ich mich keine Sekunde länger als nötig ab. Das wäre Zeitverschwendung gewesen. Die Brauchbaren sezierte ich, bis ich ihren wunden Punkt fand. Mein Vater kaufte mir ein Notizbuch, in dem ich Charakterprofile erstellte. Ich durfte es nie mitnehmen, es blieb immer bei ihm, und er händigte es mir nur eine Stunde pro Tag aus. Doch das war nur für meine Probephase. Auf Dauer musste ich lernen, alles in meinem Gedächtnis abzuspeichern, denn das konnte mir niemand stehlen. Zum Glück war ich eine hervorragende Schülerin.
Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Barcelona waren wir gerade wieder nach Berlin, in meine Geburtsstadt, zurückgekehrt, als ich Rafael Demir kennenlernte. Wir waren beide zehn Jahre alt. Obwohl das Schuljahr bereits seit zwei Monaten lief, erklärte sich der Direktor dank der Überredungskünste meines Vaters bereit, mich die fünfte Klasse besuchen zu lassen. Ich hätte locker in die sechste oder sogar siebte gehen können – das Niveau an der Neuköllner Gesamtschule war unterirdisch –, aber je weniger ich für die Schule leisten musste, desto mehr konnte ich meinem Vater behilflich sein.
Nach einer lustlosen Vorstellung der Deutschlehrerin wurde ich neben Rafael in die letzte Reihe gesetzt.
»Eleni …«, flüsterte er. »Sprichst du Griechisch?«
»Ja«, gab ich in der Muttersprache meines Vaters zurück. Außerdem beherrschte ich Deutsch, Englisch und Spanisch fließend, konnte mich oberflächlich auf Französisch, Italienisch und Arabisch unterhalten und war gerade dabei, Chinesisch, Russisch und Gebärdensprache zu lernen. Wenn ich die Grundlagen draufhatte, würde ich mit Dialekten weitermachen, das war meinem Vater zufolge fast nützlicher, als die Basics einer Sprache zu kennen.
Seine Augen begannen zu glänzen. »Meine Eltern kommen aus Zypern.«
Ich verkniff mir ein »Glückwunsch, und das interessiert wen?« und lächelte ihn stattdessen an. »Cool.«
Der Unterricht begann, und wir wechselten kein Wort mehr. Doch ich spürte seinen Blick die ganze Stunde auf mir. Seinen verzweifelten, Einsamkeit schreienden Blick. Am Anfang dachte ich, er habe sich in mich verguckt, doch mit der Zeit wurde mir klar, dass ein viel grundlegenderes Verlangen darunter lag. Er wollte die Gesellschaft von jemandem, der ihn verstand. Von dem er sich gesehen fühlte. Was für ein Klischee.
Es dauerte fast einen Monat, bis ich Rafael in mein Notizbuch aufnahm, ein Charakterprofil über ihn erstellte und ihn einen Falken taufte. In diesen Wochen wurde mir bewusst, dass er zwar verzweifelt auf der Suche nach Freundschaften war, ihn das aber nicht unbrauchbar für mich machte. Erbärmlich, ja. Aber nicht unbrauchbar. Im Gegenteil.
Rafael war nicht der größte Loser der Klasse, und er gehörte definitiv nicht zu jenen, die den Ton angaben. Er war Teil der unsichtbaren Mitte zwischen beiden Extremen, und er nutzte seine Position. Ihm entging nichts. Wenn er einen Klassenraum betrat, schien er sich immer erst einen Überblick zu verschaffen. Über den Raum. Die Position der Stühle und Tische. Die Plakate an den Wänden. Bei den Fenstern verharrte er stets besonders lang, als würde er sich seine Flucht durch diese ausmalen. Und schließlich glitt sein Blick über die Anwesenden. Sorgfältig, aber nicht zu auffällig, musterte er sie, bevor er sich an seinen Platz setzte. Außerdem passte er sein Verhalten der Person an, mit der er sprach. Es war subtil, aber mir fiel es auf, weil ich das Gleiche tat. Zuerst nahm ich an, er wollte schlichtweg allen gefallen, doch es gab nur zwei Personen in der Klasse, bei denen seine Verzweiflung zum Vorschein kam – eine war ich, die andere ein schlaksiger Junge, der von allen gemobbt wurde, weil er schwul war. Obwohl weder er noch ich Rafaels Annäherungsversuche je erwiderten, hörte er nicht auf, uns mit dieser Sehnsucht im Gesicht anzustarren. Erst viel später begriff ich, dass es dabei nicht um ihn oder mich als Mensch ging, sondern darum, was wir für ihn repräsentierten. Ich seine Herkunft, das arme Schwein seine sexuelle Identität.
Doch Rafaels Anpassungsgabe hatte nichts damit zu tun. Sie schien ihm nicht einmal richtig bewusst zu sein. Was ihn besonders wertvoll für mich machte.
»Ich habe ein neues Objekt«, verkündete ich meinem Vater, als dieser mich überraschend von der Schule abholte, nachdem er sich zwei Tage und zwei Nächte lang nicht in unserer Ein-Zimmer-Wohnung hatte blicken lassen. Ich hatte bereits gelernt, dass es nichts brachte, beleidigt oder wütend auf ihn zu sein, wenn er mich ohne eine Erklärung allein ließ. Machte ich jetzt einen Aufstand, würde mir das lediglich kostbare Zeit mit ihm stehlen, das wusste ich aus Erfahrung. Ich fürchtete mich davor, dass er nächstes Mal länger wegbleiben würde, um mir eine Lektion zu erteilen.
Sein bärtiges Gesicht leuchtete auf. Die Wärme in seinen Augen war Entschuldigung genug für mich. »Das ist meine Seraphina.«
Eleni war nämlich nicht mein richtiger Name. Es war der Name, den meine Mutter mir gegeben hatte. Meine Mutter, die sich aus dem Staub gemacht hatte, kaum dass ich das Licht der Welt erblickte. Das glaubte ich zu jenem Zeitpunkt zumindest noch. Meine Mutter, die mir ihre Höckernase und dunkelgrünen Augen vererbt hatte, obwohl ich mir so sehr wünschte, meinem Vater ähnlicher zu sehen. Aber mein Aussehen verriet nichts über mein wahres Ich, das wusste ich in dem Alter schon. Es diente nur einem einzigen Zweck. Während die gleichaltrigen Mädchen sich sichtbar unwohl in ihrer Haut fühlten, zerbrach ich mir keine Sekunde lang den Kopf darüber, ob ich zu klein, zu dick, meine Haut zu unrein oder meine Kleidung nicht cool genug war. Alles, was zählte, war, ob ich die Persona, die mein Vater für mich festgelegt hatte, überzeugend genug verkörperte.
»Erzähl mir von deinem Objekt«, forderte er mich auf, während wir den Weg Richtung Körnerpark einschlugen. »Welche Rolle würde er in deinem Raubüberfall übernehmen?«
Mein Herz klopfte schneller. Ich hatte noch nie einen eigenen Raubüberfall planen, nicht einmal darüber fantasieren dürfen. Ich war zu jung, das hatte er wieder und wieder betont. Doch nun sah es danach aus, als hätte er endlich entschieden, dass ich bereit war. Denn das Sammeln von Objekten war nicht nur ein Zeitvertreib oder eine Simulation. Es war eine Vorbereitung auf meine glorreiche Zukunft. Eines Tages würde ich in seine Fußstapfen treten.
»Rafael Demir würde mir beim Beschaffen der Lagepläne behilflich sein«, verkündete ich feierlich.
6. Kapitel Seraphina
Say something so I don’t spiral
Mein Freund Adrian befand sich noch im Tiefschlaf, da war ich mir sicher, aber seine Schwester wachte jeden Morgen um fünf Uhr auf. Nach einem Grüntee und einer Million Supplements ging es los mit Pilates, Spinning oder Bahnen schwimmen – es kam ganz darauf an, welcher Wochentag war –, ehe sie ihre sportliche Betätigung mit einem Saunagang abrundete. Und das alles, noch bevor Normalsterbliche überhaupt ans Frühstück dachten. Besonders auf die Sauna schwor sie. Ein Tag, der nicht mit ausgiebigem Schwitzen begann, war ein verlorener für Celeste Montparnasse. Was wiederum bedeutete, dass ich ebenfalls zur absoluten Saunaliebhaberin geworden war, obwohl ich mir ungefähr hundert Dinge vorstellen konnte, die ich lieber tun würde, als mich morgens unerträglicher Hitze auszusetzen. Eine Ansicht, die ich mit Adrian gemein hatte, was er allerdings nie erfahren würde. Offiziell war es Celestes und mein gemeinsames Hobby. Denn es bedeutete regelmäßig ungestörte Zweisamkeit mit ihr.
Sobald ich die Suite betrat, die ich mir mit den Montparnasse-Geschwistern teilte, änderten sich meine Haltung und meine Mimik. Es kostete mich schon lange keine Anstrengung mehr. Ich hatte mich so sehr daran gewöhnt, meine Rolle in ihrer Nähe zu spielen, dass mir nicht mal die Ereignisse der vergangenen Nacht das Theater erschwerten. Und auch nicht die kurze Google-Recherche, die ich auf dem Weg hierher hinter mich gebracht hatte. Amyotrophe Lateralsklerose. Nicht das Guillain-Barré-Syndrom. Keine vorübergehende Autoimmunerkrankung, die sich in vielen Fällen wieder bessern konnte. Sondern eine kontinuierlich fortschreitende neurodegenerative Krankheit, bei der die motorischen Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark abstarben. Eine Krankheit, mit der man über Jahre kämpfte, bis sie einen früher oder später zu Fall brachte. Ernests Krankheit. Von der angeblich alle gewusst hatten. Außer die Person, die es von Anfang an hätte kapieren sollen.
Kaum dass die Tür hinter mir mit einem Klicken zugefallen war, hörte ich Schritte aus dem Nebenraum.
Die Suite strahlte pure Eleganz aus und war die teuerste Unterbringung, die man auf der Diamond Empress buchen konnte. Nur das Beste vom Besten für die Montparnasses und ihr Schoßhündchen. Ein Ensemble aus Weiß- und Silbertönen zog sich durch die zweistöckige Kabine, reflektiert von der weichen Beleuchtung, die in die Decke eingelassen war. Direkt neben der Eingangstür befand sich eine in die Wand integrierte Bar, bestückt mit edlen Kristallgläsern und einer Auswahl an erstklassigen Spirituosen. Die Front der Bar bestand aus schimmerndem Perlmutt, und die LED-Streifen darüber verliehen ihr einen futuristischen Glanz. Ich starrte darauf, bis Celeste in mein Blickfeld trat.
Sie trug einen weißen Bademantel, der den perfekten Kontrast zu ihrem scharf geschnittenen Bob bildete. Eigentlich war sie dunkelblond wie ihr Bruder, doch seit sich mit Anfang dreißig die ersten grauen Haare bei ihr bemerkbar gemacht hatten, färbte sie sie in einem kühlen Schwarz. Obwohl sie sogar noch kleiner als ich war, umgab sie eine Aura der Autorität. Alles an ihr war puppenhaft und süß, die Stupsnase, der Mund, ihre Hände und Füße, doch ihr eiskalter Blick machte klar, dass man es mit einem Menschen zu tun hatte, der über Leichen gehen würde, um sein Ziel zu erreichen. Früher war sie nie von den Männern der Familie ernst genommen worden, hatte sie mir erzählt, inzwischen nannten diese sie hinter ihrem Rücken »La Dragonne«. Auch Adrian verwendete diesen Spitznamen für sie, allerdings sagte er ihn ihr ins Gesicht, um sie zu provozieren. Dabei bereitete ihr das Genugtuung. Das erkannte ich genau. Celeste war eine Frau, die es perfektioniert hatte, das unschuldige Prinzesschen zu spielen, um zu bekommen, was sie wollte. Doch inzwischen hatte sie das nicht mehr nötig; stattdessen lechzte sie nach einer anderen Art von Anerkennung. Denn inzwischen war Adrians und ihr Vater dement und sie beide bekleideten Führungsposten im Familienimperium.
»Wo warst du?«, fragte sie mich mit zusammengezogenen Brauen.
»Ich konnte nicht schlafen«, erwiderte ich mit einem tiefen Seufzen. »Bist du schon in der Sauna gewesen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Begleite mich.«
»Nichts lieber als das.«
Zehn Minuten später hatte ich geduscht und saß neben ihr in der hölzernen Schwitzkabine.
»Wo warst du?«, fragte sie erneut, eine Spur genervt. Immer wenn sie ungeduldig wurde, verstärkte sich ihr französischer Akzent. Celeste hasste es, Englisch zu sprechen.
Wenn sie wüsste, dass wir uns problemlos auf Französisch unterhalten könnten …
»Im Botanischen Garten«, antwortete ich prompt. Ein zweites Mal würde ich ihr nicht ausweichen können, ohne dass sie misstrauisch wurde. »Der ist rund um die Uhr geöffnet, wusstest du das?«
Keine Antwort. Es interessierte sie auch nicht wirklich. Sie wollte nur sicherstellen, dass sie nicht die Kontrolle über ihr kleines Spielzeug verlor.
Unsere Blicke trafen sich.
Wenn wir nackt und mit glühenden Körpern hier saßen, fragte ich mich regelmäßig, wie sie mich nicht erkennen konnte. In meiner rohen, unverfälschten Form. Ohne Make-up, ohne Styling, das von meinem Gesicht ablenkte. Es hatte Rafael eine Sekunde gekostet, um sich an mich zu erinnern, obwohl er damals selbst noch ein Kind gewesen war. Celeste war Mitte dreißig gewesen, als sich unsere Wege gekreuzt hatten.
Aber natürlich erinnerte sie sich nicht an mich. Das lag bestimmt nicht nur daran, dass ich meine Haare zu der Zeit auf Anweisung meines Vaters schwarz gefärbt und dunkle Kontaktlinsen getragen hatte. Während sie für mich der Mensch war, der mein Leben in ein Vorher und in ein Nachher geteilt hatte, war ich wahrscheinlich nichts als ein lästiger Teenager für sie gewesen. Schließlich hatte sie damals hauptsächlich Augen für meinen Vater gehabt.
»Adrian ist nicht gut genug für dich.«
Schlagartig wurde ich aus meinen Gedanken gerissen.