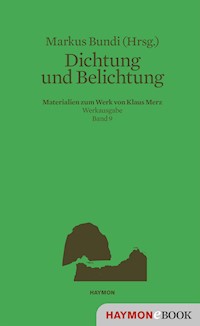
Dichtung und Belichtung E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klaus Merz – vierflüglig schillernd: eine Rezeptionsgeschichte Der Großmeister der leisen Töne erzeugt Widerhall Klaus Merz ist spätestens seit seinen beiden erfolgreichen Prosawerken Jakob schläft (1997) und Der Argentinier (2009) einer der bedeutendsten Schweizer Gegenwartsautoren. Sein Gesamtwerk – bestehend aus Prosa und Lyrik, Hörspielen und Theatertexten, Essays und Aphorismen – wäre aber nicht vollständig, fände nicht auch die rege Diskussion über seine literarischen Arbeiten darin Eingang. Dieser Band 9 der Werkausgabe widmet sich jenen Stimmen, die sich über alle Schaffensphasen des Autors hinweg, seit 1967, reflektiert mit seinen Texten auseinandersetzten: Der Merz-Kenner Markus Bundi hat hierfür über 80 Rezensionen, Laudationen und weitere Reaktionen aus nationalen und internationalen Medien gesammelt und zementiert damit die Bedeutung Klaus Merz' für die deutschsprachige Literaturlandschaft und -kritik. Wider der Etikettierung und Festschreibung – ein Zeugnis des Immer-wieder-Losschreibens Die zahlreichen Versuche und Bestrebungen einer komparatistischen Einbettung von Klaus Merz' Werken macht deutlich: Der Schriftsteller ist sich stets darin treu geblieben neue Wege zu finden, neues Licht auf Unsichtbares zu werfen. Und so wird er einmal als Lakoniker, einmal als poetischer Chronist besprochen, immer aber als ein Meister künstlerischer Leichtigkeit, der mit Worten – leise, dicht und präzise – von dem erzählt, was wartend, in schillerndster Pracht, bereits vor uns liegt. "Sucht man nach den literarischen Wurzeln von Klaus Merz, so wird man diese nur schwer in der Schweizer Literatur finden, sieht dieser hartnäckige Provinzler doch weit über den Schweizer Tellerrand hinaus." Peter Hamm (aus seiner Laudatio zum Rainer Malkowski-Preis 2016)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Bundi (Hrsg.)
Dichtung und Belichtung
Materialien zum Werk von Klaus Merz
Werkausgabe
Band 9
Zur Rezeptionsgeschichte von Klaus Merz’ Werk
«Vierflüglig, schillernd»
Markus Bundi
Nur was einem Widerstand leistet, trägt. Man wäre elend gefangen im Schlaraffenland, denn man ist frei nur im Umgang mit Gewichten, die die Freiheit kontrollieren.
Albrecht Fabri
«Hypothese: die Landschaftsstadt Aargau ist geradezu prädestiniert als Terrain für Modell-Bildungen. Das hat mit dem Selbstbewusstsein der Regionen zu tun, das auf der Verschiedenartigkeit ihrer Tradition beruht. Es hat mit der Machlust zu tun, gerade dort zu ‹bauen›, wo noch keine Vorverstädterung eingesetzt hat, wo noch ‹nichts› ist.» – Diese Annahme formulierte einst Hermann Burger, und zwar in einer von ihm konzipierten Sonderbeilage im Aargauer Tagblatt zum Schweizer Nationalfeiertag unter dem Titel «Literatur im Aargau 1986 – eine Dreisternliteratur». Und der damals verantwortliche Literaturredakteur Burger schloss seinen Aufsatz mit der Bemerkung: «Nein, die Literatur im Aargau braucht sich nicht zu verstecken vor den Aktivitäten in Zürich, Bern oder Basel. Aber es ist in dem Sinne keine ‹Aargauer Literatur›, als die Themen international, die Ausdrucksformen den modernen Strömungen verpflichtet sind. Die meisten in dieser Beilage vertretenen Autoren haben die Frage nach ihrer Beziehung zum Aargau damit beantwortet, dass sie in diesem Kanton aufgewachsen seien, dass hier ihre Landschaft der Kindheit läge.»
Annahme und Fazit des Textes meinen zunächst den Aufsatzschreibenden selbst; er konstatiert: «Die ‹Kirchberger Idyllen› und ‹Schilten› sind ohne das alte Pfarrhaus Kirchberg und das Schulhaus Schiltwald nicht denkbar.» Im Jahr zuvor, also 1985, wurde Hermann Burger von Marcel Reich-Ranicki und seinen Jurykollegen der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen, im Jahr darauf, 1987, wird er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Die Reihe jener elf Autorinnen und Autoren, die auf Burgers Einladung hin die 24-seitige Zeitungsbeilage mit Originaltexten bestücken, setzt ein mit Erika Burkart und Ernst Halter. An dritter Stelle folgt Klaus Merz mit der Erstveröffentlichung der Erzählung «Bacharach», die zwei Jahr später Eingang in den Band Tremolo Trümmer (1988) findet.
Obwohl der Redakteur in die Mitte seines Artikels eine Fotografie von Schloss Brunegg (damaliger Wohnsitz von Jean-Rudolphe von Salis, wo Hermann Burger seinerseits im Pförtnerhaus residierte) mit der Bildlegende «Selbstbewusstsein der Regionen» setzt, wird durch die Konzeption der Bundesfeier-Beilage einsichtig, dass sich das eigentliche Epizentrum dieser aufstrebenden Literatur im Freiamt auf einer Moräne befindet, im Haus Kapf, dem Wohnsitz von Erika Burkart und Ernst Halter in Althäusern, einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das den Äbten des Klosters Muri und ihrer Entourage einst als Sommerresidenz diente und im 20. Jahrhundert von den Eltern Erika Burkarts über Jahrzehnte hinweg als Gastwirtschaft betrieben wurde. «Der Kapf: Eine Beschwörungsvokabel für viele», hielt Verleger Egon Ammann im Band Das verborgene Haus (2008) fest, wohlwissend um die illustre Gästeschar, die in diesem Haus verkehrte – auch lange nachdem die Wirtschaft nicht mehr geführt wurde. Eindrückliche Zeugnisse davon, wer über die Jahrzehnte hinweg auf dem Kapf ein- und ausging, finden sich übrigens in Ernst Halters Erinnerungsbuch Alphabet der Gäste (2021). Es war der erste Zufluchtsort Hermann Burgers, der sich – nach Aussagen Erika Burkarts – zuweilen in ihrem Haus vor den Eltern verbarg, und es war auch die erste literarische Anlaufstelle von Klaus Merz und seinem jüngeren, früh verstorbenen Bruder Martin. 1967 öffnete Erika Burkart dem blutjungen Aspiranten die Tür zum St. Galler Tschudy-Verlag, wo ein erster Bogen mit Gedichten – Mit gesammelter Blindheit – des damals 22-jährigen Klaus Merz erschien (im selben Verlag debütierte Erika Burkart 1953 mit dem Bogen Der dunkle Vogel).
Dass allerdings Hermann Burger früh um die poetischen Fähigkeiten eines Bäckersohnes wusste und also zu einer so substanziellen wie auch emphatischen Besprechung von Merz’ Erstling im Aargauer Kurier anheben konnte, lag nicht so sehr in der Bekanntschaft vom Haus Kapf begründet, sondern war vielmehr der Tatsache geschuldet, dass beide denselben Weg zur großen Dichterin hatten, sprich im selben Dorf im Wynental aufgewachsen waren, in Menziken. Im Nachruf auf Burger schreibt Klaus Merz im Zürcher Tages-Anzeiger (3. März 1989): «Ich sehe Hermann Burger auf dem Rad balancieren, Schulhausplatz in Menziken, Mitte der fünfziger Jahre. Als drei Jahre Jüngerer stand ich ohne Velo im Tor und versuchte, die scharfen Bälle von Hermanns Vorderrad zu parieren. Dass Gleichgewicht ‹équilibre› heisst, wusste ich damals noch nicht, und Hermann freute sich über jedes erzielte Tor. An freien Mittwochnachmittagen stieg er nur vom Rad, wenn die Gebrüder Engesser mit ihrem roten Tretauto – kein Ferrari, ein Austin – auf den Schulhausplatz einbogen. Wir umstanden das zweisitzige Cabriolet mit den Ledersitzen, den leuchtenden Front- und Hecklichtern und beneideten die Besitzer des Wagens um ihr tröstendes Göttigeschenk, das ihnen der frühe Tod ihres Vaters eingebracht hatte. Eigentlich waren Hermanns Beine schon etwas zu lang, um im roten Austin eine Ehrenrunde zu drehen. Aber er achtete nicht auf das Gelächter seiner gleichaltrigen Klassenkameraden, die schon wieder auf ihren Drahteseln sassen und das unterbrochene Radballspiel fortsetzen wollten.»
Wer mit der Biografie von Hermann Burger vertraut ist, erkennt, wie viel Burger in diesen wenigen Merz-Zeilen steckt; wer ein wenig mit Klaus Merz’ Bibliografie bekannt ist, sieht sofort, dass der Nachrufschreiber sein eigenes Leitmotiv offenlegt: Balance. Die Schwerkraft im Gleichgewicht.
In einer Rezension zu Latentes Material (1978) schreibt Heinz F. Schafroth in der Weltwoche: «Seit 1967 publiziert der dreiunddreissigjährige Aargauer Klaus Merz Lyrik und Prosa. Die Rezensentenfunkstille, von der seine bisherige Arbeit weitgehend begleitet war, müsste angesichts der unter dem programmatischen Titel Latentes Material erschienenen Erzählungen nun unbedingt durchbrochen werden.» Ganz ungehört verhallte Schafroths Ruf nicht: Immerhin findet sich erstmals eine Besprechung in einem der großen deutschen Feuilletons (Hermann Kinder bespricht den Erzählungsband in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung), und Merz wird der Schweizer Schillerpreis verliehen.
Zwei Jahre zuvor hatte Merz die Bühne für sich entdeckt, feierte mit dem Zschokke-Kalender (UA Aarau 1976) einen Achtungserfolg. Dann das Großprojekt Danuser (UA Baden 1980), ein Freilichtspiel mit über 300 Darstellern; Zugluft – Türen schliessen automatisch, die Zusammenarbeit mit Urs Faes (UA Aarau 1982); schließlich Die Schonung, Merz’ «Moritat in sieben Gängen» (UA Zürich 1988). Alle Stücke wurden von der Presse mehr als wohlwollend, teilweise gar euphorisch aufgenommen, und dennoch gelangte kein Merz-Theater über die Landesgrenzen hinaus. Mitte der 1980er-Jahre avancierte der Autor zum Drehbuchschreiber und verfasste sieben Folgen der Schweizer Sitcom Motel – ein Fernsehereignis, das beste Quoten feierte und nicht zuletzt in der Boulevard-Zeitung Blick seinen Niederschlag fand.
Der große Erfolg indes ließ auf sich warten. Inzwischen sind sich alle einig: Da erschien 1997 dieser schmale Band mit dem merkwürdigen Untertitel «Eigentlich ein Roman», also Jakob schläft … und sein Autor schoss durch die Decke. Lobeshymnen, Preise, Übersetzungen. Alles davon mehr als zurecht, denn dieser Text gehört fraglos zum Besten, was Merz bislang geschrieben hat. Genau betrachtet begann die Erfolgsgeschichte aber ein wenig früher. Im Nachhinein zu behaupten, die Bedingungen eines Erfolgs lägen in der Kontinuität, weil eben erst Kontinuität so etwas wie Entwicklung und anhaltende Aufmerksamkeit ermöglichte, ist leicht. Doch die Behauptung stimmt, trifft, so glaube ich, im Fall von Klaus Merz gar exemplarisch zu.
Die ersten zehn Titel seines Œuvres erschienen zwischen 1967 und 1991 in sechs unterschiedlichen Verlagen, seit 1994 ist Klaus Merz beim Innsbrucker Verlag Haymon zuhause. Erst als Sachbuchverlag gegründet, startete Verleger Michael Forcher Ende der 1980er-Jahre ein belletristisches Programm, darin zum Beispiel die ersten Bücher von Raoul Schrott erschienen, worin aber auch bald Jürg Amann als Autor auftauchte, der wiederum seinen Kollegen Klaus Merz empfahl. Dass der Innsbrucker Verleger mit seinem jungen literarischen Programm große Ambitionen hatte, lässt sich an einer Einladung von 1994 ablesen: «Der Haymon-Verlag Innsbruck, die Österreichisch-Schweizerische Kulturgesellschaft, das Österreichische Generalkonsulat Zürich und das Schauspielhaus Zürich präsentieren die beiden soeben erschienenen Bücher der Schweizer Autoren Jürg Amann (Über die Jahre), Klaus Merz (Am Fuß des Kamels).» Dazu las Felix Mitterer am selben Abend des 12. März aus eigenen Werken und aus jenen von Norbert C. Kaser. Am unteren Ende der Einladung ist vermerkt: «Im Anschluß lädt Generalkonsul Dr. Aurel Saupe zu einem Glas österreichischen Wein.»
Es wurde angerichtet. Die Reaktionen auf den neuen Merz-Band waren ausnehmend positiv, so dass nicht nur Haymon nachlegte mit dem Band Kurze Durchsage (1995), einer Sammlung bereits publizierter kurzer Prosatexte und Gedichte, angereichert mit neuen, auch eine Jury im Schweizer Mittelland kam zu einem wegweisenden Entschluss und verlieh Klaus Merz 1996 – nach Monika Maron und Wilhelm Genazino als erstem Schweizer – den Solothurner Literaturpreis. Beides, Sammelband und Preis, schaffte erhöhte Aufmerksamkeit. Einerseits für das, was bisher geschah, denn Kurze Durchsage eröffnet einem breiteren Lesekreis den Einblick in ein schon zu diesem Zeitpunkt beachtliches Werk, und andererseits für das Kommende, denn mit der Verleihung des Solothurner Literaturpreises erhielt Klaus Merz so etwas wie den literarischen Ritterschlag und gehörte fortan zu den preiswürdigen Schriftstellern.
Eine Konstante währt indes schon ein wenig länger: Seit dem Band Bootsvermietung (1985) begleitet der Künstler Heinz Egger die Bücher von Klaus Merz mit seinen Zeichnungen, Pinselstrichen, Vignetten. Weniger illustrierend als vielmehr kongenial paraphrasierend sind Eggers Interventionen längst nicht mehr aus dem Merz’schen Werk wegzudenken.
Zwar taucht das Attribut des Lakonikers vereinzelt schon in früheren Besprechungen auf, doch dürfte Werner Morlang mit seinem Nachwort zu Kurze Durchsage den Ruf des Autors zementiert haben. «Klaus Merz oder Die Schule der Lakonie» lautet der Titel, mehr als ein halbes Dutzend mal findet sich das Wort im Text, so dass in der Folge – und bis heute – kein Laudator und kaum eine Rezensentin auf diesen Anker verzichten mag. Merz selbst verwendet den Begriff, wenn überhaupt, nur zögerlich, spricht zuweilen von «poetischer Lakonie»; sein eigenes Programm lautet ein wenig anders:
Der Ruf der Wörter,
ihn hören, ihm folgen, ihm misstrauen. Und immer wieder zu den Wurzeln der eigenen Sprachwelt zurückbuchstabieren. Die Betriebs-Sirenen überhören.
Seine kurzen Prosastücke und Gedichte möchten, wenn alles gut gehe, schmale, schräg aufragende Sprungbretter sein für Seele und Kopf, lüpfige Fragmente:
Kurz federn und aus der Schwerkraft ausklinken für eine Weile. Oder einbrechen durch die Folie, la folie des Alltäglichen. In Rätselhaft versetzt werden.
Am liebsten liesse er es manchmal beim blossen Titel bewenden, der den Text schon im Auge trage. Und behalte. Eine Poesie radikaler Einsilbigkeit und Latenz, minimer Verschiebung halt.
Sind aber der Leser, die Leserinnen einmal unterwegs und verhext, nehmen Text und Autor sich augenblicklich zurück. Falls sie nämlich nicht aufhören können, sich um ihre Kundschaft, ihre Kundschafterinnen zu kümmern, und zu notorischen Stewards des Absurden, freundlichen Hostessen des Phantastischen, zu reiseleitenden Bilder- und Bildungsathleten verkommen, büssen Abheben und Einbrechen, die Verzauberung ihre je eigenen Magnetfelder ein. Anstatt ein bisschen Wirklichkeit an sich heranzureissen, zwischen den Wörtern und Sätzen hervorzukitzeln, die es vorher nicht gab. – Ob ich jetzt verstehe, wie er es meine?
Dieser Text, kurz vor Veröffentlichung des Bandes Garn publiziert (Neue Zürcher Zeitung, 29. Januar 2000), bedarf keiner Interpretation. Er ist es schon. Die genannten Motive finden sich im Werk des Autors. Das Verborgene, das Zögerliche und Unscheinbare, sie gehören zum latenten Material, das Klaus Merz vorzugsweise bearbeitet, zur Sprache bringt. Der Text korrespondiert mit der Prosaminiatur «Fliegerin» (im Band Garn), die von Lieb Ellen berichtet, die darauf bestand, «ein Insekt zu sein, lebenslang». Und sie hob ab: «Vierflüglig, schillernd, da und dort kurz verharrend – in ihren Facettenaugen die vielfach gespiegelte Welt.» – Équilibre und Balance, wer könnte dafür besser stehen als eine Libelle? Kleinste Verschiebungen auszutarieren, das ist so mancher Figur in Merz’ Texten eingeschrieben, vorzugsweise auf engstem Raum: «‹Eine Aufzeichnung muss wenig genug sein, sonst ist sie keine›, sagt ausgerechnet Elias Canetti in seiner Fliegenpein. Ich versuche, mich – im Großen und Ganzen – daran zu halten», gibt Merz seinerseits zu Protokoll (im Magazin Wagner einmalig, No. 4, Innsbruck 2017).
«Dabei wirkte er bei genauerem Hinsehen wie ein Schlafwandler, der einem auf dem Brückengeländer in halsbrecherischer Balance entgegenkommt, und niemand wollte ihm seine Munterkeit so recht glauben», heißt es etwa von Kern in der Erzählung «Fast Nacht» (in Adams Kostüm, 2002), bevor er vom Hausarzt in die psychiatrische Klinik überwiesen wird. Oder denken wir an Thaler, den Protagonisten aus der Erzählung LOS (2005), der sich nach Auskunft seiner Frau «verwandert hat» – und in der Vorstellung des Erzählers endgültig das Gleichgewicht verliert.
Das Motto, das dieser Erzählung vorangestellt ist, es stammt von Walter Benjamin, dürfte programmatisch für Merz’ Prosa stehen: «Die Erzählung legt es nicht darauf an, das pure ‹an sich› der Sache zu überliefern wie eine Information oder ein Rapport. Sie senkt die Sache in das Leben des Berichtenden ein, um sie wieder aus ihm hervorzuholen. – So haftet an der Erzählung die Spur des Erzählenden wie die Spur der Töpferhand an der Tonschale.»
Im Windschatten von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt gingen einst Autoren in Stellung, die sich einer littérature engagée verpflichtet sahen, etwa Otto F. Walter, Paul Nizon, Hugo Loetscher, Adolf Muschg und Peter Bichsel. Die Gruppe Olten wurde 1971 gegründet (von 1995–1997 war Klaus Merz deren Präsident), die Solothurner Literaturtage aus der Taufe gehoben (1978). Der Schock saß tief, als die beiden Übermächtigen Anfang der 1990er-Jahre kurz nacheinander starben. Noch 1998, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, als die Schweiz Gastland war, titelte Andreas Isenschmid, der damalige Feuilleton-Chef der Weltwoche: «Ein totes Feld». Dabei hatte bereits Peter Weber mit seinem Wettermacher (1993) ein fulminantes Debüt gefeiert, Markus Werners Romane Bis bald (1992) und Festland (1996) standen hoch im Kurs, die Schweiz hatte mit dem Blütenstaubzimmer (1997) und Zoë Jenny ihr Fräuleinwunder, und Peter Stamm führte Agnes (1998) im Gepäck. Die Polemik des Literaturkritikers war gewiss mehr einer Stimmung als den tatsächlichen Verhältnissen geschuldet; Isenschmid selbst war es, der noch im Jahr zuvor eine Eloge auf Jakob schläft verfasst hatte.
Womöglich wusste man damals mit diesen Jungen literaturkritisch noch wenig anzufangen, ganz gewiss aber fehlte der Blick für jene mittlere Generation dazwischen. Und es fehlte wohl auch die Einsicht, dass die Ära der Autoritäten vorbei war und das politische Engagement allmählich erlahmte (2002 wurde die Gruppe Olten aufgelöst). Das war, so meine ich, in Deutschland nicht anders, der Statuswechsel der Schriftsteller setzte allerdings zeitverzögert ein, denn die Herren Grass, Enzensberger und Walser prägten die Feuilleton-Debatten noch bis vor wenigen Jahren. Diese Kanzel aber, sie ist inzwischen abgebaut worden. Der Blick auf die Literatur hat sich verschoben. An die vakante Stelle der Autoritäten sind Chronistinnen und Chronisten getreten, poetisch, tiefgründig und beschlagen – ganz im Sinne von Walter Benjamins Definition des Erzählers.
Ich spreche von der Generation heutiger Großmütter und Großväter, denke, was die Schweiz betrifft, zum Beispiel an den Band firma (2019) von Klaus Merz, einsetzend mit dem poetischen Zyklus «Aus der Firmengeschichte»: Lyrische und zugleich aphoristische «Denkwürdigkeiten», aneinandergereihte Medaillons, die dem Leser zu kleinen Spiegeln über eine Zeit von gut fünfzig Jahren (1968–2018) werden. Merz’ bekanntestes Buch Jakob schläft (1997) ist denn vor allen Dingen eine Familienchronik. Und da gibt es jenen frühen Band mit Erzählungen: Latentes Material (1978). Vielleicht ist dieser Titel das wegweisende Stichwort – als Ausgangspunkt dessen, was wir die letzten Jahrzehnte in den unterschiedlichsten literarischen Ausprägungen zu lesen fanden. Zum Beispiel in den Romanen von Urs Faes (*1947): Da wäre jenes dunkle Kapitel Schweizer Geschichte während des Zweiten Weltkriegs, das in Sommerwende (1989) aufgeschlagen wird, oder die Einblicke in ein Internat während der 1960er-Jahre, wohin Und Ruth (2001) entführt. Nicht minder eindrücklich: Die beiden groß angelegten Romantrilogien von Christian Haller (*1943), angefangen mit Die verschluckte Musik (2001) bis hin zu Flussabwärts gegen den Strom (2020).
Es gibt Zufälle. So zum Beispiel die Tatsache, dass Urs Faes, Christian Haller und Klaus Merz alle das Lehrerseminar in Wettingen besuchten. Weniger zufällig dürfte der hier skizzierte Wechsel von der Autorität zum Chronisten sein. Die Spur aufzunehmen wäre vielleicht mit Urwil (AG) (1975), dem ersten Roman von Ernst Halter (*1938), mit Schilten (1976), diesem hintertriebenen «Schulbericht zuhanden der Schulkonferenz» von Hermann Burger (1942–1989), oder mit den Reportagen von Niklaus Meienberg (1940–1993). Ohne Frage waren diese poetischen Chronisten nicht mehr genötigt, auf die großen Verheerungen des 20. Jahrhunderts im Reflex zu reagieren, wie es zur Stunde Null noch angezeigt war, und vielleicht sind sie deswegen zur Überzeugung gelangt, dass so etwas wie Deutungshoheit nur schwerlich in Anspruch zu nehmen ist. Gilt das für alle Alt-Achtundsechziger? Wohl kaum. Doch die Genannten sind alle Kinder des Kalten Krieges, und sie haben die Bilder der Mondlandung gesehen wie auch jene des Vietnamkriegs, sie haben den Fall der Berliner Mauer erlebt, 9/11 und das Platzen der Immobilienblase. Genügend Ereignisse also, um sicher zu wissen, dass Gewissheiten in dieser Welt keine zu erlangen sind.
Es ist nachgerade unmöglich, sich einen Überblick über die deutschsprachigen Neuerscheinungen des 21. Jahrhunderts zu verschaffen, allein schon die Titel, in denen eine Chronistenpflicht mitschwingt, sind ohne Zahl. Einige meiner Lieblingsbücher der letzten gut zwanzig Jahre: Matthias Polityckis Erzählung über Das Schweigen am anderen Ende des Rüssels (2001), Wolfgang Hermanns Gedichte Ins Tagesinnere (2002), Anna Mitgutschs Familienfest (2003), Sepp Malls Südtirol-Roman Wundränder (2004), Zsuzsanna Gahses Instabile Texte (2005), die Biografie Siebzehn Dinge (2006) von Eleonore Frey, das 800-Seiten-Epos Abendland (2007) von Michael Köhlmeier, Die Geschichten des Herrn Casparis (2008) von Iso Camartin, Martin Gülichs Roman Septemberleuchten (2009), Andreas Neesers Unsicherer Grund (2010), Der alte König in seinem Exil (2011) von Arno Geiger, Christoph Ransmayrs Atlas eines ängstlichen Mannes (2012), Urs Widmers Autobiografie Reise an den Rand des Universums (2013), Der Weg allen Fleisches (2014) von Hermann Kinder, Helmut Kraussers Roman Alles ist gut (2015), Walle Sayers Feinarbeiten zu Was in eine Streichholzschachtel paßte (2016), Die Jugend ist ein fremdes Land (2017) von Alain-Claude Sulzer, Michael Kleebergs Diwan Der Idiot des 21. Jahrhunderts (2018), die Miniaturessays Darf ich dir das Sie anbieten? (2019) von Katharina Hacker, Anne Webers Annette, ein Heldinnenepos (2020), Der Silberfuchs meiner Mutter (2021) von Alois Hotschnig, Judith Kuckarts Café der Unsichtbaren (2022).
Eine spontane Liste poetischer Chroniken, wie ich sie verstehe. Und würde ich sie an einem anderen Tag zusammenstellen, ich fände leicht für jedes Jahr einen anderen Titel. Was sie verbindet, ist so etwas wie Wahrhaftigkeit, der Drang zu beschreiben, zu schildern, wie es ist, wie es sein könnte, das Gegenstück zu «alternativen Fakten». Doch da ist kein allwissender Erzähler mehr. Oder in den Worten von Klaus Merz (Aargauer Zeitung, 9. Mai 1999): «Ich glaube nicht daran, dass man Endgültiges sagen kann. Es sind immer nur Erwägungen, Standpunkte, Entwürfe – es sind Fragen. Schon indem man ja genau beschreibt, wie es hier und heute ist, zeigt man bereits an, wie es anders sein könnte. Eigentlich interessiert es mich vor allem, Fragen zu stellen. Nicht aggressiv, sondern abwägend zu fragen, zu forschen: ‹Was wäre, wenn …?› – und hier setzt literarisches Schaffen unter anderem an. Ingeborg Bachmann sagte es einmal so: ‹Im Widerstreit des Möglichen mit dem Unmöglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten.›» – Flüssige Texte also, die sich beim Lesen zwischenzeitlich erhärten mögen, letztlich jedoch an keinem Ende festzurren lassen. Lauter Kleinigkeiten, die irgendwie ins große Ganze gehören, lauter Großartigkeiten, die jede und jeden kleinmachen. Oder wie Ian McEwan in Erkenntnis und Schönheit (2020) schreibt: «Im besten Fall ist Literatur universell und erhellt die menschliche Natur eben dort, wo sie regionaler und spezifischer kaum sein kann.»
Ich glaube, es ist vornehmlich diese literarische Form, die sich in den letzten fünfzig Jahren im deutschsprachigen Raum etabliert hat, inzwischen zu einem mächtigen Strom geworden ist (Nebenflüsse nie ausgeschlossen). Und zu diesen poetischen Chronisten gehört zweifellos Klaus Merz, seinerseits bekennend: «Vielleicht sind die grössten Sensationen in einem Menschenleben schlicht die Jahreszeiten, die immer wiederkehren, in all den Farben, in all der Pracht – stoisch. Es ist ein Grund, warum ich nicht am Äquator leben möchte, sondern lieber im Wynental. Im Grunde sind diese Ereignisse das Primäre, und wir alle schreiben letztlich Sekundärliteratur. Es ist heilsam, sich zuweilen unter den Schutz dieser Urschriften zu stellen.» (Aargauer Zeitung, 9. Mai 1999)
Der poetische Chronist. Ein neuerliches Etikett? – Das wäre ein Missverständnis. «Wenn ich zurückblicke … so hat mich immer das interessiert, was nicht auf Anhieb sichtbar ist. Darauf wollte ich Licht werfen lassen, dazu suchte ich Assoziationen. Es ging mir immer darum, eine eigene Gangart, neue Gänge und Wege zu finden. Insofern glaube ich, bin ich mir über die Jahre treu geblieben.» (Aargauer Zeitung, 13. Februar 2004) Blättert man etwas weiter zurück, so findet sich von Klaus Merz, noch bevor er eigene Prosatexte publizierte, eine Rezension zu Hans Erich Nossacks Bereitschaftsdienst. Bericht über eine Epidemie. Darin heißt es unter anderem: «Nossack lässt den Chronisten zeitlich Abstand nehmen; sein Bericht wird zu einem möglichst vollständigen und gelassenen Rückblick auf jene, unsere jetzige Zeit. Es wird alles angetippt, was uns bewegt, abstösst oder verwirrt: Mondflug und Jesus-Leute, Tiefkühlkost und Sexwelle, ‹Näher, mein Gott, zu dir› und die Internationale, Marxismus und das Leiden als absolute Privatsache. Es sind auf den ersten Blick flüchtige Bilanzen, die Nossack aus einer Anhäufung von Materialien unserer Zeit zieht, die aber gerade dadurch, dass er seine Einsichten als unverbindlich erklärt, für den Leser umso verbindlicher werden. Nossack will nie überzeugen, er ist einer von denen, die noch mit gekonntem Erzählen auskommen, um den Leser betroffen zu machen.» (Aargauer Tagblatt, 23. Februar 1974)
Je höher der Bekanntheitsgrad von Klaus Merz wurde, desto größer wurde von Seiten der Rezensentinnen und Rezensenten das Bedürfnis einer komparatistischen Einbettung. Häufig die Anlehnungsversuche an Robert Walser, gern wird auch Gerhard Meier herangezogen. Ich meine aber, Peter Hamm liegt in seiner Laudatio zum Rainer-Malkowski-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 2016 genau richtig: «Sucht man nach den literarischen Wurzeln von Klaus Merz, so wird man diese nur schwer in der Schweizer Literatur finden, sieht dieser hartnäckige Provinzler doch weit über den Schweizer Tellerrand hinaus.»
Uwe Kolbe erkennt in seiner Besprechung des Gedichts «Buchzeichen» (für die Frankfurter Anthologie) einen «ganzen Menschen»; es ist jener Mensch, der einst Mit gesammelter Blindheit als Dichter debütierte. Was doch alles geschehen kann, wenn man Merzluft atmet –
vierflüglig eben, und schillernd.
Frühe Wahrnehmung
1968–1993
Das Ungeschriebene schwingt mit
Mit gesammelter Blindheit (Gedichte, 1967)
Hermann Burger
Klaus Merz, geboren 1945 in Menziken, überschreibt seinen ersten Gedichtband, der vor einem Jahr im Tschudy-Verlag erschienen ist: «Mit gesammelter Blindheit». Dieser Titel ist kein blosser Blickfang, sondern eine Formel für das Wesen des Dichters. Was ihn blendet, das sind Äusserlichkeiten des Lebens, das ist das harte Licht des Tages.
Hofmannsthals «Ballade des äusseren Lebens» beginnt mit der unvergesslichen Strophe:
Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben
Und alle Menschen gehen ihre Wege.
Ein solches Kind, stelle ich mir vor, war Klaus Merz, verletzbar, bodenlos offen für das Tiefe. Das Sterben, von dem Hofmannsthal spricht, ist identisch mit dem Erblinden. Die Augen als Spiegel der Seele werden blind gegen aussen und öffnen sich nach innen. Zu hart getroffen vom Licht wenden sie sich der nebelhaften Dämmerung zu, in der die inneren Reichtümer verschleiert liegen.
Mit gesammelter Blindheit versucht der Dichter, sein Wesen zu entdecken, es sichtbar zu machen im Gedicht und dadurch der Finsternis und Einsamkeit zu entrinnen, der er als Geblendeter ausgesetzt ist. «Blind» heisst ursprünglich aber auch «leuchtend». Was er als Blinder visionär sieht, muss er zum Leuchten bringen.
Paul Klee hat das am einfachsten formuliert: «Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.» Im geglückten Gedicht erfüllt sich die Doppelbedeutung der Formel, die Klaus Merz gefunden hat: Der Blinde macht sein unsichtbares Wesen sichtbar. Nur erkennt man die Dichter nicht wie die Augenkranken an einer gelben Binde. Ihr Zeichen ist einzig und allein die Qualität, das Können.
Ich würde meinen, dass Klaus Merz in einigen Gedichten das erreicht, was den Dichter ausmacht: seine persönliche Sprache.
Es ist eine knappe Sprache, der man stellenweise anmerkt, dass sie durch die Schule Erika Burkarts gegangen ist. Aber Klaus Merz ist nicht in dieser Schule sitzengeblieben. Er hat allen Sprachballast, der oft junge Lyrik kennzeichnet, über Bord geworfen und setzt seine Zeichen mit grösster Sparsamkeit. Es ist die vertikale Sprache der Blinden, die auf wenigen Sprossen in die Tiefe klettern. Als Beispiel sei das Gedicht «Anfertigung eines Schmuckstückes» zitiert:
Nimm den Stein,
nimm das Auge.
Aus dem Stein
nimm die Gruft.
In die Gruft
leg das Auge.
Mit gesammelter Blindheit
schau, wie es schön ist:
In der Gruft dein Auge,
der gemeisselte Stein.
Bei diesem Gedicht habe ich immer den Eindruck, man müsse es aufhalten, es rolle davon, weil es kugelrund ist wie das Auge, das darin vorkommt. Das Gedicht ist, was es sagt; Form und Inhalt fallen zusammen. Es spricht vom Meisseln, vom Prozess des Entstehens, und ist selber abgerundet, die Kanten sind weggemeisselt.
Am Anfang stehen sich etwas Totes und etwas Lebendiges gegenüber: Auge und Stein, oder – wenn man es zurückübersetzen will – aus der Bildlichkeit ins Gedankliche: unbelebte Sprache und Erlebnis, vielleicht sogar Summe der Erlebnisse, das Wesen, symbolisch im Auge enthalten. Die Sprache birgt nun einen Hohlraum, in den der Dichter sein Wesen legt. Das ist entscheidend. Es heisst nämlich: Die Sprache, dieser riesige Berg, lässt sich nicht versetzen.
Der Dichter kann nicht eine neue Sprache auftürmen, die ja niemand verstehen würde, er kann nur in der alten Sprache graben, ihr neue Bedeutungen abgewinnen.
Dieser Hohlraum ist eine Gruft, eine Totenkammer, weil das Erlebte in der Sprache begraben wird. Erst der Leser erweckt es zu neuem Leben. Ohne Leser ist das Gedicht ein toter Gegenstand, wie das Schmuckstück, das nicht von einer Frau getragen wird, in der Schatulle erkaltet.
Um es aber zu beleben, muss man seine Schönheit und Echtheit erkennen. Das Organ dieses Erkennens sind die geschlossenen Augen. Mit gesammelter Blindheit schauen, heisst auch hier: das Innere erkennen, das kalte Leuchtfeuer im Edelstein. Denn das Ange, das lebendige Wesen, das am Anfang des Gedichts dem Stein gegenübersteht, wird am Schluss zum Stein, zum gemeisselten Stein. Das ist natürlich geformte Sprache.
Nur in der Form ist das Wesen mitteilbar. Ein Schmuckstück, ein kostbarer Ring, besteht aus Stein und Fassung. Ohne Stein ist die Fassung wertlos, ohne Fassung aber kann der Stein nicht getragen werden. So einfach und doch so richtig schreibt Klaus Merz über die Entstehung von Gedichten. In fünf kleinen Strophen werden fünf wichtige Sachverhalte und Schritte dokumentiert: der Dualismus von Wirklichkeit und Sprache, die Sprache als anziehender Hohlraum, das Begräbnis des Erlebten in der Sprache, das blinde Auge als inneres Erkenntnisorgan und schliesslich die wechselseitige Abhängigkeit von Form und Inhalt.
Ich habe absichtlich diese hässlichen, abstrakten Begriffe gewählt, um zu zeigen, wie gross der Schritt vom blossen Gedachten zum dichterischen Bild ist.
Dichterisch reden heisst: für alle Sinnesorgane erfahrbar machen, was die gewöhnliche Sprache nur dem Denken erschliesst. Der Dichter denkt nicht in erster Linie, er schaut.
Was zwischen meinen fünf Stichworten und dem Gedicht von Klaus Merz liegt, ist das dichterische Können, einen Stein in ein Schmuckstück zu fassen. –
Die von Klaus Merz bevorzugte Tageszeit ist der Abend, die Dämmerung seine liebste Stimmung. Auf der Scheide zwischen Tag und Nacht erfährt der Dichter seine Verletzbarkeit. Zwischen beiden Bereichen fühlt er sich hin- und hergerissen. Der Tag blendet, die Nacht ängstigt. Umnachtung wäre ein Grenzwort zu Nacht, Verflachung und Selbstverlust eine Gefahr des tätigen Daseins. Davon spricht das erste Gedicht des Bändchens «Siehe»:
Der Abend
hängt lau im Geäst.
Verletzbar
und weisser
erscheint jetzt die Taube.
Siehe,
ich grabe mich tiefer in Sand.
Unantastbar
will ich werden.
Manche sagen: Sterben.
Diese Taube, die am Abend reiner und weisser erscheint, steht symbolisch für das verletzbare Wesen des Dichters. Vielleicht steckt die alte Vorstellung der Seele dahinter, die Flügel hat. Man möchte sich nun an die Friedenstaube erinnern und sagen, die Abendstimmung sei harmonisch, der Dichter befinde sich im Einklang mit sich und der Welt.
Aber dieser Friede ist trügerisch. Schon Günter Grass hat in der «Blechtrommel» über die Taube gesagt: «Der Ausdruck Friedenstaube will mir nur als Paradox stimmen. Eher würde ich einem Habicht oder gar Aasgeier eine Friedensbotschaft anvertrauen als der Taube, der streitsüchtigsten Mieterin unter dem Himmel.» Es ist wahr. Wenn man den Tauben beim Körnerpicken zuschaut, wie sie einander überklettern und ins Gefieder hacken – sie machen ihrem Symbol keine Ehre.
Klaus Merz will aber gar nicht den Abendfrieden. Was in dieser Stimmung aus ihm heraustritt, ist nur scheinbar rein und weiss, im Grunde tückisch, gefährlich und dämonisch. Er gräbt sich in den Sand, um sich zu schützen, um unantastbar zu werden. Auch hier stossen wir wieder auf das Graben. Eine unterirdische Höhle wird geschaffen, vielleicht eine Gruft. Von aussen sieht es so aus, als stürbe er ab. In Wirklichkeit ist es Verpuppung, Verwandlung, die wichtigste Gabe des Dichters: die Fähigkeit zur Metamorphose. Das Motiv der Blindheit steht wiederum im Hintergrund. Einer, der den Kopf in den Sand steckt, ist blind für seine nächste Umgebung. Einer aber, der sich verwandelt, wird wach.
Er sieht im Dunkeln besser. Der Wunsch nach Unantastbarkeit ist nicht Flucht vor der Berührung, sondern Angst vor dem Zugriff, vor dem tötenden Zugriff, der die Verwandlung ausschliesst. Nach der letzten Zeile folgt noch etwas, etwas Ungeschriebenes, das aber mitschwingt: Einige wissen, nur so ist wirkliches Leben möglich.
Aargauer Kurier, 17. Juli 1968
Jeden falschen Laut vermeidend
vier vorwände ergeben kein haus (Gedichte, 1972)
Bruno Humm
Im vergangenen Herbst hat Merz – zum erstenmal bei Artemis – seinen dritten Lyrikband vorgelegt: ein schmales Heft von 45 Seiten, das Gedichte, Aphorismen und Sprachspielereien enthält. Sie sind in drei Blöcke von 9, 18 und wieder 9 Gedichten gruppiert. Diese äussere Symmetrie soll offensichtlich auf eine innere Ordnung, ein angestrebtes Gleichgewicht hinweisen: Ein Block von lyrischen Texten, der aufgespalten ist und Anfang und Ende des Bändchens bildet, umschliesst die Gruppe von Spruchgedichten und hält ihr – zumindest zahlenmässig – die Waage. Dass die eher leichtgewichtigen, spielerischen, zum Teil satirischen Texte im Zentrum stehen, ist wohl kein Zufall. Sie zeugen am deutlichsten dafür, dass Merz sich in seiner Arbeit – vielleicht müsste man richtiger sagen: durch seine Arbeit – sowohl sprachlich als auch thematisch weit von den ersten Veröffentlichungen entfernt hat. Wiederholt bringt er zum Ausdruck, dass er sich tiefes Misstrauen gegenüber «gehoben lyrischem Sprechen» erworben hat – am schroffsten im Gedicht mit dem geradezu programmatischen Titel «liquidation»:
noch pendeln
auf den balkonen
die winterhäute des vorjahres,
dein vergilbtes metaphernkleid.
zeit, es herunterzuhauen,
eh der erste schnee fällt,
der dir die alten taschen
wieder mit kälte füllt.
Das heisst nun nicht, dass Merz sich eine dichterisch bildliche Sprache ganz versagt. Aber er sucht sie nicht um jeden Preis, er prüft jedes Bild auf seine Gültigkeit und ist bestrebt, die Sprache von übernommenem, angelesenem Ballast zu befreien. Wo er dennoch «dunkelher preisend» zu raunen beginnt, verbirgt sich hinter solchen Tönen nicht selten bittere (Selbst-)Ironie. Offensichtlich will er nicht (mehr) in gehobener Literatursprache brillieren, sondern durch klare, direkte, immer primär funktionelle Alltagssprache überzeugen. Seine neuen Texte absorbieren umgangssprachliche Elemente; mundartliche Syntax und Wortwahl klingen da und dort an.
Realitätsnähe, nicht nur sprachlich, sondern auch thematisch, ist das Ziel. Die Kunst des Möglichen erhält den Vorzug vor klagend resignierendem Besingen des Unmöglichen. Wie intensiv – und nicht zuletzt rücksichtslos gegenüber sich selbst – dieses Ringen um das Mögliche, die Besinnung auf die eigenen Möglichkeiten sein kann, mag das Gedicht «tauwetter» demonstrieren:
apere stellen
tief hinein.
schichten blättern auf,
glitschiges altlaub,
aber nachts
friert der flüssige tag
wieder ein.
schlittschuhlaufen
auf dünnem eis,
keine pirouetten,
so virtuos warst du nie,
aber oft rückwärts
oder gleiten,
mondfahren vielleicht
und fliehen,
solange das eis
noch trägt.
Der Wunsch nach einer Flucht ins Uferlose, Regellose, in den Tod wird zwar nicht verleugnet, aber doch bedrängt von der Einsicht, dass Flucht letztlich nur AusFlucht und als solche unproduktiv bleibt; der Vorwand, hinter dem sich Angst vor dem Bemühen um «sauberes Gleiten», vor Rückschlägen verbirgt. Doch
vier vorwände
ergeben kein haus.
und tun als ob
da ein dach wär,
reicht nicht mehr aus.
Wer mit Vorwänden baut, tut sich schwer – er wird immer wieder im Leeren stehen. Entscheidend bleibt das Ringen nach festem Grund, um einen soliden Platz: in der Sprache, in der Gesellschaft, in der Realität.
Hier melden sich in Klaus Merz’ jüngsten Arbeiten neue Töne, bringen ein gewandeltes Selbstverständnis zum Ausdruck.
zögernd
singend
lachend
schreite ich
schreiend
meiner ersten
meiner letzten
verzückt
meiner grube entgegen.
Damit soll nicht auf einen qualitativen Unterschied hingewiesen werden – soll nicht der Ausdruck äusserster Verzweiflung an sich in Frage gestellt werden. Denn sicher ist es nicht bloss modische Pose, wenn in seinen frühen Texten das Thema Flucht dominiert. Aber offenbar hat Merz die Erfahrung gemacht, dass Angst vor der Realität, selbst wenn sprachliche Mittel sie zur Todessehnsucht stilisieren, letztlich eine Aus-Flucht bleibt; dass sich hinter verzweifelt herausgeschriebenem Weltschmerz nicht Selbstanklage, sondern Selbstmitleid verbirgt, das in fruchtlose Resignation, zum Verstummen führen muss. Der Weg aus resignierender Ich-Befangenheit führt für Merz über die Besinnung auf «Richtung» und «Auftrag»:
unterwegs
auf vollzug
und nachvollzug
blindlings
noch einmal
und immer.
auf meinem weg
das einwärtsaug sieht,
entziffert richtung
und auftrag.
unter dem schuh
die schöpferspur.
Wer weiss, dass «Vollzug und Nachvollzug» sich «noch einmal und immer» folgen können, folgen müssen, wer «Richtung und Auftrag» zu entziffern vermag, wer gar andeutet, dass er möglicherweise nur der Richtung einer «Schöpferspur» zu folgen hätte, der kann nicht (mehr) derselbe sein, der mit Hilfe der Sprache Selbstmorde einstudiert! Der hat nicht nur erfahren, dass es lohnend sein kann, seinen eigenen Platz zu suchen, er hat auch eingesehen, dass sein Platz nur einer unter vielen ist. Er hat entdeckt, dass sich ihm von hier aus ganz neue Perspektiven eröffnen, sofern er bereit ist, mit seinem «Einwärtsaug» auch in die Runde zu sehen.
Das zitierte Gedicht beschliesst den Band. Es darf durchaus als Rückblick, als Inhaltsangabe verstanden werden. Drückt es doch vollendet aus, dass es im Grunde eine Selbstbefreiung ist, die es Merz ermöglicht hat, sich aus einer sprachlichen und thematischen Verkrampfung zu lösen. Zweifel und Verzweiflung sind zwar nicht überwunden. Aber sie richten sich nicht mehr nur selbstzerfleischend auf das eigene Ich, sondern versuchen, auch die Umwelt kritisch zu bewältigen – zum Beispiel in den Gedichten «schicht», «wahlen» oder «verrufene landschaft». Am gelungensten, wie mir scheint, in «metamorphose»:
seit wir die wurzeln
verlieren,
wachsen uns
scheinbare flügel,
wächst auch
der eizahn mit,
der, was wir ausbrüten,
sprengt.
Diese Verse machen auch deutlich, wie sich Merz, jeden falschen Laut vermeidend und einzig dem richtigen Wort nachspürend, einer kargen, schmucklosen Sprache bedient. Wie sehr ihn der Umgang mit dem Material Sprache zu fesseln vermag, beweisen einzelne Sprüche, die in erster Linie Sprachspielereien sind. Gelegentlich versandet ihm zwar ein Einfall bei diesem Spiel, und man würde anstelle einer abgewandelten lieber die originale Redensart lesen:
echo
wie du auch
in den winterwald rufst,
verschneit
kommt’s zurück.
Oft aber gerinnt eine Redensart in der Umformung zu einer überraschenden, pointierten Aussage. Wie zum Beispiel
axiom
wer aus dem rahmen fällt,
ist nicht mehr im bild,
das man sich
von ihm gemacht hat.
Es drängt sich auf, das «axiom» auf Klaus Merz anzuwenden: denn sicher ist auch er mit seinen «vorwänden» aus einem alten Rahmen gefallen – ob ihm der neue aber nicht mindestens ebensogut steht?
Der bittere Geschmack von Ohrenschmalz
Obligatorische Übung (Geschichten, 1975)
Bruno Bolliger
Obligatorische Übung – ein Titel, der vorerst wohl nur einem Schweizer, und zwar einem wehrpflichtigen Schweizer, etwas zu sagen hat. Wir kennen unsere «Schiesspflicht», die meist an Sonntagen zu «erfüllen» ist. Von ihr ist denn auch in Merz’ Titelerzählung die Rede; nicht im Sinne einer beissenden Kritik an der nun einmal unverrückbar festgelegten Institution, sondern ganz anders: Klaus Merz ist ein Mensch von weichem, «lyrischem» Gemüt, stellt demgemäss dem harten obligatorischen Sport nichts anderes gegenüber als feinen Humor:
«Gut Schuss» zum Saustich, zur Standweihe, zum Vor- und Nach- und Endschiessen, «gut Schuss» stand auf dem Programm der Schützengesellschaft, das in jedem Briefkasten steckte. Die obligatorischen Übungen schwarz unterstrichen. Schiesspflichtige Jahrgänge 30 und Jüngere. Ein Befehl. Frisch geweisselt stand die Kirche mitten im Dorf. In der Nähe führte ein Bauer Jauche. Ernst merkte sich das unterste Datum auf dem Zettel. 20. August, letzte obligatorische Übung. Ein Sonntag.
Gegensätzliches wird zusammengeführt nach altem Humor-Rezept: die weisse Kirche mit der Jauche. Durch diesen Bild-Gegensatz wird der Leser unmerklich und doch zielbewusst auf den Gegensatz aufmerksam gemacht, auf den es dem Autor ankommt: Sonntag – Obligatorische Übung.
Obligatorisches und Sonntägliches sind für Klaus Merz unvereinbar. Man spürt bei ihm immer ein grosses Sehnen nach Freiheit. Es ist tatsächlich ein Sehnen nach, kein Kämpfen für. Merz ist eher ein Melancholiker als ein Revolutionär:
Er wollte nichts einbringen an diesem Tag, nur diese Bauchlage verlassen, das Hemd wechseln und eine Weile lang zu nichts verpflichtet sein.
Gibt es das überhaupt, den zu nichts verpflichteten Menschen? Merz drückt sich vorsichtig genug aus: «eine Weile lang». Er weiss um das Utopische der reinen Gegenwart. Dem Augenblick kommt keine Dauer zu.
Obligatorische Übungen sind Freiheitsbeschränkungen. Aber gerade in dieser Eigenschaft sind sie geeignet, im Menschen jene Sehnsucht nach Freiheit wachzurufen, die er sich in der Abnützung seines Alltags längst abgewöhnt hat. Solche obligatorische Übungen sind für Klaus Merz auch Besuche, für die man sich umziehen muss, Gäste, auf die man fast ängstlich wartet, Jahrgängerzusammenkünfte und all die üblichen Geselligkeiten im Umgang mit Menschen. Was den meisten Leuten offenbar Vergnügen macht, eben Geselligkeit, auch obligatorische, verfremdet Klaus Merz, und zwar mit Vorliebe durch das Mittel der peinlich genauen Wiedergabe von Sinneseindrücken. Schweissgeruch und der bittere Geschmack von Ohrenschmalz vom vergangenen Jahr am Gehörschutzpfropfen kennzeichnen die Atmosphäre an den obligatorischen Übungen im Schiessstand. Der Mensch scheint hier nur noch zu existieren, indem er erzwungenermassen etwas von sich absondert: Schweiss, Pulverdampf, Schüsse, Hülsen. Keine dieser Absonderungen untersteht dem freien Willen, auch das Schiessen selbst nicht; es ist ja «obligatorisch». Es ist paradox genug. Zur Verteidigung seiner Freiheit hat der Schweizer sich obligatorischen Übungen zu unterziehen. Auch hier liegt Grund genug für Melancholie. Das menschliche Wesen ist paradox.
Doch der hilflos auf dem Bauch liegende, hämischen Beobachtern ausgelieferte Obligatorisch-Schütze scheint schliesslich doch erlöst zu werden: Sein Blick fällt auf das Haus, das sein Eigentum ist, drüben am Hang, in der Sonne. Ein Symbol seines freien Willens? Jedenfalls hält der Schütze sich an ihm fest, bildet sich ein, er schiesse aus seiner eigenen Stube zurück in den Schiessstand. Ist dies eine bewusst-allegorische Darstellung der reichlich komplizierten Psychologie schweizerischen Wehrwillens? Oder ist es bloss ein überraschendspielerischer Umschlag der Geschichte ins Surreale? Mir scheint noch eine dritte Deutung erwägenswert: Klaus Merz zieht in seiner «Obligatorischen Übung» eine vorläufige Summe seiner eigenen Existenz. Als schöpferischer Mensch spürt er deutlich die Spannung zwischen Arbeitszwang und freier Tätigkeit. Der Mensch gibt vor, er arbeite bloss, um frei und immer freier zu werden, wie die obligatorischen Übungen im Schiessstand ja auch auf die Erhaltung der Freiheit unseres Landes hin angelegt sind. Aber die Arbeit, gemeint ist jetzt die obligatorische, nimmt den Menschen dann so sehr in Anspruch, dass er das angestrebte Ziel, nämlich Freiheit, beinahe aus den Augen verliert. Arbeit wird entfremdete Arbeit. Nur zu Zeiten, wenn zum Beispiel Obligatorisches auf einen Sonntag fällt, wenn der allzugut eingespielte Arbeits- und Freizeitrhythmus für einmal gestört wird, wird uns die Entfremdung bewusst. Klaus Merz jedenfalls hat einen Weg gefunden, die entfremdete Arbeit in sein Haus zurückzuholen. Die Schüsse aus der Stube, das sind doch wohl des Schriftstellers eigene Werke, seine Geschichten.
Nicht alle diese Schüsse gingen, wenn uns dieses Wortspiel erlaubt ist, ins Ziel. Aber drei, vier dieser Geschichten, gut die Hälfte der in dem schmalen Bändchen überhaupt enthaltenen, sind doch eigentliche «Schwarztreffer», so die hier etwas eingehender interpretierte Titelgeschichte, aber auch die Texte «Besuch», die Schulerinnerung «Ein Nachruf» und «Lutz». Wer nun aber «Umwerfendes» erwartet, vor allem vom Geschehen dieser Geschichten her, wird dem Bändchen kaum etwas abgewinnen können. Klaus Merz erfährt die Welt, und dies ist kein Tadel, auch wenn er erzählt, noch immer als Lyriker. Mitten im Verlauf der Erzählung erklingt immer wieder lyrische Sprachmusik:
Eine Schweizer Fahne hing schlaff an der Stange.
Oder:
Hinten am Waldrand über dem aufgeworfenen Graswall standen die Scheiben noch auf halbmast. Ein blendendes Schneeband. Seine Augen brannten, er nahm sie zurück in den Schatten des Standes …
Das ist lyrisches Parlando, und in alledem verspüren wir jenen Hauch von Melancholie, der für die Poesie des Aargaus charakteristisch ist.
So scheint es uns denn sehr sinnvoll, dass Klaus Merz’ Geschichten in einer Reihe «Junge Autoren bei Sauerländer» in Aarau erschienen sind. In sehr verdienstvoller Weise fördert hier der auf dem Gebiete der Kinder- und Jugendbücher längst weltbekannte Verlag junge aargauische Schriftsteller. Für Klaus Merz’ Geschichten hat sich das Wagnis des Verlegers sicher gelohnt.
«Heinrich, mir graut vor diesem Wetter»
Zschokke-Kalender (UA Aarau, 1976)
Ulrich Weber
Das rechte Stück zur rechten Zeit! Das Ensemble der Innerstadtbühne Aarau ist in den letzten Monaten bisweilen ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, was sogar im städtischen Parlament anlässlich der Budgetdebatte zum Ausdruck gekommen ist. Der Vorwurf lautete etwa, das Ensemble spiele am Aarauer Publikum vorbei, obwohl dieses Publikum nicht kleiner geworden, aber altersmässig vielleicht etwas anders strukturiert als früher ist. Und nun kommt dieses Ensemble und ruft einen Mann in Erinnerung, welcher wohl jedem Aarauer bekannt (aber nicht unbedingt näher vertraut) ist: Heinrich Zschokke (1771–1848)! Damit sind die älteren und eher historisch interessierten Aarauer zweifellos angesprochen, denn Zschokke verkörpert ein Stück «alt Aarau», auch wenn er, und das ist das Ironische, ein «Eingewanderter» und alles andere als ein konservativer Traditionalist ist. Heinrich Zschokke, Dichter, Schriftsteller, Redaktor, Schauspieleleve, Bühnenautor, Lehrer, Theologe, Forstspezialist, Politiker, ist in der Tat eine hochinteressante Persönlichkeit (das wurde schon bei Anton Krättlis Bearbeitung der «Abenteuer einer Neujahrsnacht» ersichtlich), dessen zündende Ideen, dessen missionarische Hartnäckigkeit das geistige Leben der Schweiz in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts entscheidend mitprägten, der Forderungen im Sinne der «Volksbefreiung» erhob, die bis heute ihre Aktualität nicht verloren haben.
Ein knappes Jahrhundert Schweizer Geschichte
Zusammen mit der Persönlichkeit Zschokkes wurde ein knappes Jahrhundert Geschichte, die Jahre 1798 bis 1894, skizzenhaft zur Darstellung gebracht. Einige wichtige Episoden aus Zschokkes Leben und aus seiner Zeit wurden herausgegriffen, etwa die Schaffung der Helvetischen Republik, der Marsch der Freiämter nach Aarau, der Kulturkampf mit der Klosteraufhebung, die Entstehung der Bundesverfassung, die Errichtung des Zschokke-Denkmals, die Begegnung Zschokkes mit Philipp Albert Stapfer, Heinrich von Kleist, J. Baptist von Tscharner. Dabei geht es nicht allein um die Profilierung dieses Zschokke, an den man sich von verschiedener Seite her herantastet (einige Szenen sind von anderer Warte aus gesetzt), sondern vielmehr um die Sichtbarmachung des Zeitgeistes und der sich über die Jahrzehnte wandelnden Ansichten. Im Brennpunkt steht also jene Epoche in der Schweizer Geschichte, in welcher der Aargau und die Aargauer führend und treibend an der Bildung unseres heutigen Staates beteiligt waren, der fortschrittliche Liberalismus, der dann mit der Schaffung und Enthüllung des Zschokke-Denkmals (1893/94) auf der Bühne symbolhaft eingefroren wird (eine deutliche Spitze gegen den heute gängigen «bequemen» Liberalismus).
Ein vergnüglicher Bilderbogen
Man hat für dieses Stück wiederum den Weg des Bilderbogens gewählt; über ein Dutzend Szenen werden herausgespielt; ein Weg, den die Innerstadtbühne und andere aargauische Kleintheater bereits verschiedentlich beschritten haben. Hier drängt er sich fast auf, denn eine lückenlose Präsentation dieser 100 Jahre Geschichte erscheint unmöglich; Zschokke selbst ist hier ja Vorbild, hat er doch bei seiner «Volksaufklärung» ebenfalls den Weg der Kurzinformation, der Skizzen, der Kalenderform, beschritten. Und wie Zschokke scheut man sich nicht, einen volkstümlichen Ton anzuschlagen, die Methode der vergnüglichen Belehrung anzuwenden. Gewiss, die Gefahr des Karikierens ist, allein schon von den Kostümen (etwa vom Schuhwerk!) und von den Bildern her gross, aber man darf der Inszenierung attestieren, dass aus Zschokke und seinen Zeitgenossen beileibe keine lächerlichen Figuren gemacht wurden.
Eine gelungene Vorlage …
Damit sind wir bei der Vorlage: Man darf dem Ensemble und Buchautor Klaus Merz zugestehen, dass sie eine schlechthin grossartige Leistung erbracht haben. Man weiss, dass sie zusammen über viele Monate eifrig Studien betrieben und sich anhand von Literatur und im Gespräch mit Historikern immer mehr an Zschokke und seine Zeit herangefühlt haben. Die Auswahl der Szenen erscheint geschickt, die dabei gefundene Ordnung, Systematik und Symmetrik verblüffend, der Text, die Dialoge sind wohlgesetzt und reich an Wortspielereien und hübschen Pointen; Zschokkes Frau sagt etwa bei einem Unwetter über der Blumenhalde: «Heinrich, mir graut vor … diesem Wetter.»
… und ausgezeichnete Schauspieler
Auch schauspielerisch werden, mit ganz wenigen Ausnahmen, Glanzleistungen vollbracht. Michael Maassen gibt die Rahmenfigur des «Schweizer Boten», dieses geistige Kind Zschokkes, mit seinem Schalk, seiner tölpelhaften Schüchternheit, überaus sympathisch (beispielsweise nur schon, wie er nach einer patriotischen Szene schlicht sagt: «Das war jetzt schön»). Maassen stellt auch den Zschokke dar, und er gibt ihn wohldosiert. Dort, wo er seinen patriarchalischen Stil, seinen missionarischen Eifer, chargieren könnte, hält er klug zurück; es ist ein Zschokke, dessen Grösse augenfällig wird, ohne dass auch seine Schwächen verdeckt bleiben. Auch die andern Darsteller, welche alle eine Vielzahl von Rollen zu bewältigen hatten, vollbringen Grosses: Starke Eindrücke hinterliessen Beatrix Köhler etwa als kichernde Madame Stapfer oder als schlichte Gattin Zschokkes, Hans Suter als Stapfer, als Kleist, als Freiämter Vitus, als Zschokkes Sohn oder als Bildhauer Lanz; Gustav Gisiger als Architekt oder als Leonz und Marianne Burg als von Tscharner. Gerade sie machte aber auch aus den winzigsten Rollen Perlen dieser Inszenierung, denken wir etwa an das Wein offerierende Dienstmädchen oder an das Zschokke-Baby. Peter Schweiger, der Spielleiter, setzt sich selbst weniger oft ein, überzeugte aber auch in seiner Rolle als Sepp; ihm ist ein besonderes Kränzchen für die Inszenierung zu winden. Das Kompliment ergeht letztlich aber an das gesamte Ensemble, welches auch massgeblich bei der Technik hinter der Bühne beteiligt war und ständig auf Trab gehalten wurde. Hier wurden sie von Esther Baier, der ersten Technikerin an der Innerstadtbühne Aarau, welche ebenfalls kurz auf der Bühne präsent war, hervorragend geführt.
Technisch hübsch gelöste Details
Die Inszenierung offenbarte, dass hier mit Liebe zum Detail grosse Arbeit bewältigt wurde, und man freute sich über einige herrliche Ideen: Etwa der Uhu, das sich wiegende Boot sowie der Holzfäller am Ufer bei der sonst etwas langfädigen Flussszene, die auf und ab schwebenden Wolken auf der Wasserfluh, die als Stabpuppen in Funktion tretenden Grossen und Kleinen Räte, die an Bügeln hängenden Kleider als Gesprächspartner bei einer Cocktailparty, die Pressenummer mit den Tiersymbolen, das «Bundeslied» mit der aufklappenden Schweizer Fahne usw. Auch die Kompositionen von Daniel Fueter und deren Interpretation verdienen hohes Lob und waren ebenfalls geeignet, die Atmosphäre der Zeit zu verdeutlichen. Die vielen andern helfenden und beratenden Kräfte können hier unmöglich alle aufgeführt werden (vielleicht noch Hans Gloor, Ausstattung), doch sollen sie in das Gesamtlob eingeschlossen werden.
«Eingewanderte» entfalten sich in Aarau
Man kann dieser Zschokke-Inszenierung auch einigen aktuell-symbolischen Gehalt zugestehen: Die Schauspieler sind ja, wie Zschokke und andere berühmte «Aarauer», in Aarau «Eingewanderte», der Zschokke-Darsteller sogar ein waschechter Preusse. Die Ensemble-Mitglieder sind also wie Zschokke Leute, die sich in ihrer Wahlheimat, in ihrer neuen, ihnen nicht immer freundlich gesinnten Umgebung zu entfalten suchen. Das Zschokke-Spiel wird damit gleichsam zur Geste des Ensembles gegenüber der Region Aarau, die man dankbar zur Kenntnis nimmt. Die Aarauer werden diese Inszenierung, welche die Aarauer und die Aargauer in ihrer Glanzzeit in Erinnerung ruft – der Premierenapplaus bewies es –, zweifellos mit Begeisterung aufnehmen. Wie wird man aber im übrigen Kanton darauf reagieren, etwa im Freiamt (im aargauischen «Vatikan»), das im Stück verschiedentlich als Gegenpol zu Aarau herausgeschält wird? Eine Aufführung in dieser Gegend könnte zeigen, wie brisant auch ein auf den ersten Blick historisches Stück heute noch sein kann, und es ist zu hoffen, dass das Ensemble, welches mit dieser Inszenierung der Gefahr der Isolation in Aarau zweifellos für eine Weile entronnen ist, nun nicht anderswo im Kanton in die Isolation gerät.
Noch ein beiläufiges Wort zum Schlussapplaus: Es ist schade und wirkt etwas peinlich, wenn die Schauspieler nach einer geschlossenen, stilvollen Aufführung beim Applaus förmlich auseinanderfallen und Leute, welche rund um das Stück bedeutende Aufgaben erfüllen, auf der Bühne völlig verloren wirken. Wäre es beispielsweise nicht möglich gewesen, dass die zwei weiblichen Darsteller den Buchautor im Saale geholt und auf der Bühne in ihre Mitte genommen hätten? Auch die Präsentation beim Applaus will geübt sein, denn sie stellt den Abschluss der gesamten Darbietung dar, die gerade, wenn sie wie hier so begeisternd wirkt, einen solchen Schönheitsfehler nicht verträgt.
Aargauer Tagblatt, 10. Januar 1976
Spielfiguren der Trauer
Latentes Material (Erzählungen, 1978)
Hermann Kinder
In zehn kurzen Geschichten erzählt Klaus Merz, mal in Er und mal in Ich, von Menschen, die aus der Selbstverständlichkeit gekippt sind: Ein Schuldiener schaut in die Wolken; ein Fotograf verliebt sich in das unentwickelte «latente Material» und vergräbt sich in seine «Gebärmutter Dunkelkammer»; einem Schriftsteller kommt vor leerem Papier die «künstliche Befruchtung» in den Sinn und vor Augen; ein Pfarrer erträgt seine routinierte Seelenbesprechung nicht länger. Geschichten über Melancholie, die auf Zehenspitzen daherkommen und schon wieder weg sind, bevor sie richtig angefangen haben. Die Handlung ist mehr ein Vorwand, um Bilder von Beschädigungen aufzureihen, von Einsamkeit, Lähmung, Fremdheit sich selbst gegenüber.
Klaus Merz ist 1945 geboren und Deutschlehrer im schweizerischen Aarau. Er hat bislang vor allem Gedichtbände publiziert. Und ganz besonders stark wird seine leise Prosa da, wo sie mit fast lyrischen Mitteln, mit Aussparung und suggestiver Beschreibung, Bilder der Ratlosigkeit malt: Wie jemand dasitzt, nicht weiter weiß, schaut. In solchen Passagen beeindruckt Merz damit, kluge psychologische Beobachtungen brillant anschaulich zu machen.
Dann aber verschwimmen die nur touchierten Lebensprobleme ins Vage, weil Merz prägnante Momente von Lebensläufen skizziert, die selbst er dem Leser vorenthält. Da ist die knappe Impression durch den Stoff überfordert. Merz spürt seinen sozial und intellektuell unterschiedlichen Figuren nicht nach, sondern verwendet sie als Spielfiguren seiner nachdenklichen Traurigkeit. Er erzählt nicht wirklich von den spezifischen Erlebnissen eines Pfarrers, eines Hausmeisters, einer Schwangeren, sondern demonstriert an ihnen eine unbestimmte Ratlosigkeit.
Der Autor weiß das; denn neben der Melancholie ist die Einbildung sein anderes Thema: «Manchmal habe er das Gefühl, von jemandem erzählen zu müssen, ohne daß er genau sagen könne, wo die Gründe dafür lägen … Vielleicht müsse er einen Menschen auf diese Weise loswerden, um sich wieder ungestört mit sich selber beschäftigen zu können.» Diesen Spielcharakter der Figuren betont Merz durch leitmotivische Hinweise auf die Übergänge zwischen Phantasie und Leben, vor allem durch etwas verkniffen aufgesetzte Rahmenkonstruktionen. Doch verbessert solch erzählerische Raffinesse die Texte nicht.
Ich wünschte mir, Merz würde seine faszinierende Fähigkeit, Selbstentfremdung bildhaft zu machen, entweder an einer eingehenderen Personenbeschreibung oder an Autobiographischem erproben. Wo er dies im Latenten Material ansatzweise tut (in der Titelgeschichte und der «Entstehung einer Tagebuchnotiz»), überzeugt er völlig. Wo er Fremd- und Selbstbeschreibung zu sehr verquirlt, wo zum Beispiel einer Schwangeren die Geschichte eines Literaten «angehängt» wird, geht dies auf Kosten des erzählten Falles wie der Authentizität der eigentlich gemeinten Selbsterfahrung. Und das ist schade, denn Klaus Merz ist ein sensibler, bildstarker und kluger Erzähler.
In der Dunkelkammer
Latentes Material (Erzählungen, 1978)
Heinz F. Schafroth
Seit 1967 publiziert der dreiunddreissigjährige Aargauer Klaus Merz Lyrik und Prosa. Die Rezensentenfunkstille, von der seine bisherige Arbeit weitgehend begleitet war, müsste angesichts der unter dem programmatischen Titel Latentes Material erschienenen Erzählungen nun unbedingt durchbrochen werden. Sie sind nicht nur erzählte Wirklichkeit, ihr Thema ist ebenso das Erzählen selbst.
Was diese Texte über die vielen handwerklich sauberen und geschickten Exemplare ihrer Gattung hinaushebt, ist zum einen die alles andere als platte, eindimensionale Wirklichkeitsvorstellung, die ihnen zu Grunde liegt, und zum andern die Fähigkeit des Autors, erzählend sein Metier und seine Rolle mitzubedenken.
Das Buch als Ganzes und die einzelnen Erzählungen sind als Dreischichtenliteratur zu charakterisieren. Eine erste Schicht dient der Protokollierung, Inventarisierung von Existenz, Umwelt, von Leben; in der zweiten geht es um die Frage, was an diesem Leben statt wirklich bloss dargestelltes (gespieltes, inszeniertes) Leben ist; und die dritte untersucht die Funktion des Schriftstellers sowohl dem Leben wie dem dargestellten Leben gegenüber, reflektiert sein Interesse an beidem und unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Folgen er seinerseits beides darstellt, wieweit aus dieser Darstellung, ungewollt oder beabsichtigt, eingestandenerweise oder nicht, eine (zulässige? unzulässige?) Selbstdarstellung wird.





























