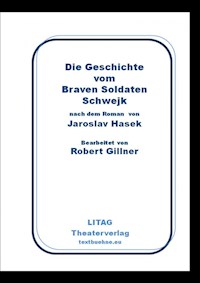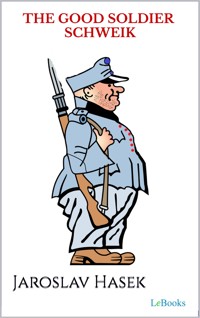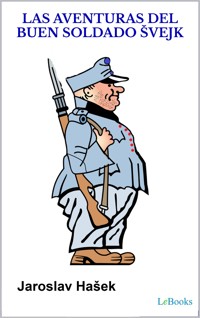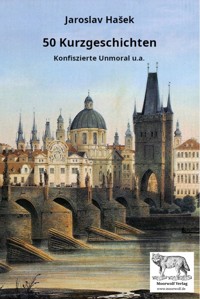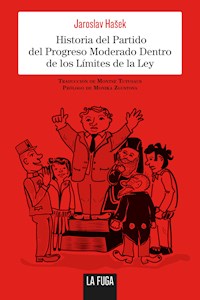Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jaroslav Hašeks Buch 'Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk' ist ein satirischer Roman, der während des Ersten Weltkriegs spielt. Schwejk, ein naiver und einfältiger Soldat, wird in absurde Situationen verwickelt, die die lächerliche Natur des Krieges und der Bürokratie beleuchten. Der scharfe Humor und die Ironie des Autors durchdringen das gesamte Werk und machen es zu einem klassischen Beispiel der tschechischen Literatur. Hašeks Buch fordert die traditionelle Vorstellung von Heldentum und Krieg auf herausfordernde und unterhaltsame Weise heraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1188
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
1. Das Eingreifen des braven Soldaten Schwejk in den Weltkrieg
»Also sie ham uns den Ferdinand erschlagen«, sagte die Bedienerin zu Herrn Schwejk, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war, und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, häßlichen, schlechtrassigen Scheusälern, ernährte, deren Stammbäume er fälschte.
Neben dieser Beschäftigung war er vom Rheumatismus heimgesucht und rieb sich gerade die Knie mit Opodeldok ein.
»Was für einen Ferdinand, Frau Müller?« fragte Schwejk, ohne aufzuhören, sich die Knie zu massieren. »Ich kenn zwei Ferdinande. Einen, der is Diener beim Drogisten Pruscha und hat dort mal aus Versehn eine Flasche mit irgendeiner Haartinktur ausgetrunken, und dann kenn ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt. Um beide is kein Schad.«
»Aber gnä' Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopischt, den dicken frommen.«
»Jesus Maria«, schrie Schwejk auf. »Das ist aber gelungen. Und wo is ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog?«
»In Sarajewo ham sie ihn mit einem Revolver niedergeschossen, gnä' Herr. Er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren.«
»Da schau her, im Automobil, Frau Müller, ja, so ein Herr kann sich das erlauben und denkt gar nicht dran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehn kann. Und noch dazu in Sarajewo, das is in Bosnien, Frau Müller. Das ham sicher die Türken gemacht. Wir hätten ihnen halt dieses Bosnien und Herzegowina nicht nehmen solln. No also, Frau Müller. Der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß. Hat er sich lang geplagt?«
»Der Herr Erzherzog war gleich weg, gnä' Herr, Sie wissen ja, so ein Revolver is kein Spaß. Unlängs hat auch ein Herr bei uns in Nusle mit einem Revolver gespielt und die ganze Familie erschossen, mitsamt dem Hausmeister, der nachschaun gekommen is, wer dort im dritten Stock schießt.«
»Mancher Revolver geht nicht los, Frau Müller, wenn Sie sich aufn Kopf stelln. Solche Systeme gibts viel. Aber auf den Herrn Erzherzog ham sie sich gewiß was Besseres gekauft, und ich möcht wetten, Frau Müller, daß sich der Mann, der das getan hat, dazu schön angezogen hat. Nämlich auf einen Herrn Erzherzog schießen, is eine sehr schwere Arbeit. Das is nicht so, wie wenn ein Wilddieb auf einen Förster schießt. Da handelt sichs darum, wie man an ihn herankommt, auf so einen Herrn kann man nicht in Hadern kommen. Da müssen Sie im Zylinder kommen, damit Sie nicht ein Polizist schon vorher abfaßt.«
»Es waren ihrer herich mehr, gnä' Herr.«
»No, das versteht sich doch von selbst, Frau Müller«, sagte Schwejk, seine Kniemassage beendend. »Wenn Sie einen Erzherzog oder den Kaiser erschlagen wollten, möchten Sie sich sicher auch mit jemandem beraten. Mehr Leute haben mehr Verstand. Der eine rät das, der andere wieder was anderes, und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wies in unserer Volkshymne heißt. Die Hauptsache is, den Moment abpassen, wenn so ein hoher Herr vorübergeht. Wie zum Beispiel, wenn Sie sich noch an den Herrn Luccheni erinnern, der was unsre selige Elisabeth mit der Feile erstochen hat. Er is mit ihr spazierengegangen. Dann traun Sie noch jemandem. Seit der Zeit geht keine Kaiserin mehr spazieren. Und dasselbe Schicksal wartet noch auf viele Leute. Sie wern sehn, Frau Müller, daß auch noch der Zar und die Zarin an die Reihe kommen und, was Gott verhüten mög, auch unser Kaiser, wenn sie schon mit seinem Onkel angefangen ham. Er hat viele Feinde, der alte Herr. Noch mehr als der Ferdinand. Wies da unlängs ein Herr im Wirtshaus gesagt hat, daß eine Zeit kommen wird, wo die Kaiser einer nach dem andern abdampfen wern und wo sie nicht einmal die Staatsanwaltschaft herausreißen wird. Dann hat er die Zeche nicht bezahlen können, und der Wirt hat ihn hopnehmen lassen müssen. Und er hat ihm eine Watsche hinuntergehaut und dem Wachmann zwei. Dann ham sie ihn in der Gemeindetruhe abgeführt, damit er zu sich kommt. Ja, Frau Müller, heutzutag geschehn Dinge! Das is wieder ein Verlust für Österreich. Wie ich noch beim Militär war, hat dort ein Infanterist einen Hauptmann erschossen. Er hat seine Flinte geladen und is in die Kanzlei gegangen. Dort hat man ihm gesagt, daß er dort nichts zu suchen hat, aber er is fort drauf bestanden, daß er mit dem Herrn Hauptmann sprechen muß. Der Hauptmann is hinausgegangen und hat ihm gleich einen Kasernarrest aufgebrummt. Er hat die Flinte genommen und hat ihn direkt ins Herz getroffen. Die Kugel is dem Herrn Hauptmann durch den Rücken hinausgefahren und hat noch in der Kanzlei Schaden angerichtet. Sie hat eine Flasche Tinte zerschlagen, und die hat die Amtsakten begossen.«
»Und was is mit dem Soldaten geschehn?« fragte nach einer Weile Frau Müller, während Schwejk sich ankleidete. »Er hat sich an den Hosenträgern aufgehängt«, sagte Schwejk, seinen harten Hut putzend. »Und die Hosenträger waren nicht mal sein. Die hat er sich vom Profosen ausgeborgt, weil ihm herich die Hosen rutschen. Hätt er warten solln, bis sie ihn erschießen? Das wissen Sie, Frau Müller, in so einer Situation geht einem der Kopf herum wie ein Mühlrad. Den Profosen haben sie dafür degradiert und ihm sechs Monate aufgepelzt. Aber er hat sie sich nicht abgesessen. Er is nach der Schweiz durchgebrannt und is dort heut Prediger in irgendeiner Kirchengemeinde. Heutzutage gibts wenig anständige Leute, Frau Müller. Ich stell mir halt vor, daß sich der Herr Erzherzog Ferdinand in Sarajewo auch in dem Mann getäuscht hat, der ihn erschossen hat. Er hat irgendeinen Herrn gesehn und sich gedacht: Das is sicher ein anständiger Mensch, wenn er mir ›Heil‹ zuruft. Und dabei knallt ihn der Herr nieder. Hat er nun einmal oder öfter geschossen?«
»Die Zeitungen schreiben, gnä' Herr, daß der Herr Erzherzog wie ein Sieb war. Er hat alle Patronen auf ihn verschossen.«
»Ja, das geht ungeheuer rasch, Frau Müller, furchtbar rasch. Ich möcht mir für so was einen Browning kaufen. Der schaut aus wie ein Spielzeug, aber Sie können damit in zwei Minuten zwanzig Erzherzöge niederschießen, magere oder dicke. Obgleich man, unter uns gesagt, Frau Müller, einen dicken Erzherzog besser trifft als einen magern. Erinnern Sie sich noch, wie sie damals in Portugal ihren König erschossen ham? Der war auch so dick. No selbstverständlich wird ein König nicht mager sein. – Also ich geh jetzt ins Wirtshaus ›Zum Kelch‹, und wenn jemand herkäm um den Rattler, auf den ich mir die Anzahlung genommen hab, dann sagen Sie ihm, daß ich ihn in meinem Hundezwinger am Land hab, daß ich ihm unlängs die Ohren kupiert hab und daß man ihn jetzt nicht transportieren kann, solang die Ohren nicht zuheiln, damit er sie sich nicht verkühlt. Den Schlüssel geben Sie zur Hausmeisterin.«
Im Wirtshaus »Zum Kelch« saß ein einsamer Gast. Es war der Zivilpolizist Bretschneider, der im Dienste der Staatspolizei stand. Der Wirt Palivec spülte die Tassen ab, und Bretschneider bemühte sich vergeblich, mit ihm ein ernstes Gespräch anzuknüpfen.
Palivec war als ordinärer Mensch bekannt, jedes zweite Wort von ihm war Dreck oder Hinterer. Dabei war er aber belesen und verwies jedermann darauf, was Victor Hugo in seiner Schilderung der Antwort der alten Garde Napoleons an die Engländer in der Schlacht von Waterloo über dieses Thema schreibt.
»Einen feinen Sommer ham wir«, knüpfte Bretschneider sein ernstes Gespräch an.
»Steht alles für einen Dreck«, antwortete Palivec, die Tassen in den Speiseschrank einordnend.
»Die haben uns in Sarajewo was Schönes eingebrockt«, ließ sich mit schwacher Hoffnung wieder Bretschneider vernehmen.
»In welchem Sarajewo?« fragte Palivec. »In der Nusler Weinstube? Dort rauft man sich ja jeden Tag. Sie wissen ja, Nusle!«
»Im bosnischen Sarajewo, Herr Wirt. Man hat dort den Herrn Erzherzog Ferdinand erschossen. Was sagen Sie dazu?«
»Ich misch mich in solche Sachen nicht hinein. Damit kann mich jeder im Arsch lecken«, antwortete höflich Herr Palivec und zündete sich seine Pfeife an. »Sich heutzutage in so was hineinmischen, das kann jeden den Kopf kosten. Ich bin Gewerbetreibender, wenn jemand kommt und sich ein Bier bestellt, schenk ichs ihm ein. Aber so ein Sarajewo, Politik oder der selige Erzherzog, das is nix für uns. Draus schaut nix heraus als Pankrác.«
Bretschneider verstummte und blickte enttäuscht in der leeren Gaststube umher.
»Da ist mal ein Bild vom Kaiser gehangen«, ließ er sich nach einer Weile von neuem vernehmen. »Gerade dort, wo jetzt der Spiegel hängt.«
»Ja, da ham Sie recht«, antwortete Herr Palivec. »Er is dort gehangen, und die Fliegen ham auf ihn geschissen, so hab ich ihn auf den Boden gegeben. Sie wissen ja, jemand könnt sich irgendeine Bemerkung erlauben, und man könnt davon noch Unannehmlichkeiten haben. Hab ich das nötig?«
»In Sarajewo hat es aber bös aussehn müssen, Herr Wirt.«
Auf diese heimtückische direkte Frage antwortete Herr Palivec ungewöhnlich vorsichtig:
»Um diese Zeit is es in Bosnien verflucht heiß. Wie ich gedient hab, mußten wir unserm Oberlajtnant Eis aufn Kopf geben.«
»Bei welchem Regiment haben Sie gedient, Herr Wirt?«
»An solche Kleinigkeiten erinner ich mich nicht, ich hab mich nie um so einen Dreck gekümmert und war auch nie drauf neugierig«, antwortete Herr Palivec, »allzu große Neugier schadet.«
Der Zivilpolizist Bretschneider verstummte endgültig, und sein betrübter Ausdruck heiterte sich erst bei der Ankunft Schwejks auf, der bei seinem Eintritt in das Wirtshaus ein schwarzes Bier mit folgender Bemerkung bestellte:
»In Wien ham sie heut auch Trauer.«
Bretschneiders Augen leuchteten voller Hoffnung auf. Er sagte kurz:
»Auf Konopischt hängen zehn schwarze Fahnen.«
»Es sollten zwölf dort sein«, sagte Schwejk nach einem Schluck.
»Warum meinen Sie zwölf?« fragte Bretschneider.
»Damits eine runde Zahl gibt. Aufs Dutzend rechnet sichs besser, und im Dutzend kommt auch alles billiger«, antwortete Schwejk. Es trat Stille ein, die Schwejk selbst durch folgenden Stoßseufzer unterbrach:
»Also er ruht schon in Gottes Schoß. Gott geb ihm ewigen Frieden. Er hats nicht mal erlebt, daß er Kaiser worden is. Wie ich beim Militär gedient hab, is einmal ein General vom Pferd gefalln und hat sich in aller Seelenruh erschlagen. Man wollte ihm wieder aufs Pferd helfen, ihn hinaufheben, da sieht man, daß er mausetot is. Und er hat auch zum Feldmarschall avancieren solln. Das is bei einer Parade geschehn. Diese Paraden führen nie zu was Gutem. In Sarajewo war auch so eine Parade. Ich erinner mich, daß mir bei so einer Parade einmal zwanzig Knöpfe bei der Montur gefehlt ham und daß ich dafür vierzehn Tage Einzel gefaßt hab. Zwei Tage bin ich krummgeschlossen gelegen wie Lazarus. Aber Disziplin muß beim Militär sein. Sonst möcht sich niemand aus jemanden was machen. Unser Oberlajtnant Makovec hat uns immer gesagt: ›Disziplin, ihr Heuochsen, muß sein, sonst möchtet ihr wie die Affen auf den Bäumen klettern. Aber das Militär wird aus euch Menschen machen, ihr Trotteln.‹ Und is das nicht wahr? Stellen Sie sich einen Park vor, sag mr aufn Karlsplatz, und auf jedem Baum einen Soldaten ohne Disziplin. Davor hab ich immer die größte Angst gehabt.« »Das in Sarajewo«, knüpfte Bretschneider an, »haben die Serben gemacht.«
»Da irren Sie sich aber sehr«, antwortete Schwejk. »Das ham die Türken gemacht, wegen Bosnien und Herzegowina.«
Und Schwejk legte seine Ansichten über die internationale Politik Österreichs auf dem Balkan dar. Die Türken hätten im Jahre 1912 den Krieg mit Serbien, Bulgarien und Griechenland verloren. Sie hatten damals wollen, Österreich solle ihnen helfen, und als dies nicht geschah, schossen sie Ferdinand nieder.
»Hast du die Türken gern?« wandte sich Schwejk an Palivec. »Hast du diese heidnischen Hunde gern? Nicht wahr, das nicht.«
»Ein Gast wie der andere«, sagt Palivec, »und wenns auch ein Türke is. Für uns Gewerbetreibende gibts keine Politik. Bezahl dein Bier und setz dich hin und quatsch, was du willst. Das is mein Grundsatz. Ob unsern Ferdinand ein Türke oder ein Serbe, ein Katholik oder Mohammedaner, ein Anarchist oder Jungtscheche umgebracht hat, is mir ganz powidel.«
»Gut, Herr Wirt«, ließ sich Bretschneider vernehmen, der wiederum die Hoffnung aufgab, einen von den beiden in die Enge treiben zu können. »Aber Sie werden zugeben, daß das ein großer Verlust für Österreich ist.«
Statt des Wirtes antwortete Schwejk:
»Ein Verlust is es, das läßt sich nicht leugnen. Ein furchtbarer Verlust. Der Ferdinand läßt sich nicht durch jeden beliebigen Trottel ersetzen. Nur noch dicker hätt er sein solln.«
»Wie meinen Sie das?« warf Bretschneider ein.
»Wie ich das mein?« antwortete Schwejk heiter, »no, nur so: wenn er dicker gewesen wär, dann hätt ihn sicher schon früher der Schlag getroffen, wie er die alten Weiber in Konopischt gejagt hat, wenn sie in seinem Revier Reisig und Schwämme gesammelt ham, und er hätt nicht eines so schmählichen Todes sterben müssen. Wenn ich mir das so überleg, ein Onkel Seiner Majestät des Kaisers, und sie erschießen ihn! Das is ja ein Schkandal, die ganzen Zeitungen sind voll damit. Bei uns in Budweis hat man vor Jahren auf dem Markt bei irgendeinem kleinen Streit einen Viehhändler erstochen, einen gewissen Bratislav Ludwig, der hatte einen Sohn namens Bohuslav, und wenn der seine Schweine verkaufen kam, wollte niemand was von ihm kaufen, und jeder hat gesagt: ›Das ist der Sohn von diesem Erstochenen. Das wird gewiß auch ein feiner Lump sein.‹ Er hat in Krummau von der Brücke in die Moldau springen müssen, und man hat ihn wieder zu Bewußtsein bringen müssen, und man hat aus ihm das Wasser herauspumpen müssen, und er hat in den Armen des Arztes seinen Geist aufgeben müssen, wie der ihm irgendeine Injektion gemacht hat.«
»Sie ziehen aber merkwürdige Vergleiche«, sagte Bretschneider bedeutungsvoll, »zuerst sprechen Sie von Ferdinand und dann von einem Viehhändler.«
»I wo«, verteidigte sich Schwejk. »Gott bewahre, daß ich jemand mit jemandem vergleichen möcht. Der Herr Wirt kennt mich. Nicht wahr, ich hab nie jemanden mit jemandem verglichen? Ich möcht nur nicht in der Haut der Frau Erzherzogin stecken. Was wird die jetzt machen? Die Kinder sind Waisen, die Herrschaft in Konopischt ohne Herrn. Soll sie sich wieder mit irgendeinem Erzherzog verheiraten? Was hätt sie davon? Sie wird mit ihm wieder nach Sarajewo fahren und zum zweitenmal Witwe wern. Da hat vor Jahren in Zliw bei Hluboká ein Heger gelebt, der hat den häßlichen Namen Pinscher gehabt. Die Wilddiebe ham ihn erschossen, und er hat eine Witwe mit zwei Kindern hinterlassen, und sie hat sich nach einem Jahr wieder einen Heger genommen, den Pepi Schawlovic aus Mydlowař. Und den ham sie ihr auch erschossen. Dann hat sie sich zum drittenmal verheiratet und hat wieder einen Heger genommen und hat gesagt: ›Aller guten Dinge sind drei. Wenns diesmal nicht glückt, dann weiß ich schon nicht, was ich machen soll.‹ Natürlich hat man ihr ihn wieder erschossen, und da hat sie mit diesen Hegern zusammen schon sechs Kinder gehabt. Sie is bis in die Kanzlei vom Herrn Fürsten im Hluboká gegangen und hat sich beschwert, daß sie mit diesen Hegern so ein Malör hat. Dort hat man ihr den Teichwächter Jarosch vom Ražitzer Teich empfohlen. Und was sagen Sie dazu: den ham sie ihr wieder beim Fischfang im Teich ertränkt, und dabei hat sie mit ihm schon zwei Kinder gehabt. Da hat sie sich einen Schweinschneider aus Vodňan genommen, und er hat sie eines Abends mit der Hacke erschlagen und is sich dann freiwillig anzeigen gegangen. Wie man ihn dann beim Kreisgericht in Pisek gehängt hat, hat er dem Priester die Nase abgebissen und hat gesagt, daß er überhaupt nichts bereut, und hat auch noch was sehr Häßliches über unsern Kaiser gesagt.«
»Und wissen Sie nicht, was er gesagt hat?« fragte mit hoffnungsvoller Stimme Bretschneider.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil sich niemand getraut hat, es zu wiederholen. Aber es war herich etwas so Furchtbares und Schreckliches, daß ein Rat vom Gericht, der dabei war, davon verrückt geworn is, und noch heut hält man ihn in der Isolierzelle, damit nix ans Licht kommt. Es war nicht nur eine gewöhnliche Beleidigung, wie man sie begeht, wenn man betrunken is.«
»Und welche Majestätsbeleidigungen begeht man denn da?« fragte Bretschneider.
»Meine Herren, ich bitt Sie, sprechen Sie von was andrem«, ließ sich der Wirt Palivec vernehmen. »Wissen Sie, ich hab so was nicht gern. Man läßt was fallen, und das kann einen manchmal verdrießen.«
»Welche Majestätsbeleidigungen man begeht, wenn man betrunken is?« wiederholte Schwejk. »Verschiedene. Betrinken Sie sich, lassen Sie sich die österreichische Hymne aufspieln, und Sie wern sehn, was Sie anfangen wern zu sprechen. Sie wern sich so viel über Seine Majestät ausdenken, daß es, wenn nur die Hälfte davon wahr wär, genügen möcht, um ihn für sein ganzes Leben unmöglich zu machen. Aber der alte Herr verdient sichs wirklich nicht. Bedenken Sie: Seinen Sohn Rudolf hat er im zarten Alter in voller Manneskraft verloren. Seine Gemahlin Elisabeth hat man mit einem Dolch durchbohrt, dann is ihm der Johann Ort verlorengegangen; seinen Bruder, den Kaiser von Mexiko, hat man ihm in irgendeiner Festung, an irgendeiner Mauer erschossen. Jetzt ham sie ihm wieder auf seine alten Tage den Onkel abgemurkst. Da müßte man wirklich eiserne Nerven haben. Und dann fängt irgendein besoffener Kerl an, ihm aufzuheißen. Wenns heute zum Krieg kommt, geh ich freiwillig und wer unserm Kaiser dienen, bis man mich in Stücke reißt.«
Schwejk tat einen tüchtigen Schluck und fuhr fort:
»Sie glauben, unser Kaiser wird das so lassen? Da kennen Sie ihn schlecht. Krieg mit den Türken muß sein. Ihr habt meinen Onkel erschlagen, da habt ihr dafür eins über die Kuschen. Es gibt bestimmt Krieg. Serbien und Rußland wern uns in diesem Krieg helfen. Sakra, wir wern die Feinde dreschen.«
Schwejk sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht, das lächelte wie der zunehmende Mond, glänzte vor Begeisterung. Ihm war alles so klar.
»Kann sein«, fuhr er in seiner Schilderung der Zukunft Österreichs fort, »daß uns, wenn wir mit den Türken Krieg führen, die Deutschen in den Rücken falln, weil die Deutschen und die Türken zusammenhalten. Wir können uns aber mit Frankreich verbünden, das seit dem Jahr einundsiebzig auf Deutschland schlecht zu sprechen is. Und schon wirds gehn. Es wird Krieg geben, mehr sag ich euch nicht.«
Bretschneider stand auf und sagte feierlich:
»Mehr müssen Sie auch nicht sagen. Kommen Sie mit mir auf den Gang, dort werde ich Ihnen etwas sagen.«
Schwejk folgte dem Zivilpolizisten auf den Gang, wo seiner eine kleine Überraschung harrte, als ihm sein Biernachbar den Adler zeigte und erklärte, daß er ihn verhafte und sofort zur Polizeidirektion führen werde. Schwejk bemühte sich, ihm klarzumachen, daß er sich vielleicht irre, er sei vollständig unschuldig und habe nicht ein Wort gesagt, das jemanden beleidigen könne. Bretschneider sagte ihm jedoch, er habe sich einer Reihe strafbarer Handlungen schuldig gemacht, unter denen auch das Verbrechen des Hochverrats eine Rolle spiele.
Dann kehrten sie in die Gaststube zurück, und Schwejk sagte zu Herrn Palivec:
»Ich hab fünf Biere und ein Kipfel mit einem Würstl. Jetzt geben Sie mir noch einen Sliwowitz und dann muß ich schon gehn, weil ich verhaftet bin.«
Bretschneider zeigte Herrn Palivec den Adler, blickte Herrn Palivec eine Weile an und fragte dann:
»Sind Sie verheiratet?«
»Ja.«
»Und kann Ihre Frau während Ihrer Abwesenheit das Geschäft führen?«
»Ja.«
»Dann ist alles in Ordnung, Herr Wirt«, sagte Bretschneider heiter, »rufen Sie Ihre Frau herein, übergeben Sie ihr alles, und abends werden wir Sie abholen.«
»Mach dir nichts draus«, tröstete ihn Schwejk, »ich geh nur wegen Hochverrat hin.«
»Aber wofür ich« stöhnte Herr Palivec. »Ich war doch so vorsichtig.«
Bretschneider lachte und sagte siegesfroh:
»Dafür, daß Sie gesagt haben, daß die Fliegen auf unsern Kaiser geschissen haben. Man wird Ihnen schon unsern Kaiser aus dem Kopf treiben.«
Und Schwejk verließ das Gasthaus »Zum Kelch« in Begleitung des Zivilpolizisten, den er mit seinem freundlichen Lächeln fragte, als sie auf die Straße traten:
»Soll ich vom Trottoir heruntergehn?«
»Warum?«
»Ich denk, wenn ich verhaftet bin, hab ich kein Recht mehr, auf dem Trottoir zu gehn.«
Als sie in das Tor der Polizeidirektion traten, sagte Schwejk:
»Wie rasch uns die Zeit verlaufen is! Gehn Sie oft zum ›Kelch‹?«
Und während man Schwejk in die Aufnahmekanzlei führte, übergab Herr Palivec beim »Kelch« die Gastwirtschaft seiner weinenden Frau, wobei er sie in seiner sonderbaren Art tröstete:
»Wein nicht, heul nicht, was können sie mir wegen einem beschissenen Kaiserbild machen?«
Und so griff der brave Soldat Schwejk in seiner freundlichen Weise in den Weltkrieg ein.
Die Historiker wird es interessieren, daß er weit in die Zukunft voraussah. Wenn sich die Situation später anders entwickelte, als er beim »Kelch« auseinandergesetzt hatte, dann müssen wir berücksichtigen, daß er keine diplomatische Vorbildung besaß.
2. Der brave Soldat Schwejk auf der Polizeidirektion
Das Attentat in Sarajewo füllte die Polizeidirektion mit zahlreichen Opfern. Man brachte eins nach dem andern, und der alte Inspektor in der Aufnahmekanzlei sagte mit seiner gutmütigen Stimme:
»Dieser Ferdinand wird sich euch nicht auszahlen!«
Als man Schwejk in eine der vielen Zellen des ersten Stockwerks sperrte, fand er dort eine Gesellschaft von sechs Männern vor. Fünf saßen rings um den Tisch, und in der Ecke auf dem Kavallett saß, als wollte er sich von ihnen absondern, ein Mann in mittleren Jahren. Schwejk begann einen nach dem andern auszufragen, warum man ihn eingesperrt habe.
Von den fünfen, die am Tisch saßen, erhielt er nahezu die gleiche Antwort:
»Wegen Sarajewo!« – »Wegen Ferdinand!« – »Wegen diesem Mord am Herrn Erzherzog!« – »Wegen Ferdinand!« – »Dafür, daß man den Herrn Erzherzog in Sarajewo umgebracht hat!«
Der sechste, der sich von diesen fünf absonderte, sagte, daß er mit ihnen nichts zu tun haben wolle, damit auf ihn kein Verdacht falle, denn er sitze hier nur wegen versuchten Raubmordes an einem Bauer aus Holitz.
Schwejk setzte sich an den Tisch in die Gesellschaft der Verschwörer, die einander bereits zum zehntenmal erzählten, wie sie in diese Affäre hineingeraten waren.
Alle, bis auf einen, hatte es entweder im Wirtshaus, in der Weinstube oder im Kaffeehaus ereilt. Eine Ausnahme bildete ein ungewöhnlich dicker Herr mit einer Brille und verweinten Augen, der zu Hause in seiner Wohnung verhaftet worden war, weil er zwei Tage vor dem Attentat in Sarajewo für zwei serbische Studenten, Techniker, im Gasthaus die Zeche bezahlt hatte und vom Detektiv Brix in ihrer Gesellschaft betrunken im »Montmartre« in der Kettengasse gesehen worden war, wo er, wie er im Protokoll bereits durch seine Unterschrift bestätigt hatte, ebenfalls für sie gezahlt hatte.
Auf alle Fragen bei der Voruntersuchung auf der Polizeidirektion jammerte er stereotyp:
»Ich habe ein Papiergeschäft.«
Worauf ihm ebenfalls die stereotype Antwort zuteil wurde:
»Das ist kein Beweis für Ihre Unschuld.«
Der kleine Herr, den es in einer Weinstube erwischt hatte, war Geschichtsprofessor und hatte dem Weinstubenbesitzer die Geschichte verschiedener Attentate erklärt. Er wurde gerade in dem Augenblick verhaftet, als er die psychologische Analyse aller Attentate mit den Worten beendete:
»Der Gedanke des Attentates ist so einfach wie das Ei des Kolumbus.«
»Genauso einfach, wie Sie Pankrác erwartet«, wurde sein Ausspruch während des Verhörs von dem Polizeikommissär ergänzt.
Der dritte Verschwörer war der Vorsitzende des Wohltätigkeitsvereins »Dobromil« in Hodkowitschka. An dem Tage, an dem das Attentat verübt worden war, veranstaltete der »Dobromil« ein Gartenfest mit anschließendem Konzert. Der Gendarmeriewachtmeister kam, um die Teilnehmer aufzufordern, das Fest zu beenden, denn Österreich habe Trauer, worauf der Vorsitzende des »Dobromil« gutmütig entgegnete:
»Warten Sie ein Weilchen, bis man das ›Hej, Slowane‹ zu Ende gespielt haben wird.«
Jetzt saß er da mit gesenktem Kopf und lamentierte:
»Im August haben wir neue Vorstandswahlen, wenn ich bis zu der Zeit nicht zu Hause bin, kann es geschehn, daß man mich nicht wählt. Und ich bin schon zum zehntenmal Vorsitzender. Ich überleb diese Schande nicht.«
Seltsam hatte der selige Ferdinand dem vierten Verhafteten mitgespielt, einem Mann von lauterem Charakter und makellosem Schild.
Er war volle zwei Tage jeglichem Gespräch über Ferdinand ausgewichen, bis er den Eichelkönig mit der Schellsieben trumpfte:
»Sieben Kugeln wie in Sarajewo.«
Haar und Bart des fünften Mannes, der, wie er selbst sagte, »wegen diesem Mord am Herrn Erzherzog in Sarajewo« saß, waren noch vor Schreck gesträubt, so daß sein Kopf an einen Stallpinscher gemahnte.
Dieser Mann hatte in dem Restaurant, wo er verhaftet worden war, überhaupt kein Wort gesprochen, ja nicht einmal die Zeitungsberichte über die Ermordung Ferdinands gelesen. Er war ganz allein an einem Tisch gesessen, als irgendein Herr zu ihm kam, sich ihm gegenübersetzte und rasch zu ihm sagte:
»Haben Sie davon gelesen?«
»Nein.«
»Wissen Sie davon?«
»Nein.«
»Und wissen Sie, worum es sich handelt?«
»Nein, ich kümmer mich nicht drum.«
»Aber es sollte Sie doch interessieren.«
»Ich weiß nicht, was mich interessieren sollt! Ich rauch meine Zigarre, trink meine paar Glas Bier, eß mein Abendbrot und les keine Zeitung. Die Zeitungen lügen. Wozu soll ich mich aufregen?«
»Sie interessiert also nicht einmal der Mord in Sarajewo?«
»Mich interessiert überhaupt kein Mord, obs nun in Prag, in Wien, in Sarajewo oder in London is. Dafür sind die Behörden, die Gerichte und die Polizei da. Wenn man jemanden irgendwo erschlägt, recht geschieht ihm, warum is der Trottel so unvorsichtig und läßt sich erschlagen.«
Das waren seine letzten Worte in dieser Unterredung. Seit dieser Zeit wiederholte er nur laut in Intervallen von fünf Minuten: »Ich bin unschuldig.«
Diese Worte rief er auch im Tor der Polizeidirektion, diese Worte wird er auch während der Überführung zum Strafgericht in Prag wiederholen, und mit diesen Worten wird er auch seine Kerkerzelle betreten.
Als Schwejk alle diese schrecklichen Verschwörergeschichten angehört hatte, hielt er es für angezeigt, den Arrestanten die vollständige Hoffnungslosigkeit ihrer Situation zu erklären.
»Ja, mit uns allen stehts sehr schlecht«, begann er seine Trostesworte. »Das is nicht wahr, was ihr sagt, daß euch, uns allen, nix geschehn kann. Wofür ham wir eine Polizei, als dafür, daß sie uns für unsere losen Mäuler straft. Wenn eine so gefährliche Zeit kommt, daß man auf Erzherzoge schießt, so darf sich niemand wundern, daß man ihn auf die Polizeidirektion bringt. Das geschieht alles von wegen der Aufmachung, damit der Ferdinand Reklam hat vor seinem Begräbnis. Je mehr unser hier sein wern, desto besser wirds für uns sein, denn um so lustiger wern wirs haben. Wie ich beim Militär gedient hab, war manchmal unsere halbe Kompanie eingesperrt. Und wieviel unschuldige Leute sind schon verurteilt worn. Und nicht nur beim Militär, sondern auch von den Gerichten. Einmal is, ich erinner mich noch gut, eine Frau verurteilt worn, weil sie ihre neugeborenen Zwillinge erwürgt hat. Obgleich sie steif und fest geschworen hat, daß sie die Zwillinge nicht hat erwürgen können, weil sie nur ein Mäderl zur Welt gebracht hat und es ihr gelungen war, es ganz schmerzlos zu erwürgen, is sie trotzdem wegen Doppelmord verurteilt worn. Oder dieser unschuldige Zigeuner in Zaběhlitz, was am Christtag in der Nacht in einen Bäckerladen eingebrochen is. Er hat geschworen, daß er sich nur anwärmen gegangen is, aber es hat ihm nichts genützt. Wie das Gericht mal was in die Hand nimmt, stehts schlimm. Aber das muß sein. Vielleicht sind nicht alle Leute solche Lumpen, wie man es von ihnen voraussetzen kann: aber wie unterscheidest du heutzutag einen anständigen Menschen von einem Lumpen, besonders heut, in einer so ernsten Zeit, wo sie diesen Ferdinand abgemurkst ham. Da hat man bei uns, wie ich beim Militär in Budweis gedient hab, im Wald hinterm Exerzierplatz den Hund von unserem Hauptmann erschossen. Wie er davon erfahren hat, hat er uns alle rufen lassen, hat uns antreten lassen und hat gesagt, daß jeder zehnte Mann vortreten soll. Selbstverständlich war ich auch der zehnte, und so sind wir Habtacht gestanden und ham nicht mal gezwinkert. Der Hauptmann geht um uns herum und sagt: ›Ihr Lumpen, Schurken, Kanaillen, gefleckte Hyänen, ich möcht euch allen wegen dem Hund Einzel aufpelzen, euch zu Nudeln zerhacken, erschießen und blauen Karpfen aus euch machen. Damit ihrs aber wißt, daß ich euch nicht schonen wer, geb ich euch allen zehn Tage Kasernarrest.‹ Also seht ihr, damals hat sichs um ein Hunterl gehandelt, und jetzt handelt sichs sogar um einen Erzherzog. Und deshalb muß Schrecken sein, damit die Trauer für was steht.«
»Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig«, wiederholte der Mann mit dem gesträubten Haar.
»Jesus Christus war auch unschuldig«, sagte Schwejk, »und sie ham ihn auch gekreuzigt. Nirgendwo is jemals jemandem etwas an einem unschuldigen Menschen gelegen gewesen. Maulhalten und weiterdienen! – wie mans uns beim Militär gesagt hat. Das is das Beste und Schönste.«
Schwejk legte sich auf das Kavallett und schlief friedlich ein.
Inzwischen brachte man zwei Neue. Einer von ihnen war ein Bosniake. Er schritt in der Zelle auf und ab, knirschte mit den Zähnen, und jedes zweite Wort von ihm war:
»Jebenti duschu.«
Ihn quälte der Gedanke, daß ihm auf der Polizeidirektion sein Gottscheerkorb verlorengehen könnte.
Der zweite neue Gast war der Wirt Palivec, der seinen Bekannten Schwejk, als er ihn bemerkte, weckte und mit einer Stimme voller Tragik rief:
»Ich bin auch schon hier!«
Schwejk schüttelte ihm herzlich die Hand und sagte:
»Da bin ich wirklich froh. Ich hab gewußt, daß jener Herr Wort halten wird, wie er Ihnen gesagt hat, daß man Sie abholen wird. So eine Pünktlichkeit is eine schöne Sache.«
Herr Palivec bemerkte jedoch, daß so eine Pünktlichkeit einen Dreck wert sei, und fragte Schwejk leise, ob die andern eingesperrten Herren nicht Diebe seien, weil ihm das als Gewerbetreibendem schaden könne. Schwejk erklärte ihm, daß alle, bis auf einen, der wegen versuchten Raubmordes an einem Bauer aus Holitz hier sei, wegen des Erzherzogs in ihre Gesellschaft gekommen seien.
Herr Palivec war beleidigt und sagte, daß er nicht wegen irgendeines vertrottelten Erzherzogs hier sei, sondern wegen Seiner Majestät des Kaisers. Und weil dies die andern zu interessieren begann, erzählte er ihnen, wie die Fliegen ihm Seine Majestät den Kaiser verunreinigt hatten.
»Sie ham mir ihn verschweint, die Biester«, schloß er die Schilderung seines Abenteuers, »und zum Schluß ham sie mich ins Kriminal gebracht. Ich wer das diesen Fliegen nicht verzeihn«, fügte er drohend hinzu.
Schwejk legte sich abermals schlafen, aber er schlief nicht lange, denn man holte ihn ab, um ihn zum Verhör zu führen.
Und so trug Schwejk, während er über die Treppe in die 3. Abteilung zum Verhör schritt, sein Kreuz auf den Gipfel Golgathas, ohne etwas von seinem Martyrium zu merken.
Als er die Aufschrift erblickte, daß das Spucken auf den Gängen verboten sei, bat er den Polizisten, ihm zu erlauben, in den Spucknapf zu spucken, und strahlend in seiner Einfalt betrat er die Kanzlei mit den Worten:
»Winsch einen guten Abend, meine Herren, allen miteinand.«
Statt einer Antwort puffte ihn jemand in die Rippen und stellte ihn vor den Tisch, hinter dem ein Herr mit einem kühlen Beamtengesicht von so tierischer Grausamkeit saß, als wäre er gerade aus Lombrosos Buch »Verbrechertypen« herausgefallen.
Er schaute blutdürstig auf Schwejk und sagte:
»Benehmen Sie sich nicht so blöd!«
»Ich kann mir nicht helfen«, antwortete Schwejk ernst, »man hat mich beim Militär wegen Blödheit superarbitriert. Ich bin amtlich von der Superarbitrierungskommission für einen Idioten erklärt worn. Ich bin ein behördlicher Idiot.«
Der Herr mit dem Verbrechertypus knirschte mit den Zähnen:
»Das, wessen Sie beschuldigt sind und wessen Sie sich schuldig gemacht haben, zeugt davon, daß Sie alle fünf Sinne beisammen haben.«
Und er zählte Schwejk eine ganze Reihe verschiedener Verbrechen auf, angefangen vom Hochverrat und endend mit Majestätsbeleidigung und Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen Hauses. Inmitten dieser Gruppe glänzte die Billigung der Ermordung Erzherzog Ferdinands. Davon ging ein Zweig mit neuen Verbrechen aus, unter denen das Verbrechen der Aufwiegelung strahlte, weil sich alles in einem öffentlichen Lokal abgespielt hatte.
»Was sagen Sie dazu?« fragte der Herr mit den Zügen tierischer Grausamkeit siegesbewußt.
»Es is viel«, erwiderte Schwejk unschuldig, »allzuviel is ungesund.«
»Na also, daß Sie das wenigstens einsehen.«
»Ich seh alles ein, Strenge muß sein, ohne Strenge möcht niemand nirgends hinkommen. Das is so wie einmal, wie ich beim Militär gedient hab ...«
»Halten Sies Maul!« schrie der Polizeirat Schwejk an, »und sprechen Sie erst, bis ich Sie etwas fragen werde! Verstehn Sie?«
»Wie sollt ich nicht verstehn«, sagte Schwejk, »melde gehorsamst, daß ich versteh und daß ich mich in allem, was Sie sagen, zurechtfinden kann.«
»Mit wem verkehren Sie denn?«
»Mit meiner Bedienerin, Euer Gnaden.«
»Und in den hiesigen politischen Kreisen haben Sie keine Bekannten?«
»Das schon, Euer Gnaden, ich pfleg mir das Mittagsblatt der Národní Politika, die Tschubitschka zu kaufen.«
»Hinaus!« brüllte der Herr mit dem tierischen Aussehen Schwejk an.
Als man Schwejk aus der Kanzlei führte, sagte er:
»Gute Nacht, Euer Gnaden.«
In seine Zelle zurückgekehrt, verkündete Schwejk allen Arrestanten, daß so ein Verhör eine Hetz sei. »Bißl schreit man euch dort an, und zum Schluß wirft man euch heraus.«
»Früher«, fuhr Schwejk fort, »da wars ärger. Ich hab mal ein Buch gelesen, daß der Angeklagte auf glühendem Eisen gehn und geschmolzenes Blei trinken mußte, damit man erkennt, daß er unschuldig ist. Oder hat man ihm die Füße in spanische Stiefel gesteckt und hat ihn auf eine Leiter gespannt, wenn er nicht gestehn wollt, oder man hat ihm die Hüften mit einer Feuerwehrfackel gebrannt, wie mans dem heiligen Johann Nepomuk gemacht hat. Der hat herich dabei geschrien, wie wenn man ihn gespießt hätt, und hat nicht aufgehört, bis man ihn von der Elisabethbrücke in einem wasserdichten Sack hinuntergeworfen hat. Solche Fälle hats viel gegeben, und nachher ham sie den Betreffenden noch gevierteilt oder irgendwo beim Museum an den Pfahl geschlagen. Und wenn man ihn nur in den Hungerturm geworfen hat, war so ein Mensch wie neu geboren.«
»Heutzutag is es eine Hetz, eingesperrt zu sein«, fuhr Schwejk wohlgefällig fort, »kein Vierteilen, keine spanischen Stiefel, Kavalletts hamr, einen Tisch hamr, Bänke hamr, wir drängen uns nicht einer auf den andern, Suppe kriegen wir, Brot geben sie uns, einen Krug mit Wasser bringen sie uns, den Abort hamr direkt vorm Mund. In allem sieht man den Fortschritt. Bisserl weit is es zum Verhör, das is wahr, über drei Gänge und ein Stockwerk höher, aber dafür is es auf den Gängen sauber und lebhaft. Da führt man einen her, den andern hin, Junge, Alte, Männer und Weibsbilder. Man is froh, wenn man wenigstens nicht hier allein is. Jeder geht zufrieden seines Wegs und muß sich nicht fürchten, daß man ihm in der Kanzlei sagt: ›Also wir ham uns beraten, und morgen wern Sie gevierteilt oder verbrannt, je nach Wunsch.‹ Das war sicher ein schwerer Entschluß, und ich denk, meine Herren, daß mancher von uns in einem solchen Moment ganz getepscht wär. Ja, heutzutag ham sich die Verhältnisse zu unsern Gunsten gebessert.«
Er beendete gerade die Verteidigung des modernen Gefängniswesens, als der Aufseher die Tür öffnete und rief:
»Schwejk, ziehn Sie sich an, Sie gehn zum Verhör.«
»Ich zieh mich an«, antwortete Schwejk, »ich hab nichts dagegen, aber ich fürcht mich, daß es ein Irrtum is, ich bin schon einmal beim Verhör herausgeworfen worn. Und dann fürcht ich mich, daß sich die übrigen Herren, die hier mit mir sind, nicht auf mich ärgern, weil ich zweimal hintereinander geh und sie heut noch nicht einmal dort waren. Sie könnten auf mich eifersüchtig wern.«
»Kommen Sie heraus und quatschen Sie nicht«, lautete die Antwort auf die kavaliermäßige Kundgebung Schwejks.
Schwejk befand sich abermals vor dem Herrn mit dem Verbrechertypus, der ihn ohne jede Einleitung hart und unabweisbar fragte:
»Gestehn Sie alles?«
Schwejk heftete seine guten, blauen Augen auf den unerbittlichen Menschen und sagte weich:
»Wenn Sie wünschen, Euer Gnaden, daß ich gesteh, so gesteh ich, mir kanns nicht schaden. Wenn Sie aber sagen: ›Schwejk, gestehn Sie nichts ein‹, wer ich mich herausdrehn, bis man mich in Stücke reißt.«
Der gestrenge Herr schrieb etwas in die Akten, und während er Schwejk die Feder reichte, forderte er ihn auf, zu unterschreiben.
Und Schwejk unterschrieb die Angaben Bretschneiders sowie folgenden Zusatz:
Alle oben angeführten Beschuldigungen gegen mich beruhen auf Wahrheit.
Josef Schwejk
Nachdem er unterschrieben hatte, wandte er sich an den gestrengen Herrn:
»Soll ich noch was unterschreiben? Oder soll ich erst früh kommen?«
»Früh wird man Sie ins Strafgericht überführen«, lautete die Antwort.
»Um wieviel Uhr, Euer Gnaden? Damit ich um Himmels willen nicht verschlaf.«
»Hinaus!« wurde Schwejk an diesem Tage schon zum zweitenmal hinter dem Tische angeschrien, vor welchem er stand.
Als er in sein neues vergittertes Heim zurückkehrte, sagte Schwejk dem Polizisten, der ihn begleitete:
»Alles geht hier wie am Schnürl.«
Sobald die Türe hinter ihm geschlossen war, überschütteten ihn seine Gefängniskollegen mit verschiedenen Fragen, auf die Schwejk klar entgegnete:
»Soeben hab ich gestanden, daß ich herich den Erzherzog Ferdinand erschlagen hab.«
Sechs Männer duckten sich entsetzt unter den verlausten Decken, nur der Bosniake sagte:
»Dobro doschli.«
Während er sich auf das Kavallett legte, sagte Schwejk: »Das is dumm, daß wir hier keinen Wecker ham.«
Am Morgen weckte man ihn aber auch ohne Wecker, und Punkt sechs Uhr führte man Schwejk im »grünen Anton« zum Landesstrafgericht.
»Morgenstunde hat Gold im Munde«, sagte Schwejk zu seinen Mitreisenden, als der »grüne Anton« aus dem Tor der Polizeidirektion fuhr.
3. Schwejk vor den Gerichtsärzten
Die sauberen, gemütlichen Zimmerchen des Landesstrafgerichtes machten auf Schwejk den günstigsten Eindruck. Die weißgetünchten Wände, die schwarzlackierten Gitter und auch der dicke Oberaufseher für die Untersuchungshäftlinge, Herr Demartini, mit den violetten Aufschlägen und der violetten Borte an der ärarischen Kappe. Die violette Farbe ist nicht nur hier vorgeschrieben, sondern auch bei religiösen Zeremonien am Aschermittwoch und Karfreitag.
Die glorreiche Geschichte der römischen Herrschaft über Jerusalem wiederholte sich. Man führte die Häftlinge hinaus und stellte sie unten im Erdgeschoß vor die Pilatusse des Jahres 1914. Und die Untersuchungsrichter, Pilatusse der Neuzeit, ließen sich, statt sich in allen Ehren die Hände zu waschen, bei »Teissig« Gulasch und Pilsner Bier holen und lieferten der Staatsanwaltschaft neue und neue Klagen ab.
Hier schwand zumeist alle Logik, und der § siegte, der § drosselte, der § verblödete, der § prasselte, der § lachte, der § drohte und verzieh nicht. Es waren Jongleure des Gesetzes, Opferpriester der Buchstaben des Gesetzes, Angeklagtenfresser, Tiger des österreichischen Dschungels, die ihren Sprung auf den Angeklagten nach der Nummer des Paragraphen berechneten.
Eine Ausnahme bildeten einige Herren (ebenso wie bei der Polizeidirektion), die das Gesetz nicht so ernst nahmen, denn man findet überall Weizen zwischen Spreu.
Zu einem solchen Herrn führte man Schwejk zum Verhör. Ein alter Herr von gutmütigem Aussehen, der, als er einst den bekannten Mörder Valesch verhörte, niemals zu sagen vergaß:
»Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Valesch, hier ist gerade ein leerer Stuhl.«
Als man Schwejk vorführte, forderte er ihn mit der ihm angeborenen Liebenswürdigkeit auf, sich zu setzen, und sagte:
»Also Sie sind der Herr Schwejk?«
»Ich denk«, entgegnete Schwejk, »daß ichs sein muß, weil auch mein Vater ein Schwejk und meine Mutter eine Schwejk war. Ich kann ihnen nicht so eine Schande antun, meinen Namen zu verleugnen.«
Ein freundliches Lächeln huschte über das Gesicht des Untersuchungsrichters.
»Sie haben sich aber eine hübsche Geschichte eingebrockt. Sie haben hübsch viel auf dem Gewissen.«
»Ich hab immer viel auf dem Gewissen«, sagte Schwejk, indem er noch freundlicher lächelte als der Herr Untersuchungsrichter, »ich hab vielleicht noch mehr auf dem Gewissen als Sie, Euer Gnaden.«
»Das geht aus dem Protokoll hervor, das Sie unterschrieben haben«, sagte in nicht minder freundlichem Ton der Untersuchungsrichter, »hat man auf der Polizei keinen Druck auf Sie ausgeübt?«
»Aber woher denn, Euer Gnaden. Ich selbst hab sie gefragt, ob ichs unterschreiben soll, und wie sie gesagt ham, ich solls unterschreiben, hab ich ihnen gefolgt. Ich wer mich doch nicht mit ihnen wegen meiner eigenen Unterschrift raufen. Damit möcht ich mir ganz bestimmt nicht nützen. Ordnung muß sein.«
»Fühlen Sie sich ganz gesund, Herr Schwejk?«
»Ganz gesund grad nicht, Euer Gnaden Herr Rat. Ich hab Rheuma, ich kurier mich mit Opodeldok.«
Der alte Herr lächelte wiederum freundlich: »Was würden Sie dazu sagen, wenn wir Sie von Gerichtsärzten untersuchen lassen würden?«
»Ich denk, daß es mit mir nicht so arg is, daß die Herren mit mir überflüssige Zeit verlieren müßten. Mich hat schon irgendein Herr Doktor auf der Polizeidirektion untersucht, ob ich keinen Tripper hab.«
»Wissen Sie was, Herr Schwejk, wir werden es halt doch mit den Gerichtsärzten versuchen. Wir werden hübsch eine Kommission zusammenstellen, werden Sie in Untersuchungshaft belassen, und inzwischen ruhen Sie sich hübsch aus. Vorläufig noch eine Frage: Sie sollen nach dem Protokoll erklärt und verbreitet haben, daß bald ein Krieg ausbrechen wird?«
»Das bitte ja, Euer Gnaden, er wird in der allernächsten Zeit ausbrechen.«
»Und werden Sie nicht von Zeit zu Zeit von Anfällen gepackt?«
»Nein, bitte sehr, nur einmal hätt mich fast ein Automobil aufm Karlsplatz gepackt, aber das is schon paar Jahre her.«
Damit war das Verhör beendet. Schwejk reichte dem Untersuchungsrichter die Hand. Als er in seine Zelle zurückkehrte, sagte er seinem Nachbar:
»So wern mich also wegen dem Mord am Herrn Erzherzog Ferdinand die Gerichtsärzte untersuchen.«
»Ich bin auch schon von den Gerichtsärzten untersucht worden«, sagte ein junger Mann, »das war damals, als ich wegen der Teppiche vor die Geschworenen gekommen bin. Man hat mich für schwachsinnig erklärt. Jetzt hab ich eine Dampfdreschmaschine veruntreut, und man kann mir nichts machen. Mein Advokat hat mir gestern gesagt, wenn ich schon einmal für schwachsinnig erklärt worden bin, so muß ich davon schon fürs ganze Leben einen Vorteil haben.«
»Ich glaub diesen Gerichtsärzten nichts«, bemerkte ein Mann von intelligentem Aussehen. »Wie ich einmal Wechsel gefälscht hab, hab ich für alle Fälle die Vorlesungen vom Doktor Heveroch besucht, und wie sie mich erwischt haben, hab ich einen Paralytiker simuliert, genauso wie ihn Doktor Heveroch geschildert hat. Ich hab einen Gerichtsarzt von der Kommission ins Bein gebissen, hab die Tinte aus dem Tintenfaß ausgetrunken und hab mich, mit Vergeben, meine Herren, vor der ganzen Kommission in einem Winkel ausgemacht. Aber dafür, daß ich einem die Wade durchgebissen hab, haben sie mich für vollkommen gesund erklärt, und ich war verloren.«
»Ich fürcht mich nicht ein bißl vor diesen Herrn«, verkündete Schwejk, »wie ich beim Militär gedient hab, hat mich ein Tierarzt untersucht, und es is ganz gut ausgefalln.«
»Die Gerichtsärzte sind Schufte«, ließ sich ein kleiner verhutzelter Mensch vernehmen, »neulich hat man durch einen Zufall auf meiner Wiese ein Skelett gefunden, und die Gerichtsärzte ham gesagt, daß dieses Skelett vor vierzig Jahren durch den Hieb eines stumpfen Gegenstandes in den Kopf erschlagen worden ist. Ich bin achtunddreißig Jahre alt, und man hat mich eingesperrt, obwohl ich einen Taufschein, einen Auszug aus der Matrik und einen Heimatschein hab.«
»Ich denk«, sagte Schwejk, »wir sollten alles von einer bessern Seite betrachten. Jeder kann sich irren, und er muß sich irren, je mehr er über etwas nachdenkt. Die Gerichtsärzte sind Menschen, und Menschen ham ihre Fehler. So wie einmal in Nusle, grad bei der Brücke über den Botitschbach, da is einmal in der Nacht ein Herr zu mir gekommen, wie ich vom ›Banzet‹ nach Haus gegangen bin, und hat mir mit einem Ochsenziemer eins übern Kopf gegeben, und wie ich am Boden gelegen bin, hat er auf mich geleuchtet und sagt: ›Das is ein Irrtum, das is er nicht.‹ Und is darüber so in Wut geraten, daß er sich geirrt hat, daß er mir noch eins übern Rücken gehaut hat. Das liegt schon so in der menschlichen Natur, daß sich der Mensch bis zu seinem Tod irrt. Wie der Herr, was in der Nacht einen halb erfrorenen tollen Hund gefunden hat. Er nimmt ihn mit nach Haus und steckt ihn der Frau ins Bett. Wie sich der Hund erwärmt hat und zu sich gekommen is, hat er die ganze Familie gebissen, und den Jüngsten in der Wiege hat er zerrissen und aufgefressen. Oder wer ich euch ein Beispiel erzähln, wie sich bei uns im Haus ein Drechsler geirrt hat. Er hat sich mit dem Schlüssel die Podoler Kirche aufgemacht, weil er geglaubt hat, daß das seine Küche is, und hat sich auf den Altar gelegt, weil er geglaubt hat, daß er zu Haus im Bett liegt, und hat paar von diesen Deckerln mit heiligen Inschriften auf sich gelegt und untern Kopf das Evangelium und noch andere geweihte Bücher, damit ers hoch unterm Kopf hat. Früh hat ihn der Küster gefunden, und er sagt ihm ganz gutmütig, wie er zu sich gekommen is, daß es ein Irrtum is. ›Hübscher Irrtum‹, sagt der Küster, ›wenn wir wegen so einem Irrtum die Kirche von neuem einweihen lassen müssen.‹ Dann is dieser Drechsler vor Gerichtsärzte gekommen, und die ham ihm bewiesen, daß er ganz zurechnungsfähig und nüchtern war. Wenn er besoffen gewesen wär, so hätt er herich mit dem Schlüssel nicht ins Schloß von der Kirchentür getroffen. Dann is dieser Drechsler in Pankrác gestorben. Oder noch ein Beispiel, wie sich in Kladno ein Polizeihund geirrt hat, der Wolfshund von dem bekannten Wachtmeister Rotter. Wachtmeister Rotter hat solche Hunde gezüchtet und hat Versuche mit Landstreichern gemacht, bis alle Landstreicher angefangen ham, dem Kladnoer Kreis auszuweichen. Da hat er den Befehl gegeben, daß die Gendarmen, kosts was kost, einen verdächtigen Menschen bringen solln. Da ham sie ihm einmal einen ziemlich anständig angezogenen Mann gebracht, den sie in den Laner Wäldern auf einem Holzstamm sitzen gesehn ham. Gleich ham sie ihm ein Stückerl vom Rockschoß abschneiden lassen, den hat man den Gendarmeriepolizeihunden zu riechen gegeben, und dann ham sie diesen Mann in eine Ziegelei hinter der Stadt geführt und diese dressierten Hunde auf seine Spur losgelassen. Die ham ihn gefunden und wieder zurückgebracht. Dann hat der Mann über eine Leiter auf den Boden kriechen, über die Mauer klettern und in den Teich springen müssen und die Hunde hinter ihm. Zum Schluß hat sichs herausgestellt, daß der Mann ein tschechischer radikaler Abgeordneter war, der einen Ausflug in die Laner Wälder gemacht hat, wie er vom Parlament genug gehabt hat. Deshalb sag ich euch, daß alle Menschen Irrtümern unterliegen, daß sie sich irren, obs nun ein Gelehrter oder ein blöder ungebildeter Trottel is. Sogar Minister irren sich.«
Die Kommission der Gerichtsärzte, die darüber entscheiden sollte, ob der geistige Horizont Schwejks all den Verbrechen, deren er angeklagt war, entspreche oder nicht, bestand aus drei ungewöhnlich ernsten Herrn, deren Ansichten bedeutend auseinandergingen.
Sie vertraten drei verschiedene wissenschaftliche Schulen und psychiatrische Anschauungen.
Wenn es im Falle Schwejk zwischen diesen entgegengesetzten wissenschaftlichen Lagern zu einer völligen Übereinstimmung kam, läßt sich dies nur durch den niederschmetternden Eindruck erklären, den Schwejk auf die ganze Kommission machte. Beim Betreten des Zimmers, in dem sein Geisteszustand geprüft werden sollte, rief er nämlich aus, als er auf der Wand das dort hängende Bild des österreichischen Monarchen bemerkte:
»Meine Herren, es lebe Kaiser Franz Josef I.«
Die Sache war vollkommen klar. Durch die spontane Kundgebung Schwejks entfiel eine ganze Reihe von Fragen, und es bedurfte nur noch einiger der wichtigsten, um aus den Antworten auf Grund des Systems des Psychiaters Kallerson, des Doktors Heveroch und des Engländers Weikin die wahre Geistesverfassung Schwejks festzustellen.
»Ist Radium schwerer als Blei?«
»Ich habs, bitte, nicht gewogen«, antwortete Schwejk mit seinem freundlichen Lächeln.
»Glauben Sie an das Ende der Welt?«
»Zuerst müßt ich das Ende der Welt sehn«, warf Schwejk gleichmütig hin, »ganz bestimmt wern wirs aber morgen noch nicht erleben.«
»Könnten Sie den Durchmesser der Erdkugel ausmessen?«
»Das möcht ich, bitte, nicht treffen«, antwortete Schwejk, »aber ich selbst möcht ihnen, meine Herren, auch ein Rätsel aufgeben: Es is ein dreistöckiges Haus, in diesem Haus sind in jedem Stock acht Fenster. Auf dem Dach sind zwei Giebel und zwei Kamine. In jedem Stock sind zwei Mieter. Und jetzt sagen Sie mir, meine Herrn, in welchem Jahr is dem Hausmeister seine Großmutter gestorben?«
Die Gerichtsärzte blickten einander bedeutungsvoll an, nichtsdestoweniger stellte einer von ihnen noch die Frage:
»Kennen Sie nicht die größte Tiefe im Stillen Ozean?«
»Bitte nein«, lautete die Antwort, »aber ich denk, daß sie entschieden größer sein wird als die von der Moldau unterm Wyschehrader Felsen.«
Der Vorsitzende der Kommission fragte kurz: »Genügt?« aber eines der Mitglieder erbat sich doch noch folgende Frage:
»Wieviel ist 12897 mal 13863?«
»729«, antwortete Schwejk, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Ich glaube, das genügt vollkommen«, sagte der Vorsitzende der Kommission. »Sie können den Angeklagten wieder abführen.«
»Ich danke Ihnen, meine Herren«, sagte Schwejk ehrerbietig, »mir genügts auch vollkommen.«
Nachdem er gegangen war, kam das Kollegium der drei überein, daß Schwejk ein notorischer Blödian und Idiot nach allen von den psychiatrischen Wissenschaften erfundenen Naturgesetzen sei.
In dem an den Untersuchungsrichter abgesandten Bericht stand unter anderem: »Die endesgefertigten Gerichtsärzte stützen sich in ihrem Urteil bezüglich völliger geistiger Stumpfheit und angeborenem Kretinismus des der oben angeführten Kommission zugewiesenen Josef Schwejk auf den Ausspruch: Es lebe Kaiser Franz Josef I., der vollkommen genügt, um den Geisteszustand Josef Schwejks als den eines notorischen Idioten erkennen zu lassen. Die endesgefertigte Kommission beantragt daher: 1. Einstellung der Untersuchung gegen Josef Schwejk; 2. Überführung Josef Schwejks zur Beobachtung in die psychiatrische Klinik zwecks Feststellung, wie weit sein Geisteszustand für seine Umgebung gefährlich ist.«
Während dieser Bericht abgefaßt wurde, erklärte Schwejk seinen Haftgenossen: »Auf den Ferdinand ham sie gepfiffen und ham sich mit mir von noch größeren Unsinnen unterhalten. Zum Schluß hamr uns gesagt, daß uns das vollkommen genügt, was wir uns erzählt ham, und sind auseinandergegangen.«
»Ich glaub niemandem«, bemerkte der verhutzelte, kleine Mensch, auf dessen Wiese man zufällig ein Skelett ausgegraben hatte, »es is alles eine Bande.«
»Auch diese Bande muß sein«, sagte Schwejk und legte sich auf den Strohsack, »wenns alle Menschen mit den andern Menschen gut meinen möchten, tät bald einer den andern erschlagen.«
4. Schwejks Hinauswurf aus dem Irrenhaus
Wenn Schwejk später sein Leben im Irrenhaus schilderte, geschah dies unter ungewöhnlichen Lobpreisungen: »Ich weiß wirklich nicht, warum die Narren sich ärgern, wenn man sie dort einsperrt. Man kann dort nackt auf der Erde kriechen, heulen wie ein Schakal, toben und beißen. Wenn man das irgendwo auf der Promenade machen möcht, möchten die Leute sich wundern, aber dort is es selbstverständlich! Dort gibts so eine Freiheit, wie sich sie nicht mal die Sozialisten träumen lassen. Man kann sich dort sogar für den Herrgott oder für die Jungfrau Maria ausgeben, oder für den Papst, oder für den König von England, oder für Seine Majestät den Kaiser, oder für den heiligen Wenzel, obzwar der letztere dort gefesselt und nackt war und in der Isolierzelle gelegen is. Einer war auch dort, der hat geschrien, er is ein Erzbischof, aber der hat nichts anderes gemacht als nur gefressen, und noch was hat er gemacht, mit Vergeben, Sie wissen schon, was sich so bißl darauf reimt, aber dort schämt sich keiner dafür. Einer hat sich dort sogar für den heiligen Cyrill und Method ausgegeben, damit er zwei Portionen kriegt. Und ein Herr war dort schwanger und hat jeden zur Taufe eingeladen. Dann hats dort viel eingesperrte Schauspieler, Politiker, Fischer und Skauts, Markensammler und Fotografen und Maler gegeben. Einer war dort wegen alten Töpfen, die er Aschenurnen genannt hat. Einer war dort in der Zwangsjacke, damit er nicht ausrechnen kann, wann die Welt untergehn wird. Auch mit paar Professoren bin ich dort zusammengekommen. Einer von ihnen is mir fort nachgegangen und hat mir erklärt, daß die Wiege der Zigeuner im Riesengebirge gestanden is, und der andre hat mir auseinandergesetzt, daß im Innern der Erdkugel noch ein viel größerer Erdball is als obenauf.
Jeder hat dort sprechen können, was er gewollt hat und was ihm grad auf die Zunge gekommen is, wie wenn er im Parlament wär. Manchmal haben sie sich dort Märchen erzählt und sich bißl gerauft, wenns mit einer Prinzessin sehr schlecht ausgefalln is. Am wildesten war ein Herr, der sich für den 16. Band von Ottos Lexikon ausgegeben hat; der hat jeden gebeten, er soll ihn aufmachen und das Schlagwort ›Kartonagennäherin‹ finden, sonst is er herich verloren. Er hat sich erst beruhigt, wenn sie ihm die Zwangsjacke gegeben ham. Dann war er ruhig, weil er geglaubt hat, daß er in die Buchbinderpresse gekommen is, und hat gebeten, daß sie ihn modern beschneiden solln. Überhaupt hat man dort gelebt wie im Paradies. Man kann dort schreien, brüllen, singen, weinen, meckern, stöhnen, springen, beten, Purzelbäume schlagen, auf allen vieren gehn, auf einem Fuß hüpfen, im Kreis laufen, tanzen, den ganzen Tag auf der Erde kauern und auf den Wänden kriechen. Niemand kommt zu euch und sagt: ›Das dürfen Sie nicht machen, Herr, das paßt sich nicht, Sie könnten sich schämen, Sie wolln ein gebildeter Mensch sein?‹ Wahr is aber, daß auch ganz stille Narren dort sind. So war dort ein gebildeter Erfinder, der hat sich dort in der Nase gebohrt und hat nur einmal im Tag gesagt: ›Soeben hab ich die Elektrizität erfunden.‹ Wie ich sag, sehr hübsch wars dort, und die paar Tage, die ich im Irrenhaus verbracht hab, gehören zu den schönsten meines Lebens.«
Und wirklich, schon der Empfang selbst, der Schwejk im Irrenhaus zuteil geworden war, als man ihn vom Strafgericht zur Beobachtung einlieferte, übertraf seine Erwartungen. Zuerst zog man ihn nackt aus, dann gab man ihm irgendeinen Schlafrock und führte ihn ins Bad, während ihn zwei Wärter vertraulich unter den Armen faßten, wobei ihn einer mit der Wiedergabe einer jüdischen Anekdote unterhielt. Im Badezimmer steckte man ihn in eine Wanne mit warmem Wasser, zog ihn dann heraus und stellte ihn unter eine kalte Dusche. Das wiederholte man dreimal, und dann fragte man ihn, wie ihm das gefalle. Schwejk sagte, daß er sehr gern bade. »Wenn Sie mir noch die Nägel und die Haare schneiden wern, so wird mir nichts zu meinem vollkommenen Glück fehln«, fügte er lächelnd und liebenswürdig hinzu.
Auch dieser Wunsch wurde erfüllt, und nachdem sie ihn noch gründlich mit einem Schwamm abgerieben hatten, wickelten ihn die Wärter in ein Leintuch und trugen ihn in die erste Abteilung ins Bett, wo sie ihn niederlegten, mit einer Decke zudeckten und ihn einzuschlafen baten.
Schwejk erzählt noch heute mit Liebe davon: »Stelln Sie sich vor, daß sie mich getragen ham, wirklich weggetragen ham, ich war in diesem Augenblick vollkommen glücklich.«
Und er schlief auch glücklich im Bett ein. Dann weckte man ihn, um ihm einen Topf Milch und eine Semmel vorzusetzen. Die Semmel war bereits in kleine Stückchen zerschnitten, und während einer von den Wärtern Schwejk an beiden Händen hielt, tunkte der andere die Semmelstückchen in die Milch und fütterte ihn, wie man eine Gans mit Klößen füttert. Als sie ihn gefüttert hatten, faßten sie ihn unter den Armen und führten ihn auf den Abort, wo sie ihn baten, seine kleine und große Notdurft zu verrichten.
Auch von diesem schönen Augenblick erzählt Schwejk mit Liebe, und ich muß sicherlich nicht mit seinen Worten wiedergeben, was sie dann mit ihm taten. Ich erwähne nur, daß Schwejk erzählt:
»Einer von ihnen hat mich dabei in den Armen gehalten.«
Nachdem sie ihn zurückgebracht hatten, legten sie ihn wiederum ins Bett und baten ihn abermals, einzuschlafen. Als er eingeschlafen war, weckten sie ihn und führten ihn ins Ordinationszimmer, wo Schwejk, völlig nackt vor zwei Ärzten stehend, der glorreichen Zeit seiner Assentierung gedachte. Unwillkürlich entschlüpfte es seinen Lippen:
»Tauglich.«
»Was sagen Sie?« fragte einer der Ärzte. »Machen Sie fünf Schritte nach vorn und fünf Schritte zurück.«
Schwejk machte zehn.
»Ich habe Ihnen doch gesagt«, sagte der Arzt, »Sie solln fünf machen.«
»Mir kommts auf paar Schritte nicht an«, sagte Schwejk.
Hierauf forderten ihn die Ärzte auf, er möge sich auf einen Stuhl setzen, und einer klopfte ihm auf die Knie. Dann sagte er zu dem andern, daß die Reflexe vollständig normal seien, worauf der zweite den Kopf schüttelte und Schwejk selbst auf die Knie zu klopfen begann, während der erste Schwejks Augenlider emporhob und seine Pupillen untersuchte. Dann gingen sie zum Tisch und warfen ein paar lateinische Ausdrücke hin.
»Hören Sie, können Sie singen?« fragte einer von ihnen Schwejk. »Könnten Sie uns nicht irgendein Lied vorsingen?«
»Ohne weiters, meine Herren«, antwortete Schwejk. »Ich hab zwar weder Stimme noch musikalisches Gehör, aber ich will versuchen Ihnen den Gefalln zu tun, wenn Sie sich unterhalten wolln!«
Und Schwejk legte los:
»Der kleine Mönch im Lehnstuhl dort blickt nieder in tiefem Sinnen, zwei bittre heiße Tränen fort auf seine Wangen rinnen.
Weiter kann ichs nicht«, fuhr Schwejk fort. »Wenn Sie aber wollen, sing ich Ihnen:
Wie ist mir heute bang zumute, wie schwer hebts meine Brust, dort in der Ferne, im Schein der Sterne dort, dort allein ist meine Lust.
Und auch das kann ich nich weiter«, seufzte Schwejk. »Ich kann noch die erste Strophe von ›Kde domov muj‹ und dann noch: ›General Windischgrätz und die hohen Herren, als die Sonne aufging, gaben die Befehle‹ und noch paar solche Nationallieder, wie: ›Gott erhalte, Gott beschütze‹ und ›Als wir nach Jaroměř zogen‹ und ›Wir grüßen dich vieltausendmal‹.«
Die beiden Herren Ärzte blickten einander an und einer von ihnen stellte an Schwejk die Frage: »Wurde Ihr Geisteszustand bereits einmal geprüft?«
»Beim Militär«, antwortete Schwejk feierlich und stolz, »bin ich von den Herren Militärärzten amtlich für einen notorischen Idioten erklärt worn.«
»Mir scheint, Sie sind ein Simulant!« schrie der zweite Arzt Schwejk an.
»Ich, meine Herren«, verteidigte sich Schwejk, »bin kein Simulant, ich bin ein wirklicher Idiot, Sie können sich darüber in der Kanzlei der Einundneunziger in Budweis oder beim Ergänzungskommando in Karolinental erkundigen.«
Der ältere von den Ärzten winkte hoffnungslos mit der Hand und sagte, auf Schwejk weisend, zu den Wärtern: »Diesem Mann da geben Sie seine Kleider zurück, und bringen Sie ihn in die dritte Klasse auf den ersten Korridor, dann kommt einer zurück und trägt alle Dokumente über ihn in die Kanzlei. Und sagen Sie dort, daß mans bald erledigen soll, damit wir ihn hier nicht lang auf dem Hals haben.«
Die Ärzte warfen noch einen niederschmetternden Blick auf Schwejk, der ehrerbietig rücklings zur Tür zurückwich, wobei er sich höflich verneigte. Auf die Frage eines der Wärter, was er da für Dummheiten mache, erwiderte er: »Weil ich nicht angezogen bin, und ich will den Herren nichts zeigen, damit sie nicht denken, daß ich unhöflich oder ordinär bin.«
Von dem Augenblick, wo die Wärter den Befehl erhalten hatten, Schwejk seine Kleider zurückzugeben, wandten sie ihm nicht mehr die geringste Sorgfalt zu. Sie befahlen ihm, sich anzukleiden, und einer führte ihn in die dritte Klasse, wo er während der paar Tage, deren es bedurfte, um in der Kanzlei seinen schriftlichen Hinauswurf durchzuführen, Gelegenheit hatte, hübsche Beobachtungen zu machen. Die enttäuschten Ärzte gaben ihm das Gutachten mit auf den Weg, daß er ein »Simulant von schwachem Verstand sei«, und weil man ihn vor dem Mittagessen entließ, kam es zu einem kleinen Auftritt.
Schwejk erklärte, wenn man jemanden aus dem Irrenhaus hinauswerfe, dürfe man ihn nicht ohne Mittagessen hinauswerfen.
5. Schwejk auf dem Polizeikommissariat in der Salmgasse
Auf die schönen sonnigen Tage im Irrenhaus folgten für Schwejk Stunden voller Nachstellungen. Polizeiinspektor Braun arrangierte die Begegnungsszene mit Schwejk mit der Grausamkeit römischer Henkersknechte aus der Zeit des reizenden Kaisers Nero. Hart, wie damals, als man sagte: »Werft diesen Lumpen, den Christen, vor den Löwen«, sagte Inspektor Braun: »Steckt ihn hinters ›Katr‹!«
Kein Wort mehr und kein Wort weniger. Nur die Augen des Herrn Polizeiinspektors Braun leuchteten dabei in einer sonderbaren perversen Wollust.
Schwejk verneigte sich und sagte stolz: »Ich bin bereit, meine Herren. Ich denk, daß Katr dasselbe bedeutet wie Separation, und das is nicht das ärgste.«
»Machen Sie sich hier nicht zu breit«, entgegnete der Polizist, worauf Schwejk sich vernehmen ließ: »Ich bin ganz bescheiden und dankbar für alles, was Sie für mich tun.«