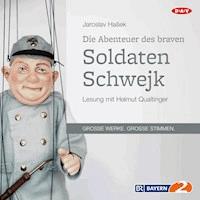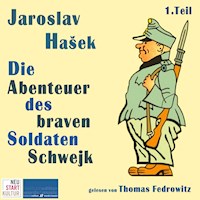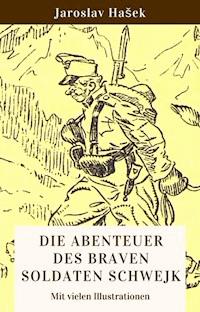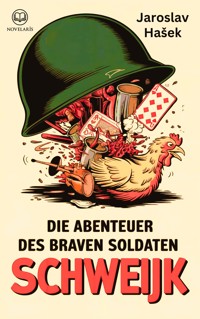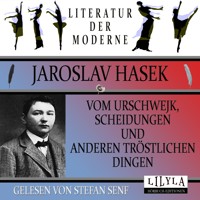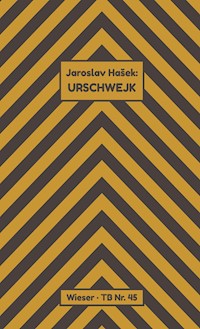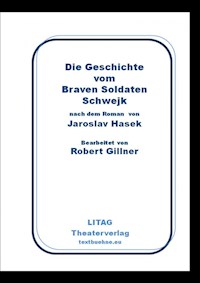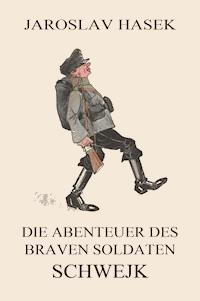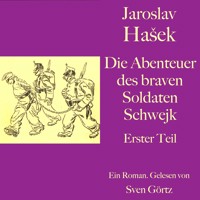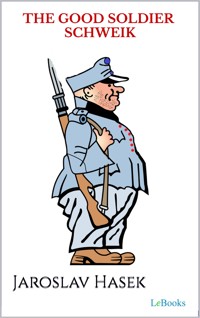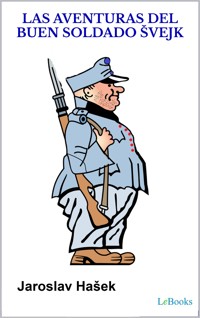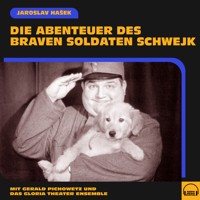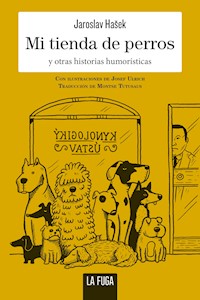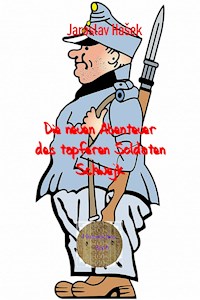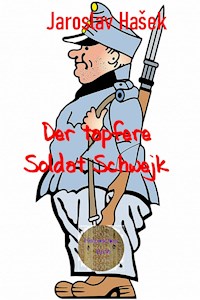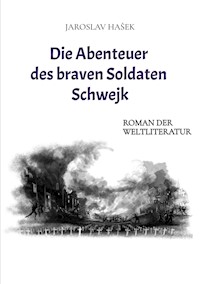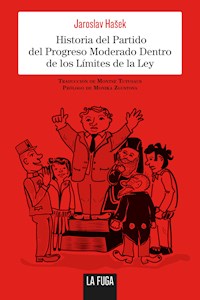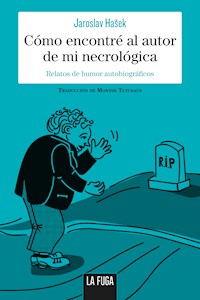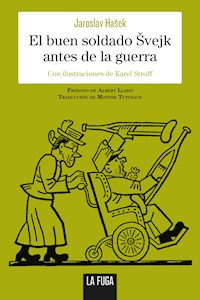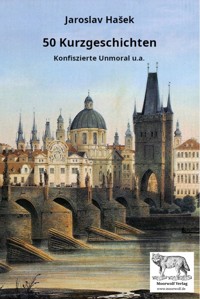
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
50 Kurzgeschichten von Jaroslav Hašek. Er hat darin mit beißendem Humor die gesellschaftliche Zustände gnadenlos aufs Korn genommen. Teilweise musste er sie entfremden, um seine Geschichten durch die Zensur zu bringen. Kriege, Vorgesetzte, Klerus, Bürokratie, Spitzel, Bevormundung, Korruption, Zensur, ..... das alles bietet reichlich Stoff für seine Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jaroslav Hašek
Kurzgeschichten
Konfiszierte Unmoral u.a.
Moorwolf Verlag
Jaroslav Hašek: Kurzgeschichten - Konfiszierte Unmoral u.a.
Moorwolf Verlag
Kontakt: [email protected]
Titelbild: Franz Xaver Sandmann - Karlsbrücke (Ausschnitt)
Vertrieb: epubli
Made in Germany
© Moorwolf Verlag, 2023
ISBN: 978-3-757563-69-1
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Der Praktikant Žemla
Die Korruptionsaffäre des Magistratspraktikanten Bachůra
Von einem Zensor
Eine Berufungsverhandlung
Das kleine körperliche Bedürfnis und die Justiz
Der Mann ohne Fahrkarte
Die Chirurgie und der Zolltarif
Glauben Sie nicht es sei ein Vergnügen mit der Straßenbahn zu fahren
Der mysteriöse Fall mit dem Grabmal
Wie Österreich durch eine Elementarkatastrophe gerettet wurde
Tabak
Eine Hochverratsaffäre in Kroatien
Wie mir die Irredenta in Zadar meine Karriere verdarb
Auf den Spuren der Prager Staatspolizei
Die Staatspolizeischule
Aufruhr in der österreichischen Marine
Ein sonderbares Ereignis
Mörder gesucht
Der Herr Polizei-Oberkommisar Wagner
Die Gerechtigkeit siegt
Konfiszierte Unmoral
Der Scharfsinn des Detektivs Patočka
Im Detektivinstitut
Das Abenteuer des Herrn Karafiát
Ein guter Mensch
Der ehrlicher Finder
Der Verbrecher
Der Lausbubenstreich des Herrn Čaboun
Die Mittel des Herrn Polizeidirektors
Die Feldmütze des Infanteristen Trunec
Wie aus der Mannschaftsküche des Kaschauer Regiment der Schmalz verschwand
Die Geschichte von einem braven schwedischen Soldaten
Eine Militärlieferung
Aus den Aufzeichnungen eine Offiziers
Der verfluchte Ruthene
Die Natur der Lehre vom Trainwesen
Eine Eselsgeschichte aus Bosnien
Der gute Herr Špirk
Das traurige Ende des Kriegsberichterstatters des Prager Tagblatts
Die Beichte des Hochverräters
Nehmen Sie nur, Soldat...
Die Sache mit der Garantie
Die Tragödie die k.u.k. Feldwebels Henry Haller vom 13. Infanterieregiment
Die Verdienstmedaille
Der Fall des Veteranen Kokoschka
An seine Exzellenz den Herrn Finanzminister, Ritter Bilinski, in Wien
Das Märchen vom tragischen Ende eines ordentlichen Ministers
Der Roman des Herrn Chocholka von der Lebensmittelakzise
Der Kreishauptmann von Hořice
Luftfahrt in Böhmen
Vorwort des Herausgebers
Jaroslav Hašek ist einer der bedeutendsten tschechischen Autoren. Weltbekannt wurde sein unvollendetes Werk „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“. Es wurde in über 50 Sprachen übersetzt, und mehrfach verfilmt.
Am 30.April 1883 in Prag geboren, lebe er unter ärmlichen Verhältnissen in dunklen feuchten Wohnungen. Er besuchte ein Gymnasium, welches er aber nach dem frühen Tod seines Vaters, der ein depressiver Alkoholiker war, wieder verlassen musste. Als 11-jähriger wurde er von einem Matrosen, der dann Zuhälter wurde, durch die Bordelle Prags mitgenommen. Das Elend Prags und seiner Kinder hat er früh und erbarmungslos kennen gelernt.
Später begann er eine Lehre in einer Drogerie. Dort wurde er alsbald herausgeworfen, weil er den Unterrock eines Dienstmädchens als rote Fahne über den Dächern Prags hisste. Er trat dann in die Handelsakademie ein, um diese erfolgreich zu absolvieren. Eine Stellung bei einer Bank verlor er, weil er mehrfach nicht zur Arbeit erschien.
Als Chefredakteur von Die Welt der Tiere erfand Hašek eine ganze Reihe neuer Arten für seine Leser: Urzeitliche Flöhe, Riesenangorakaninchen, Schwefelbauchwalfische und lederschuppige Einhornkälber. Er schilderte dort sich bis zur Bewusstlosigkeit betrinkende Papageien und gab Tipps zur Zucht von Werwölfen. Da dieses einigen Lesern, wie auch seinem Herausgeber nicht gefiel, verlor er auch diese Stellung. Danach betätigte er sich als Tierhändler, der Straßenköter zu Rassehunden umfärbte, und mit gefälschten Stammbäumen verkaufte.
Mit 17 Jahren begann er nebenbei und später hauptberuflich Gedichte und Reiseskizzen zu schreiben. Er schloss sich der anarchistischen Bewegung an, ging auf Demonstrationen, und kam viel herum. Er bereiste Österreich-Ungarn, Bosnien-Herzegowina, den Balkan, Italien, die Schweiz, aber auch Dresden, Leipzig, Magdeburg, den Thüringer Wald, Berlin und Hamburg. Dabei ging er den unterschiedlichsten Tätigkeiten nach, als Hilfsarbeiter auf dem Schlachthof, als Fellhändler, Bäckerangestellte, auf einem Lastkahn, und als Bergarbeiter. Gelegentlich machte er auch Bekanntschaft mit dem Gefängnis, wegen „Widerstand gegen die Staatsgewalt" oder „Landstreicherei".
1904 war er Mitbegründer der Satirepartei Partei für gemäßigten Fortschritt in den Schranken der Gesetze.
1912, mittlerweile verheiratet, bekam seine Frau einen Sohn, den er jedoch nur zweimal zu Gesicht bekam, weil sein Schwiegervater ihn alsbald hinauswarf.
Als 1914 der erste Weltkrieg begann, wurde er zur k.u.k. Armee eingezogen. An der Ostfront ließ er sich von den Russen überrennen, um in Gefangenschaft zu kommen. Dort wechselte er nach der Machtergreifung der Bolschewiken zur roten Armee und wurde politischer Kommissar. Aus Russland kehrte er mit einer neuen Frau zurück, deren Ehe aber nicht anerkannt wurde.
„Viermal tot und doch lebendig" schrieb nach seiner Rückkehr die Zeitung České slovo über ihn.
Er nahm in Prag seine schriftstellerischen Tätigkeiten wieder auf. Als Dauergast in Wirtshäusern sammelte er Stoff für seine Geschichten, schrieb sie dort und las sie auch gleich vor. Sein Alkoholkonsum sollen regelmäßige 35 Biere pro Tag gewesen sein. Er musste viel schreiben um diese zu bezahlen, ohne die er aber wohl auch nicht hätte schreiben können.
Bevor Hašek 1923 mit nur 39 Jahren vermutlich auch an seinem Alkoholkonsum starb, hinterließ er neben dem braven Soldaten Schwejk auch noch rund 1500 Kurzprosatexte.
Diese Sammlung von Kurzgeschichten ist ein Teil davon.
Seinen beißenden Humor, mit dem er die gesellschaftliche Zustände gnadenlos aufs Korn nimmt, musste er teilweise entfremden, um seine Geschichten durch die Zensur zu bringen.
Kriege, Klerus, Bürokratie, Spitzel, politische Korrektheit, Bevormundung, Korruption, Zensur, .....
Jaroslav Hašek würde auch heute viel Stoff für neue Geschichten finden.
Husberger Moor Knut Heinzel
Der Praktikant Žemla
Seit Jan Žemla in den Staatsdienst getreten war, hatte er nur den einen Wunsch: die Gunst des Herrn Präsidenten zu erlangen.
Für einen jungen begabten Mann ist es gewiß nicht leicht, sich in einer Behörde durchzusetzen. So war es kein Wunder, daß der Praktikant Žemla eines Tages voll Schrecken feststellen mußte, daß ihm sein Vorhaben bisher nicht gelungen war.
Und doch wollte Jan Žemla dem Staate nützlich sein, der ihn mit zweiundsechzig Kronen monatlich ernährte. Als braver Staatsbürger murrte er jedoch nicht.
So vergingen zwei Jahre, und er hatte es nicht mehr weit zum »wirklichen Praktikanten«. Dann würde er zwar nur ein Gehalt von fünfzig Kronen haben, also zwölf Kronen weniger als jetzt als »unwirklicher Praktikant«, dafür aber das Recht, den Titel eines »wirklichen Praktikanten« zu führen, wodurch ihm zugesichert war, daß er bei guter Führung eines Tages mit einer definitiven Anstellung rechnen durfte.
»Wirklicher Praktikant« mußte er fünf Jahre sein. Dann würde sich ihm plötzlich das Tor zum Paradies öffnen. Er könnte schwören! Er dürfte den Diensteid ablegen und würde »vereidigter wirklicher Praktikant erster Stufe« werden. Spielend vergingen dann weitere drei Jahre. Nach dieser Zeit würde er »vereidigter wirklicher Praktikant erster Stufe mit vierteljährlicher Kündigung«. Nach Ablauf der folgenden zwei Jahre würde er "sodann »nicht definitiver Aspirant« und somit Anwärter auf die Stelle eines »wirklichen Aspiranten«. Er würde dann gerade in den Jahren sein, in denen bei einem normalen Sterblichen die Weisheitszähne schlecht zu werden beginnen.
Dann aber... dann... Seine Phantasie kannte keine Grenzen. In Gedanken durchlief er bereits alle Stufen der Besoldungsklassen.
»Herr Žemla«, sagte da der Offizial Makula zu ihm, »Sie starren ja dauernd zur Decke! Sie tun ganz so, - als wären Sie der Herr Präsident.«
Von diesem Tage stammt die erste Eintragung im »Schwarzen Buch« des Praktikanten Žemla: »Der Offizial Makula sagte vom Herrn Präsidenten, er tue "nichts anderes, als zur Decke starren.«
Das war kein schlechter Einfall mit diesem Schwarzen Buch! Obwohl Žemla ein geduldiger Mensch war, hatte er doch erkannt, daß es auch noch andere Wege zur endlichen Ernennung zum »definitiven Aspiranten mit vierteljährlicher Kündigung« geben müßte.
Der Staat war der Brotgeber. Aber wenn man in eine solche Behörde Einblick nimmt, erkennt man, daß gerade die am besten gefütterten und genährten Menschen am meisten auf ihren Brotgeber, den Staat und seine Vertreter im Amte, schimpfen.
Eines Tages, als Jan Žemla gerade über den Übermut der Untergebenen nachdachte, war in seiner ehrlichen Seele der Gedanke aufgekeimt, ein Schwarzes Buch anzulegen, ein Buch über die Sünden des Personals, ein Buch, in dem alle bösen Taten und Handlungen seiner Kollegen im Amte, alle schlechten Gedanken, Grimassen und Gesten verzeichnet werden sollten, all das, was man als Aufruhr, Geheimbündelei und als üble Nachrede gegenüber dem Herrn Präsidenten, dem Vertreter seines Brotgebers und des Brotgebers aller jener, bezeichnen konnte, die heimtückischerweise nicht das Lied dessen sangen, dessen Brot sie aßen.
In diesem Buche sollte also alles vermerkt werden. Jeder Praktikant, Diener, Aspirant, ob definitiv oder nicht definitiv, Adjunkt und Offizial würde darin seine Rubrik haben.
Zeitlebens hatte Praktikant Žemla nie so viel Mühe auf eine Arbeit verwandt wie nun auf die sorgfältige Ausfüllung aller dieser Rubriken in seinem Schwarzen Buch.
Wie schon erwähnt, galt die erste Eintragung Offizial Makula. Sie lautete:
Name: Offizial Makula.
Tag: 14. März.
Tat: Er erklärte, der Herr Präsident tue nichts anderes, als zur Decke starren.
Eindruck auf das übrige Personal: schlecht, alle lachten, nur der nicht definitive Praktikant Žemla verzog keine Miene.
»Warte nur, mein Freund Makula!« dachte Žemla bei sich. »Das hast du davon, daß du zwar selbst rauchst, mir aber das Rauchen in der Öffentlichkeit nicht gestattest!«
In dem Schwarzen Buch wuchsen die Bemerkungen, die ein schlechtes Licht auf die Disziplin in der Behörde warfen, erfreulich an:
Der wirkliche Praktikant mit vierteljährlicher Kündigung Jurajda sagte am 21. März: »Hier ist ja das reinste Narrenhaus!« Alle stimmten zu, nur Žemla ging auf den Flur.
Der Diener Karas erklärte am 21. März mit gedämpfter Stimme: »Dies ist ein Platz für Esel.« Wenn das den anderen zu Ohren gekommen wäre, hätte es einen schlechten Eindruck gemacht, und viele hätten gelacht. Der Praktikant Žemla ermahnte aber den Diener Karas: »Sie sind noch nicht definitiv angestellt, denken Sie daran, was Sie sagen!«
Am 22. März sagte der Aspirant Klučina: »Der Herr Präsident ist ein Ochse!« Alle stimmten zu, nur der Praktikant Žemla sagte kein Wort und vertiefte sich in seine Arbeit.
Am gleichen Tage sprach der Herr Oberoffizial Heller unehrerbietig über die Gattin des Herrn Präsidenten: »Ich habe diese alte Schraube mit unserem Alten im Auto gesehen. Der wäre auch froh, wenn der Fahrer in einen Teich führe. Dann würden er und der Fahrer sich retten.« Das machte auf Jan Žemla, der immer noch nicht definitiver Praktikant ist, einen niederschmetternden Eindruck. Am meisten lachten der Diener Bilek und der Konzipist Biner. Offizial Makula sagte: »Geben Sie Ruhe, mir tut schon der Bauch vom Lachen wehl«
23. März. Die Praktikanten Kander und Šeba unterhielten sich miteinander. Šeba machte laut abfällige Bemerkungen über den ganzen Behördenapparat. Es war etwas so Schreckliches, daß sich der noch immer nicht definitive Praktikant Jan Žemla die Ohren zuhielt, um die folgenden Worte nicht zu vernehmen: »In der Behörde verliert man die jungen Jahre, bevor man das ersehnte Ziel erreicht... .« »Sie haben recht«, sagte darauf Praktikant Kander, »Hier kann man nichts, als die Menschen ausnützen und dabei sind die hohen Herren alle Esel.« Bei diesen Worten räusperte sich der Praktikant Jan Žemla und meinte: »Hier ist es aber heiß!« Darauf sagten beide laut: »Der Herr Präsident würde es verdienen, daß man ihm gründlich einheizt.«
24. März: An diesem Tage hatte der Praktikant Žemla einen Streit mit einem Menschen aus dem Amt. Dieser Mensch ist nur ein Diener, hat zwei Kinder und noch keine definitive Anstellung. Trotzdem erlaubte er sich folgende Bemerkung: »Der Herr Präsident bildet sich ein, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben, dabei ist er ein rechter Trottel. Heute hat er mich nach Prager Salami geschickt und weiß gar nicht, daß er Wurst von Karabec gegessen hat.« Als der nicht definitive Praktikant Jan Žemla fragte, was das Wort »Karabec« bedeute, wurde ihm gesagt, das sei eine luxuriöse Roßschlächterei. Daraufhin verließ Jan Žemla augenblicklich die Kanzlei, um nicht den allgemeinen Heiterkeitsausbruch mit anhören zu müssen. Hinter der Tür hörte er den Adjunkten Klazar am lautesten lachen und ausrufen: »Da weiß dieser Trottel nicht einmal, was er frißt!«
25. März: Offizial Peska machte schlechte Witze und äffte den Herrn Präsidenten nach, wobei er seine Redeweise und seine Gesten nachahmte. Er machte eine lächerliche Figur und sagte: »Äh, äh, äh, meine Herren, ja, ja, ja, es freut mich, daß Sie arbeiten. Ja, ja, ja, immer tüchtig sein!« Nach diesen Worten ergab sich eine allgemeine Heiterkeit, an der sich jedoch der nicht definitive Praktikant Žemla nicht beteiligte, weil er an diesem Tage wie immer eifrig mit der ihm übertragenen Arbeit beschäftigt war, um sie rechtzeitig fertig zu haben und keine »Reste« übrigzu- behalten wie andere Herren in dieser Abteilung, die direkt aus Nachtcafes und anderen Lokalen, in denen sie bestimmt kein anständiges Wort hören, zum Dienst kommen.«
26. März: An diesem Tage kam der Oberoffizial Koudelka von der Abteilung fünf zu uns und sagte
zu unserem Oberoffizial so laut, daß wir es alle hörten: »Es ist doch wahr! Der Herr Präsident hält ein Fräulein aus. Gestern begegnete ich ihm zufällig, als er mit ihr in eine Kutsche stieg. Wenn das publik würde, gäbe es einen großen Skandal .. .«
Am nächsten Tag »verlor« der Praktikant Žemla sein Schwarzes Buch in der Kanzlei des Herrn Präsidenten....
»Herr Žemla, sofort zum Herrn Präsidenten!« ertönte es zwei Stunden später aus dem Telefon.
Hoch erfreut eilte Herr Žemla zur Kanzlei des Präsidenten, wo er ganz außer Atem ankam. Endlich! Ihm winkten Belohnung und Aufstieg.
»Herr Žemla!« sagte der Herr Präsident, »was Sie da geschrieben haben, ist ja alles ganz hübsch, bis auf das Letzte! Mensch, so etwas machen Sie während der Amtsstunden? Sie sind fristlos aus dem Staatsdienst entlassen. Damit haben Sie sich Ihre Karriere verscherzt. So etwas zu schreiben, statt amtliche Schriftstücke auszufertigen! Kerl, verschwinden Sie, aber augenblicklich . . .!«
Die Korruptionsaffäre des Magistratspraktikanten Bachůra
Der Magistratspraktikant Bachůra war ein junger, unerfahrener Mann, der noch nicht wußte, daß für Menschen seines Schlages beim Magistrat tausenderlei Gefahren lauern und daß es eines festen Charakters bedarf, wenn ein Praktikant nicht unterliegen und in eine Korruptionsaffäre verwickelt werden will. Mit seinen Vorgesetzten oder auch ohne sie.
Der Magistratspraktikant Bachůra wußte nicht, daß die Hydra Mammon nur darauf lauert, die zarten Seelen der Magistratspraktikanten zu verschlingen, so wie sie bereits manches graue Haupt eines Stadtverordneten verschlungen hat.
Keine der großen Korruptionsaffären im Rathaus, die die öffentliche Meinung erregten, läßt sich jedoch auch nur im entferntesten mit der Affäre des Praktikanten Bachůra vergleichen.
Heute irrt der korrumpierte Bachůra wie einst Judas durch die Welt, denn er hat die reine Fahne des Rathauses in den Schmutz gezerrt, ja sogar sie selbst befleckt.
Um in die ganze unangenehme Geschichte einzudringen, müssen wir bei der Prager Kleinseite beginnen.
Auf der Kleinseite befindet sich im Wirrsal altertümlicher Gäßchen das Gasthaus des Herrn Šedivy. Dieser Herr Sedivy war einer jener altväterischen Menschen, die den Gesundheitsvorschriften des Magistrats keine Beachtung schenkten und die Ventilationsrohre vielleicht jahrzehntelang im Pissoir münden ließen.
Die Gäste beschwerten sich niemals, denn das Bier war gut, und im Pissoir war es ohnehin ständig dunkel.
Dieses Pissoir, das in der Korruptionsaffäre des Praktikannten Bachůra eine wichtige Rolle spielt, besaß kein Fenster zum Lichtschacht, ja überhaupt keine Öffnung, die wenigstens einen Strahl Tageslicht in das Innere des traurigen, feuchten Raumes eingelassen hätte, um diesen düsteren Ort lichter und heiterer zu machen.
Diejenigen aber, die das Gasthaus aufsuchten, um hier ihr Bier zu trinken, waren durchaus zufrieden. Die konservative Kleinseite protestierte in ihrer steinernen Erstarrung nicht dagegen. Aber es kam eine Zeit, in der das moderne zivilisierte Leben nach dem Pissoir des Herrn Šedivy griff.
Eine Baukommission stellte. die beiden fürchterlichen Dinge fest: die in das Pissoir mündenden Ventilationsrohre (was sofort der Gesundheitskommission gemeldet wurde) und das unbeleuchtete Pissoir ohne eine ins Freie führende Öffnung.
Und so geschah es, daß der Magistratspraktikant Bachůra als Schriftführer der Baukommission die Bekanntschaft des Herrn Šedivy machte.
Mit einem vernichtenden Blick verfolgte er alle Bewegungen des Gastwirts, der fest und kampflustig erklärte, die ganze löbliche Kommission sei noch nicht auf der Welt gewesen, als man in diesem Pissoir bereits seine Notdurft verrichtete, und es sei auch gegangen; dazu brauche man kein Licht. Wenn eine Abflußrinne vorhanden sei, genüge das vollkommen. Der Raum habe ja eine Tür; das sei eine genügend große Öffnung, um Luft einzulassen.
»Mäßigen Sie sich!« sagte man ihm. »Damit Sie sich nicht noch eine Beamtenbeleidigung zuziehen! Glauben Sie denn, es ist ein Vergnügen, von einem Pissoir zum andern zu gehen ?«
Dann wurde ihm aufgetragen, die Mauer durchbrechen und in das Pissoir ein Fenster einsetzen zu lassen. Da es sich jedoch um eine bauliche Veränderung eines gastgewerblich genutzten Raumes handle, müsse er einen Bauplan sowie ein Gesuch einreichen, die Wand durchbrechen zu dürfen.
Das war am Vormittag. Am Nachmittag kam die Gesundheitskommission und ordnete an, die Entlüftungsrohre durch die neuzuschaffende Öffnung in den Lichtschacht zu führen.
Herrn Šedivy drehte sich der Kopf. Da sollte also die Mauer durchbrochen werden, so war es angeordnet. Zuerst aber mußte er einen Plan vorlegen und um die Bewilligung nachsuchen, die Mauer durchbrechen zu dürfen. Und nun sollte er, angeblich aus Gesundheitsrücksichten, auch noch die Ventilationsrohre in den Lichtschacht leiten, in den doch die Fenster aller Aborte aus dem ganzen Hause führten.
Nach einer schlaflosen Nacht ging er zu einem Maurermeister und bat ihn, einen Plan für den Fensterdurchbruch zu entwerfen. Hierauf ließ er durch einen Schreiber, der gewerbsmäßig Behördengesuche verfaßte, ein Gesuch einreichen, der hochwohllöbliche Magistrat möge die das Pissoir betreffenden Pläne binnen kürzester Frist genehmigen und die Durchbrechung der Mauer zwecks Anbringung eines Fensters gestatten, wofür er gelobe, sich durch gutes Betragen im Alter dankbar zu erweisen.
Es vergingen drei Wochen, und das Gesuch war noch immer nicht erledigt.
Herr Šedivy begab sich also zum Magistrat, um die Angelegenheit zu beschleunigen.
Im Baureferat traf er nur den Praktikanten Bachůra an, denn die anderen saßen seit neun Uhr im gegenüberliegenden Gasthaus beim Frühstück. Jetzt war es gerade zwölf Uhr.
»Was wünschen Sie?« fragte der Praktikant Bachůra würdevoll.
» Junger Herr, wissen Sie, ich komme wegen meines Pissoirs, wegen Šedivys Pissoir auf der Kleinseite. Sie erinnern sich doch ?«
»Ja, ich entsinne mich«, erwiderte Bachůra feierlich, ‚sich glaube jedenfalls, mich zu entsinnen. Und was wollen Sie eigentlich ?«
»Es sind nun schon drei Wochen vergangen, seit ich mein Gesuch eingereicht habe, und es würde nicht schaden, die Sache zu beschleunigen. Meine Gäste freuen sich schon wie die kleinen Kinder auf das Fenster, bei uns geschieht nämlich nie etwas, und das ist ein Ereignis.«
Bachůra wußte, daß das Gesuch längst erledigt war und in einem Fach lag. Man brauchte es nur zu expedieren. Aber der Bürovorsteher hatte zu ihm gesagt: »Schicken Sie es noch nicht ab! Soll dieser Kerl von einem Gastwirt warten! Der Magistrat muß solche Leute fest an der Kandare halten.« Bachůra schwieg eine Weile und sagte dann mit ernster Miene: »Nun, wir werden sehen, was sich machen läßt.«
Etwa eine Woche nach diesem Besuch ging Bachůra privat über den Franzenskai. Er hatte dort nämlich ein Stelldichein mit einem Fräulein, das froh war, einen Herrn vom Magistrat gefunden zu haben.
Es war ein schöner Nachmittag, warm und heiter. Bachůra blieb bei einem Erfrischungskiosk stehen, ließ sich je ein Glas Himbeer- und Zitronenlimonade ein- schenken und ging dann in Gedanken an sein Mädchen, mit dem er sich bald treffen würde, weiter.
Am Horizont grüßte der Hradschin, der Laurenziberg war in frisches Grün getaucht, und auf der Schützeninsel blühten die Kastanien. Aber inmitten all dieser Schönheit bekam Bachůra plötzlich Bauchschmerzen. Er hatte kurz vor dem Verlassen seiner Wohnung ein Glas Joghurt, die Nationalspeise der geschlagenen Bulgaren, getrunken; nun hatten Himbeer- und Zitronenlimonade den unerbittlichen Prozeß im Labyrinth seiner Därme vollendet.
Am Moldauufer steht im Park ein kleines Häuschen. Zwar ist es klein, aber es ist wichtiger als alle anderen Häuser in der Umgebung. Es trägt zwei Aufschriften. Vom Kai aus kann man die Tafel »Für Herren«, vom Kinderspielplatz im Park aus die diskreter angebrachte Aufschrift »Für Damen« lesen.
In dieses Häuschen stürzte Bachůra, wie ein Löwe, wie ein durstiger Araber in der Wüste zu einer Zisterne, wie die Assentierungskommission auf die Rekruten.
»Erste oder zweite Klasse ?«
»Zweite«, stieß Bachüra bescheiden, aber schnell hervor. Die Alte blickte ihn an und sagte: »Sie kenne ich doch von irgendwoher, junger Herr?« und riß einen Zettel vom Block.
Bachůra griff ins Portemonnaie und rief entsetzt: »Das ist doch nicht möglich! Ich dachte, ich hätte noch einen Sechser!«
Die Alte schaute ihn noch einmal an und sagte dann bedächtig, wodurch sie die entsetzliche Situation Bachůras noch verschlimmerte: »Wissen Sie, woher ich Sie kenne? Von meinem Bruder, dem Gastwirt Šedivy auf der Kleinseite. Ich war damals gerade bei ihm, als Sie mit der Kommission wegen des Pissoirs dort waren. Nehmen Sie nur den Zettel! Bei Ihnen sind wir sicher!«
Bachůra sprang erleichtert in das kleine Separee.
Als er sich glücklich und fröhlich entfernte, rief ihm die Alte nach: »Und vergessen Sie nicht, junger Herr, meinem Bruder die Erledigung wegen des Aborts zu schicken!«
Ohne den Bürovorsteher zu fragen, schickte Bachůra gleich am nächsten Tag das erledigte Gesuch und die bereits seit Wochen schlummernden genehmigten Pläne an Herrn Šedivy und atmete daraufhin erleichtert auf.
Jeden Morgen gegen neun Uhr suchte der Herr Magistratsrat Stanĕk das kleine Häuschen am Franzenskai auf, den Schauplatz jener abscheulichen Korruptionsaffäre des Magistratspraktikanten Bachůra. Er tat dies, um sich darüber zu informieren, wie die Öffentlichkeit die Arbeit des Magistrats beurteilte, denn die Alte vom Toilettenhäuschen war für ihn die Stimme des Volkes. Das war nun einmal sein Steckenpferd.
»Sehen Sie, Euer Gnaden, die Korruption erfaßt jetzt schon die Kleinsten«, erzählte die Alte, »ja, so sind diese Herren vom Rathaus, wenn man sie einmal umsonst läßt, gehen sie einem gleich an die Hand, so wie meinem Bruder...« Und sie berichtete dem Herrn Rat bis in alle Einzelheiten die ganze abscheuliche Korruptionsaffäre des Magistratspraktikanten” Bachůra.
Heute sitzt an Bachůras Platz bereits ein anderer Praktikant, denn Bachůra wurde nach Beendigung des Disziplinarverfährens, in dessen Verlauf man ihm in der Angelegenheit des Gastwirts Šedivy Bestechlichkeit nachwies, entlassen.
Nun irrt er wie einst Judas durch Europa. Zuletzt wurde er in Hamburg dabei beobachtet, wie er verdächtig in das schwarze Wasser eines Kanals blickte.
Jemand hat eines seiner Selbstgespräche belauscht: »Wenn ich wenigstens ein Abonnement für das ganze Jahr bekommen hätte... Aber so... Jaja! Kleine Diebe hängt man.. .«
Von einem Zensor
Zu der Zeit, als noch nicht eine solche Pressefreiheit herrschte wie heute, in einer Zeit, als noch Druckwerke konfisziert wurden, was heute auf der Welt nirgends mehr geschieht, lebte in einem gesegneten Lande ein Zensor, der einen Wasserkopf hatte.
Vom medizinischen Standpunkt war dieser Zensor dadurch interessant, daß das Wetter einen gewissen Einfluß auf die Ausdehnung des Wassers in seinem Kopf hatte. Wie das Wetter spielten auch Sonne und Mond eine wichtige Rolle im Leben des Zensors, da sie das Volumen des Wassers in seinem Kopf veränderten.
Er selbst nannte diese Erscheinung »Ebbe und Flut«. Entweder nahm das Wasser in seinem Kopf zu, oder es nahm ab, immer aber hatte er genug Wasser im Gehirn.
Er war Mitglied eines Klubs, dessen Mitglieder voll Verachtung auf jene Menschen blickten, die kein Wasser im Kopf hatten. »Idiotenklub« stand über der Tür des Klubraums, und in diesem Klub war der Herr Zensor Vorsitzender.
In dieser Eigenschaft kümmerte er sich unermüdlich um die geistige Entwicklung der Klubmitglieder und hielt selbst oft und gern für sie Vorträge: was Zensoren sind, warum es Zensoren gibt, weshalb Zensoren sein müssen und wie es wäre, wenn es keine Zensoren gäbe.
Diese Vorträge waren äußerst geistreich, schon deshalb, weil der Herr Zensor nur dann sprach, wenn | das Wasser in seinem Kopf stieg.
In diese geistvollen Vorträge über seinen erhabenen Beruf streute er Erwägungen über die Ordnung in der Welt sowie Gedanken über den Staat und über gute Staatsbürger ein, wobei er seine Ausführungen mit einer Reihe von Aphorismen würzte, die von ihm selbst stammten.
In jedem seiner Vorträge legte er dar, daß es auf der Welt Menschen und Tiere gäbe. Diesen Satz belegte er, indem er mit markanten Worten auf sein eigenes Dasein verwies.
Er sagte, die Menschen könne man in zwei Gruppen einteilen, in solche, die kein Wasser im Kopf hätten, und in Menschen mit einem Wasserkopf. Im Staate erfreuten sich allein Menschen dieser zweiten Gruppe der verdienten Wertschätzung. Dafür gab er Beispiele. Er nannte sich selbst und die übrigen Klubmitglieder und sagte, von diesen geschätzten Bürgern erfreuten sich die Zensoren größter Beliebtheit, ja sie seien noch beliebter als die Polizisten, die sich zwar ebenfalls großer Beliebtheit erfreuten, wenn auch nicht so großer wie sie. »Jeder Zensor«, sagte er, »weiß um diese Beliebtheit, deren er sich erfreut, und ist stolz darauf.«
Dann erläuterte er, was jeder Zensor habe: einen Kopf, zwei Ohren, eine Nase, einen Mund, Arme und Beine, Hals, Haare und Schnurrbart, einen Nabel, oft einen Penis und mitunter auch ein Muttermal. Von den Vierfüßlern unterschieden sich die Zensoren dadurch, daß sie in der Mehrzahl der Fälle paarweise gehen, keine körperliche Berührung mit Tieren haben, sprechen, rauchen und Schnaps trinken - und auf die Reinheit der Presse achten.
Jeder Zensor trüge Socken, Unterhosen, ein Hemd, alles mit seinem Namen gezeichnet. Taschentücher brauche er nicht, denn jeder anständige Zensor sei verpflichtet, sich die Nase mit dem Papier konfiszierter Druckschriften zu putzen.
Ferner trüge jeder Zensor eine Hose, möglichst so genäht, daß sie nicht Anstoß errege. Sie dürfe also nicht so eng sein, daß sie hinten aufplatzen könne. Die Zensoren trügen ferner Weste und Jacke, und zwar deshalb, damit sie etwas an sich hätten, was ihnen selbst der ärgste Feind nicht vorwerfen könne. Bei Bedarf könne jeder seine Wäsche wechseln. Ferner gäbe es Mäntel und Hüte. Auch diese benütze ein Zensor wie jeder andere. Warum gäbe es dann also Menschen, die die Zensoren am liebsten anspucken wollten?
Er legte sich diese Frage vor und beantwortete sie in seinem Vortrage gleich ungemein scharfsinnig und witzig: Nur deshalb, weil diese Menschen kein Wasser im Kopf hätten. Ein Mensch, der Wasser im Kopf hätte, verfüge über einen weit schärferen Verstand als ein Mensch ohne Wasserkopf, man sage ja, Wasser reinige den Verstand. Die Überlegungen der Zensoren seien deshalb weit geistreicher als die von Menschen ohne Wasserkopf.
Nun gab der Zensor Beweise aus seiner Tätigkeit, berichtete von Menschen, die naiverweise etwas druckten, obwohl sie, wenn sie wie er einen Wasserkopf besäßen, den Verfasser des Artikels schon längst aus der Redaktion hinausgeprügelt, ihn dann wieder in die Redaktion hineingezerrt und in den Papierkorb geworfen hätten, damit man ihn am Morgen mit in den Ofen stecke.
Für diese seine Behauptungen führte er auch ein Beispiel an: In einer Zeitung habe man sich erdreistet, folgenden Satz zu drucken: »Die Exkremente der Fledermäuse sind schwarzbraun.« Diesen Satz habe er wegen grober Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit konfiszieren müssen. Jeder denkende Mensch werde zugeben, daß das Wort »Exkremente« nicht in eine Zeitung passe, da es die Moral weitgehend verletze. Wenn jemand dieses Wort lese, und sei es auch in der Verbindung »Exkremente der Fledermäuse«, müsse er gleich an einen Abort denken, ‚und weil das entschieden eine unmoralische Sache sei, müsse dieser Begriff ausgemerzt werden.
Sei es etwa nicht seine heiligste Pflicht gewesen, folgenden Vers zu konfiszieren: »Der Frühling ist voll Fruchtbarkeit, es atmet alles Liebe.« Auf den ersten Blick würde darin niemand eine Aufforderung zu Taten sehen, die die Scham und die öffentliche Sittlichkeit verletzen. Analysiere man aber diese Verse, so fielen einem die Worte »Fruchtbarkeit« und »Liebe« ins Auge. Also: fruchtbare Liebe und Frühling. Er, der Zensor, habe zu Hause einen Kater und eine Katze, und sobald der Frühling anbreche, würden der Kater und die Katze..., kurz und gut, der Zensor wisse, was der Dichter mit seinem fruchtbaren Frühling und der Liebe sagen wollte. Schaut euch den Kater und die Katze des Herrn Zensors an und macht es wie diese Tiere! Einmal habe er sich auch gezwungen gesehen, in einer anderen Zeitung folgenden Satz zu konfiszieren: »Ein armer Mann schleppte sich mühsam über die Straße, während eine Equipage an ihm vorüberfuhr. Der arme Mann blickte versonnen dem sich entfernenden Gefährt nach.« Wieder könnte man sagen, das sei ganz unschuldig geschrieben. Gewiß, aber man müsse zwischen den Zeilen lesen. Das Wort »versonnen« beinhalte den Tatbestand eines Verstoßes gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung, denn der arme Mann habe ja dabei nachgedacht. Worüber er nachdachte, werde in dem Artikel zwar nicht gesagt, aber man könne es sich leicht denken. Sicherlich habe er gedacht, er könnte auf den Wagen springen, den Lakaien töten, mit seiner schmutzigen Faust die Herrschaft im Wagen erschlagen und sich ihres Geldes bemächtigen.
Und was sagten die Mitglieder des Klubs zu folgendem Satz: »Bei uns gibt es 127 600 Schnapsbuden und 18 200 Schulen. Auf eine Schule kommen also sieben Schnapsbuden.« Hochansehnliche Versammlung! Was gibt es in einer Schule außer Schülern, Lehrern und Bänken? Das Kreuz. Und ferner? Das Bild des Monarchen. Nun lese man diesen einen konfiszierten Satz nochmals: Auf eine Schule kommen sieben Schnapsbuden! Begreifen Sie, was man damit sagen wollte? Der Monarch ist ein Schnapsbruder! Aus diesem Grunde ist das Verbrechen der Majestätsbeleidigung und das Verbrechen der Verächtlichmachung der Religion gegeben, weil heimtückischerweise auch das Kruzifix mit einbezogen ist.
Die Vorträge des Herrn Zensors über seine Tätigkeit lösten allgemeine Erregung aus. Mehrere Psychiater schickten einander grobe Briefe, weil jeder als erster nachweisen wollte, daß der Herr Zensor ein Irrer oder ein Idiot sei.
Allen diesen Redereien machte der Herr Zensor durch folgende im Regierungsblatt veröffentlichte Erklärung ein Ende:
Im Hinblick auf den nicht abreißenden Streit der Herren Psychiater, ob ich ein Irrer oder ein Idiot bin, erkläre ich folgendes: Ich wurde mit einem so großen Kopf geboren, daß ich einige Jahre hindurch ein Bleipüppchen spielen konnte, das immer auf den Kopf fällt. Mit Recht konnte also jeder sagen, ich sei auf den Kopf gefallen. Damit möchte ich nicht behaupten, daß ich die Bezeichnung »Idiot« ablehne. Sonst würde ich ja nicht im Interesse des Klubs handeln, dessen Vorsitzender ich bin. Warum soll man mich aber als »Narr« oder als »Trottel« bezeichnen? Man kann mich doch so ansprechen, wie es die meisten Menschen tun: »Herr Zensor!«
Diese seine Erklärung im Regierungsblatt konfiszierte er selbst und hängte dem Redakteur ein Verfahren wegen Ehrabschneidung, begangen in einem Presseorgan, an. Seither hieß es von ihm, er sei unparteiisch.
Sorgfältiger als zuvor begann er, auch die »direkte Aktion« zu beachten. Der Teufel mag wissen, wie viele Menschen von einer »direkten Aktion« schrieben! Er kam kaum nach, alle Artikel zu konfiszieren, in denen diese beiden Wörter auftauchten. Sie brauchten auch nicht nebeneinander zu stehen, ja nicht einmal auf derselben Seite. Es genügte beispielsweise, wenn auf der ersten Seite stand: »Die direkte Reihenfolge läßt sich "nicht genau feststellen«, und auf der nächsten: »Die "Aktion zum Ankauf einer größeren Menge von Aktien entwickelt sich erfreulich.« Er fand es trotzdem heraus. Dabei ließ er sich auch nicht dadurch täuschen, daß die beiden Sätze auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hatten.
Ebenso sah er sich gezwungen, einen fünfhundert Seiten langen Roman zu konfiszieren, weil sich darin folgende Sätze fanden: Reisen bildet. Der Fremde war in der Stadt unbekannt. In einem Gasthof stieg er ab. Zehn Meilen von der Stadt ragte ein hoher Berg empor. Orinoko ist der Name eines Flusses; Sieben Stunden wanderte er auf der Landstraße. Um neun Uhr erreichte er die Stadt. Nirgends fand er Ruhe. Selten war ihm das Glück so hold. Eva war schön. Mutterseelenallein stand sie in der Welt. Tulpen blühten im “Garten. Mein Vater wurde neunzig Jahre alt. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Die Nase ist ein Körperteil. - Eine Hand wäscht die andere.
Unschuldige Sätze? Wenn man sie richtig ordnet, - erhält man:
Der Fremde war in der Stadt unbekannt.
Eva war schön.
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.
Zehn Meilen von der Stadt ragte ein hoher Berg empor.
Eine Hand wäscht die andere.
Nirgends fand er Ruhe.
Sieben Meilen wanderte er auf der Landstraße.
Orinoko ist der Name eines Flusses.
Reisen bildet.
In einem Gasthof stieg er ab.
Selten war ihm das Glück so hold.
Tulpen blühten im Garten.
Die Nase ist ein Körperteil.
Um neun Uhr erreichte er die Stadt.
Mein Vater wurde neunzig Jahre alt.
Mutterseelenallein stand sie in der Welt.
Und nun ergeben die Anfangsbuchstaben: »Der Zensor ist dumm.« Welche Frechheit!
Als das bekannt wurde, hieß es, der Zensor sei verbohrt und unsittlich. Das muß einer ja wohl sein, der sich die Arbeit macht, aus fünfhundert Seiten einzelne Sätze herauszusuchen und sie so anzuordnen, daß man dem Schriftsteller etwas am Zeuge flicken kann.
Und doch schlug auch für den Herrn Zensor das letzte Stündlein. Eines Tages erhielt er folgenden Brief:
An den Herrn mit dem Wasserkopf!
Sobald irgendwo die Rede von einer direkten Aktion ist, konfiszieren Sie gleich die Stelle. Sie Unglücklicher! Eine direkte Aktion führen Sie ja schon längst selbst durch. Sie essen, um nicht Hungers zu sterben, Sie trinken, um nicht vor Durst umzukommen, Sie gehen auf die Toilette, um nicht zu platzen. Herr Zensor! Wenn Sie ein Mensch sind, der die direkte Aktion wirklich haßt, richten Sie sich danach!
Seit dieser Zeit war der Zensor traurig. Er, der so oft das verdammte Wort konfisziert hatte, führte selbst eine direkte Aktion durch! Er aß, er trank, er suchte die Toilette auf.
Und er beschloß, sich selbst zu konfiszieren. Er aß nicht mehr, trank nicht mehr und ging nicht mehr auf die Toilette. Als er es nicht mehr aushalten konnte, sprang er vom dritten Stock auf die Straße. Und er erschlug sich, konfiszierte sich selbst auf eine neue Weise.
Aus seinem Körper floß das Blut in Strömen, wie bei einem geschlachteten Ochsen, und aus seinem Kopf ergoß sich soviel Wasser, daß ein vorüber humpelnder Invalide darin ertrank.
Eine Berufungsverhandlung
Vor dem Berufungs-Pressesenat wurde eben über den Einspruch gegen die Konfiskation einer Broschüre verhandelt. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Broschüre einen Verstoß gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung erblickt.
Die Mitglieder des Senats saßen an einem langen Tisch, und von der Stelle aus, an der sonst ein Rechtsanwalt steht, verteidigte der junge begeisterte Autor, Redakteur einer sozialistischen Tageszeitung, seine Broschüre.
Die Worte flossen ihm wie Honigseim von den Lippen, und er redete wie mit Engelszungen. Eben erläuterte er die Begriffe »Revolution« und »Evolution« und sagte, gerade dieser und jener Satz hätte niemanden verletzen können, weil er eine bloße Zitierung der Geschichte darstelle, wie sie in der Schule gelehrt werde.
Der Vorsitzende des Senats blickte ihn an, hörte ihm aber nicht zu. Im Laufe seiner langjährigen Praxis hatte er gelernt, jemandem auf den Mund zu schauen, ohne hören zu müssen, was der Betreffende sprach. Es war ihm auch völlig gleichgültig, was hier vorgetragen wurde. Er schaute und schaute - und befand sich im gleichen Zustand wie ein ermüdeter Soldat, ‚der schläft, aber trotzdem weitermarschiert. Auch jetzt blickte er den jungen Mann unverwandt an, dachte aber an etwas ganz anderes.
Der begeisterte junge Mann, der seine Sache verteidigte, glaubte, seine Worte interessierten den Herrn Vorsitzenden ungemein, und öffnete die Schleusen seiner Beredsamkeit noch mehr. Er sprach mit allem Elan und blickte dabei dem Herrn Vorsitzenden gespannt in die Augen.
Der dachte gerade angestrengt darüber nach, was eigentlich seinem heutigen Morgenkaffee gefehlt haben könne. Die Sahne sei einwandfrei gewesen, hatte seine Frau gesagt, der Kaffee wie gewöhnlich frisch aus der Kaffeebrennerei, der Zusatz aus dem Werk in Kolin - und trotzdem war es nicht der gleiche gute Kaffee gewesen wie sonst.
Wieder verweilte sein Blick auf dem Redner, und er dachte: Du könntest auch Manschetten tragen!
Der begeisterte junge Mann sprach weiter und gestikulierte heftig mit den Händen.
Aha, die Manschetten hat er auf den Tisch gelegt! stellte der Herr Vorsitzende schließlich fest, und sein Blick wanderte nun zu seinem Nachbarn, einem Gerichtsrat, dem zweiten Mitglied des Senats.
Dessen Augen ließen klar erkennen, daß ihm der Einspruch allzu lang erschien und daß er wohl ein bißchen schlummern müsse. Er stützte also den Kopf in die Hände, so daß es aussah, als vergleiche er den Text der beschlagnahmten Broschüre; damit man ihn nicht beobachten konnte, baute er zuvor die Gesetzbücher wie eine Barriere vor sich auf und begann zu schnarchen.
Das dauerte jedoch nicht lange, denn das dritte Mitglied des Senats stieß ihn an und flüsterte: »Jetzt habe ich wieder ein Stechen im Kreuz verspürt, Herr Kollege!« Er hatte Rheumatismus und mußte sich gegen die Rückenlehne des Sessels stützen, so daß er die Augen nicht schließen konnte, ohne daß es der Redner bemerkte. |
So machte er denn ein gequältes Gesicht, gähnte herzhaft und beschäftigte sich sodann mit den vor ihm liegenden Akten. Auf eines der Blätter hatte er einen Hund gemalt, und nun radierte er ihm nacheinander Schwanz, Beine und Kopf weg. Dies tat er gedankenverloren, denn er war bereits mit einer neuen Kritzelei beschäftigt.
Dann stieß er wieder den Rat zur Linken an und flüsterte ihm ins Ohr: »Was meinen Sie, Herr Kollege, wäre darauf nicht ein Glas Branntwein gut
Der erwachte und brummte verschlafen: »Den Bleistift lassen Sie ihm!« Dann schlummerte er weiter.
Und der junge Mann redete fort und fort und verteidigte scharfsinnig seine Sache, während an der anderen Seite des Vorsitzenden das vierte Mitglied des Senats laut gähnte. Sodann beugte sich dieser über den Vorsitzenden hinweg, nahm dem zweiten Mitglied des Senats schlauerweise seinen Wall aus Gesetzbüchern weg, wobei er verbindlich sagte: »Sie gestatten doch, Herr Kollege?«
Der erwachte und blickte mit vorquellenden Augen auf den Berufungskläger, wie die amtliche Bezeichnung eines solchen Mannes lautet.
Das vierte Mitglied des Senats baute nun aus den Gesetzbüchern selbst einen Wall vor sich auf, stützte das Kinn in die Hände und träumte. So ein Schlaf ist auf den ersten Blick nicht ruhig, aber wer darin längere Praxis hat, so wie dieses Mitglied des Senats, befreit sich leicht von der Sorge, er könnte während der Verhandlung wie ein Holzklotz schlafen. Ein solcher Schlaf ist eine wahre Kunst, und der Gerichtsrat war ein Meister auf diesem Gebiet. Ab und zu wurde er wach, nahm von dem Schutzwall ein Gesetzbuch, blätterte darin, legte es wieder auf seinen Platz und schlief weiter.
Der Redner bemerkte diesen Transport der Gesetzbücher und sprach um so nachdrücklicher, um die Herren davon zu überzeugen, daß die Konfiskation der Broschüre grundlos erfolgt sei. Das Hin- und Herwandern der Folianten erschien ihm als ein untrügliches Anzeichen dafür, daß sich die Herren für seinen Fall lebhaft interessierten.