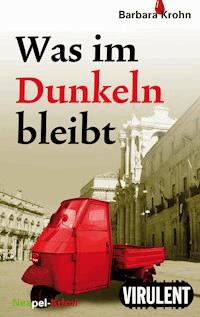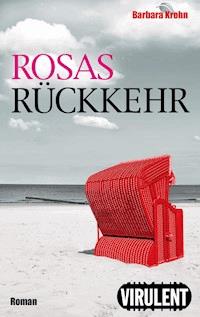Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Krimi
- Serie: Neapel-Krimi
- Sprache: Deutsch
Weihnachten steht vor der Tür. Sonja Zorn hat ihre Stelle in der Redaktion in Hamburg gekündigt und ist probeweise zu Commissario Gennaro Gentilini nach Neapel gezogen – beide haben die Nase voll vom aufreibenden Wechsel zwischen Nähe und Distanz in einer Fernbeziehung. Doch auch zur besinnlichen Adventszeit macht das Verbrechen in Neapel keine Pause: Zwei Kinderschänder, nach kurzer Haft wieder auf freiem Fuß, werden erschossen. Ein Geschäft mit Krippenfiguren geht in Flammen auf – es gehörte der Mutter eines der fünf missbrauchten Jungen. Am Fest der Liebe stehen Sonja, Gentilini und die Kollegen aus dem Kommissariat für Sexualdelikte vor verzwickten Fragen nach Gerechtigkeit, Strafe, Selbstjustiz – und Blutrache hat in Neapel Tradition…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
gerd gewidmet
Vendetta è un piatto da mangiar freddo(Rache ist ein Gericht, das kalt gegessen wird)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
1
Es gab einfach alles. Die Verkaufstische draußen vor den vielen kleinen Läden zu beiden Seiten der Gasse waren beladen mit allen Köstlichkeiten, die je nach Saison auf den Märkten Neapels zu finden waren: saftige aufgeschnittene Wassermelonenhälften, Körbe voll mattglänzender Maronen, ganze Hügellandschaften aus frisch gepflückten Orangen und Zitronen, Artischocken, Zucchini, Auberginen in Hülle und Fülle, Salatköpfe, Tomaten, Bananen, Feigen und Kaktusfrüchte, Granatäpfel, Körbe mit Eiern, Schälchen mit Waldbeeren, einladende Käsesorten, Caciotta, Parmesan, Provolone in unterschiedlichen Reifegraden. Gleich daneben ein Stand mit Schinken, Mortadella, Salami und appetitlich um die Aufbauten gewundenen Wurstketten, dann wieder Platten voll hellroter Schalentiere, Langusten, Krebse und Hummer nebst flachen Schüsseln voll silberglitzernder Fische in diversen Größen und Formen, Miesmuscheln, Herzmuscheln, Taschenmuscheln, Schnecken, Calamari, Verkaufsstände für Tripa, aufgeschichtetes Weißbrot, ofenfrische Pizzen, reichverzierte Torten – was immer das Herz begehrte.
Was aber fehlte, war der unverkennbare, derbe, zuweilen übelkeiterregende Geruch nach Meer und Salz und Fisch, auf den Märkten ein verlässlicher Vorbote der Stände der Fischverkäufer. Was nicht in der Luft lag, war das gelborange, säuerlich prickelnde Aroma der Zitrusfrüchte, der köstliche, durch nichts zu ersetzende Duft nach frisch gebackenem Brot, der beißende Rauch aus dem mit Kohlen befeuerten Öfchen, auf dem Esskastanien geröstet wurden. Eine ganze Dimension mediterranen Marktgeschehens, die dem Besucher das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ, die Lust weckte, die Waren in die Hand zu nehmen und gleich zu verspeisen, oder aber zu waschen, zu putzen, zu schneiden, zu würzen, zu braten, zu kochen, zu backen – fehlte. Ja, es gab alles: aber ohne Geruch und in Miniaturformat.
Via San Gregorio Armeno. Die Weihnachtsgasse. Die Krippengasse. Hier wurden die neapolitanischen Weihnachtskrippen bestückt. Sonja war überwältigt. Konnte sich kaum sattsehen, während sie sich neben Livia im Schneckentempo an den Ständen entlangschob, immer wieder angerempelt wurde, sich gegen den Druck der Menschenmenge stemmte. Fülle des Südens.
Es war Samstag, an diesem Wochenende waren Gennaros Kinder bei ihnen, gegen Mittag war überraschend Livia aufgetaucht. Sie war Gennaros älteste Freundin und seit ein paar Jahren auch Kollegin bei der Kripo, nur dass Livia Picone für die »abhandengekommene schöne Kunst« zuständig war und Gennaro Gentilini für die »aufgetauchten hässlichen Leichen«, wie sie es spaßeshalber nannten. Beim Essen hatte Gennaro vorgeschlagen, sie könnten alle fünf gemeinsam in die historische Altstadt gehen, sich in ein paar Kirchen die Weihnachtskrippen ansehen und danach durch die Via San Gregorio Armeno schlendern.
Ein Sturm des Protests.
»Nur über meine Leiche!« Isabella, seit einer Woche siebzehn, war mit zwei Freundinnen verabredet, der Rest der Welt ging sie nichts an.
Giorgio, Gennaros vierzehnjähriger Sohn, hatte gemault, sein Vater habe schon seit Ewigkeiten versprochen, mit ihm zu einem Ligaspiel des SSC Napoli zu gehen. Und Sonja hatte ebenso spontan wie entgeistert gemurmelt: »Weihnachtskrippen? Wieso das denn?«
Sollten der Rummel in den Straßen, die sich in jeder Kaffeebar stapelnden Panettone-Packungen, die batteriebetriebenen, jinglebells-quäkenden Weihnachtsmänner, die einen in der Via Roma gnadenlos in Empfang nahmen, sobald man das Gassengeflecht der Quartieri Spagnoli verließ, auch in ihrem geliebten Gennaro eine Art Vorweihnachtsmann geweckt haben? Den Romantiker, der einmal im Jahr süße Kindheitserinnerungen ins harte Kriminalerleben einließ? – lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter –, wozu Weihnachten sich doch anbot, glöckchensüße Erinnerungen an in der Familie verbrachte Stunden, an Melodien von Weihnachtsliedern, deren Texte (meistens nur der Refrain und die erste Strophe) ebenso urplötzlich aus den Tiefen des Gedächtnisses auftauchten wie Fragmente aus einem der vier Evangelien – und es begab sich aber zu der Zeit ...
»Wieso nicht?«, hatte Gennaro herausfordernd in die Runde gefragt. Isabella war mit gezücktem Handy in ihrem Zimmer verschwunden. Livia zeigte sich zu allen Schandtaten bereit, wie sie es nannte.
Sonja, stirnrunzelnd: »Eine Ausstellung mit Dutzenden von Jesussen und ebenso vielen Marias und Josefs und noch mehr Stallgetier?«
Gennaro, auflachend: »Was wären wir ohne unsere Vorurteile, oh nordische Geliebte aus dem Lande der Barbaren. Lass dich überraschen!«
»Aber Papa, heute spielen sie doch gegen Pisa ...«, hatte Giorgio heftig protestiert und mit dem Fuß aufgestampft, »versprochen ist versprochen, du hast sonst sowieso nie Zeit, immer kommen irgendwelche blöden Leichen dazwischen, aber heute ...«
Dagegen ließ sich nichts einwenden. Zu oft waren Wochenendunternehmungen in letzter Sekunde vereitelt worden, weil ein Anruf aus der Questura kam und Commissario Gennaro Gentilini dringend am Tatort gebraucht wurde. Auch Sonja und Livia fanden, dass Vater und Sohn unter den ausnahmsweise einmal günstigen Umständen ins Stadion gehörten. Gennaro, der kein Fußballfan war und Menschenmassen hasste, musste sich geschlagen geben, unterfütterte diese Schlappe aber mit einem längeren Monolog darüber, wie anders das alles früher gewesen war: als er noch ein Junge war, da hätte er wer-weiß-was dafür gegeben, mit den Eltern über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, den ganzen November hätten er und seine Brüder sich darauf gefreut, etceterapepe. Blieben nur Sonja und Livia übrig.
Als die beiden Männer aus dem Haus waren, hatte Livia gesagt: »Beschreib mir deine Krippe.«
»Wieso meine?«
»Wie sieht sie aus, was ist drin?«
»In meinem Kopf?«
»In deinem Kopf, in deiner Krippe.«
Vor Sonjas innerem Auge nahm ein Stall Gestalt an, aus Holz und strohgedeckt, darin Maria, Joseph, Ochs und Esel und in der Krippe das Jesuskind, zusätzlich ein paar Schafe, ein, zwei Hirten, eventuell auch, zwecks kirchenkalenderlichem Zeitraffer, die Weisen aus dem Morgenland.
»Mehr nicht?« Livia wirkte enttäuscht, beinahe empört.
»Mehr nicht. Das heißt, eigentlich ...«
Als Sonja mit siebzehn zu Hause auszog, hatte sie geglaubt, der Weihnachtsrummel liege für immer hinter ihr. Ihretwegen sollte keine Tanne dran glauben müssen, sie würde nie wieder im Leben eine einzige Weihnachtskugel kaufen, Engel, Lametta, das ganze Glitzerzeug, womöglich auch noch Krippenfiguren, im Brustton der Überzeugung: Nie! Aber als Luzie auf die Welt kam und zwei oder drei Jahre alt war, hatte Oma Hilde ungefragt die Krippe wieder eingeführt, guck mal, Luzielein, was für schöne Püppchen, und Luzies Kinderhand hatte nach dem Schaf gegrabscht und ihr Mund hatte sssaaf gesagt und ihre Augen hatten gestrahlt, und seither gehörte die Weihnachtskrippe wieder dazu. Und mit ihr der Baum, denn eine Krippe gehörte unter einen Baum, und ein Baum war ohne Ausstattung langweilig und ungeschminkt. Und alle Supermärkte, Baumärkte, Kaufhäuser überboten sich in Farbe und Glitzer, wie sollte ein Kind da widerstehen können? Irgendwann hatte Luzie die Krippenlandschaft mit Gummitieren bestückt: Elefanten, Löwen, Kamelen, Zebras, Kängurus, Affen sowie jede Menge Pferde und Hunde und Katzen marschierten auf den Stall zu, drängten sich um die Krippe, hockten auf dem Dach, Wolf und Schaf, Tiger und Antilope, Seite an Seite als Demonstration des Weltfriedens, Arche Noah meets Bethlehem. In einer dritten Phase waren die Bewohner der Luft dazugestoßen, blaue, rote, grüne, mit Silber-oder Goldglitzer verzierte, kleine, mittlere, große Vögel, kunstvoll in hauchdünnes Glas geblasen und prächtig herausgeputzt mit goldenen oder silbernen Schnäbeln und bunt gefiederter Schwanzpracht, die auf den Zweigen hockten.
Die Vögel waren geblieben, der jährliche Nadelbaum ebenfalls, Oma Hildes solide Krippe aber wurde in den Keller abgeschoben.
Livia hatte nachsichtig gelächelt. »0 presebbio ...«
Die Krippe – sie hatte das Wort fast wehmütig in den Mund genommen, gedreht und gewendet – il presepe napoletano war ein ganzer Kosmos für sich.
Jede Familie hat zu Hause ihre eigene Krippenlandschaft. Anfang Dezember wird sie aufgestellt und immer wieder umgebaut und erweitert. Nicht Bethlehem ist der Mittelpunkt der Welt, sondern Neapel. Mit all seinen Schätzen und all seinen Widersprüchen.«
»Gennaro hat keine.«
»Die Familienkrippe wird bei der Scheidung in Rosarias Besitztum übergegangen sein.«
»Und du?«
»Ich habe auch keine. Ich lebe ja allein. Aber meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister mit ihren Kindern, sie haben alle eine riesige Krippe.«
Livia war ins Schwärmen geraten: über weite Landschaften aus Pappmache, Pappe, Kork mit Dutzenden, ja Hunderten von Figuren aus dem neapolitanischen Alltag, Pizzabäcker mit in den Fels gebauten Öfen, Weinhändler, Bettler, Fischer, Konditoren, Kartenspieler, Musikanten, Pulcinellas, Mägde, Hirten mit Schafen über den Schultern. Zu den historischen Figuren kamen jedes Jahr neue hinzu, Politiker wie Berlusconi, Bush, sogar Osama bin Laden, bekannte Sportler, Filmstars. Im Jahr zuvor hatten zwanzig neapolitanische Konditoren gemeinsam eine riesige Weihnachtskrippe aus Schokolade hergestellt.
»Die größte Schokokrippe der Welt. Aus drei Tonnen Schokolade!« Sie fuhr fort: »In der Via San Gregorio Armeno sind die besten Krippenbauer der Stadt, ihre Läden und Werkstätten, dort gibt es alles, was das Herz begehrt. Das musst du dir unbedingt ansehen, Sonja, das sind ganz andere Dimensionen als die Krippen, die du kennst. Ich wette, du wirst begeistert sein!«
Ja, Sonja war tatsächlich begeistert. Was für eine Vielfalt! Was für eine Fülle! In der Krippengasse war die Hölle los. Einheimische und Touristen drängelten und schoben sich an den Verkaufstischen und Vitrinen vorbei, aus denen dicht an dicht Abertausende tongewordener Figuren jeden Standes und Berufs zurückstarrten, unbeeindruckt, farbenfroh, lackiert, unlackiert, fein gearbeitet, Massenware. Die Gasse war überfüllt, in jeder Hinsicht. Es roch nach Schweiß in diversen Ablagerungsgraden, nach After Shave und Parfüm, menschlichen Ausdünstungen. Nach Zigarettenrauch, Abgasen, muffigen Winterjacken. Nach einem viel zu warmen Dezember.
Achtzehn Grad, Sonja schwitzte selbst in ihrer leichten Lederjacke. Sie fühlte sich in diesem Moment deutlich stärker zu den plätschernden Miniaturbrunnen hingezogen als zu den mit roten Lämpchen künstlich lodernden Pizzaöfen.
Sie zog Livia zu einem Stand, an dem Brunnen in verschiedenen Varianten feilgeboten wurden: von der stilecht nachgebauten barocken Felsenkaskade von der Größe eines mittelgroßen Playmobil-Drachenfelsens bis hin zu Mini-Brunnen in Zigarettenschachtelformat. Sie nahm einen mittelgroßen Brunnen in die Hand und begutachtete ihn. Aus einem Miniaturrohr, das aus einer grüngrauen Mauer hervorragte, floss ein Strahl Wasser über zwei Stufen in ein kleines, hellblau ausgemaltes Becken. Das Wasser wurde mithilfe einer Pumpe zurückgeleitet.
»Solo dieci Euro, Signora«, sagte eine heisere Männerstimme. »Quasi niente.«
Zehn Euro waren zehn Euro. Das konnte viel oder wenig sein. Wenn der Brunnen funktionierte, kein schlechter Preis, dachte Sonja. Und wenn er nicht funktionierte ...
»Funziona, Signora, e come!«, sagte der Verkäufer, als habe er ihren Gedanken gelesen. »Sehen Sie!«
Der Verkäufer, ein Mann mittleren Alters in einem Trainingsanzug und mit Zehntagebart, griff nach einem Monstrum von Mehrfachsteckdose, fummelte einen der darin befindlichen acht bis zehn Stecker heraus, erwischte den falschen, fluchte, porcamiseria, probierte es mit einem anderen, fluchte, managgia, wollte nach einem dritten greifen, als hinter seinem Rücken eine kleine Hand auftauchte, die geschickt und zielsicher den zweiten Stecker von rechts herauszog, was zum Teufel?! – die Pumpe im Brunnen hörte auf zu arbeiten, der Brunnen versiegte ... Ecco …
»Sehen Sie, Signora, ganz einfach, Sie ziehen den Stecker, der Brunnen stoppt, Sie tun den Stecker rein, der Brunnen läuft wieder. So einfach ist das.« Er breitete die Arme aus, lachte. »Das Leben ist einfach. Vero? Stimmt’s?«
»Schön wär’s«, sagte Livia.
Das Kind, dem das Einfache gelungen war, nämlich den richtigen Stecker zu finden, war ein etwa zehnjähriger Junge, den der Mann jetzt in die Backe zwickte.
»Ihr Sohn?«, fragte Sonja.
»Mein Neffe.«
Der Junge entwand sich und kauerte sich am Eingang des Ladens auf einen Hocker. Er trug ein gefälschtes Markentrikot des SSC Neapel und wie sein Onkel eine Trainingshose. Neben ihm stand ein Transistorradio, das den Strom aus derselben Steckdose bezog. Während er die Sportübertragung hörte, behielt er das Geschehen in der Menge aufmerksam im Blick.
»Wie sieht’s aus, gewinnen wir heute?«, fragte Livia.
Er sah zu ihr hoch, reckte das Kinn. »E come! Aber klar!«
»Wie steht’s denn?«
»Eins eins. Aber das wird noch.«
»Warum bist du nicht im Stadion?« Er legte den Kopf schief. »Ich muss im Laden helfen. Nächstes Mal.«
Sein Onkel legte ihm die Hand auf den Kopf. »Im Januar gehen wir zusammen hin, du und ich. Abgemacht?«
Im vorsichtigen Lächeln des Jungen mischten sich Hoffnung und Skepsis. Als eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm sich mit dem suchenden Blick der potentiellen Käuferin näherte, sprang er auf.
Sonja stellte sich bereits plastisch vor, wie der Brunnen in Gentilinis Wohnung auf dem kleinen Tisch am Fenster stand und den ganzen Tag lang munter vor sich hinplätscherte. Ein Zimmerspringbrunnen auf Neapolitanisch. Nachts könnten sie ihn neben dem Bett installieren und sich einbilden, sie lägen unter dem Sternenhimmel im Moos, gleich neben einer Quelle. Hauptsache, der Brunnen funktionierte auch zu Hause und war nicht undicht.
»Eine gute Wahl!«, setzte der Mann nach. »Seien wir ehrlich, das Leben ist einfach, es sind die Menschen, die es kompliziert machen.«
Livia puffte ihr mit dem Ellbogen leicht in die Seite.
Sonja sah sie fragend an.
»Sechs«, zischte Livia. »Sag sechs Euro.«
Der Mann hatte sie gehört und warf ihr einen vernichtenden Blick zu. Er zog den Stecker aus dem Brunnen, der augenblicklich verstummte. »Soll ich Ihnen verraten, wie viele von diesen Brunnen ich heute schon verkauft habe? Über ein Dutzend. Dies hier ist das letzte Exemplar, Signora. Aber sechs Euro ... Niente!« Eine wegwerfende Handbewegung.
Livia zog Sonja einen Meter von dem Stand weg.
»Ich gebe Ihnen auf diesen Brunnen eine Garantie«, rief der Mann hinterher, als würde er ihr die Bank von Neapel zum Geschenk machen.
Sie blieben stehen, drehten sich um.
»Wenn der Brunnen nicht läuft, bringen Sie ihn zurück und Sie bekommen einen anderen. Ganz einfach.« Er legte die Hand auf die linke Brust: »Wir verkaufen nur beste Qualität, Signora. Zu zehn Euro. Festpreis. Mit Garantie. Ist das ein Wort?«
Sonja griff in die Vordertasche ihrer Jeans und zählte ein paar Geldstücke ab. »Ich biete neun.«
Der Verkäufer schnalzte wie bedauernd mit der Zunge, ließ sich aber auf den Handel ein. »Siete duri, voi tedeschi. Duri e furbi. Hart und schlau seid ihr Deutschen.«
Sonja lächelte verschmitzt. »Was das Handeln angeht, bin ich in Neapel in die Lehre gegangen.«
Mit einem unhandlichen Paket unter dem Arm schoben Sonja und Livia sich weiter die Gasse hinauf in Richtung der Kirche San Lorenzo Maggiore. Alle paar Schritte blieben sie stehen, betraten einen Laden, sahen sich unter den hoffnungsvoll-misstrauischen Blicken der Verkäufer die angebotenen Krippenfiguren an, die minutiös gestalteten Gesichter, Frisuren, Kleider der Frauen, die Männer mit weißer Kochmütze, Kniebundhosen, Schürze, schlank, wohlbeleibt, ärmlich, reich, die Marktstände voller Käse-, Wurst-, Fisch-, Gemüsesorten. In einer Vitrine stand die Prominenz: Monica Lewinsky und Bill Clinton, Berlusconi, Madonna, Maradona, der Papst. Sonja gefielen die traditionellen Figuren besser. Sie erkundigte sich nach den Preisen. Manche Figurengruppen wurden spottbillig angeboten, andere waren sehr teuer. Diese Farben, diese Vielfalt. Sonja sah keine Unterschiede mehr. Es war wie bei einem IKEA-Besuch an einem Samstag: zu bunt, zu voll, zu warm, zu viel.
Sie kamen mit einer Ladenbesitzerin ins Gespräch, deren Schwester in Berlin lebte. Die Frau war etwas jünger als Sonja. Sie wirkte herzlich. Sie schien nicht nur am Geschäft interessiert zu sein. Die Figuren in dem Laden hatten etwas Eigenes, Besonderes. Auf den ersten Blick war klar, dass es sich hier nicht um Massenware handelte. In dem Gespräch, das sich entspann, stellte sich heraus, dass Caterina, so hieß die Frau, ursprünglich Kunstgeschichte studiert hatte, worauf Livia sagte, sie sei eigentlich Malerin. Sie hielten sich noch eine Weile in dem Laden auf, plauderten über dies und das, schließlich kaufte Sonja einen Taralli-Verkäufer mitsamt seinem Stand. Ohne zu handeln. Und erhielt trotzdem zwanzig Prozent Preisnachlass.
Als Sonja und Livia nach einigen weiteren Pausen und Begutachtungen endlich die Piazza San Lorenzo erreicht hatten, war vom unteren Ende der Gasse her Tumult zu hören, Rufe, Schreie. Sie blieben stehen.
»Was ist da los?«
Beide lauschten. Der neapolitanische Dialekt war eine Art gutturaler Rufgesang, der in der Luft lag wie das Knattern der Zweiräder, das Röhren der Espressomaschinen. Sonja verstand nach wie vor nur Bruchteile dessen, was die Leute sagten.
Livia zuckte die Achseln. »Anscheinend ein Raubüberfall.«
»Am helllichten Tag?«
Sonja fror plötzlich. Diese verfluchte Stadt mit ihrer nicht endenden Gewalt, dachte sie. Livia zog sie weiter. »Das geht uns nichts an.«
2
Die Sache war sonnenklar: Das Opfer war ein Schwein gewesen. Gennaro Gentilini starrte durch die verdreckte Fensterscheibe auf einen Streifen Hafen, Meer, Großstadt. Die Wintersonne hatte das Gebäude vom Südwesten aus im Visier und knallte unbarmherzig auf alles, was sich bewegte – und was sich nicht bewegte. Wie um die letzte Munition loszuwerden. Zu warm, viel zu warm, dieser Dezember. Wenn der Kalender Winter proklamierte und das Klima sich einen Teufel drum scherte. Die Zeitungen hatten ein neues Lieblingsthema entdeckt, die Klimakatastrophe. Ob Katastrophe oder nicht – Kopfschmerzwetter war es allemal.
Der Commissario spürte in sich eine große Müdigkeit. Sie saß in den Gliedern, in den Poren, in den Adern, im Hirn, sie hatte sich eingenistet im Zentrum des logischen Denkens, drückte schwer auf die Augenlider und vor allem auf die Motivation, etwas zu tun. Irgendetwas. Etwas zu tun gab es immer. Sein Arbeitstag bestand schließlich aus Nachdenken und Kombinieren.
Wozu? Das Schwein war tot. Sollte Gentilini dessen Mörder jagen? Porcamiseria ...
Er legte den Kopf in die Hände. Der Kopf war schwer. Er stellte sich Sonjas Hände vor, die ihm diesen schweren Kopf abnahmen und in ihren Schoß betteten, und sie nahm ihm nicht nur den Kopf ab, sondern auch alles Schwere, das sich darin befand, schwarzen Gedankenfilz, bösartige Informationsknäuel, zu Verdruss geronnene Wut. Mit ihren kühlen Fingern begann Sonja seine Kopfhaut zu massieren, Punkte zu setzen: Grüppchen von Fingerkuppen wie Blütenblätter, immer fünf auf einmal, ein schönes Muster, ein Pünktchenmuster hoch oben, wo er, Gentilini, ein Ende hatte, gleich unter dem Himmel. Die Melodie von Polkadots and Moonbeams fiel ihm ein und verflog gleich wieder, denn mit jeder Berührung der Finger wurde sein Kopf leerer und leichter, bis Gennaro das Gefühl hatte, gar keinen mehr zu besitzen – der kopflose Commissario Gentilini: das war dann meistens der Moment, an dem er jäh zusammenzuckte, sich mit einem Ruck aus Sonjas Händen löste. Basta, Schluss mit der Entspannung.
Wo waren wir stehengeblieben?
Piscitelli, die Sau.
Gennaro, verdammt, wie redest du? Bei deinen Kindern würdest du dir diese Ausdrucksweise verbieten. Einen Euro in die Kasse für unflätige Flüche, Sprüche und Beschimpfungen! Die cassa bestemmia e parolacce war in einer Phase entstanden, als Giorgio kopfüber in die Untiefen der Pubertät abgetaucht war, um mit einem Riesenvorrat an Schimpfwörtern und Diffamierungen wieder aufzutauchen, mit dem er hauptsächlich die ältere Schwester traktierte, die sich, was das betraf, als unanfechtbar ebenbürtig erwies. An den Wochenenden, die Giorgio und Isabella bei ihrem Vater verbrachten, hatte die Kasse sich zunächst recht schnell gefüllt. Mit der Zeit aber begann es den beiden dann doch um jeden vom Taschengeld fehlenden Euro leid zu tun. Mittlerweile stagnierten die Einnahmen, man kam offenbar auch ohne Dauerunflätigkeiten zurecht. Sollte diese Unsitte womöglich in umgekehrter Erblinie auf den Vater übergegangen sein?
Cazzate. Der Commissario rieb sich die Stirn, gab sich einen Ruck, griff zum Hörer, wählte eine kurze Nummer.
»Hier Gentilini. Hör mal, ich hab deinen Bericht bekommen, ja, üble Sache, so ein A ... – Du sagst es. – Ja, das sollten wir. Magst du raufkommen oder ich runter zu dir? – Va bene. Caffè? Fra dieci minuti? Daccordociao.«
Er wählte ein zweites Mal.
»Hier Gentilini, das Übliche, aber doppelt – Wie? –Non ho capito, wie doppelt? – Na, zweifach eben. – Nein, nicht nur ein doppelter Espresso, sondern zwei. – Nein, nicht zwei normale, zwei doppelte, ci siamo, eh? –Si, vierter Stock, esatto, grazieciao.«
Wie schwer es doch manchmal war, sich über einfachste Dinge zu verständigen.
Er stand auf, reckte sich, ging zum Waschbecken und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Frisch werden, hieß die Devise. Noch hielten die Kopfschmerzen sich in Grenzen.
Sein Kollege Stefano hatte gegen halb zwei die Segel gestrichen, nachdem er sich mit mehreren Aspirin über den Vormittag geschleppt hatte. Und das wollte etwas heißen, wenn Stefano Di Maio die vergleichsweise Windstille im Polizeipräsidium gegen das Tosen und Toben des familiären Wirbelsturms eintauschte, den fünf Kinder zwischen vier und vierzehn Jahren unablässig anfachten. Und ab März gab es Verstärkung durch ein weiteres Kind, das konnte heiter werden.
Gut, dass Stefano schon weg war. So hatte er nicht mehr mitbekommen, was für einen Bericht Armando Nocera aus dem Dezernat für Sexualdelikte ihnen raufgeschickt hatte. Mit ein paar neuen Informationen zum Mord an Ernesto Piscitelli. Mannomann. Wenn Stefano diesen Dreck gelesen hätte, wäre er rot angelaufen, hätte getobt und rumgeschrien, dass man es den ganzen Flur hinunter gehört hätte, bis zu den Fahrstühlen, in jedem Zimmer, und die Kollegen hätten ein paar Witze gerissen – »o pateterno« explodiert, Leute, bleibt in Deckung, das Außenministerium erlässt dringende Reisewarnung in die Hoheitsgebiete der Ermittler Di Maio und Gentilini. Hoffentlich zerreißt es ihn nicht eines Tages ...«
Dass Stefano der Kragen platzte, passierte nicht oft, ein oder zweimal im Jahr, und nie grundlos. Stefano war kein Choleriker, sondern ein gutmütiger Mensch, ein kinderliebender Familienvater, aber was zuviel war, war zuviel.
Auch Gentilini war wütend, sehr sogar, aber seine Wut lähmte ihn heute eher. Sie kroch ihm in die Glieder, setzte sich dort fest, schnürte ihm die Zufuhr an Vitalität ab und verbündete sich mit seiner Müdigkeit. Übrig blieben dann nur noch hilflose Verwünschungen. ’A vita storta te porta ’a morte. Wer Gewalt sät, wird Tod ernten.
Bis vor gut zwei Jahren war Ernesto Piscitelli ein unbescholtener Mann gewesen. Zumindest hatte er keine Vorstrafen gehabt. Keine Körperverletzung, kein Verkehrsdelikt, jedenfalls nichts, was aktenkundig geworden war. Was nichts heißen musste. In dieser Stadt fand vieles niemals den Weg in eine Polizeiakte. Jeder konnte Dreck am Stecken haben, wirklich jeder. Piscitelli hatte vor vier Jahren eine Videothek im Centro Storico eröffnet. Wie in den meisten Videotheken gab es einen Eingang für den Normalverbraucher und einen zweiten für Leute über achtzehn, die es in die Horror-Gewalt-Porno-Ecke zog. Alles nach Vorschrift. Keine Auffälligkeiten.
Piscitellis letztes Stündlein hatte am Sonntagnachmittag geschlagen – und Gentilini aus seinem wohlverdienten Familienwochenende herausgerissen. Er war zum Tatort in die Via Duomo gefahren, hatte die Ermittlungen aufgenommen. Ein einziger Schuss durchs Fenster. Die Videothek hatte mehrere Hinterzimmer. Eins davon war ein kleiner Büroraum mit vergittertem Fenster, Tresor, Schreibtisch, Computer, Aktenschränken, einem Kalender der Salumeria Sannazzaro. Piscitelli war offenbar nicht allein gewesen. Er hatte kurz zuvor Besuch gehabt. Der schon wieder gegangen war, als der Schuss fiel. Oder auch nicht. Auf dem Tisch standen außer einem randvollen Aschenbecher zwei halbvolle Sektgläser und eine fast leere Flasche Spumante. Vielleicht hatte der Videothekenbesitzer seine Haftentlassung gefeiert.
Denn vor gut zwei Jahren war Piscitelli verhaftet worden.
Neben dem Büro lagen zwei weitere Räume. Einer davon wurde als Lager benutzt. Der zweite privat. Das stand alles in Noceras Akte.
Privat hieß, mit Dämmplatten verkleidete Wände, mit weichen Teppichen ausgelegter Boden. Privat hieß, ein überdimensioniertes Bett und ein riesiger Bildschirm mitsamt DVD-Gerät.
Privat hieß, laut Piscitellis damaliger Aussage, er habe den Raum untervermietet. An gute Bekannte. Das sei sein gutes Recht. Ein Zimmer in einem Laden, der ihm gehört, unterzuvermieten. An einen Kunden, der ihm gutes Geld dafür bezahle.
Privat hieß, wie sich herausstellte, dort gingen Männer ein und aus. – Dagegen sei ja wohl nichts einzuwenden, seit wann sei es in diesem Lande strafbar, dass Männer sich privat in einem Hinterzimmer trafen. Um Karten zu spielen. Bei einem Glas Wein. Nicht einmal verbotene Glücksspiele. Na also.
Auf dem Bett?
Privat hieß, dort seine Ruhe zu haben. Sich in aller Ruhe einen Film reinzuziehen. – Das sei ja wohl nicht verboten. Ohne dass die Frauen einen störten. Oder die Kinder mit ihrem Geschrei.
Die Kinder? Piscitelli hatte gar keine Kinder. Er war nicht einmal verheiratet. Anders als einige der Männer, die sich dort vergnügten.
Privat hieß, die Männer brachten Jungens mit. Ragazzi. Scugnizzi. Scuola elementare, Grundschulalter. – Woher hätte er bitteschön wissen sollen, dass das nicht die Söhne, Neffen, Enkel dieser Männer waren? Er könne seine Augen doch wirklich nicht überall haben, hatte Piscitelli sich zu rechtfertigen versucht, zumal in einer Videothek ...
Er war in Untersuchungshaft gelandet, ebenso wie die Männer, die fünf Jungen aus der Nachbarschaft im Alter zwischen sieben und neun Jahren über Wochen hinweg sexuell missbraucht hatten. Im Hinterzimmer einer Videothek mitten in der historischen Altstadt von Neapel, keine hundert Meter vom Dom entfernt. Und letzten Donnerstag waren sie alle aus der Haft entlassen worden. Nicht etwa, weil sich nachträglich ihre Unschuld erwiesen hätte, sondern weil die Fristen der Untersuchungshaft wieder einmal abgelaufen waren, was schon so manchem Mafioso und manchem Mörder die Freiheit beschert hatte.
Gentilini erinnerte sich nur sehr undeutlich an diesen Fall, der laut dem Presseüberblick, den Armando beigelegt hatte, vor rund zweieinhalb Jahren durch die Zeitungen gegangen war. Das machte ihn wütend, auch auf sich selbst. Diese Borniertheit: Er arbeitete in der Mordkommission, damals hatte es keine Toten gegeben, also war er auch nicht mit der Sache befasst. Das war genau die Haltung, die Gentilini im Grunde verabscheute. Die er vehement beklagte, wenn er auf der Suche nach Tatzeugen war: dass die Leute nicht über den eigenen Tellerrand schauten, dass sie sich Scheuklappen zulegten, weil es in dieser Stadt nur Ärger brachte, wenn man zu wachsam war, allzuviel mitbekam.
Sich um den eigenen Kram scheren. Ja, das galt auch für ihn selbst, dachte er zerknirscht. Aber konnte man seine Augen überall haben? Sollte er sich etwa auch noch um alle anderen Verbrechen kümmern als um die, die auf seinem Schreibtisch landeten? Er las erneut die Namen der Kinder: Gianpiero Leopardi, Nino Catalano, Silvano Villani, Giuliano Fanti, Lucio Massa.
3
Es klopfte. Die Tür wurde aufgerissen. Ein Mann mit silbergrauen Haaren ließ dem Barjungen, der ein Tablett mit Espressotassen, einem Alukännchen und zwei Gläsern Wasser balancierte, den Vortritt. Der Commissario schob einen Stapel Papier zur Seite. Armando Nocera zog sich Stefanos Stuhl heran. Der Barjunge lud den Inhalt des Tabletts ab.
Als sie wieder allein im Zimmer waren, herrschte einige Momente lang Schweigen. Die beiden Kommissare tranken ihren Espresso. Sie stärkten sich in stillem Genuss, tankten Energie wie bei einem Sekundenschlaf.
»Buono, il caffè«, entschloss sich Nocera schließlich zu einer unanfechtbaren Äußerung. Er war Ende vierzig, nur wenige Jahre älter als Gentilini, eine Handbreit kleiner und sicherlich fünfzehn Kilo leichter. Seit seine dichten Haare sich von tiefem Schwarzbraun in ein elegantes Silbergrau verwandelt hatten, erinnerte er den Commissario manchmal an einen drahtigen Husky.
Gentilini gab einen Laut der Zustimmung von sich. Er griff nach einem Bleistift, der auf seinem Schreibtisch lag, begann damit herumzuspielen. »Brutta storia ...«
»Du sagst es. Ganz üble Geschichte. Wann genau hat es Piscitelli erwischt?«
»Gestern Nachmittag zwischen vier und sechs. Im Hinterzimmer seiner Videothek. Ein einziger Schuss, ein Volltreffer, finita la storia.« Gentilini versuchte jetzt, mit der rechten Hand den Bleistift von Finger zu Finger weiterzugeben, sein Sohn Giorgio machte das ständig. Meisterhaft und blitzschnell.
Der Bleistift fiel zu Boden. Gentilini ließ ihn liegen.
»Sieht nach einem Profi aus«, fügte er hinzu. »Der Täter, meine ich.«
Nocera musste lächeln. »Ich kann das auch nicht. Gianni, mein Neffe, hat mehrmals versucht, mir solche Tricks beizubringen – da hab ich keine Chance. Für solche Spielereien sind wir wohl zu alt.«
Gentilini warf ihm einen wehmütigen Blick zu. »Nicht nur dafür, Armando. Manchmal denke ich, ich bin längst zu alt für diesen vermaledeiten Job.« Und da Nocera nicht reagierte, fuhr er fort: »Im Januar werde ich fünfundvierzig.« Er hob die Hände, wie um den erwarteten Kommentar seines Gegenübers schon im Vorfeld abzuwehren. »Sag jetzt bloß nichts vom besten Mannesalter und so weiter. Das meine ich nicht.«
Aber der Kollege verschränkte nur abwartend die Arme hinter dem Kopf und sah ihn an. Sein Blick hatte etwas Beruhigendes und Irritierendes zugleich.
Armando Nocera war seit fast fünfundzwanzig Jahren bei der Polizei und leitete seit zwölf Jahren das Dezernat für Sexualdelikte. Gentilini und er kannten sich ungefähr genauso lange. Sie mochten und respektierten sich. Privat hatten sie keinen Kontakt, es hatte sich nie ergeben, aber ihre Gespräche waren, so selten sich die Gelegenheit ergab, immer irgendwie besonders. Nicht wie mit vielen anderen Kollegen, bei denen Gentilini oft das Gefühl hatte, er müsse auf der Hut sein, seine Worte abwägen, einem Kalkül folgen, taktisch vorgehen, irgendwelche Schutzmaßnahmen treffen, hinter denen er unangreifbar blieb. Das war bei Nocera anders. Kein Schein, nur Sein. Als habe man nicht viel Zeit miteinander und müsse diese Zeit intensiv nutzen. In Noceras Gegenwart hatten auch Zweifel, Schwächen, gedankliche Irrwege ihren Raum.
»Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Gennaro«, sagte er schließlich. »Wir haben in all den Jahren zuviel Mist in uns angesammelt. Einen Riesenberg an Bösartigkeiten und Brutalitäten und Perversionen und Machtgier. Und dieser Berg steht hoch und ziemlich einsam in einem Meer aus Blut und Tränen. Und die Luft drumherum riecht nach Schmerz und Gewalt. Klingt wie aus einem Groschenroman, ist aber so.« Er brach ab, sah kurz zu Boden, als suche er etwas, fixierte dann einen unsichtbaren Punkt im Linoleum. »Wir haben Schießen gelernt und wie man Leute verhört und verhaftet und Indizien zusammenträgt. Aber wie man das alles wieder loswird, den ganzen Dreck? Ohne vor so viel Dreck zu erstarren? Daran zu ersticken? Und den Mut zu verlieren? Wo, bitte schön, ist unsere Müllkippe, unsere Verbrennungsanlage für sämtliche Todsünden, die hier in Neapel in einem einzigen Jahr begangen werden?«
Er bückte sich, hob den heruntergefallenen Bleistift auf und legte ihn auf Gentilinis Schreibtisch.
»Ich sage es dir ganz offen, Gennaro: Selten hat mich eine Nachricht wie der Mord an Piscitelli mit solch einer Genugtuung erfüllt. Einer weniger, habe ich gedacht – gut so. Und du weißt, ich bin sonst nicht so. Wirklich nicht«.
»Ging mir nicht anders, Armando«, nickte Gentilini. »Ich habe vorhin hier gesessen und in deiner Akte gelesen und gedacht, endlich hat es mal den Richtigen erwischt. Der Schweinehund.« Er schüttelte den Kopf. »Das ist doch ...« Er ließ den Satz unvollendet.
»Wir sind alle keine Heiligen, Gennaro«, sagte Nocera. Seine blaugrauen Augen ruhten auf dem Commissario.
Vielleicht sieht ein Analytiker einen so an, dachte Gentilini, der nie in seinem Leben bei einem Therapeuten gewesen war: wissend, mitfühlend, nachsichtig, durchdringend und immer mit einer Prise Ironie.
»Gut, es ist unsere Aufgabe, die Schuldigen hinter Gitter zu bringen. Aber wenn sie dann gleich wieder rauskommen? Ich meine, man bringt diese Leute mühsam hinter Gitter, die Beweislage ist erdrückend ...«
» ... und unser lahmes, überlastetes Justizsystem sorgt dafür, dass diese Typen, von denen wir wissen, dass sie Dreck am Stecken haben, umgehend wieder auf freien Fuß kommen«, beendete Nocera den Satz. »U-Haft-Frist abgelaufen, Termine nicht eingehalten, Verfahrensfehler – und das war’s. Ja, das ist eine einzige Farce! Bitter, sehr bitter.«
Gentilini schob den Unterkiefer vor und brach den Bleistift in der Mitte durch. »Da fragst du dich wirklich, wozu du dir den Arsch aufreißt. Bitte entschuldige die Formulierung, aber es ist doch so!«
Nocera zog die Augenbrauen hoch, ein Lächeln rutschte in seinen Blick. »Nun, in diesem Fall hat jemand anders dem Elend ein Ende gesetzt.«
Einen Moment lang sagte keiner etwas.
»Hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte?«
»Unser neapolitanischer Ersatzstaat?«
»Ein Fingerzeig aus dem Reich der Camorra ... Möglich. Aber warum?«
Nocera kniff die Augen zusammen, wie um sich zu konzentrieren. »Vielleicht als Abstrafung. Um den Kerlen deutlich zu zeigen, wo die Grenze verläuft. Was geduldet wird und was nicht. Sex mit Kindern wird nicht geduldet. Damit niemand auf die Idee kommt, das zu kopieren.«
Gentilini runzelte die Stirn. »Bist du sicher, dass das die Moral von Leuten ist, die Zehnjährige als Pusher an den Straßenecken postieren?«
»Geschäft und Moral waren schon immer zweierlei.«
»Stimmt.«
»Die eingesessenen Camorrafamilien aus dem Kernbereich Neapels haben jedenfalls ein eindeutiges Interesse daran, dass ihnen niemand in ihren Machtbereich hineinpfuscht.«
Gentilini griff nach der Akte, blätterte. »Außer dem Videothekenbesitzer wurden aus der Untersuchungshaft entlassen ... Ciro Tagliamonte, Pedell der Grundschule in der Via Settembrini, dann Alberto Esposito, Inhaber einer Bar mit dem schönen Namen Stella, und drittens Angelo Pommella, das ist doch ...«
»... der stammt aus der Sippe der Pommellas, genau. In den sechziger Jahren Zigarettenschmuggel, eine Generation später Einstieg ins Drogengeschäft. Im Dossier Pommella findest du eine ganze Latte an kleineren und größeren Rechtswidrigkeiten«, ergänzte Nocera. »Die Tatwaffe?«
»Eine Beretta 92 – wie man sie mittlerweile an jeder Straßenecke bekommt.«
Nocera griff nach einer Umlaufmappe und begann, sich Luft zuzufächern. »Eine Hitze ist das hier oben. Sag mal, wie hältst du das eigentlich aus in dieser Sauna? Funktionieren die Rolläden nicht?«
»Die Rolläden nicht, die Klimaanlage auch nicht, dafür können die Fenster nur einen Spalt breit geöffnet werden«, knurrte Gentilini. »Das nenne ich Fortschritt. Und wenn es endlich draußen Winter wird, fällt wahrscheinlich auch noch die Heizung aus. Aber das sind alles vergleichsweise lässliche Übel.« Er tippte mit dem Bleistift auf die Akte. »Wie ist die Sauerei aufgeflogen?«
Nocera schwieg. »Einer der Jungen wollte morgens nicht mehr zur Schule gehen«, sagte er schließlich. »Ein anderer war zum Bettnässer geworden. Die Mütter der beiden haben sich zufällig beim Einkaufen getroffen und zufällig miteinander geredet und sind dabei zufällig auf das Thema gekommen ...« Er wischte sich mit der Hand über das Gesicht. »Das hätte noch wochenlang so weitergehen können, wenn Caterina Catalano und Mariella Leopardi nicht misstrauisch geworden wären und sich schließlich einem Pfarrer anvertraut hätten. Welches Kind geht schon immer froh zur Schule? Da gibt es andere Erklärungen, an die man natürlich viel lieber denkt, als dass das eigene Kind einer Bande von Pädophilen in die Hände gefallen ist.«
Gentilini nickte.
»Es hat trotzdem lange gedauert, bis die vier Männer endlich verhaftet wurden. Eine Schlamperei in einer Dienststelle, dann das Problem mit den Aussagen der Jungen ...« Nocera seufzte. »Zehn, fünfzehn Jahre hätten die Kerle mindestens bekommen, wenn der Hauptprozess rechtzeitig eröffnet worden wäre. Aber so … Und bis heute ist offen, ob es nicht noch weitere Beteiligte gab. Die Drecksäcke haben natürlich alles abgestritten und geschwiegen. Piscitelli hat immer so getan, als wüsste er von nichts. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Jetzt schweigt er für immer. Unter dem Bett in seiner Wohnung wurden damals übrigens ein paar Kinderpornovideos gefunden.«
»Und in der Videothek?«
» Nichts.«
»Wie lange ging das ... in der Videothek?«
»Fast drei Monate.«
Gentilini schluckte.
»Sie haben die Kinder mit Drogen und Alkohol und Videos bei Laune gehal...«
»Bitte, erspar mir die Einzelheiten, wenn’s geht«, murmelte Gentilini.
Armando Nocera nickte unmerklich. »Certo. Das muss nicht sein. Das muss nie sein.«
Beide schwiegen eine Weile. Das Telefon klingelte in die Stille hinein. Der Commissario nahm den Hörer ab, lauschte, verzog keine Miene. Zwischendurch sagte er übertrieben freundlich:
»Sì, certo. – Alles, was in unserer Macht steht, dottore ... – A Natale ’o diavolo va cammenando ... – Was ich damit sagen will? Nun, auch die Weihnachtszeit bleibt von Verbrechen aller Art nicht verschont ... – Das sollten wir, gewiss – aber natürlich – Ihnen auch, arrivederci, dottore.«
Er legte auf, verdrehte die Augen. »Pagano«, sagte er. »Unser Oberkommandant hat den dringlichen Wunsch geäußert, dass keine Fälle über die Weihnachtstage verschleppt werden.«
»Hat er das so ausgedrückt?«
»Originalzitat, minimal abgewandelt.«
»A Natale ’o diavolo va cammenando ...«, wiederholte Nocera sinnierend, »das habe ich lange nicht mehr gehört, meine Großmutter hat das immer gesagt: Weihnachten ist der Teufel los.«
»Originalzitat, minimal abgewandelt«, schmunzelte Gentilini. »Und wir sollen uns ihm an die Fersen heften ...«
»Wie willst du vorgehen? Gibt es Zeugen?«
Gentilini zuckte die Achseln. »Nicht für unsereinen. Von den Leuten aus der Nachbarschaft, die wir befragt haben, hat keiner was gesehen oder gehört. Bisher jedenfalls nicht. Vielleicht meldet sich wider Erwarten jemand, wenn die Presse die Geschichte entdeckt.«
»Die vier sind am Donnerstag entlassen worden«, sagte Nocera mehr zu sich selbst. »Und am Sonntag ist einer von ihnen tot. Das ist doch eigenartig.«
»Kannst du mir irgendwas zu Piscitelli erzählen? Was für ein Typ das war?«
Nocera überlegte kurz. »Liceo artistico, aber abgebrochen, keine Ausbildung, nicht verheiratet, zwei Geschwister, stammt aus einer Arbeiterfamilie per bene ... Steht alles in der Akte. Als Typ nicht brutal, durchaus clever, aber schmierig, undurchschaubar, wie ein Aal, der sich einem zwischen den Fingern entwindet.« »Camorrakontakte?«
»Die Schutzgebühr wird er bezahlt haben, aber ansonsten gab es darauf keine Hinweise.«
Gentilini reckte sich. »Gut. Eines jedenfalls wissen wir: Piscitelli hatte Besuch. Vielleicht hat er seine Entlassung gefeiert. Es gibt jede Menge Fingerabdrücke, unter anderem an den Gläsern. Sie werden gerade mit denen der anderen drei Männer abgeglichen, ich warte auf den Anruf.«
Nocera erhob sich und schenkte seinem Kollegen von der Mordkommission zum Abschied einen aufrichtig mitleidigen Blick. »Ich möchte nicht mit dir tauschen, Gennaro. Den Mörder eines Kinderschänders zu suchen ...« In der Tür drehte er sich noch einmal um. »Aber wir können reden, wann immer du willst. D’accordo? Und bitte halt mich auf dem Laufenden.«
4
An manchen Tagen erwachte Sonja mit dem befremdenden Gefühl, sie stecke in einem Spiel. Sie sei die Figur, und jemand anders bewege die Fäden, an denen sie hing. Nicht Gennaro, nein, niemand Konkretes. Beileibe kein Gott. Eher Neapel. Neapel als Kosmos, als Universum, in dem sie seit drei Monaten lebte.
Vielleicht hing dieses innere Bild mit der Fremdheit zusammen, die sie von Zeit zu Zeit in Neapel empfand, ganz unvermittelt, ohne Grund oder bestimmten Anlass. Dann stand sie irgendwo, auf einer Piazza, in der Metro, in einer Bar, und plötzlich schwankte der Boden unter ihren Füßen. Nicht als physikalisches Phänomen. Die Erde bebte nicht wirklich, auch wenn die zwischen Vesuv und Phlegräischen Feldern gelegene Stadt, die wie alle Metropolen unaufhörlich wucherte, sich an den Hängen des Vulkans entlangfraß und in die Ebenen des Hinterlands ergoss, aus geologischer Sicht dauerhaft von einem Vulkanausbruch oder einem Erdbeben bedroht war. Sonja hatte bisher weder das eine noch das andere erlebt. Der letzte Ausbruch des Vesuvs datierte aus dem Jahr 1944, das letzte große Erdbeben hatte die Stadt 1980 erschüttert. Es waren aber auch keine Schwindelanfälle, die Sonja in diesen Augenblicken hatte, sondern einfach das Gefühl, dass alles ins Rutschen geriet, abzustürzen drohte. Alles Gewisse, Sichere, Vertraute, Selbstvertraute. Dass der Boden, auf dem sie sich bewegte, brüchig war. Nur einen Moment lang, dann war wieder alles gut und sie atmete einmal tief durch und trank einen Espresso und nahm das Leben wieder in die Hand. Ihr Leben, hier in Neapel. Behutsam zunächst, dann voll Energie, als müsse sie sich beweisen, dass sie notfalls in der Lage wäre, von Scholle zu Scholle zu springen. Abgründe zu überwinden.
Natürlich war sie hier eine Fremde, auch nach drei Monaten noch. Sie kannte sich zwar inzwischen leidlich in der Stadt aus, wusste, wie man von A nach B kommt und hatte jede Menge nette Leute kennen gelernt. Sie sprach Italienisch, konnte sich verständigen, einkaufen, argumentieren – doch schnellen Wortwechseln und Gesprächen im Dialekt konnte sie nur schwer folgen. Gennaro sprach in ihrer Gegenwart so gut wie nie Dialekt, manchmal ein, zwei Sätze mit den Kindern oder wenn er mit seiner Exfrau Rosaria telefonierte. Dann klang er beinahe wie ein Fremder.
Sie dachte darüber nach, wie sich ihr Leben innerhalb so kurzer Zeit verändert hatte. Hätte ihr vor neun Monaten jemand prophezeit, dass sie sich in einen Kriminalkommissar verlieben, ihre feste Stelle als Redakteurin aufgeben und zu ihm nach Neapel ziehen würde, hätte sie einmal laut gelacht und sich mit dem Finger an die Stirn getippt. Guter Witz mit absurder Schräglage. Mit einem Mann zusammenwohnen, ausgerechnet in Süditalien, die finanzielle Absicherung in den Wind schießen ...
Es hatte keine Vorhersage dieser Art gegeben. Eins hatte sich aus dem anderen ergeben. Da lebte man jahrelang routiniert und in kalkulierbarem Gleichmaß vor sich hin und plötzlich kam etwas in Bewegung. Das Steinchen, der Schmetterlingsflügel. Das Chaos, nicht als Theorie, sondern als Praxis. Die Auswirkungen waren krass. Als hätte Sonja sich ungewollt selbst ein Schnippchen geschlagen.
Zwanzig Jahre lang war sie Tag für Tag in die Redaktion gedackelt – es war nicht immer dieselbe, aber immer irgendeine. Zuletzt hatte sie für die Wohnzeitschrift Sweet Home gearbeitet. Hatte, wenn Not an der Frau war, auch zu Hause Artikel geschrieben, nachts, wenn Luzie schlief. Morgens war sie dann schlaftrunken aus dem Bett getaumelt, hatte ihrer Tochter Kakao gekocht und das Schulbrot gestrichen, dann zack! wieder ab in die U-Bahn und in die Redaktion.
Und jetzt? Luzie war flügge, sie lebte seit September in Florenz und würde Weihnachten nach Neapel kommen. Sonja freute sich schon jetzt darauf. Meine kleine Tochter, dachte sie. Meine große, große zwanzigjährige Tochter.
Sie musste sich um niemand anderen kümmern als um sich selbst. Und um Gennaro, aber erst abends, wenn er heimkam.
Das Zauberwort hieß Selbstbestimmung. Wie gut du es doch hast, dachte sie und kuschelte sich noch einmal unter die Decke. Du musst nicht mehr in die Redaktion. Du bist endlich wieder frei.
Am Anfang war Sonja viel durch die Stadt gelaufen, hatte sich Kirchen und Palazzi angesehen, war ins Museum gegangen, hatte andere Deutsche getroffen, die seit Jahren hier lebten, ihr nützliche Informationen zusteckten und alle möglichen Anekdoten erzählten: über das Leben in der Stadt, das Überleben am Golf von Neapel. Die Vorzüge, die Nachteile. Manchmal trafen sie sich in einem Café oder unternahmen einen gemeinsamen Ausflug. Wenn das Wetter einmal schlecht war, hatte Sonja stundenlang auf Gennaros gemütlichem Sofa gelegen und gelesen, sich wieder im Faulenzen geübt.
Doch bald hatte sich die Unruhe zurückgemeldet, die man auch Tatendrang nennen konnte. Etwas zu tun. Etwas zu schreiben. Die Tage zu füllen, nicht nur mit Provisorien und Zufällen und netten Verabredungen. Dem Tag eine Form zu geben. Also: Zeitung lesen, sich Themen überlegen, recherchieren, Leute interviewen, die Kontakte zu deutschen Medien ausbauen, Reportagen anbieten, im Geschäft bleiben. Zunächst hatte sie ein paar kürzere Artikel über die Stadt geschrieben, über den Kult um die Verflüssigung des Blutes von San Gennaro, über den heidnischen Brauch, am zweiten November auf den Friedhof zu gehen und dort ein kleines Picknick zu veranstalten, an dem auch die Totenseelen teilhatten. Den ganzen November über hatte Sonja an einer Reportage über das unterirdische Neapel gearbeitet, die sie diversen deutschen Printmedien und Fernsehsendern angeboten hatte. Mit Erfolg.
In Neapel gab es Themen wie Sand am Meer. Man musste sich nur bücken und den Sand aufheben, aber aufpassen, dass er einem nicht zwischen den Fingern zerrann und andere Leute die Fäden spannen und zogen ...
Was in den letzten Monaten seltener geworden war, waren die unbelasteten, innigen Momente mit Gennaro. Oft war er abends müde, aufgerieben vom zermürbenden Kampf um ein Minimum an Recht und Gesetz. Die Arbeit steckte ihm in den Gliedern, löste sich nicht augenblicklich in Wohlgefallen auf, nur weil zu Hause die Liebste wartete. Und umgekehrt war Sonja nicht mehr der alle Trübsal überstrahlende Stern am Firmament, der den Commissario auf Schritt und Tritt zum Erglühen brachte.
Normalität eben. Alltag. Sie hatten die Schwelle zur Gewohnheit überschritten. Gesten, Blicke, Fragen, Antworten begannen sich zu wiederholen und unmerklich Spuren in ihr gemeinsames Leben zu schleifen, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Spuren, die mehr waren als Liebesritzereien in einem Baumstamm im Park.
»Ihr seid nicht von Wolke sieben abgestürzt, das ist doch schon viel«, hatte Maris dazu am Telefon gesagt, Sonjas beste Freundin aus Hamburg.
Maris war für ihren Pragmatismus bekannt. Sie führte eine Kneipe auf einer ausgedienten Barkasse in der Speicherstadt und hatte diverse Tiefschläge in ihrem Leben durchgestanden. Dabei war ein Großteil ihrer Illusionen mit über Bord gegangen. Sie lebte hoch erhobenen Kopfes seit drei Jahren ohne Mann und hatte sich noch nicht ein einziges Mal darüber beklagt.
»Stell dir vor, du wärst eines Morgens aufgewacht, hättest dir die Augen gerieben und gedacht: Was ist das denn für ein Heini neben mir? Kenn ich den? Rührt sich bei mir irgendwas, wenn ich ihn ansehe? Kann ich das Schnarchen auch nur eine weitere Nacht ertragen? Will ich morgen früh wieder so aufwachen? Will ich heute Abend mit ihm am Tisch sitzen und mir seine Stories anhören? Wie lange brauche ich zum Packen?«
Sonja hatte gegen ihren Willen lachen müssen. Maris war kompromisslos und nahm kein Blatt vor den Mund. Für sie gab es nur Ja oder Nein. Damit waren die meisten Männer überfordert. Viele Frauen im Übrigen auch.
»Ich will doch gar nicht packen«, hatte Sonja etwas kleinlaut geantwortet.
»Dann bin ich ja froh!«
»Trotzdem ...«
»Jetzt aber mal ehrlich: Wie oft ist dir das bisher passiert?«
»Was? Ohne rosarote Brille aufzuwachen?«
»Dass du immer noch bei ihm bist«, hatte Maris mit milder Stimme korrigiert. »Und er bei dir. Obwohl, und ich betone: obwohl ihr den ersten Liebesrausch hinter euch habt.«
In den zwanzig gemeinsamen Jahren mit Luzie hatte Sonja zwar immer wieder Männergeschichten gehabt und durchlebt, auch über längere Zeit, aber im Vergleich zu dem Maitanz an Gefühlen, in den sie mit Gennaro hineingewirbelt war, glichen diese Beziehungen schnöden Zweckgemeinschaften, Einsamkeitsablenkungen, Treffs zur Triebabfuhr, nett, kuschelig, manchmal einfach nur banal, von Liebe keine Spur. All das wusste Maris ganz genau. Warum fragte sie dann? Sonja sagte ihr das.
»Um dir klarzumachen, was für ein Glück du hast! Gebt euch Mühe, verdammt noch mal. So eine Chance gibt’s nicht oft im Leben.«
Recht hatte sie.
Alte Geschichte, dachte Sonja: Sie war die Figur in diesem Leben, von dem jeder nur ein einziges zur Verfügung hatte, und sie war zugleich diejenige, die dieser Figur erst Leben einhauchte: Steh auf, schlüpf aus dem warmen Bett, geh unter die Dusche (gibt es heute Wasser?), mach dir einen Espresso, trink ihn auf der Terrasse (scheint heute die Sonne?) und überleg dir, was du mit dem Tag anfängst (ein Artikel über die Krippengasse? Gleich nach dem Frühstück könnte sie ein paar Mails an die einschlägigen Redaktionen losschicken!).
Kurz vor halb neun. Höchste Zeit. Auf geht’s. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett.
Andiamo. Jammo – sieh da, ein neapolitanisches Wort: Jammo, jammo ’n coppa jammo ja, begann sie zu singen, funicolì, funicolaaa!
Sie lief barfuß die Treppe hoch auf die Terrasse und stieß die Glastür auf. Blauer Himmel, die Sonne schien, ein ungewöhnlich warmer Dezember. Gennaros Schildkröte knabberte an einem Salatblatt. Zurück in der Küche drehte Sonja probehalber den Wasserhahn auf. Na? Es gurgelte – und plätscherte und begann zu laufen. Mit wie wenig man doch in dieser Stadt zufrieden sein konnte. Fließendes Wasser aus dem Hahn. Das wäre ihr in Hamburg als Grund für Glücksgefühle nicht im Traum eingefallen.
5
Dreck am Stecken hatten die Pommellas auf die eine oder andere Weise alle, auch der Vater, aber entweder waren sie clever genug oder sie standen unter der richtigen Protektion – jedenfalls war bis auf den pädophilen Angelo bisher keiner von ihnen für längere Zeit im Gefängnis gelandet. Der Commissario hatte sich die Dossiers aller Pommellas angesehen und sich anschließend noch bei den Kollegen umgehört.
Vater Federico war vor vielen Jahren mehrfach wegen Zigarettenschmuggels und Glücksspiels festgenommen worden, aber stets nach wenigen Wochen wieder auf freiem Fuß gewesen. In letzter Zeit war es stiller um ihn geworden, offenbar hatte er sich zur Ruhe gesetzt und überließ es nun seinen Söhnen, das Familienvermögen zu mehren und die Kriminalpolizei auf Trab zu halten.
Gegen Felice Pommella hatte es mehrere Anklagen wegen Körperverletzung, Waffenbesitz und Zuhälterei gegeben, aber er war immer mit einer Bewährungsstrafe davongekommen.
Die einzige Schwester, Grazia Pommella, führte einen Massagesalon, in dem alles Mögliche getrieben wurde, was in die Graustufenzone zwischen Rotlicht und Drogenhandel fiel.
Die Zwillinge Mario und Gianluca Pommella hatten vor ein paar Jahren einen Krippenladen im Centro Storico eröffnet, in dem ausschließlich Massenware aus China verkauft wurde. Marcocavallo, der Kollege von der Drogenfahndung, hatte die beiden lange schon im Verdacht, dass es auf ihren Geschäftsreisen nach China um ganz andere Geschäfte ging als um die Produktion von Krippenfiguren, und dass in ihrem Laden aufregendere Dinge über den Tisch wanderten als tönerne Hirten, Pizzabäcker und Jesuskinder.