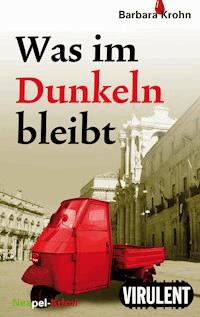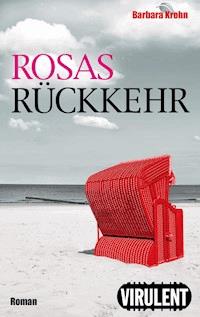Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Krimi
- Serie: Neapel-Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Hamburger Journalistin Sonja Zorn fliegt nach Neapel – eine Menge verdrängter Erinnerungen im Gepäck. Sie ist auf der Suche nach ihrer Tochter Luzie. Die Neunzehnjährige war nach einem heftigen Streit aufgebrochen, um in Neapel nach ihrem Vater zu suchen, von dem sie nichts als den Vornamen kennt. Sonja macht sich Sorgen, zu lange hat sie kein Lebenszeichen mehr von Luzie erhalten, und Neapel steht seit Monaten in den Schlagzeilen. Kein Tag vergeht ohne neue Todesopfer im gnadenlosen Machtkampf der Camorraclans. Gleich am Flughafen wird Sonja von Commissario Gennaro Gentilini in Empfang genommen. Nein, er will sie nicht verhaften, auch nicht bevormunden, er will sich nur im Umgang mit Neapel als hilfreich erweisen. Und bald ist Sonja dankbar für Gennaros Unterstützung. Besonders, als in der Tasche eines erschossenen Fotografen und Kleinkriminellen ein Foto von Luzie gefunden wird…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Nachbemerkung
Impressum
E-Books von Barbara Krohn
Weitere Neapel-Krimis
Roman
Leseprobe - Was im Dunkeln bleibt
Napule è nu sole amaro Napule è addore ’e mare Napule è ’na carta sporca e nisciuno se ne importa …
1
Es war Abneigung auf den ersten Blick: Eine seit Ewigkeiten nicht mehr geputzte eingestaubte Smogglocke hing über der Stadt. Als die Boeing in diesen gelblichen Dunstkreis eintauchte, hielt Sonja automatisch die Luft an. Der Pilot legte wie zur Beschwichtigung eine extrem sanfte Landung hin, die überwiegend deutschen Fluggäste spendeten Applaus. Napoli Capodichino.
Die Cockpittür öffnete sich, Heißluft schwappte herein, Saunacharakter, doch ohne verführerische Duftessenzen. Dann im Urlauberpulk in der sengenden Sonne zu Fuß über das Rollfeld. Schweißgebadet betrat Sonja die Ankunftshalle.
Sie war zum ersten Mal in Neapel und aus ganzem Herzen entschlossen, die Stadt nicht zu mögen. Zwanzig Jahre lang hatte sie versucht, Neapel von der inneren Landkarte zu tilgen. Übrig geblieben war ein weißer Fleck mitten in Italien, um den sie bei all ihren Reisen über die Alpen einen großen Bogen gemacht hatte.
Gruppengelächter. Ein Stück weiter rechts stand ein Trupp gut gelaunter Deutscher mit Sonnenhüten, Shorts und Shirts, die ihrer Vorfreude auf den Inselurlaub freien Lauf ließen.
»Kennst du das Land, wo die Orangen blühen …«
»Das waren Zitronen, Herbert!«
»Dann eben Zitronen.«
»Sind ja auch Zitrusfrüchte, muss man nicht so genau nehmen.«
»Also, der alte Schiller würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste …«
»Goethe, Luise, das war Goethe!«
Erneut schallendes Gelächter.
Den ganzen Flug über hatte Sonja sich hinter einem Band mit Erzählungen von Elsa Morante verkrochen, den sie von Maris zum Geburtstag bekommen hatte. Sie verspürte das Bedürfnis abzutauchen und sich abzuschirmen: gegen Erinnerungen, die sie für immer eingemottet zu haben glaubte, gegen diese gnadenlosen Gedankenirrgärten, die sie seit einem guten Monat von innen aushöhlten. Nicht zuletzt auch gegen die Flut von Reisetipps, die ringsum lautstark ausgetauscht wurden: die Qualität der Thermalbäder auf Ischia, die Sauberkeit der Strände am Golf von Neapel, die Namen preiswerter Restaurants. Aber es war ihr schwer gefallen, sich zu konzentrieren. Gegen ihren Willen hatte sie immer wieder der einen oder anderen Anekdote gelauscht, die von ihren Landsleuten zum Besten gegeben wurde. Darin ging es um Triumphe beim Feilschen, um kleinere Diebstähle oder Betrügereien wie in der Geschichte der besonders günstig erworbenen Spiegelreflexkamera, die sich beim Auswickeln im Hotelzimmer als schnöder Ziegelstein entpuppte. Karambolagen mit dem Leben, bei denen nur leichte Blechschäden zu verzeichnen waren, die sich aber gerade deshalb vorzüglich dazu eigneten, abends bei einem Glas Wein auf der Hotelterrasse und nach dem Urlaub zu Hause ausgeschmückt zu werden: Man hatte etwas erlebt, konnte etwas erzählen und sich einreihen in den Reigen ähnlicher Geschichten, denn fast jeder war irgendwann in seinem Leben einmal beklaut oder betrogen worden.
Sie erwartete nichts von dieser Stadt. Keine Geschichten, keine Karambolagen jedweder Art, bloß nicht! Sie wollte nicht in der Sonne sitzen, nicht den Vesuv besteigen, nicht nach Capri fahren. Sie hasste es, um Preise zu feilschen, und Pizza konnte sie ebensogut woanders essen.
Das leere Transportband, das sich durch die Gepäckhalle wand wie die schuppige Haut eines ausgestorbenen Reptils, war noch immer nicht angesprungen. Vielleicht diente das ewige Warten auf das Gepäck als Maßnahme zur Akklimatisierung. Auf jeden Fall war es eine Prüfung in Sachen Geduld. Die ersten Beschwerden wurden laut. Zwei Urlauber steuerten auf einen uniformierten Flughafenbeamten zu.
Sonja dachte, dass ihr Koffer vielleicht just in diesem Moment unter der sengenden Sonne des Südens von einer Gruppe Kleinkrimineller beiseite geschafft wurde.
Es wäre nicht das erste Mal. Sie erinnerte sich nur zu gut an den Rückflug von der Algarve mit Zwischenlandung in Madrid. Mit Tochter und Mutter hatte sie auf dem Hamburger Flughafen auf das Gepäck gewartet. Alle drei hatten sie wie gebannt auf die sich lichtende Schlange aus Koffern und Reisetaschen gestarrt, die vor ihnen auf dem Transportband vorbeizog. Luzie war damals fünf oder sechs gewesen und entsprechend zuversichtlich, Oma Hilde hatte wie immer wortreich die finstersten Aussichten beschworen, und Sonja stand dazwischen, innerlich auf hundertachtzig, nach außen die Ruhe selbst. Zum Schluss hatten nur noch zwei fremde Reisetaschen einsam ihre Runden gedreht – fehlgeleitetes Gepäck, auf das in irgendeinem anderen Flughafen irgendwo auf der Welt irgendwer vergeblich wartete. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden würden auch ihre Koffer wieder auftauchen, hatte der Flughafenangestellte prophezeit, aber er sollte sich irren. Das Gepäck war und blieb verschwunden. Jahre später hatte Sonja in der Zeitung eine Notiz entdeckt, dass in Madrid eine Bande von Gepäckdieben aufgeflogen war, die mit dem Bodenpersonal gemeinsame Sache machten.
All das stand ihr jetzt wieder lebhaft vor Augen: Luzie, die Tränen über den Verlust der am Strand gefundenen Muscheln vergoss, Oma Hilde, die sich seither standhaft weigerte, ein Flugzeug zu besteigen, sie selbst, die damals geschworen hatte, nur noch mit Handgepäck zu reisen …
Sie musste ein wenig lächeln. Das war auch so einer dieser vielen Seifenblasenvorsätze, die im Nu an der Wirklichkeit zerplatzten. Und wie lange das alles her war. Vierzehn, fünfzehn Jahre. Damals war Luzie so klein gewesen, ein Kind, das noch viele Muscheln suchen und finden sollte. Sonja dachte, dass die Zeit zum Glück die scharfen, verletzenden Kanten der Erlebnisse abschliff, so dass man immer mehr Erinnerungskiesel mit sich herumtrug, runde Steine, Seelenschmeichler. Und sie konnte nur hoffen, dass es sich mit dieser Reise ähnlich verhalten würde. Dass keine Narben zurückblieben, sondern nur die milden Erinnerungen, die man später mit einem Lächeln bedenken konnte.
Aber in diesem Prozess ließ die Gegenwart sich nicht überspringen. Leider. Und Gegenwart hieß vieles: Da war der Riesenstreit mit Luzie und ihr Verschwinden. Da waren die zermürbenden schlaflosen Nächte und die Entscheidung, nach Neapel zu fliegen und nach ihrer Tochter zu suchen, die sich seit über vier Wochen nicht gemeldet hatte. Sonja hatte immer wieder vergeblich versucht, sie per Handy zu erreichen, aber Luzie hatte es entweder ausgeschaltet, oder es war ihr geklaut worden. Da war Neapel, der weiße Fleck in ihrer Erinnerung, der nach Farbe verlangte und sich einfach nicht länger ignorieren ließ. Seit Luzies Verschwinden stolperte Sonja unentwegt über kleine wie große Meldungen in den Zeitungen, in denen die Rede war von den brutalen Machtkämpfen der Camorra-Clans in der Stadt am Vesuv, von den über zweihundert Toten in einem einzigen Jahr. Die Opfer waren zunehmend unschuldige Außenstehende: Ein Verbrecher hatte ein junges Mädchen bei einer Schießerei als Schutzschild benutzt. Einem Jugendlichen auf der Vespa war zum Verhängnis geworden, dass er, vermutlich auf Drängen seiner Eltern, einen Integralhelm getragen hatte und zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht war – jemand hatte ihn für den Killer eines verfeindeten Clans gehalten und eiskalt abgeknallt.
Sonja hatte diese Notizen widerwillig, mit wachsender Beklemmung gelesen. Dass sie nicht wusste, wo Luzie steckte, machte sie ganz verrückt vor Sorge. Fast zwanzig Jahre lang war Luzie Sonjas Tochter gewesen und Sonja Luzies Mutter. Und alles war gut. Sie brauchten keine alten Geschichten. Vor allem brauchten sie keine Suche nach einem Vater, der nie einer gewesen war. Ausgerechnet Neapel. Das war wirklich das Allerletzte.
Da musst du durch, sagte eine innere Stimme. Kopf hoch, Augen auf und durch.
Ist alles nur halb so wild, beschwichtigte eine andere Stimme. Neapel sehen und sterben – so schlimm wird’s schon nicht werden, und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Mit einem Ruck kam Bewegung in das Transportband und riss Sonja aus ihren Gedanken. Das Gepäck wurde nacheinander vom Band gepflückt. Ihr Koffer tauchte als einer der letzten auf. Das war immerhin ein Anfang.
2
Als Sonja durch die Sperre ging, stellte sich ihr ein Mann in den Weg. Südländer, aber einen halben Kopf größer als sie. Kaugummi kauend hielt er ihr ein Stück Pappkarton vor die Nase, auf dem ihr Name stand. Nicht zu übersehen: Sonja Zorn.
Sie stutzte, blieb stehen. Da musste ein Irrtum vorliegen.
Er sah sie erwartungsvoll an.
»Si sbaglia«, wehrte sie ihn in bestem Sprachkursitalienisch ab. »Das muss ein Irrtum sein. Ich gehöre zu keiner Reisegruppe.« Sie wollte an ihm vorbei.
Der Mann öffnete mit einem entwaffnenden Lachen die Arme, als wäre die Welt ein großer Witz. Es sah aus, als wollte er Sonja umarmen. Oder sie daran hindern weiterzugehen.
»Benvenuta a Napoli, Signorina Zorn. Ich bin Commissario Gentilini. Gennaro Gentilini.«
Es dauerte einen Moment, bis die Information zu ihr durchgedrungen war. Commissario? Der Mann war von der Polizei? Sie gefror augenblicklich zu einem Eisblock. Luzie … Vor ihrem inneren Auge spielten sich im Bruchteil von Sekunden Dramen ab, grauenvolle Bilder stürzten auf sie ein, die allesamt Luzie zum Mittelpunkt hatten, Luzie als Hauptfigur, als Opfer. Die Angst schnürte Sonja die Luft ab.
Dann registrierte sie wie durch einen Schleier das Lächeln im Gesicht des Kommissars. Wer so lächelt, hat nicht den Tod im Gepäck, sagte ihre innere Stimme, bleib ruhig, es ist nichts passiert. Der Eisberg in ihr begann zu tauen. Sie gewann die Fassung zurück.
»Ich wüsste nicht, dass wir uns kennen.«
»Noch nicht«, sagte der Mann. »Aber wir haben einen gemeinsamen Freund.« Er fuhr fort, Lion Lichtenberg (er sagte Licktenberrrge) habe ihn heute früh angerufen und gebeten, Signorina Zorn (was sich aus seinem Mund eher wie Dsorne anhörte) am Flughafen abzuholen. »Und hier bin ich.«
Sonja war sich sicher, dass Lion nie und nimmer Signorina gesagt hatte.
»Signora«, verbesserte sie kühl.
»Mi scusi«, sagte er. »Natürlich. Signora.«
»Trotzdem danke«, sagte sie. »Nett von Ihnen.«
»Nichts zu danken.«
Einen Moment lang starrten sie sich an, der Commissario unerschüttert lächelnd und nonstop das Kaugummi umwälzend, Sonja unerschüttert nichtlächelnd. Im nächsten Moment nahm Gentilini ihr wortlos den großen Rollkoffer aus der Hand und begann ihn mannhaft und zielstrebig in Richtung Ausgang zu schleppen, statt das Gepäck wie ein folgsames Hündchen über den glatt polierten Terrazzoboden zu dirigieren. Bitte sehr, wenn ihm das lieber war.
Sonja folgte ihm mit sehr gemischten Gefühlen im Abstand von zwei Metern. Kaum setzte sie einen Schritt außer Landes, hatte sie auch schon zwei Männer im Nacken. Der eine fädelte von Hamburg aus Kontakte ein, um die sie ihn nicht gebeten hatte, der andere nahm sie gleich auf den ersten Metern in Gewahrsam. Natürlich konnte man die Sache auch anders sehen: Ihr uralter treuer Freund Lion Lichtenberg, mit dem sie im Sandkasten Burgen gebaut hatte und der später bei der Hamburger Kripo gelandet war, sorgte auch aus der Ferne rührend für sie, indem er Sie mit jemandem bekannt machte, der ihr in dieser Stadt nützlich sein konnte. Dagegen war nichts zu sagen, das war, solange keine Hintergedanken im Spiel waren, lieb und nett, und auch dieser Kaugummi kauende, lachende, Koffer schleppende Commissario wollte vermutlich auf seine Art nur nett und gastfreundlich sein – gentile eben, um seinem Namen alle Ehre zu machen. Dennoch fragte sie sich verärgert, was Lion ihm wohl erzählt haben mochte, über sie, Luzie, den Hintergrund ihrer Reise … Sie brauchte keine Hilfe. Sie kam allein klar.
Während sich das Polizeiauto im sprichwörtlichen Schneckentempo durch die verstopften Straßen der Peripherie schob, tauschten Sonja und Gentilini die üblichen Höflichkeiten aus. Wie der Flug gewesen war, das Wetter in Hamburg, das Wetter in Neapel, dergleichen mehr.
Nein, sie war noch nie in Neapel gewesen. Weder auf Ischia noch auf Capri.
Nein, auch nicht an der amalfitanischen Küste.
Sorrento? Nein.
Nicht auf dem Vesuv. Auch nicht in Pompeji, nein. Überall im Norden, ja, am Gardasee, in der Lombardei, im Friaul, natürlich Toskana, Cinque Terre, Elba, Sardinien, mehrmals in Rom und Venedig, sogar auf Sizilien aber Neapel, nein, noch nie.
Sie fügte ein leider hinzu, das klang höflicher.
»Warum nicht?« Gentilini sah sie interessiert von der Seite an. »Für Sie als Journalistin muss Neapel doch ein gefundenes Fressen sein.«
»Es hat sich nicht ergeben.«
Darum eben, dachte sie. Weil sie sich damals geschworen hatte, niemals einen Fuß in diese Stadt zu setzen. Und hätte Luzie nicht vor ein paar Wochen angefangen, beharrlich nach ihren Wurzeln zu graben und Fragen zu stellen, die sie früher nie gestellt hatte, und auf Dachböden zu stöbern und alte Koffer zu öffnen, würde Neapel vermutlich weiterhin hinter verstaubten Oleanderbüschen im Straßengraben von Sonjas kurvenreichem Lebensweg verrotten. Von wegen gefundenes Fressen. Aber das ging diesen Commissario nichts an. »Ich finde, es gibt genügend andere Probleme auf der Welt, als sich zu fragen, weshalb man irgendwo noch nicht gewesen ist«, fügte sie hinzu. »Waren Sie etwa schon mal in Hamburg?«
Gentilini schnalzte verneinend mit der Zunge.
»Und warum nicht?«
Er grinste. »Hat sich nicht ergeben. Leider.«
Sonja fächerte sich unauffällig Luft zu. Die Temperaturen im Inneren des Lancia kletterten allmählich in den roten Bereich. Aus dem Augenwinkel stellte sie fest, dass der Dienstwagen zwar eine Klimaanlage hatte, diese aber nicht eingeschaltet war. In Hamburg hatte es in den letzten zwei Wochen fast ununterbrochen geregnet, und Anfang Mai war es noch einmal richtig kalt geworden. Alle in der Redaktion hatten sich so aufgeführt, als könne man die Sonne herbeijammern, unentwegt wurden Reisepläne geschmiedet und wieder verworfen – und nun saß Sonja neben diesem durchaus ansehnlichen neapolitanischen Commissario im Auto, schwitzte und war noch nicht einmal angemessen dankbar.
Commissario Gentilini wedelte mit der Hand vor den Schaltern auf dem Armaturenbrett herum, als wolle er ihnen gut zureden. Oder ihnen kühlende Luft zufächern. Die Kippschalter schienen es ihm nicht danken zu wollen.
»Guasto«, sagte er lakonisch. »Kaputt.« Dann lachte er. »Eins der wenigen deutschen Wörter, die ich kenne.« Er fügte hinzu, die Vertragswerkstatt der neapolitanischen Polizei sei leider heillos überlastet. »C’aggia fa’. Da kann man nichts machen.«
Offenbar waren auch die Straßen überlastet. Oder es gab einfach zu viele Autos. Jedenfalls steckten sie schon seit ein paar Minuten hoffnungslos im Stau. Nichts ging mehr. Der Commissario schaltete den Motor aus.
»Wie kommt es, dass Sie so gut Italienisch sprechen?«
»Ich habe es mit der Zeit gelernt.«
»Aber warum ausgerechnet Italienisch? Haben Sie in Italien Verwandte?«
Er sagte nicht Verwandte, sondern famiglia. Haben Sie in Italien Familie … Und sofort war Sonja auf der Hut. War das eine unschuldige freundliche Frage, oder wollte er sie aushorchen? Wie schrecklich empfindlich sie doch war, so leicht aus der Fassung zu bringen.
»Nein«, sagte sie.
Luzies Vater war kein Verwandter und gehörte nicht zur Familie. Jedenfalls nicht aus Sonjas Sicht. Um sich abzulenken fügte sie hinzu: »Ich habe einfach so damit angefangen, an der Volkshochschule. Ich war damals siebzehn. Es hat mir gefallen. Also habe ich weitergemacht.«
Ja, aber warum eigentlich? Warum tat man in seinem Leben etwas und etwas anderes nicht? Warum fuhr man an einen Ort und ließ einen anderen links liegen?
Italienisch zu lernen war eine dieser unbewussten, intuitiven Entscheidungen gewesen, hinter denen sich kein Lebensplan entfaltete wie auf einer riesigen Landkarte mit fest abgesteckten anvisierten Zielen: erst das, dann das, dann das. Alles hätte ebenso gut ganz anders kommen können. Es waren doch letztlich Zufälle, die einen im Leben hierhin oder dorthin führten, wichtig war nur, was man daraus machte. Manche Steine am Wegrand sammelte man auf und passte sie ins Lebensmosaik ein, andere ließ man liegen. Es gab Ideen, die plötzlich vor dem inneren Auge auffunkelten und andere, die man maximal zur Kenntnis nahm, und das war’s. In dem Sprachkurs damals hatte Sonja Maris kennen gelernt, und daraus war eine Freundschaft fürs Leben geworden. Andere Leute, denen sie damals begegnet war, waren schnell wieder im Dickicht des Alltags verschwunden. Wie Antonio …
Ihr brach der Schweiß aus.
»Ich habe früher mal versucht, Japanisch zu lernen«, sagte Gentilini. »Ist ziemlich kompliziert.«
»Und warum ausgerechnet Japanisch?«
»Damals wollte ich möglichst weit weg aus Neapel und möglichst viel Geld verdienen. Japan erschien mir dafür der passende Ort.« Er lachte leise. »Was für verrückte Ideen man hat, wenn man jung ist.«
»Was ist daraus geworden?«
»Wie Sie sehen, bin ich in Neapel geblieben und bei der Polizei gelandet.«
»Mit Zwischenstation in Japan?«
Er antwortet nicht, aber sie bemerkte, dass das Lächeln aus seinem Gesicht verschwunden war. Vielleicht ein versteckter Hinweis, dass auch bei ihm zwischen der verrückten Idee von damals und der nüchternen Gegenwart eine Geschichte von zerplatzten Träumen, pragmatischen Entscheidungen, verletzten Sehnsüchten lauerte. Jeder trug solche Geschichten mit sich herum. Weg aus Neapel? Das hatte sie schon einmal gehört, vor über zwanzig Jahren …
Dass man den Wunsch hatte, dieser Stadt zu entfliehen, wunderte sie allerdings nicht. Der Blick aus dem Autofenster bot außer viel Blech nur einen räudigen Wurf von im Nichts endenden Betonpfeilern und planlos wuchernden, heruntergekommenen Behausungen, vor denen statt grüner Pflanzen und bunter Blumen rostiges Blech und jede Menge Müll blühten. Sie hielt Ausschau nach dem Vesuv, sah aber nichts als ein Meer aus Autos und ein zweites aus Häuserdächern mit Fernsehantennen, die wie Periskope von U-Booten in den graublauen Himmel äugten. Sie horchte auf das Rauschen des Meeres, das Raunen von Sibyllen, den Gesang von Sirenen, doch was ihr ersatzweise angeboten wurde war das ungeduldige Aufheulen frisierter Vespamotoren und Hupen in allen Varianten und Lautstärken.
Irgendwo im Hinterkopf vibrierte Lion Lichtenbergs Stimme, die etwas von einer sinnlichen Stadt faselte. Sinnlich? In der Nase beißende Abgasschwaden, in den Gehörgängen Verkehrslärm, vor Augen ein einziges unerfreuliches Chaos, das sich gerade selbst strangulierte – und auf der Zunge eine Reihe unansehnlicher Worte, die dem Ganzen entsprechend Ausdruck verleihen würden. Aber das hatte Lion wohl nicht gemeint.
»Und – gefällt es Ihnen?«, fragte Commissario Gentilini, der ihren Blick bemerkt hatte.
Wahrscheinlich erwartete er ein paar begeisterte, zumindest erwartungsvolle Floskeln, aber Sonja konnte nicht anders, auch auf die Gefahr hin, ihren Chauffeur endgültig zu verprellen.
»Ehrlich gesagt, nein.«
»Das merkt man.« Er grinste beifällig, und ihr war unklar, ob er ihr insgeheim Recht gab oder sich im Gegenteil über sie lustig machte.
Sie verschränkte die Arme über der Brust. »Und Ihnen?«
»Ich lebe hier«, sagte er achselzuckend. Und dann geschah etwas Unerwartetes: Der Commissario fing an zu singen.
Sul mare luccica / l’astro d’argento / placida è l’onda …
Im ersten Moment war Sonja peinlich berührt. War das ein Willkommensständchen für die widerspenstige Reisende aus dem Norden? Eine schmalzige Kostprobe aus dem Reich Mandolinen spielender Machos? Doch dann spürte sie, dass nichts davon zutraf. Da war kein Schmalz und keine Spur von Theatralik, Kitsch oder Übertreibung. Das Schmalzige existierte einzig und allein in ihrem Kopf. Neben ihr am Steuer des Polizeiwagens saß ein leibhaftiger Neapolitaner, der nicht grölte oder leierte oder schmetterte oder brummte, sondern einfach sang. Mit weicher, wohlklingender Stimme und vor allem völlig ungeniert, während die Melodie sanft auf und ab schaukelte wie ein Fischerboot auf dem glitzernden Meer.
… venite all’argile / barchetta mia …
Der Gesang eroberte ihr Herz zwar nicht im Sturm, aber er riss eine ansehnliche Bresche in die Mauer ihrer Abneigung. Einen Moment lang hatte sie eine Opernbühne vor Augen, darauf eine Hand voll Autoattrappen vor einem blauen Leinwandmeer, und in den ramponierten Gehäusen mit künstlich aufgepinselten Roststellen saßen echte Sänger, die nun aufstanden und ihre Oberkörper durch die offenen Autodächer schoben und im Chor losschmetterten wie in einer Oper von Verdi …
Der Kommissar wiederholte den Refrain und legte dabei ein paar Dezibel zu: Santa Lucia! Santa Lucia!
Wie auf ein unausgesprochenes Kommando setzte zeitgleich ein Hupkonzert ein. Vielleicht hatte irgendwer im Stau die Geduld verloren und augenblicklich eine Vielzahl anderer frustrierter Autofahrer angesteckt, die alle nur darauf warteten, sich endlich Luft machen zu können.
Gentilini hörte genauso abrupt auf zu singen, wie er begonnen hatte, betätigte zwei Schalter auf dem Armaturenbrett – sie waren also doch nicht allesamt kaputt –, woraufhin sich erstens lautlos die Fenster schlossen und zweitens die Polizeisirene auf dem Dach zu heulen begann.
Nach einigem Zögern öffnete sich im blickdichten Verkehrsgewimmel ein Spalt, gerade so groß, dass der Lancia, ohne Kratzer oder Beulen zu riskieren, hindurchpasste. Mit Einsatzhorn kamen sie deutlich schnellervoran.
»Neapel ist ein Monstrum an Stadt, und wenn es mir zu dicht auf die Pelle rückt, singe ich, das beruhigt«, sagte er, wie um zu überspielen, dass er die Grenze der belanglosen Nettigkeiten zwischen ihnen ebenso eindeutig überschritten hatte wie Sonja mit ihrer unverhohlenen Abneigung.
Sie hatte das Gefühl, irgendetwas erwidern zu müssen. Aber was? »Molto bello«? Oder: »Was für ein schönes Lied!« Oder: »Singen Sie in einem Chor?«
Aber nichts davon kam ihr über die Lippen, alles, was ihr einfiel, klang so unzulänglich und platt, Geplapper ohne Sinn und Verstand. War es reiner Zufall, dass er ausgerechnet dieses Lied gesungen hatte? Santa Lucia … Luzie … Hatte Lion ihm womöglich doch erzählt, weshalb sie hier war?
3
Gentilini warf einen Blick auf seine Armbanduhr und verkündete kategorisch, es sei höchste Zeit, in der Altstadt etwas zu essen. Sonja lag ein Protest auf der Zunge. Sie wäre zumindest gern gefragt worden. Doch ihr Magen meldete sich unüberhörbar mit Gegenprotest.
Sie dachte daran, wie oft sie und Hendrik bis zur Appetitlosigkeit darüber diskutiert hatten, wo man essen gehen solle: beim Inder, beim Thailänder, beim Chinesen, Türken, Spanier, Portugiesen oder doch im neuen Bistro hinter der Oper oder lieber gleich beim Italiener, wo man immer wieder landete, wenn einem partout nichts anderes einfiel? Hendrik arbeitete ein Stockwerk über den Räumen von Sweet Home in der Friss-oder-stirb-Abteilung, wie die Redaktion der Gourmetzeitschrift intern genannt wurde. Natürlich war er immer über neueröffnete Restaurants auf dem Laufenden, aber die Entscheidung hatte er – wie eigentlich alle Entscheidungen – stets Sonja überlassen. Einer der Gründe für ihre Trennung, aber nur einer von vielen. Wenigstens schien dieser Gentilini zur Abwechslung einmal ein entscheidungsfreudiger Mann zu sein.
Nach einer verwirrenden, kurvenreichen Fahrt durch ein Labyrinth enger Gassen hielt der Commissario auf einer kleinen Piazza direkt vor dem Eingang einer namenlosen Trattoria. Ein älterer Mann mit Schirmmütze, der auf einem Küchenstuhl im Schatten gesessen hatte, humpelte auf die Fahrertür zu.
Gentilini stieg aus. Sonja beobachtete, wie er dem Mann etwas in die Hand drückte.
»Grazie, Commissarioprofessò, grazie.«
»Mi raccommando, Pasquale.«
Der Mann tat empört: »Ma professò, dite la verità, è mai successo niente?«
»Niente«, lächelte Gentilini. Er ging ums Auto herum und hielt Sonja die Beifahrertür auf.
Pasquale setzte sich hinters Steuer und fuhr los.
»Und mein Gepäck?«, rief Sonja in einem Anflug von Panik.
Einen Moment lang wurde sie von dem absurden Gedanken gepackt, dass hier alles Lug und Betrug war, der Parkplatzwächter genauso unecht wie der Kommissar. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie einen Roman von Robert Coover gelesen. Darin kehrt Pinocchio als alter, ehrwürdiger Professor in seine Heimatstadt Venedig zurück, und kaum verlässt er den Bahnhof, wird er wie in seiner Jugend nach allen Regeln der Kunst übers Ohr gehauen und von Fuchs und Katze in die Zange genommen … Hatte dieser Parkplatzwächter nicht ein Gesicht wie ein Fuchs? Hatte sie sich Gentilinis Ausweis zeigen lassen? Woher wusste sie, dass das alles nicht ein abgekartetes Spiel war? Und waren sie nicht im Begriff, eine Trattoria zu betreten, die nicht einmal einen Namen zu haben schien, sodass sie sie später niemals wiederfinden würde? Sie kannte sich in Neapel nicht aus und würde nicht einmal erklären können, wie ihr das alles passiert war …
Wie angewurzelt stand sie da, das T-Shirt klebte ihr auf der Haut. Dann spürte sie, wie eine Hand sich auf ihren Arm legte.
»Keine Sorge. Einen besseren Bewacher als Pasquale gibt es in der ganzen Stadt nicht.«
Die Stimme klang sanft und entschieden. Sie tat ihr wohl und vertrieb die lähmenden Gedanken. Kurz darauf begrüßte auch die Wirtin Gentilini unmissverständlich als Commissario.
Auf dem Tisch lagen noch die mit Tomatensauce und Rotwein bekleckerten Papiersets der Vorgänger. Ein unrasierter junger Mann mit deutlichem Ansatz zur Fülligkeit schlurfte heran, knüllte die Sets zusammen und fegte einmal mit dem Geschirrtuch die Krümel von der Tischplatte. Dann teilte er wie Spielkarten neue Sets aus und knallte wortlos vier Wassergläser darauf, die entsprechend robust aussahen. Schließlich baute er sich an der Kopfseite des Tisches auf und fing an, die Speisekarte zu erzählen – jedenfalls klang das, was er in gutturalem neapolitanischem Singsang vortrug, in Sonjas Ohren wie eine Erzählung, eine Erzählung von Essen und Trinken, deren Exposition und Höhepunkte sie leider nicht mitbekam. Sie hörte zwar das eine oder andere Wort heraus, spaghetti zum Beispiel oder pasta oder costoletta, aber das war nun wirklich keine Kunst. Nichts zu machen: ihren Sprachkenntnissen zum Trotz musste sie sich von Commissario Gentilini übersetzen lassen, was ihren Magen erwartete. Der junge Mann mit dem Geschirrtuch blieb die ganze Zeit über am Tisch stehen, ungeladener Zeuge dieser peinlichen Niederlage. Sie bestellte, was Gentilini ihr empfahl: als Primo polpi affogati, als Hauptgang alici fritte.
»Vino bianco?«
Sie nickte. »E un’aqua minerale.« Wie verführerisch einfach. Keine fünfseitige Weinkarte, kein überflüssiger Firlefanz.
Der junge Mann stellte eine Karaffe Wein und eine Flasche Wasser auf den Tisch. Dann brachte er einen Korb mit frisch geschnittenem Weißbrot. Gentilini schenkte ein.
»Auf Ihre Zeit in Neapel.«
Sie tranken sich zu.
»Wo haben Sie und Lion sich eigentlich kennen gelernt?«
»Während der Ausbildung. Wir waren einen Monat zusammen in New York auf einem Lehrgang«, sagte er. »Wir hatten von Anfang an die gleiche Wellenlänge. Und jede Menge Spaß. Lion ist nicht so engstirnig wie viele meiner Kollegen. Wir waren zusammen in der Metropolitan Opera und bei den Yankees. Seitdem hat er mich ein paarmal hier besucht.«
»Aber Sie ihn nicht.«
Gentilini nickte. »Steht schon lange auf meinem Programm. Aber der Norden ist weit.«
»Nicht weiter als für uns der Süden«, sagte sie.
»Stimmt. Außerdem hätte ich Sie dann eher kennen gelernt.«
Macho, dachte sie. Der hat seine Sprüche gut gelernt.
Gentilini hatte hellbraune Augen mit dunkleren Flecken. Einer davon kam zu ihr herübergetrieben, sie fing ihn auf, ohne zu wissen, was sie damit anfangen sollte. Ein aufgesammelter Blick. Sie hatte seit längerem keine Männerblicke mehr aufgesammelt, es war der erste seit der Trennung von Hendrik vor zwei Jahren.
»Und jetzt erzählen Sie mir, weshalb Sie in Neapel sind.«
Das klang schon wieder verdächtig nach dem kategorischen maskulinen Imperativ. Sie warf den Kopf in den Nacken.
»Hat Lion Ihnen das nicht verraten?« Es klang weniger schroff, als sie eigentlich vorgehabt hatte.
»In mancher Hinsicht sind Männer sehr diskret«, konterte er und lächelte verschmitzt. »Aber er hat ausgeplaudert, dass Sie Journalistin sind. Vielleicht kann ich Ihnen bei der Recherche behilflich sein.«
Ganz schön von sich überzeugt, der Herr Kommissar. »Normalerweise schreibe ich über Inneneinrichtung«, sagte sie. »Ich besinge Fußböden, Regale, pfiffige Ideen für schräge Wände oder wie man Arbeits-, Schlaf- und Wohnzimmer auf zwölf Quadratmetern unterbringt.«
Er grinste. »Wenn man keine hohen ästhetischen Ansprüche stellt, kann man sich dazu in Neapel viele Anregungen holen. In den Bassi in den Quartieri Spagnoli leben zehnköpfige Familien mitsamt Madonna und TV in einem einzigen Zimmer. Man kann zwar Neapel nicht gerade als Hauptstadt des Designs bezeichnen, aber ein Onkel von mir kennt …«
»Sweet Home ist nur ein Job«, unterbrach sie ihn. »Ich verdiene damit mein Geld, das ist alles.«
Er nickte. »Und was konkret ist Ihr Thema in Neapel?«
Sollte sie ihn mit irgendeiner erfundenen Recherchestory abspeisen? Oder ihm vielleicht von der widerwärtigen Mobbingkampagne in der Redaktion berichten, bei der es zwei Tote gegeben hatte …
»Das ist eine lange Geschichte«, murmelte sie ausweichend.
»Gibt’s keine Kurzfassung?«
Der Kerl ließ nicht locker. Einen Augenblick lang zog sie in Erwägung, ihm von Luzie zu erzählen. Zumindest zu sagen, dass sie in Neapel nach ihr suchte. Nur das. Mehr nicht. Aber das ging nicht. Denn er würde nachfragen, er war ein Profi. Und sie würde antworten müssen. Sie würde sagen müssen, meine Tochter sucht hier in Neapel nach ihrem ihr unbekannten Vater, und dann kämen das Warum und Wieso und das Damals und ihre eigene Rolle dabei auf den Tisch. Nüchtern betrachtet war Luzie neunzehn und somit volljährig und für sich selbst verantwortlich. Sie ist kein dummes Gör mehr, sie geht ihren eigenen Weg. Hatte Lion gesagt. Hatte, mit ähnlichen Worten, auch Maris gesagt. Hätte Sonja mit mehr Abstand vermutlich selbst so gesehen. Wenn Luzie nicht ihre eigene Tochter gewesen wäre. Das brachte sie auf eine Idee. Ein kleiner Rollenwechsel war eine gute Tarnung. Wer weiß, vielleicht konnte dieser Gentilini tatsächlich weiterhelfen.
»Ich suche nach einer jungen Frau. Sie ist die Tochter einer guten Freundin aus Hamburg.«
Er wirkte fast enttäuscht. »So eine Art Recherche meinen Sie.« Er griff in den Brotkorb, riss ein Stückchen Weißbrot ab und schob es sich in den Mund. »Und ich dachte schon, ich könnte etwas über Duschvorhänge dazulernen. Wie alt ist sie?«
»Sie wird im Juni zwanzig. Sie hat sich seit Monaten nicht mehr zu Hause gemeldet. Zuletzt aus Neapel.« Das war leicht übertrieben, beeindruckte Gentilini aber trotzdem nicht im Geringsten.
Er zuckte die Achseln. »Als ich zwanzig war, bin ich fast ein Jahr lang kreuz und quer durch Südostasien gereist. In der ganzen Zeit habe ich nur eine einzige Postkarte nach Hause geschrieben, und zwar am Tag vor meinem Rückflug. Die Postkarte kam allerdings erst ein halbes Jahr später an. Ich meine … «
»Ich weiß, was Sie sagen wollen«, schnitt Sonja ihm das Wort ab. Sie ärgerte sich bereits über die dumme Idee mit der Halbwahrheit. Hätte sie bloß ihren Mund gehalten und sich lieber mit Gentilini über die Wohn- oder die Kochkunst in Neapel unterhalten. Sie versuchte, eine Spur Gelassenheit in ihre Stimme zu legen. »Mit zwanzig probiert man die verrücktesten Sachen aus und schert sich einen Teufel darum, ob die Eltern Bescheid wissen oder etwas gutheißen oder nicht. Ich habe selbst versucht, meiner Freundin das klar zu machen. Aber wenn man auf der anderen Seite steht, sieht man das plötzlich nicht mehr so locker. Sie macht sich einfach große Sorgen.« Sie griff nach dem Wasserglas wie eine Verdurstende und trank es in einem Zug leer. »Wie auch immer. Gut möglich, dass Luzie morgen von selbst wieder auftaucht.«
»Warum macht Ihre Freundin sich nicht selbst auf die Suche?«
Die dunklen Flecken in seinen Augen tanzten auf sie zu. Sonja ließ das unsichtbare Gitter runter.
»Sie hat noch einen jüngeren Sohn und kann unmöglich aus Hamburg weg.« Eiskalt gelogen und nicht mit der Wimper gezuckt. »Außerdem hatte ich gerade Zeit. Das Aufspüren von Informationen, Dingen, Menschen gehört zu meinem Beruf.«
Er lachte leise. »Da haben wir etwas gemeinsam. Aber wieso ausgerechnet Neapel? Gibt es einen speziellen Grund?« Der Profi in ihm ließ nicht locker. Und sie nicht aus den Augen.
Sie starrte zurück, zögerte. Wer A sagte, konnte ebensogut auch B sagen. »Sie … Sie sucht nach ihrem Vater. Er ist Neapolitaner.«
Er machte eine Geste, als wollte er sagen, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. »Kennt sie ihn?«
Sonja schüttelte den Kopf.
»Verstehe. Neapel ist groß. In Neapel kann man sich leicht aus den Augen verlieren. Wie heißt er?«
Sonja griff nach dem Weinglas, um sich irgendwo festzuhalten. Sie hatte es ja gewusst. Dass er immer weiterfragen würde. Er war ein Kommissar, egal wie breit sein Lächeln sein mochte und wie anrührend sein Gesang. Genau das aber hatte sie nicht gewollt. Sie hätte es an seiner Stelle vermutlich ähnlich gemacht. Aber sie war nicht an seiner Stelle. Und sie suchte nicht die Tochter ihrer Freundin. Die Erinnerung, die zu dieser ganzen vermaledeiten Geschichte gehörte, war ihre eigene. Sie kam nicht drum herum.
Ihre Stimme war belegt. »Sie kennt offenbar nur seinen Vornamen.«
»Keine Adresse?«
Sonja schüttelte den Kopf.
Gentilini schwieg und drehte das Glas in den Händen. »Das wird nicht einfach. Weiß er von seinem Vaterglück?«
»Wieso Glück?«, entfuhr es Sonja viel zu heftig. Sie biss sich auf die Zunge und war froh, dass just in diesem Augenblick der Kellner schwungvoll zwei dampfende Teller vor ihnen abstellte.
»Ecco due purpetielle affucate. Buon appetito, Commissario.«
Gentilini schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Grazie, Gigìno.« Dann stopfte er die weiße Stoffserviette mit einer Ecke in den Halsausschnitt seines Hemdes, wünschte auch Sonja einen guten Appetit und tauchte die Gabel in den mit Tomatensauce, Kapern, Oliven und Tintenfisch bedeckten Berg Spaghetti. »Delizioso«, murmelte er. Mit einem Blick auf ihre beige Seidenbluse fügte er hinzu: »Würde ich Ihnen übrigens auch empfehlen. Ich meine, die Serviette.«
Zwei, drei Minuten lang widmeten sie sich beide wortlos den leiblichen Genüssen, und Sonja wollte gerade innerlich aufatmen, als der Commissario den Gesprächsfaden wieder aufnahm.
»Was ich trotzdem noch nicht verstehe, ich meine, wozu das Ganze? Wieso wartet Ihre Freundin nicht einfach ab? Wieso lässt sie ihre Tochter nicht einfach in Ruhe ihren Vater suchen und vielleicht finden oder auch nicht? Wieso hat sie Sie hinterhergeschickt?«
»Ich kenne Luzie … habe ich erwähnt, dass ihre Tochter Luzie heißt … nein, wahrscheinlich nicht … seit sie auf der Welt ist«, sagte Sonja. »Ich bin also eine Vertraute und soll vermitteln, weil … «
Es war gar nicht nötig, lange nach einer Antwort zu suchen. Sie kannte das Motiv dieser fiktiven Freundin bestens. Ihre Stimme zitterte ein wenig, als sie sagte: »Ich glaube, sie hat einfach Angst, dass ihre Tochter nicht zurückkommt. Dass sie ihr nicht verzeiht, dass … Ecco.«
Sie brach den Satz ab, spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Basta!, dachte sie wütend. Es reicht! Was ging ihn das eigentlich an? Schließlich kannte sie den Typen kaum. Je mehr sie redete, desto dünner wurde das Eis, auf dem sie sich bewegte. Sie wollte das nicht. Sie wollte nicht einbrechen. Wollte nicht darüber reden. Kurz entschlossen griff sie nach ihrem Lederrucksack, kramte Luzies Foto hervor und schob es ihm hin.
»Wer weiß, vielleicht läuft sie Ihnen zufällig über den Weg.«
Der Kommissar nahm das Foto und sah es sich kurz an. In dem Moment klingelte sein Handy. Während er telefonierte, verfinsterte sich seine Miene. Die Welt war jetzt eindeutig kein großer Witz mehr, vielleicht war sie es nie gewesen und wurde nur ab und zu von einem Lachen übertönt, das man brauchte, um über die Runden zu kommen. Sonja hörte ihn knapp »dove« und »va bene« und »vengo subito« sagen, dann fluchte er einmal unmissverständlich.
»Ich muss weg. Tut mir Leid.« Er warf einen bedauernden Blick auf den halb vollen Teller vor seiner Nase. Dann schob er den Stuhl zurück und stand auf.
»Was ist los?«
»Eine Schießerei mit zwei Toten in den Quartieri Spagnoli. Genießen Sie das Essen, und lassen Sie sich danach ein Taxi rufen.«
»Nein. Ich komme mit.«
Der Kommissar sah sie irritiert an. Die dunklen Flecken in seinen Augen waren abwehrbereit. Ihm war anzumerken, dass er Widerspruch dieser Art nicht gewohnt war. Dann zuckte er mit den Schultern.
»Die deutsche Presse … Warum eigentlich nicht.« Er legte ein paar Scheine auf den Tisch und griff sich eine Scheibe Weißbrot. »Aber das wird sicherlich kein schöner Anblick. Hier geht’s um was anderes als um stilvolle Esszimmereinrichtungen. «
»Zerbrechen Sie sich bloß nicht meinen Kopf«, sagte Sonja, während sie zur Tür gingen.
»Commissario, Sie müssen weg? Aber die Pasta, was für ein Jammer … « Die Wirtin war aus der Küche gekommen und rang die Hände.
Gentilini blieb kurz stehen. »Was soll ich machen, Giuseppina, so ist das Leben. Tut mir Leid.«
Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Tut Ihnen Leid? Und was ist mit Ihrem Magen? Haben sich wieder mal ein paar dieser malviventi gegenseitig eine Kugel in den Kopf geballert? Kommen Sie, kommen Sie, auch ein Commissario muss essen. Davon, dass Sie hungern, werden diese Mistkerle auch nicht wieder lebendig. Wer tot ist, ist tot. Sage ich die Wahrheit oder nicht, he?«
Ihr Sohn zuckte lahm die Schultern. »Mamma, der Commissario muss … «
»Natürlich haben Sie Recht«, sagte Gentilini sanft. »Mein Magen ist ganz auf Ihrer Seite, Signora. Aber was sein muss, muss sein. C’aggia fa’.«
4
Frisch gewaschene, unbefleckte Laken hingen an den Leinen wie Friedensfahnen. An der Straßenecke die rosa Neonbeleuchtung eines Marienaltars, ästhetisch reizvoll im Kontrast zum Blaulicht der kreuz und quer geparkten Polizeiwagen. Die beiden Leichen lagen direkt vor dem Eingang eines Metzgerladens: zwei Männer, jeder offenbar von mehreren Schüssen getroffen. Es gab viel Blut. Eine unschöne Szene, ein bisschen wie Sonntagabend auf der Mattscheibe, nur in echt. Im Schaufenster hinter den Toten hingen an Eisenhaken befestigte halbe Schafe und gerupfte Hühner mit langem Hals, darunter standen Aluschalen mit Fleischklumpen darin, eine Schale mit einer hellen Masse, vermutlich Hirn, eine andere mit dunkelroten Lappen, vermutlich Leber. Der Laden selbst war leer gefegt. Zwei Uniformierte hielten Anwohner und Passanten auf Abstand.
Sonja war aus Gentilinis Auto ausgestiegen, hatte nur aus einiger Entfernung kurz einen Blick auf die leblosen Körper geworfen, die den Eingang zur Metzgerei versperrten, und sich dann an den Rand des Geschehens zurückgezogen, in den Schutz einer Hauswand. Niemand beachtete sie. Dies war nicht ihr Terrain, sondern Gentilinis Heimspiel.
Bühnenhintergrund war ein heruntergekommener Platz in den Quartieri Spagnoli, ein schachbrettähnliches Geflecht enger, teils dunkler Gassen, die sich jenseits der Flaniermeile Via Roma an den Hang des Vomero pressten. Rings um den kleinen Platz vom Charme eines Trümmergrundstücks drängten sich fünf-, sechsstöckige Häuser mit unansehnlichen Fassaden und schmalen Balkonen, zwischen denen wie als notdürftiger Halt Wäscheleinen gespannt waren. Angesichts des sichtbaren Mangels an Raum und Licht wirkte der freie, unbebaute Fleck allerdings fast wie Luxus: eine Minioase inmitten einer Millionenstadt. Es gab Spuren, die auf einen Ort der Begegnung hindeuteten: Skelette von Sitzbänken um einen Sandkasten, dessen karger Inhalt angereichert war mit Blechdosen und sonstigen Untergruppen der Gattung Müll und der, wie es aussah, maximal noch als Katzenklo diente; zwei verrostete, planlos sich in die Luft schraubende Spiralen, auf denen ursprünglich wohl Schaukeltiere montiert waren; die Halterung für eine Wippe, die jetzt vielleicht anderswo als langer Tisch diente; eine Reihe ehemals weißer, mit Neonfarben besprühter Pflanzgefäße, die offenbar nur deshalb nicht geklaut oder demoliert worden waren, weil sie aus Beton bestanden. Der Ort des Miteinander – ein Ort des Vandalismus.
So oder ähnlich würde Sonja die Reportage über solch ein Pflaster betitelt haben. Sie hätte über die Kinder und Jugendlichen geschrieben, die hier wohnten, über ihre Eltern, wie sie ihr Geld verdienten, über Arbeitslosigkeit und Perspektivenflaute und gescheiterte, in Aggressionen umgeschlagene Hoffnungen. Leichen waren dabei nicht vorgesehen. Aber auch die Reportage war nicht vorgesehen; diese Ödnis hier hatte in der Tat nichts mit Sweet Home zu tun.
Damals, als Sonja mit dem Journalismus anfing und das erste Praktikum bei einem Wochenblatt in Bergedorf bekam, war sie voller Elan gewesen. Zeitungsschreiber sollten aufklären, Hintergründe aufdecken, Verhältnisse analysieren, über die vergessenen Menschen und Orte der Welt berichten. Stattdessen hatte sie Kochrezepte zusammenstellen und einen Artikel über Schrebergärten schreiben müssen, der ihr zu drei Vierteln zusammengestrichen wurde. Mit Luzie im Schlepptau waren dann die restlichen Illusionen zerstoben. Pragmatik war angesagt. Geldverdienen. Was das betraf hatte das rabiate Kürzen der Artikel Sonja sogar vorangebracht. Nach dem Wochenblatt war sie für ein Jahr bei einer Fernsehzeitschrift gelandet und nach diversen Zwischenstationen in der Redaktion von Sweet Home. Auf der vergleichsweise sicheren Seite des Lebens.
Irritiert sah sie sich um. Eine sonderbare Stimmung lag in der Luft, wie ein kollektiver Sud aus Protest und Resignation, Entsetzen und Gleichmut, Aufschrei und gleichzeitigem Verstummen – große Gefühle, die sich gegenseitig in Schach hielten und zu annullieren versuchten. Übrig blieb der Eindruck, als sei eigentlich gar nichts Besonderes passiert, als sei nur kurz der Tod vom Himmel herabgefahren oder aus der Hölle heraufgestiegen, um sich zwei neue Opfer zu holen – ein Achselzucken, da kann man nichts machen.
Ein paar Schritte entfernt standen mehrere Leute aus dem Viertel zusammen. Ein älterer, ziemlich dicker Mann brummte halblaut, doch für Sonja verständlich genug: »Sollen sie sich doch alle gegenseitig umbringen. Dann haben wir endlich Ruhe.«
Ein anderer Mann winkte ab: »Unmöglich. Es sind viel zu viele.«
»Centocinquantadue«, sagte ein jüngerer Mann mit ausdrucksloser Stimme.
»Was soll das sein, hundertzweiundfünfzig, die neue Buslinie in den Himmel?«
Irgendwer rief: »Neue Tombolazahlen! Todsichere Sache!«
Ein Mann lachte. »Da hast du Recht, todsicher ist es …«
»Letzte Woche war im Mattino die Rede von hundertfünfundfünfzig! «
Eine jüngere Frau mit Kleinkind auf dem Arm, die in einem Hauseingang stand, mischte sich ein: »Im Telegiornale haben sie was von hundertachtzig Toten gesagt.«
Der erste Mann zuckte die Achseln: »Nichts als Zahlen. Eine so gut und so falsch wie die andere. Dann nehmen wir eben die Mitte, das wären dann … hundertachtundsechzig. «
»Hehe, Pasquale, wo hast du denn rechnen gelernt?«, höhnte der zweite.
»In derselben Schule wie du, Klugscheißer. In der Schule des Lebens.« Die beiden lachten mit rauen Stimmen.
»E chi se ne frega«, brummte ein vierter Mann, der seinen Kopf aus einer Wohnung im Erdgeschoss steckte, sozusagen Parkett erste Reihe. »Hundertzweiundfünfzig, hundertfünfundfünfzig, hundertachtundsechzig und wenn es der tausendeinhundertdreiundsiebzigste wäre!« Er spuckte aus. »Nachwachsen würden sie trotzdem. Wie die Arme einer Krake. Wenn du zwei davon abschlägst, wachsen sofort vier neue nach. Da kann man nichts machen. Gar nichts.«
Einige Leute, die zugehört hatten, machten zustimmende Gesten. »Hier muss jeder sehen, wie er über die Runden kommt«, sagte eine Frau.
»Man muss sich überall auf der Welt arrangieren«, ergänzte der Mann namens Pasquale.
»Wie denn, wo denn, was heißt hier arrangieren«, mischte sich eine zweite Frau ein, »dass ich nicht lache, du bist allein, du kannst gut reden, du arrangierst dir dein Leben nach Belieben, aber zieh du erst mal sechs Kinder groß und finde für sie eine Arbeit, eine anständige Arbeit, für die sie anständiges Geld bekommen, kein dreckiges Geld, an dem Blut klebt von … «
»Calmati, Maria, beruhige dich, nicht so laut.«
»Ist doch wahr … !«, schimpfte die Frau weiter. »Alle wollen sie das große Geld, und zwar möglichst schnell. Der eine verkauft in den Schulen Drogen, der andere steht Schmiere …«
»Wenn es genug Arbeit gäbe, käme keiner von den Jungs auf dumme Gedanken.«
»Das sagst du.«
»Ja, das sage ich.«
Eine ältere Frau legte stumm die Hände gegeneinander und sandte flehentliche Blicke gen Himmel.
»Du glaubst doch nicht, dass die zwei da drüben einer anständigen Arbeit nachgegangen sind, das ist denen doch zu mühsam, in die Fabrik zu gehen und sich ans Band zu stellen … Neinneinnein, die wissen selbst am allerbesten, weshalb es sie erwischt hat!«
»Welche Fabrik, he, welche Fabrik?! Siehst du hier in der ganzen Gegend irgendeine Fabrik?«
»Ha ragione«, sagte eine andere Frau in einer Kittelschürze mit hellblauen Blümchen und nickte Sonja auffordernd zu. »Ha ragione. Oder etwa nicht?«
Sonja nickte, ohne zu wissen, wem sie damit Recht gab. Wahrscheinlich allen. »Die machen unsere Kinder mit Drogen kaputt und fahren dicke Motorräder, die sie von ihrem dreckigen Geld kaufen, der Sohn von … «
»Enzo, zitto!«, zischte seine Frau und schob den Sprecher unsanft in den Hauseingang. »Managgia, nicht so laut!!«
»Und die Polizei?«, rief ein anderer Mann herausfordernd. »Was tut die Polizei?«
Der Mann namens Pasquale verscheuchte zwei Gassenjungen, die angefangen hatten, unter lautem Scheppern eine Blechdose über das Pflaster zu kicken.
»Die kassieren jeden Monat dicke Gehälter und sehen ansonsten zu, dass sie aus der Schusslinie bleiben«, bemerkte ein junger Mann lakonisch. »Wie hieß das neulich so schön? Der Innenminister schickt zehntausend Polizisten nach Neapel … Die müssen es sich unterwegs anders überlegt haben … Oder habt ihr nachts hier schon mal eine Streife gesehen?«
»Du hast doch nachts deine Augen sowieso ganz woanders«, rief einer. Lautes Gelächter.
»Peppino, si mangia!«, erscholl eine Stimme aus dem Inneren einer Wohnung. Essen ging vor. Der junge Mann verschwand im Hausflur.
Sonja erkundigte sich bei der Frau in der Kittelschürze, was eigentlich genau passiert sei.
Die Frau musterte sie mit wachsamem Misstrauen. Offenbar hatte sie sofort herausgehört, dass Sonja keine Einheimische war. »Woher kommen Sie? Francia?«
»Nein, ich bin Deutsche.«
»Ah, tedesca, brava.« Ihre Miene hellte sich auf.
Sonja hatte nicht die geringste Ahnung, was gegen die Franzosen vorlag, außer dass sie bei den Fußballmeisterschaften der letzten Jahrzehnte vielleicht einmal zu oft gegen die Italiener gewonnen hatten. Oder gab es hier in Neapel andere uralte Ressentiments gegen die Nachfahren Napoleons?
»Unser Kühlschrank kommt aus Deutschland«, sagte die Frau. »Miele. Gute Ware. Tipptopp. Läuft seit zwanzig Jahren, ohne einmal aufzumucken.«
»Che vuoi, la Germania funziona«, kommentierte ihr Mann. »Das war schon immer so.