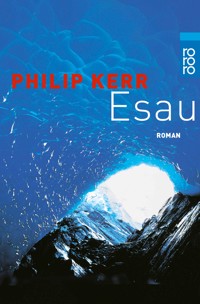9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Berlin 1934. Die Welt ist blind. Bernie Gunther nicht. Gerade sind die Nazis an die Macht gekommen, und Bernie Gunther will als Privatdetektiv im Hotel Adlon so wenig Aufsehen wie möglich erregen. Doch dann stirbt ein Hotelgast. Als auch noch die Leiche eines jüdischen Boxers im Landwehrkanal auftaucht, gerät Gunther in den Strudel krimineller Machenschaften um den Bau des Olympiastadions. Gleichzeitig drohen die Amerikaner, die Spiele zu boykottieren. Entschiedene Befürworterin eines Boykotts ist die wunderschöne jüdisch-amerikanische Journalistin Noreen Charalambides. Bernie erliegt ihrem Charme. Beide geraten ins Fadenkreuz der Nazis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 777
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Philip Kerr
Die Adlon Verschwörung
Thriller
Über dieses Buch
Berlin 1934. Die Welt ist blind. Bernie Gunther nicht.
Gerade sind die Nazis an die Macht gekommen, und Bernie Gunther will als Privatdetektiv im Hotel Adlon so wenig Aufsehen wie möglich erregen. Doch dann stirbt ein Hotelgast. Als auch noch die Leiche eines jüdischen Boxers im Landwehrkanal auftaucht, gerät Gunther in den Strudel krimineller Machenschaften um den Bau des Olympiastadions. Gleichzeitig drohen die Amerikaner, die Spiele zu boykottieren.
Entschiedene Befürworterin eines Boykotts ist die wunderschöne jüdisch-amerikanische Journalistin Noreen Charalambides. Bernie erliegt ihrem Charme. Beide geraten ins Fadenkreuz der Nazis …
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2011
Copyright © 2010 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«If the Dead Rise not» Copyright © 2009 by thynKER ltd
Covergestaltung Pepperzak Brand
Coverabbildung Roger Paperno/Monsoon/Photolibrary/Corbis; ullstein bild
ISBN 978-3-644-20761-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Caradoc King
Wenn ich, nach Menschenweise zu reden,
mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir,
wenn Tote nicht auferweckt werden?
Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir.
AUS DEM ERSTEN BRIEF DES PAULUS AN DIE KORINTHER
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Namen, Personen, Firmen, Organisationen, Orte und Ereignisse sind entweder das Produkt der Phantasie des Autors oder werden zu fiktiven Zwecken benutzt. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen lebenden oder verstorbenen Personen, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Erster TeilBerlin 1934
Kapitel 1
Es war so ein Lärmen, wie man es aus der Ferne vernimmt und zunächst nicht einordnen kann: ein schmutziger Frachtdampfer, der die Spree hinunterstampft, das Schnaufen einer rangierenden Lok unter dem großen Glasdach des Anhalter Bahnhofs, der ungeduldige Odem eines gewaltigen Untiers – als wäre einer der steinernen Dinosaurier des Berliner Zoos zum Leben erwacht und rumpelte nun die Wilhelmstraße entlang. Was auch immer, der Lärm klang viel zu mechanisch, um menschlich zu sein, um gar wie Musik zu klingen. Da tönten laut die Becken und klingelnden Glockenspiele, und dann endlich sah ich sie – eine Abteilung Soldaten marschierte durch die Straße, als wollte sie den Straßenbelag feststampfen. Allein von diesem Anblick taten mir bereits die Füße weh. Sie kamen die Straße entlang, präzise Bewegungen, die Mauserkarabiner links geschultert, die muskulösen rechten Arme mit der Exaktheit eines Pendels zwischen Ellbogen und adlerverzierter Gürtelschnalle hin und her schnellend, die mit grauem Stahl behelmten Köpfe hoch erhoben und die Gedanken – vorausgesetzt, sie hatten welche – ganz beim Volk, beim Reich, beim Führer – bei Deutschland!
Menschen blieben stehen und gafften und salutierten dem Fahnen schwingenden Verkehrshindernis – der Bestand eines kompletten Kurzwarenladens aus rotem, schwarzem und weißem Vorhangstoff war hier verarbeitet worden.
Andere Passanten kamen herbeigerannt, um sich dem Auflauf mit patriotischer Begeisterung anzuschließen. Kinder wurden auf breite Schultern gehoben oder schlüpften zwischen Polizistenbeinen hindurch, um nur ja nichts zu versäumen. Einzig der Mann direkt neben mir wirkte alles andere als begeistert.
«Merken Sie sich meine Worte», sagte er. «Dieser schwachsinnige Idiot Hitler plant allen Ernstes einen weiteren Krieg mit England und Frankreich. Als hätten wir beim letzten nicht schon genug Männer verloren. All dieses Hin-und-her-Marschieren macht mich ganz krank! Es mag ja sein, dass Gott den Teufel erfunden hat, aber Österreich verdanken wir den Führer.»
Der Mann, der diese Worte sagte, hatte ein Gesicht wie der Prager Golem und einen fassförmigen Leib, der auf einen Bierwagen gehörte. Er trug einen kurzen Ledermantel und eine Schirmmütze, die direkt aus seiner Stirn zu wachsen schien. Seine Ohren waren so groß wie die eines indischen Elefanten, sein Schnurrbart erinnerte an eine Klobürste, und seine Kinne waren so zahlreich wie Eulen in Athen. Schon bevor er seinen Zigarettenstummel in Richtung der Blechkapelle schnippte und die Basstrommel traf, hatte sich eine Lücke um diesen unbesonnenen Kommentator herum aufgetan, als wäre er der Überträger einer ansteckenden, tödlichen Krankheit. Niemand wollte in seiner Nähe sein, wenn sich die Gestapo daranmachte, diesen Mann von seiner vermeintlichen Krankheit heilen zu wollen.
Ich wandte mich ebenfalls ab und ging rasch die Hedemannstraße hinunter. Es war ein warmer Tag gegen Ende September, an dem ein Wort wie «Sommer» mich an etwas Kostbares denken ließ, etwas Kostbares, das wir bald verlieren würden. Genau wie «Freiheit» oder «Gerechtigkeit». Heute skandierte jeder an jeder Ecke «Deutschland erwache!», während ich das Gefühl hatte, dass wir mit beinahe traumwandlerischer Sicherheit auf eine schreckliche Zukunft zusteuerten. Allerdings wäre ich nicht so dumm gewesen, derartige Befürchtungen öffentlich zu äußern – ganz bestimmt nicht, wenn Fremde zuhörten. Ich hatte meine Prinzipien, zugegeben – doch ich hatte auch noch all meine Zähne im Mund.
«He, Sie da!», sagte eine Stimme hinter mir. «Warten Sie! Ich will mit Ihnen reden.»
Ich ging weiter, als hätte ich nichts gehört. Ich kam bis zur Saarlandstraße – die Königgrätzer Straße geheißen hatte, bevor die Nazis beschlossen hatten, dass wir alle eine ständige Mahnung an die Ungerechtigkeiten des Vertrages von Versailles und der Beschlüsse des Völkerbunds brauchten –, da holte mich der Typ ein.
«Haben Sie mich nicht gehört?», fragte er, indem er mich an der Schulter packte, herumdrehte, gegen eine Litfaßsäule drückte und mir eine bronzene Marke unter die Nase hielt. Schwer zu erkennen, ob er tatsächlich zur Staatspolizei gehörte, doch nach allem, was ich über Hermann Görings neue Preußische Polizei wusste, trugen nur die unteren Dienstgrade bronzefarbene Bieruntersetzer mit sich herum. Außer uns beiden war niemand auf dem Bürgersteig, und die Litfaßsäule schirmte uns vor neugierigen Blicken aus vorbeifahrenden Fahrzeugen ab. Nicht, dass viel Reklame auf der Säule geklebt hätte – neuerdings bestand Werbung nur aus irgendwelchen Schildern, die einem Juden sagten, wohin er nicht treten durfte.
«Nein, ich habe Sie nicht gehört», antwortete ich.
«Der Mann vorhin, der in diesem Ton über den Führer gesprochen hat. Sie müssen ihn gehört haben. Sie haben direkt neben ihm gestanden.»
«Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendetwas über den Führer gesagt hätte», antwortete ich. «Ich habe der Musik der Marschkapelle gelauscht.»
«Und warum sind Sie dann plötzlich weggegangen?»
«Weil mir plötzlich wieder eingefallen ist, dass ich eine Verabredung habe.»
Die Miene des Polizisten verdunkelte sich. Kein freundliches Gesicht. Er hatte tiefliegende Augen, einen schmallippigen, arroganten Mund und ein ziemlich spitzes Kinn. Es war ein Gesicht, das den Tod nicht zu fürchten brauchte, weil es schon lebendig aussah wie ein Totenschädel. Hätte Goebbels einen älteren und noch fanatischeren Nazibruder gehabt, er hätte vielleicht ausgesehen wie der Kerl vor mir.
«Ich glaube Ihnen nicht», sagte er – und indem er ungeduldig mit den Fingern schnippte, fügte er hinzu: «Ihren Ausweis bitte.»
Das «Bitte» mochte höflich klingen, doch ich wollte ihm meinen Ausweis trotzdem nur ungern zeigen. Der achte Abschnitt auf der zweiten Seite gab Auskunft über meinen erlernten und meinen ausgeübten Beruf, und weil ich nicht mehr Polizeibeamter war, sondern Hotelangestellter, hätte ich ihm auch gleich sagen können, dass ich die Nazis nicht mochte und nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Schlimmer noch – ein Mann, der aus der Berliner Kriminalpolizei entlassen worden war wegen seiner Loyalität gegenüber der alten Weimarer Republik, würde natürlich auch weghören, wenn sich jemand abfällig über den Führer äußerte. Auf der anderen Seite wusste ich auch, dass der Kerl mich möglicherweise verhaften würde, nur um mir den Tag zu verderben, und das konnte schnell mit zwei Wochen in einem Konzentrationslager enden.
Er schnippte erneut mit den Fingern und wandte den Blick jetzt beinahe gelangweilt ab. «Kommen Sie schon, machen Sie voran – ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.»
Ich biss mir auf die Unterlippe, wütend darüber, erneut herumgeschubst zu werden, nicht nur von diesem kadavergesichtigen Schmiermichel, sondern von dem ganzen verdammten Nazistaat. Ich war bereits gezwungen worden, meinen Beruf als Kriminalbeamter im gehobenen Dienst zu quittieren – einen Beruf, den ich geliebt hatte –, und man behandelte mich wie einen Paria, weil ich an der alten Republik festhielt. Das republikanische System hatte viele Schwächen gehabt, keine Frage, doch wenigstens war es ein demokratisches gewesen. Seit dem Zusammenbruch der Weimarer Republik war Berlin, meine Geburtsstadt, nicht mehr wiederzuerkennen. Früher der liberalste Ort der Welt, war die Stadt heute wie ein einziger Exerzierplatz. Diktaturen sehen immer nur so lange hübsch aus, bis jemand anfängt, einen herumzukommandieren.
«Sind Sie taub, Mann? Zeigen Sie mir Ihren verdammten Ausweis!» Der Polizeibeamte schnippte erneut mit den Fingern.
Langsam wurde ich wütend. Ich griff mit der linken Hand in meine Jackentasche, als wollte ich den Ausweis hervorholen, wobei ich mich gerade weit genug von ihm wegdrehte, damit er nicht sah, dass ich die Rechte zur Faust ballte. Und als ich diese Faust in seinem Unterleib versenkte, gab ich mein gesamtes Körpergewicht in diesen Schlag.
Treffer. Es raubte ihm die Luft, und er kippte mir vornüber in die Arme. Wenn so ein Schlag ins Schwarze trifft, dann bleibt der Typ eine ganze Weile außer Gefecht. Ich hielt den bewusstlosen Kerl für einen Moment, dann bugsierte ich ihn vor mir her durch die Drehtür des Hotels Deutscher Kaiser. Meine Wut war unterdessen der schieren Panik gewichen.
«Ich glaube, dieser Mann hat einen Anfall erlitten oder so was», sagte ich zu dem stirnrunzelnden Türsteher und ließ den Schmiermichel in einen Ledersessel gleiten. «Wo sind die Telefone? Ich rufe gleich einen Krankenwagen.»
Der Portier deutete in Richtung eines Korridors um die Ecke hinter dem Empfangsschalter.
Ich lockerte dem Bewusstlosen demonstrativ die Krawatte und tat, als ginge ich zu den Telefonzellen, doch sobald ich um die Ecke war, schlüpfte ich durch eine Personaltür, eilte eine Treppe hinunter und verließ schließlich das Hotel durch die Küche. Ich kam in einer Seitengasse heraus, die in die Saarlandstraße mündete, und hastete von dort aus weiter Richtung Anhalter Bahnhof. Ich überlegte kurz, ob ich in einen Zug springen sollte, dann sah ich den U-Bahn-Tunnel, der den Bahnhof mit dem Excelsior verband, Berlins zweitbestem Hotel. Niemand würde auf die Idee kommen, dort nach mir zu suchen, wo mir hier doch ganz offensichtlich zahlreiche Fluchtrouten zur Verfügung gestanden hätten. Abgesehen davon verfügte das Hotel Excelsior über eine ganz ausgezeichnete Bar. Kaum etwas macht einen Mann durstiger als eine Prügelei mit einem Polizisten.
Kapitel 2
Ich ging geradewegs in die Bar, orderte einen doppelten Korn und kippte ihn hinunter, als hätten wir Mitte Januar.
Im Excelsior war überall Polizei, doch der einzige Beamte, den ich kannte, war der Hausdetektiv Rolf Kuhnast. Vor der Säuberung von 1933 hatte Kuhnast bei der Politischen Polizei in Potsdam gearbeitet und wäre inzwischen sicherlich bei der Gestapo gewesen, hätte es nicht zwei Gründe gegeben, die dagegen sprachen. Einer war, dass Kuhnast im April 1932 eine Gruppe von Beamten angeführt hatte, die, um einen Staatsstreich durch die Nazis zu vereiteln, mit der Verhaftung des SA-Führers Graf Helldorf beauftragt gewesen war. Der zweite war, dass Helldorf inzwischen der Polizeipräsident von Potsdam war.
«Guten Tag, Kuhnast», begrüßte ich ihn.
«Bernie Gunther. Was führt den Hausdetektiv des Adlon ins Hotel Excelsior?»
«Ach, ich vergesse immer wieder, dass das Excelsior ein Hotel ist. Ich bin eigentlich gekommen, um eine Zugfahrkarte zu kaufen.»
«Sie sind wirklich ein Witzbold, Gunther. Waren Sie schon immer.»
«Ich würde ja selbst lachen, wenn hier nicht so viel Polizei wäre. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß ja, dass das Excelsior der Lieblingsladen der Gestapo ist, aber normalerweise sind sie diskreter. Hier laufen Kerle rum, die aussehen, als wären sie direkt aus dem Neandertal gekommen. Auf Händen und Füßen.»
«Wir haben einen sehr bedeutenden Gast», erklärte Kuhnast. «Ein amerikanisches Mitglied des Olympischen Komitees wohnt in unserem Haus.»
«Ich dachte, das offizielle olympische Hotel wäre der Kaiserhof?»
«Ist auch so. Aber es gab eine Änderung in letzter Minute, und der Kaiserhof konnte den Gast nicht einquartieren.»
«Dann ist das Adlon schätzungsweise ebenfalls voll.»
«Woher soll ich das wissen, Gunther?», sagte Kuhnast. «Nur zu, gehen Sie mir auf die Nerven. Diese Gestapo macht mir hier schon das Leben schwer, und es hat mir gerade noch gefehlt, dass ein Klugscheißer aus dem Adlon mir die Krawatte richten will.»
«Ich will Sie doch gar nicht schikanieren, Kuhnast. Ehrlich nicht. Hören Sie, was halten Sie davon, wenn ich Sie zu einem Korn einlade?»
«Ich bin überrascht, dass Sie sich das leisten können, Gunther.»
«Ich hätte nichts dagegen, selbst eingeladen zu werden. Ein Hausbulle leistet keine gute Arbeit, wenn er nicht etwas gegen den Barmann in der Hand hat. Kommen Sie irgendwann mal im Adlon vorbei, und ich zeige Ihnen, welch ein Menschenfreund unser Barmann sein kann, wenn er mit den Fingern in der Kasse erwischt wurde.»
«Otto? Das glaube ich nicht!»
«Müssen Sie auch nicht, Kuhnast. Aber Frau Adlon glaubt es, und sie ist nicht so verständnisvoll wie ich.» Ich bestellte mir einen weiteren Korn. «Kommen Sie, trinken Sie einen mit. Ich brauche einen kräftigen Schluck, um mich zu beruhigen, nach dem, was ich vorhin erlebt habe.»
«Was ist denn passiert?»
«Lassen Sie’s gut sein, Kuhnast. Sagen wir, Bier reicht nicht aus.»
Ich kippte meinen zweiten Korn dem ersten hinterher.
Kuhnast schüttelte den Kopf. «Ich würde ja gerne, Gunther, aber Herr Elschner wird ungehalten, wenn ich nicht darauf achte, dass diese Nazibastarde nicht unsere Aschenbecher klauen.»
Dass er vor mir so offen sprach, lag wohl daran, dass er bestens informiert war über meine eigene republikanische Gesinnung. Dennoch blieb er vorsichtig und führte mich zunächst aus der Bar und durch die Empfangshalle in den gegenüberliegenden Palmenhof. Hier war es ungefährlicher, frei zu reden, niemand konnte uns belauschen, weil im Hintergrund das Orchester des Excelsior spielte. Wollte man nicht augenblicklich verhaftet werden, konnte man dieser Tage in Deutschland nur über das Wetter reden.
«So, so», sagte ich. «Die Gestapo ist also hier, um irgendeinen Ami zu schützen?» Ich schüttelte den Kopf. «Ich dachte, Hitler mag die Amis nicht.»
«Dieser spezielle Ami unternimmt eine Tour durch Berlin, um zu entscheiden, ob die Stadt sich in zwei Jahren als Austragungsort der Olympischen Spiele eignet.»
«Westlich von Charlottenburg gibt es zweitausend Arbeiter, die den starken Eindruck haben, dass die Spiele bereits stattfinden.»
«Es scheint, dass viele Amerikaner dafür sind, wegen der antisemitischen Haltung unserer Regierung, die Olympiade in Deutschland zu boykottieren. Der Ami ist hier, um festzustellen, ob in Deutschland jüdische Mitbürger diskriminiert werden.»
«Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass er dafür in einem Hotel absteigen musste.»
Rolf Kuhnast erwiderte mein Grinsen. «Nach allem, was ich gehört habe, ist es eine bloße Formalität. Zurzeit ist er oben in einem unserer Veranstaltungsräume und studiert die Faktenlage, das heißt die Dokumente, die das Propagandaministerium für ihn zusammengestellt hat.»
«Ah, diese Fakten. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand einen falschen Eindruck von Hitler-Deutschland bekommt, oder? Es ist schließlich nicht so, dass Sie oder ich irgendwas gegen die Juden in dieser Stadt hätten. Es ist nur so, dass die Stadt von ganz bestimmten Leuten regiert wird.»
Es fiel mir schwer, wie der Amerikaner die antijüdischen Maßnahmen der neuen Regierung zu ignorieren – überall in der Stadt gab es so zahlreiche ungeheuerliche Beispiele. Nur ein Blinder konnte die derben Zeichnungen auf den Titelseiten der Naziblätter übersehen, die Davidsterne auf den Schaufenstern von Geschäften in jüdischem Besitz und die «Nur für Deutsche!»-Schilder an den Eingängen zu den öffentlichen Anlagen und Parks – ganz zu schweigen von der realen Angst in den Augen eines jeden Juden im «Vaterland».
«Brundage – das ist der Name des Amis …»
«Klingt irgendwie deutsch …»
«Er spricht kein Wort unserer Sprache», sagte Kuhnast. «Solange er keinen englisch sprechenden Juden begegnet, sollte alles glattlaufen.»
Ich sah mich im Palmenhof um.
«Wieso? Besteht denn die Gefahr, er könnte so etwas tun?»
«Ich wäre überrascht, wenn im Umkreis von hundert Metern um dieses Haus auch nur ein einziger Jude zu finden wäre – Brundage bekommt hohen Besuch ins Excelsior.»
«Doch wohl nicht vom Führer?»
«Sein dunkler Schatten.»
«Der Stellvertreter des Führers kommt ins Excelsior? Hoffentlich haben Sie die Toiletten gereinigt.»
Unvermittelt unterbrach das Orchester sein Stück und stimmte die Nationalhymne an. Die Hotelgäste sprangen von ihren Plätzen auf, ihre ausgestreckten rechten Arme zeigten in Richtung Eingangshalle. Mir blieb gar keine andere Wahl, als es ihnen gleichzutun.
Und tatsächlich, umgeben von seiner SA-Leibwache und Gestapo-Schergen kam Rudolf Heß in der braunen Uniform der SA in das Hotel marschiert. Er hatte ein grobes Gesicht, das an eine Fußmatte erinnerte, aber irgendwie weniger einladend war. Er war mittelgroß und schlank mit dunklem, lockigem Haar und einer transsilvanischen Stirn, den tiefliegenden Augen eines Werwolfs und einem Mund mit Lippen, die so schmal waren wie Rasiermesser. Indem er unsere patriotische Begrüßung flüchtig erwiderte, durchquerte er die Halle und polterte zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hinauf. Mit seiner beflissenen Ausstrahlung erinnerte er mich an einen Schäferhund, der von seinem ostmärkischen Herrn von der Leine gelassen worden war, um dem Amerikaner vom Olympischen Komitee die Hand zu lecken.
Wie es der Zufall wollte, würde mir ein ähnliches Schicksal blühen. Auch ich würde jemandem die Hand lecken müssen – und zwar die Hand eines dieser Gestapo-Typen.
Kapitel 3
Als Hausdetektiv des Adlon wurde von mir erwartet, dass ich Diebesgesindel und Mordbuben den Zugang zum Hotel verwehrte. Doch das konnte sich als schwierig erweisen, wenn die Diebe und Mörder Parteioffizielle der Nazis waren. Einige, beispielsweise Wilhelm Frick, der Reichsminister des Inneren, hatten sogar eine Gefängnisstrafe abgesessen. Das Ministerium befand sich Unter den Linden, gleich um die Ecke vom Adlon, und Frick, ein echter bayrischer Dickschädel mit einer Warze im Gesicht und einer Freundin, die zufällig die Ehefrau eines prominenten Nazi-Architekten war, ging im Hotel ein und aus. Seine Freundin wahrscheinlich auch.
Genauso schwierig für einen Hoteldetektiv war die starke Fluktuation beim Personal, wo ehrliche, hart arbeitende Menschen, die zufällig Juden waren, durch Leute ausgetauscht wurden, die sich als sehr viel weniger ehrlich und fleißig erwiesen, aber dafür zumindest deutscher aussahen.
Ich hielt mich größtenteils aus diesen Dingen heraus, doch als meine Kollegin meinte, im Adlon kündigen und Berlin verlassen zu müssen, fühlte ich mich verpflichtet, ihr zu helfen.
Frieda Bamberger war mehr als eine alte Freundin. Von Zeit zu Zeit waren wir ein Liebespaar, aus Bequemlichkeit, was nur eine hübsche Umschreibung dafür war, dass wir gerne miteinander ins Bett gingen und nicht mehr voneinander wollten – schließlich hatte sie einen Ehemann in Hamburg, von dem sie getrennt lebte. Frieda war eine olympische Fechterin und Jüdin, und allein aus diesem Grund war sie im November 1933 aus dem Berliner Fechtclub ausgeschlossen worden. Ein ähnliches Schicksal, wie es nahezu jedem Juden in Deutschland widerfahren war, der in einem Turn- oder Sportverein war. Im Sommer 1934 erging es einem Juden in Deutschland ähnlich wie einem Kind in Grimms schauerlichem Märchen, das sich in einem Wald verlief, wo hungrige Wölfe lauerten.
Nicht, dass Frieda glaubte, die Situation in Hamburg wäre besser als in Berlin, doch sie hoffte, dass die Diskriminierung, die sie hier in Berlin erdulden musste, dort erträglicher wäre, weil ihr Mann nicht jüdisch war.
«Hör zu», hatte ich zu ihr gesagt. «Ich kenne jemanden bei der Gestapo, der im Judenreferat arbeitet. Einen ehemaligen Kollegen aus meiner Zeit am Alex. Ich habe ihn einmal für eine Beförderung vorgeschlagen, deswegen schuldet er mir noch einen Gefallen. Ich besuche ihn und rede mit ihm; mal sehen, was wir tun können.»
«Du kannst nicht ändern, wer ich bin, Bernie», antwortete sie.
«Vielleicht nicht, wer du bist, aber vielleicht das, was andere über dich sagen.»
Zum damaligen Zeitpunkt wohnte ich in der Schlesischen Straße, im Osten der Stadt. Am Tag meines Termins bei der Gestapo war ich in die U-Bahn gestiegen, nach Westen bis zum Halleschen Tor gefahren und von dort aus zu Fuß weiter in die Wilhelmstraße gegangen – und hatte mir bei dieser Gelegenheit den Ärger mit dem kadavergesichtigen Schmiermichel vor dem Hotel Deutscher Kaiser eingefangen. Von meinem vorübergehenden Zufluchtsort im Excelsior bis zum Gestapo-Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße 8 war es nur ein Katzensprung. Das Gebäude sah weniger wie die Zentrale der neuen deutschen Geheimen Staatspolizei aus als vielmehr wie ein elegantes Hotel aus wilhelminischen Tagen, ein Eindruck, der durch das direkt benachbarte ehemalige Hotel Prinz Albrecht (in dem inzwischen die «Reichsführung SS» untergebracht war) noch verstärkt wurde.
Nur wenige Passanten waren in der Prinz-Albrecht-Straße zu sehen, nur derjenige, der unbedingt musste, ging durch diese Straße. So wie ich, der ich gerade erst einen Beamten niedergeschlagen hatte. Vielleicht dachte ich deshalb, dass dies der letzte Ort wäre, an dem jemand nach mir suchen würde.
Mit den bemerkenswerten Balustraden, den hohen Gewölbedecken und einer Treppe so breit wie Eisenbahngeleise sah die Gestapo-Zentrale wie ein Museum aus, ganz gewiss nicht nach Geheimpolizei – oder vielleicht nach einer Abtei, deren Mönche in schwarzen Ledermänteln herumliefen und Freude daran hatten, Menschen Schmerzen zuzufügen, bis sie ihre Sünden gestanden. Ich betrat das Gebäude und näherte mich einer uniformierten, nicht unattraktiven jungen Frau am Empfang, die mich eine Treppe hinaufbrachte, wir bogen um eine Ecke und gelangten zur Sektion II.
Als ich meinen alten Bekannten sah, lächelte ich erfreut und winkte ihm zu, bis zwei Frauen aus dem Schreibzimmer die Köpfe hoben und mich mit einem halb belustigten, halb überraschten Blick fixierten – als hätte ich mich mit meinem Verhalten der Lächerlichkeit preisgegeben und als wäre ich völlig fehl am Platz. Ihre Überraschung war kaum gespielt – die Gestapo mochte erst seit achtzehn Monaten existieren, doch sie hatte sich bereits einen furchterregenden Ruf erworben, weshalb ich ja so nervös war und erfreut lächelte beim Anblick von Otto Schuchardt. Er winkte nicht zurück. Er lächelte auch nicht. Schuchardt war nie eine Stimmungskanone gewesen, doch ich war ziemlich sicher, dass ich ihn hin und wieder lachen gehört hatte, als wir noch Kollegen am Alex gewesen waren. Andererseits – vielleicht hatte er nur gelacht, weil ich sein Vorgesetzter gewesen war, und während wir uns jetzt die Hände schüttelten, dachte ich bereits, dass es ein Fehler gewesen war herzukommen und dass der fleißige junge Beamte, an den ich mich erinnerte, aus dem gleichen Stoff gemacht war wie die Balustraden und das Treppenhaus hinter der Sektionstür. Er reicht mir die Hand, die kalt war wie Eisen.
Schuchardt war ein attraktiver Mann, wenn man Männer mit weißblonden Haaren und hellblauen Augen attraktiv findet. Ich war selbst blond und blauäugig und betrachtete ihn als eine Art verbesserte Nazi-Version meiner selbst. Ein Herrenmensch und nicht ein bemitleidenswerter Fritz mit einer jüdischen Freundin. Andererseits war Frieda ein ziemlich großzügiger Trostpreis.
Schuchardt führte mich in sein kleines Büro und schloss die Tür mit der großen Milchglasscheibe hinter uns. Wir waren allein mit einem kleinen Holzschreibtisch, einem ganzen Panzerverband von Aktenschränken und einem hübschen Ausblick auf den Garten hinter dem Gestapo-Hauptquartier, wo ein Gärtner sich geflissentlich um die Blumenbeete beugte.
«Kaffee?»
«Gerne.»
Schuchardt steckte einen Tauchsieder in einen Becher mit Leitungswasser. Er schien sich über mein Auftauchen zu amüsieren, denn sein falkenartiges Gesicht zeigte einen Ausdruck, als hätte er zum Frühstück mehrere Spatzen verspeist.
«So, so, so», sagte er. «Bernie Gunther. Ist eine Weile her … zwei Jahre, wie?»
«Kann schon sein.»
«Arthur Nebe ist auch hier. Er ist stellvertretender Sektionschef. Ich wage zu behaupten, dass noch einige andere Leute hier arbeiten, die Sie kennen. Ich persönlich habe ja nie verstanden, warum Sie die Kripo verlassen haben.»
«Ich hielt es für besser zu gehen, bevor ich rausgeworfen wurde.»
«Da irren Sie sich aber gewaltig, denke ich. Die Partei bevorzugt herausragende Kriminalisten, wie Sie einer sind, gegenüber den Mitläufern, die auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind und verborgene Motive haben.» Sein rasiermesserscharfer Nasenrücken legte sich in missvergnügte Falten. «Abgesehen davon haben wir immer noch eine Reihe von Beamten bei der Kripo, die der Partei nicht beigetreten sind. Sie werden gerade dafür respektiert. Ernst Gennat ist so ein Beispiel.»
«Vermutlich haben Sie recht.» Ich hätte all die guten Kripo-Beamten erwähnen können, die im Verlauf der Säuberungsaktion von 1933 rausgeworfen worden waren: Kopp, Klingelhöller, Rodenberg und wie sie alle heißen. Doch ich war nicht hier, um mich auf eine Diskussion über Politik einzulassen. Ich steckte mir eine Muratti an, füllte meine Lungen mit dem Rauch und wartete einige Sekunden, während ich überlegte, ob ich es tatsächlich wagen konnte, Otto Schuchardt gegenüber den eigentlichen Zweck meines Besuchs zu erwähnen.
«Entspannen Sie sich, alter Freund», sagte er und reichte mir einen Becher mit überraschend wohlschmeckendem Kaffee. «Schließlich waren Sie es, der mir geholfen hat, die Uniform abzulegen und bei der Kripo anzufangen. Ich vergesse meine Freunde nicht.»
«Ich freue mich, das zu hören.»
«Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Sie hergekommen sind, um jemanden anzuschwärzen. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ein Denunziant sind. Also, was kann ich für Sie tun?»
«Ich habe eine Freundin», begann ich. «Sie ist eine gute Deutsche, aber sie ist auch Jüdin. Sie ist für Deutschland bei der Olympiade in Paris angetreten. Sie ist nicht religiös, und sie ist mit einem Nichtjuden verheiratet. Sie möchte Berlin verlassen. Ich hoffe, ich kann sie überreden, sich das anders zu überlegen. Ich frage mich, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, offiziell ihr Judentum zu vergessen oder zu ignorieren. Sie haben sicher selbst gehört, dass gelegentlich derartige Dinge geschehen.»
«Tatsächlich?»
«Nun ja … ich denke, schon.»
«Ich würde derartige Gerüchte nicht gedankenlos weitergeben, wäre ich an Ihrer Stelle. Ganz gleich, wie wahr sie sein mögen. Sagen Sie mir doch, wie jüdisch ist Ihre Freundin?»
«Wie ich bereits sagte, sie hat Deutschland bei der Olympiade in …»
«Nein, ich meinte ihre Abstammung. Das Blut. Verstehen Sie, das ist es, was dieser Tage zählt. Ihre Freundin könnte aussehen wie Leni Riefenstahl und mit Julius Streicher verheiratet sein, und nichts davon wäre von Bedeutung, wenn sie von jüdischem Blut wäre.»
«Ihre Eltern sind beide jüdisch.»
«Dann kann ich nichts tun, um ihr zu helfen. Mehr noch, ich muss Ihnen dringend raten, ihr nicht zu helfen. Sie will Berlin verlassen, sagen Sie?»
«Sie glaubt, dass es in Hamburg besser ist.»
«Hamburg?» Diesmal war Schuchardt ehrlich amüsiert. «Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ihr Problem lösen wird. Nein, mein Rat an Ihre Freundin lautet, Deutschland zu verlassen.»
«Sie machen Witze.»
«Ich fürchte, leider nicht, Gunther. Demnächst werden neue Gesetze verabschiedet, die im Ergebnis sämtliche Juden in Deutschland denaturalisieren. Ich dürfte Ihnen das eigentlich nicht erzählen, aber es gibt viele alte Kämpfer, die vor 1930 in die Partei eingetreten sind und die glauben, dass noch längst nicht genug getan wurde, um die jüdische Frage zu lösen. Einige von uns – mich eingeschlossen – gehen davon aus, dass das Klima für Juden hier ziemlich rau werden könnte.»
«Ich verstehe.»
«Nein, ich glaube, nicht. Zumindest noch nicht. Aber Sie werden es verstehen. Ich versuche, Ihnen etwas zu erklären. Nach dem, was mein Boss erzählt hat, der Kriminalassessor Volk, ist eine Person nur dann als deutschstämmig anzusehen, wenn alle vier Großeltern von deutschem Blut waren. Eine Person gilt offiziell als jüdisch, wenn mindestens drei Großeltern jüdisch waren.»
«Und wenn nur ein Großelternteil jüdisch war?», wollte ich wissen.
«Dann gilt die betreffende Person als Mischblut, infolge Rassenkreuzung.»
«Und worauf läuft das alles hinaus, Schuchardt? In praktischer Hinsicht?»
«Juden wird die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Ihnen wird verboten, sich mit reinrassigen Deutschen zu verheiraten oder mit reinrassigen Deutschen sexuelle Beziehungen einzugehen. Jegliche Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist verboten, und Besitz kann nur in bestimmten Grenzen erworben oder behalten werden. Mischlinge müssen sich an den Führer selbst wenden, um ihre Arisierung oder Neueinstufung zu ersuchen.»
«Jesses.»
Otto Schuchardt lächelte. «Ich bezweifle stark, dass Jesus eine Chance auf Neueinstufung hätte. Es sei denn, er könnte nachweisen, dass sein himmlischer Vater Deutscher ist.»
Ich sog den Rauch meiner Zigarette in die Lungen, als wäre es Muttermilch, dann drückte ich den Stummel in einem winzigen Aschenbecher aus. Sicher gibt es ein zusammengesetztes Wort, das genau beschreibt, wie ich mich fühlte. Ich kam nur nicht darauf. Doch ich war ziemlich sicher, dass darin die Wortelemente «Entsetzen» und «Sprachlosigkeit» und «Tritt in den Magen» vorkamen. Und Schuchardt war noch nicht fertig.
«Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen», sagte ich.
Wieder erschien auf seinem Gesicht ein Ausdruck von gequälter Belustigung. «Nein, wissen Sie nicht», erwiderte er. «Aber ich denke, Sie werden es bald begreifen.»
Er öffnete seine Schreibtischschublade und nahm eine dicke beigefarbene Akte hervor. Auf der oberen linken Ecke des Aktendeckels klebte ein weißes Schild mit dem Namen des Subjekts, um das es in der Akte ging. Der Name auf dem Aufkleber war meiner.
«Das hier ist Ihre Personalakte aus der Zeit bei der Polizei. Jeder Beamte hat so eine Akte. Und alle Expolizisten, wie Sie.» Schuchardt klappte die Akte auf und entnahm die erste Seite. «Das Inhaltsverzeichnis. Jedem Gegenstand, jedem hinzugefügten Eintrag wird eine Nummer auf dieser Seite hier zugewiesen. Wollen mal sehen. Ah, hier ist es. Ja. Nummer dreiundzwanzig.» Er blätterte die Seiten um, bis er gefunden hatte, wonach er suchte – ein weiteres Blatt Papier. Er nahm es hervor und reichte es mir.
Ein anonymer Brief, der darauf hinwies, dass ich einen jüdischen Großelternteil gehabt hatte. Die Handschrift kam mir vage vertraut vor, doch ich fühlte mich nicht imstande, vor Otto Schuchardt über die Identität des Schreibers nachzudenken. «Es erscheint mir wenig sinnvoll, diese Tatsache abzustreiten», räumte ich ein und gab ihm das Blatt zurück.
«Ganz im Gegenteil», sagte er. «Es wäre das Sinnvollste, diesen Umstand schlichtweg abzustreiten.» Er entzündete ein Streichholz, hielt das Feuer an den Brief und ließ ihn brennend in den Papierkorb fallen. «Wie ich vorhin sagte, ich vergesse meine Freunde nicht.» Dann nahm er seinen Füllfederhalter hervor und schrieb etwas unter der Rubrik BEMERKUNGEN. «Keine weiteren Maßnahmen erforderlich», sagte er, während er schrieb. «Trotzdem wäre es vielleicht besser, wenn Sie versuchen, das in Ordnung zu bringen.»
«Es erscheint mir jetzt ein wenig zu spät dafür», antwortete ich. «Meine Großmutter ist seit zwanzig Jahren tot.»
«Als Mischling zweiten Grades werden Sie möglicherweise feststellen», sagte er, ohne auf meinen Witz einzugehen, «dass in Zukunft gewisse Einschränkungen für Sie gelten. Beispielsweise könnte es passieren, dass Sie eine Erklärung über Ihre Herkunft abgeben müssen, falls Sie ein Geschäft eröffnen wollen.»
«Tatsächlich habe ich daran gedacht, mich als Privatdetektiv selbstständig zu machen. Vorausgesetzt, ich kann das Geld aufbringen. Die Arbeit als Hausdetektiv im Adlon ist ziemlich langweilig, wenn man vorher bei der Mordinspektion am Alex gearbeitet hat.»
«In diesem Fall wären Sie gut beraten, wenn Sie Ihren jüdischen Großelternteil aus den offiziellen Aufzeichnungen verschwinden ließen. Glauben Sie mir, Sie wären nicht der Erste, der so etwas tut. Es gibt sehr viel mehr Mischlinge, als Sie vielleicht glauben. Allein in der Regierung weiß ich von drei Personen.»
«Wir leben in einer verrückten, falschen Welt, so viel steht fest», sagte ich, nahm meine Zigaretten hervor, steckte mir eine in den Mund, überlegte es mir anders, schob sie wieder in die Packung zurück. «Wie würden Sie so etwas anstellen? Einen Großelternteil verschwinden lassen, meine ich?»
«Offen gestanden, Bernie, das weiß ich auch nicht. Andererseits wäre es keine schlechte Idee, wenn Sie sich mal mit Otto Trettin am Alex unterhielten.»
«Trettin? Wie soll Trettin mir helfen?»
«Otto ist ein äußerst erfindungsreicher Mann mit ausgezeichneten Beziehungen. Sie wissen, dass er Liebermann von Sonnenbergs Abteilung übernommen hat, als Erich der neue Chef der Kripo wurde.»
«Falschmünzerei und Urkundenfälschung», sagte ich. «Ich verstehe allmählich. Ja, Otto war schon immer ein sehr geschäftstüchtiger Junge.»
«Was Sie nicht von mir wissen.»
«Von Ihnen? Ich war nie hier.» Ich erhob mich.
Wir schüttelten uns die Hand. «Erzählen Sie Ihren jüdischen Freunden, was ich Ihnen gesagt habe, Bernie. Sie sollen aus Deutschland verschwinden, solange es noch geht. Deutschland ist nur noch für die Deutschen.» Er hob den rechten Arm und fügte ein beinahe betrübt klingendes «Heil Hitler» hinzu, halb Gewohnheit, halb Überzeugung.
An jedem anderen Ort hätte ich es vielleicht ignoriert. Nicht jedoch in der Gestapo-Zentrale. Außerdem war ich ihm zu Dank verpflichtet – nicht nur, weil er mir geholfen hatte, sondern auch um Friedas willen. Und ich wollte nicht, dass er mich für ungehobelt hielt. Also erwiderte ich seinen Hitlergruß, den ich nun schon das zweite Mal an diesem Tag entbieten musste. Wenn das so weiterging, wäre ich bald ein richtiges Nazischwein, noch bevor die Woche zu Ende ging. Drei Viertel von mir jedenfalls.
Schuchardt begleitete mich nach unten, wo sich mehrere uniformierte Polizeibeamte herumdrückten. Sie schienen aufgebracht. Schuchardt blieb stehen und redete einen der Männer an, während ich weiterging.
«Was ist passiert?», fragte ich, als Schuchardt wieder zu mir aufgeschlossen hatte.
«Ein Kollege wurde tot im Hotel Deutscher Kaiser gefunden», sagte er.
Beinahe hätte ich mich verschluckt. «Das ist schlimm», sagte ich, bemüht, mir nicht anmerken zu lassen, dass sich mein Magen krampfartig zusammenzog. «Was ist passiert?»
«Niemand hat etwas gesehen. Die Ärzte meinen, dass er einen Schlag in den Unterleib bekommen hat.»
Kapitel 4
Frieda reiste nach Hamburg ab, und danach schien es keinen Juden mehr lange im Adlon zu halten. Max Prenn, der Empfangschef des Hotels und ein Cousin von Daniel Prenn, dem besten deutschen Tennisspieler jener Tage, kündigte an, dass er seinem Verwandten ins Ausland zu folgen gedachte, nachdem Daniel aus der deutschen Rasentennisvereinigung ausgeschlossen worden war. Er wollte zukünftig in England leben. Als Nächstes verabschiedete sich ein Isaac Sowieso, einer der Musiker des Hotelorchesters, um zukünftig im Ritz in Paris zu arbeiten. Und schließlich ging auch Ilse Szrajbman, eine Stenotypistin, die Sekretariatsarbeiten für die Hotelgäste erledigt hatte. Sie kehrte in ihre Heimatstadt Danzig zurück, die entweder in Polen lag oder eine freie Stadt im alten Preußen war, je nachdem, von welcher Seite man die Sache sah.
Ich zog es vor, keine Meinung dazu zu haben – so, wie ich mich im Herbst 1934 bemühte, über viele andere Dinge auch nicht weiter nachzudenken. Danzig war nichts weiter als ein zusätzlicher Streitpunkt des Versailler Vertrags, wie das Rheinland und das Saarland und Elsass-Lothringen und unsere afrikanischen Kolonien und die Größe unserer militärischen Streitkräfte. Zumindest in dieser Hinsicht war ich viel weniger deutsch als die drei Viertel in mir, die im neuen Deutschland geduldet waren.
Der Geschäftsführer des Hotels, Georg Behlert, machte seiner Berufsbezeichnung alle Ehre. Er nahm Geschäftsleute und ihre Bemühungen, im Adlon Geschäfte zu machen, äußerst ernst, und die Tatsache, dass einer der wichtigsten und lukrativsten Gäste des Hotels, ein Amerikaner namens Max Reles in Suite 114, sich gern der Dienste von Ilse Szrajbman bedient hatte, hatte zur Folge, dass Ilses Abreise aus dem Hotel Behlert am meisten bekümmerte.
«Die Zufriedenheit und der Komfort der Gäste des Adlon stehen an oberster Stelle», sagte er in einem Tonfall zu mir, als wäre dies eine wichtige Nachricht.
Ich war in seinem Büro, mit Blick auf den botanischen Garten des Hotels, aus dem Behlert früher an jedem Tag im Sommer eine Ansteckblume zu pflücken pflegte. So lange, bis der Gärtner ihn informiert hatte, dass – zumindest in Berlin – rote Nelken das traditionelle Zeichen der Kommunisten waren und aus diesem Grund illegal. Armer Behlert. Er war genauso wenig Kommunist, wie er Nazi war – seine einzige Überzeugung war die, dass das Adlon besser war als alle anderen Berliner Hotels, und er trug nie wieder eine Boutonniere.
«Ein Empfangschef, ein Violinist, ja, selbst ein Hausdetektiv helfen, den Hotelbetrieb am Laufen zu halten. Trotzdem sind sie relativ anonym, und es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass ein Gast Unannehmlichkeiten erleidet, wenn einer von ihnen kündigt. Aber Fräulein Szrajbman hat jeden Tag für Herrn Reles gearbeitet. Er hat ihr vertraut. Es wird nicht einfach, einen Ersatz für sie zu finden, der so gut stenographiert und Maschine schreibt und so zuverlässig ist wie sie.»
Behlert war kein Schnösel – er sah nur so aus und redete so daher. Er war ein paar Jahre jünger als ich – zu jung, um im Ersten Weltkrieg gekämpft zu haben – und trug einen Frack, einen Kragen, der so steif war wie das Lächeln auf seinem Gesicht, Gamaschen und einen schmalen Schnurrbart, der aussah, als hätte Ronald Colman ihn eigens für Behlert gezüchtet.
«Ich denke, wir müssen eine Stellenanzeige aufgeben», sagte er. «Vielleicht in der Deutschen Frau.»
«Das ist ein Nazi-Blatt», sagte ich. «Geben Sie dort eine Anzeige auf, und ich garantiere Ihnen, Sie holen sich einen Spion von der Gestapo ins Haus.»
Behlert sprang auf und schloss die Bürotür.
«Bitte, Herr Gunther. Ich denke, es ist nicht ratsam, so zu reden. Sie könnten uns beide in Schwierigkeiten bringen. Sie reden gerade so, als wäre etwas falsch daran, jemanden zu beschäftigen, der ein Nationalsozialist ist.»
Behlert war sich viel zu vornehm, um das Wort «Nazi» in den Mund zu nehmen.
«Verstehen Sie mich nicht falsch», entgegnete ich. «Ich liebe die Nazis. Allerdings habe ich den Verdacht, dass neunundneunzig Komma neun Prozent der Nazis sich alle Mühe geben, die restlichen null Komma eins Prozent unverdient in ein möglichst schlechtes Licht zu rücken.»
«Bitte, Herr Gunther.»
«Ich schätze, einige gäben ausgezeichnete Sekretärinnen ab. Ehrlich gesagt, ich habe einige gesehen, als ich vor ein paar Tagen im Hauptquartier der Gestapo war.»
«Sie waren in der Gestapo-Zentrale?» Behlert rückte seinen Kragen zurecht, während sein Adamsapfel zuckte.
«Sicher. Ich war früher mal Polizeibeamter, schon vergessen? Wie dem auch sei, ich habe einen Bekannten, Chef einer Sektion, die eine ganze Horde von Sekretärinnen beschäftigt. Blond, blauäugig, hundert Worte die Minute, und das ganz freiwillig. Wenn erst Daumenschrauben und Folterbank zum Einsatz kommen, müssen die guten Mädels noch schneller sein.»
Behlert sah aus, als wäre ihm unser Gespräch unangenehm. «Sie sind ein höchst ungewöhnlicher Mann, Herr Gunther», sagte er.
«Genau das hat mein Freund bei der Gestapo auch gesagt. Irgendetwas in der Art jedenfalls. Hören Sie, Herr Behlert, verzeihen Sie bitte, wenn ich mich in Ihre Angelegenheiten einmische, aber mir scheint, dass wir im Adlon ganz sicher niemanden gebrauchen können, der unsere Gäste mit seinem Gerede über die Politik in Angst und Schrecken versetzt. Nicht wenige Gäste sind Ausländer, und wir beherbergen auch zahlreiche Juden. Sie sind sehr eigen, was Dinge wie Redefreiheit angeht – ganz zu schweigen von Freiheit der Juden. Warum überlassen Sie nicht mir die Suche nach einer geeigneten Person? Jemandem, der keinerlei Interesse an der Politik zeigt. Es ist doch so, dass ich Bewerberinnen ohnehin überprüfen müsste. Abgesehen davon sehe ich mich ganz gerne nach jungen Mädchen um. Selbst nach denen, die imstande sind, sich ihren Lebensunterhalt auf anständige Weise zu verdienen.»
«Schon gut, schon gut, Herr Gunther. Sie haben ja recht.»
«Womit?»
«Mit dem, was Sie gerade gesagt haben», räumte Behlert ein. «Ich habe mich soeben erinnert, wie es war, als man sich noch unterhalten konnte, ohne sich ständig dabei umzusehen, ob man belauscht wird.»
«Wissen Sie, worin meiner Meinung nach das Problem liegt? Bevor die Nazis die Macht übernommen haben, gab es zwar die Redefreiheit, aber keine Rede war so, dass es sich gelohnt hätte, sie anzuhören.»
An jenem Abend besuchte ich eine der Bars im Haus Europa, einem geometrischen Pavillon aus Beton und Glas. Es hatte geregnet, und die Straßen schimmerten dunkel im Licht der Laternen. Die modernen Bürohäuser – Odol, Allianz, Mercedes – ließen mit den hell erleuchteten Fenstern an einen Ozeandampfer denken, der den Atlantik überquerte. Ein Taxi ließ mich in der Nähe des Bugs aussteigen, und ich betrat den Pavillon der Café-Bar, um nach einem geeigneten Besatzungsmitglied Ausschau zu halten, das Ilse Szrajbman ersetzen könnte.
Selbstverständlich hatte ich noch einen Grund, hier zu sein, sonst hätte ich wohl eine so riskante Aufgabe nicht ohne weiteres übernommen. Ich hatte etwas zu tun, während ich mich hier langsam betrank. Etwas Besseres, als mich schuldig am Tod des Polizisten zu fühlen, den ich niedergeschlagen hatte.
Sein Name war August Krichbaum, und die meisten Zeitungen hatten über den Mord an ihm berichtet und außerdem geschrieben, es habe einen Zeugen gegeben, der mich angeblich beobachtet habe. Glücklicherweise hatte der Zeuge Krichbaums Dahinscheiden aus einem Fenster im obersten Stock des Hotels Deutscher Kaiser beobachtet und von mir nichts außer meinem braunen Hut gesehen. Der Portier hatte mich als einen Mann von vielleicht dreißig Jahren mit Schnurrbart beschrieben – hätte ich einen Schnurrbart getragen, ich hätte ihn spätestens abrasiert, nachdem ich diese Zeilen gelesen hatte. Mein einziger Trost war, dass Krichbaum weder Frau noch Familie hinterließ. Das und die Tatsache, dass er ein ehemaliger SA-Mann und seit 1929 Parteimitglied gewesen war. Trotzdem, ich hatte nicht vorgehabt, ihn zu töten. Durch meinen Schlag hatte sich Krichbaums Blutdruck so stark abgesenkt, dass sein Herz ins Stottern geraten und schließlich stehengeblieben war.
Wie üblich war der Pavillon voll mit Stenotypistinnen mit Glockenhüten auf dem Kopf. Ich sprach einige von ihnen an, doch nicht eine war so, wie die Gäste des Hotels sich eine Sekretärin vorstellten – obwohl sie sicher prima Diktate aufnehmen und Maschine schreiben konnten. Ich wusste genau, wie so ein Mädchen zu sein hatte, auch wenn Georg Behlert diesen Umstand gern ignorierte: Das Mädchen brauchte ein wenig Glamour. Genau wie das Hotel selbst. Qualität und Effizienz hatten das Adlon zu dem gemacht, was es heute war. Doch weil das Haus eine glamouröse Aura umgab, war es berühmt geworden, und wegen ebenjener Aura waren alle Zimmer stets ausgebucht – ausschließlich von Leuten, die etwas hermachten, Persönlichkeiten. Weshalb sich natürlich auch die eine oder andere zwielichtige Gestalt hierherwagte. Das zu verhindern war meine Aufgabe, der ich, seit Frieda abgereist war, häufig nach dem Abendessen nachging. Nachdem die Nazis sämtliche Sexclubs und Bars geschlossen hatten, deretwegen Berlin damals gleichsam ein Synonym für Laster und sexuelle Entgleisung war, gab es immer noch eine beträchtliche Anzahl an Freudenmädchen, die in den Maisons von Friedrichstadt oder – häufiger – in den Bars und Lobbys der größeren Hotels arbeiteten. Und so verließ ich den Pavillon schließlich und machte mich auf den Heimweg, um im Adlon nach dem Rechten zu sehen.
Der Portier Carl sah mich aus dem Taxi steigen und kam mir mit einem Schirm entgegen. Er war ziemlich gut mit dem Schirm und einem Lächeln und der Tür und taugte sonst zu herzlich wenig. Nicht gerade das, was ich einen ordentlichen Beruf genannt hätte, doch mit den Trinkgeldern verdiente er mehr als ich. Eine Menge mehr sogar. Frieda hatte den starken Verdacht gehegt, dass Carl Geld von Freudenmädchen nahm, damit er sie in das Hotel ließ, doch weder sie noch ich hatten ihn je überführen oder es beweisen können.
Flankiert von zwei mächtigen Steinsäulen, jede einzelne so dick wie das Rohr eines Belagerungsgeschützes, blieben Carl und ich für einen Moment draußen vor dem Hotel auf dem Bürgersteig stehen, um eine Zigarette zu rauchen und unsere Lungen zu trainieren. Über dem Eingang war ein lachendes Gesicht in den Stein gemeißelt. Zweifellos hatte es die Zimmerpreise gesehen. Fünfzehn Mark die Nacht – das war fast ein Drittel dessen, was ich in einer Woche verdiente.
Ich ging in die Halle, tippte grüßend an meinen feuchten Hut, als ich den neuen Empfangschef passierte, und zwinkerte den Hotelpagen zu. Es waren acht, und sie saßen gähnend auf einer Bank aus poliertem Holz wie eine Kolonie gelangweilter Affen, während sie darauf warteten, von einem Gast oder zu einer sonstigen Pflicht gerufen zu werden. Im Adlon gab es keine Klingeln. Im Hotel herrschte stets eine Stille wie im großen Lesesaal der Preußischen Staatsbibliothek. Ich nahm an, dass es den Gästen recht war, auch wenn mir persönlich ein wenig mehr Lebhaftigkeit und etwas weniger Zurückhaltung lieber gewesen wären. Die Bronzebüste des Kaisers auf einem Kamin aus Siena-Marmor, der beinahe so groß war wie das Brandenburger Tor gleich um die Ecke, schien, ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ganz ähnlich zu denken.
«He!»
«Meinen Sie mich, Majestät?»
«Was machen Sie hier, Gunther?», fragte der Kaiser und zwirbelte das Ende eines Schnurrbarts, dessen Spitzen an die Schwingen eines Albatros erinnerten. «Sie sollten sich um Ihre eigenen Geschäfte kümmern. Die Zeiten, in denen wir leben, sind ideal für Abschaum wie Sie. Bei all den Menschen, die in dieser Stadt verschwinden, könnten Sie als Privatdetektiv ein Vermögen verdienen. Je früher Sie damit anfangen, desto besser, würde ich sagen. Schließlich sind Sie wohl kaum geeignet, an einem Ort wie diesem zu arbeiten, meinen Sie nicht? Sehen Sie sich mal Ihre Füße an. Von Ihren Manieren gar nicht erst zu reden.»
«Was stimmt nicht mit meinen Manieren, Majestät?»
Der Kaiser lachte auf. «Hören Sie sich doch selbst einmal zu. Dieser Dialekt beispielsweise. Er ist furchtbar. Mehr noch, es gelingt Ihnen nicht einmal, halbwegs überzeugend ‹Majestät› zu sagen. Sie haben absolut keinen Sinn für Untertänigkeit. Weshalb Sie im Hotelgeschäft völlig nutzlos sind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum Louis Adlon Sie eingestellt hat. Sie sind ein Strolch. Sie sind immer einer gewesen und werden immer einer sein. Warum sonst haben Sie diesen armen Krichbaum ermordet? Glauben Sie mir – Sie gehören nicht hierher.»
Ich blickte mich in der prunkvoll eingerichteten Halle um. Betrachtete die Säulen aus Marmor in der Farbe von zerlassener Butter. Boden und die Wände waren auch marmorn – als hätte es einen Schlussverkauf in einem Marmorsteinbruch gegeben. Der Kaiser hatte nicht ganz unrecht. Wenn ich noch länger im Adlon blieb, würde ich wahrscheinlich selbst zu Marmor. Wie einer der nackten, muskelbepackten Helden aus der griechischen Sagenwelt.
«Ich würde ja gerne aufhören, Majestät», sagte ich zum Kaiser. «Ich kann es mir nur nicht leisten. Noch nicht. Es kostet Geld, ein eigenes Geschäft einzurichten.»
«Warum gehen Sie nicht zu jemandem von Ihrem Stamm und leihen sich Geld?»
«Mein Stamm? Sie meinen …?»
«Sind Sie nun Vierteljude oder nicht? Das muss doch etwas wert sein, wenn Sie versuchen, sich irgendwo schnelles Geld zu leihen.»
Ich spürte, wie in mir die Wut aufstieg, als hätte er mich geohrfeigt. Vielleicht hätte ich ihm eine derbe Antwort gegeben, wie der Strolch, der ich in seinen Augen war. Zumindest damit hatte er recht. Stattdessen beschloss ich, seine Bemerkungen zu ignorieren. Immerhin war er der Kaiser.
Ich fuhr ins oberste Stockwerk und begann meine nächtliche Patrouille durch das Niemandsland der um diese Uhrzeit spärlich erleuchteten Korridore und Treppenhäuser. Meine Füße waren groß, zugegeben, doch sie bewegten sich lautlos auf den dicken türkischen Teppichen. Wäre nicht das leise Quietschen der Ledersohlen meiner besten Salamander gewesen, ich hätte Herrn Jansens Geist sein können, des stellvertretenden Geschäftsführers des Hotels, der sich nach einem Skandal im Jahre 1913, in den unter anderem eine russische Spionin verwickelt gewesen war, mit der Pistole in den Kopf geschossen hatte. Es heißt, Jansen hätte die Pistole in ein dickes Badetuch gewickelt, um die Hotelgäste nicht durch den Lärm des Schusses aufzuschrecken. Ich bin sicher, man war ihm dankbar für seine Rücksichtnahme.
Ich betrat den Wilhelmstraßenanbau, bog um eine Ecke und sah vor mir eine Frau in einem leichten Sommermantel. Sie klopfte leise an eine Tür. Ich blieb stehen und wartete ab, was als Nächstes geschah. Die Tür blieb geschlossen. Die Frau klopfte erneut, und diesmal drückte sie das Gesicht an das Holz und begann zu reden.
«Machen Sie auf dadrin, ja? Sie haben in der Pension Schmidt angerufen und eine Gesellschafterin angefordert, Sie erinnern sich? Und jetzt bin ich hier.» Sie wartete einen Moment, bevor sie fortfuhr. «Soll ich Ihren Schwanz lutschen? Ich liebe es, Schwänze zu lutschen. Ich bin ziemlich gut darin, wissen Sie?» Als immer noch keine Antwort kam, stieß sie einen verärgerten Seufzer aus. «Hören Sie, ich weiß, ich habe mich ein wenig verspätet, und das tut mir auch sehr leid, aber es ist nicht ganz einfach, ein Taxi zu bekommen, wenn es regnet. Also lassen Sie mich bitte rein.»
«Das stimmt», sagte ich zu ihr. «Ich musste selbst länger nach einem suchen. Einem Taxi, meine ich.»
Sie wirbelte herum und starrte mich an. Sie presste sich die Hand auf die Brust und stieß ein erschrockenes Ächzen aus, das einem erleichterten Auflachen wich. «Sie haben mir vielleicht einen Schrecken eingejagt», sagte sie.
«Das tut mir leid. Es lag nicht in meiner Absicht, Sie zu erschrecken.»
«Nein, nein, schon gut. Ist das Ihr Zimmer?»
«Leider nicht.» Ich meinte es ehrlich, so viel kann ich sagen. Selbst in der schwachen Beleuchtung konnte ich sehen, dass sie eine Schönheit war. Und sie roch auch wie eine. Ich trat auf sie zu.
«Sie halten mich wahrscheinlich für ziemlich dumm», sagte sie. «Aber ich habe offenbar meine Zimmernummer vergessen. Ich habe unten im Restaurant mit meinem Mann zu Abend gegessen, und wir haben uns wegen irgendetwas in die Haare bekommen, deswegen ist er aufgesprungen und gegangen. Und jetzt stehe ich hier und kann mich nicht erinnern, welches Zimmer wir haben.»
Frieda Bamberger hätte sie festgehalten und die Polizei gerufen. Und unter normalen Umständen hätte ich das Gleiche getan. Doch irgendwo zwischen dem Pavillon und dem Adlon hatte ich den Entschluss gefasst, künftig ein wenig nachsichtiger zu sein und ein wenig besonnener zu urteilen. Ich hatte übrigens auch entschieden, nicht mehr so schnell zuzuschlagen. Ich lächelte sie an. «Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein», sagte ich. «Ich arbeite für das Hotel. Wie war noch gleich der Name?»
«Schmidt.»
Einleuchtend, dass sie das sagte, schließlich könnte ich mitbekommen haben, wie sie ihn erwähnte. Das einzig Dumme daran war: Ich wusste, dass die Pension Schmidt das nobelste Bordell in ganz Berlin war.
«Aha.»
«Vielleicht gehen wir nach unten, und ich kann den Empfangschef fragen, welche Zimmernummer wir haben.» Das kam von ihr, nicht von mir. Sie hatte Nerven aus Draht, das musste man ihr lassen.
«Ich bin sicher, Sie stehen vor dem richtigen Zimmer. Kitty Schmidt hat sich noch nie geirrt, wenn es um etwas so Elementares ging wie die Zimmernummer eines Kunden.» Ich deutete mit meinem Hut in Richtung der Tür. «Es ist nur so, dass diese Typen manchmal ihre Meinung ändern. Sie denken an ihre Frauen und Kinder und ihre Gesundheit, und dann vergeht ihnen die Lust. Wahrscheinlich sitzt er hinter der Tür und hat jedes Wort gehört, während er so tut, als würde er schlafen, oder er legt sich schon zurecht, was er dem Manager erzählt, wenn ich ihn aus dem Zimmer hole und ihn verdächtige, ein Mädchen ins Hotel bestellt zu haben.»
«Sie irren sich …»
«Nein, Sie irren sich.» Ich nahm sie am Arm. «Sie kommen jetzt besser mit mir, Fräulein.»
«Was, wenn ich anfange zu schreien?»
Ich grinste. «Dann wecken Sie die Gäste. Das wollen Sie doch sicherlich nicht. Der Nachtportier würde kommen, und ich wäre gezwungen, die Polente zu rufen, und man würde Ihren hübschen Hintern für die Nacht hinter schwedische Gardinen verfrachten.» Ich stieß einen Seufzer aus. «Aber es ist schon spät, ich bin müde, und ich würde Sie lieber einfach nur rauswerfen.»
«Einverstanden», sagte sie strahlend und ließ sich von mir durch den Korridor zu den Treppen führen, wo die Beleuchtung besser war.
Als ich sie zum ersten Mal richtig in Augenschein nehmen konnte, sah ich, dass ihr Mantel mit Pelz abgesetzt war. Darunter trug sie ein veilchenfarbenes Kleid aus irgendeinem hauchfeinen Material, seidig glänzende, milchig-transparente Strümpfe, elegante graue Schuhe, eine Perlenkette und einen kleinen violetten Glockenhut. Ihr Haar war braun und relativ kurz geschnitten, ihre Augen grün, und sie war auf eine knabenhafte Weise wunderschön, obwohl die Nazis den deutschen Frauen weismachten, dass es völlig in Ordnung war, sich wie eine Milchmagd anzuziehen, wie eine auszusehen und, nach allem, was ich wusste, auch so zu riechen. Die junge Frau auf der Treppe neben mir sah eher so aus, als wäre sie auf einer Muschelschale herbeigeflogen gekommen, durch die Luft geweht von Zephyr persönlich.
«Sie versprechen, dass Sie mich nicht an die Polizei ausliefern», sagte sie auf dem Weg nach unten.
«Wenn Sie sich benehmen, ja.»
«Weil ich nämlich meine Arbeit verliere, wenn ich vor einen Strafrichter komme und er mich in den Knast bringt.»
«Arbeit nennen Sie das?»
«Nein, ich meine nicht den Strich. Ich gehe nur hin und wieder anschaffen, wenn ich zusätzliches Geld brauche, um meiner Mutter zu helfen. Nein, ich meine meine richtige Arbeit. Wenn ich meine Stelle verliere, bleibt mir nur noch der Strich, und das will ich nicht. Vor ein paar Jahren wäre es vielleicht noch anders gewesen, aber heute … die Zeiten haben sich geändert, und die Leute sind längst nicht mehr so tolerant.»
«Wie kommen Sie auf diese Idee?»
«Sie scheinen trotzdem ein anständiger Kerl zu sein.»
«Es gibt Leute, die das ganz anders sehen», sagte ich bitter.
«Wie meinen Sie das?», fragte sie.
«Ach, nichts.»
«Sie sind kein Jude, oder?»
«Sehe ich aus wie einer?»
«Nein. Es war bloß die Art und Weise, wie Sie gesagt haben – was Sie gesagt haben. Sie reden wie ein Jude, manchmal zumindest. Nicht, dass es mich auch nur im Geringsten interessiert, was ein Mann glaubt oder wo er herkommt. Ich kapiere sowieso nicht, was die ganze Aufregung deswegen soll. Ich bin noch nie einem Juden begegnet, der aussieht wie in diesen albernen Zeichnungen. Und ich muss es wissen. Ich arbeite für einen Juden, und er ist der netteste Mann, den man sich überhaupt vorstellen kann.»
«Und was machen Sie für ihn?»
«Sie müssen es nicht so formulieren, wissen Sie? Ich sitze nicht auf seinem Gesicht, wenn es das ist, was Sie meinen. Ich bin Stenotypistin bei Odol. Der Zahnpastafirma.» Sie lächelte strahlend, als wollte sie mir ihre Zähne zeigen.
«Im Europahaus?»
«Ja. Was ist daran so lustig?»
«Nichts. Ich komme nur gerade von dort. Offen gestanden, ich habe nach Ihnen gesucht.»
«Nach mir? Wie meinen Sie das?»
«Vergessen Sie’s. Was macht Ihr Chef bei Odol?»
«Er leitet die Rechtsabteilung.» Sie lächelte. «Ich weiß – es ist ein ziemlicher Widerspruch, nicht wahr? Ich und eine Arbeit in der Rechtsabteilung.»
«Und auf den Strich gehen ist also Ihr Hobby?»
Sie zuckte die Schultern. «Wie ich schon sagte, ich brauche das Geld, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Haben Sie Menschen im Hotel gesehen?»
«Den Spielfilm? Sicher.»
«War er nicht wunderbar?»
«Er war ganz in Ordnung.»
«Ich bin ein wenig wie Flämmchen, glaube ich. Das Mädchen, das von Joan Crawford gespielt wird. Ich liebe große Hotels wie das in diesem Film. Wie das Adlon. ‹Menschen kommen, Menschen gehen, und nie passiert etwas.› Aber es ist ganz anders, nicht wahr? Ich glaube, in einem Hotel wie dem Adlon passiert eine ganze Menge. Viel mehr als im Leben der meisten gewöhnlichen Menschen. Ich liebe die Atmosphäre in diesem Hotel. Ich liebe den Glamour. Ich liebe es, wie sich die Laken anfühlen. Die großen Badezimmer. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich die Badezimmer in diesem Hotel liebe.»
«Ist das alles nicht ziemlich gefährlich? Freudenmädchen leben riskant. In Berlin gibt es viele Männer, die nur zu gern anderen Schmerzen zufügen. Hitler. Göring. Heß. Um nur drei zu nennen.»
«Das ist ein weiterer Grund, in ein Hotel wie das Adlon zu gehen. Die Typen, die hier wohnen, wissen, wie man sich benimmt. Sie behandeln Frauen anständig. Sie sind höflich. Abgesehen davon, wenn irgendetwas schiefgehen würde, müsste ich nur schreien, und schon würde jemand wie Sie auftauchen. Was sind Sie überhaupt? Sie sehen nicht aus, als würden Sie am Empfang arbeiten. Nicht mit diesen Pranken. Und Sie sind nicht der Hausdetektiv. Nicht der, den ich vorhin gesehen habe.»
«Sie scheinen sich hier ja bestens auszukennen», sagte ich, ohne auf ihre Fragen einzugehen.
«Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.»
«Sind Sie eine gute Stenotypistin?»
«Bis jetzt hat sich noch nie jemand über mich beschwert. Ich habe Steno- und Maschinenzeugnisse von der Sekretärinnenschule am Ku’damm. Und davor habe ich das Abitur gemacht.»
Wir erreichten die Eingangshalle, wo der neue Empfangschef uns misstrauisch beäugte. Ich dirigierte die junge Frau eine weitere Treppe hinunter in den Keller.
«Ich dachte, Sie wollen mich rauswerfen?», sagte sie und sah sich nach der Eingangstür um.
Ich antwortete nicht. Ich dachte nach. Ich dachte: warum nicht Ilse Szrajbman durch diese junge Frau ersetzen? Sie sah gut aus, war gut gekleidet, sympathisch, intelligent und eigenen Angaben nach überdies noch eine gute Stenotypistin. Eine Behauptung, die leicht zu überprüfen war – dazu musste ich nicht mehr tun als sie hinter eine Schreibmaschine setzen. Außerdem, so sagte ich mir, hätte ich die junge Frau durchaus auch im Europahaus auftreiben und ihr die Stelle anbieten können – ohne zu wissen, auf welche Weise sie sich hin und wieder ein Zubrot verdiente.
«Haben Sie Vorstrafen?»
Die meisten Deutschen hielten Huren nur für Kriminelle, doch ich hatte genug Freudenmädchen im Leben kennengelernt, um zu wissen, dass viele von ihnen alles andere waren als kriminell. Häufig waren sie kultiviert, umsichtig und klug. Abgesehen davon war die junge Frau nicht gerade ein Backfisch. Sie wusste sich in einem Hotel wie dem Adlon zu bewegen. Sie war keine Dame, doch es fiel ihr nicht schwer, sich als eine auszugeben, sollte es nötig sein.
«Ich? Bis jetzt nicht, nein.»
Und doch. Meine Instinkte und meine Erfahrung als Polizist sagten mir, ihr nicht zu vertrauen. Andererseits sagten mir meine jüngsten Erfahrungen als Deutscher, überhaupt niemandem mehr zu vertrauen.
«Schön. Gehen wir in mein Büro. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen.»
Sie blieb auf der Treppe stehen. «Ich bin keine Suppenküche, mein Herr.»
«Seien Sie unbesorgt, ich habe nichts dergleichen im Sinn. Abgesehen davon bin ich Romantiker. Ich will mindestens ein gemeinsames Essen in einem schicken Restaurant. Ich will Blumen und Champagner und eine Schachtel Pralinen von Hövel. Und dann, wenn ich die Dame mag, lasse ich mich von ihr zum Einkaufen bei Gerson mitnehmen. Allerdings muss ich Sie warnen – es dauert eine Weile, bevor ich mich sicher genug fühle, um mit Ihnen ein Wochenende in Baden-Baden zu verbringen.»
«Sie haben einen kostspieligen Geschmack, Herr …?»
«Gunther. Bernie Gunther.»
«Aber das gefällt mir. Passt zu meinem.»
«Ich hatte ein Gefühl, als wäre es so.»
Wir gingen in das Büro des Hausdetektivs, ein fensterloses Zimmer mit einem Feldbett, einem kalten Ofen, einem Stuhl, einem Schreibtisch davor und einem Waschbecken. Auf einem Regal über dem Waschbecken standen ein Rasierer und eine Seifenschale, außerdem gab es ein Bügelbrett und ein Bügeleisen, sodass man ein Hemd aufbügeln konnte, um halbwegs respektabel auszusehen. Fritz Muller, der andere Hausdetektiv, hatte seinen starken Schweißgeruch hinterlassen, doch der Gestank nach Zigaretten und Langeweile stammte ganz allein von mir. Sie rümpfte angewidert die Nase.
«So also sieht das Leben im Keller aus, ja? Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Herr Gunther, aber angesichts des Standards im Hotel ist es hier drin schlichtweg schäbig.»
«Angesichts des Standards im Hotel ist auch das Charlottenburger Schloss schäbig. Wenn wir jetzt zu meinem Vorschlag kommen könnten, Fräulein …?»
«Bauer. Dora Bauer.»
«Ihr richtiger Name?»
«Es würde Ihnen kaum gefallen, wenn ich Ihnen einen anderen nenne.»
«Und das können Sie beweisen.»
«Wir sind in Deutschland.»
Sie öffnete ihre Handtasche und nahm mehrere Dokumente hervor. Eines, ein kleines Büchlein, war in rotes Schweinsleder eingeschlagen. «Sie sind Parteimitglied?»
«In meinem Beruf ist es ratsam, im Besitz solcher Papiere zu sein. Damit werden mir keine unangenehmen Fragen gestellt. Die meisten Polizisten lassen mich in Ruhe, sobald sie das Parteibuch sehen.»
«Daran zweifle ich nicht eine Sekunde. Wozu ist der gelbe Ausweis?»
«Mein Mitgliedsausweis für die Staatliche Schauspielervereinigung. Wenn ich nicht als Stenotypistin arbeite oder auf den Strich gehe, bin ich nämlich Schauspielerin. Ich dachte, wenn ich in der Partei bin, bekomme ich ein paar anständige Rollen. Bis jetzt: Fehlanzeige. Mein letzter Auftritt war in Die Büchse der Pandora an den Kammerspielen in der Schumannstraße. Ich habe die Lulu gespielt. Das war vor drei Jahren. Seither tippe ich für Herrn Weiß bei Odol und träume von einer besseren Zukunft. Wie lautet jetzt Ihr Vorschlag?»
«Ganz einfach. Wir haben viele Geschäftsleute hier im Adlon. Viele von ihnen benötigen die Dienste einer Stenotypistin. Sie zahlen gut. Weitaus mehr als den üblichen Tarif, der in einem Büro gezahlt wird. Vielleicht nicht ganz so viel wie das, was Sie in einer Stunde auf dem Rücken liegend verdienen, aber sicher eine ganze Menge mehr als Odol. Außerdem ist es eine ehrliche Arbeit, und vor allen Dingen ist sie sicher. Und Sie könnten legitim im Adlon ein und aus gehen.»
«Ist das Ihr Ernst?» Sie schien begeistert. «Hier arbeiten? Im Hotel Adlon? Ehrlich?»
«Selbstverständlich.»
«Großes Ehrenwort?»
Ich lächelte nur und nickte.
«Sie mögen lachen, Herr Gunther, aber glauben Sie mir, heutzutage gibt es immer einen Haken, wenn einer jungen Frau eine Arbeit angeboten wird.»
«Glauben Sie, dass Herr Weiß Ihnen ein Empfehlungsschreiben ausstellt?»