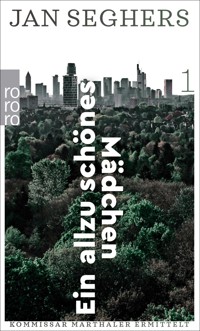9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Marthaler ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Mord in der Vergangenheit. Eine Intrige in der Gegenwart. Hauptkommissar Marthaler muss einen Fall lösen, der ihn an seine Grenzen bringt. An einem nebligen Morgen fährt ein Transporter durch den Stadtwald. Ein wertvolles Gemälde soll zum Frankfurter Flughafen gebracht werden. Plötzlich nehmen zwei vermummte Motorradfahrer die Verfolgung auf. Es kommt zum Schusswechsel. Dabei wird ein Wachmann getötet und Hauptkommissar Marthalers schwangere Freundin Tereza schwer verletzt. Robert Marthaler wird von den Ermittlungen ausgeschlossen. Als er auf eigene Faust recherchiert, gibt ihm der «kleine Bruno», ein obdachloser Exhäftling, den entscheidenden Tipp: Es besteht eine Verbindung zu einem vierzig Jahre alten Verbrechen, dem Mord an der Prostituierten Karin Rosenherz. Schon die Suche nach der Akte ist ein Abenteuer. Das einzige Exemplar befindet sich im Besitz der Journalistin Anna Buchwald. Marthaler sieht sich gezwungen, mit der geheimnisvollen jungen Frau zusammenzuarbeiten. Bei ihren Ermittlungen geraten der Kommissar und die Journalistin in ein Netz aus Intrigen, Korruption und Gewalt. Als der kleine Bruno erschlagen und am überwucherten Ufer eines Sees das Skelett einer lange vermissten Frau entdeckt wird, ahnen beide: Ihre Gegner schrecken vor nichts zurück. Es scheint, als solle die «Akte Rosenherz» für immer geschlossen bleiben … Band 4 der Krimi-Reihe um Kommissar Marthaler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Jan Seghers
Die Akte Rosenherz
Roman
Über dieses Buch
An einem nebligen Morgen fährt ein Transporter durch den Stadtwald. Ein wertvolles Gemälde soll zum Frankfurter Flughafen gebracht werden. Plötzlich nehmen zwei vermummte Motorradfahrer die Verfolgung auf. Es kommt zum Schusswechsel. Dabei wird ein Wachmann getötet und Hauptkommissar Marthalers schwangere Freundin Tereza schwer verletzt.
Robert Marthaler wird von den Ermittlungen ausgeschlossen. Als er auf eigene Faust recherchiert, gibt ihm der «kleine Bruno», ein obdachloser Exhäftling, den entscheidenden Tipp: Es besteht eine Verbindung zu einem vierzig Jahre alten Verbrechen, dem Mord an der Prostituierten Karin Rosenherz.
Schon die Suche nach der Akte ist ein Abenteuer. Das einzige Exemplar befindet sich im Besitz der Journalistin Anna Buchwald. Marthaler sieht sich gezwungen, mit der geheimnisvollen jungen Frau zusammenzuarbeiten. Bei ihren Ermittlungen geraten der Kommissar und die Journalistin in ein Netz aus Intrigen, Korruption und Gewalt. Als der kleine Bruno erschlagen und am überwucherten Ufer eines Sees das Skelett einer lange vermissten Frau entdeckt wird, ahnen beide: Ihre Gegner schrecken vor nichts zurück. Es scheint, als solle die «Akte Rosenherz» für immer geschlossen bleiben …
Vita
Jan Seghers alias Matthias Altenburg wurde 1958 geboren. Der Schriftsteller, Kritiker und Essayist lebt in Frankfurt am Main. Nach dem großen Erfolg von «Ein allzu schönes Mädchen» und «Die Braut im Schnee» folgte «Partitur des Todes»; für diesen Kriminalroman wurde der Autor mit dem «Offenbacher Literaturpreis» sowie dem «Burgdorfer Krimipreis» ausgezeichnet. «Die Akte Rosenherz» ist der vierte Fall für Kommissar Marthaler.
Besuchen Sie den Autor auf seiner Website:
www.janseghers.de
Vielleicht ist dies nicht die Welt,
aber mit ein, zwei kleinen Änderungen
könnte sie es sein.
THOMAS PYNCHON
Als ich geboren wurde
Als die Tage Glück waren
Als das Leben zerrann
Als der Tod zu mir kam
Für Ingrid Kolb und Hermann Peter Piwitt
Als ich damals am Tatort ankam und sah, was geschehen war, bereute ich zum ersten Mal, Polizist geworden zu sein. Niemand, der in der Kirchnerstraße war, wird den Anblick jemals wieder vergessen. Es gab hartgesottene Kollegen, die mir erzählten, dass sie noch Jahre später nachts aus dem Schlaf aufschreckten und das Bild der Toten vor sich sahen. Es war der Abend eines heißen Tages Anfang August 1966, als wir in das Haus in der Frankfurter Innenstadt gerufen wurden. In der Wohnung im dritten Stock hatte man die Leiche einer Frau entdeckt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um Karin Niebergall handelte, die aber in Wirklichkeit Karin Rosenherz hieß. Ihr Körper und ihr Hals waren mit Stichwunden übersät. Offensichtlich hatte es einen Kampf gegeben. Überall in der Wohnung fanden wir Blutspuren, an der Tapete, auf den Teppichen, im Bett, an der Kleidung. Karin Rosenherz war – wie man damals sagte – eine stadtbekannte Lebedame. Und natürlich brach sofort die Hölle über uns herein. Alle dachten an den Nitribitt-Mord, der neun Jahre zuvor geschehen war. Die Ähnlichkeiten waren nicht zu übersehen – das mondäne Auftreten der Rosenherz, ihr weißer Mercedes, die gehobene Kundschaft. Aus der gesamten Republik reisten die Reporter an. Sie quartierten sich in den umliegenden Hotels ein, versuchten Kolleginnen, Verwandte und Freunde des Opfers aufzuspüren. Und wie schon im Fall Nitribitt warf man uns auch bei Karin Rosenherz vor, wir hätten nicht ordentlich ermittelt, wir hätten Prominente geschont, hätten Verdächtige gedeckt und Unterlagen verschwinden lassen. Aber all das sind haltlose Unterstellungen. Wir haben den Fall nicht gelöst, das ist wahr. Aber glauben Sie mir, niemand leidet darunter mehr als meine Kollegen und ich selbst.
Aus einem Zeitungsgespräch mit dem Frankfurter
Kriminaloberrat Herbert M. anlässlich seiner Verabschiedung
aus dem Polizeidienst im Februar 1992
Erster Teil
Eins
Lange Zeit war sie spät schlafen gegangen. Manchmal, nachts, wenn sie endlich wieder alleine war, lag sie noch wach und dachte: Ich muss jetzt schlafen. Dann nahm sie ein Buch, las eine Seite oder zwei, bis ihre Gedanken abschweiften und das eben Gelesene sich vermischte mit den Dingen, die sie erlebt hatte – gestern, vor ein paar Wochen oder in ihrer Kindheit. Dann war sie selbst die unglückliche Ehebrecherin aus ihrem Roman, der kleine Junge, der auf einen Kuss seiner Mutter wartete, oder eine Schiffsreisende, unter deren Blicken die Flussufer vorüberglitten wie zwei breite, sich abrollende Bänder.
Heute war Mittwoch, der 3. August des Jahres 1966. Als Karin Niebergall gegen Mittag langsam erwachte, schien ihr die Sonne durch den Spalt zwischen den Vorhängen ins Gesicht, und die junge Frau merkte, dass etwas anders war als sonst. Sie hatte den undeutlichen Eindruck, mit der Nacht auch ihr altes Leben hinter sich lassen zu müssen. Noch war sie zu müde, um zu entscheiden, ob sie diesen Gedanken mochte oder ob sie ihn rasch verwerfen sollte. Sie schaute auf die Uhr, schloss erneut die Augen und drehte sich auf die andere Seite.
Erst als sie hörte, wie einer der jungen Männer aus dem Nachbarhaus seinen Motorroller auf dem Bürgersteig parkte, stand sie auf, reckte sich ausgiebig, ging hinüber zum Büfett und schaltete das Radio ein. Während sie sich im Bad die Zähne putzte, hörte sie, wie Cliff Richard Rote Lippen soll man küssen sang.
Ihr letzter Kunde war gegen drei Uhr gegangen, hatte aber schon kurz darauf schnaufend wieder im dunklen Hausflur vor ihrer Wohnung gestanden und sie gebeten, noch einmal mit hinunterzugehen und ihm die Eingangstür aufzuschließen. An den Namen des Mannes erinnerte sie sich nicht mehr. Obwohl sie das Fenster in der Nacht gekippt hatte, roch es noch immer nach dem Rauch seiner Zigarre.
Als sie die Vorhänge öffnete und nunmehr die Straße mit den grünen Kronen der Bäume, dem bunten Gewimmel der Passanten und den glänzenden Schaufenstern im vollen Sonnenlicht liegen sah, war es, als würde sie zugleich einen Blick in ihre Zukunft werfen. Unwillkürlich musste sie lächeln bei der Vorstellung, vielleicht selbst bald zu jenen Frauen dort unten zu gehören, die am Arm ihrer Ehemänner durch die Stadt schlenderten, ihre Kinder von der Schule abholten, um gemeinsam in den Zoo zu gehen, hinterher Eis zu essen und den Abend vor dem Fernseher zu verbringen. Vielleicht würde sie, wie schon öfter geplant, ein kleines Geschäft eröffnen, eine Modeboutique, einen Schreibwarenladen oder einen Schönheitssalon. Sie würde sich zeitig schlafen legen, zweimal im Jahr Urlaub machen, ein paar Pfund zunehmen und nur mit dem Mann ins Bett gehen, den sie liebte. Die Vorstellung kam ihr verlockend vor. Verlockend und zugleich ein wenig fad.
Sie schaute sich um. Auf dem kleinen Rauchtisch zwischen den beiden Sesseln standen die Gläser, die sie in der Nacht benutzt hatten. Ihres erkannte sie an den Lippenstiftspuren. Die halbvolle Whiskey-Flasche stand offen daneben. Den Aschenbecher hatte sie noch geleert, aber nicht mehr ausgewischt. Auf dem Boden lagen ihr Slip und die Würste der aufgerollten Perlonstrümpfe. Die rote Perücke hatte sie, kurz bevor ihr die Augen zufielen, neben das Bett auf den Boden gleiten lassen. Sie seufzte. All dies erweckte den Eindruck von Trostlosigkeit.
Sie kam am Flurspiegel vorüber und blieb stehen. Noch immer nackt, blies sie die Wangen auf, streckte den Bauch nach vorne, schnitt eine Grimasse und zeigte ihrem Spiegelbild die Zunge.
Doch, dachte sie noch einmal, mein Leben muss sich ändern. Aber schon wenig später, als sie geduscht, sich gekämmt und im Café Kranzler angerufen hatte, um ein Frühstück zu bestellen, auf das sie nun wartete, hatte sie den Vorsatz bereits wieder vergessen. Um sich die Zeit zu verkürzen, nahm sie eine der kleinen Sektflaschen aus dem Kühlschrank, goss sich ein Glas ein, leerte es in einem Zug und füllte es sogleich aufs Neue. Im Radio spielten Ernst Mosch und sein Orchester die Ambosspolka. Sie drehte den Ton leiser.
Als es klingelte, drückte sie den Öffner, ließ die Wohnungstür angelehnt und ging zurück in die Küche, um Kaffee aufzubrühen. Aus dem Treppenhaus hörte sie Schritte, die sich näherten.
«Leg die Sachen vor die Tür», rief sie, «ich zahle morgen.»
«Ich habe etwas für Sie», antwortete die Stimme eines jungen Mannes.
Sie huschte ins Schlafzimmer, zog sich den Kimono über und ging zur Tür.
Der Bote des Kranzler, der ihr zwei-, dreimal in der Woche gegen Mittag das Frühstück brachte, streckte ihr beide Hände entgegen. In der einen hielt er die Tüte mit den belegten Brötchen, in der anderen einen blauen Briefumschlag.
Karin Niebergall sah den Jungen an. Er trug eine Uniform und hatte rosige Wangen. Unter der Mütze sah man sein krauses rotblondes Haar.
«Danke», sagte sie. «Ich zahle morgen.» Und als der Junge keine Anstalten machte zu gehen: «Sonst noch was?»
Er schaute zu Boden. «Ich soll Ihnen den Brief geben. Ein Mann steht unten und wartet. Ich soll ihm sagen, ob Sie kommen.»
«Ob ich komme? Ob ich wohin komme? Und warum kommt dieser Mann nicht selbst hoch, wenn er etwas von mir will?»
Der Junge zuckte mit den Schultern.
Karin Niebergall seufzte, riss den Umschlag auf und sah als Erstes den Hundertmarkschein. Dann zog sie die bedruckte Karte hervor und las: Philipp Lichtenberg würde sich freuen, Sie am 3. August 1966 um 16 Uhr auf seiner Geburtstagsparty im Haus seiner Eltern begrüßen zu dürfen. Um Antwort wird gebeten.
Sie schüttelte den Kopf. «Aber das ist ja heute. Unmöglich! Sag dem Mann, so kurzfristig kann ich keine Termine annehmen.»
Der Junge sah sie unschlüssig an, dann nickte er. Er hatte sich bereits abgewandt, um zu gehen, als sie ihn wieder zurückrief. «Nein, warte! Hast du heute Nachmittag schon was vor?»
«Wer? Ich?»
«Sonst noch jemand hier?»
«Bis drei muss ich arbeiten …»
«Willst du mich begleiten? Hast du Lust, mit mir auf eine Party in Sachsenhausen zu gehen?»
Die Wangen des Jungen glühten. Er suchte die Antwort zwischen seinen Füßen.
Karin Niebergall legte ihm eine Hand auf den Oberarm und zwang ihn, sie anzuschauen. «Sag mal, du hast ja richtig Muskeln … Wie heißt du?»
«Hartmut.»
«Gut, Hartmut. Sei um vier Uhr hier, ja? Hast du schon deinen Führerschein?»
Der Junge schüttelte den Kopf. «Aber ich kann fahren.»
«Gut. Also dann … bis vier. Abgemacht? Und sag dem Mann, dass ich da sein werde. Aber verrat nicht, dass du mitkommst.»
Lange stand sie vor dem Schrank und überlegte, was sie anziehen sollte. Schließlich lächelte sie und griff nach dem knielangen gestreiften Sommerkleid, das Jean Seberg in der gesamten zweiten Hälfte von Außer Atem getragen hatte. Karin Niebergall hatte ihren Schneider in den Film geschickt und ihn gut dafür bezahlt, dass er ihr eine genaue Kopie dieses Kleides anfertigte. Inzwischen war es ein wenig aus der Mode gekommen, wirkte zwar immer noch adrett, aber mit seinem breiten, hochgeschlossenen Kragen keineswegs verführerisch. Dennoch ahnte die junge Frau, dass ihr genau deshalb die Aufmerksamkeit der Geburtstagsgäste gewiss sein würde.
Sie hatte gelernt, das Interesse an ihrer Person immer aufs Neue zu wecken, indem sie sich anders verhielt, als man erwartete. Sie änderte ihr Aussehen durch neue Kleider, Hosen, Schuhe, Frisuren und Perücken und scheinbar zugleich sich selbst – wie eine Verwandlungskünstlerin, der es gelang, bei ihrem Publikum jedes Mal die Illusion zu erzeugen, nicht ein neues Kostüm stehe vor ihm, sondern ein neuer Mensch. Mal war sie die herrische Generalin, die ganze Armeen von Männern mit einer fast unmerklichen Bewegung ihres Kopfes zu willenlosen Marionetten machte, dann wieder konnte sie ängstlich die Augen aufreißen und so hilflos an ihrem Zeigefinger knabbern, dass nur der allergröbste Klotz in der Lage gewesen wäre, ihr nicht schützend den Arm um die Schultern zu legen.
Sie erzählte Geschichten über ihre Herkunft, die sich vollständig widersprachen und die sie doch, hielt man ihr die Ungereimtheiten vor, immer miteinander zur Deckung zu bringen versuchte. Mal entstammte sie einer Familie ostpreußischer Gutsbesitzer, dann war sie ein entlaufenes Heimkind, das sich – halbnackt und barfuß wie im Märchen vom Sterntaler – quer durch Europa auf die Suche nach seinen Eltern begeben hatte. Ja, gewiss, ihr Vater sei ein jüdischer Bariton gewesen, der es als Emigrant auf dem Broadway zu Ruhm und Reichtum gebracht habe und der ihr bis heute monatlich einen Brief mit hundert Dollar schicke. Wie er dann aber gleichzeitig ein hoher Offizier der deutschen Wehrmacht gewesen sein könne, der mal von griechischen Partisanen getötet worden, mal in einem sibirischen Lager verschollen war? Ja also bitte, dann habe man ihr eben nicht aufmerksam genug zugehört! Der eine sei ihr Vater, der zweite ihr Ziehvater gewesen, den ihre Mutter nach Scheidung und Flucht des ersten geheiratet … Ob man dergleichen nie gehört habe? Kein Widerspruch war zu groß, als dass sie ihn nicht lässig hätte ausräumen, keine Lüge zu dreist, als dass sie sie nicht im Nu wie die reine Wahrheit hätte aussehen lassen können. Sprach man sie hingegen auf ebenjene Mutter an, wurde Karin Niebergall einsilbig und wechselte rasch den Gegenstand des Gesprächs.
Ob all diese Geschichten auch nur einen Funken Wahrheit enthielten, ob sie gänzlich frei erfunden oder aus den Illustrierten, die sie wie eine Süchtige verschlang, zusammengeklaubt waren – niemand wusste es, und kaum jemand schien es wissen zu wollen. Erst recht nicht die Männer, die sie stets so zahlreich umgaben und die bei ihr vieles suchten, zu allerletzt aber gewiss die Wahrheit. Und so war bald unter den wechselnden Masken ein wahres Gesicht, wenn es denn je ein solches gegeben hatte, nicht mehr auszumachen – am wenigsten wohl für sie selbst.
Und wer sie irgendwann aus guten Gründen für ein verschlagenes Luder hielt, dem konnte sie beim nächsten Zusammentreffen als Inbegriff der Treuherzigkeit erscheinen, immerhin aber als eine schuldlos Gefallene, die unausweichlich das Bedürfnis weckte, ihr beizustehen und sie auf den rechten Weg zurückzuführen. Oder wenn sich das – wie nicht anders zu erwarten – als aussichtslos erwies, wenigstens von ihrer Verruchtheit zu naschen.
Im Treppenhaus öffnete sich die Tür der Wohnung, die sich unter ihrer eigenen befand. Ein kleiner Junge streckte den Kopf heraus und sah Karin Niebergall durch seine Brille erwartungsvoll an. Abrupt hielt sie inne.
«Mensch, Timo», sagte sie, «hast du mich jetzt erschreckt.»
Der Junge lachte. «Gar nicht», sagte er. «Du tust nur so. Du tust immer nur so.»
«Heißt das, dass ich lüge?», fragte sie mit gespielter Strenge.
«Nee, aber du flunkerst.»
«Pass nur auf, du kleiner Naseweis! Wenn du weiter so frech bist, werde ich mit deiner Mutter sprechen müssen.»
«Die arbeitet.»
Karin Niebergall kramte in ihrer Handtasche, um nach einem Bonbon zu suchen, fand aber keines. «Leider», sagte sie, «heute hab ich nichts für dich.»
Er zuckte mit den Schultern, als sei es ihm egal, blieb aber stehen und sah sie weiter unverwandt an.
«Weißt du was, ich werde nachher noch ein paar Gummibärchen besorgen, die leg ich dir am Abend auf die Stufen. Ist das in Ordnung?»
Er nickte. Dann schloss er die Tür.
Als sie die Straße betrat, legte Karin Niebergall für einen Moment den Kopf in den Nacken und ließ ihr Gesicht von der Sonne bescheinen. Im dritten Stock des gegenüberliegenden Hauses sah sie den Kunststudenten am Fenster stehen und zu ihr hinunterschauen. Sie lächelte und nickte ihm zu. Dann setzte sie ihre Sonnenbrille auf. Von der Polizei befragt, würde der junge Mann später angeben, sie an diesem Tag um kurz nach sechzehn Uhr zum letzten Mal gesehen zu haben. Er selbst habe bald darauf das Haus verlassen, sei zum Bahnhof gegangen und mit dem Zug nach Mannheim gefahren, wo er sich eine Ausstellung angesehen habe.
Hartmut stand auf der anderen Straßenseite. Er trug schwarze Schuhe, einen Anzug, dessen Hosenbeine zu kurz waren, und ein weißes Oberhemd. Sein Kopf schien in Flammen zu stehen.
Karin Niebergall lachte. «Du siehst aus wie eine Karotte», sagte sie. «Wie eine Karotte im Konfirmandenanzug. Wirst du jedes Mal rot, wenn eine Frau dich ansieht?»
Sie gingen zum Parkhaus in der Nähe der Hauptwache, wo Karin Niebergall einen Stellplatz gemietet hatte.
«Der da ist es», sagte sie, als beide an dem weißen Mercedes 220 SE angekommen waren. Sie warf dem Jungen den Wagenschlüssel zu und wartete, dass er ihr die Beifahrertür öffnete.
«Soll ich … wirklich?», fragte Hartmut.
«Ich sitze nie am Steuer, wenn ein Mann mich begleitet, es sei denn, es ist ein Kunde. Merk dir das. Und sollten wir mal zusammen ausgehen, bist du es, der zahlt. Ich gebe dir das Geld, aber du zahlst.»
Der Junge nickte, als wisse er Bescheid.
An der Ausfahrt mussten sie warten, bis der Parkwächter ihnen die Schranke öffnete. Er beugte sich herunter. Als er die Halterin des Wagens erkannte, legte er die Fingerspitzen salutierend an seine Schildmütze.
Auf der Gutleutstraße fuhren sie in Richtung Basler Platz. Als sie die Friedensbrücke überquerten, merkte sie, dass der Junge unruhig wurde.
«Was ist?», fragte sie.
«Hinter uns ist ein Polizeiwagen.»
Karin Niebergall lachte. «Keine Angst», sagte sie. «Die tun uns nichts. Die kennen mich, und die kennen meinen Wagen. Aber mir scheint, du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder?»
Der Junge zögerte. Offensichtlich wollte er nichts Falsches sagen: «Ich weiß, wie Sie heißen.»
«Ja», sagte sie, «vielleicht. Das heißt immerhin, dass du lesen kannst. Schließlich steht ja ein Name auf dem Klingelschild. Aber wenn du mehr nicht wissen willst, soll’s mir recht sein.»
«Ich würde aber gerne etwas wissen …»
«Nämlich?»
«Haben Sie keinen …?»
«Keinen was? Keinen Freund, keinen Verlobten, keinen Mann?»
Der Junge nickte.
«Ich habe einen Verlobten. Aber der hat sich seit zwei Tagen nicht blicken lassen. Und wenn er nicht bald wieder auftaucht, war’s das. Für heute bist du mein Verlobter … einverstanden? Ich heiße übrigens Karin. So darf mich nicht jeder nennen.»
Hartmut warf ihr einen kurzen Seitenblick zu, dann schaute er wieder angestrengt auf die Straße.
«Hauptsache, du verliebst dich nicht in mich», sagte Karin Niebergall. «Klar?»
«Klar!», sagte der Junge eifrig.
Hinter den Bahngleisen bogen sie ab in die Richard-Strauss-Allee und erreichten das kleine Villenviertel, das hier verborgen zwischen dem Stadtwald und der großen Ausfallstraße lag, die keine drei Jahre zuvor, kurz nachdem der amerikanische Präsident in Dallas ermordet worden war, dessen Namen erhalten hatte. Sie parkten den Wagen am Rand der Fahrbahn und gingen den restlichen Weg zu Fuß.
«Ich weiß es», sagte Hartmut plötzlich, als sie auf dem Bürgersteig vor der Villa Lichtenberg standen.
«Was weißt du?»
«Ich weiß, was Sie sind.»
«Nichts weißt du», erwiderte Karin Niebergall.
«Doch. Sie sind … Du bist eine Nutte.»
Sie schaute ihn sekundenlang an, ohne etwas zu sagen. Sie holte aus und schlug ihm mit der flachen Hand auf die Wange.
Dann hakte sie sich bei ihm unter und steuerte auf den Eingang zu.
Zwei
Als sich Fausto Albanelli am frühen Morgen des 4. August 1966 auf den Weg zur Arbeit machte und an der Wohnung seiner Nachbarin vorbeikam, hielt er einen Moment inne. Die Tür war nur angelehnt, doch als er nun anklopfte und den Namen der Frau rief, meldete sich niemand.
«Signora Niebergall», rief er noch einmal, nun schon etwas lauter, aber auch diesmal erhielt er keine Antwort. Er drückte auf den Klingelknopf und erschrak vor dem schrillen Geräusch, das er verursacht hatte. Albanelli überlegte, ob er einfach hineingehen und nach dem Rechten sehen sollte, dann schaute er auf die Uhr und merkte, dass er schon jetzt viel zu spät dran war. Eilig lief er die Treppen hinab, stieß die Tür zur Straße auf und hatte, als er kaum zwei Minuten später den Frankfurter Hof erreichte, jenes große Hotel, wo er seit gut einem Jahr als Zimmerkellner arbeitete, seine Nachbarin schon wieder vergessen.
Fausto Albanelli war zwanzig Jahre alt und kam, wie die beiden anderen jungen Männer, mit denen er sich die Dachwohnung in der Frankfurter Kirchnerstraße teilte, aus Pietrabruna, einem kleinen Ort in den Bergen Liguriens.
Es war sein Freund Guido, der ihn Stunden später, als sie alle gemeinsam im Aufenthaltsraum saßen und ihr Mittagessen zu sich nahmen, wieder an den Vorfall erinnerte.
«Bei deinem Fräulein stand die Tür offen», sagte er, «vielleicht hat sie dich erwartet.»
«Sie ist nicht mein Fräulein», erwiderte Fausto, «und sie hat mich nicht erwartet.»
«Aber du warst schon mal bei ihr und willst nicht drüber reden, das ist verdächtig genug. Warum willst du eigentlich nicht drüber reden?», fragte Dario.
«Weil es lustiger ist, wenn ihr euch eure Gedanken macht.»
«Ich habe neulich mit Paola am Telefon darüber geredet; sie fand es jedenfalls gar nicht lustig.»
Fausto, der gerade seine Gabel mit einer Ladung Makkaroni zum Mund führte, hielt mitten in der Bewegung inne: «Du hast … mit Paola …?»
«Natürlich», sagte Dario. «Auch ich bin mit ihr befreundet. Sie soll schließlich wissen, was für ein Strolch ihr Zukünftiger ist. Ich musste ihr die Wahrheit sagen. Dafür sind Freunde da.»
Seit zwei Jahren waren Fausto und Paola ein Paar. Die junge Frau stammte aus demselben Dorf wie er, arbeitete inzwischen als Kindergärtnerin in Imperia und lebte somit neunhundert Kilometer von ihrem Geliebten entfernt, worüber dieser allabendlich klagte. Die beiden hatten sich am Tag vor seiner Abreise verlobt, wechselten seitdem regelmäßig Briefe und beteuerten auch bei den seltenen, aber jedes Mal viel zu teuren Telefonaten, wie sehr sie einander vermissten.
Fausto legte seine Gabel nieder, stand langsam auf, beugte sich über den Tisch und packte Dario am Kragen. Erst als er das breite Grinsen auf Guidos Gesicht sah, merkte er, dass er einem Scherz seiner Freunde aufgesessen war. «Na, wisst ihr …», stammelte er, «nein, wirklich.»
«Also? Was ist nun? Was wolltest du bei Signora Niebergall?»
«Sie hat mich gebeten, drei Bilder an die Wand zu hängen. Dann hat sie mir eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen angeboten.»
«Und du hast angenommen?»
«Ja, warum nicht?»
«Aber Paola hast du davon natürlich nichts erzählt.»
«Nein, verdammt, ihr wisst doch, wie eifersüchtig sie sein kann.»
«Das ist alles?»
«Nein. Ich habe ihr mal den Stecker ihres elektrischen Damenrasierers repariert und einmal, als ich sie zufällig in der Stadt getroffen habe, eine Cola mit ihr getrunken. Seid ihr jetzt zufrieden?»
«Und was ist mit der kleinen Mariele?», fragte Guido mit Blick auf die große Uhr, die über der Tür hing.
«Was hat Mariele damit zu tun?»
«Sie wartet bestimmt, dass du ihr das Mittagessen aufs Zimmer bringst.»
Mariele war ein elfjähriges Mädchen, das einmal im Monat mit seinen Großeltern aus Westfalen für ein paar Tage in den Frankfurter Hof kam. Die Kleine saß im Rollstuhl, hatte sich gleich bei ihrem ersten Aufenthalt mit Fausto Albanelli angefreundet und bestand seitdem darauf, ausschließlich von ihm bedient zu werden.
«Verdammt», sagte Fausto, «das habe ich völlig vergessen.» Er stand auf, schob seinen Teller zur Seite und eilte zur Tür. «Gut, dass ihr mich daran erinnert.»
«Keine Ursache», sagte Dario. «Wir räumen auch noch dein Geschirr weg. Dafür sind Freunde da.»
Gegen sechzehn Uhr am Nachmittag desselben Tages war der Arbeitstag der drei jungen Italiener beendet. Während Dario und Guido sich vor dem Ausgang des Hotels eilig verabschiedeten, weil sie sich im Bahnhofskino einen Western von Sergio Leone anschauen wollten, machte sich Fausto direkt auf den Heimweg. Er öffnete die Haustür, nahm im Treppenflur immer zwei Stufen auf einmal, hielt aber schon auf dem ersten Absatz inne und lief noch einmal nach unten, um nachzuschauen, ob Post von seiner Verlobten gekommen war. Ein wenig enttäuscht schloss er den leeren Briefkasten wieder und machte sich erneut an den Aufstieg, im Kopf nun schon ein paar scherzhafte Ermahnungen an Paola formulierend, die er aber sogleich mit zahlreichen Liebesschwüren abmildern würde.
Als er im dritten Stock an der Wohnung von Karin Niebergall vorbeikam, sah er, dass die Tür noch immer offen stand. Seine Beunruhigung vom Morgen wich nun der Gewissheit, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Wieder klopfte er an, wieder rief er den Namen seiner Nachbarin, wieder meldete sich niemand.
Das Innere der Wohnung war dunkel. Mit der Fußspitze schob er die Tür ein wenig weiter auf, machte einen Schritt nach vorne und drückte auf den Schalter für die Dielenlampe.
Nichts. Es blieb dunkel. Er senkte seine Stimme zu einem Flüstern: «Signora Niebergall, sind Sie zu Hause? Geht es Ihnen gut?»
Es war, als habe er Angst, das Unglück, das hier geschehen sein mochte, durch seine Stimme erst hervorzurufen.
«Ihr Licht ist kaputt? Soll ich nachschauen?»
Er ging einen Meter weiter, dann sah er den Fleck an der Wand. Sofort war er sicher, dass es sich um Blut handelte. Auch auf dem Boden waren dunkle Flecken zu sehen. Fausto Albanelli schloss die Augen und wich mit pochendem Herzen zurück bis zur Wohnungstür.
Er wollte gerade den Hausflur wieder betreten, als er das Geräusch von Schritten hörte. Mit angehaltenem Atem blieb er stehen. Jemand kam die Treppe herauf, ein Schlüssel klapperte, in einer der unteren Etagen wurde eine Tür geöffnet und gleich darauf wieder geschlossen.
Dann war es still.
Eilig huschte der junge Mann aus Karin Niebergalls Wohnung, lief so leise er es vermochte bis ins Dachgeschoss, vermied dabei, auf die knarrende vorletzte Stufe zu treten, und atmete erleichtert auf, als er endlich in seinem Zimmer saß und überlegen konnte, was zu tun war.
Jedenfalls würde er nicht zur Polizei gehen. Obwohl er selbst noch keine Erfahrungen mit deutschen Polizisten gemacht hatte, war immer wieder zu hören, dass man als «Spaghetti» schlecht behandelt wurde. Außerdem musste er an die Ermahnungen seiner Patentante denken, jener legendären Faustina, einer stattlichen Frau, von der es hieß, sie habe als Partisanin im Kampf gegen die Deutschen wahre Wundertaten vollbracht. So wurde erzählt, dass sie noch in den letzten Tagen des Krieges einen deutschen Offizier, der ihr auf unschickliche Weise nahe gekommen war, zu Tode gebracht habe, indem sie ihn zunächst betrunken gemacht und sich dann auf das Gesicht des Soldaten gesetzt habe und so lange sitzen geblieben sei, bis der schmächtige Unhold aufgehört habe zu zappeln und schließlich auch zu atmen.
Es war eine jener Geschichten, wie sie auf allen Dorf- und Familienfesten ein ums andere Mal erzählt und bei jeder Wiederholung weiter ausgeschmückt wurden, bis die Heranwachsenden, die ihnen eben noch mit heißen Ohren zugehört hatten, schließlich die Augen verdrehten und das Weite suchten.
Dass er nach Frankfurt gehen würde, hatte er seiner Tante erst einen Tag vor der Abreise gestanden. Nie vergessen würde er Faustinas Rede über das Wesen der Deutschen, vor denen sich zu hüten er ihr hoch und sogar heilig hatte versprechen müssen. Die «Crucchi», so hatte sie mit erhobenem Zeigefinger gepredigt, seien ebenso verschlagen wie kulturlos, sie könnten nicht kochen, hätten keine Lebensart, seien mal unterwürfig wie geschlagene Hunde, würden einem aber gleich darauf, ohne mit der Wimper zu zucken, die Kehle durchbeißen. Ja, darin sei dem dicken Churchill zuzustimmen: Entweder habe man die Deutschen zu Füßen oder man habe sie am Hals. Er, Fausto, solle zusehen, ihnen aus dem Weg zu gehen, vor allem dann, wenn sie Uniformen trügen oder Beamte seien, er solle sich mit keiner deutschen Frau einlassen, solle darauf achten, genug Pasta zu essen, nach einem schweren Essen einen Amaro nicht zu verschmähen, seine Mutter zu ehren und seine Madrina nicht ganz zu vergessen. Dann hatte sie ihn an ihre Brust gepresst, eine Träne verdrückt und war ohne ein weiteres Wort gegangen.
Was man allerdings machen sollte, wenn man als italienischer Zimmerkellner in Frankfurt lebte und einen Blutfleck hinter der offenen Wohnungstür seiner deutschen Nachbarin entdeckt hatte, davon war in Faustinas Anweisungen nicht die Rede gewesen.
Weder würde er zurückgehen, um Karin Niebergalls Wohnung genauer zu inspizieren, noch würde er jemanden aus der Nachbarschaft alarmieren, er würde keinen Arzt benachrichtigen, und schon gar nicht würde er die Polizei rufen. Er würde einfach warten, bis seine Freunde aus dem Kino kamen, um dann gemeinsam mit ihnen zu beratschlagen.
Aber mit jeder Minute, die er tatenlos verstreichen ließ, wuchs seine Nervosität. Und obwohl er ein reines Gewissen hatte, wurde das Gefühl, sich schuldig zu machen, immer stärker. Jetzt, da er auf Dario und Guido wartete, schien die Zeit nur im Schneckentempo vergehen zu wollen. Er zwang sich, nicht allzu oft auf die Uhr zu schauen, tat es dann aber doch wieder und sah enttäuscht, dass seit dem letzten Mal gerade zwei Minuten vergangen waren.
Um sich abzulenken, begann Fausto Albanelli den geplanten Brief an seine Verlobte zu schreiben. Dreimal setzte er an, dreimal zerriss er das Blatt wieder, bis er schließlich aufgab und stattdessen anfing, das wenige Geschirr abzuwaschen, das noch vom Frühstück auf der Spüle stand. Als das Radio lief, konnte er sich weder auf die Musik noch auf die Beiträge konzentrieren. Schließlich ging er ins Badezimmer, zog sich aus und legte sich in die Wanne.
Er versuchte, an Paola zu denken, er versuchte, an seine Eltern zu denken, und er versuchte, an Mariele zu denken, aber immer wieder schweiften seine Gedanken ab und landeten bei dem Fleck an Karin Niebergalls Wand.
Schließlich traf er eine Entscheidung, die ihm so ungeheuerlich wie unausweichlich schien. Er würde nicht warten, bis der Film, den sich Guido und Dario anschauten, zu Ende war. Er würde zum Bahnhof gehen und verlangen, dass man seine Freunde aus dem Kino holte.
In dem Kassenhäuschen saß ein älterer Mann über seiner Zeitung und rauchte. Er blickte nicht einmal auf, als Fausto direkt vor ihm stand und vorsichtig gegen die Scheibe pochte.
«Film läuft schon», sagte der Kassierer, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. «Nächste Vorstellung um neun.»
«Ich weiß», sagte der junge Mann, «aber meine Freunde sind drin. Sie müssen ihnen Bescheid sagen, dass sie rauskommen.»
Langsam blätterte der Alte seine Zeitung um. «Ich muss gar nix. Ich muss sterben», sagte er.
«Hören Sie, es ist wichtig. Es ist wirklich jemand gestorben, es geht um einen Todesfall.»
Der Kassierer schniefte. Er ließ endlose Sekunden vergehen, dann drückte er sorgfältig seine Zigarette aus. Endlich blickte er Fausto an. «Nix gibt’s. Hätt ich ja viel zu tun, wenn ich jedes Mal den Film stören wollte, wenn jemand gestorben ist.»
Dann begriff Fausto Albanelli. Er zog sein Portemonnaie hervor, nahm ein Zweimarkstück heraus und schob es unter der Scheibe hindurch.
Der Alte wackelte eine Weile mit dem Kopf, als sei er unschlüssig, wie er auf diese neuerliche Unverschämtheit des Störenfrieds reagieren solle, ließ dann aber die Münze mit einer raschen Bewegung verschwinden und erhob sich umständlich von seinem Stuhl. Als er sein Kassenhäuschen verlassen hatte, gab er dem Jungen einen Wink, ihm zu folgen. Während Fausto vor Ungeduld zappelte, schlurfte der Kassierer mit schwerfälligen Schritten vor ihm her in Richtung der steilen Treppe, die zum Kinosaal führte. Alle zwei, drei Stufen blieb er stehen, um zu verschnaufen.
Als er die Tür erreicht hatte, drehte er sich zu Fausto um, schaute ihn aus feuchten Augen an und begann zu kichern: «So was Blödes», sagte er, «ein Todesfall. Hat man so was Blödes schon mal gehört. Die Namen?»
«Dario und Guido.»
«Was?»
«Dario und Guido», wiederholte Fausto. «So heißen meine Freunde.»
Mit offenem Mund starrte ihn der Kassierer an, dann schüttelte er wieder den Kopf. «Itaker!», sagte er. «Glaubt man’s denn. Ich störe wegen zwei Itakern die Vorstellung.»
Keine halbe Stunde später standen die drei Freunde, jeder mit einer brennenden Kerze in der Hand, im Treppenhaus der Kirchnerstraße 2 vor der dunklen Wohnung Karin Niebergalls. Sie schauten einander unschlüssig an, bis Fausto kurz nickte und vorging.
Während seine Freunde in der Diele warteten, öffnete er die Tür, von der er wusste, dass sich dahinter das Wohnzimmer der Nachbarin befand, schaute sich kurz um, konnte aber nichts Auffälliges entdecken.
«Leer», sagte er flüsternd und ging zum nächsten Raum.
Er hatte ihn kaum betreten, als er mit seinem rechten Fuß gegen einen weichen Gegenstand stieß. Er ging in die Hocke, leuchtete mit seiner Kerze den Boden ab, sah etwas, das wie ein Büschel Haare aussah, und erkannte, dass es sich um eine Perücke handelte. Nicht weit davon lag eine Weinflasche, die auf dem Teppich ausgelaufen war.
Er wandte sich zu den beiden anderen um, die hinter ihm im Türrahmen standen.
«Ich glaube, hier ist es», sagte er mit belegter Stimme.
Dario und Guido kamen näher. Zu dritt standen sie nebeneinander und hielten ihre Kerzen in die Höhe. Auf dem Boden lagen herausgerissene Schubladen, verstreute Papiere und Kleidungsstücke.
Fast gleichzeitig sahen sie im schwachen, flackernden Licht die Beine der Frau, die zwischen dem Bett und einem Sessel hervorschauten.
Fausto atmete durch, dann ging er ein paar Schritte weiter, bis er neben dem zerwühlten Himmelbett stand.
«O, dio», sagte er, als er den zusammengekrümmten Körper Karin Niebergalls auf dem Boden liegen sah.
Dario machte einen Schritt nach vorne, aber im selben Moment wandte Fausto sich um und breitete die Arme aus. Sein Gesicht war bleich: «Mein Gott, nein», stammelte er. «Bleibt, wo ihr seid. Das … das wollt ihr nicht sehen.»
Drei
Für die beiden Schutzpolizisten Ernst Wendtland und Rüdiger Heinemann hatte der Abend ruhig begonnen. Sie kamen gerade von einem Einsatz, bei dem sie die Personalien einer Zechprellerin aufgenommen hatten. Die alte Frau hatte in einem Café auf der Zeil ein Glas Sekt getrunken, dann aber gemerkt, dass sie kein Geld eingesteckt hatte, was ihr, wie sie angab, so peinlich gewesen sei, dass sie versucht habe, durch den Hinterausgang zu entwischen, wo sie von einer Kellnerin gestellt worden war. Als die beiden Polizisten eingetroffen waren, war die Dame in Tränen ausgebrochen, hatte ihre Dummheit umgehend zugegeben und mehrfach beteuert, dass sie so etwas noch nie zuvor getan habe. Bereitwillig hatte sie ihren Ausweis gezeigt, aber dringend darum gebeten, ihre Tochter von dem Vorfall nicht in Kenntnis zu setzen. Als die Frau versprochen hatte, ihre Zeche sofort am nächsten Vormittag zu begleichen, war der Inhaber des Cafés bereit gewesen, von einer Anzeige Abstand zu nehmen.
«Hunger?», fragte Rüdiger Heinemann, als er wieder neben seinem Kollegen auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens – eines VW Käfer – saß.
Ernst Wendtland nickte.
«Rindswurst?»
Erneutes Nicken.
«Gref-Völsing?»
«Gref-Völsing!»
Es war ein Dialog, der sich, wenn die beiden gemeinsam Spätdienst hatten, so unweigerlich wie ihr abendlicher Appetit einstellte. Obwohl sich die Verkaufsstelle der Metzgerei Gref-Völsing an der Hanauer Landstraße befand und damit außerhalb ihres Reviers, leisteten sich die beiden regelmäßig dieses kleine Dienstvergehen, weil es erwiesenermaßen nirgendwo bessere Rindswürste gab. Und wenn man sie erwischen würde, wollten sie behaupten, einen Autofahrer, der sich verdächtig benommen hatte, hierher verfolgt zu haben.
Sie stellten den Wagen auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn ab, ließen die Beifahrertür offen und betraten das Geschäft.
Die Verkäuferin in ihrer Kittelschürze seufzte. «Immer auf den letzten Drücker, die Herren von der Polizei. Ich bin schon am Aufräumen.» Sie zeigte auf die große Uhr, die über der Eingangstür hing; es war sieben Minuten vor sechs.
«Geht schnell», erwiderte Wendtland. «Wir sind gleich wieder weg.»
«Wie immer?»
Die Polizisten nickten. Die Frau stellte zwei Pappteller auf die Theke, packte auf jeden ein Brötchen, fischte zwei Rindswürste aus dem heißen Wasser und legte sie dazu.
«Senf nehmt euch selbst», sagte sie. «Ich geh wieder nach hinten.»
Der Funkspruch kam um siebzehn Uhr sechsundfünfzig. «Leblose weibliche Person in der Kirchnerstraße 2, dritter Stock, Wohnung Niebergall. Wahrscheinlich äußere Gewalteinwirkung. Sofort überprüfen.»
Rüdiger Heinemann hatte seine Rindswurst fallen lassen, war zum Streifenwagen gerannt und hatte die Meldung entgegengenommen. Jetzt winkte er seinem Kollegen zu, der ebenfalls die Metzgerei verließ und auf den Fahrersitz sprang.
«Kirchnerstraße 2», sagte Heinemann.
«Weißt du, was passiert ist?», fragte Wendtland, der den Wagen bereits gewendet hatte und nun mit eingeschaltetem Martinshorn in Richtung Innenstadt raste.
«Ja: leblose Person, wahrscheinlich …»
«Nein», unterbrach ihn sein Kollege, «das meine ich nicht. Wir sind da gerade rausgerannt und haben vergessen, unsere Zeche zu bezahlen.»
Keine zehn Minuten später hatten sie die Kirchnerstraße erreicht. Vor der Wohnung im dritten Stock wurden sie von einem Mann erwartet. Auf den Treppenstufen zum Dachgeschoss saßen die drei jungen Männer.
Der Mann nickte den beiden Polizisten zu: «Sie ist tot. Wahrscheinlich erstochen. Wie es aussieht, mit einem spitzen Gegenstand …»
«Was reden Sie da? Wer sind Sie?», fuhr Wendtland ihn an.
Der Mann hob die Augenbrauen und ließ einen Moment vergehen, bis er mit einem Lächeln antwortete: «Mein Name ist Dr. Gerlach, ich bin Arzt. Meine Praxis befindet sich im Erdgeschoss. Diese drei jungen Herren haben mich vor etwa einer halben Stunde benachrichtigt, dass Frau Niebergall in ihrem Blut auf dem Boden liegt. Ich habe nachgesehen und ihren Tod festgestellt.»
«Sie haben sie gefunden?», fragte Wendtland in Richtung der Freunde.
Die nickten.
«Dann bleiben Sie hier sitzen und rühren sich nicht von der Stelle. Wir gehen rein und sehen nach.»
«Nehmen Sie das hier mit», sagte Dr. Gerlach und reichte den Polizisten eine große Taschenlampe. «In der gesamten Wohnung scheint der Strom ausgefallen zu sein. Und …»
«Was ‹und›?», fragte Rüdiger Heinemann.
«Ja», sagte der Arzt. «Ich bin ja einiges gewohnt, aber das, was Sie dort drin erwartet, ist kein schöner Anblick. Ich wollte Sie nur warnen. Sie liegt im Schlafzimmer, zweite Tür rechts.»
Heinemann schluckte. Dann nickte er dem Arzt zu und betrat als Erster die Wohnung. Als Wendtland seinem Kollegen folgen wollte, hielt Dr. Gerlach ihn zurück. «Ich denke, es sind bereits genug Leute durch die Wohnung getrampelt. Ihre Kollegen von der Kripo werden froh sein, wenn nicht noch mehr Spuren zerstört werden.»
Einen Moment lang sah es aus, als wollte Ernst Wendtland sich die Belehrungen des Arztes verbitten, dann aber senkte er den Blick, dankbar für den Grund, sich den Anblick der toten Frau ersparen zu können.
Es dauerte keine Minute, bis Rüdiger Heinemann zurückkam. Aus seinem Gesicht war jede Farbe gewichen. Seine Lippen bebten. Er schien kurz davor, sich übergeben zu müssen.
An die Wand des Treppenhauses gelehnt, sah er mit flackernden Lidern in Richtung seines Kollegen.
«Hol die Kripo», stieß er hervor. «Die ganze Besetzung.»
Dann ließ er sich an der Wand hinabgleiten und blieb am ganzen Körper zitternd auf den hölzernen Dielen sitzen.
Staatsanwalt Traugott Köhler saß am Esstisch seines Wohnzimmers und nahm sein Abendbrot zu sich. Es bestand aus einer Scheibe Schwarzbrot und einem Schälchen mit Rote-Bete-Salat, den er sich am Abend zuvor zubereitet hatte. Dazu trank er, nach einem Rezept seiner über neunzigjährigen Großmutter, ein Glas Rotwein, das mit Traubenzucker und einem rohen Ei verquirlt war. Traugott Köhler war Anfang dreißig, durchtrainiert und hatte zu seinem Leidwesen bereits graues Haar, das er nach Art der amerikanischen Soldaten kurzgeschnitten trug. Er galt als scharfer Hund und wurde im engeren Kreis seiner Kollegen Terry genannt, was ihm durchaus gefiel – nicht nur wegen seines Faibles für alles Amerikanische, sondern auch, weil dieser Spitzname auf jene Hunderasse verwies, der er sich im Innersten verwandt fühlte. Terry Köhler hatte klare Vorstellungen, wie sein berufliches und privates Leben verlaufen würde. Vier Generationen lang hatte seine Familie begnadete Juristen hervorgebracht, und auch er hatte sein Studium als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen und einige aufsehenerregende Artikel in der juristischen Fachpresse veröffentlicht. Dennoch war er unzufrieden. Er wollte mehr, als nur in Fachkreisen bekannt zu sein, er wollte mehr als beruflichen Erfolg.
Terry Köhler mochte die Oper. Er ging gerne zu Ausstellungseröffnungen, besuchte Ballettaufführungen und sah sich jede neue Inszenierung im Schauspielhaus an. Vor allem liebte er den Applaus nach der Vorstellung, die flammenden Blitzlichter auf den Premierenfeiern. Er konnte nicht malen, spielte kein Instrument, und seine Versuche zu singen klangen erbarmungswürdig. Er war ein ganz und gar unkünstlerischer Mensch. Aber er liebte die Künstler. Er liebte sie, manchmal verachtete er sie, vor allem aber beneidete er sie. Wenn man ihnen zujubelte, wenn man sie interviewte und fotografierte, wünschte er, selbst ein Künstler zu sein. Berühmt zu sein, stellte er sich als Inbegriff des Glücks vor.
Terry Köhler war unverheiratet, beabsichtigte dies auch noch eine Weile zu bleiben, und begnügte sich stattdessen mit gelegentlichen Affären, bei denen er stets darauf achtete, sie rechtzeitig zu beenden. Den Zeitpunkt, sich eine Frau zu nehmen und eine Familie zu gründen, würde er sich weder vom Zufall noch von irgendwelchen Konventionen diktieren lassen.
Über seinem Schreibtisch hing ein Foto von John F. Kennedy.
Wie jeden Donnerstag hatte Terry Köhler auch heute zeitig Feierabend gemacht, um im Fernsehen die alten Kurzfilme mit Stan Laurel und Oliver Hardy sehen zu können, anschließend seine tägliche Gymnastik zu treiben, zu duschen und hinterher noch ein paar Akten zu bearbeiten. Umso ärgerlicher reagierte er, als ausgerechnet jetzt das Telefon läutete.
Am anderen Ende meldete sich Kriminaldirektor Gerling. Der Staatsanwalt und er kannten sich seit einigen Jahren, waren nicht nur dienstlich miteinander verbunden, sondern traten auch als Tennisspieler im 1. TC Eschersheim einmal pro Woche gegeneinander an.
«Terry, lass dein Essen stehen, schalt die Mattscheibe aus und sieh zu, dass du so schnell wie möglich herkommst. Die Niebergall ist umgebracht worden. Wir müssen …»
«Du meinst die Niebergall?»
«Ja. Hier sieht es aus wie in einem Schlachthaus. Wahrscheinlich ist sie in ihrem Himmelbett erstochen worden. Wir müssen sofort einen Plan aushecken; in Kürze wird es hier von Reportern nur so wimmeln. Du weißt, was jetzt auf uns zukommt.»
Terry Köhler lächelte. Sein Ärger war mit einem Schlag verflogen. Er wusste, was jetzt vor allem auf ihn selbst zukommen würde. Und es erfüllte ihn mit Genugtuung. Genau darauf hatte er gewartet: auf seinen ersten wirklich spektakulären Fall.
Er würde noch mehr arbeiten müssen als jetzt schon. Er würde fotografiert werden und Interviews geben. Und seine Karriere würde, wenn alles gut lief, einen deutlichen Schub bekommen. Der Mord an Rosemarie Nitribitt war neun Jahre her, aber allen Mitarbeitern bei Polizei und Justiz noch gut in Erinnerung. Und die Presse würde jetzt dafür sorgen, dass der Öffentlichkeit jedes Detail wieder ins Gedächtnis gerufen würde. Auch wenn es im Fall Nitribitt nie zu einer Verurteilung gekommen war, auch wenn man den Hauptverdächtigen hatte laufenlassen müssen – der Tod Rosemarie Nitribitts war zu einer Legende geworden, von der alle, die damals mit dem Fall befasst waren, noch immer zehrten. Die Ermordung Karin Niebergalls hatte das Zeug, ein zweiter Fall Nitribitt zu werden. Ein Fall, der, wenn man keinen entscheidenden Fehler machte, einen Staatsanwalt bis an das Ende seiner Laufbahn und darüber hinaus begleiten würde. Und er hatte Glück, dass Urlaubszeit war, sich viele seiner Kollegen noch in den Ferien befanden und er, Terry Köhler, zur rechten Zeit am rechten Ort war.
Er war Karin Niebergall nie begegnet, wusste aber um den Ruf, den sie bei Eingeweihten genoss. Und er würde dafür sorgen, dass nun, da sie tot war, dieser Ruf ins Unermessliche wuchs. In Kürze würde es niemanden geben, der ihren Namen nicht kannte. Alles hing davon ab, wie geschickt er die Ermittlungen lenkte. Und davon, dass der Fall nicht allzu schnell gelöst würde. Wenn der Täter nur nicht ein tölpelhafter Freier war, der sie aufgrund eines Streits getötet hatte und sich zwei Tage später erwischen ließ. Wenn es nur nicht, wie bei 95 Prozent aller Tötungsdelikte, eine langweilige Beziehungstat war. Je größer das Rätsel, umso mehr würde die Neugier der Öffentlichkeit angeheizt. Je dunkler die Tat, desto heller würde er im Licht stehen. Er sah die Schlagzeilen bereits vor sich: «Tod im Himmelbett: das traurige Ende von Deutschlands raffiniertestem Freudenmädchen. Exklusivinterview mit Staatsanwalt Traugott ‹Terry› Köhler».
Die Meute der Reporter würde es sich nicht nehmen lassen, Karin Niebergalls Leben und Sterben vor den Lesern auszubreiten. Man würde ihre Familie und ihre Freunde aufspüren, man würde Fotos veröffentlichen und über mögliche Motive und Täter spekulieren. Und Terry Köhler würde dafür sorgen, dass sein Name jedes Mal genannt wurde. Er war es, der Informationen weitergeben oder zurückhalten konnte. Er war es, der die hungrigen Mäuler stopfte oder sie noch gieriger nach der Beute schnappen ließ.
Als der Staatsanwalt kurz nach neunzehn Uhr am Tatort eintraf, glich das alte Bürgerhaus in der Kirchnerstraße 2 einem Bienenstock. Man hatte den Eingang abgesperrt. Kein Unbefugter durfte das Haus betreten. Dennoch wimmelte es von Männern – manche in Uniform, die meisten in Zivil –, die treppauf, treppab liefen und den Unmut Terry Köhlers hervorriefen.
Er bahnte sich einen Weg in den dritten Stock und wies den dort postierten Schutzpolizisten an, Kriminaldirektor Gerling ins Treppenhaus zu bitten.
«Gut», sagte Gerling, als er im Türrahmen erschien, «wird Zeit, dass du hier Ordnung reinbringst.»
«Worauf du dich verlassen kannst. Wie viele Leute sind drin?»
«Zu viele. Aber alle sehr, sehr wichtig!»
«Wer?»
«Fünf Leute der MK1, fünfmal Erkennungsdienst, die Rechtsmedizin in Person von Professor Fassbinder samt Assistentin. Und … der PP.»
Köhler schaute ungläubig: «Der Polizeipräsident? Du machst Witze!»
«Von wegen Witze. Die Sache wird schon jetzt ganz hoch gehängt. Alle sind völlig aus dem Häuschen. Du kannst dir denken, was hier los ist, wenn …»
«Wenn hier bekannte Namen ins Spiel kommen, meinst du? Wenn sich auf ihrer Kundenliste die Telefonnummern von Prominenten finden?»
Gerling nickte. «Unter den Kollegen wird schon jetzt gemunkelt. Von Politikern ist die Rede, von Wirtschaftsleuten …»
Köhler winkte ab: «Same procedure as every time. Lass sie munkeln.»
«Wir wissen noch nicht mal, wie wir den Fall nennen sollen.»
«Wie das?»
«Bei der Polizei ist niemand mit dem Namen Niebergall aktenkundig. Im Melderegister steht der Name Karin Rosenherz. Das ist ihr Geburtsname. Anscheinend war sie irgendwann mit einem Herrn Niebergall verheiratet, ist später geschieden worden und hat nach der Scheidung ihren Geburtsnamen wieder angenommen. Für ihre Freier war sie aber immer noch die Niebergall.»
«Obwohl Rosenherz ja viel passender geklungen hätte … bei ihrem Gewerbe», sagte der Staatsanwalt.
Gerling lachte. «Tja. Aber wahrscheinlich hat sie den Namen ihrer Familie genau damit nicht in Verbindung bringen wollen. Also hat sie sich weiter Niebergall genannt. Was den Verflossenen wohl nicht gerade begeistert haben dürfte …»
«Wenn er davon wusste. Jedenfalls ist ihr richtiger Name Rosenherz?»
Gerling nickte.
«Perfekt», sagte Köhler. «Dann ist das der Name, den sie ab sofort in allen offiziellen Schriftstücken, Protokollen und Presseerklärungen tragen wird. Und jetzt … will ich sie endlich sehen.»
Irritiert schaute der Polizist den Staatsanwalt an. «Du weißt, dass du dir das nicht zumuten musst.»
Terry Köhler grinste: «So schlimm wird’s schon nicht werden. Ich muss wissen, mit was wir es hier zu tun haben.» Und als er merkte, dass der Kriminaldirektor immer noch zögerte: «Beißen kann sie mich jedenfalls nicht mehr.»
Gerling nickte. Dann ließ er Köhler an sich vorbei ins Innere der Wohnung gehen.
Obwohl sich in jedem Zimmer Leute aufhielten, war kaum ein Laut zu hören. Stumm gingen die Beamten des Erkennungsdienstes unter den aufgestellten Scheinwerfern ihrer Arbeit nach. Es wurde vermessen und fotografiert. Auf dem Vertiko in der Diele befand sich eine grau lackierte Holzkiste, in der kleine Plastiktüten mit gesicherten Spuren verstaut wurden. Aus dem Schlafzimmer war Gemurmel zu hören.
Der Polizeipräsident stand mit dem Rücken zur Tür. Als er hörte, dass sich jemand von hinten näherte, drehte er sich um und gab Köhler wortlos die Hand.
Der Rechtsmediziner schaute auf, hielt kurz in seinem Gemurmel inne, grüßte ebenfalls und diktierte dann weiter. Seine Assistentin notierte seine Worte auf einen Block, der auf ein Schreibbrett geklemmt war.
Als der Polizeipräsident einen Schritt zur Seite trat, um den Blick auf die Tote freizugeben, bereute der Staatsanwalt die forsche Selbstverständlichkeit, mit der er eben noch verlangt hatte, den Leichnam zu sehen. Er hatte Mühe, beim Anblick der Toten die Fassung zu bewahren. Wenn er sich später an diesen Moment erinnerte, würde er immer das Gefühl haben, alle Einzelheiten dieses schrecklichen Mordes binnen einer Sekunde nicht nur mit den Augen, sondern mit jeder Faser seines Körpers erfasst zu haben.
Karin Rosenherz, wie er sie nun bei sich bereits nannte, lag auf der Seite.
Im gesamten Bereich um die Leiche herum war der Teppich durchtränkt mit Blut, das bereits getrocknet war.
Ihr Körper war nackt bis auf eine Art Büstenhalter, der aber nur den unteren Teil ihrer kleinen Brüste bedeckte, während der obere Teil und die Brustwarzen frei lagen. Die Beine waren leicht angewinkelt, die Arme verdreht und beide Hände zu Fäusten verkrampft.
Unterhalb des Kehlkopfs konnte man eine deutlich klaffende Wunde erkennen.
Der gesamte Nacken war übersät mit Stichverletzungen. Es sah aus, als habe der Täter seine Waffe immer wieder mit voller Wucht in ihren Hals gerammt.
Der Mund der Toten war halb geöffnet, ebenso die Augenlider. Die Pupillen waren nach oben gerichtet, der Blick gebrochen. Es sah aus, als habe sie in den letzten Sekunden ihres Lebens und noch bei vollem Bewusstsein in den Abgrund des bevorstehenden Todes geschaut und verstanden, dass nichts und niemand ihr mehr helfen würde.
«Geht es?», fragte der Rechtsmediziner, der Terry Köhler besorgt anschaute. «Soll ich Ihnen etwas zur Beruhigung geben?»
Der Staatsanwalt schluckte. Dann schüttelte er den Kopf. Am meisten überraschte ihn, wie klein, wie schmal Karin Rosenherz gewesen war. «Etwas so Verlorenes habe ich noch nie gesehen», sagte er leise.
«Ob Sie es glauben oder nicht», erwiderte Professor Fassbinder, «mir geht es genauso. Der Täter hat diese Frau terrorisiert. Man meint, die Panik noch in ihren toten Augen zu erkennen.»
Als Staatsanwalt Köhler sich jetzt umschaute, stellte er fest, dass nicht nur in der direkten Umgebung des Leichnams, sondern überall im Zimmer Blutspuren zu sehen waren. Verschmierte Flecken auf dem Parkett, Spritzer an den Wänden, auf der zerwühlten Bettwäsche, an der Tür ein verwischtes Muster, das aussah, als habe jemand versucht, sich mit einer blutigen Hand dort abzustützen.
Auch der Oberkörper der Leiche war zum Teil mit Blut verschmiert. Das Haar lag wirr um den Kopf; eine Strähne klebte auf der Wange. Die Haut der Toten war farblos. Umso größer wirkte der Kontrast ihres dunklen Schamhaars und der rosa lackierten Fußnägel.
Terry Köhler versuchte, wieder halbwegs ins Gleichgewicht zu kommen, indem er sich so routiniert wie möglich verhielt: «Können Sie schon etwas zu Zeitpunkt und Ursache ihres Todes sagen?»
Professor Fassbinder legte den Kopf in den Nacken und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. «Geben Sie mir noch ein paar Minuten, dann bin ich mit der ersten äußeren Leichenschau durch. Ich rufe Sie, wenn ich so weit bin.»
Ohne zu antworten, wandte der Staatsanwalt sich um. Er war nicht erpicht darauf, sich die Leiche noch einmal anzusehen. Hinter ihm setzte das Gemurmel des Rechtsmediziners wieder ein.
An der Schlafzimmertür blieb Köhler stehen und schaute noch einmal zurück. Der Raum sah aus, als sei ein Sturm hindurchgefegt. Die Türen des großen Kleiderschranks standen offen. Schubladen waren herausgerissen worden, der Inhalt auf dem Boden verteilt. Auf dem Teppich lagen zerknitterte Kleidungsstücke. Ein kleiner Beistelltisch war umgekippt, ebenso ein mit Plüsch bezogener Hocker. Daneben sah man zwei Perücken liegen, eine schwarze, eine rotblonde. Einer der schweren Vorhänge vor dem Fenster war halb heruntergerissen.
Als Köhler die Diele betrat, stand dort ein stämmiger Mann in Zivil, den er nie zuvor gesehen hatte. Der Mann rauchte und ließ die Asche seiner Zigarette achtlos zu Boden fallen.
«Wer sind Sie, was haben Sie hier zu suchen?», fuhr der Staatsanwalt ihn an.
Verdutzt schaute ihn der Fremde an, dann grinste er: «Himstedt. Peter Himstedt. Mir gehört dieses Haus; die Tote war meine Mieterin.»
Köhler platzte der Kragen: «Was fällt Ihnen ein, hier zu rauchen? Woher wissen Sie, dass es hier eine Tote gibt? Wie kommen Sie auf die Idee, hier herumlungern zu dürfen? Wer hat Sie überhaupt hereingelassen?»
Ohne auf eine Antwort des Mannes zu warten, schob der Staatsanwalt den Hausbesitzer aus der Wohnungstür, dann drückte er dem dort postierten Schutzpolizisten einen Bleistift und einen Zettel in die Hand: «Schreiben Sie mir Ihren Namen und Ihre Dienstnummer auf!»
Der Uniformierte sah ihn fragend an.
«Tun Sie, was ich sage! Ich werde dafür sorgen, dass Sie die nächsten drei Jahre Gummiknüppel polieren.»
Kurz sah es so aus, als wolle der Polizist protestieren, dann zog er jedoch den Kopf ein und tat, was man ihm befohlen hatte.
«Und jetzt gehen Sie runter und holen einen Kollegen, der mindestens drei Gramm Hirn im Kopf hat. Das heißt: wenn es einen solchen gibt und sofern Sie das beurteilen können.»
Köhler lief zurück in die Wohnung. Er stürmte durch alle Zimmer: «Raus!», brüllte er. «Jeder, der hier nichts zu tun hat, verlässt sofort den Tatort! Egal, welche Abteilung, egal, welcher Dienstgrad. Das ist ein Befehl! Sammelt euch auf der Straße. Wir kommen gleich runter und verteilen die Aufgaben.»
Nacheinander drückten sich ein paar der Männer an ihm vorbei. Der Unmut, sich vom Staatsanwalt herumkommandieren zu lassen, war ihnen anzumerken. Dennoch wussten sie, dass er recht hatte. Egal, wie eng sie später in die Ermittlungen eingebunden würden, jetzt war jeder Polizist, der nicht unbedingt am Tatort gebraucht wurde, einer zu viel.
Vier
Vor dem Haus hatten sich fast zwanzig Ermittler versammelt. Der Platz rund um den Kaiserbrunnen war abgesperrt. Inzwischen hatte sich herumgesprochen, was in der Kirchnerstraße 2 passiert war. Neben den zahlreichen Neugierigen, die an der Absperrung versammelt waren, versuchten nun auch die ersten Reporter, sich Zugang zu verschaffen.
Köhler und Gerling standen ein wenig abseits. Mit gesenkter Stimme redete der Staatsanwalt auf den Kriminaldirektor ein. «Ich will, dass du deine Truppe besser im Griff hast», sagte er. «Nichts von dem, was wir dort oben gesehen haben, darf nach außen dringen. Ist das klar?»
Gerling wiegte den Kopf: «Terry, bei aller Liebe, du musst mir nicht meinen Beruf erklären. Ich kann mich auf meine Leute verlassen. Aber du weißt, dass es unmöglich ist, eine solche Ermittlung vollständig geheim zu halten. Ich werde es versuchen, aber …»
«Nein», unterbrach ihn Köhler, «kein Aber! Das ist in diesem Fall die falsche Einstellung. Wir werden eine Verschwiegenheitserklärung formulieren, die jeder unterschreiben muss, der am Tatort war. Nicht nur der Arzt aus dem Haus, nicht nur die drei Italiener und der Hausbesitzer, auch die Beamten …»
«Nein», widersprach Gerling.
«Doch, genau so werden wir es machen.»
«Was soll das? Unsere Leute sind sowieso zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie wissen, dass sie nicht plaudern dürfen. Wenn du sie jetzt zwingst, so etwas zu unterschreiben, demonstrierst du ihnen dein Misstrauen. Damit würden wir die Ermittlungen schon am Anfang unnötig belasten.»
Der Staatsanwalt rückte seine Krawatte zurecht und beugte seinen Kopf ein wenig weiter zu Gerlings Ohr. Obwohl er leise sprach, hatte seine Stimme eine deutlich vernehmbare Schärfe angenommen: «Sie werden unterschreiben! Alle! Und du wirst dafür sorgen! Niemand sagt zu irgendwem ein Wort. Keinesfalls dürfen irgendwelche Einzelheiten an die Presse durchsickern. Niemand wird sich in der Öffentlichkeit äußern, mich ausgenommen. Niemand! Hast du das verstanden?»
Resigniert nickte Gerling. Seine Lippen waren schmal. Er wandte sich ab, um zu den wartenden Ermittlern hinüberzugehen.
«Und noch was …», sagte Köhler.
Gerling drehte sich zu ihm um: «Nämlich?»
«Du wirst ebenfalls unterschreiben!»
Vor Überraschung war der Kriminaldirektor drei Sekunden lang sprachlos. Aus schmalen Augen sah er sein Gegenüber an. «Terry!», sagte er schließlich. «Terry, weißt du, dass ich bis vor kurzem dachte, wir könnten nicht nur Tennispartner sein, sondern auch Freunde werden?»
«Und?»
«Jetzt weiß ich es besser. Jetzt weiß ich, dass es stimmt, was viele über dich sagen.»
«Und was sagen sie?»
«Dass du ein Arschloch bist.»
Terry Köhler verzog keine Miene. Er ging zügig an Gerling vorbei und auf die Beamten der Mordkommission zu. Dann klatschte er in die Hände: «Meine Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.»
Über einige Gesichter huschte ein verstohlenes Lächeln.
«Sie alle wissen inzwischen, um wen es sich bei der Toten handelt, Sie wissen auch, welchen Beruf sie ausübte und dass sie ihre Kundschaft nicht gerade im Rinnstein aufgelesen hat. Karin Rosenherz – so hieß das Opfer und so werden wir es künftig auch nennen – hatte vermutlich Kontakt zu den eher gehobenen Kreisen unserer Gesellschaft. Das heißt keinesfalls, dass dort auch der Täter zu suchen ist. Es heißt jedoch, dass wir unsere Ermittlungen mit größter Diskretion durchführen. Wir werden mit vollkommener Verschwiegenheit vorgehen. Das heißt, Sie reden mit niemandem über irgendetwas, das Sie im Laufe der Ermittlungen erfahren. Mit niemandem! Nicht mit der Presse, nicht mit Ihren Freunden, nicht mit Ihren Frauen und schon gar nicht mit Ihren Müttern.»
Köhler wartete, bis das kurze Gelächter bei den Umstehenden verebbt war. Dann fuhr er fort: «Auch gegenüber Kollegen, die mit dem Fall nichts zu tun haben, wird Ihr Mund verschlossen bleiben! Alle Informationen gehen zuerst an mich! Ich will vor jeder relevanten Zeugenbefragung informiert werden. Ich sagte: vor. Und ich sagte: vor jeder. Sollte sich bei einem Zeugen auch nur der leiseste Verdacht ergeben, dass er als Täter in Frage kommt, werde ich unverzüglich hinzugezogen! Meine Sekretärin wird Ihnen allen einen Zettel mit meiner Dienst- und mit meiner Privatnummer zukommen lassen. Ich bin ab sofort für Sie alle jederzeit erreichbar. Und wenn ich sage jederzeit, dann heißt das jederzeit: Tag und Nacht und am Wochenende. Es gibt also keine Ausreden.»
Während er sprach, schaukelte Terry Köhler immer wieder leicht mit dem Oberkörper, eine Geste, die er für ebenso eindrucksvoll wie lässig hielt, nachdem er in einem amerikanischen Spielfilm gesehen hatte, dass ein erfolgreicher Anwalt dadurch seinen Worten Nachdruck verliehen hatte.
«So, und jetzt gehen wir an die Arbeit. Rollen Sie das gesamte Umfeld der Toten auf! Ich will wissen, wo sie herkommt, was sie für Eltern und Verwandte hatte, wer ihre Freunde, wer ihre Kunden und wer möglicherweise ihre Feinde waren. Tauchen Sie ein ins Milieu, aber tauchen Sie bitte nicht ungebührlich tief ein!»
Erneutes Gelächter.
«Sollten unter den Asservaten Tagebücher, Adressverzeichnisse, Visitenkarten, Terminkalender und Briefe auftauchen – wahrscheinlich ist dergleichen sogar schon gesichert worden …»
Er warf einen fragenden Blick in die Runde. Einer der Erkennungsdienstleute hob die Hand und nickte.
«… Ich sehe, das ist der Fall – dann kommen diese Unterlagen zuerst auf meinen Schreibtisch. Versuchen Sie alles über den Tagesablauf des Opfers herauszubekommen. Befragen Sie ihre Kolleginnen, sprechen Sie mit Kellnern und Taxifahrern. Ich will einen Zeitplan, aus dem ersichtlich ist, wo Karin Rosenherz sich in den letzten Wochen aufgehalten hat. Für die achtundvierzig Stunden vor ihrem Tod sollte dieser Zeitplan möglichst lückenlos sein. Ach ja, und finden Sie bitte auch heraus …» Köhler hielt inne und hob nun die Hand, um jede zur Schau getragene Belustigung schon im Vorfeld zu unterbinden, «… finden Sie auch heraus, wer ihr Frauenarzt war. Kurz und gut, ich will alles über Karin Rosenherz wissen! Einzelheiten der jetzt anstehenden Aufgaben besprechen Sie bitte mit Kriminaldirektor Gerling, der mein volles Vertrauen hat und den ich nicht nur als hervorragenden Polizisten, sondern auch als phantastischen Tennisspieler und treuen Freund schätzen gelernt habe.»
Terry Köhler drehte sich auf dem Absatz um und ging auf den Hauseingang zu. Bei seinen letzten Worten hatte er selbst Mühe gehabt, nicht zu lachen.
Professor Fassbinder empfing ihn in der Küche. Der Mediziner hatte den Kopf gesenkt, seine Arme hingen schlaff herab. Er sah müde aus.
«Ich nehme an, Sie legen keinen Wert darauf, die Tote noch einmal zu sehen», sagte er.
Köhler winkte ab. «Machen wir es kurz. Wichtigster Punkt: Haben Sie eine Ahnung, wann die Frau umgebracht wurde?»
«Rigor mortis und Livores sind im Normalfall …»
«Okay, okay», unterbrach ihn der Staatsanwalt. «Wir haben beide Latein lernen müssen, meine Stärke war es allerdings nie, also bitte!»
«Die Leichenstarre ist bereits voll ausgebildet, das heißt, die Frau ist mindestens vierzehn bis achtzehn Stunden tot. Leichenflecken finden sich aufgrund der starken Ausblutung nur spärlich, deshalb taugen sie in diesem Fall nicht als Indikator.»
«Verstehe. Können wir das weiter eingrenzen? Wie lange kann sie höchstens tot sein?»
«Bei den momentanen Außentemperaturen würde sich die Leichenstarre aufgrund der Zersetzungsvorgänge im Körper nach vierundzwanzig bis dreißig Stunden wieder lösen. Da dies noch nicht der Fall ist, kann ihr Tod also frühestens gestern am späten Nachmittag eingetreten sein. Wenn Sie es noch genauer wissen wollen, müssen Sie entweder warten, bis wir alle Ergebnisse haben, oder einen Zeugen auftreiben, der sie kurz vor ihrem Tod noch lebend gesehen hat.»
«Das werden wir tun; darauf können Sie sich verlassen», sagte Köhler. «Todesursache?»
«Sie haben die große Wunde in der Nähe des Kehlkopfs gesehen. Ein Einstich, der möglicherweise die Luftröhre verletzt und eine Embolie verursacht hat. Könnte aber auch sein, dass sie verblutet ist. Ich habe insgesamt sechzehn Stichwunden gezählt, viele davon am hinteren Hals und am oberen Rücken.»
«Ein Messer?»
Fassbinder wiegte zweifelnd den Kopf. «Es sieht aus, als seien zwei Waffen benutzt worden: eine dünnere, spitze und eine breite, stumpfe. Beide Werkzeuge können nicht sehr lang gewesen sein. Deshalb hat der Täter wohl so oft und mit so großer Kraft zugestochen. An ein paar Stellen sieht es aus, als habe er die Waffe im Körper des Opfers gedreht, um eine größere Wirkung zu erzielen.»
«Sechzehn Stiche?»
Professor Fassbinder nickte. «Was auch immer hier geschehen ist, die Frau ist … nicht schnell gestorben. Mehr über den Charakter der Wunden und damit über die mögliche Tatwaffe weiß ich erst, wenn wir die Leiche gewaschen haben und …»
«Okay … Gehen Sie davon aus, dass das Opfer versucht hat, sich zu wehren?»
«Das ist sicher. Ich habe sämtliche Fingernägel geschnitten und werde sie heute Abend noch im Labor untersuchen lassen. Aber so viel kann ich schon jetzt sagen: Unter einigen befanden sich nicht nur Wollfasern, sondern auch Hautpartikel. Ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Kampf stattgefunden hat, dass sie den Angreifer gekratzt und verletzt hat. Irgendwo sollte also auch beim Täter eine Wunde zu finden sein. Und ich vermute, eine nicht ganz kleine Wunde.»
«Was ja auch heißt: Das Ganze kann eigentlich nicht ohne Lärm abgegangen sein.»