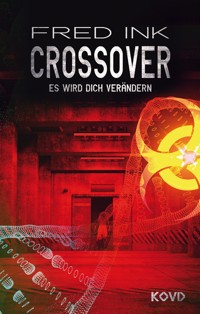3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
H. P. Lovecraft gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Phantastik. Obwohl er seit über 80 Jahren tot ist und kein allzu umfangreiches Prosawerk hinterließ, beeinflusst er noch immer unzählige Autoren. Einer von ihnen ist Fred Ink, der seinem Vorbild mit den drei hier versammelten Novellen Tribut zollt. Das Grauen in den Bergen: Ein frisch aus dem Sanatorium entlassener Mann erfährt von einer gewaltigen Erbschaft. Doch an den Erhalt des Vermögens ist eine rätselhafte Bedingung geknüpft. Die Suche nach Antworten belastet schon bald mehr als seinen Verstand. Wurmstichig: Mit Waffengewalt soll ein Arzt dazu gebracht werden, seinem Peiniger den Bauch aufzuschneiden. Die Geschichte, die der Mann zur Begründung vorbringt, beginnt auf der Schwäbischen Alb und endet in den schlimmsten Albträumen. Der Untergang von Godly Gulch: Ein Schatten liegt auf dem Heimatort des kleinen Ben. Er und seine Ma sind Entbehrungen und Kummer gewohnt. Doch erst als ein Fremder bei ihnen auftaucht, erkennen sie nach und nach die unaussprechlichen Schrecken, die Godly Gulch in ihren Klauen halten. Erleben Sie die klassische Gruselatmosphäre der Erzählungen und folgen Sie gemeinsam mit Fred Ink Lovecrafts Fußspuren! Leserstimmen (Quelle: Rezensionen): "Klasse Buch, wer Lovecraft mag, ist hier genau richtig. Dem Autor gelingt es, das Grauen direkt und gleichzeitig subtil herüber zu bringen. Super!" "Lovecraftiger geht’s nicht!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fred Ink
Die Alten waren, die Alten sind
Drei Horrornovellen auf H. P. Lovecrafts Spuren
Impressum
© 2017 Fred Ink. Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: Jenny Merz und Fred Ink
Lektorat: Markus Günther, Romana Grimm,
David Rohlmann
Herausgegeben von:Oliver Lutz
Paulinenstraße 26
72116 Mössingen
Deutschland
Dieses E-Book ist für Ihre persönliche Nutzung lizenziert. Das E-Book darf nicht an Dritte weitergegeben oder weiterverkauft werden. Wenn Sie das Buch an eine andere Person weitergeben wollen, kaufen Sie bitte eine zusätzliche Lizenz für jeden weiteren Leser. Wenn Sie dieses Buch lesen, es aber nicht gekauft haben, oder es nicht für Ihre persönliche Nutzung gekauft wurde, kaufen Sie bitte Ihre eigene Kopie.
Vielen Dank, dass Sie die harte Arbeit des Autors respektieren und würdigen.
- Vorwort -
H. P. Lovecraft ist zweifelsohne einer der einflussreichsten Autoren im Bereich der phantastischen Literatur. Aber das brauche ich Ihnen vermutlich nicht zu sagen, werter Leser, denn Sie werden sich dieses Buch aus gutem Grund gekauft haben. Aber ich möchte betonen, welchen Einfluss Lovecraft auf mich hatte und noch immer hat. Der Großteil meiner Romane und Kurzgeschichten ist geprägt von Lovecraft-Einflüssen, und bei den wenigen Ausnahmen musste ich mich wirklich anstrengen, um sie frei davon zu halten.
Mich fasziniert das Universum, das Lovecraft erschaffen hat; ein Universum, in dem der Mensch unbedeutend und schwach ist. Isoliert treibt er auf einem winzigen Staubkorn namens Erde durch die Tiefen des Alls und hat keine Ahnung davon, welche Schrecken dort draußen zu finden sind (was vermutlich ganz gut so ist). Wesen, die unermesslich mächtiger sind als wir, lauern zwischen den Sternen. Sie warten auf ihre Chance, auf einen günstigen Zeitpunkt, um erneut über uns zu herrschen oder uns gar zu vernichten. Uralte Kulte beten sie seit Menschengedenken an und operieren im Verborgenen, um ihre blasphemischen Lehren weiterzureichen. Wer ihnen in die Quere kommt, steckt in gewaltigen Schwierigkeiten. Zuweilen nehmen die »Großen Alten« auch direkt Einfluss auf uns, und wer immer eine solche Begegnung hat, kann von Glück sagen, wenn er lebend davonkommt. Was jedoch ganz sicher leiden wird, ist sein Verstand.
Es ist ein Universum der Antihelden, die es mit gottgleichen Gegnern aufnehmen müssen. Falls sie am Ende siegreich sind, zahlen sie einen hohen Preis dafür. So gut wie nie wird ihnen dafür Ehre zuteil, weil niemand von ihnen oder den Gefahren, die sie abwenden, Notiz nimmt. Und falls doch, so glaubt dieser Jemand ihnen nicht.
Lovecraft war sehr belesen, besonders im Bereich der Naturwissenschaften kannte er sich aus. In vielen seiner Geschichten finden sich Bezüge zum damaligen Stand der Forschung. Heutzutage ist freilich vieles überholt, doch wenn man sich beim Lesen in die 1920er versetzt, verstärken solche Passagen das angenehme Kribbeln, das Leser von Horrorliteratur so schätzen. Sie machen das Grauen realer, indem sie mögliche Erklärungen für das Übernatürliche bieten.
Passend dazu geht ein Großteil der Schrecken von Büchern aus, von verbotenen Schriften voller uraltem Wissen, das der Mensch sich besser niemals angeeignet hätte. Außerdem bedient sich Lovecraft gerne Stilelementen wie Tagebucheinträgen und Briefwechseln, die hervorragend dazu geeignet sind, dem Leser gerade genug Informationen zu liefern, um ihn mitfiebern zu lassen.
Wenn Sie diese Aspekte im Hinterkopf behalten, während Sie meine Werke lesen, werden Sie feststellen, dass ich meine Erzählungen oft ganz ähnlich aufbaue. Das geschieht in den meisten Fällen nicht bewusst, aber ich weiß genau, wer dabei im Hintergrund die Fäden zieht.
Dieses Buch dreht sich um Geschichten, die ich ganz absichtlich »auf Lovecraft getrimmt« habe. Teilweise bedienen sie sich sogar ungeniert bei den Werken des »Einsiedlers aus Providence«. Man könnte sagen, es sind Fanprojekte. Indem ich sie schrieb, verneigte ich mich vor einem meiner Idole und führte sein Werk fort. Und ganz nebenbei hatte ich jede Menge Spaß dabei. Selbstverständlich reiche ich nicht an das große Vorbild heran, aber ich hoffe, dass das Ergebnis Ihnen einige vergnügliche Stunden bereiten wird.
Um einen möglichst großen »Lovecraft-Effekt« zu erzielen, habe ich die Sprache der Geschichten entsprechend angepasst. Sie lesen sich altmodisch und etwas gestelzt, hier und da finden sich sperrige Formulierungen oder kaum gebräuchliche Wörter. Manch einer wird mir in diesem Zusammenhang vorwerfen, keinen eigenen Stil zu besitzen. Er sei hiermit auf meine anderen Werke verwiesen (eine Auswahl findet sich am Ende dieses Buchs).
»Die Alten waren, die Alten sind« will nach Lovecraft klingen (zumindest ein wenig), und falls Sie das so empfinden, war ich erfolgreich. Natürlich soll dieses Buch aber mehr als eine Kopie sein. Die Novellen stecken voller eigenständiger Ideen und heben sich auch in anderen Aspekten vom Vorbild ab. So gibt es bei mir beispielsweise mehr Action (allerdings nicht zu viel, keine Sorge). Ab und an fließt Blut, manchmal sogar eine Menge davon. Und obwohl die Schrecken, ganz wie bei Lovecraft, oftmals nur angedeutet werden, bekommt man sie hier und da in vollem Umfang zu Gesicht. Ich hoffe, dass Ihnen dieser »modernere« Mix zusagt, und dass Sie das erwähnte Kribbeln verspüren, während Sie sich die folgenden Seiten zu Gemüte führen.
Eines noch: Die erste Novelle, »Das Grauen in den Bergen«, ist nicht nur eine Hommage an Lovecraft, sondern auch an E. A. Poe (der wiederum ein Vorbild von Lovecraft war). Außerdem versteckt sich darin ein Rätsel, das etwas Eigeninitiative von Ihnen verlangt. Manche Leser konnten es nicht lösen und haben mich deswegen kontaktiert. Ich will es Ihnen aber nicht zu einfach machen, daher sei nur so viel verraten: Es steht alles im Text. Mit ein wenig Hirnschmalz werden Sie es schon herausfinden. Werden Sie selbst zu einem Lovecraft-Charakter und kommen Sie dem Grauen auf die Spur!
Fred Ink, Espoo, 21.03.2017
»The Old Ones were, the Old Ones are, and the Old Ones shall be.«
H. P. Lovecraft
Das Grauen in den Bergen
- Ein Schreiben und ein Abschied -
Namenloses Dorf, 12. Oktober 1927
Liebste Magdalene,
wenn du dies liest, existiere ich nicht mehr. Dein Mann ist dann ausgelöscht, und was von ihm bleibt, wage ich nicht zu beschreiben. In gewisser Weise werde ich gestorben sein, und vermutlich ist es das Beste, wenn du meinen Tod als Gewissheit akzeptierst. Verschwende keinen Gedanken mehr an deinen Gatten, schone deine Kräfte und versuche nicht, mich zu finden. Ich werde tot sein und du wirst endlich Frieden haben. Das ist alles, was du wissen musst.
Mir liegt viel an deinem Seelenheil, daher würde ich dich am liebsten nicht mit der Chronologie der Ereignisse belasten. Ereignisse, die mich in Abgründe blicken ließen, die tiefer und finsterer sind, als ich sie mir je hätte vorstellen können – Schlünde, sowohl inner-, als auch außerhalb meiner selbst. Ereignisse, die mich vollkommen vereinnahmten, mich die Kontrolle verlieren ließen und die mich schließlich zu jener fürchterlichen und zugleich verheißungsvollen Entscheidung zwangen, die meinem bisherigen Leben so vollständig ein Ende setzen wird.
Du hast weiß Gott lange genug unter mir und meiner labilen Psyche gelitten; du solltest nicht von den schrecklichen Erlebnissen der letzten Tage gemartert werden, von meinem Entsetzen, meinen Entdeckungen und meiner Ausweglosigkeit. Aber ich liebe dich mehr als alles Andere und daher hast du es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ich möchte vollkommen ehrlich zu dir sein, bevor ich mich aus dieser Existenz verabschiede.
Vermutlich wirst du meine Ausführungen als Ausgeburt eines kranken Hirns abtun – noch ein schizophrener Schub, ein weiterer Rückschlag nach einer hoffnungsvoll begonnenen Therapie. Mein Geist war seit jeher zerrüttet und das Einzige, was die klaffenden Lücken zwischen der Realität und dem Chaos dahinter zu kitten vermochte, warst du. Es warst einzig du, meine liebste Magdalene. Und du hast inzwischen so viel meines Irrsinns miterleben müssen, dass du begonnen hast, selbst daran Schaden zu nehmen. Du hast dich zurückgezogen, dir eine Auszeit erbeten, um dich von deinem Ehemann zu erholen. Die vorläufige Trennung war eine glückliche Fügung des Schicksals, denn sie sorgte dafür, dass du nicht zugegen warst, als mich der Brief erreichte.
Mir gefällt der Gedanke, dass du alles, was nach diesem Schreiben kam, als Wahnvorstellungen auslegen könntest, als einen Anfall von Geisteskrankheit, der letzten Endes zu meinem Untergang führte. Am besten verfährst du genau so, meine Liebste. Glaube mir kein Wort, verabschiede dich in Würde und sei endlich frei. Ich werde bald aufhören, dich zu quälen.
- Eine Entlassung und eine Reise -
Ich erhielt den Brief am fünften Oktober. Obgleich jenes Datum erst wenige Tage zurückliegt, hat sich in der Zwischenzeit so vieles zugetragen, dass es mir vorkommt, als wären Jahre vergangen.
An diesem Montag wurde ich aus dem Sanatorium entlassen. Ich hatte gute Fortschritte gemacht, wurde mir versichert. Die Medikamente schlugen an, die psychiatrischen Sitzungen halfen dabei, dass ich mich selbst besser verstand und die Beschäftigung mit Ton und Farben ließ mich die inneren Dämonen bekämpfen, indem ich sie in reale Bilder und Skulpturen bannte. Mit der nötigen Medikamention versehen, wollte man mich erneut auf die Welt loslassen.
Ein sanfter Windhauch umspielte meine Züge, als ich über den laubbedeckten Kiesweg zum Tor schritt. Die Oktobersonne streichelte mir die Wangen und schien sagen zu wollen: Sei guten Muts! So wie die Bäume im nächsten Frühjahr erneut austreiben, so wirst auch du wieder erblühen. Du bist den Ballast deines alten Lebens losgeworden. Der Schnee wird kommen und alles bedecken, und was sich dann vor dir ausbreitet, ist jungfräulicher Boden, den du so beschreiten kannst, wie du möchtest.
Klingt nach schwelgerischem Unsinn, nicht wahr? Doch an jenem Tag fühlte es sich so an. Ich träumte davon, ganz von vorne zu beginnen, mir ein einfaches, ehrliches Leben aufzubauen und dich zurückzugewinnen. Ich breitete die Arme aus, sog die erdige, kühle Luft in mich auf und trat durch das schmiedeeiserne Tor hinaus in die Freiheit. Mein Koffer stand bereit. Ich ergriff ihn und setzte mich in Richtung der Bushaltestelle in Bewegung. Wohin es mich verschlagen würde, wusste ich nicht – erst einmal in einem Motel unterkommen, dann würde man schon sehen.
Bereits nach wenigen Schritten sah ich die schwarze Limousine, die nahe dem Tor parkte. Als der Fahrer mich bemerkte, stieg er aus und nickte mir freundlich zu.
»Mr. Usher?« Er klang vornehm und trug eine Chauffeurs-Uniform aus edlem Zwirn.
»Ja?«, entgegnete ich wenig einfallsreich.
»Vergessen Sie den Bus. Mr. Vanderbilt hielt es für geziemender, dass ich Sie abhole.«
Ehe ich meiner Verblüffung Ausdruck verleihen konnte, hatte der Mann sich mein Gepäck gegriffen und im Kofferraum verstaut. Er kehrte zu mir zurück und hielt mir die Tür auf. »Wenn ich bitten dürfte?«
»Wer ist Mr. Vanderbilt? Und wohin wollen Sie mich bringen?«
»Mr. Vanderbilt pflegt mich nicht über die Details seiner Geschäfte zu informieren. Nach allem, was ich weiß, spielt jedoch eine Erbschaft eine nicht unerhebliche Rolle bei der Sache.«
»Eine Erbschaft? Wer sollte mir etwas vererben? Ich habe keine Familie, abgesehen von …« Das pure Entsetzen ergriff mich. »Magdalene! Was ist mit meiner Frau?«
Der Chauffeur lächelte milde. »Ihre Gattin ist wohlauf, machen Sie sich keine Sorgen.«
»Woher wollen Sie das wissen? Ich denke, Ihr Boss erzählt Ihnen …«
»Mr. Vanderbilt hat zufälligerweise darauf bestanden, dass ich ausschließlich Sie abhole, Mr. Usher. Ihre Frau darf unter keinen Umständen zugegen sein.«
Ich bestürmte den Mann noch mit vielen weiteren Fragen, doch er lächelte sie allesamt weg und deutete hartnäckig ins Innere des Fahrzeugs. Es war ein sündhaft teures Modell, ausgelegt mit duftendem Leder und mit Zierleisten aus Wurzelholz veredelt. Ich gebe zu, dass der Gedanke, derart komfortabel zu reisen, einen nicht unerheblichen Reiz auf mich ausübte. Selbstverständlich hatten mich die Andeutungen des Mannes auch neugierig gemacht; ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer mir etwas hätte vererben sollen und brannte darauf, dieses Rätsel zu lösen. Ein vorläufiges Reiseziel hatte ich nun auch, also gab ich dem Drängen des Fahrers schließlich nach und sank in die weiche Rückbank.
Als der Chauffeur (seinen Namen habe ich nie erfahren) sich während der Fahrt als weitgehend wortkarg entpuppte, beschloss ich, stattdessen die Landschaft zu genießen, um die nagenden Gedanken zu verdrängen. Viel zu lange hatte ich nur durch vergitterte Fenster nach draußen spähen können, hatte ich lediglich Luft atmen können, die durch Reihen von Metallstäben und Zäunen gefiltert wurde. Nun breitete sich die offene Welt vor mir aus, und mir schien, als habe sie sich zu meiner Begrüßung in ihr prächtigstes Gewand gekleidet. Eine Prozession aus rotgoldenen Blättern, dampfenden Wiesen und märchenhaften Gehöften zog an meinen gierigen Augen vorbei, als wir über die verschlungenen Straßen der Berge Neuenglands rollten. Naturbelassene Bächlein plätschern dort unbehelligt dahin, während uralte Bäume ihre mächtigen Äste über sie breiten. Es gibt Schluchten und Täler, die bis heute der menschlichen Besiedlung entgangen sind. Und mit einem Mal erschien mir die Vorstellung, ein Leben in dieser wunderschönen Abgeschiedenheit zu führen, ungemein verlockend. Wo könnte ich eine bessere Gelegenheit finden, mich ins Leben zurückzutasten, als in der friedlichen Idylle dieser ländlichen Gegend?
Natürlich hatte ich zu jenem Zeitpunkt keine Ahnung davon, dass mein weiterer Weg mich schon bald in diese Abgeschiedenheit führen würde. Mir war auch nicht klar, dass es Flecken gibt, die der Mensch vollkommen zu Recht meidet, Orte, denen ein Schatten anhaftet und die nicht gesund sind. Hätte ich nur den Schimmer einer Vorstellung davon gehabt, was mir innerhalb der nächsten Tage bevorstehen würde, ich hätte sofort die Tür des Wagens aufgestoßen und mich in voller Fahrt auf die Straße geworfen.
- Ein Erbe und ein Vertrag -
Mr. Vanderbilt kam einem Geier so nah, wie es einem Menschen möglich ist. Vielleicht hatte er die Grenzen des in diesem Zusammenhang Erlaubten auch um einige Zoll überschritten. Sein kahler Schädel klammerte sich an einen langen, dürren Hals. Eine riesige Aristokratennase stach mir entgegen, während mich kleine, gierig funkelnde Äuglein musterten. Sein Alter war unbestimmbar, ich schätzte ihn jedoch auf mindestens siebzig, da seiner Haut eine pergamentartige Faltigkeit zu eigen war, die mir nicht sonderlich behagte. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, einem Aasfresser gegenüberzusitzen, der vom sicheren Platz im hohen Geäst aus auf seine nächste Mahlzeit herablächelte.
Wie Vanderbilts Büro eingerichtet war, werde ich nicht verraten. Und in welcher Stadt das Gebäude stand, wirst du ebenfalls nicht erfahren, Magdalene. Ich möchte dich nicht in die Lage versetzen, meine Spuren zurückverfolgen zu können. Du könntest sonst auf die Idee kommen, etwas sehr Törichtes zu tun und mich suchen. Falls du glaubst, in Vanderbilts Namen einen brauchbaren Hinweis gefunden zu haben, lass dir gesagt sein: Es handelt sich nicht um den wahren Namen dieses Mannes. Vielmehr ist er frei erfunden, wie sämtliche Namen innerhalb meines Berichts. Bemühe dich also nicht, Liebste!
Nachdem ich in einem Ledersessel vor Vanderbilts Schreibtisch Platz genommen hatte, faltete der Mann die dürren Hände vor der Brust und legte sein spitzes Kinn darauf ab. Er musterte mich einige Sekunden lang, bevor er verkündete: »Mr. Usher, kein Zweifel. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen.«
»Bitte? Wie meinen Sie das?«
Vanderbilt lehnte sich zurück, entfaltete beide Zeigefinger und legte ihre Spitzen aneinander. Sein Anzug raschelte, als er an dem spindeldürren, trockenen Körper entlangglitt. »Ich spreche von Familienangehörigkeit, Mr. Usher. Körperbauliche Merkmale, vererbte Parallelen.«
»Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe keine Blutsverwandten. Ich war ein Waisenkind und habe bislang keine Kinder gezeugt. Und wenn meine Frau mit mir verwandt wäre, wüsste ich das sicherlich.«
Falls ich gehofft hatte, mit der letzten Bemerkung eine amüsierte Reaktion zu provozieren, wurde ich enttäuscht. Vanderbilts Stimme klang rau und hohl, als er antwortete: »Das ist es, was sie bislang dachten, Mr. Usher. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagte …« Eine seiner Spinnenhände zog eine Schublade des Schreibtisches auf, fasste hinein und förderte einen versiegelten Umschlag zutage. »… dass bis vor wenigen Tagen tatsächlich ein Blutsverwandter von Ihnen existiert hat? Und dass Sie der alleinige Erbe seiner gesamten Besitztümer sind?«
»Und wer soll das sein? Denken Sie wirklich, ich wüsste nichts davon, wenn ich irgendwo dort draußen einen Onkel, Neffen oder Großcousin hätte?«
Du weißt ja, dass ich viele Jahre meines Lebens darauf verwandt habe, meine Herkunft zu ergründen, Magdalene. Daher wirst du den Schock nachvollziehen können, den Vanderbilts nächste Worte mir versetzten.
»Ich spreche nicht von einem Onkel oder Großcousin. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um Ihren Vater.«
Es dauerte einige Sekunden, ehe die Farbe in mein Gesicht zurückkehrte. Als ich wieder Luft bekam, sprudelte es aus mir heraus: »Mein … mein Vater? Blödsinn! Ich habe meine Eltern nie kennengelernt! Woher …? Sind Sie sicher? Was hat er all die Jahre gemacht? Woran ist er gestorben?«
Ich wusste nicht, was ich angesichts dieser Offenbarung fühlen sollte. Vanderbilt war weit davon entfernt, mich von der Wahrhaftigkeit seiner Behauptung zu überzeugen. Doch selbst falls ich ihm geglaubt hätte … in mir rangen die verschiedensten Emotionen miteinander. Was der Notar anschließend erzählte, machte die Sache nicht gerade besser.
»Beruhigen Sie sich, Mr. Usher. Ihre aufbrausende Art ist eines Gentlemans nicht würdig. Ja, atmen Sie tief durch. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Besser. Also, um einige Ihrer Fragen zu beantworten: Ihr Vater hat zeit seines Lebens von Ihrer Existenz gewusst. Ja, er hat Sie sogar überwacht, könnte man sagen. Allerdings zwangen gewisse … Umstände ihn und seine Gattin dazu, sich Ihnen niemals zu offenbaren.«
»Seine Ga … Sie meinen meine Mutter?«
»In der Tat, ich spreche von Ihrer Mutter.«
»Aber … aber warum haben sie sich nie bei mir gemeldet? Weshalb waren sie nicht für mich da, als … als ich sie gebraucht hätte?«
Ich war drauf und dran, dem dürren Kerl an die Kehle zu springen. Die Vorstellung, dass die eigenen Eltern sich vor mir verborgen haben sollten … dass sie mich weggegeben hatten, in die zweifelhafte Obhut eines Heims … dass sie mich laut Vanderbilt mit meinem entbehrungsreichen und gepeinigten Leben alleingelassen hatten, obwohl Sie von meinen Problemen wussten … es war beinahe mehr, als ich ertragen konnte.
Der ausgemergelte Mann beugte sich vor und fixierte mich mit kühlem Blick. »Es ist nicht meine Aufgabe, die Motive Ihrer Eltern zu hinterfragen, Mr. Usher. Ich verwalte lediglich den Nachlass.« Einer seiner Finger pochte auf den Umschlag. Ich erwartete halb, dass er ihn mit dem dürren Ding aufspießen würde. »Und ich vermute, dass Sie an der Bedingung interessiert sind, die an die Übergabe des Nachlasses gebunden ist.«
»Bedingung?«
»Jawohl, es gibt eine Bedingung. Sie müssen wissen, dass Ihre Eltern durchaus an Ihrem Wohlergehen interessiert waren, denn Sie haben Ihnen eine nicht unerhebliche Summe vermacht. Zusätzlich liegt dem Scheck ein Schreiben Ihres Vaters bei, das, ich zitiere: ›… die Antworten auf viele berechtigte Fragen enthält, selbst wenn es unser Verhalten niemals wird entschuldigen können.‹ Klingt das interessant, Mr. Usher?«
Ich prustete: »Da fragen Sie noch? Nun öffnen Sie den verdammten Umschlag schon, Sie …«
Vanderbilts Zweig von einem Zeigefinger hob sich und wurde sanft geschwenkt. »Ich fürchte, derart einfach ist die Sache nicht. Da wäre noch die erwähnte Bedingung.«
Erneut griff er in die Schreibtischschublade. Als seine Hand wieder erschien, hielt sie ein Blatt Papier und einen Füllfederhalter umklammert. »Es obliegt mir, Ihnen diesen Kontrakt zu unterbreiten, Mr. Usher. Sollten Sie mit den Bedingungen des Vertrages einverstanden sein, werde ich Ihre Unterschrift notariell beglaubigen. Alsdann steht einer Übergabe des Nachlasses nichts mehr im Wege.« Er lächelte wölfisch.
»Kontrakt? Was zur …?«
Ich riss das Dokument an mich. Abgesehen von der Kopfzeile und den unleserlichen Unterschriften Vanderbilts und eines Mannes, bei dem es sich um meinen Vater handeln sollte, stand dort nur ein einziger Satz. Ich las ihn wieder und wieder, starrte minutenlang auf das Blatt Papier und wandte mich letztlich verstört an den menschlichen Geier, der mir gegenübersaß.
»Weshalb sollte er wollen, dass ich das tue?«
Vanderbilt zuckte mit den Achseln – spitze Schulterknochen durchbohrten nahezu das Jackett. »Ich weiß es nicht, Mr. Usher. Wie gesagt ist es nicht meine Aufgabe, die Motive …«
Ich hörte schon nicht mehr hin, sondern klebte wieder an dem Vertrag. Vor meinen ungläubigen Augen prangte der Satz, jener einzelne Satz, der etwas so anscheinend Sinnloses von mir forderte. Ich wünschte heute bei Gott, ich hätte ihn tatsächlich befolgt.
Das Schriftstück verlangte in unmissverständlichem Tonfall:
Verbrenne unser Haus sowie sämtliche Besitztümer, die sich darin befinden.
»Woher weiß ich, dass das kein Scherz ist? Haben Sie einen Beweis dafür, dass dieses Schreiben tatsächlich von meinem leiblichen Vater stammt?«
Vanderbilts Finger krochen in die Innentasche seines Sakkos. Kommentarlos legte er eine Fotografie vor mir ab. Sie zeigte zwei Personen, eine männlich, eine weiblich. Ich hatte beide noch nie gesehen. Und doch erkannte ich sie sofort.
Irgendwann griff ich mit tauben Fingern nach dem Füllfederhalter und kritzelte meinen Namen auf das Papier. »Wie lange habe ich Zeit?«, murmelte ich.
»Der Vertrag ist an keinerlei Fristen gebunden, Mr. Usher.«
»Woher wollen Sie wissen, dass ich es auch wirklich getan habe?«
»Geben Sie mir Bescheid, sobald die Bedingung erfüllt ist. Ich werde anreisen und die Ruine in Augenschein nehmen.«
»Kann ich mir das Haus zuerst ansehen, bevor ich es in Brand stecke?«
»Auch hierzu beinhaltet der Vertrag keine Klausel. Es steht Ihnen frei zu tun, was Sie möchten. Aber ich kann Ihnen den Scheck erst aushändigen, wenn das Gebäude ein Raub der Flammen geworden ist.«
Konnte ich es einfach zerstören? Durfte ich das? Es mochte so viele Dinge beinhalten, die mir etwas über meine Eltern sagen konnten. Über sie und über die Art, wie sie gelebt hatten. Und vielleicht auch darüber, weshalb ich an diesem Leben nicht hatte teilhaben dürfen. Ich musste es zuerst untersuchen, Vertrag hin oder her.
»Allerdings«, fügte Vanderbilt plötzlich an, »sollten Sie wissen, dass der Sinn des Kontrakts eindeutig darin besteht, Sie von dem Haus und den Dingen darin fernzuhalten. Was auch immer Ihre Eltern getan haben, sie möchten nicht, dass es an die Öffentlichkeit gelangt. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie schlicht tun, worum Sie gebeten wurden.«
Ich schüttelte den Kopf. »Geben Sie mir die Adresse. Wir sehen uns in ein paar Tagen.«
Vanderbilt seufzte. »Ganz wie Sie wünschen.«
Noch ein Stück Papier wechselte den Besitzer. Ich wollte schon aufstehen und das Büro verlassen, als mir eine Idee kam. »Was ist mit dem Brief? Bekomme ich den ebenfalls erst, wenn das Gebäude nicht mehr steht?«
»So sieht es der Vertrag vor, Mr. Usher.«
»Aber es ist doch nur ein Brief. Eine simple Nachricht. Verglichen mit dem Rest des Erbes nahezu wertlos.«
»Tut mir leid, Mr. Usher, aber …«
»Auf welche Summe beläuft sich das Erbe?«
Unfassbar, dass mir diese Frage erst jetzt in den Sinn kam, was? Aber wie ich inzwischen weiß, verkommt Geld angesichts privater Verluste und eines Mahlstroms unterschiedlichster Gefühle endgültig zur Nebensache.
Ohne mit der Wimper zu zucken, entgegnete Vanderbilt: »Rund zehn Millionen Dollar.«
Ich schluckte. »Na schön. Wenn Sie mir den Brief jetzt sofort aushändigen, können Sie zehn Prozent der Summe zu Ihrem Honorar addieren. Wie klingt das für Sie?«
Der Notar sagte lange nichts. Seinem Pergamentgesicht war keinerlei Emotion zu entnehmen. Schließlich griff er abermals in einige Schubladen und setzte ein neues Schriftstück auf. Ich unterzeichnete an der Stelle, die er mir zeigte, worauf er lächelnd verkündete: »Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Usher.«
Und so bekam ich den Brief.
- Ein Brief und ein Geständnis -
Mein Sohn,
da du dies liest, hast du meinem letzten Wunsch entsprochen und getan, was ich nie konnte. Vielen Dank! Ich bin mir sicher, dass du dir nun viele Fragen stellst. Mit etwas Glück legt sich deine Verwunderung jedoch bald, denn dieses Schreiben enthält die Antworten auf viele berechtigte Fragen, selbst wenn es unser Verhalten niemals wird entschuldigen können.
Zunächst möchte ich dir eines versichern: Deine Mutter und ich haben dich stets geliebt. Vermutlich wirst du dies angesichts deines schwierigen Lebensweges kaum glauben, doch wir konnten unserer Zuneigung am ehesten Ausdruck verleihen, indem wir dir fernblieben. Du musst wissen, dass wir uns mit einer recht seltsamen und gefährlichen Angelegenheit befasst haben. Diese Angelegenheit war es, derentwegen wir dich der Obhut eines Heims überließen. Und sie ist der Grund für das verfrühte Ableben deiner Mutter. Was mich angeht, so plane ich zwar, meinem Leben selbst ein Ende zu setzen, doch wird dafür letztendlich auch die erwähnte Angelegenheit verantwortlich sein.
Wovon ich spreche, brauchst du nicht zu wissen. Die Sache könnte dich genauso vereinnahmen, wie sie es mit uns getan hat, und das möchte ich mit aller Macht verhindern. Du hast unser Haus vernichtet, was hoffentlich bedeutet, dass du niemals erfahren wirst, was wir in jenem gottverlassenen Dorf gesucht haben. Gräme dich jetzt nicht, denn es war das einzig Richtige, alles zu verbrennen. Ich weiß das seit langer Zeit, doch war die Obsession stets stärker als mein Wille, das Rechte zu tun.
Lass mich dir sagen, dass du von edlem Geblüt bist, Junge. Dein Ur-Ur-Urgroßvater war der Graf von Coldlowe, damals, in der alten Heimat. Der Titel ist inzwischen freilich bedeutungslos geworden, allerdings sorgte der Reichtum der Coldlowes dafür, dass die Nachkommen des Grafen stets in Wohlstand leben und zahlreiche Annehmlichkeiten genießen konnten. Ich hoffe, dass du trotz deiner Krankheit und den damit verbundenen Strapazen deine edle Abstammung spüren konntest. Die Coldlowes sind ein nobles Geschlecht, voller Würde, Kraft und Hartnäckigkeit; und es würde mich mit Stolz erfüllen, in dir diese Eigenschaften fortbestehen zu sehen. Allerdings solltest du die Coldlowe’schen Tugenden auf andere Ziele als die Enträtselung unserer Geheimnisse richten. Es ist nun alles Asche, und so soll es auf ewig bleiben.
Leider war es notwendig, dass der Waisenknabe, zu dem wir dich machten, namenlos war. Ansonsten wärest du uns mit Sicherheit auf die Schliche gekommen. Eine Spende an das Heim sorgte dafür, dass dein neuer Name einigermaßen wohlklingend war. Und was das Vermögen der Coldlowes angeht … ich fürchte, meine verbissene Suche hat einen großen Teil davon verschlungen, doch es sollte genug übrig sein, um den Rest deines Lebens weniger strapaziös und unangenehm werden zu lassen als die vergangenen Jahre.
Ich möchte es noch einmal in aller Deutlichkeit sagen: Lass unsere Suche ruhen! Sie hat deinen Großvater in den Wahnsinn getrieben, deine Mutter aufgefressen und mich die Pistole laden lassen, die während des Schreibens neben mir liegt. Ich bekomme es nicht aus meinem Kopf, verstehst du? Es hat von mir Besitz ergriffen, darum war es mir unmöglich, die Früchte meiner Arbeit selbst zu vernichten und ich musste dich damit belasten.
Deine Mutter und ich fühlten uns wie Schatzjäger, doch war der Pfad zu tückisch für uns. Was wir gesucht haben, ist nicht für eines normalen Menschen Hand bestimmt. Es schadet dem Geist. Deine Krankheit wurde von dem Ding hervorgerufen, und das, obwohl wir ihm nie wirklich nahe waren. Es hat deinen unreifen Verstand vergiftet, während er sich im Mutterleib entfaltete. Und weil wir selbst nach deiner Geburt nicht von der Sache lassen konnten, mussten wir dich hergeben. Verstehst du? Du wärest ansonsten längst tot. Wir taten es, um dich zu schützen.
Diese Sache … sie ist das Schönste und zugleich Schrecklichste, das ein Mensch sich vorzustellen vermag. Freundschaften wurden dafür beendet, Herzen gebrochen, Leben genommen. Und nichts hat die Suchenden ihrem Ziel näher gebracht.
Es würde dich ebenfalls vernichten. Also lass die Sache ruhen. Kehre niemals in das Dorf zurück und erzähle niemandem davon. Am besten verbrennst du auch diesen Brief.
Ich werde nun die erste edle und richtige Tat seit vielen Jahren vollbringen. Und gleichzeitig wird es meine letzte sein.
Ich wünschte, ich hätte den Mut gefunden, dir in die Augen zu sehen, während ich dir dies alles berichte.Vergib uns.
Frederick von Coldlowe
***
Du kannst dir sicher vorstellen, wie sehr mich die Lektüre dieses Schreibens bestürzte, Magdalene. Zwar war ich noch immer nicht vollkommen überzeugt davon, der Adressat des Textes zu sein, doch waren meine Zweifel hinlänglich ausgeräumt, um mich tiefes Mitgefühl, eine gewisse Befriedigung, Sorge und Wut gleichermaßen verspüren zu lassen.
Ob dieser Frederick mein Vater war oder nicht (die Fotografie war ein starker Beweis, doch geschickte Fälschung vermag selbst das geschulteste Auge zu täuschen), er tat mir aufrichtig leid. Man musste kein Hellseher sein, um seine Todesursache zu erraten. Er hatte sich selbst erschossen – und der verfrühte Tod seiner Frau hatte allem Anschein nach nicht unerheblich zu dieser Entscheidung beigetragen. Er hatte sein Leben einer ausweglosen Sache verschrieben, und diese Sache hatte ihn am Ende vernichtet. Es las sich wie eine griechische Tragödie.
Falls ich tatsächlich sein Sohn war, so war ich einerseits wütend auf ihn – weil er mich verstoßen, mir die elterliche Liebe vorenthalten hatte –, andererseits flößte mir die Vorstellung, ich könnte von adeliger Abstammung sein, auch Stolz ein. Hatte ich nicht mehr erduldet als die meisten Menschen? War ich nicht erhobenen Hauptes aus jeder Katastrophe hervorgegangen? Mein Geist ist krank, doch ich war stets bemüht, die Gewalt über mein Leben nicht aus der Hand zu geben. Und zu jenem Zeitpunkt hatte ich die Kontrolle. Die Dämonen waren gebändigt. Waren es die Coldlowe’schen Tugenden, die mich dies hatten vollbringen lassen?
Selbstverständlich plagte mich das schlechte Gewissen, weil ich den Brief verfrüht geöffnet hatte. Doch barg diese Verfehlung eine gewaltige Chance. Mein vermeintlicher Vater sprach von Geheimnissen, machte Andeutungen, die so erschreckend und zugleich verlockend klangen …
Du kennst mich, Magdalene. Du weißt, wie neugierig ich immer war. Nichts quält mich mehr als ein hübsch verpacktes Geschenk, dessen Inhalt ein Mysterium für mich darstellt. Und hätte mein vermeintlicher Vater mehr über mich gewusst, er hätte mit Sicherheit ein weniger rätselhaftes Schreiben aufgesetzt. Schon während des Lesens war mir klar, dass ich das Haus wie geplant untersuchen würde. Verbrennen konnte ich es auch später, weder das Gebäude noch Vanderbilts Scheck würden davonlaufen. Ich musste einfach erfahren, was so magnetisch an den Menschen gesogen hatte, die vorgaben, mich gezeugt zu haben.
Mein Koffer war ohnehin gepackt, ein Busticket rasch gekauft. Am Nachmittag des nächsten Tages erreichte ich das Dorf.
- Eine Ortschaft und eine Düsternis -
Meine Nasenspitze kribbelte, als ich den Bus verließ; vermutlich platzten in der dünnen Luft einige Blutgefäße. Der Fahrer machte keinen Hehl daraus, dass er die Gegend schnellstmöglich wieder verlassen wollte. Ich war der letzte Fahrgast gewesen, niemand sonst wagte sich so weit in das Mittelgebirge vor. Die Haltestelle wurde nur bei Bedarf angesteuert – und der bestand nicht häufig. Kaum hatte ich zwei Schritte getan, wendete das Vehikel hinter mir bereits und ruckelte den ausgeschlagenen Weg hinab.
Der Pfad führte einen oder zwei Kilometer durch den Wald. Es war düster, die Luft klamm und kalt. Der Wind strich mit Rasierklingen über meine Wangen. Während ich den Koffer zwischen den Stämmen dahinschleppte, sann ich darüber nach, ob ich mich vor wilden Tieren in Acht nehmen musste. Wölfe und Bären sind selten geworden, doch schien diese raue und abgelegene Gegend gutes Terrain für große Räuber zu sein. Ich kam allerdings rasch zu dem Schluss, dass mir keine Gefahr drohte, denn allem Anschein nach gab es in meiner Nähe überhaupt keine Tiere. Der Wald war vollkommen still, wenn man von den im böigen Wind raschelnden Nadeln absah. Kein Vogel zwitscherte, kein Insekt summte. Ich fragte mich, woran das liegen mochte. Es war kalt, doch hatte der Winter selbst hier oben noch nicht Einzug gehalten. Etwas anderes musste die Gegend entvölkert und zum Verstummen gebracht haben.
Je intensiver ich lauschte und mich konzentrierte, desto mehr glaubte ich, doch etwas auszumachen: ein nahezu unmerkliches Brummen. Eine Schwingung in einer Frequenz, die das Ohr eines alten Mannes nicht erfassen könnte. Etwas schien in der Luft zu liegen, ein unfassbares und unangenehmes Ding, eine Präsenz, die sich über das Land breitete und alles in erstickendes Schweigen hüllte …
Und dann war mir, als würde die Schwingung in einer bestimmten Richtung stärker werden, so als stünde dort die Quelle des Brummens. Ein Sender oder etwas Ähnliches. Mein Blick heftete sich auf die Bergspitze, die über den Bäumen vor mir aufragte.
»Unsinn!«, schalt ich mich und blinzelte energisch. Ich habe oft genug miterlebt, wie mein Verstand mir Traumbilder vorgaukelte. Man hat mir immer wieder erklärt, was real ist und was nicht. Wenn die Worte der Ärzte nicht ausreichten, griff man zur Übermittlung der Botschaft auf Medikamente und Elektroschocks zurück. Ich habe gelernt, zwischen der Wirklichkeit und meinen Fantasien zu unterscheiden. Und ich hatte mir geschworen, nicht noch einmal von Letzteren irregeleitet zu werden.
Also zwang ich mich, die fremdartige Schwingung zu ignorieren. Gewiss gab es ganz natürliche Erklärungen dafür. Wenn ich in wenigen Stunden meine Medikamente nahm, wäre alles wieder in Ordnung.
Insgeheim wunderte ich mich aber, denn diese Ausgeburt meines kranken Verstands hätten nach ihrer Entlarvung eigentlich verschwinden müssen. So hatte man es mir beigebracht. Doch hier, in den Bergen, in der feuchten Kälte, blieb alles bestehen.
Schließlich erreichte ich die Siedlung. Nie hatte sich mir ein bedrückenderer Anblick geboten. Das Dorf sank gegen den Gipfel eines Berges (von denen es in Neuengland jede Menge gibt, also bitte: Mach dir keine Mühe, Magdalene). Es schien sich ängstlich in seine Ecke zu kauern, um den Nebeln, die es bedrängten, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Mir war, als würde die Feuchtigkeit den Großteil des Sonnenlichts verschlucken. Stete Düsternis hielt die schiefen Hütten umklammert und legte sich bleiern auf mein Gemüt. Wie ich inzwischen weiß, wird es in den schlammigen Gassen niemals wirklich hell, selbst an Tagen, an denen sich die Schleier lichten.
Die Bezeichnung »Dorf« war beinahe zu hoch gegriffen. Vielleicht ein Dutzend Gebäude stand gegen die Flanke des Berges gewürfelt, und kaum eines von ihnen war bewohnbar. Die meisten Fenster waren vernagelt, der Großteil der Dächer zumindest teilweise abgedeckt, viele der Mauern rissig oder eingestürzt. Moose und Flechten überzogen alles mit feuchtem Filz. Die Straße, die sich durch das Bild des Verfalls wand, war unbefestigt. Lehmiger Boden schmatzte unter meinen Schuhen, als ich diesen Bretterfriedhof betrat.
Keine Menschenseele war zu sehen. Fußspuren vermisste ich ebenso wie aus Schornsteinen aufsteigende Rauchfahnen. Alles wirkte verlassen. Befand ich mich in einer Geisterstadt?
Aber halt, da war etwas! Ein Geräusch. Es kam von vorn, wo der Weg eine scharfe Biegung beschrieb. An dieser Ecke stand ein Haus, das nicht ganz so heruntergekommen wirkte wie die anderen.
Als ich schließlich begriff, was ich da hörte, umfasste ich den Griff meines Koffers fester. Es war ein Knurren. Tief, grollend und feindselig.
Ich zögerte. Lebten hier doch Raubtiere?
Natürlich hätte ich umkehren können. Aber die geplante Erforschung des Heims meiner vermeintlichen Eltern erforderte, dass ich weiterging. Bislang hatte keine der verfallenden Ruinen die richtige Hausnummer getragen. Und wenn ich mein Erbe haben wollte, musste ich mich gleichfalls weiter vorwagen – schließlich kann man aus der Ferne kein Gebäude in Schutt und Asche legen, zumindest nicht mit Mitteln, die mir zugänglich sind.
Also setzte ich tapfer einen Fuß vor den anderen. Zwei Schritte, dann fünf. Zehn.
Das Knurren erstarb.
Ich lächelte. Die Siedlung war also doch nicht gänzlich verlassen. Dort vorne lebte sicherlich jemand, und diese Person besaß einen Hund, der eben sein Revier abgesteckt hatte. Die ungewohnte Umgebung musste sich nachteilig auf meine Psyche auswirken, wenn mich so etwas alltägliches dermaßen aus der Fassung …
Plötzlich kam er um die Ecke geschossen. Seine Zunge wehte bei jedem Satz neben ihm her wie eine Standarte. Das Maul war weit aufgerissen, die Zähne darin gebleckt. Oh ja, es war ein Hund. Ein Exemplar von der Größe eines Kalbs. Er hatte kurzes, in verschiedenen Brauntönen geschecktes Fell, einen schlanken, muskulösen Körper und bösartige, rote Augen. Und er kam direkt auf mich zu.
Im letzten Moment riss ich den Koffer empor. Ich hielt ihn zwischen mich und das tierische Projektil, das sich auf mich zu bohrte. Der Aufprall trieb mir die Luft aus den Lungen und warf mich auf den Rücken. Kalter Schlamm drang mir in die Kleidung. Ehe ich Atem schöpfen konnte, war das Tier schon wieder heran. Speichelflocken troffen von seinen Lefzen, als es nach meinem Gesicht schnappte. Reflexartig hob ich den linken Arm. Spitze Zähne wurden von kräftigen Kiefern in mein Fleisch getrieben. Ich brüllte vor Schmerzen, wand mich und verteilte blindlings Faustschläge. Doch der Hund hielt meinen Unterarm fest umklammert und riss mit solch gewaltiger Kraft daran, dass er meinen Körper durch den Morast schleifte. Mir stieg der Geruch des Tiers in die Nase: animalisch, moschusartig, vermischt mit dem Gestank von verwesendem Fleisch, der seinem Rachen entströmte.
Mir schwanden die Sinne. Wie von fern hörte ich eine Stimme krächzen: »Boxer! Was tust’n da, um Himmels will’n?«
Mein Hinterkopf prallte immer wieder auf den Boden. Wäre der Weg trocken und fest gewesen, hätte ich wohl schon längst das Bewusstsein verloren.
»Boxer, aus! Hörst du nich, dummes Vieh? Lass den Mann los, verdammt!«
Die Erfahrung rettete mich. Wer lange Jahre in Nervenheilanstalten verbracht hat, musste zwangsläufig einige Kämpfe mit unberechenbaren und gefährlichen Gegnern überstehen. Ein Mann kann jegliche Menschlichkeit verlieren und mit bestialischer Gewalt toben, wenn der Wahnsinn ihn packt. Diese Begegnungen haben einen effektiven, sich unorthodoxer Methoden bedienenden Kämpfer aus mir gemacht. Man erfreut sich nicht lange guter Gesundheit, wenn man versucht, einem Irren im fairen Kampf gegenüberzutreten.
Meine Rechte tastete sich am Bauch des Untiers entlang. Es zerrte noch immer an meinem Arm, höllische Schmerzen tobten darin. Ich spürte, wie die Wunden weiter aufrissen und erschreckende Mengen an Blut freisetzten. Und dennoch schob ich die Hand tiefer, bis ich schließlich zu fassen bekam, wonach ich gesucht hatte. Zu meinem Glück handelte es sich bei dem monströsen Hund um ein männliches Exemplar. Rasch drückte ich zu, so fest ich konnte.
Augenblicklich verwandelte sich das Grollen über mir in schrilles Wimmern. Die Zähne lösten sich aus dem Arm, der Druck wurde von mir genommen. Humpelnd und mit eingezogenem Schwanz stahl sich das Tier davon.
Ich wollte mich aufrichten, doch der Schwindel war zu stark. Kraftlos sank ich zurück in den Morast.
Wieder erklang die Stimme, näher diesmal. »Um Himmels will’n, geht’s Ihnen gut? Wir müss’n Ihren Arm verbinden. Lass’n Se sich aufhelfen, junger Mann! Er is‘ sonst’n ganz friedlicher, mein Boxer. So is‘ er eigentlich nur zu …«
Ein weibliches, wettergegerbtes Gesicht schob sich über mich. Die grauen Haare waren mit Nadeln zu einem Knoten hochgesteckt, die Nase knollenartig, die Augen gelb, durchzogen von einem Netzwerk roter Äderchen und gesäumt von dunklen Ringen. Als ich nun gemustert wurde, weiteten sie sich entsetzt.
»Sie … Sie sind einer von denen. Sie sind‘n Coldlowe!« Es klang wie eine Anschuldigung. »Bei Gott, Sie sind’n Coldlowe. Und ich hatt‘ gedacht, ‘s wär vorbei …«
Mein Arm schmerzte noch immer, als würde er in Flammen stehen. Ich stöhnte. Das brachte die Alte anscheinend wieder zu sich. Sie schüttelte energisch den Kopf, beugte sich ganz zu mir herab und legte mir den Arm um die Schultern, um mir aufzuhelfen.
»Egal wer Sie sind, komm’n Se ers‘ mal mit. Mein Hund hat Sie verletzt, und ich muss jetzt zuseh’n, dass ich Sie verarztet bekomm‘.«
***
Eine halbe Stunde später waren meine Wunden ausgewaschen, mit einer dubiosen Kräutersalbe bestrichen und verbunden. Mein Kreislauf hatte sich stabilisiert, doch bestand die Alte darauf, dass ich noch für einige Minuten auf ihrer Bank liegenblieb.
Das Haus war einfach, die Möbel spärlich und altmodisch. Um mich aufzuwärmen, prasselten einige Holzscheite im Kamin. Meine Gastgeberin redete auf mich ein, während sie emsig umherhuschte.
»Glück ham Se gehabt. Wie’s aussieht, brauchen wir Nadel und Faden nich‘. Sei’n Se froh, dass Sie so nen dicken Mantel anhatten. Ich wasch‘ Ihre Sachen, das mach‘ ich. Und wenn alles wieder trocken ist, näh‘ ich die kaputten Stellen. Rühr’n Se sich nich‘, dann mach‘ ich Ihnen gleich noch ne Suppe. Sie müss’n ja ganz durchgefroren sein.«
Die Aussicht auf ein warmes Mahl erleichterte mir das Stillhalten erheblich. Ich besah mir die Frau genauer. Sie schien alt zu sein, allerdings war etwas an der Art ihrer Gebeugtheit, das nicht von den Lebensjahren herrührte. Eine Last schien ihr auf der Seele zu liegen. Selbst langjährige und harte körperliche Arbeit kann nicht solch tiefe Sorgenfalten reißen.
»Wie … wie heißen Sie, gute Frau?«
»Pickman. Das is‘ mein Name, Mister.«
»Mrs. Pickman?«
»Jawohl, Gott is‘ mein Zeuge!«
Ich war erfreut, glaubte ich nun doch, dass sich noch mindestens ein dritter Mensch in dem Dorf aufhielt.
»Wo ist Mr. Pickman?«
Die krumme Gestalt versteifte sich. Die Hände, die eben noch eifrig mit dem Waschzuber beschäftigt gewesen waren, stellten die Arbeit ein.
»Er … er is‘ fort«, murmelte sie schließlich. »Gestorben.«
»Das tut mir leid«, versuchte ich meinen Fehltritt zu korrigieren. »Ich … es …«
Sie warf mir einen seltsamen Blick zu, irgendwie lauernd und abschätzend. »Wenn’s Ihnen wirklich leid tut, warum sind Se dann hier?«
»Wie meinen Sie das?«
Nun stand sie auf, streifte die nassen Hände an der Schürze ab und kam zu mir herüber. Sie sah mir in die Augen, als sie fragte: »Woll’n Se mir erzähl’n, Sie wüssten nich‘, was meinen Butch geholt hat? Sie und Ihre Sippe wiss‘n darüber doch mehr als jeder and’re.«
»Ich … nein, ich weiß nichts. Wovon sprechen Sie, Mrs. Pickman?«
Sie stemmte die arthritischen Hände in die Hüften. »Am Besten erzähl’n Sie jetzt erst mal mir, was Se hier woll’n. Dann überleg‘ ich mir, was ich Ihnen alles sagen werd‘.«
Also berichtete ich ihr von dem Testament und dem Schreiben, von meiner Absicht, das Haus zu durchsuchen, um es anschließend zu verbrennen und von den Zweifeln bezüglich meiner Abstammung.
Sie lauschte beinahe andächtig und versicherte mir schließlich: »Glauben Se’s ruhig, junger Mann. Sie sind Ihr’s Vaters Sohn, das seh‘ ich sofort. Und wenn Sie wirklich die Wahrheit gesagt ham, helf‘ ich Ihnen gern.«
Ich war mehr als verblüfft. »Sie haben nichts dagegen, dass ich das Haus verbrenne?«
»Nein, nich‘ mal’n Stück. Aber ich find’s nich‘ gut, dass Se sich noch umsehen woll’n. Was Ihre Eltern hier gemacht ham, is nich‘ gut, junger Mann. Zerstör’n Sie alles und verschwind‘n Se wieder.«
»Tut mir leid, das kann ich nicht. Würden Sie einfach die Gelegenheit verstreichen lassen, etwas über Ihre Familie zu erfahren? Eine Familie, die Sie nie kennenlernen durften?«
Sie seufzte. »Da ham Se wohl Recht. Aber trotzdem sollt‘ das, was Ihre Leut‘ hier über die Jahre getrieb’n ham, besser vergessen sein.«
»Darf ich fragen, warum Sie das Haus nicht längst selbst zerstört haben? Es scheint mir, als könne Ihnen seine Vernichtung gar nicht früh genug kommen.«
Sie blickte betreten zu Boden und rang die Hände.
»‘s ist nich‘ so einfach, junger Mann. Seh’n Se, ich darf nichts unternehm‘n gegen die Dinge, die Ihre Familie gemacht hat. ‘s würd mich sonst strafen, mich hol’n …« Ihre Stimme wurde zu einem unverständlichen Murmeln.
»Sie holen? Wovon sprechen Sie?«
Plötzlich gab sich die Alte einen Ruck. Sie setzte ein gezwungenes Lächeln auf. »Ach, hör’n Se nich‘ auf mich, junger Mann. Dummes Bauerngewäsch von ner alten Schachtel, nichts weiter. Durchsuchen Se Ihr Haus! Ich geb‘ Ihn’n gern ‘n paar Lebensmittel, damit Sie ersma über die Runden komm‘n. Und wenn Sie soweit sind, geb’n Se mir Bescheid und wir leg’n das prächtigste Feuerchen, das dies‘ Dorf je geseh’n hat!«
- Ein Heim und eine Entdeckung -
Kurz darauf geleitete mich Mrs. Pickman zum Haus meiner Eltern – ja, meiner Eltern. Ich muss zugeben, dass sich die Zweifel beinahe verflüchtigt hatten. Wenn sogar diese hinterwäldlerische Bauersfrau mich erkannte … es musste schon mit dem Teufel zugehen, sollte ich kein Coldlowe sein.
Das letzte Licht schwand, als ich zum zweiten Mal an diesem Tag über den schlammigen Pfad stapfte. Ich trug eine Decke um die Schultern, die einstweilen meinen Mantel ersetzen sollte. Die Kälte, die aufgrund der nahenden Finsternis in mir aufstieg, war jedoch nicht durch ein Kleidungsstück zu bezähmen.
»Außer mir lebt hier sons‘ keiner mehr«, krächzte die Alte. »Se sind alle fort, und wahrscheinlich isses auch besser so.«
Die Sonne war längst hinter dem Berg verschwunden, das Zwielicht besaß eine nahezu greifbare Präsenz. Ein eisiger Wind pfiff mir um die Ohren. Er roch nach nahendem Winter, entmutigend und hoffnungslos.
Ich nickte. »Mit diesem Ort scheint etwas nicht … es ist, als wäre er …«
Mrs. Pickman gurrte energisch, ein Geräusch, das wohl Zustimmung signalisieren sollte. »Als wär’s was Böses, nicht? Verderbt. Sehn’n Se nur zu, dass Sie bald wieder verschwinden. ‘s gibt schönere Flecken auf der Welt.«
»Weshalb sind Sie noch hier?«
Sie lachte schnarrend. »Wo sollt‘ ein altes Ding wie ich schon hin?«
Während sie vor mir herging, murmelte die Alte weiter. Sie redete so leise, dass sie glauben musste, ich würde sie nicht mehr hören. Vielleicht war sie sich auch nicht bewusst, die Worte tatsächlich auszusprechen. »Außerdem gilt’s, Aufgaben zu erfüll’n. Verträge sind‘s, alte Bande. Unheil, das droht, wenn ich nicht bleib‘ ...«
Mehr verstand ich nicht. Aber das Gehörte reichte aus, um mich noch stärker frösteln zu lassen.
Seit ich mich im Freien befand, vernahm ich auch wieder die rätselhafte Schwingung. Sie brummte unablässig und lenkte meine Aufmerksamkeit wie magisch in Richtung des Gipfels.
»Was ist das eigentlich für ein Geräusch?«
Mrs. Pickman zögerte eine Spur zu lange. »Was meinen Se denn?«
»Dieses Surren. Es kommt von dort oben.«
Ich deutete den Hang hinauf. Die Alte sah kurz hin, riss den Blick dann aber förmlich von der Bergspitze. Sie bekreuzigte sich mit einer schnellen Bewegung und murmelte etwas Unverständliches. Eine knotige Hand ergriff meinen unverletzten Arm und zog mich weiter den Weg entlang.
»Ach, hier lieg’n allerlei seltsam Ding‘ in der Luft. Der Wind pfeift um die Gipfel und hört sich bös‘ an. Machen Se sich keine Gedanken, junger Herr.«
Sie war keine sonderlich talentierte Lügnerin, doch ich beschloss, das Thema vorerst ruhen zu lassen. Stattdessen widmete ich meine Aufmerksamkeit Mrs. Pickmans Hund, der hinter einer Häuserruine hervortrabte und sich uns anschloss. Er machte keine Anstalten, mich erneut anzufallen, fletschte jedoch drohend die Zähne.
»‘s ist wegen Ihrer Abstammung«, krähte Mrs. Pickman. »Er riecht Coldlowe’sches Blut auf nen Kilometer gegen ’n Wind, mein Boxer. Konnt‘ Sie und Ihresgleich’n noch nie leiden.«
»Was hat er gegen uns?«
Ein tiefes Knurren antwortete mir. Scheinbar reichte schon meine Stimme aus, um das Vieh zu erzürnen.
»Boxer, aus!«, zischte Mrs. Pickman und hob drohend eine Hand. Das Knurren verstummte. »Ich glaub‘, er weiß irg’ndwie, dass die Coldlowes das Unheil übers Dorf gebracht ham. Wollten zwar alle nix Böses, doch isses durch sie erst wirklich schlimm hier geword’n.«
Ich blieb stehen. »Mrs. Pickman, wovon zum Teufel reden Sie? Was haben meine Eltern hier angestellt?«
»‘s waren nich‘ nur Ihre Eltern. Ihre Ahnen ham seit Generationen hier gelebt, zumindest immer für’n paar Monate im Jahr.«
»Und was haben sie getan?«
Sie schien kurz zu überlegen. Dann winkte sie ab. »Ach, das is‘ nun vorbei. Belasten Se sich nich‘ damit, tun Se, weswegen Sie hier sind und lassen Se die Vergangenheit ruh’n. Dies‘ Dorf wird schon bald vergessen sein und dann is‘ die Sache erledigt.«
Sie stapfte weiter. Ich rief: »Aber … Mrs. Pickman! Ich bestehe darauf, dass Sie …«
»Keine Antworten mehr«, schnarrte sie. »Spät ist’s geworden. Beeilen Sie sich, damit’s nich‘ unterwegs dunkel wird.«
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass in dem gottverlassenen Dorf keinerlei Strommasten standen. Elektrizität gab es nicht, was bedeutete, dass nach Einbruch der Nacht alles in undurchdringliches Dunkel gehüllt sein würde.
Wir passierten eine trostlose Weide. Ausgemergelte Rinder zupften die wenigen grünen Halme aus der graubraunen Vegetation.
»Meine Tiere sind’s«, verkündete Mrs. Pickman stolz. »‘s ist nich‘ viel, aber ‘s reicht für ein bisschen Milch und nen ordentlichen Braten an den Feiertagen.«
Das Areal war dilettantisch eingezäunt. Einer gesunden Kuh wäre es ein Leichtes gewesen, die morsche Barriere zu durchbrechen. Doch diesen Tieren schien jeglicher Freiheitsdrang abhanden gekommen zu sein. Sie wirkten mehr tot als lebendig, während sie unendlich langsam wiederkäuten.
Nachdem wir auch den Stall der Rinder hinter uns gelassen hatten, ragte es endlich vor uns auf. Es war weit weniger heruntergekommen als die übrigen Gebäude an der Bergflanke, hätte inmitten einer modernen und florierenden Stadt aber trotzdem wie eine Ruine gewirkt. Der weiße Anstrich war großflächig abgeblättert, einige der Regenrinnen hingen schief herab, mehrere Fensterscheiben mussten zu Bruch gegangen sein, denn sie waren durch Planen verhängt. Trotz allem erfasste mich ein warmes, angenehmes Gefühl. Ob es an der Entdeckung eines beinahe einladenden Ortes inmitten der deprimierenden Umgebung lag oder daran, dass sich tief in meinem Innern eine Erinnerung regte, vermochte ich nicht zu sagen. Jedenfalls ging mir beim Anblick meines Zuhauses sofort das Herz auf.
»Boxer, du bleibst draußen!«, kommandierte Mrs. Pickman und sperrte die Tür auf.
Es war kein großes Gebäude. Zwei Stockwerke mit jeweils zwei Räumen, Küche und Wohnbereich unten, Schlaf- und Badezimmer oben. Altmodische Öllampen hingen an Haken in den Wänden und vertrieben schon bald die schlimmsten Schatten.
Mrs. Pickman kannte sich bestens aus. »Hab mich hier um alles gekümmert, seit Ihr Vater nich‘ mehr ist.«
Sie zeigte mir, wo die Schlüssel hingen, an welchen Orten Töpfe, Teller, Tassen und sonstige Utensilien zu finden waren und entfachte ein Feuer in dem Kamin im Wohnzimmer. Ein beruhigend großer Holzvorrat lagerte unter einem Vordach neben dem Haus, sodass ich mich vor der kalten Jahreszeit nicht zu fürchten brauchte. Einer der Küchenschränke enthielt Konserven, die von Mrs. Pickman noch durch frisches Gemüse, einige Eier und etwas Fleisch aus ihrer privaten Speisekammer ergänzt wurden. Als sie mich umsorgt wusste, verabschiedete sie sich – allerdings nicht, ohne mir für den kommenden Tag ihren Besuch anzukündigen.
»Dann können Se mir erzähl’n, ob Sie schon soweit sind – Se wissen schon.«
Zahlreiche Falten verschoben sich, als sie mir von der Tür aus zuzwinkerte, dann war sie fort.
Obwohl es recht spät war und ich einen langen und mehr als anstrengenden Tag hinter mir hatte, erfasste mich Tatendrang. Ich wirbelte durch die Zimmer, zog Planen von den Möbeln, untersuchte Schränke und Bücherregale und studierte die wenigen Bilder an den Wänden. Letztere waren insofern interessant, als sie sämtlich einen meiner Ahnen zeigten. Die Gesichtszüge der Coldlowes waren unverkennbar. Bei den ältesten der Bilder handelte es sich um Ölgemälde, an denen der Zahn der Zeit sichtlich genagt hatte, neuere Abbildungen waren Fotografien. Eine davon wagte es, nicht nur einen männlichen Coldlowe abzubilden, sondern auch dessen Partnerin. Es handelte sich um ein Paar, das mir von einer anderen Aufnahme noch gut im Gedächtnis haftete. Sie lächelten mich glücklich an. Hinter ihnen verlieh die tiefstehende Sonne einem mit Wurzeln überwucherten, südamerikanischen Tempel ein überirdisches Glühen. Neben der Frau steckte ein Spaten im Boden, mit dem sie wohl den Tonkrug ausgegraben hatte, den sie stolz auf dem Arm trug.
Wie es schien, waren Vater und Mutter Abenteurer und Altertumsforscher gewesen – ob nun beruflich oder als Hobby, vermochte ich freilich nicht zu sagen. Ich spürte meine Augenwinkel feucht werden und strich wehmütig mit dem Finger über die beiden Gesichter.
»Warum durfte ich nicht dabei sein?«, hauchte ich und wandte mich ab.
Ich rief mir ins Gedächtnis, dass ich nach Geheimnissen Ausschau halten wollte. Also suchte ich nach ungewöhnlichen Dingen – seltsame Gegenstände, Aufzeichnungen, Bücher … irgendetwas, das mir Aufschluss darüber geben konnte, was meine Familie über Generationen hinweg beschäftigt und ins Unglück gestürzt hatte.
Schon bald musste ich mir eingestehen, dass das Haus in dieser Hinsicht nichts Brauchbares liefern würde. Ich spähte unter sämtliche Möbelstücke, nahm die Bilder von den Wänden und rollte die Teppiche zusammen, um vielleicht ein Versteck zu finden. Das Gebäude war wie gesagt nicht groß und bot daher nur wenige Möglichkeiten, um brisantes Material zu verbergen. Selbst die kleine Bibliothek im Wohnzimmer enthielt nichts als einige Standardwerke und Groschenromane. Nach vielleicht einer Stunde gab ich es auf.
»Dieses Haus ist so harmlos wie ein Kätzchen«, murmelte ich frustriert. »Weshalb zum Teufel wollte Vater, dass ich es verbrenne?«
In einem der Vorratsschränke hatte ich eine Flasche Sherry gesehen. Ich entkorkte sie, goss mir reichlich ein, ließ mich in einen der Sessel im Wohnbereich fallen und spülte meine Medikamente hinunter. Als das Glas leer war, schleppte ich mich auf bleiernen Beinen zu dem Doppelbett im oberen Stockwerk, kroch hinein und schlief fast augenblicklich ein.
***
Es musste zu viel Sherry gewesen sein, denn meine Träume waren wirr und verstörend. Ich flog durch schwarze Schemen, inmitten derer sich weiß der Berg und das Dorf abzeichneten. Ein Leuchtfeuer wies mir den Weg um den Fels herum und leitete mich auf sanften Luftströmen zu einem Ding, das jenseits des Gipfels lag. Es waberte und verformte sich beständig, pumpte wie ein Herz und glühte wie ein Stück Kohle in der Esse. Ich konnte nicht erkennen, was es war, doch es sang zu mir, lockte mich, lud mich ein, umwarb mich … ich fühlte mich an die Sage von Odysseus erinnert und wünschte, ich könne mir wie er Wachs in die Ohren stopfen, um den Verlockungen der Sirenen zu entkommen. Ich nahm all meine Kraft zusammen, wandte mich ab und floh, flog wieder zurück zu dem weißen Dorf in der Schwärze …
Doch stattdessen fand ich mich an ein Bett gefesselt wieder, in einer Zelle mit gepolsterten Wänden. Einer Zelle, die ich in- und auswendig kannte, weil ich darin zahllose einsame Stunden verbracht hatte. Ich konnte die exakte Zahl der Flecken an der Decke benennen, wusste, wie viele Schritte der Raum längs und quer durchmaß und erinnerte mich nur zu gut an die Art, wie die Polsterungen den Schall dämpften. Ich war zurück in der Anstalt und das Entsetzen packte mich. Meine Finger krallten sich in die Matratze, mehrere Nägel rissen ab. Ich warf den Kopf in den Nacken und brüllte, brüllte …
***
Schreiend und schweißgebadet schrak ich hoch und sah nichts als Schwärze. Es musste mitten in der Nacht sein. Orientierungslos tastete ich um mich und fand endlich die Schachtel mit den Zündhölzern. Zitternd riss ich eines an und entdeckte in seinem flackernden Licht die Öllampe. Es dauerte einige Sekunden, bis ich mich hinreichend orientiert hatte. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, atmete langsam und tief durch … und wusste plötzlich des Rätsels Lösung.
»Die Abmessungen«, murmelte ich.
Ich sprang aus dem Bett, nahm die Lampe mit und begann, systematisch die Räume abzugehen, wobei ich meine Schritte zählte. Ich addierte jeden Fuß, den ich vor den anderen setzte. Als ich oben fertig war, begab ich mich ins Erdgeschoss und wiederholte den Vorgang. Und tatsächlich: im Wohnbereich, an einer Wand ohne Fenster, kam ich zweieinhalb Schritte zu früh zum Stehen. Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich den geschickt zwischen Brettern verborgenen Spalt entdeckt hatte. Ich tastete mich daran entlang, meine Finger fanden eine Vertiefung, fassten hinein und zogen. Ein hölzernes Klicken antwortete. Die Wand schwang mir in den Angeln entgegen. Ich streckte den Arm mit der Lampe aus und beleuchtete das Geheimnis des Hauses, während ich triumphierend ausrief: »Die Coldlowe’sche Hartnäckigkeit hat gesiegt!«