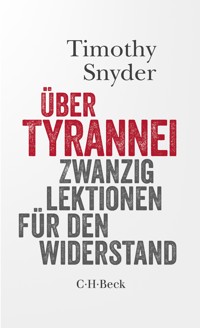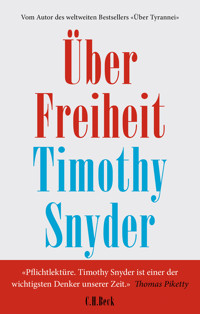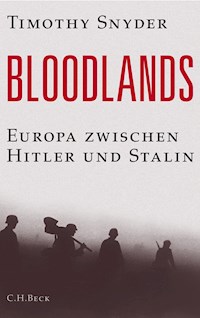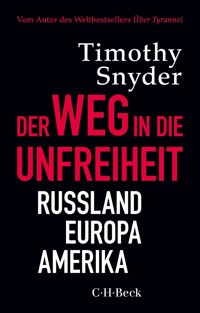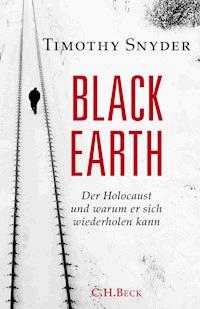9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Sprache: Deutsch
"Es war schon viel zu leicht, in diesem Land zu sterben, bevor das Coronavirus in die Vereinigten Staaten gelangte. Unser stümperhafter Umgang mit der Pandemie ist das jüngste Symptom unserer Krankheit, einer Politik, die Schmerz und Tod statt Sicherheit und Gesundheit bringt, Profit für einige wenige statt Wohlstand für viele."
Vom Autor des Nr. 1-Bestsellers “
Über Tyrannei” kommt eine vernichtende Kritik an Amerikas Reaktion auf die Corona-Pandemie. Timothy Snyder legt in seiner Analyse die Wurzeln des Übels frei. Sein Buch ist ein aufwühlender persönlicher Krankenbericht und zugleich eine dringende Warnung an uns alle, die Kommerzialisierung der Medizin zu verhindern und den Sozialstaat nicht aus der Hand zu geben.
Am 29. Dezember 2019 wurde der Historiker Timothy Snyder ernsthaft krank. Er konnte nicht mehr stehen, kaum noch klar denken und wartete stundenlang in der Notaufnahme, bevor er untersucht und eilig in den Operationssaal gebracht wurde. Während sein Leben an einem seidenen Faden hing und das neue Jahr begann, wurde ihm bewusst, wie profitorientiert das Gesundheitswesen in den USA ist und wie wenig alle Rechte und Freiheiten wert sind, wenn das Menschenrecht auf eine gute medizinische Versorgung nicht dazu gehört.
Dann kam die Pandemie. Die Regierung von Donald Trump machte alles noch viel schlimmer durch absichtliche Ignoranz, Desinformation und Machtspiele. Das Gesundheitssystem stand vor seinem ultimativen Test, und es versagte. Tausende von Amerikanern starben.
In diesem augenöffnenden Cri de Coeur rekonstruiert Snyder die sozialen Entwicklungen, die zu der aktuellen Lage geführt haben, und er beschreibt die Lehren, die daraus gezogen werden müssen. Er beleuchtet dunkle Momente der Geschichte und solche in seinem eigenen Leben, und er zeigt, welche vier Prinzipien beherzigt werden müssen, um von der “
amerikanischen Krankheit” geheilt zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Timothy Snyder
Die amerikanische Krankheit
Vier Lektionen der Freiheit aus einem US-Hospital
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andreas Wirthensohn
C.H.Beck
Zum Buch
«Es war schon viel zu leicht, in diesem Land zu sterben, bevor das Coronavirus in die Vereinigten Staaten gelangte. Unser stümperhafter Umgang mit der Pandemie ist das jüngste Symptom unserer Krankheit, einer Politik, die Schmerz und Tod statt Sicherheit und Gesundheit bringt, Profit für einige wenige statt Wohlstand für viele.»
Vom Autor des Nr. 1-Bestsellers Über Tyrannei kommt eine vernichtende Kritik an Amerikas Reaktion auf die Corona-Pandemie. Timothy Snyder legt in seiner Analyse die Wurzeln des Übels frei. Sein Buch ist ein aufwühlender persönlicher Krankenbericht und zugleich eine dringende Warnung an uns alle, die Kommerzialisierung der Medizin zu verhindern und den Sozialstaat nicht aus der Hand zu geben.
Über den Autor
Timothy Snyder ist Professor für Geschichte an der Yale-University und Autor der Bücher Bloodlands, Black Earth, Der Weg in die Unfreiheit und Über Tyrannei, die auf Deutsch alle im Verlag C.H.Beck erschienen sind. Für seine Arbeiten hat er u.a. den Hannah-Arendt-Preis und den Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung erhalten. Er gehört zu den führenden Intellektuellen in den Vereinigten Staaten.
Inhalt
Prolog: Einsamkeit und Solidarität
Einleitung: Unsere Krankheit
1: Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht
2: Erneuerung fängt bei den Kindern an
3: Die Wahrheit wird uns frei machen
4: Ärzte sollten das Sagen haben
Schluss: Unsere Genesung
Epilog: Wut und Empathie
Danksagung
Anmerkungen
Prolog: Einsamkeit und Solidarität
Einleitung: Unsere Krankheit
1. Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht
2. Erneuerung fängt bei den Kindern an
3. Die Wahrheit wird uns frei machen
4. Ärzte sollte das Sagen haben
Schluss: Unsere Genesung
Epilog: Wut und Empathie
Ich widme die deutschsprachige Ausgabe dieses Buches dem Gedenken an den Philosophen
Krzysztof Michalski (1948–2013)
und danke den Kolleginnen und Kollegen sowie dem Stab des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien, dessen Gründer er war.
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.
1. Korinther 13,12
Prolog: Einsamkeit und Solidarität
Als ich um Mitternacht in die Notaufnahme eingeliefert wurde, benutzte ich das Wort «Unwohlsein» (malaise), um dem Arzt meinen Zustand zu beschreiben. Mein Kopf schmerzte, meine Hände und Füße kribbelten, ich hustete und konnte mich kaum bewegen. Immer wieder wurde ich von Zitteranfällen heimgesucht. Der Tag, der gerade erst begonnen hatte, der 29. Dezember 2019, hätte mein letzter sein können. Ich hatte einen Abszess von der Größe eines Baseballs in der Leber, und die Infektion hatte sich in mein Blut ergossen. Damals wusste ich das noch nicht, aber ich wusste, dass etwas zutiefst nicht stimmte. Unwohlsein bedeutet natürlich Schwäche und Müdigkeit, ein Gefühl, dass nichts funktioniert und nichts getan werden kann.
Unwohlsein (malaise) ist das, was wir empfinden, wenn wir eine Krankheit (malady) haben. «Malaise» und «malady» sind gute alte Wörter aus dem Französischen und Lateinischen, die im Englischen seit Jahrhunderten verwendet werden; in Zeiten der Amerikanischen Revolution bedeuteten sie sowohl Krankheit als auch Tyrannei. Nach dem Massaker von Boston forderten prominente Bostoner Bürger in einem Brief ein Ende der «nationalen und kolonialen Krankheit». Die Gründerväter schrieben von malaise und malady, wenn sie über ihre eigene Gesundheit und die der von ihnen gegründeten Republik diskutierten.
In diesem Buch geht es um eine Krankheit – nicht um meine eigene, obwohl diese meine Krankheit mir geholfen hat, sie zu erkennen, sondern um unsere gemeinsame amerikanische Krankheit: «our public malady», um James Madison zu zitieren. Unsere Krankheit ist eine körperliche Krankheit, aber auch das politische Übel, das sie umgibt. Wir sind auf eine Art krank, die uns die Freiheit kostet, und auf eine Art unfrei, die uns die Gesundheit kostet. In unserer Politik geht es zu sehr um den Fluch des Schmerzes und zu wenig um die Segnungen der Freiheit.
Als ich Ende letzten Jahres krank wurde, dachte ich an die Freiheit. Als Historiker hatte ich zwanzig Jahre damit verbracht, über die Gräueltaten des 20. Jahrhunderts zu schreiben, über ethnische Säuberungen, den Holocaust der Nazis und den sowjetischen Terror. In letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, wie die Geschichte vor der Tyrannei in der Gegenwart schützt und wie sie die Freiheit für die Zukunft sichert. Das letzte Mal, als ich vor einem Publikum stehen konnte, habe ich einen Vortrag darüber gehalten, wie Amerika ein freies Land werden könnte. An diesem Abend hatte ich bereits Schmerzen, aber ich machte meinen Job, und dann ging ich ins Krankenhaus. Was folgte, hat mir geholfen, eingehender über die Freiheit und über Amerika nachzudenken.
Als ich am 3. Dezember 2019 in München am Rednerpult stand, hatte ich eine Blinddarmentzündung, die von den deutschen Ärzten übersehen wurde. Mein Blinddarm platzte, und meine Leber hat sich entzündet. Das wurde von den amerikanischen Ärzten übersehen. Und so landete ich am 29. Dezember in einer Notaufnahme in New Haven, Connecticut, als Bakterien durch meinen Blutkreislauf rasten und ich immer noch über die Freiheit nachdachte. Über drei Monate hinweg, zwischen Dezember 2019 und März 2020, machte ich mir in fünf Krankenhäusern Notizen und Skizzen. Es war leicht zu begreifen, dass Freiheit und Gesundheit miteinander zusammenhingen, als mein Wille meinen Körper nicht bewegen konnte und als mein Körper an Beuteln und Schläuchen hing.
***
Wenn ich mir die Seiten meiner Krankenhausjournale ansehe, die mit Kochsalzlösung, Alkohol und Blut befleckt sind, sehe ich, dass die New-Haven-Abschnitte aus den letzten Tagen des Jahres die starken Emotionen betreffen, die mich gerettet haben, als ich dem Tod nahe war. Heftige Wut und sanfte Empathie hielten mich am Leben und provozierten mich dazu, neu über Freiheit nachzudenken. Die ersten Worte, die ich in New Haven schrieb, waren «nur Wut, einsame Wut». Inmitten der tödlichen Krankheit habe ich nichts deutlicher und eindringlicher gespürt als Wut. Sie überkam mich nachts im Krankenhaus, verschaffte mir eine Fackel, die leuchtete inmitten von Formen der Dunkelheit, wie ich sie zuvor noch nie erlebt hatte.
Am 29. Dezember, nach siebzehn Stunden in der Notaufnahme, wurde ich an der Leber operiert. Als ich in den frühen Morgenstunden des 30. Dezember auf dem Rücken in einem Krankenhausbett lag, mit Schläuchen in Armen und Brust, konnte ich meine Fäuste nicht ballen, aber ich stellte mir vor, wie ich meine Fäuste ballte. Ich konnte meinen Körper nicht auf meinen Unterarmen aus dem Bett hieven, aber ich stellte mir in Gedanken vor, wie ich das tat. Ich war nur ein weiterer Patient auf einer weiteren Krankenhausstation, eine weitere Ansammlung versagender Organe, ein weiteres Gefäß voll infiziertem Blut. Aber ich fühlte mich nicht so. Ich fühlte mich wie ein bewegungsunfähiges, wutentbranntes Ich.
Die Wut war wunderbar rein, unbefleckt durch irgendeinen Gegenstand, auf den sie sich richtete. Ich war nicht wütend auf Gott; es war nicht seine Schuld. Ich war nicht wütend auf die Ärzte und die Krankenschwestern, unvollkommene Menschen in einer unvollkommenen Welt. Ich war nicht wütend auf die Fußgänger, die sich jenseits meiner Kammer aus verknäulten Laken und Schläuchen frei durch die Stadt bewegten, nicht auf die Lieferanten, die ihre Wagentüren zuknallten, nicht auf die Lastwagenfahrer, die lautstark hupten. Ich war nicht wütend auf die Bakterien, die sich an der reichen Gabe meines Blutes gütlich taten. Meine Wut richtete sich gegen nichts. Ich wütete gegen eine Welt, in der ich nicht war.
Ich wütete, also war ich. Die Wut warf ein Licht, das einen Umriss von mir offenbarte. «Der Schatten des Einsamen ist das Einzigartige», schrieb ich, reichlich rätselhaft, in mein Tagebuch. Meine Neuronen fingen gerade an zu feuern. Am nächsten Tag, dem 31. Dezember, begann sich mein Geist von der Sepsis und der Sedierung zu erholen. Ich konnte mehr als nur ein paar Sekunden am Stück denken. Mein erster ausgiebiger Gedanke galt der Einzigartigkeit. Niemand hatte sich jemals so wie ich durchs Leben bewegt und genau die gleichen Entscheidungen getroffen. Niemand verbrachte Silvester in genau der gleichen Situation und mit genau den gleichen Emotionen.
Ich wollte, dass meine Wut mich aus meinem Bett heraus und in ein neues Jahr führte. Vor meinem geistigen Auge sah ich meinen Leichnam, seine Verwesung. Die Vorhersehbarkeit des Verrottens war schrecklich. Es ist für jeden, der je gelebt hat, dasselbe. Was ich wollte, war Unvorhersehbarkeit, meine eigene Unberechenbarkeit und mein eigener Kontakt mit der Unvorhersehbarkeit anderer.
Ein paar Nächte lang war meine Wut mein Leben. Sie war hier, sie war jetzt, und ich wollte mehr vom Hier und mehr vom Jetzt. In meinem Bett lechzte ich nach ein paar Wochen mehr, und danach noch ein paar Wochen mehr, in denen ich nicht wusste, was mit meinem Körper geschehen würde, in denen ich nicht wusste, was sich in meinem Kopf abspielen würde – in denen ich aber wusste, dass die Person, die fühlte und dachte, ich war. Der Tod würde meinen Sinn dafür auslöschen, wie die Dinge sein könnten und sollten, für das Mögliche und das Schöne. Es war dieses Nichts, «dieses besondere Nichts», wie ich in meinem Tagebuch schrieb, gegen das ich wütete.
Die Wut begleitete mich immer nur ein paar Minuten lang und brachte sowohl Wärme als auch Licht. Mein Körper fühlte sich gewöhnlich kalt an, trotz des Fiebers. In meinem Krankenhausbett an Silvester wollte ich, dass die Sonne aufging, und ich wollte sie im Zimmer haben. Ich wollte sie auf meiner Haut haben. Nach drei Tagen Zittern brauchte ich mehr als nur meine eigene Wärme, die durch die dünnen Laken entwich, welche sich ständig um die Schläuche in meiner Brust und meinem Arm wickelten. Der winterliche Sonnenaufgang in Neuengland, durch ein dickes Fenster gesehen, ist nichts Besonderes; ich lebte in Symbolen und Sehnsüchten.
Ich wollte nicht, dass die Fackel in meinem Kopf ein einsames Licht war. Und das war sie auch nicht. Menschen kamen mich besuchen. Meine Frau öffnete das Rollo, und das fahle Neue Jahr trat ein. Als andere Besucher kamen, stellte ich Vermutungen darüber an, wie sie am Krankenbett auf mein hilfloses Ich reagieren würden, aber ich wusste es nicht. Ich erinnerte mich, dass einige alte Freunde, die mich besuchten, glaubten, Patienten, die Besuch bekamen, würden besser behandelt. Sie haben ohne Zweifel Recht: Gesundheit ist eine Sache des Zusammenseins, auf diese und auf hundert andere Weisen.
Ein Besuch hilft uns, allein zu sein. Das solidarische Zusammensein ermöglicht es, in Ruhe in die Einsamkeit zurückzukehren. Allein durch ihr Erscheinen lösen meine Freunde Erinnerungen aus, Assoziationsketten zurück in unsere Vergangenheit. Ich erinnerte mich an einen Moment, in dem eine Freundin diese pragmatische Sichtweise darüber, warum Patienten besucht werden sollten, geteilt hatte: Jahre zuvor, als ich es war, der an ihrem Bett saß, als sie es war, die krank und schwanger in demselben Krankenhaus lag, in dem ich jetzt selbst lag. Ich dachte an ihre Kinder, dann an meine. Eine andere Stimmung überkam mich: eine sanfte Empathie.
***
Die Wut war reines Ich, mein Wunsch, ein Klang zu sein und kein Echo, zusammenzusetzen und nicht zu zerfallen. Sie richtete sich nicht gegen irgendetwas, außer gegen das gesamte Universum und seine Gesetze des Unlebens. Für ein oder zwei Nächte konnte ich in meinem eigenen Licht erstrahlen.
Doch langsam und leise drängte sich eine zweite Stimmung auf, eine, die mir auf andere Weise half: ein Gefühl, dass das Leben nur insofern wirklich Leben war, als es dabei nicht nur um mich ging. Wie die Wut besuchte mich diese Stimmung, wenn ich allein war, wenn ich wenig für mich tun konnte, wenn mein gesamtes Bewegungsgefühl aus Visionen in meinem Kopf kam. In dieser Stimmung hatte ich das Gefühl, ich würde mich mit anderen Menschen in einem Cluster von etwas befinden, das durch die Zeit taumelte. Als ich versuchte, dieses Gefühl in mein Tagebuch zu zeichnen, fiel mir ein ungleichmäßiges, schwimmendes Gefährt ein. Es sah ein bisschen wie ein Floß aus.
Ein Floß kann nach und nach aus Einzelteilen und Bruchstücken gebaut werden. Ich war Teil eines Floßes, und andere waren es auch; wir trieben und drängten uns zusammen im selben Wasser, manchmal mühelos, manchmal gegen die Felsen. Wenn meine Planke in die Tiefe fiel, konnte das Floß vom Weg abkommen oder kentern. Einige Bohlen des Floßes waren weiter von meinem Brett entfernt, einige waren näher. Ich sagte mir vor, auf welche Weise das Leben meiner Kinder an mein eigenes gebunden war. Was zählte, war nicht, dass ich anders war, sondern dass ich ihnen gehörte: Ich war ihr Vater. Jedes Stück ihrer Existenz beinhaltete die Erwartung meiner Präsenz. Sie hatten mich nie nicht berührt. Ihre Bretter waren immer an meine gebunden gewesen.
Ich stellte mir vor, was sich ohne mich ändern würde, angefangen bei den täglichen Details, die den geistigen Kalender eines Elternteils prägen: Fußballtraining, Mathe-Hausaufgaben, Vorlesen. Mir wurde schmerzhaft bewusst, dass meine Visionen von meinem Sohn ohne mich, von meiner Tochter ohne mich genauso real waren wie mein vorheriges Leben mit ihnen. Ich schaute zu, wie sich ihre Zukunft ohne mich vor meinem geistigen Auge entfaltete, und dann spulte ich sie zurück.
Diese schwebende Erkenntnis, dass das Leben nicht mir gehörte, diese sanfte Empathie, geleitete mich vom Tod weg. Dieses Gefühl, dass das Leben geteilt wurde, begann mit meinen Kindern, erweiterte sich aber nach außen, eine ungleichmäßige Ansammlung von Holz, aus der das Floß bestand. Ich spritzte und zerrte mit allen, die ich kannte und liebte, vorwärts, und alle wären davon betroffen, wenn ich jetzt wegfiele. In dieser Stimmung wütete ich nicht, sondern trieb dahin, voller Erinnerungen, Kontemplation und Empathie.