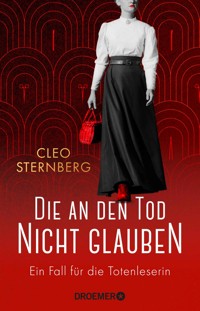
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gerichtsmedizinerin Perdita Menke ermittelt
- Sprache: Deutsch
Spektakuläre Morde und ein hinreißendes Ermittler-Paar im historischen Berlin »Die an den Tod nicht glauben« ist der 1. Band einer schillernden historischen Krimi-Reihe für Leser*innen von René Anour oder Anne Stern. Berlin, 1910. Als eine weibliche Leiche aus der Spree gezogen wird, wird ihr Fall vom zuständigen Rechtsmediziener schnell und nachlässig abgehandelt: Vermutlich hat die bitterarme ledige Mutter schlicht Selbstmord begangen. Ganz anders sieht das die angehende Gerichtsmedizinerin Perdita Menke. Ein Detail an der Leiche hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Und weil ihre Mutter sich ebenfalls das Leben genommen haben soll – was Perdita bis heute nicht glaubt –, nimmt sie den Fall persönlich. Bei ihren Ermittlungen stößt sie bald auf den ebenso geheimnisumwitterten wie charmanten Bestatter Charon Czerny. Perdita misstraut ihm zutiefst, scheint er doch aus dem Tod eine Show für sein Geschäft zu machen. Versucht Charon gar, den Mörder zu decken? Erst als es für sie beide gefährlich wird, erkennen Perdita und Charon, dass sie auf derselben Seite stehen … Der historische Kriminalroman basiert auf einem echten Mord in Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts Für ihre Krimi-Reihe lässt sich Cleo Sternberg von mysteriösen wahren Fällen und medizinischen Kuriositäten inspirieren. Die resolute Gerichtsmedizinerin Perdita Menke und der rätselhafte Leichenbestatter Charon Czerny schwanken zwischen Ablehnung und Anziehung und geben ein großartiges Ermittler-Paar ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cleo Sternberg
Die an den Tod nicht glauben
Ein Fall für die Totenleserin
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin 1910. Als eine weibliche Leiche aus der Spree geborgen wird, handeln die zuständigen Rechtsmediziner den Fall schnell und nachlässig ab. Denn Frauke Walther, eine ledige Mutter in Armut, soll sich das Leben genommen haben. Perdita Menke, selbst ernannte Obduktionsassistentin, hegt aber Zweifel und nimmt die Suche nach der Todesursache persönlich. Auch ihre Mutter hat angeblich Selbstmord begangen. Bald stößt sie auf den ebenso geheimnisvollen wie charmanten Bestatter Charon Czerny und ist überzeugt, dass er ihr etwas verheimlicht, das den Tod der armen Frau erklären könnte. Weitere Todesfälle ereignen sich, und auch Perditas Leben gerät in Gefahr: Sie ist gezwungen, mit Charon zusammenzuarbeiten, obwohl er in die Verbrechen verwickelt ist. Während sich das Netz um sie zusammenzieht, entwickelt sich zwischen den beiden eine Beziehung aus Misstrauen, Nähe und Leidenschaft …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Anmerkung
Motto
Prolog
Und wieder in eine [...]
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Zweiter Teil
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Dritter Teil
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Es war einer der [...]
Glossar
Für mein Bromley Picturehouse,
das es nicht mehr gibt
Zum besseren Verständnis der zeitgeschichtlichen und fachspezifischen Begriffe findet sich am Ende dieses Romans ein Glossar.
Die Zeilen zur Einstimmung auf die einzelnen Teile entstammen den Schlussstrophen des Films DieDreigroschenoper (1931) von Georg Wilhelm Pabst, frei nach Bertolt Brechts gleichnamigem Bühnenstück.
Sie sind in Brechts zugrunde liegendem Stück nicht vorhanden.
Schlussstück
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
Lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
Wagt er zu weinen
Mitten in uns.
Rainer Maria Rilke, Das Buch der Bilder, 1902
Prolog
Alt-Berlin Mitte Januar 1905
»Denn die einen sind im Dunkeln.«
Aus dem Film Die Dreigroschenoper von Georg Wilhelm Pabst, frei nach Bertolt Brechtsgleichnamigem Bühnenstück.
Und wieder in eine von diesen Straßen.«
Friedemann Goebel, Wachtmeister der Königlichen Schutzmannschaft zu Berlin, gab einen Laut von sich, als würde er beim Gehen schnarchen. »Das ganze Alt-Berlin mit seinem vornehmen Getue ist der reinste Flickenteppich aus Elend, Unrat und Verbrechen. Wie Innereien in einem Weiberbauch: außen hui, aber innen – pfui, pfui, pfui.«
»Wenn Sie meinen, Herr Wachtmeister.« Dieter Schultz, Schutzmann der Königlichen Schutzmannschaft, hastete schwer atmend hinter seinem Vorgesetzten her. Wachtmeister Goebel hatte grundsätzlich einen Schritt am Leib, als gelte es zu beweisen, dass ein Polizist zu Fuß mit einem Kollegen zu Pferd mühelos mithalten konnte.
Die Mauerstraße war eine jener breiten, von hohen Gebäuden gesäumten Avenuen rund um die Friedrichstraße, die Schutzmann Schultz eigentlich nicht wie der Sündenpfuhl vorkam, über den Wachtmeister Goebel wetterte. Solche gab es hier allerdings in Hülle und Fülle, vor allem in den Seitenstraßen mit den Abrisshäusern, wo sich zwischen bröckelnden Mauern die Huren, Hehler und Habenichtse einnisteten. In der Mauerstraße hingegen fanden sich vorwiegend Geschäftshäuser und Bürogebäude, manche regelrecht prächtig, die meisten gepflegt, so gut wie alle vermutlich mit einem nach hinten gelegenen Gewerbehof ausgestattet.
Um diese Uhrzeit an einem frühen Winterabend herrschten hier Stille und Leere, während es in anderen Teilen der Stadt vor Gesindel wimmelte und der Verkehr sich ballte. Außer dem blassgelben Flackern der weit auseinanderstehenden Gaslaternen gab es kaum Licht. Die Fassade des neuen Bankhauses zog sich über mehrere Gebäude, und an beiden Enden der Straße erhob sich zu gemäßigter Höhe der Turm einer Kirche. Insgesamt machte die Straße einen zwar nicht schönen oder einladenden, jedoch soliden und sauberen Eindruck. Das Haus mit der Nummer 50, zu dem die zwei Männer der Schutzpolizei gerufen worden waren, bildete davon keine Ausnahme.
Ebenso wie die Gebäude zu seinen zwei Flanken besaß es eine schmalbrüstige Front und beherbergte über dem Geschäftsbereich offenbar auch Wohnräume, deren Fenster von Vorhängen verhüllt waren. Die Meldung war von einer Nachbarin erstattet worden, einer Frau Sidonie Klawitter, die sich gehörig echauffiert und sogleich nach dem »Amt für Mord und Totschlag« verlangt hatte.
Ein solches – oder genauer gesagt: einen sogenannten Mordbereitschaftsdienst – gab es in Berlin seit drei Jahren tatsächlich, und auf diesen Fortschritt durfte die Hauptstadt stolz sein. Allerdings schickte man die handverlesenen Beamten, die ihm angehörten, nicht zu einem Vorfall, der sich wie dieser eher nach einer häuslichen Rauferei oder womöglich nur einem Gezänk unter Nachbarn anhörte.
»Bei dem geht’s doch seit Jahren nicht mit rechten Dingen zu«, hatte Frau Klawitter gezetert. »Den Bruder hat er verschwinden lassen, den hat seit Pfingsten null-drei kein Mensch mehr zu Gesicht bekommen. Der Mutter, dieser armen Seele, hat’s das Herz gebrochen, die hat sich am Ende selbst ihr Totenhemd nähen müssen, und der eigene Sohn hat sie ins Grab gebracht. Und jetzt – ich hab’s kommen sehen – hat er obendrein noch seinem Herrn Vater das Licht ausgeblasen.«
»Und dessen sind Sie sicher?«, hatte Hermann Nierlich, der ihnen vorgesetzte Hauptmann, die Dame gefragt, ehe er eine Entscheidung über die zu entsendenden Männer traf.
»Aber selbstverständlich!«, hatte die entrüstete Dame gerufen. »Ich hab doch das Geschrei gehört, und dann den Rumms, als der arme Teufel umgefallen ist. Und was der jüngste Czerny für einer ist, das weiß ich schon seit Jahren. Die ganze Straße weiß es. Der hat den Tod in den Augen, wenn Sie da reingucken, erstarrt Ihnen das Herz zu Eis, sag ich Ihnen.«
Weibergeschwätz. Heiße Luft, aufgewirbelt von Leuten, die nicht genug zu tun hatten. Für so was forderte man keinen von den Kriminalern an, das regelte die Schutzpolizei unter sich.
»Goebel, Schultz – ihr geht«, hatte die Entscheidung des Hauptmanns gelautet. »Nur Säbel, keine Pistolen. Wird schon keine große Sache sein.«
Die wutschnaubende Dame Klawitter hatte er vorab nach Hause geschickt und eindringlich gewarnt, sich am vermeintlichen Tatort nicht blicken zu lassen. Schutzmann Schultz, der nun – eine knappe Stunde später – mit seinem Wachtmeister vor der fraglichen Haustür stand, war sich sicher, dass sie nebenan hinter einem der Fenster kauerte und durch einen Spalt in den Vorhängen spähte.
Wachtmeister Goebel inspizierte das Geschäftsschild aus braun angelaufenem Messing. Arthur Czerny und Sohn, Totengräber, verkündete es. Und in der Zeile darunter: Hilde Czerny. Totenwäsche. Maßgefertigt.
»Na, Prost Mahlzeit«, brummte Goebel, räusperte sich und betätigte den Türklopfer, der ebenfalls aus Messing war und den Kopf irgendeines grauenerregenden Fabeltiers mit offenem Maul darstellte.
»Herr Czerny?«, rief Goebel, wobei er sich in die Brust warf. »Sofort aufmachen. Polizei.«
Es kam vor, dass sie drei- bis viermal klopfen oder sogar gegen die Tür treten mussten, denn der Polizei machte niemand gern auf. Weshalb Dieter Schultz sich bisweilen fragte, ob es nicht sinnvoller wäre, das Wort ›Polizei‹ gar nicht erst laut auszusprechen. An diesem Abend in der Mauerstraße brauchten sie jedoch nicht lange zu warten. Wachtmeister Goebel hatte kaum zu Ende gesprochen und Luft geholt, als die Tür nach innen geöffnet wurde.
»Sie wünschen?« Der junge Mann, der im Spalt erschien, hätte einer von denen sein können, die in den zahllosen Berliner Theatern oder wenigstens im Varieté auftraten. Isolde Tschöpke, Dieter Schultz’ Verlobte, hätte bei seinem Anblick zweifellos schwärmerisch die Augen verdreht und ausgerufen: »Jott im Himmel, wat für ’n scheenet Stück Mensch.«
Das schöne Stück Mensch musste ungefähr so alt oder besser so jung sein, wie Dieter Schultz es gewesen war, als er seinen Dienst beim preußischen Militär angetreten hatte, doch er verfügte über ein Auftreten, eine geradezu gelangweilte Selbstsicherheit, wie Dieter sie sich in den fünf seither verstrichenen Jahren niemals angeeignet hatte. Er hatte sehr schwarzes, sich stark in die Stirn lockendes Haar, wie es in diesen Breitengraden selten vorkam und eher den Welschen zugeschrieben wurde. Auch gekleidet war er wie ein Franzose, in einen offenbar tadellosen schwarzen Gehrock, als hätte er gerade das Haus verlassen wollen, aber mit noch offenem Hemd, ohne Kragen und Brusteinsatz, wie sich kein braver Deutscher vor einem Besucher hätte blicken lassen.
Besonders groß war er nicht.
Das waren Franzosen, soweit es Dieter Schultz bekannt war, praktisch nie.
Was ihm an Länge fehlte, machte er durch die Breite seiner prächtigen Schultern wett, was Dieter vermuten ließ, dass es auf der einen oder der anderen Seite seiner Familie einen deutschen Einschlag geben musste.
Den geschwungenen und allzu roten Mund hatte er vom deutschen Teil seiner Ahnen allerdings nicht, und so fein, wie mit dem Tintenstift gezogen, ließ sich auch kein Deutscher den Schnurrbart rasieren. Vor allem aber die Augen passten in keine lautere und klare deutsche Wirklichkeit.
Dieter Schultz erschrak ein wenig. Zumindest in diesem Punkt hatte die Dame Klawitter die Wahrheit gesprochen: Die Augen des Mannes waren grau und undurchdringlich wie Eis, wirkten vollkommen leblos und sorgten dafür, dass Dieter in seinem Uniformrock fröstelte.
Herausfordernd sah er ihnen entgegen, zog wie ein viel älterer Mann die Stirn kraus, indem er eine pechschwarze Braue hob, und ließ auf der anderen Seite den Mundwinkel zucken. Dieter Schultz hatte nicht die Absicht, ihn anzustarren, doch er musste bekennen, dass er von der Bandbreite des Mienenspiels fasziniert war.
Goebel zog seine blank poliert glänzende Dienstmarke aus der Tasche und hielt sie dem halb französischen Schönling vor die Nase. »Wachtmeister Friedemann Goebel, Königlich-Preußische Polizei zu Berlin«, schnarrte er. »Ich ersuche um unverzügliche Auskunft, ob ich mit einem Herrn Czerny spreche.«
»Die Auskunft soll den Herren von der Königlich-Preußischen Polizei unverzüglich erteilt werden«, erwiderte der Franzose aufgeräumt. »Sie tun es.«
»Sie selbst sind Herr Czerny?«
»Das kann ich nicht leugnen.«
»Der Jüngere?«
»Ich fürchte, das ist eine Frage der Betrachtung.«
Er sprach ohne jeden fremdländischen Akzent, aber mit jener Art von Betonung, die durchblicken ließ, dass seine Bildung sich nicht auf eine Handvoll Volksschuljahre im Wedding oder in Moabit beschränkte.
Verwirrt hielt Wachtmeister Goebel inne. Dann räusperte er sich und führte eine Hand an seinen Säbel. »Ich muss Sie auffordern, die Spitzfindigkeiten zu unterlassen«, sagte er. »Wir kommen in einer ernsten Angelegenheit. Uns liegt eine Meldung vor, dass es in Ihren Wohnräumen zu einem … Zwischenfall mit Todesfolge gekommen ist. Entspricht dies den Tatsachen?«
Jetzt lächelte der Mann über beide Mundwinkel und entblößte dabei beneidenswert weiße Zähne. »Zwischenfall mit Todesfolge«, wiederholte er. »Ich denke, wenn man es auf Teufel komm raus so bezeichnen möchte, kann man das wohl tun. Man könnte auch schlicht Tod sagen, aber das würde nicht so herrlich amtlich klingen, oder? In jedem Fall lautet meine Antwort Ja.«
Im selben Moment verschwand das Lächeln. Das Gesicht des Mannes war zum Lächeln nicht gemacht, stellte Dieter Schultz fest.
»Ihre Antwort lautet Ja?«, rief Goebel perplex. Dass ein Delinquent ein Tötungsdelikt in derart aufgeräumtem Tonfall eingestand, statt es vehement abzustreiten, gehörte nicht zu den Dingen, die sie auf ihren Einsätzen häufig erlebten. »Sie sind also geständig und bekennen, Ihren Vater, Herrn ähhh …«, er blickte auf das Geschäftsschild, »Herrn Arthur Czerny getötet zu haben?«
»Ich bekenne ganz und gar nichts dergleichen«, erwiderte Czerny. »Ich habe lediglich bejaht, dass sich oben in meiner Wohnung ein – wie haben Sie es ausgedrückt? – Zwischenfall mit Todesfolge ereignet hat, demzufolge mein Vater, der nämliche Herr Arthur Czerny, gebürtig in Breslau, am 12. Februar 1852, nicht länger unter den Lebenden weilt. Nach dem Genuss einer Zigarre der Marke Gail in einem Sessel seiner guten Stube muss er allzu hastig aufgestanden sein und erlitt nach meinem Dafürhalten einen veritablen Herzanfall, der mit beinahe sofortiger Wirkung zu seinem Ableben führte.«
Das alles erzählte der Mann ihnen derart beiläufig, als spreche er über das Zerschellen eines nicht sonderlich geschätzten Wasserglases. Obwohl er dabei nicht lachte, kam es Dieter Schultz vor, als amüsiere er sich. Flüchtig glaubte er, aus dem Innern des Hauses ein ersticktes Wimmern zu hören, doch da es gleich wieder aufhörte, schrieb er es seiner Einbildung zu.
»Ihr Vater hat einen Herzanfall erlitten?«, wiederholte Goebel.
»Davon kann ich nur ausgehen.« Czerny zuckte mit den Schultern. »Ich war ja nicht dabei.«
»Wo befanden Sie sich zur Tatzeit?«, bellte Goebel.
»Zur sogenannten Tatzeit befand ich mich in meinem Schlafzimmer«, erwiderte Czerny. »Ich saß an einem in selbiges Zimmer hineingequetschten Schreibpult, bei dem es sich um einen zweckentfremdeten Frisiertisch handelt, und habe versucht, meiner Arbeit nachzugehen.«
»Wir haben eine Zeugin, die Geschrei gehört haben will«, begehrte Goebel auf.
»Wenn Ihre Zeugin das will, sei ihr das unbenommen«, sagte Czerny. »Ein wenig Geschrei mag mein Vater schon von sich gegeben haben, ehe er starb. Es nehmen ja die wenigsten den Tod ganz ohne Ach und Weh entgegen. Falls Sie jedoch wissen wollen, ob ich etwas gehört habe, muss ich Sie enttäuschen. Sobald ich mich in meine Arbeit versenke, bin ich so gut wie blind und taub.«
»Und warum haben Sie keinen Arzt gerufen?«, fuhr Goebel ihn an.
»Ich würde mich nicht als ausgesprochen medizinisch bewandert bezeichnen«, bekundete Czerny. »Aber soweit ich durch meinen Beruf mit derlei Dingen in Berührung komme, ist es bisher noch keinem Vertreter der ärztlichen Zunft gelungen, den Tod zu heilen.«
»Ich untersage Ihnen, sich über den Ernst der Lage lustig zu machen«, rief Goebel.
»Ich mache mich nicht lustig«, entgegnete Czerny freundlich. »Glauben Sie mir, ich besitze dazu nicht das geringste Talent.«
»Ich verlange von Ihnen eine unverzügliche Erklärung dafür, dass Sie niemanden herbeigerufen haben, sondern untätig in Ihrer Wohnung verblieben sind, obwohl Sie den Tod Ihres Vaters entdeckt haben wollen«, forderte Goebel. Er erinnerte Dieter an einen Kartenspieler, dem in frappierendem Tempo die Trümpfe ausgingen.
Czerny lehnte den Rücken an den Türpfosten und kreuzte seine elegant bekleideten Beine. »Wie bereits gesagt, einen Arzt herbeizurufen, erschien mir auf der Basis meiner Kenntnisse sinnlos«, sagte er. »Eher hielt ich den Einsatz eines Bestatters vonnöten. Warum ich nun allerdings selbigen nicht rief, ist leicht zu begründen.«
Er beugte sich vor und klopfte auf das angelaufene Messinggeschäftsschild, genauer gesagt auf den Schriftzug Totengräber unter dem Namen seines Vaters. »Da ich selbst vom Fach bin, hielt ich es für unnötig, Eulen nach Athen zu tragen. Mein Vater ist bereits der Vorschrift und der Pietät entsprechend aufgebahrt. Wenn Sie ihn gern inspizieren möchten – bitte hier entlang.«
Erster Teil
BerlinOktober 1910
»Und die andern sind im Licht.«
Aus dem Film Die Dreigroschenoper von Georg Wilhelm Pabst, frei nach Bertolt Brechtsgleichnamigem Bühnenstück.
1
Wir sind die, denen sich der Tod auf den Tisch legt.‹
Diese bemerkenswerte Spruchweisheit hatte der Mann geprägt, den jeder im Institut für gerichtliche Medizin liebevoll Menkenke nannte. Seinem Vorgesetzten, dem Geheimen Medizinalrat Konrad Meyer zu Köcker, hatte das Bonmot so gut gefallen, dass er es in geschwungener Schrift auf feines Papier pinseln, rahmen und im Autopsiesaal des Leichen- und Sektionshauses an die Wand hängen ließ.
Sooft Perdita in der Frühe mit Blecheimer und Wischlappen hier hereinspazierte, um die Obduktionstische nach Benutzung gründlich abzuseifen, blieb ihr nichts anderes übrig, als den ihr seit Jahr und Tag bekannten Sinnspruch von Neuem zu lesen.
Menkenke, der im bürgerlichen Leben den Namen Ludwig Adalbert Menke trug, liebte kaum etwas so sehr wie das Ersinnen von Spruchweisheiten. Sobald er eine neue aus dem Ärmel geschüttelt hatte, unternahm er jegliche Anstrengung, um dem Medizinalrat über den Weg zu laufen und seine Kreation beiläufig fallen zu lassen. Wobei er natürlich darauf hoffte, diese werde ebenfalls in gerahmter Form den Weg an die Wand des Allerheiligsten finden.
Meyer zu Köcker aber war wählerisch. »Knapp daneben ist auch vorbei, Menkenke«, pflegte er zu sagen und weigerte sich standhaft, dem auf den Tisch gelegten Tod eine weitere Weisheit von Ludwig Menke hinzuzufügen. Falls dieser also darauf spekuliert hatte, durch das Verfassen von Wandsprüchen Ruhm und Vermögen zu erlangen und sich zur Ruhe setzen zu können, so hatte er sich getäuscht und war gezwungen, sein beschwerliches Tagwerk fortzusetzen.
Allzu beschwerlich fand er es gar nicht, vermutete Perdita. Auch wenn er einen Gutteil der anfallenden Tätigkeiten mit Ächzen und Seufzen begleitete, war sie sich recht sicher, dass er seine Arbeit im Grunde herzlich liebte. Ursprünglich – genauer gesagt vor vierundzwanzig Jahren – war er als Hausmeister des Instituts eingestellt worden. Damals war das Gebäude in der Hannoverschen Straße brandneu gewesen und hatte lediglich zwei Stockwerke umfasst, in denen die frisch gegründete Institution sich ausbreiten durfte. Offiziell bekleidete er diese Funktion noch immer, auch wenn er inzwischen so viele unterschiedliche Aufgaben verrichtete, dass Meyer zu Köcker und die übrigen Rechtsmediziner ihn ihr Faktotum nannten. Er bewohnte auch noch immer die damals eigens im Vorbau eingerichtete Hausmeisterwohnung und war damit der Einzige, der mit den Toten des Instituts unter einem Dach lebte.
Nein, nicht ganz der Einzige.
Drei Jahre nach Eröffnung des Instituts war ein schreiendes, neugeborenes Bündel in die Hausmeisterwohnung eingezogen und auf den Namen Perdita getauft worden. Ludwig Menke war der Vater jenes Bündels, das sich inzwischen zu einer jungen Dame von einundzwanzig Jahren ausgewachsen hatte.
Wobei es so einige gab, die der Bezeichnung ›Dame‹ in Perditas Fall widersprochen hätten.
Hätten die beiden Menkes im Zoologischen Garten gehaust und hätte Perdita von klein auf Begeisterung für dessen tierische Bewohner gezeigt, um später den Wunsch zu äußern, einen entsprechenden Beruf zu ergreifen, so hätte es vermutlich geheißen: Sie hat sich eben schon als Kind in alles, was da kreucht und fleucht, verliebt. Warum sollte man sie diese Leidenschaft also nicht verfolgen lassen?
Dasselbe hätte sicher auch gegolten, wenn sie in einem Modesalon, einer Konditorei oder einer Kunstgalerie aufgewachsen wäre und sich in Kleider, Torten oder Gemälde verliebt hätte.
Aber in Tote?
Welcher Mensch, welche junge Frau von gesundem Verstand verliebte sich denn in Tote?
Und welcher Vater, der sich ebenfalls eines gesunden Verstandes rühmte, hätte sich bereit erklärt, seine geliebte einzige Tochter in einer solchen Leidenschaft zu unterstützen?
Perdita hätte versuchen können, zu erklären, was diese Leidenschaft in ihr entfachte, doch vermutlich wäre sie damit gescheitert. Sie war beredt, sie hatte, solange sie denken konnte, die Erwachsenen um sich herum dazu herausgefordert, mit ihr über alles und jedes zu sprechen, und vertrat den Standpunkt, dass selbst unfassliche Dinge handhabbar wurden, sobald man sich bemühte, sie zu erklären.
Dass es davon Ausnahmen gab, konnte sie jedoch nicht abstreiten. Was sie zum Tod zog, zu dem gewaltsamen, grausamen, zur Unzeit eingetroffenen Tod, der sich im Gerichtsmedizinischen Institut splitternackt und jeglicher Würde beraubt auf einen kalten Metalltisch legen musste, hätte sie nicht zu erklären vermocht. Und vor allem hätte sie es nicht gewollt.
Den Versuch, ihren Vater zu überzeugen, würde sie dennoch wagen. Noch heute. Sie musste es einfach schaffen. Gerichtsmedizinerin wollte sie werden. Es gab nichts auf der Welt, das sie so sehr wollte.
Perdita stellte den Eimer ab, tauchte einen Lappen in die Seifenlauge und begann, die Platte des Seziertischs abzuwaschen. Seit einiger Zeit gab es Pläne, sämtliche Tische mit Abflüssen zu versehen, um die Reinigung zu vereinfachen, aber bisher war noch nichts geschehen. So oder so wurden Möbel und Gerätschaften, die mit Leichen in Berührung kamen, gründlich gereinigt, und die Sägespäne unter den Tischen, in die Blut und andere Körperflüssigkeiten rannen, wurden täglich ausgefegt. Fast als wäre der Tod ansteckend. Tatsächlich hatte Perdita bei so gut wie sämtlichen Hilfskräften, die im Laufe der Jahre gekommen und gegangen waren, eine schier panische Furcht vor Krankheiten erlebt, die die Toten angeblich übertrugen.
»Lebende übertragen mehr davon«, hatte sie dem jungen Friedrich Briggsen, der als Obduktionsassistent angefangen und nach wenigen Tagen die Flucht ergriffen hatte, erklärt, aber der stoppelhaarige Herr Briggsen hatte nichts darauf gegeben. Männer gaben selten etwas auf das, was Frauen sagten, selbst wenn sie ihnen – wie Briggsen bei Perdita – schöne Augen machten. Das wusste Perdita an ihrem Vater und an dem kleinen Stammpersonal, das der Rechtsmedizin seit Jahr und Tag angehörte, zu schätzen: Einschließlich Meyer zu Köcker hatten sie letztendlich gelernt, dass es nichts brachte, auf das, was Perdita Menke sagte, nichts zu geben, weil Perdita es so lange wiederholen würde, bis sie sich Gehör verschafft hatte. Also konnte man es auch gleich hinter sich bringen.
Mit kräftigen Schwüngen ihrer von der Arbeit gestählten Arme seifte Perdita die Oberfläche ab. Mit dem Putzen der Säle im Leichenhaus verdiente sie sich seit ihrem vierzehnten Lebensjahr ein paar Pfennige, die ihr Vater sie behalten ließ. »Für deine Zukunft«, pflegte er zu sagen. Dass seine Tochter den nach Formaldehyd duftenden Dunstkreis von Krankenhäusern niemals würde verlassen wollen, hatte er ja längst begriffen. Er hatte angenommen, dass Krankenschwester ein angemessener Beruf für sie sein würde, und wusste, dass der Lohn, der den in der Pflege beschäftigten Frauen gezahlt wurde, weder zum Leben noch zum Sterben reichte.
Also gestattete er ihr die Hilfsarbeiten im Leichenhaus, die durchaus nicht nur das Putzen umfassten. Dass Emilie Zinke, die einzige Kameradin aus Schultagen, mit der Perdita noch gelegentlich zusammentraf, darüber die Nase rümpfte, machte ihr nichts aus. »Aber Tote stinken doch!«, hatte Emilie gerufen.
»Lebende etwa nicht?«, hatte Perdita gefragt und war ihres Wegs gezogen.
Konrad Meyer zu Köcker schätzte Perditas Arbeit viel zu sehr, um auf sie zu verzichten, auch wenn er anfangs versucht hatte, ihren Vater von dem Plan abzubringen. »Sie können doch wohl darauf hoffen, dass der künftige Ehemann Ihrer Tochter sie angemessen unterhalten wird, Menkenke«, hatte sie den Medizinalrat zu ihrem Vater sagen hören. »Unansehnlich ist das Mädchen schließlich nicht, falls ich mir erlauben darf, das anzumerken. Wenn auch nicht hübsch im klassischen Sinn.«
»Nee«, hatte Perditas Vater kategorisch erwidert. »Darauf, dass meene Kleene einen zum Heiraten findet, setz ick mal besser nicht. Klasse hatse ja. Mehr als alle Hübschen. Aber wir in unserer Familie, wir haben für die Ehe wenig Begabung, da mach ick mir nüscht vor.«
»Es ist ja wohl kaum vorstellbar, dass unser Menkchen Mutterlos eine solche Veranlagung von Ihnen geerbt haben könnte«, hatte Meyer zu Köcker in seiner gewohnt leicht pikierten Art erwidert, aber Perditas Vater hatte abgewinkt.
»Das würde Sie wundern, Herr Medizinalrat, wat in unserm Leben so allet vorstellbar ist«, hatte er gesagt.
Also war es dabei geblieben: Perdita erledigte Hilfsarbeiten für die Rechtsmediziner, wie sie es genau genommen schon als kleines Mädchen getan hatte, und erhielt dafür ein wenig Geld, das sie für ihre Zukunft sparte. Sie absolvierte die Schule, war zwar intelligent genug, sich irgendwie durchzuwursteln, ließ es aber an Fleiß fehlen, weil sie nun einmal nicht zu den Menschen gehörte, denen es gegeben war, still auf ihrem Hintern zu sitzen. Und weil alles, was sich zur selben Zeit im Gerichtsmedizinischen Institut abspielte, so viel interessanter war.
Außerdem war der Abschluss an der höheren Mädchenschule, für die Konrad Meyer zu Köcker wie ein großzügiger Pate die horrende Gebühr bezahlt hatte, ja ohnehin nur ein wertloser Fetzen Papier, hatte Perdita geglaubt. Frauen waren an Preußens Universitäten nicht zugelassen, ob sie nun über einen Abschluss verfügten oder nicht. Dann aber hatte vor bald drei Jahren im März der preußische Kultusminister von Studt jene Rede gehalten, die tags darauf in aller Munde war und die Gemüter ehrwürdiger Bürger zum Überkochen brachte:
»Nicht nur das Gefühl«, so bekundete der Minister mit Schmelz in der Stimme, »sondern vielmehr auch der Verstand soll fortan bei preußischen Frauen gefördert werden.«
Die Wellen der Empörung, die folgten, waren gigantisch und zwangen den Minister, zurückzurudern. Die intellektuelle Bildung der Frau, so beteuerte er, dürfe keinesfalls dazu führen, dass deren Herzensreinheit und Gemütstiefe beeinträchtigt würden, denn diese seien ein Schatz des deutschen Volkes. Das Ergebnis blieb von dem Geschwätz jedoch unangetastet und war sensationell: Künftig war es in Preußen jenen Frauen, die ein Abitur vorweisen konnten, mit gewissen Einschränkungen gestattet, ein Studium an einer Universität aufzunehmen.
Und das ausgerechnet, nachdem Perdita die Schule in eher unrühmlicher Weise verlassen und stattdessen eine Schwesternausbildung an der angrenzenden Universitätsklinik, der Charité,angetreten hatte.
Wenn sie nun hier in der Gerichtsmedizin, wo sie in ihrem Element war, daran dachte, kam es Perdita vor, als hätte sie jeden einzelnen Augenblick dieser Ausbildung gehasst.
Ganz so war es natürlich nicht. Längst war die Lehre in der Krankenpflege nicht mehr ausschließlich darauf ausgerichtet, fromme und opferbereite Schwestern heranzuziehen, sondern vermittelte handfestes Wissen über die Beschaffenheit des menschlichen Körpers und die verschiedenen Übel, die darauf lauerten, ihn heimzusuchen.
All das hatte Perdita in sich aufgesogen wie ein Schwamm. Wenn sie auch nicht verhindern konnte, dass ihre Ausbilderinnen bemerkten, auf welche Wissensgebiete ihr Hauptinteresse ausgerichtet war.
»Es ist mir wahrhaftig ein Rätsel, was eine wohlerzogene junge Dame wie Sie, Fräulein Menke, mit einer solchen Macht zu den verabscheuungswürdigsten Verbrechen zieht«, hatte Oberschwester Wilhelmine getadelt, nachdem Perdita sich darum gerissen hatte, die Leiche eines erstochenen Kleinkriminellen besichtigen zu dürfen. Sie hatte ihre Schülerin eindringlich davor gewarnt, ihr Gemüt zu gefährden, und ihr gedroht, sie werde »mit Ihrem Herrn Vater sprechen müssen«, wenn Perdita sich nicht ihrem Geschlecht und ihrer Berufung entsprechend verhalte. »In unserem Beruf sorgen wir für leidende, heimgesuchte Menschen, da sind Feingefühl, Mitleid und Beherrschung der Emotionen vonnöten. Sollte ich bei Ihnen weiterhin einen Hang zum Niederen, Brutalen und Finsteren bemerken, so bleibt mir nichts übrig, als Sie wegen mangelnder Eignung auszuschließen.«
Darin war Perdita der properen Wilhelmine nun zuvorgekommen.
Ihre Unfähigkeit, sich in das Reglement von Bravheit und Biederkeit einzufügen und zugleich ihre Neugier auf all das zu bezähmen, was die Oberschwester ihr verboten hatte, hatten dem Experiment Krankenpflege ein Ende gesetzt. Perdita hatte ihre Ausbildung hingeworfen, hatte einen beträchtlichen Teil des »für ihre Zukunft« gesparten Geldes für einen durch Unachtsamkeit zerrissenen Kittel und eine wirklich versehentlich zerbrochene Bettpfanne hinblättern müssen und war in ihr Zuhause entflohen.
In ihr Zuhause. Ins Gerichtsmedizinische Institut.
Die Erleichterung, die in ihr aufwallte, war grenzenlos. Endlich brauchte sie sich mit ihrer morgendlichen Arbeit nicht mehr zu beeilen, um gleich darauf hinüber in den Lehrbetrieb der Klinik zu hetzen, sondern konnte sich Zeit lassen und alles gründlich tun. »Jeder Tote verdient Respekt«, lautete eine der Spruchweisheiten ihres Vaters. »Selbst wenn er im Leben nich’ wusste, wie man so ’n Wort buchstabiert.« Perdita sorgte dafür, dass ein Tisch blitzblank war, ehe der nächste Tote darauf seinen Platz erhielt, und versuchte damit, ihm jenen Respekt zu erweisen.
Wenn sie mit dem Putzen fertig war, erstreckte sich der ganze Tag mit all dem Unverhofften, Neuen und Abenteuerlichen, das er bringen mochte, vor ihr. Sie konnte auf das Eintreffen der Rechtsmediziner warten und ihnen ihre Hilfe anbieten, wie es ihr sonst nur in kurzen Ferien möglich gewesen war. Dass sie das abrupte Ende ihrer Ausbildung so gar nicht bereute, zeigte ihr, dass sie das Richtige getan hatte und dass der Weg, den sie nun einschlagen wollte, der einzig richtige für sie war.
Was ihr allerdings noch auf der Seele lag, war das Wissen, dass sie ihren Vater von ihren Entschlüssen unterrichten musste. Sie hatte es sofort am Vorabend erledigen wollen, sie war keine, die mit schlechten Nachrichten hinterm Berg hielt, sondern vertrat die Ansicht, dass Karten auf den Tisch gehörten. Dann aber hatten, als sie nach Hause kam, Paul Ledig und Samuel Sonneberg mit ihrem Vater am Küchentisch gesessen. Die zwei waren die Fahrer der Leichentransporte und seit Jahrzehnten Ludwig Menkes Freunde. Alle drei freuten sich auf einen zünftigen Skatabend, und den hatte Perdita ihnen nicht verderben wollen.
Ihr Vater war so stolz auf das, was seine Tochter seiner Ansicht nach eines Tages zustande bringen würde. Seinen beiden Freunden hatte er wieder einmal mit einem solchen Glanz in den Augen und einer solchen Erregung in der Stimme von ihren vermeintlichen Leistungen berichtet, dass Perdita ein Anflug von Scham überkam.
Und Scham war kein Gefühl, mit dem Perdita Menke gut umgehen konnte.
Ihr Vater war der beste der Welt, darüber gab es keine Diskussion. Er hatte sie alleine aufziehen müssen, sein ›Menkchen Mutterlos‹, wie die Männer im Institut sie getauft hatten, und er hatte ihr gegeben, was immer er aufbringen konnte. Liebe im Überfluss. Das Gefühl, auch zu zweit eine richtige Familie zu sein. »Leben heißt Abschiednehmen«, lautete eine seiner Spruchweisheiten, und nur für Perditas Ohren hatte er hinzugefügt: »Aber als ick damals hier die Stellung jekriegt hab, und als dann noch du jekommen bist, war das mit dem Abschied für lange Zeit vorbei.«
Im Leben anderer Mädchen ihres Alters schienen Väter keine große Rolle zu spielen, und wenn doch, dann wurden sie gefürchtet oder sogar gehasst. Perdita und ihr Vater hingegen waren eine Einheit, eine kleine Gemeinschaft, die am Abend die Tür hinter sich verriegelte, alles Bedrohliche ausschloss und sich beschützt und geborgen wusste. Zumindest war es so gewesen, solange Perdita ein Kind gewesen war und ihre Neugier auf das, was vor der Tür lauerte, im Zaum halten konnte.
In den letzten Jahren war ihr die kleine Bienenwabenwohnung über der Hausmeisterloge des Instituts ein wenig zu eng geworden. Vielleicht glaubte sie nicht mehr sonderlich fest an Schutz und Geborgenheit, sondern wusste zu viel über die Fugen und Ritzen, durch die das Böse selbst in die heimeligste Stube kriechen konnte. Aber sie vermisste die Zeit, in der sie bedingungslos darauf vertraut hatte, und war ihrem Vater dankbar dafür.
Er hatte ihr die schönste Kindheit bereitet, die ein Kind nur haben konnte, und das Letzte, was sie wollte, war, ihn zu enttäuschen. Er hatte sein Bestes getan, um ihre Anlagen zu fördern, und wenn sie an seine bescheidene Prahlerei vor seinen Skatkumpeln dachte, wurde ihr ein bisschen übel.
Aber es half ja nichts.
Sobald sie mit den Tischen fertig war, würde sie eine Pause einlegen, nach drüben laufen, wo er in seiner Hausmeisterloge inzwischen sicher schon Stellung bezogen hatte, und zu ihm sagen:
»Paps, ich werde keine Krankenschwester mehr. Ich will studieren. Ich werde Gerichtsmedizinerin.«
Auf den Knien fegte sie die Sägespäne auf und schrubbte Flecken vom Kachelboden. Körperflüssigkeit, dunkles Blut, von Lymphe aufgehellt. Wenn sie die Kameradinnen in der Lehre hatte erschrecken wollen, hatte sie ihnen die Farben dieser Flecken etwas ausführlicher als nötig beschrieben. Warum eigentlich? Diese Mädchen hatten ihr ja nichts getan, und dass sie sich leichter in die ihnen zugedachte Rolle einfügten als Perdita, war nicht ihre Schuld und machte sie nicht zu schlechten Menschen.
Perdita wusste es selbst nicht.
Manchmal ritt sie der Teufel, und den bekam man ja so einfach nicht vom Rücken.
Eine Tür schlug. Sie drehte den Kopf und sah einen kleinen, kompakt gebauten Mann in weißem Kittel in den Raum marschieren.
»Ah, guten Morgen, liebes Menkchen! Schon so fleißig? Das trifft sich bestens, denn gerade Sie hatte ich gehofft, hier anzutreffen.«
Manche Leute hatten Namen, die klangen, als hätte sie sich jemand eigens für sie ausgedacht. Dr. Leo Leiser, der dienstälteste der drei Gerichtsmediziner, die dauerhaft im Institut beschäftigt waren, gehörte dazu. Ob er sprach, ob er auftrat, ob er unter den ordentlich aufgereihten Werkzeugen in den Wandregalen etwas suchte – alles geschah bei ihm in einer derart phänomenalen Lautstärke, dass man in Versuchung war, ›Leiser, leiser!‹ zu rufen. Tat man es, so schlug er verlegen die Hand vor den Mund und gelobte Besserung, nur um wenige Augenblicke später unvermindert weiterzulärmen.
Perdita mochte ihn. Sie mochte sie alle. ›Der Leisetreter‹, wie ihr Vater Dr. Leiser nannte, war alles andere als der fähigste unter ihnen. Er litt unter chronischer Zerstreutheit und hätte, statt am Seziertisch zu stehen, lieber hinter einem Professorenschreibtisch gesessen und nach Herzenslust Studenten belehrt. Dies aber kam stattdessen Konrad Meyer zu Köcker zu, der an der Charité einen Lehrstuhl innehatte und deshalb für das Institut immer weniger Zeit aufbrachte.
Im Grunde eine verdrehte Welt. Der einzige begnadete Rechtsmediziner in ihrem Stab war Meyer zu Köcker selbst, und seine Studenten mit ihrer Besserwisserei und ihrem Leichtsinn gingen ihm auf die Nerven. Hätte er mit Leiser getauscht, wäre allen geholfen gewesen, aber so einfach ließen sich die Dinge nicht regeln.
Perdita stand auf, ließ die Wurzelbürste in den Eimer gleiten und wischte sich die Hände an ihrem Gabardinerock ab. »Guten Morgen, Herr Doktor«, begrüßte sie Leiser. »Womit kann ich denn dienen?«
»Aber, aber, Menkchen.« Tadelnd wackelte er mit dem Zeigefinger. »Wieder einmal vergessen, für die Arbeit eine Schürze anzulegen?«
»Ach, ich hasse die Dinger einfach«, platzte Perdita heraus. »Ständig verrutschen sie, die Schleife löst sich, oder sie sind im Weg. Geben Sie mir lieber einen Kittel, Herr Doktor. Dann helfe ich Ihnen.«
»Sie sind aber kein Mann, Menkchen«, sagte er, noch immer tadelnd, öffnete jedoch den in die Wand eingelassenen Spind mit den Kitteln, sodass Perdita sich bedienen konnte. »Ihre Hilfe brauche ich allerdings nicht bei etwas, das Dreck macht, sondern mit einem Obduktionsprotokoll, das ich auf Teufel komm raus nicht finden kann.«
Leiser konnte ständig auf Teufel komm raus etwas nicht finden. Seine Ablage war in etwa so sorgfältig geführt wie Perditas Nähkorb, in dem sich zwischen Knoten und Gewirr nichts Brauchbares zutage fördern ließ.
»Um welchen Fall geht es denn?«, fragte sie.
»Können Sie sich an die Selbstmörderin Susette Schneider erinnern?«, fragte er. »Die Vergiftung, bei der es uns nicht mit Sicherheit gelungen ist, das verwendete Gift nachzuweisen?«
»Und ob«, murmelte Perdita und konnte sich eines aufköchelnden Zorns nicht erwehren. Auch wenn die Obduktion jener Leiche bald zwei Jahre zurückliegen musste, war ihr das unbefriedigende Ergebnis noch allzu gut in Erinnerung. Sie hatte seinerzeit für eine Übersendung von Leichenteilen ans Pharmazeutische Institut plädiert, um zusätzliche Untersuchungen durchführen zu lassen. Wie üblich hatte jedoch niemand auf sie gehört.
»Zusätzliche Untersuchungen kosten zusätzliches Geld, Menkchen«, hatte Dr. Heinrich Friedlieb, der Gerichtsmediziner, der die Obduktion geleitet hatte, sie belehrt. »Und unsere Vorschriften darüber, für wen wir dieses Geld ausgeben dürfen, lassen weit weniger Spielraum, als Sie in Ihrer Naivität glauben.«
Perdita wusste, was er meinte: Susette Schneider hatte zu den Ärmsten der Armen gehört, verwahrlost, vermutlich von der Prostitution lebend, keinem Angehörigen einen Pfifferling wert. Für solche wie sie wurde kein Geld lockergemacht, und so blieb das, was die Tote ihnen hätte erzählen können, ihr Geheimnis, das sie mit ins Grab nahm.
Die Leiche war aus dem Autopsiesaal verschwunden, ehe Perdita Zeit gehabt hätte, ein paar eigene Untersuchungen vorzunehmen. Irgendein ungenannter Wohltäter hatte für das Begräbnis bezahlt, und abgeholt hatte sie der Mann, der ihr von allen, die dafür infrage kamen, am meisten verhasst war.
Der, den sie den Totenflüsterer nannten.
Der, der aus dem Tod einen Klamauk machte und sich aufschwang, als wäre er ihm überlegen.
Perdita hatte ihr ganzes bisheriges Leben mit Toten verbracht, und wenn es sie eines gelehrt hatte, dann war es Respekt. Der jedoch schien diesem vermutlich selbst ernannten charmantesten Bestatter von Berlin vollkommen fremd zu sein. Dass seine Vorgehensweise beim Umgang mit Leichen, die in ihrem Haus obduziert worden waren, häufig allzu übereilt und nicht ganz koscher erschien, kam noch dazu.
Perdita kannte ihn nicht persönlich, war entschlossen, ihn auch nie kennenzulernen, und hätte sich außerdem lieber von einem Straßenkehrer beerdigen lassen als von ihm.
»Das Protokoll dazu ist jetzt vom Alexanderplatz angefordert worden.« Leisers Stimme klang bittend und rief Perdita in die Gegenwart zurück. »Keine Ahnung, weshalb sich nach so vielen Jahren noch jemand für diesen längst abgehakten Fall interessiert, aber der Beamte, der angefragt hat, will heute noch jemanden schicken, um das Dokument abzuholen. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wer damals die Untersuchung überhaupt gemacht hat.«
»Friedlieb«, informierte Perdita ihn prompt. Am Alexanderplatz stand das Polizeipräsidium, in dem es seit ein paar Jahren eine feste Mordkommission gab. Wenn die Beamten von dort Unterlagen anforderten, durfte ihr Institut sich keine Schlamperei erlauben. »Ich hole Ihnen das Protokoll«, versprach sie Leiser. »Aber danach müssen Sie mir auch bei einer Sache behilflich sein.«
»Das ist Erpressung, Menkchen«, protestierte Leiser.
»Ist es«, erwiderte sie gelassen. »Ich brauche Schützenhilfe von Ihnen, wenn ich meinem Vater begreiflich mache, dass ich nun doch keine Krankenschwester, sondern Gerichtsmedizinerin werden will.«
»Gerichtsmedizinerin.« Dr. Leo Leiser betrachtete Perdita Menke, als wisse er nicht, worum es sich bei dieser Berufsbezeichnung handeln könnte. »Nun, bei eingehender Betrachtung hätte man das wohl kommen sehen müssen. Wie ich heute aber nicht zum ersten Mal feststelle, sind Sie nun einmal kein Mann, liebes Menkchen.«
»Ein Mann wäre auch keine Gerichtsmedizinerin«, konterte Perdita trocken. »Außerdem sind die meisten Männer nicht so gut wie ich. Ich kann eine Leiche umdrehen, ohne mir einen Bruch zu heben, einen Bauchraum ausnehmen, ohne mich zu übergeben, und einem Brandopfer ins Gesicht sehen, ohne in Ohnmacht zu sinken. Um festzustellen, ob eine Wasserleiche ertrunken ist, brauche ich keine Viertelstunde, und eine nach dem Tod zugefügte Verletzung kann ich mit bloßem Auge von einer, die tödlich war, unterscheiden. Und wenn das alles nicht reicht, weiß ich auch noch, wo das Protokoll steckt, das Sie für die Herren vom Alexanderplatz brauchen. Was steht es also? Sind wir im Geschäft?«
»Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich unserem Freund Menkenke erkläre, seine Tochter wolle sich ihre zarte Mädchenseele beim Anblick nackter Männerleichen verderben!«, rief Leiser. »Und unter lauter Burschen studieren wolle sie obendrein!«
»Ach, hören Sie schon auf«, gab Perdita unbeeindruckt zurück. »Wenn es so etwas wie eine Seele überhaupt gibt, obwohl wir bei all den Autopsien nie auch nur eine einzige gefunden haben, dann gibt’s an meiner nichts mehr zu verderben. Und die Studenten werden mich schon nicht fressen. Denen bin ich zu zäh.«
Damit marschierte sie hinüber in das kleine Büro, wo Gerichtsmediziner Friedlieb Dokumente aufbewahrte, mit denen er noch nicht abgeschlossen hatte. Warum er damit nach zwei Jahren nicht abgeschlossen hatte, war ihr zwar ein Rätsel, aber wenn Leiser im Archiv nichts gefunden hatte, konnte das Protokoll nur hier sein. Und im Gegensatz zu seinem Kollegen ordnete Friedlieb alles säuberlich und alphabetisch.
Perdita wusste, sie hatte genug gesagt, und soweit es ihm möglich war, würde Leiser ihr helfen. Auch wenn er das, was sie vorhatte, nicht guthieß. So arbeiteten sie hier zusammen, die Leute vom Gerichtsmedizinischen Institut. Nicht alles, was einer von ihnen tat, mussten die anderen mögen, aber weil sie den, der es tat, mochten, nahmen sie es letzten Endes hin.
Sie fischte den Schlüssel zum Aktenschrank aus Friedliebs penibel aufgeräumter Schublade und öffnete das Schloss. Peinlich genau beschriftet reihte sich Protokoll an Protokoll. Von A wie Abergast über F wie Franke bis M wie Mehnert. Der Buchstabe S, und darin eingebettet das S-C-H, war rasch gefunden, und Perdita streckte schon die Hand danach aus, doch sie hielt inne.
Das gesuchte Protokoll war nicht da.
›Schmidt, Hubertus‹ gab es und ›Schweinitz, Gertrude‹, aber dazwischen, wo ›Schneider, Susette‹ hätte stecken müssen, klaffte eine Lücke.
Jemand musste das Dokument entfernt haben, und noch im selben Atemzug stellte sich Perdita die Frage, ob derjenige dazu befugt gewesen war.
2
Ein paar Wochen zuvor, im September, hatte sie den Maler kennengelernt. Kurz darauf führte er sie in seinen Bekanntenkreis ein, und seither hatte sich ihr gesamtes Leben um hundertachtzig Grad gewandelt.
Minda war allein in der großen Stadt gewesen, sie hatte nicht gewusst, wie sie sich durchschlagen sollte, und hatte bald auch die fünf Mark Monatsmiete für ihr Zimmer in der Pension nicht mehr auftreiben können. Vor allem aber hatte sie nicht gewusst, wie sie die endlosen Tage und Abende herumbringen sollte und wie die Einsamkeit mit all den finsteren Gedanken zu ertragen war.
Minda war Schauspielerin. Sie war aus einem Dorf in Anhalt nach Berlin gekommen, um hier ihren Weg zu gehen, und es war ihr auch sofort gelungen, ein Engagement zu ergattern. An Begabung fehlte es ihr nicht. Sie konnte tanzen und singen, hatte verschiedene klassische und moderne Rollen einstudiert, und sie war ungewöhnlich hübsch. Jeder sagte das. Leider hatte der Theaterleiter, der sie vom Fleck weg engagiert hatte, ihr nicht viel zahlen können, und das Publikum hatte ihren Dialekt nicht gemocht. Die Leute hatten sie ausgelacht und gebuht, als der Vorhang fiel, weshalb der Mann Minda nach ein paar Aufführungen hatte gehen lassen müssen.
»Das Zeug dazu hast du, aber mit diesem Dialekt kann das nichts werden bei dir«, hatte er gesagt und ihr geraten, Sprechunterricht zu nehmen. Den Rat hätte Minda nur zu gern befolgt, doch leider fehlte es ihr am nötigen Kleingeld.
Ihr Vater in Anhalt war kein armer Mann, sondern ein Beamter im höheren Dienst, aber er hatte vier Töchter, die ihm auf der Tasche lagen. Von dieser Idee mit Berlin und der Schauspielerei hielt er außerdem wenig. Minda hatte ihn schließlich dazu gebracht, ihr einen kleinen monatlichen Betrag zu zahlen, indem sie ihm vorgeschwärmt hatte, dass sie reich und berühmt werden und ihm dann alles doppelt und dreifach zurückzahlen würde. Im Grunde war ihr Vater stolz darauf, dass eine seiner Töchter eine so augenfällige Schönheit war, und die Vorstellung, sie könne eines Tages auf einer namhaften Bühne stehen, gefiel ihm nicht schlecht. Also tat er für sie, was er konnte. Nur reichte das Geld, das er ihr anwies, eben vorne und hinten nicht.
Bis Minda den Maler kennenlernte.
Er begegnete ihr im Café Dalles, wo sie sich die billigste Mittagsmahlzeit – Eierspeise mit Kartoffeln – nicht hatte leisten können, beglich ihre Zeche und fragte sie ohne Umschweife, ob sie ihm gegen Bezahlung Modell stehen würde.
Nackt.
Minda war nicht von gestern. Was einer wie der Maler, der Eduard Stückgold hieß, mit Modellstehen meinte, glaubte sie zu wissen, und wenn sie hundertmal vom Dorf stammte. Sie war keine Käufliche. Aber sie brauchte das Geld, sie ging an ihrer Einsamkeit zugrunde, und wenn sie ihn am helllichten Tag in seinem Atelier in der Ansbacher Straße aufsuchte, würde schon nichts geschehen, was sie nicht wollte.
Es geschah nichts, was sie nicht wollte. Daraus, dass er in sie verliebt war, dass er gern alles von ihr gehabt hätte, machte Eduard Stückgold keinen Hehl, doch er nahm sich weder Freiheiten heraus, noch gestand er sich die geringste Hoffnung zu. »Wenn sich ein hässlicher Vogel wie ich an einer solchen Schönheit vergreifen würde, käme das einem Sakrileg gleich«, sagte er, der in der Tat so hässlich war, dass Minda sich anfangs erschrocken hatte. Sein Gesicht hatte etwas von einer Dörrpflaume, und sein Haar war grau wie Eisen, obwohl er noch keine dreißig war.
Statt zu versuchen, sie zu verführen, malte er sie. Nackt. Aber nicht obszön, sondern richtiggehend künstlerisch. Minda hatte von bildender Kunst nicht viel Ahnung. Ihre Liebe galt dem Theater, aber dass Eduard Stückgold etwas konnte, erkannte sogar sie. Und er bezahlte sie für die Nachmittage, an denen sie in seinem schlecht beheizten Atelier stundenlang mit erhobenen Armen vor ihm still stand. Keine Reichtümer, aber immerhin genug für die Miete, eine warme Mahlzeit im Café Dalles und ein paar Bier gegen die Einsamkeit der Abende.
Der Maler war auch arm. Aber seine Art von Armut war wesentlich leichter erträglich. Es war eine Armut, bei der man immer mit einem plötzlichen Geldsegen rechnen konnte, bei der man Freunde hatte, die einen im Notfall freihielten, und Gastwirte, die einen anschreiben ließen. Freunde hatte Eduard Stückgold jede Menge, einen ganzen Kreis von Künstlern, Literaten und faszinierenden Gestalten, die sich allabendlich in einer Kneipe an der Neuen Wilhelmstraße trafen. Der Name jener Kneipe wurde nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, und anfangs hatte sich Eduard gesträubt, Minda dorthin mitzunehmen.
»Sie würden über dich herfallen, würden dich verderben, und ich will dich so unschuldig und makellos behalten, wie ich dich gefunden habe«, hatte er gesagt.
Minda aber hatte ihm keine Ruhe gelassen, und so hatte er sich eines Abends breitschlagen lassen. Sie hatte ihr schönstes Kleid angezogen, ein blaues, das ihren Körper umschloss und durch die hautfarbene Spitze am Ausschnitt etwas diskret Frivoles hatte. Das Haar hatte sie aufgesteckt, weil sie wusste, dass diese Frisur die sanfte Linie ihres Nackens und ihrer Schultern besonders zur Geltung brachte. Im Grunde war sie kein sonderlich eitles Mädchen, sondern fand im Gegenteil, dass all das Getue um Äußerlichkeiten lästig und übertrieben war. Sie wusste jedoch, dass darin ihr Kapital bestand, das Pfund, mit dem sie zu wuchern hatte wie ein Mann mit seinem scharfen Verstand, seinem ererbten Namen oder seinen körperlichen Kräften.
»Du siehst wie eine Göttin aus«, hatte der Maler gesagt. »Da dies so oder so der Abend ist, an dem ich dich verlieren werde, können wir es genauso gut rasch hinter uns bringen.«
Anfangs war sie enttäuscht gewesen. Der Sommer war gerade zu Ende gegangen, die Abende waren noch recht lange hell, und sie waren erst aufgebrochen, als es bereits stockfinster war. An der Ecke, wo sich die Kneipe befand, stand nur eine einzige funzelige Laterne, aus der Kneipe drang kein Licht auf die Straße, und es gab kein Ladenschild. Überhaupt machte das Etablissement nicht das Geringste her und hatte mit Mindas Vorstellungen von ein wenig Glanz und Glamour nichts zu tun. Über der Tür hing an vier rostigen Eisenketten ein scheußlicher schwarzer, prall gestopfter Sack, der an ein Schwein ohne Kopf erinnerte.
Der Maler bemerkte ihren Blick. »Ein alter Weinschlauch«, erklärte er. »Jemand fand das komisch, hat es hier aufgehängt, und seither heißt die Kaschemme für jedermann nur noch Zum Schwarzen Ferkel.«
Er hielt Minda die Tür auf. Bierdunst, Schweißgestank und der Qualm von billigen Zigaretten wallten ihr entgegen. In dem Raum mit der niedrigen Decke, in den sie traten, war es fast so dunkel wie draußen auf der Straße, und an dreien der vier Wände stapelten sich Fässer und Flaschen mit Wein und Schnaps. Was an Platz übrig blieb, war mit Menschen vollgestopft, die samt und sonders mit Trinken beschäftigt waren. Einige wandten die Köpfe, verschiedene versuchten sogar, Eduard und Minda anzusprechen, aber der Maler zog sie rasch weiter, auf eine hohe, aus dunklem Holz gezimmerte Theke zu.
Eine Frau stand dahinter, die Getränke zubereitete, wobei ihr das blonde, wie bei einer Meerjungfrau verzottelte Haar übers Gesicht fiel. Zu Mindas Verblüffung öffnete sich neben der Theke durch einen Rundbogen ein weiterer, etwa ebenso großer Raum, in dem längere Tische standen und in der Mitte eine kleine Tanzfläche ausgespart war. Auch hier stapelten sich Wein- und Schnapsflaschen an den Wänden, doch an der hinteren stand außerdem ein Klavier, an dem ein Mann sich offenbar gerade bereit machte, den Tasten Töne zu entlocken. Der Raum hier war weniger überfüllt, und die Gäste schienen erlesener. Abgerissen und betrunken waren auch sie, doch dabei vertieft in lebhafte Unterhaltungen und schon auf den ersten Blick nicht wie gewöhnliches Volk wirkend.
»Guten Abend, Eduard, altes Haus!«, rief ein Jüngling, der auf hellblonde, fleischige, beinahe weibliche Weise hübsch war und einen samtenen, veilchenfarbenen Gehrock trug. »Und wen bringst du uns denn da? Eine zauberhafte Unbekannte? Je später der Abend, desto schöner die Gäste – nur herein, nur herein, Guglielmo hat sich gerade erboten, uns aufzuspielen.«
Er sprach mit einem seltsamen Zungenschlag, den Minda nicht zuordnen konnte und der, wie er ihr später erklärte, der Akzent der Kaukasiendeutschen war.
»Aus Tiflis bin ich«, stellte er sich ihr vor, nachdem er dafür gesorgt hatte, dass der Platz neben seinem für sie frei gemacht und eine Flasche besten Weines für sie bestellt worden war. »Genauer gesagt aus Alexandersdorf. Eugen Küchelbecker mein Name, Meyerhold von der Mutterseite, und Dichter mein Stand. Nun ja.« Sein Lächeln war schüchtern, es ließ ihn so jung wirken, als ginge er noch zur Schule und trüge kurze Hosen. »Die Kunst ist ja brotlos, wer wüsste das besser als wir, die wir ihre Sklaven sind. Meinen Unterhalt bestreite ich also nicht durch die Werke meines Geistes, sondern durch meine Einkünfte als Kaufmann. Agrarerzeugnisse. Vom Winterweizen bis zum Zuchtpferd bekommen Sie bei mir alles.«
Der Klavierspieler hieb in die Tasten, spielte ein düsteres, wuchtiges Stück, das zum Tanzen viel zu bombastisch schien. Dennoch begaben sich einige Paare auf die Fläche und tanzten auf so laszive Weise miteinander, dass Minda der Mund offen stand.
Ich bin wirklich ein Landei, dachte sie. Und das hier ist endlich die große Stadt.
Eugen Küchelbecker dachte nicht ans Tanzen, sondern schwadronierte ohne Punkt und Komma weiter. Mindas Eindruck nach war er jedoch keiner von den Männern, die sich selbst gern reden hörten, sondern schwafelte so viel, um seine Verlegenheit zu überspielen. Zu den wichtigen Leuten, die im Schwarzen Ferkel die Strippen zogen, gehörte er offenbar nicht, obwohl er wohlhabender war als die anderen und die meisten freihielt.
Vermutlich ein Jüngelchen, das nach Berlin gekommen war, um das Vermögen seines Vaters durchzubringen. Nicht unsympathisch. Und vor allem nicht unpraktisch mit den Spendierhosen, in denen er ständig herumlief. Wichtigere Rollen aber hatten zum Beispiel der Pianist Wilhelm Schlederer, der sich selbst Guglielmo nannte, der Schriftsteller Ehrenwein, der an einer Geschichte des Verbrechens schrieb, und auch der Maler Eduard Stückgold inne.
Zu jenen kamen noch weitere, die im Laufe der Nacht vollkommen außer Rand und Band gerieten, geradezu orgiastisch auf den Tischen tanzten, sich Kleidungsstücke vom Leib rissen und flaschenweise Alkohol in sich hineinschütteten. Die polizeilich vorgeschriebene Sperrstunde schien im Schwarzen Ferkel keine Gültigkeit zu haben. Gefeiert wurde so lange, bis sich von einem Augenblick auf den anderen auf dem verdreckten Boden der Tanzfläche ein vielfarbig glitzerndes Mosaik abzeichnete, ein Regenbogen ganz besonderer Art.
Dies geschah, sobald durch das mit bunten Flaschen vollgestellte Fenster die Morgensonne brach und sich in dem Grün, dem Goldbraun und dem Violett des Glases spiegelte. Es war der Augenblick, in dem Gustav Russ, der Wirt des Lokals, der sich die ganze Nacht im Hintergrund hielt und seine Gäste sich selbst überließ, durch die beiden Schankstuben schlurfte, die verbliebenen Schnapsleichen einsammelte und sie eher pragmatisch als sanft vor die Tür beförderte.
Minda blieb immer bis zum allerletzten Moment. Sie liebte die Nächte im Schwarzen Ferkel, das Tanzen, das Trinken, das Beisammensein, die Komplimente und schwärmerischen Blicke, doch vor allem die abertausend Möglichkeiten, die sich in jeder neu heraufziehenden Nacht aufzutun schienen.
Mit der Einsamkeit war es vorbei. Tagsüber schlief sie, und in der Nacht verschmolz sie im Ferkel mit den Reizen der großen Stadt.
Eduard Stückgold beklagte sich, dass sie kaum noch Zeit für ihn hatte, aber Minda war kein undankbares Mädchen. Wann immer es sich einrichten ließ, suchte sie ihn auch jetzt noch in seinem Atelier auf und stand ihm Modell.
»Solange du ihnen allen gehörst und keinem im Besonderen, gehörst du im Grunde auch mir noch ein wenig, nicht wahr?«, hatte er sie gefragt.
Sie hatte gelacht. »Gehören tu ich keinem, aber dir vielleicht ein winziges bisschen.«
In gewisser Weise hatte das der Wahrheit entsprochen, auch wenn sie mit Guglielmo in eine ebenso stürmische wie kurze Affäre gestolpert war und einer aus dem Heer der Dichter, ein Pole namens Stani, ihr einen Verszyklus gewidmet hatte. Das alles war wie ein Aufflackern, das gleich wieder erlosch, um etwas Neuem Platz zu machen. Minda wollte etwas erleben, wollte Ziele erreichen, eine Zukunft haben – aber die Ziele und die Zukunft konnten noch ein wenig warten. Für den Augenblick hätte es ihr völlig genügt, wenn alles noch eine Weile lang so geblieben wäre, wie es war.
Dann aber waren eines Nachts die beiden gekommen.
Die beiden.
So nannten die anderen sie.
»Heute Nacht kommen die beiden – Tadeú ist wieder in der Stadt«, hatte Ariadne, die Barfrau mit den blonden Meerjungfrauenzotteln, verkündet, und drinnen war das Gemunkel weitergegangen:
»Bin gespannt, wann die beiden sich heute Nacht blicken lassen.«
»Wer weiß, ob Tadeú nicht allein kommt.«
»Nicht heute. Nicht, wenn er gerade erst wieder da ist. Heute kommen sie beide.«
Guglielmo wartete mit dem Klavierspielen, und die Paare warteten mit dem Tanzen. Selbst mit dem Trinken, dem sie sich sonst wie in einem Wettbewerb hingaben, waren sie alle heute ein wenig langsamer. Der ganze Saal voller Lebenskünstler schien im Warten gefangen, als hätte die Zeit eine Pause gemacht.
»Was hat es denn auf sich mit diesen beiden?«, fragte Minda Eugen Küchelbecker, doch der Kaukasier, der für gewöhnlich die Freundlichkeit eines wandelnden Auskunftsbüros an den Tag legte, schüttelte unwillig den Kopf.
»Ich mag es nicht, dass immerfort von den beiden geredet wird, wo es doch in Wahrheit nur Tadeú ist, der zu uns gehört«, bekundete er. »Tadeú, unser König, gekrönt mit Weinlaub im Haar, Tadeú, der uns gefehlt hat und der nun endlich zurückgekommen ist. Dass er dauernd diesen Leichenfledderer, diesen Totenflüsterer mitbringt, ist die reinste Unsitte, aber das ist nur vorübergehend. Es wird sich genauso wieder legen wie jede frühere kurze Affektion. Tadeú braucht niemanden an seiner Seite. Tadeú ist ein Solitär. Und er hat uns.«
»Um ehrlich zu sein, ist Küchelbecker ein bisschen plemplem«, hatte Minda vor Kurzem zu Eduard gesagt, und jetzt dachte sie es von Neuem. Vielleicht waren die alle so, die Kaukasier – überspannt, zu heiß gebadet oder so, als verpassten sie sich ständig etwas Stärkeres als Kokain. Meistens fand sie es lustig, manchmal ging es ihr auf die Nerven. In jener Nacht vergaß sie es. Weil gleich darauf die beiden kamen.
Sie waren füreinander gemacht, dachte Minda, als die zwei Männer kurz vor Mitternacht unter stürmischem Hallo den Schankraum betraten. Minda war Schauspielerin, sie verstand sich auf Auftritte, und der Auftritt der beiden war perfekt. Der eine fungierte als Kulisse des anderen. Tadeú war groß, hager, schmutzig blond wie ein Straßenköter. Er hatte einen Spitzbart und ein Gesicht wie ein hungriger Wolf. Sein Gefährte war kleiner, elegant und dunkel wie die Höllennacht. Der Anzug des einen war zusammengewürfelt und verschossen, der des anderen schwarz, schmuck und ihm auf den Leib geschneidert wie ein Raubtierfell. Umwerfend waren sie beide, der eine auf schöne, der andere auf hässliche, fast abstoßende Weise. Dazu von einer Nonchalance, als wäre ihnen nur allzu bewusst, dass dieser Raum voller Menschen die ganze Nacht hindurch nichts anderes getan hatte, als auf sie zu warten.
Es war ihnen bewusst. Die Schankstube war in einen Dornröschenschlaf gefallen, und jetzt küsste Tadeú mit teuflisch gerecktem Spitzbart die Luft, und sie erwachte von Neuem zum Leben. Klavierspiel setzte ein, Paare begannen zu tanzen, schwelgende Gedichte wurden rezitiert, und der Wein floss wie von selbst aus Flaschenhälsen in ausgedörrte Kehlen. Minda hatte vorgehabt, noch ein wenig länger Beobachterin zu bleiben, doch keinen Atemzug später fand sie sich bereits im Herzen des Geschehens.
»Und wen haben wir hier?« Seine Stimme war Verführung und Bedrohung zugleich – undenkbar, sich ihr zu entziehen. Er legte den Arm um ihre Taille und roch nicht ganz sauber, doch selbst das gefiel ihr. »Dass du noch nie hier warst, weiß ich, denn auch wenn die meisten in diesem Stall zum Vergessen sind – dich hätte ich im Gedächtnis behalten.«
»Gehört es sich nicht, dass der Herr sich zuerst vorstellt?«, fragte Minda.
»Das mag sein«, erwiderte er und stierte mit seinen brennenden Augen in die ihren. Sie hatten nicht dieselbe Farbe. Das eine war hell, entweder grau oder blassblau, das andere grün. »Es mag sogar sehr wohl sein, ich aber tue nie, was sich gehört.«
»Aha.«
»Also sag’s mir – wer bist du?«
»Minda.«
»Skandinavierin?«
»Meine Großmutter stammte aus Norwegen.«
»Daher die Rasse.« Er blickte an ihr hinauf und hinunter, zog eine flachshelle Strähne aus ihrer Frisur und ließ sie durch die knochigen Finger gleiten. »Ich will dich haben, Norweger-Minda.«
Durch Mindas Leib zuckten kleine schmerzhafte Blitze. Sie war es sich schuldig, dass sie die Ruhe bewahrte, aber das war viel leichter gesagt als getan.
»Ob ich dich auch haben will, sage ich dir, wenn ich weiß, wer du bist«, verwies sie ihn.
»Ich bin der Teufel«, raunte er.
Mindas Kehle entrang sich ein kleines, zu hoch geratenes Lachen. »Ist das nicht ein bisschen albern? Und aufgeblasen?«
»Nein«, sagte er, ohne zu lachen.
Eine Nacht und einen Tag später befand sie, dass die Bezeichnung als Spitzname für ihn zumindest nicht schlecht taugte.
Und in den Tagen und Nächten, die folgten, erfuhr sie, dass nicht wenige Leute im Ferkel überzeugt waren, dass seine Behauptung der Wahrheit entsprach.
Da war sie jedoch bereits mit Tadeú, dem Teufel, in eine Affäre getaumelt, aus der sie sich kein Entkommen mehr vorstellen konnte. Was er ihr gab, war viel mehr als Sex. Es erhöhte sie, weckte Kräfte, von denen sie nie geglaubt hatte, dass sie in ihr verborgen lagen, machte sie, die von den Theaterbesuchern verlachte Minda Ackermann aus Anhalt, zu einem Menschen, der sich ebenso wie Tadeú selbst über andere Menschen erhob. An seiner Seite konnte nur bleiben, wer wie er zu Großem geboren war. Er gehörte ihr, und sie gehörte ihm. Für den Maler Eduard Stückgold hatte sie fortan keine Zeit mehr.
3
Sie hatte kein Abitur. Keine Zulassung zu einem Studium, das bisher in Preußen noch keine einzige Frau erfolgreich abgeschlossen hatte. Ja, seit zwei Jahren konnten Frauen theoretisch Zugang erlangen, doch wurde es ihnen auch ermöglicht, diesen wahrzunehmen? Im gesamten deutschen Reich hatten bisher nicht mehr als neun Studentinnen in Medizin promoviert, und diese hatten etliche Umwege über Universitäten in der Schweiz und im Elsass hinter sich bringen müssen, um schließlich an ihr Ziel zu gelangen.
In Anbetracht dessen, was diese Frauen auf sich genommen hatten, fühlte Perdita sich jämmerlich klein. Sie waren Pionierinnen, denen nichts zu beschwerlich war. Sie selbst hingegen hatte sich nicht einmal überwinden können, die langweilige Schulzeit bis zum Ende abzusitzen.
Von ihrer Schwesternausbildung ganz zu schweigen.
»Wenn Sie ausgelernt hätten, könnten wir zumindest von gewissen Grundkenntnissen in Anatomie bei Ihnen ausgehen«, hatte der bebrillte Angestellte im Zulassungsbüro der Friedrich-Wilhelms-Universität gebrummt, die Stirn in Falten gelegt und in obskuren Papieren geblättert. »Aber so? Was haben Sie denn überhaupt vorzuweisen, meine Liebe?«
»Ich bin im Leichenschauhaus aufgewachsen«, konnte Perdita sich nicht verkneifen, zu sagen. Dass ihr das bei dem Bebrillten keine Punkte einspielen würde, war ihr allerdings selbst klar.
Wie sich herausstellte, entschied sich der Mensch, ihre Antwort geflissentlich zu ignorieren. »So oder so lässt sich für uns nicht ersehen, ob Sie zum wissenschaftlichen Studium und Beruf eine Eignung mitbringen«, schwafelte er weiter, und Perdita fühlte sich noch ein bisschen kleiner.
Ob sie zum wissenschaftlichen Studium eine Eignung mitbrachte, bezweifelte sie ja selbst. Alles, was sie wollte, war, den Toten ihre Geheimnisse abzuringen, sie ihre Geschichten erzählen zu lassen, die andernfalls nie mehr ein Mensch zu hören bekommen würde. Und sie wollte es in leitender Funktion tun, in der sie selbst Entscheidungen treffen durfte, nicht als kleine, nicht einmal offiziell angestellte Obduktionsassistentin, die Anweisungen auszuführen hatte, ob sie sie guthieß oder nicht.
So ähnlich hatte sie es ihrem Vater erklärt, weil sie wusste, dass etwas davon in ihm einen Nerv treffen würde. Er wollte seine Tochter schützen, er betrachtete es als seine höchste Pflicht, für sie einzustehen. Aber er betrachtete es auch als seine Pflicht, für die Toten einzustehen, für die, die keine Stimme mehr hatten und sich nicht länger wehren konnten.
Leo Leiser, der Leisetreter, hatte Perdita dabei zwar nur sehr halbherzig sekundiert, doch seine Anwesenheit verlieh ihrer Erklärung einen seriösen Anstrich. Sie war ihm dankbar. Nachdem sie ihm das versprochene Protokoll zum Susette-Schneider-Fall nicht hatte liefern können, wäre er nicht dazu verpflichtet gewesen, aber mit solchen Mitteln spielte er nicht.
»Es ist ja nicht Ihre Schuld, dass bei uns eine solche Schlamperei herrscht«, hatte er gesagt.
Dass das Protokoll aus anderen Gründen als Schlamperei verloren gegangen sein könnte, wollte er gar nicht erst in Betracht ziehen. »Hier kommt doch niemand herein als unsere eigenen Leute, die Polizei und die Herren von den Bestattungsunternehmen«, hatte er versucht, sie zu überzeugen.
Die Herren von den Bestattungsunternehmen waren die Letzten, denen Perdita über den Weg traute, namentlich einem bestimmten Herrn, aber Leo Leiser winkte ab. »Liebes Menkchen, selbst wenn einer hier bei uns etwas stehlen wollte – dann doch ganz bestimmt nicht die paar Fetzen Papier über jenes erbarmungswürdige Menschenkind, das freundlos und im Elend von der Welt gegangen ist.«
Dabei war es geblieben. Offenbar hatten die Kommissare vom Alexanderplatz ihre Anfrage auch recht bald wieder fallen lassen. Nicht einmal ihnen war Susette Schneider wirklich wichtig gewesen, und wenn Perdita nicht die Möglichkeit bekam, selbst als Gerichtsmedizinerin ihren Weg zu machen, würden Verstorbene wie sie auch weiterhin niemandem wichtig sein.





























