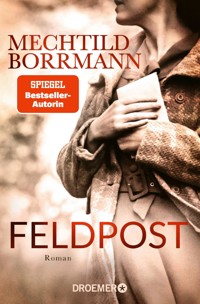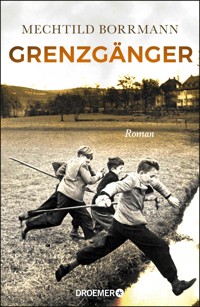9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die andere Häfte der Hoffnung - nominiert für den renommierten Friedrich-Glauser-Preis 2015! Valentina wartet auf die Rückkehr ihrer Tochter aus Deutschland. Seit Monaten hat sie nichts mehr von ihr gehört. Sie scheint spurlos verschwunden – wie viele andere Studentinnen, die angeblich ein Stipendium in Deutschland erhalten haben. Valentina lebt dagegen in der verbotenen Zone von Tschernobyl, ihrer alten Heimat. Um dem trostlosen Warten und dem bitterkalten Winter zu trotzen und die Hoffnung nicht zu verlieren, beginnt Valentina ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. In Deutschland versteckt währenddessen Martin Lessmann eine junge osteuropäische Frau vor ihren Verfolgern. Als sie sich kurz darauf die Pulsadern aufschneidet, rettet er sie ein zweites Mal – und erfährt Ungeheuerliches. Zeitgeschichte packend aufbereitet - ein Roman der Spuren hinterlässt! »Virtuos, meisterlich erzählt. Zeitgeschichte packend aufbereitet – ein Krimi der absoluten Spitzenklasse.« hr-online
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mechtild Borrmann
Die andere Hälfte der Hoffnung
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Walentyna lebt in der verbotenen Zone von Tschernobyl. Hier lebt nur, wer nicht anders kann oder wer gezwungen ist, sich zu verstecken. Die alte Frau wartet auf die Rückkehr ihrer Tochter, von der sie seit Monaten nichts mehr gehört hat. Sie scheint spurlos verschwunden – wie viele andere Studentinnen, die im Jahr 2009 angeblich mit einem Studienstipendium nach Deutschland gegangen sind. Um dem trostlosen Warten und dem bitterkalten Winter zu trotzen, beginnt Walentyna ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben.
In Deutschland versteckt währenddessen Matthias Lessmann eine junge osteuropäische Frau vor ihren Verfolgern. Barfuß und nur leicht bekleidet stand sie eines Februarmorgens auf seinem Hof. Wenig später schneidet sie sich die Pulsadern auf. Lessmann rettet der jungen Ukrainerin ein zweites Mal das Leben und erfährt eine Geschichte von ungeheuerlicher politischer Brisanz …
Inhaltsübersicht
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Epilog
Personenverzeichnis
Danksagung
Hoffnung ist die zweite Seele der Unglücklichen.
Johann Wolfgang von Goethe
Kapitel 1
Zyfflich, Sonntag, 14. Februar 2010
Matthias Lessmann stand mit der Schale Körnerfutter im Hof. Er ignorierte die Hühner, die sich gackernd um ihn versammelten, kniff die Augen zusammen und blickte zur Landstraße. Eine Frau – oder war es eher ein Mädchen? – kam die schmale Asphaltstraße entlang. Sie ging in Richtung Dorf. Manchmal blieb sie stehen, drehte sich suchend um, schien unschlüssig, wankte.
Resigniert schüttelte Lessmann den Kopf. Diese jungen Leute heutzutage. Immer verrückter wurden die. Wahrscheinlich hatte das Mädchen bis in den Morgen gefeiert und zu viel getrunken. Aber das ging ihn nichts an.
Seit sie vor drei Jahren aus der großen Scheune auf dem Eichenhof eine Wochenenddisco gemacht hatten, rasten nachts Autos an seinem Haus vorbei oder betrunkene Jugendliche grölten auf der Straße.
Er streute mit kleinen runden Bewegungen die Körner auf den Hühnerhof. Von der Obstwiese flogen Meisen aus den kahlen Ästen der Apfel- und Kirschbäume herbei, landeten zwischen den Hühnern und ergatterten hier und da ein paar Körner. Er ging zum Schafstall, öffnete den Verschlag, und die Tiere rannten blökend über die hart gefrorene Wiese zum Gatter, forderten Heu und Wasser. Er folgte ihnen gemächlich, an seiner Seite die alte Schäferhündin Bella. Auf den beiden Eimern, die er am Vortag mit frischem Wasser gefüllt hatte, lagen dicke Eisschichten.
Wieder sah er hinüber zur Straße. Das Mädchen war näher gekommen.
Ja war die denn verrückt? Nur ein dünnes schwarzes Kleid mit Trägern. Eher eine Art Unterrock. Und das bei minus zehn Grad.
Auch Bella hatte jetzt Witterung aufgenommen, lief unruhig am Zaun, der die Schafwiese von der Straße trennte, auf und ab und bellte.
Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Die war ja barfuß. Wer war die denn? Die Kleine von den Wegners? Nein. Jessica Kröger? Nein. Nein, die war nicht von hier. Warum drehte die sich dauernd um? Hoffte die auf ein Auto? Auf eine Mitfahrgelegenheit?
Er hob die Wassereimer über das Gatter, schlug sie gegen einen der Zaunpfähle, bis sich die Eisschicht auf der Wasseroberfläche vom Eimerrand löste, dann schüttete er den Inhalt aus. Er ging hinüber zur Scheune und holte einen Heuballen. Wieder blickte er zur Straße. Sie war verschwunden. Bella bellte die Straße an. Sein Blick wanderte über das flache Land, über die mit Rauhreif überzogenen, weiß glitzernden Felder und Wiesen. Im Osten zeigte sich die gebogene Linie der aufgehenden Sonne mit einem blassen, fast violett schimmernden Hof. Ein sicheres Zeichen für weitere Kälte und Schneefälle.
Wo war das Mädchen hin?
Er zog sein Taschenmesser aus der Hosentasche, schnitt die beiden Bänder durch und verteilte das Heu in der Raufe. Augenblicklich stellten die Schafe ihr Blöken ein.
Er hörte Motorengeräusche. Im Schritttempo fuhr ein schwarzer Geländewagen die Landstraße entlang.
Als das Auto hinter der nächsten Biegung verschwand, sah er sie wieder. Sie krabbelte aus dem Graben zwischen Feld und Straße und blieb gut zwanzig Meter von ihm entfernt stehen. Die Hündin kläffte aufgeregt. Er ging auf die Hecke zu, die sein Grundstück abgrenzte. Das Mädchen hatte die Arme um den schmalen Körper geschlungen und schien am ganzen Leib zu zittern. »Hilfe«, sagte sie. »Bitte, helfen Sie mir.«
Lessmann rief »aus«, und die Hündin war augenblicklich ruhig. Sein erster Impuls war, zu den Schafen zurückzukehren. Das Dorf war zwei Kilometer entfernt. Das konnte sie schaffen. Was hatte er mit der zu tun? Die würde nur Ärger und Unannehmlichkeiten bringen. Außerdem hatte sie diesen Akzent, war sicher Ausländerin, verstand ihn womöglich nicht mal.
Er zeigte in Richtung Kirchturm.
»Das Dorf ist nicht weit«, rief er. »Keine zwei Kilometer.«
Wieder hörte er Motorengeräusche und wusste, ohne das Auto zu sehen, dass es der Geländewagen war, der zurückkam. Auch sie schien ihn zu hören. Sie lief an der Hecke entlang auf die Hofeinfahrt zu. Bella rannte ebenfalls los. Er rief die Hündin zurück, und dann tat Matthias Lessmann etwas, das ihm nur selten passierte. Er handelte, ohne nachzudenken.
Er öffnete das Tor, fasste nach ihrem Arm und zog sie über den Hof hinter sich her zur Scheune.
Der Wagen wurde langsamer, kam näher und hielt an.
»Aufpassen«, sagte er zu Bella, und die Hündin lief los, stellte sich in die Hofeinfahrt und knurrte das Auto an.
Die Frau kauerte hinter einem Stapel Heuballen. Er konnte das Klappern ihrer Zähne hören.
Mit der Rechten fuhr er sich durch seine zu langen grauen Haare. Was war bloß in ihn gefahren? Er wollte doch nur seine Ruhe, und jetzt hatte er sich den Ärger direkt auf den Hof geholt. Vielleicht war das ein Vater, der nach seiner Tochter suchte, oder ein Ehemann. Vielleicht war die verheiratet. Aber irgendwas passte nicht.
Er stand im Schutz der offenen Stalltür und spähte durch den Spalt, den die Türangeln zwischen Wand und Tor ließen. Im Wagen saßen zwei Männer, die sich suchend umsahen. Der Fahrer spielte mit dem Gaspedal, der Motor heulte mehrere Male auf, bis sie endlich im Schritttempo weiterfuhren.
Er schaute den Rücklichtern nach. Als sie hinter der nächsten Kurve verschwunden waren, trat er in das Innere der Scheune.
Sie saß, zu einem kleinen Päckchen zusammengekauert, zwischen den Heuballen. Ihre Zähne schlugen aufeinander, und das gleichmäßige Klappern erinnerte ihn an die alte Nähmaschine seiner Frau, wenn sie Vorhänge genäht oder Kleider geändert hatte.
Sie kauerte da und starrte ihn mit großen braunen Augen an, wie ein Beutetier den Jäger.
Er hob die Hände und zeigte seine Handinnenflächen.
»Hey, hey«, sagte er, wie er es bei seinen Tieren tat, wenn sie scheuten. »Ich tue dir doch nichts.«
Ihr Atem ging stockend.
»Ist das Auto weg?«, fragte sie, und jetzt meinte er, einen osteuropäischen Akzent zu erkennen.
»Ja. Ja, das Auto ist weitergefahren.« Unschlüssig trat er von einem Bein auf das andere. Er sollte hinausgehen und den Schafen frisches Wasser bringen. Er sollte ihr klarmachen, dass sie jetzt gehen müsse, aber die Männer in dem Wagen hatten ihn beunruhigt, und er hörte sich sagen: »Komm mit ins Haus. Das Beste wird sein, wir rufen die Polizei.«
Das hatte nicht die erhoffte beruhigende Wirkung.
»Nein! Polizei … nein. Bitte, ich gehe, aber nicht Polizei!«, brachte sie zitternd vor Kälte mühsam hervor.
Lessmann zog seine Lammfellweste aus, die er über einem dicken Pullover trug, und reichte sie ihr. Er wusste nicht, warum er das tat.
Zögerlich nahm sie sie entgegen, schlüpfte hinein und zog sie vorne weit übereinander.
Sie war schrecklich dünn. Vielleicht hatte sie Hunger?
»Komm mit ins Haus«, sagte er versöhnlich. »Ich mach dir einen heißen Tee und ein Brot, dann sieht die Welt schon besser aus.«
»Keine Polizei!«, flehte sie noch einmal.
»Nein. Keine Polizei. Ist ja gut«, knurrte er.
Sie gingen zum Hintereingang, über die Deele in die Küche. Er zog seine Gummistiefel aus und schlüpfte in die abgetretenen braunen Pantoffeln. In der Küche nahm er den Kessel vom Herd, füllte ihn mit Wasser und zündete die Gasflamme an.
»Dauert ein bisschen«, sagte er und zeigte auf die vergilbte runde Kunststoffuhr, die einmal weiß gewesen war. Er sah sie an. »Setz dich.«
Sie schien den Raum zu inspizieren. Er war nicht auf Besuch eingerichtet. Eigentlich seit sechs Jahren nicht mehr. Seit dem Tod seiner Frau Vera.
Er nahm den Stapel Zeitungen von der Küchenbank und wischte mit der Hand über den fadenscheinigen grünen Polsterbezug.
»Bitte!«
Dann blickte er wieder auf ihre Füße und wusste, dass ein Tee da nicht helfen konnte. Sie müsste baden, heiß baden.
»Heiß baden«, sagt er, »das Beste wäre ein heißes Bad.« Das war nur ein Gedanke gewesen, den er mehr im Selbstgespräch zu sich sagte, wie er es sich in den letzten Jahren angewöhnt hatte.
Sie schluckte, senkte den Kopf und nickte.
Fahrig fuhr er sich mit der Hand über den Nacken, in seinem Blick lagen Überforderung und Hilflosigkeit.
»Aber dann musst du gehen, verstanden!«, sagte er heftiger als beabsichtigt.
Im Badezimmer, an einem der Haken an der Tür, hing sein schwerer, blaugrau gestreifter Bademantel. Er drehte das Wasser auf, fühlte die Temperatur, nahm den Bademantel vom Haken und brachte ihn ihr in die Küche.
»Dauert ein paar Minuten. Zieh den solange an.«
Sie versuchte ein dankbares Lächeln, das in ihren Mundwinkeln zitterte und zerbrach.
Plötzlich war er gerührt. Von diesem Zittern, von ihrer dünnen Gestalt, von der Art, wie sie sich ihm auslieferte.
Der Wasserkessel pfiff. Er suchte nach der Teekanne, fand sie im schmutzigen Geschirr in der Spüle und wusch sie notdürftig aus.
Auf dem Tisch schob er Papiere beiseite, räumte Tassen ab, stellte leere Bierflaschen in einen Kasten zurück. Wieder ging er ins Badezimmer, drehte den Wasserhahn zu, fühlte die Temperatur und nickte zufrieden.
In der Küchentür blieb er stehen und machte eine Geste in Richtung Bad.
»Das Wasser ist fertig«, sagte er.
Sie hatte sich den Bademantel über die Lammfellweste gezogen. Als sie hinüberging, schleifte der Saum über den abgetretenen Linoleumboden des Flurs wie die Schleppe einer verarmten Königin.
Er folgte ihr zum Badezimmer und blieb unschlüssig in der Tür stehen.
»Wenn man … wenn man sehr kalt geworden ist, durchgefroren … dann tut warmes Wasser weh. Du musst ganz vorsichtig hineinsteigen«, stotterte er, um sie auf den Schmerz vorzubereiten.
Sie nickte stumm.
Ihr langes braunes Haar verdeckte ihr Gesicht, als sie mit gesenktem Kopf den Bademantel und die Fellweste auszog. Ihr Kopf schien noch tiefer zu sinken, als sie nach dem Reißverschluss des dünnen Kleides griff.
»Moment!«, rief er erschrocken, verließ eilig das Bad und zog die Tür hinter sich zu.
Er blieb auf dem Flur stehen, lauschte ihrem zischenden Ein- und Ausatmen, mit dem sie dem Schmerz begegnete, als sie in die Wanne stieg. Dann wurde es still.
Erleichtert ging er in die Küche zurück, belegte ein Brot großzügig mit Gouda und stellte den Teller auf den Tisch. Oben im Schlafzimmer war noch Kleidung von Vera. Er hatte den Teil des Schrankes seit ihrem Tod nicht geöffnet, aber sicher gab es einen Mantel und vielleicht auch Schuhe, die ihr passten und die er dem Mädchen überlassen könnte. Vera hätte das sicher auch getan.
Er wusch zwei Tassen aus. Noch einmal blickte er auf das gestapelte, schmutzige Geschirr im Spülbecken. Der Zustand seiner Küche war ihm plötzlich unangenehm. Er räumte das Spülbecken aus, steckte den Stöpsel in den Ausguss und ließ Wasser ein. Als er das Geschirr abtrocknete und in die Schränke räumte, kam es ihm merkwürdig vor, dass er aus dem Badezimmer keinen Laut hörte. Er sah auf die vergilbte Uhr. Fast eine Stunde. Das Badewasser musste inzwischen abgekühlt sein. Sie musste doch wenigstens heißes Wasser nachlassen, sonst war sie bald wieder unterkühlt.
Er ging in den Flur und klopfte an die Badezimmertür.
»Hallo?«
Keine Antwort.
»Hallo, ist alles in Ordnung?«, fragte er unsicher.
Keine Antwort.
Er konnte doch nicht einfach reingehen. Seine Unruhe wischte alle Bedenken fort, und er drückte die Türklinke hinunter.
Noch einmal fragte er: »Hallo, ist alles gut?«
Dann schob er die Tür auf. Das Wasser war rot, eine seiner Rasierklingen lag vor der Wanne auf dem Boden.
Kapitel 2
Entfremdungszone, Oktober 2010
Über Nacht hat der Winter sein Brautkleid angelegt, und das Land funkelt in der Morgensonne. Strahlend schön.
Walentyna steht im Küchenwinkel am Fenster.
Oktober. Wenn die Kälte so früh kommt, wird sie lange bleiben.
Ljudmyla, die Nachbarin aus Trojeschtschina, hat ihrem Sohn Artem vor einigen Tagen Zucker, Salz, Mehl und Öl mitgegeben. Sogar vier Eier waren dabei. Artem arbeitet beim Zoll, bewacht im Vierzehn-Tage-Rhythmus die Entfremdungszone an einer der Straßen, die nach Belarus führen. Für diese Arbeit hatten sie Verbindungen spielen lassen und viel Geld bezahlt.
Einmal im Monat bringt er Walentyna die von seiner Mutter gewissenhaft gefüllten Taschen. Dafür hat Walentyna ihre Vierzig-Quadratmeter-Wohnung in Trojeschtschina Ljudmylas Tochter mit Mann und zwei Kindern überlassen. Sie selbst hat die Kosten für Strom, Gas und Wasser, die in den letzten Jahren unaufhörlich gestiegen waren, nicht mehr bezahlen können.
Artem hat ihr das Regal aus Klinkersteinen und groben Brettern gebaut, das den Ofen und das Schränkchen mit der Spülschüssel vom Rest des Zimmers trennt. Einige Gläser mit eingelegten Gurken, Tomaten, Bohnen, Pilzen und Pflaumen stehen darauf, und unter der Luke im Holzfußboden lagern Kartoffeln, Kohl und Äpfel. Von der Decke hängt getrocknete Minze und Kamille. Alles aus dem eigenen Garten oder in der Umgebung gesammelt. Das vorbereitete Brennholz wird für einen so langen Winter, wie er sich jetzt ankündigt, nicht reichen, aber Holz gibt es zur Genüge.
Kisa, die graugestreifte Katze, miaut und drückt sich sacht an ihr Bein. Sie hebt sie hoch und verlässt den Küchenwinkel. Hinter dem Regal steht der Sessel, der mit der blauen Nylondecke, die sie aus Trojeschtschina mitgebracht hat, ganz ansehnlich ist. An der Rückwand steht das schmale Bett und der alte Schrank und vor dem zweiten Fenster der Stuhl mit dem kleinen Tisch, auf dem die weiße Tischdecke liegt. Die war bei der Plünderung des Hauses im Schrank vergessen worden. Die Ränder sind, in der Tradition der Polissja, mit leuchtend roten und blauen Blumen bestickt. Die Stockflecken hat sie beim Waschen nicht ganz herausbekommen. Blassbraune Stellen liegen zwischen den Blumen.
Am Abend zuvor hat sie das Notizbuch mit dem grünen Pappeinband, den Bleistift mit dem Radiergummi am Ende und einen Anspitzer aus Metall auf den Tisch gelegt. Fünf Jahre ist es her, dass sie in fein geschwungenen Buchstaben »Mein Tagebuch« auf den Einband geschrieben und es ihrer Tochter geschenkt hat. Die hatte es nie benutzt und es in Trojeschtschina zurückgelassen.
Das Buch und die Mutter.
Heute Morgen ist Walentyna mit dem ersten Tageslicht aufgewacht, hat von der Tür bis zum Klohäuschen den Schnee weggeräumt und an der Pumpe einen Eimer mit Wasser gefüllt. Wenn es so kalt bleibt, wird die Pumpe in wenigen Tagen eingefroren sein. Aber dann ist da ja der Schnee, und der Fluss ist auch nicht weit.
Auf dem Ofen kocht sie einige Minzeblätter auf und füllt den Sud in eine Tasse.
Dann gibt es nichts mehr zu tun. Diesen Augenblick hat sie sorgfältig vorbereitet, aber jetzt versucht sie ihm – auf der Suche nach Handgriffen, die sie noch erledigen kann – zu entkommen. Der Boden ist gefegt, das Holz für diesen Tag steht im Korb neben dem Ofen, und das Brot, das sie gestern gebacken hat, wird für einige Tage reichen.
Sie setzt sich mit dem Teebecher an den Tisch, schlägt das Buch auf und nimmt den Stift zur Hand. Über eine Stunde starrt sie auf das fein linierte Papier, bis die Linien verschwimmen und sich schließlich auflösen. Sie steht auf, geht die drei Schritte zwischen Regal und Tür auf und ab und versucht ihre Gedanken zu ordnen. Und immer drängt sich jenes Wort in den Vordergrund: Glück!
Das Wort, das seit Tagen in ihrem Kopf ist, an dem sie kaut, das sie zerlegt, dreht und wendet, und das sich, so meint sie jetzt zu erkennen, in ihrem Leben letztendlich immer mit dieser kleinen Silbe zusammengetan hat.
Un-Glück.
Ihr Mund ist trocken, als sie sich zurück auf den alten Holzstuhl setzt, den Bleistift zur Hand nimmt und die ersten Sätze schreibt:
Meine kleine Kateryna, es war die Hoffnung, die meinen Verstand getrübt hat. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber Hoffnung – das habe ich viel zu spät verstanden – ist ein lähmendes Gift, das uns ausharren lässt. Im Rückblick scheint mir, als hätte ich mein Leben lang gewartet. Auf morgen, übermorgen, irgendwann. An jenem Abend vor einem Jahr dachte ich, alles Warten habe sich gelohnt. Ich dachte: Vielleicht haben wir jetzt endlich einmal Glück!
Sie legt den Stift beiseite und starrt aus dem Fenster. Da war es wieder, dieses Wort. Wann hatte sie es gelernt? In ihrer Erinnerung war es immer bunt und leuchtend gewesen, ein Synonym für Wünsche, die sich in der Zukunft erfüllen würden, und in ihrer Kindheit war es unverbrüchlich mit den großen Zielen des Arbeiter- und Bauernstaates verbunden gewesen.
Nicht weit von hier, in Ritschyzja war sie aufgewachsen. Nach 1986 war sie Jahr für Jahr am Gedenktag für die Verstorbenen dorthin zurückgekehrt, um den Friedhof am Dorfrand zu besuchen und die verstorbene Mutter zu ehren. Sie hatte das verwilderte Grab hergerichtet, den eisernen Zaun, der die Grabstelle einfasste, frisch gestrichen und nach altem Brauch mit der Toten gegessen und getrunken. Sie legte Speisen vor den Grabstein, und in den ersten Jahren, als ihr Mann Hlib sie noch begleitete, schüttete er mit jedem Glas Wodka, das er trank, eines auf die Grabstelle. Dann hatten sie die Entfremdungszone eilig verlassen. Nie fand sie den Mut, ins Dorf hineinzugehen und das Haus ihrer Kindheit zu besuchen.
Erst als sie im vergangenen Frühjahr herkam, um zu bleiben, war sie in den Ort hineingegangen, hatte gehofft, dass sie vielleicht ihr Elternhaus beziehen könnte. Aber Ritschyzja war bei einem großen Brand 1996 zur Hälfte niedergebrannt. In dem geplünderten Restdorf überwucherten Klettergewächse die eingefallenen Dächer und bahnten sich durch zerschlagene Fenster und ausgehebelte Türen ihre Wege in die zerfallenden Häuser. Im aufgebrochenen Asphalt der Straßen und des ehemaligen Schulhofs wuchsen Birken und verkrüppelte Kiefern zwischen Gräsern, Löwenzahn und mannshohen Weiden. Und fast wie zum Hohn blühten überall weiße Heckenröschen.
Vorsichtig hatte sie die schwere, ehemals lichtblaue Holztür des Schulgebäudes geöffnet. Die Farbe schälte sich in breiten Streifen ab, legte das schimmelnde Holz darunter frei. Im Gebäude gab es noch einige zurückgelassene Schulbänke und Stühle. Hefte und Bücher, all die Jahre der Witterung ausgesetzt und von Mäusen zerfressen, lagen auf dem Boden verstreut. Die schweren Tafeln waren abmontiert und verkauft worden, und irgendwo im Land schrieben ahnungslose Lehrer ihre Formeln auf strahlende Tafeln.
Das Mosaik in der Eingangshalle, ein Erntebild zum Ruhme des Arbeiter- und Bauernstaates, das sie als Kind sehr geliebt hatte, war noch da. In einem der Klassenräume setzte sie sich auf ein Pult. Wie lange sie so dasaß, in dieser allumfassenden Stille, wusste sie nicht mehr, aber an das Gefühl von Einsamkeit, das nichts mit der Abwesenheit von Menschen zu tun hatte, erinnerte sie sich gut. Eine Leere, in der Vergangenheit und Zukunft keinen Platz hatten. Nur das kleine Zeitfenster des Augenblicks und dieser Schmerz, als sie verstand, dass es nichts mehr gab, worauf sie warten konnte.
Sie zieht die grobe grüne Strickjacke vor ihrer Brust zusammen, nimmt den Stift wieder zur Hand und radiert die Sätze aus. Nur »Meine kleine Kateryna« lässt sie stehen.
Am besten wird sein, ich fange von vorne an. Du hast nie nach deinen Großeltern gefragt und auch meine Kindheit in Ritschyzja hast du nie angesprochen. Du hast wohl gespürt, dass ich davon nicht erzählen wollte. Die Entfremdungszone, die es schon über fünf Jahre gab, als du geboren wurdest, war eine leere Stelle in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wann ich beschlossen habe, so zu tun, als wäre sie schon immer da gewesen. Unbewohnbares Gebiet. Ganz natürlich. So wie Wüsten oder Sümpfe.
Dein Did war Landmaschinenmechaniker im Kolchos, und deine Baba arbeitete als Melkerin. Ich war ihr einziges Kind. Wir bewohnten in Ritschyzja ein bescheidenes Haus, diesem hier, das ich jetzt bewohne, nicht unähnlich. Aber dieses liegt allein, und das Haus deiner Großeltern lag mitten im Ort. Auch dort war die Wasserstelle draußen, die Wasserpumpe im Winter eingefroren und das Klohäuschen im hinteren Teil des Gartens. Deine Großeltern haben als Kinder die Kollektivierung mit den Hungerjahren in den Dreißigern und später dann den Großen Vaterländischen Krieg erlebt. Vom Vaterländischen Krieg wusste ich natürlich aus der Schule. Deine Großeltern sprachen nicht über diese Zeit.
Von den Hungerjahren hörte ich zum ersten Mal mit acht oder neun Jahren. Der Nachbar Iwan Kyjan kletterte auf der Feier zur großen sozialistischen Oktoberrevolution auf die Bühne und rief: »Wahre Ukrainer feiern den Tag nicht, den Millionen von uns mit dem Hungertod bezahlt haben!« Er war betrunken. Ich erinnere mich an die Stille danach, dass Baba meine Hand nahm und wir das Fest verließen und dass ich Did am Abend fragte, was der Nachbar gemeint habe. Er packte mich bei den Schultern, schüttelte mich und schimpfte: »Du wirst das auf der Stelle vergessen und nie wieder davon sprechen. Hast du das verstanden?« Noch nie hatte er so mit mir gesprochen.
Am nächsten Tag war der Nachbar nicht mehr da, und kurz darauf waren auch seine Frau und die Kinder fort. »Zu Verwandten«, wurde geflüstert. Wir haben nie wieder von ihnen gehört und auch nie wieder von ihnen gesprochen. Einer der Söhne, Witali Kyjan, war in meiner Klasse. Wir mochten uns sehr, gingen immer zusammen zur Schule, und vor einigen Monaten …
Sie nimmt einen Schluck von dem inzwischen kalt gewordenen Pfefferminztee. Wie Lebensfäden sich verloren und dann wieder zueinanderfanden. Aber das gehörte hier noch nicht hin.
Sie sollte nicht abschweifen, sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf das, was sie getan und was sie versäumt hatte. Aber vielleicht hatte damals alles angefangen. Die erschrockene Stille auf dem Dorfplatz. Der ängstliche und zugleich drohende Blick von Did. Vielleicht hatte sie damals gelernt, dass man nicht alles fragen und sagen durfte.
Entschlossen streicht sie die letzten Worte.
… zusammen zur Schule.
Im Sommer gingen wir Kinder im nahe gelegenen Fluss baden. Am Abend kamen manchmal die Erwachsenen dazu. Die untergehende Sonne legte ein orangerotes Band auf den Fluss, und wir sprangen von einem Baum, dessen Äste sich weit über das Wasser beugten. Die Frauen flüsterten uns Mädchen zu, dass das Baden im Abendlicht uns schön mache, und wir sprangen wieder und wieder in die glitzernde Bahn, bis die Sonne endgültig verschwunden war.
In der Schule trugen wir von der ersten bis zur vierten Klasse voller Stolz das Kinderbild Lenins im roten Stern an unseren Schuluniformen, das uns als Oktoberkinder auswies, und unser höchstes Ziel war es, Pionier zu werden. Mit zehn leisteten wir unseren Pioniereid. Jeden Morgen musste das Pioniertuch gebügelt werden, und dann waberte der warmsüße Geruch von erhitzter Kunstseide durch die Küche, und jeden Morgen versammelten wir uns auf dem Schulhof und begrüßten den Tag mit den Worten: »Zum Kampf für die Sache der Kommunistischen Partei der Sowjetunion – Seid bereit! – Immer bereit!« Im Unterricht sprach die Lehrerin voller Ehrfurcht über »Großväterchen Lenin«, über die Errungenschaften des Arbeiter- und Bauerstaates und über die Feinde der Sowjetunion, die unser Land und unsere schillernde Zukunft bedrohten. Anschließend sangen wir stehend und mit erhobenem, angewinkeltem Arm: »Höher die Freudenfeuer, die blauen Nächte. Wir Pioniere sind Kinder der Arbeiterklasse …« Ich liebte das Gefühl der Zugehörigkeit, dieses Eingebundensein in eine große Vision.
Im Dorf hingen Plakate, die uns daran erinnerten, dass der Feind nicht weit war, Spione unerkannt in unserer Mitte lebten. Das Bild einer Landarbeiterin mit rotem Kopftuch und dem Zeigefinger vor dem Mund ist mir noch in Erinnerung. Darunter stand: Die Saboteure sind unter uns. Gib acht, mit wem du sprichst.
Täglich ging ich an dem Mosaik in der Einganghalle der Schule vorbei. Es war gut drei Meter hoch und wohl fünf Meter breit, zeigte Männer, die mit Sensen das Getreide schnitten, und Frauen, die es zu Garben banden. Sie lächelten uns Kindern entgegen, kaum dass wir die Schule betreten hatten, strahlten Zufriedenheit und Glück aus. »Meine Arbeit. Mein Beitrag für Sozialismus und Frieden«, stand in einem Bogen darüber.
Sie hält inne, betrachtet die vorletzte Zeile. Da war es wieder. Glück! Damals hatte sie das Wort also schon gekannt. Das Mosaik war wie eine Verheißung gewesen, und obwohl es die Arbeit in einem Kolchos zeigte, hatte sie es nicht mit dem Dorfalltag in Verbindung gebracht. Vielleicht, weil der Vater fluchte, wenn wochenlang Ersatzteile für die Maschinen fehlten oder ganz ausblieben. Vielleicht, weil die Eltern nicht diese fröhliche Zuversicht ausstrahlten, sondern spätabends erschöpft nach Hause kamen. Vielleicht, weil man stundenlang anstehen musste, um Milch oder ein Stück Speck zu ergattern, obwohl der Kolchos über hundert Kühe besaß und Rinder und Schweine.
Es muss 1969 oder 1970 gewesen sein, als sich im Dorf flüsternd ein Gerücht verbreitete. In der Nähe der Stadt Tschernobyl am Fluß Prypjat wurde gebaut. Zunächst war die Rede von einer großen Fabrik, aber dann fiel immer öfter das Wort »Kernkraftwerk«, und bald sprach man von mehreren Reaktoren. 1972, daran erinnere ich mich genau, hielt der Genosse Vorsitzende des örtlichen Parteibüros auf einem Fest eine Rede, in der er zum ersten Mal öffentlich von einem Kernkraftwerk sprach. Die Reaktoren würden unsere Region zu einer der wichtigsten in der ganzen Sowjetunion machen und Wohlstand für alle bringen. Eine Anstrengung, zu der auf der ganzen Welt nur die Sowjetunion in der Lage sei. Für die angestellten Spezialisten würde eine eigene moderne Stadt gebaut werden.
In den Wochen danach hörten wir von Wohnungen mit fließendem Wasser, Heizung, Bad und sogar Telefon. Die neue Stadt sollte, wie der Fluss, Prypjat heißen.
Die Lehrerin erklärte uns immer wieder, nur die Besten hätten eine Chance, dort einmal zu arbeiten und zu wohnen, und die Entscheidungen würden in Moskau getroffen. Ich war eine gute Schülerin, und jetzt hatte ich ein Ziel vor Augen und verdoppelte meine Anstrengungen.
Die Eltern sahen meine schulischen Leistungen mit Stolz, und auch meinen Wunsch, später in Prypjat zu arbeiten, unterstützten sie.
Wie alle Kinder verbrachte ich schon damals nur noch wenig Zeit mit ihnen. Der Schulunterricht ging bis zum Nachmittag, und die anschließenden Pionierveranstaltungen nahmen uns voll in Anspruch. Das war wohl auch der Grund dafür, dass ich die veränderte Stimmung im Dorf und zu Hause lange nicht wahrnahm. Bis zu jenem Abend, als uns der Kolchosleiter zusammen mit dem Genossen vom Parteibüro einen Besuch abstattete.
Kapitel 3
Zyfflich, 15. Februar 2010
Was Matthias Lessmann in welcher Reihenfolge tat, daran konnte er sich später nicht erinnern. Dass er Mullbinden aus dem Medizinschrank gezerrt hatte, dass er das Mädchen in ihrer dürren Nacktheit aus der Wanne gehoben und die Unterarme abgebunden hatte. Dass er, als der Blutfluss nachließ, die Schnitte mit Druckverbänden versorgt hatte.
Und seine Angst war ihm im Gedächtnis geblieben. Eine Angst, die er nicht mehr empfunden hatte, seit seine Frau vor über sechs Jahren an Krebs gestorben war. Angst um das Leben eines anderen Menschen. Er lief zum Telefon, um einen Krankenwagen zu rufen, aber als er die erste Ziffer des Notrufes gewählt hatte, legte er wieder auf. Wie sollte er das erklären? Ein junges Mädchen, deren Namen er nicht kannte, die mit einem Fetzen, nicht mehr als ein Unterrock, bekleidet gewesen war und jetzt nackt und mit aufgeschnittenen Pulsadern auf dem Fliesenboden seines Badezimmers lag.
Er trug sie hinauf ins Schlafzimmer, legte sie in sein Bett und schlug ihr sanft auf die Wangen. »Hallo? Hallo, kannst du mich hören?« Sie öffnete kurz die Augen, und in ihrem Blick lag eine Resignation, die ihn zusammenzucken ließ. Dann schlief sie ein.
Den ganzen Vormittag saß er an ihrem Bett, kontrollierte immer wieder die Verbände an den Handgelenken, schimpfte sich in Gedanken einen Idioten und studierte ihre Gesichtszüge. Er hätte sich nicht einmischen sollen. Warum hatte er sie nicht einfach ziehen lassen?
Wie alt mochte sie sein? Höchstens zwanzig. Wahrscheinlich war sie Russin oder Polin. Jedenfalls Osteuropa, da war er sich sicher.
Er fuhr sich mit der schwieligen Hand über das verwitterte Gesicht, betete still, der Herr möge sie überleben lassen, und dabei – aber das gestand er sich erst viel später ein – ging es ihm nicht nur um das Leben des Mädchens. Er dachte immer wieder darüber nach, wie er ein totes Mädchen in seinem Haus, in seinem Bett, erklären sollte. Die Wahrheit würde man ihm kaum glauben.
Unter dem Daunenbett, mit dem er sie zugedeckt hatte, verschwand sie fast. Ihr Gesicht hatte diese glatte Unschuld, die alle jungen Mädchen hübsch machte. Die vollen Lippen waren blutleer und hoben sich kaum von dem blassen Teint ihrer Haut ab. Dafür traten die weich geschwungenen Augenbrauen umso deutlicher hervor, und das noch feuchte dunkle Haar wellte sich um ihren Kopf. Er wusste nicht mal ihren Namen.
Er war es nicht mehr gewohnt, Menschen um sich zu haben, nicht mehr gewohnt, sich für Menschen zu interessieren.
Es war schon nach elf, als er meinte, dass ihre Atemzüge gleichmäßiger und kräftiger klangen. Die Druckverbände waren trocken geblieben, die Blutung seit gut zwei Stunden gestoppt. Beruhigt stellte er sich an das Fenster und sah hinaus. Sie würde es schaffen. Sie war jung.
Die Schafe standen immer noch wartend neben der Raufe. Ihm fiel ein, dass sie noch kein Wasser hatten.
Auf der Deele zog er die Gummistiefel an und wollte seine Fellweste vom Haken nehmen. Die lag noch im Badezimmer. In der Wanne stand das rote Wasser. Er zog seinen rechten Ärmel hoch und zögerte. Für einen Augenblick hatte er den absurden Gedanken, dass es Unrecht sei, ihr verdünntes Blut einfach fortzuspülen. Dann zog er den Stöpsel, reinigte die Badewanne und wischte den Boden. Als er das dünne Kleid in den Wäschekorb werfen wollte, spürte er etwas Festes. Am Saum waren einige Stiche der Naht geöffnet, und ein Stückchen Papier lugte hervor. Er zog es heraus. Kyrillische Buchstaben auf einem kleinen, gefalteten Zettel, der aussah, als sei er Hunderte Male auseinander- und zusammengefaltet worden. Er legte ihn in den Spiegelschrank.
Auf der Deele füllte er zwei Wassereimer, ging hinaus und stellte sie auf die Schafkoppel. Er sprach mit den Tieren, wie er es sich in den letzten Jahren angewöhnt hatte. »Da haben wir uns was eingebrockt, was? Jetzt müssen wir die wohl erst gesund pflegen, bis die weiterkann.«
Er griff Trine ins Stirnfell und ruckelte sanft. Das Tier drückte den Kopf fest gegen seine Hand und genoss die Liebkosung. Der Himmel zeigte jetzt ein gleichmäßiges Grau. Am Nachmittag würde es schneien.
»Wenn wir die nicht rechtzeitig gefunden hätten im Bad. Nein, da wollen wir lieber nicht drüber nachdenken. Das Beste wäre wohl, wir würden sie ins Krankenhaus bringen. Aber was sollen wir denen sagen? Die sagen sich doch: Der alte Sack! Wieso hat der ein so junges Mädchen in seinem Haus? So denken die doch. Und dann das Gerede im Dorf.« Er schüttelte resigniert den Kopf, kraulte Trine die Ohren und blickte über die Wiesen und Felder. Eine Unruhe machte sich in ihm breit, eine Ahnung, dass sein ruhiges Leben sich mit dem heutigen Tag verändern würde.
Im Hühnerstall sammelte er fünf Eier ein und betrachtete die Hennen, die mit aufgeplustertem Gefieder auf der Stange saßen. Eine kräftige Hühnerbrühe würde ihr guttun. Er griff sich eines der Hühner heraus, nahm es an den Beinen und trug es kopfüber über den Hof zu dem Hauklotz vor dem Deelentor, auf dem er das Brennholz für den Kamin schlug. Mit der Rückseite des Beils schlug er dem Tier aufs Haupt, legte den baumelnden Kopf auf den Klotz und trennte ihn ab. Der Hühnerkörper tat letzte zuckende Flügelschläge.
In der Küche setzte er einen Kessel auf, trug das kochende Wasser auf den gefliesten Teil der Deele, wo früher das Melkgeschirr und die Kühlanlage gestanden hatten. Er rupfte das Tier und nahm es aus. Die Katzen und Bella umkreisten ihn und stritten um die Innereien, die er ihnen zuwarf.
Nachdem er das Huhn in reichlich Salzwasser auf den Herd gestellt und Lauch, Sellerie und Möhren aus der Tiefkühltruhe zum Auftauen in die Spüle gelegt hatte, kochte er Tee und ging mit einer Tasse hinauf ins Schlafzimmer.
»Hallo! Kannst du mich hören?«, fragte er. Als sie die Augen öffnete und nicht gleich wieder schloss, setzte er sich erleichtert auf die Bettkante.
»Tee«, sagte er und hielt ihr die Tasse hin. »Du musst trinken.«
Er stützte ihren Kopf ab, während sie vorsichtig einen Schluck nahm.
»Du machst ja Sachen«, versuchte er einen leichten Ton, »da hättest du uns beide aber in allergrößte Schwierigkeiten bringen können.« Noch während er sprach, wusste er, dass die Bemerkung dumm war. Die Schwierigkeiten hätte nur er gehabt. Schnell fügte er an: »Wie heißt du?«
»Tanja«, flüsterte sie.
Er nickte. Fragen stapelten sich in seinem Mund. Wo kommst du her? Wer waren die Männer? Wieso läufst du halb nackt in aller Frühe hier herum? Warum hast du versucht …?
»Ich bin Lessmann«, sagte er, räusperte sich und vervollständigte: »Matthias. Matthias Lessmann.« Er versuchte aufmunternd zu lächeln. »Ich könnte … ich mein, soll ich vielleicht jemanden anrufen … dass dich jemand abholt?«
Ihr »Nein« kam unmittelbar und klang erschrocken.
»Schon gut«, besänftigte er sie und sprach dann davon, dass sie jetzt erst einmal Ruhe brauche, redete von der Hühnerbrühe, die am Abend fertig sein würde, und dass sie sicher bald wieder auf dem Damm wäre.
Da sah er zum ersten Mal ein kleines Lächeln auf ihrem Gesicht.
»Auf dem Damm?«, fragte sie. »Was ist: Auf dem Damm?«
»Gesund«, sagte er, »kräftig … richtig gesund eben«, und er freute sich, dass sie ihn verstand und dass sie bald aufstehen könnte und nicht in diesem Zimmer sterben würde, wie seine Frau es über Monate hinweg getan hatte.
Später, nachdem er das Gemüse in die Suppe getan hatte, stand er am Küchenfenster. Inzwischen schneite es heftig, und er dachte, dass er die Hühner in den Stall sperren sollte, bevor die schneeblinden Tiere nicht zurückfanden. Er beugte sich zum Fenster, um zu sehen, ob es bereits eine lückenlose Schneedecke gab, als er ihn sah. Der Geländewagen parkte gut hundert Meter von seiner Hofeinfahrt entfernt am Straßenrand. Die Männer waren ausgestiegen und kamen die Straße entlang.
Bella lag unter dem Küchentisch. Lessmann schnalzte mit der Zunge, ging zur Haustür, ließ Bella raus und holte sein Fernglas aus der Kommode im Flur. Einer der Männer trug eine braune Lammfelljacke. Lessmann schätzte ihn auf Mitte zwanzig. Bella stand jetzt kläffend in der Einfahrt. Der andere Mann, vielleicht Ende dreißig, trug eine blaue Burberry-Wachsjacke und hatte die Hände tief in den Taschen vergraben.
Der Geländewagen war ein Landrover mit Düsseldorfer Kennzeichen. Er konnte es nicht ganz erkennen, ein Zaunpfahl verdeckte die Sicht auf das Nummernschild, nur das D für Düsseldorf und die Nummer 232 waren zu sehen.
Er war noch mit dem Wagen beschäftigt, als er hörte, dass Bella ihren Standort gewechselt hatte und jetzt schier verrückt spielte, sich nicht zwischen Bellen und Knurren entscheiden konnte. Er lief hinüber ins Wohnzimmer, sah, wie einer der Männer versuchte, über die Schafwiese zu kommen, und Bella mit einem Stock abwehrte. Lessmann lief auf die Deele, nahm sein Jagdgewehr aus dem Schrank, lud es und rannte in Hausschuhen hinaus. Er schoss in die Luft. Der Mann ließ den Stock fallen und wich zurück. Lessmann legte das Gewehr an, rief Bella zu sich und ging, den Mann auf der Wiese im Visier, langsam vorwärts.
»Schafdiebe«, rief er. »Gottverdammte Schafdiebe! Am helllichten Tag! Aber jetzt hab ich euch endlich!«
Der Mann hatte die Hände gehoben und starrte Lessmann an, der mit ungekämmten, halblangen grauen Haaren und einem mehrere Tage alten Stoppelbart in ausgelatschten Hausschuhen im Schnee stand und auf ihn zielte. Lessmann schimpfte weiter »… wird euch teuer zu stehen kommen … Das sechste in einem Jahr …«
Während er weitere unsinnige Anschuldigungen erhob, nahm er wahr, dass der Mann in der Felljacke zurück zum Auto lief. Er hörte, wie der Motor gestartet wurde, ließ sein Gewehr auf Brusthöhe sinken und rief: »Haut bloß ab und lasst euch hier nie wieder blicken. Das nächste Mal erschieße ich dich, das ist mein gutes Recht!«
Der Wagen hielt auf Höhe der Schafwiese, die Seitentür wurde geöffnet, und der zweite Mann sprang hinein.
Als Lessmann ins Haus ging und das Gewehr in den Schrank zurückstellte, war er zufrieden mit sich. Er dachte, dass die beiden nun verstanden hätten und dass er sie nicht wiedersehen würde.
Kapitel 4
Entfremdungszone, Oktober 2010
Das Heft hat sie geöffnet an den hinteren Rand des Tisches direkt vor das Fenster geschoben. Die Sonne bescheint die Worte, zeigt sie in einem anderen Licht. Sie steht auf, legt Holz nach, stellt den Topf mit dem Pfefferminzsud zurück auf den Ofen und legt eine Scheibe Brot neben den Topf. Der Minzeduft breitet sich aus, legt sich über den leichten Modergeruch, der immer noch in den Wänden steckt. Wenn sie den Winter über ordentlich heizt, wird er wohl endgültig verschwunden sein.
Sie setzt sich in den Sessel und isst das angeröstete Brot.
Als Artem bei seinem Besuch vor vier Tagen die Nachricht brachte, dass Leonid nach Deutschland fahren würde, hatte sie ihn geküsst vor Freude. Sie lud ihn zum Essen ein, aber er lehnte ab, wie er es immer tat. »Etwas Brot«, bot sie an, »und von der Wurst, die du beim letzten Mal mitgebracht hast. Nichts von hier! Iss doch, Jungchen.« Aber er hatte es eilig, war schon an der Tür, als er sagte: »Seien Sie mir nicht böse, Walentyna, aber das Holz, das Sie verbrennen, das ist von hier.«
Da war sie sich rücksichtslos vorgekommen und hatte ihn hinausbegleitet. Im Hof plauderten sie noch ein bisschen. Artem war mit dem kleinen Motorroller gekommen. Als sie hergezogen war, hatte er sich einen Anhänger geliehen und ihre Kleidung, ein bisschen Geschirr, die Töpfe, ihre Bettdecke und die blaue Nylondecke hergebracht und ihr geholfen, das Haus bewohnbar zu machen. In seinem kleinen Kontrollhäuschen gab es Strom, und er besaß ein Handy. Damit hatte er zwar nur auf einem gut zwei Kilometer entfernten Hügel Empfang, aber Leonid könnte ihm Nachrichten schicken. Eine Stunde brauchte er von seinem Kontrollhäuschen bis zu ihr, aber jetzt …
Es würde in den nächsten Tagen wohl weiter schneien, und mit seinem Roller war dann kein Durchkommen mehr.
Sie geht zum Tisch, nimmt den Anspitzer und den Bleistift und wirft die feine Holzrosette, die beim Anspitzen entsteht, in den Ofen.
Sie liest die letzte Zeile und setzt ihre Erzählung fort.
Bis zu jenem Abend 1974, als uns der Kolchosleiter zusammen mit dem Genossen vom Parteibüro einen Besuch abstattete. Ich saß vor dem Haus. Sie sprachen davon, dass deine Baba die Arbeitsnorm seit Monaten nicht einhalte. Sie klagte über Rückenschmerzen und dass das Melken für sie eine Tortur sei. Ob sie nicht in eine andere Abteilung wechseln könne. Die Leiterin der Hühnerställe habe gesagt … Der Kolchosleiter schnitt ihr das Wort ab und legte ein Papier auf den Tisch, auf dem der Arzt, der Baba untersucht hatte, bescheinigte, dass es keine Ursache für die angeblichen Rückenschmerzen gäbe.
Das Wort »Sabotage« fiel, und der Genosse aus dem Parteibüro sagte, sie habe ja schon mal für den Feind gearbeitet.
Ich weiß noch, dass ich auf der Stufe vor dem Haus saß und kaum atmen konnte. Als sie gegangen waren, ging ich nicht ins Haus, sondern lief zum Fluss. So ungeheuerlich ich den Verdacht auch fand, schien diese Anschuldigung wie eine Erklärung für all die unverständlichen Bemerkungen und Bilder der letzten Monate.
Baba, die seit einiger Zeit abseits stand, mit der nur selten jemand sprach. Die an den Sommerabenden nicht mehr mit an den Fluss kam und nicht mit den Nachbarinnen vor einem der Häuser saß und plauderte. Dein Did, der sie vor einigen Wochen mit den Worten »Irgendwann werden sie es wieder vergessen« tröstete. Die Lehrerin, die gesagt hatte: »Auch in unserem Dorf gibt es welche, die für den Feind gearbeitet haben.«
Ich wusste, dass Baba aus dem Oblast Ternopil kam und dass ihre Eltern im Großen Vaterländischen Krieg gestorben waren. Mehr hatte sie dazu nie gesagt.
Tagelang ging ich ihr aus dem Weg, fürchtete die Bestätigung, dass sie eine derjenigen war, vor denen die Arbeiterin auf den Plakaten im Dorf warnte.
Sie schiebt den Stuhl zurück und steht auf. Ein stechender Schmerz im Lendenwirbel zwingt sie vornüber. Ihre knochigen Hände umfassen fest den Rand der Tischplatte. Sie atmet gegen den Schmerz an, richtet sich langsam auf.
Nie wäre sie auf die Idee gekommen, mit jemandem darüber zu sprechen. Was zu Hause geredet wurde, trug man nicht nach draußen. Nie hätte sie in der Schule oder bei den Pionieren erwähnt, dass die Eltern über die Partei und die Arbeitsbedingungen im Kolchos schimpften. Sie wusste nicht mehr, wann, wo und wie sie es gelernt hatte. Sie war sich sogar sicher, dass niemand es ihr explizit gesagt hatte, aber alle machten das so. Man sprach nicht über das, was zu Hause geredet wurde. Gleichzeitig waren sie alle kindliche Patrioten. Großväterchen Lenin beschützte sie, er erfüllte Wünsche, wenn man ihn nur inständig genug bat, er verlangte von seinen jungen Pionieren Mut und Ehrlichkeit und er strafte, wenn man nicht die Wahrheit sagte.
An jenem Abend gerieten all diese Wahrheiten und Regeln ins Wanken. »Ich war gerade erst vierzehn geworden«, könnte sie schreiben. Vorsichtig setzt sie sich auf den Stuhl zurück. Der Bleistift ist schon wieder stumpf. Sie sollte weniger aufdrücken und nicht so sehr ins Detail gehen, sonst war die Mine bald verbraucht und das Heft voll. Aber jetzt, wo sie sich in ihren Erinnerungen verfängt, werden die Kleinigkeiten wichtig, sind scheinbar nebensächliche Begebenheiten von Bedeutung.
In dieser Zeit wechselte ich von den Pionieren zum Komsomol. Wir waren nur wenige Vierzehnjährige, und es war eine besondere Auszeichnung. Ein großes Fest auf dem Leninplatz, auf den wir einmarschierten, feierlich unseren Treueeid »zum Kampf für die Kommunistische Partei der Sowjetunion« erneuerten und zu Mitgliedern des Komsomol wurden. Einige Wochen später wurde ich abends, nach einer Veranstaltung im Kulturhaus, vom Genossen Gruppenleiter angesprochen. Er bat mich in sein Büro. »Du weißt sicher, dass deine Mutter im Vaterländischen Krieg nach Deutschland gegangen ist und für die Faschisten gearbeitet hat«, sagte er. Die Partei habe das erst vor einem halben Jahr erfahren, als im Kolchos die Daten der Genossen und Genossinnen aktualisiert wurden und sich in Babas Papieren Lücken zeigten. »Wir haben dich trotzdem im Komsomol aufgenommen, du kannst ja nichts für die Verfehlungen deiner Mutter, und deine Beurteilungen von der Schule und den Pionieren sind sehr positiv.« Dann änderte sich sein Ton. »Wir erwarten von dir, dass du zu Hause aufmerksam bist und deinen patriotischen Pflichten nachkommst.«