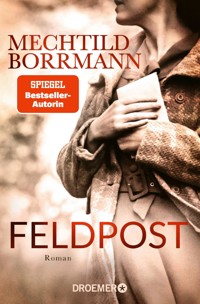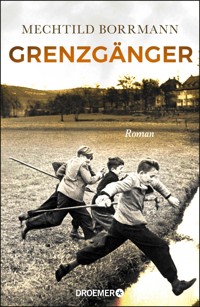9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten voller Menschlichkeit, die Herz und Verstand berühren Von Menschen im Schatten, am Rande der Gesellschaft und manchmal auch der Legalität erzählen Mechtild Borrmanns Geschichten in Glück hat einen langsamen Takt. In klarer, schnörkelloser Sprache werden alltägliche Schicksale zu Momentaufnahmen des Menschseins. Mal erschütternd, mal anrührend, mal versöhnlich – die Bestsellerautorin erzählt vom Hadern und Verzweifeln, von der Wut und von Versöhnung, von großen Träumen, kleinem Glück und der Schönheit des Augenblicks. Borrmann erweist sich als einfühlsame Beobachterin, die tief in die Seele ihrer Protagonisten blickt. Ihre Erzählungen handeln von Schuld und Sühne, Liebe und Verlust, dem Ringen um Würde und dem Streben nach Glück. Mit feinem Gespür für die leisen Töne des Lebens beleuchtet sie die Schattenseiten unserer Gesellschaft und schafft zugleich Raum für Mitgefühl und Hoffnung. Auch in der kurzen Form zeigt sich Mechtild Borrmann als »großartige Chronistin des Alltags und eine absolute Menschenfreundin« (Reinhard Jahn, WDR5 Mordsberatung). Glück hat einen langsamen Takt ist eine bewegende Sammlung von Geschichten, die noch lange nachwirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mechtild Borrmann
Glück hat einen langsamen Takt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Von Menschen im Schatten, am Rande der Gesellschaft und manchmal auch der Legalität erzählen Mechtild Borrmanns Geschichten:
Da ist der 17-jährige Till, der noch nie verliebt war – bis er die neue Freundin seines Vaters kennenlernt. Da ist Christa, die von klein auf unter der Kälte und Bigotterie ihrer Mutter gelitten hat – bis ein einziger Satz ihr Leben dramatisch verändert. Und da ist der alte Karl Petzold, der kaum noch weiß, dass er sein Leben vergisst, und sich wundert, weshalb sein Sohn seinen Sessel aus dem Wohnzimmer trägt …
In klarer, schnörkelloser Sprache werden diese und andere ganz alltägliche Schicksale zu Momentaufnahmen des Menschseins. Mal erschütternd, mal anrührend, mal versöhnlich handeln die Erzählungen der vielfach preisgekrönten Autorin vom Hadern und Verzweifeln, von der Wut und von Versöhnung, von großen Träumen, kleinem Glück und der Schönheit des Augenblicks.
Inhaltsübersicht
Am Anfang war Blau
Tannengrün
Die Sonntagsbriefe
Ausgegraben
Aufnahme
Augenblicke
Glück hat einen langsamen Takt
Geben und nehmen
Das vierte Gebot
Drei Steine
Hanna sagt
Die Spur zurück
Ausgerechnet Blumen
Leere Taschen
Seine Freundin
Seltene Seerosen
Das Geschenk
Brief an einen Sohn
Hammer Treue
Gnadenlos
Am Anfang war Blau
Als Kind hatte sie vom Großvater gelernt, dass die Wildgänse die Farben des Sommers hüten. Wenn sie sich zu Hunderten erhoben, über das Dorf flogen und ihre Rufe minutenlang die Luft zum Vibrieren brachten, nickte der Alte zufrieden, sah zum Himmel und sagte: »Da zieht er hin, der Winter!« Ihre kleine Hand in seiner, nahm er sie mit, hinauf auf den Deich und weiter, zu der stillgelegten rostigen Eisenbahnbrücke, die über den Alten Rhein führte. Sie sahen zu, wie die Vogelschwärme aufbrachen, die in den Wiesen überwintert hatten. Einer geheimen Regel folgend, teilten sie sich in Gruppen und stiegen auf.
»Auf die Wildgänse musst du achtgeben«, flüsterte der Alte dann. »Wenn sie aufbrechen, ist die Kälte vorüber. Unter ihrem Gefieder haben sie die Farben des Sommers gehütet, und die lassen sie jetzt mit jedem Flügelschlag auf das Land fallen.«
Sie hatte ihm geglaubt.
Als sie in der Schule den Frühling auf diese Weise erklärte, lachte die Lehrerin und sagte: »Da hat dein Opa dir aber einen Bären aufgebunden!«, und sie vergaß die Märznachmittage auf der Eisenbahnbrücke.
Sie steht am Fenster und blickt hinaus in den Klinikpark.
So viel Schnee. Die Welt nur die hingeworfene Bleistiftskizze eines Malers. Laublos verharren alte Kastanien in weißer Stille, malen mit ihren Zweigen unbegehbare Wege auf den milchigen Himmel.
Schwarz-weiß.
»Ein blinder Fleck«, hatte der Therapeut gesagt.
»Immer denkt man, blinde Flecken seien schwarz«, hatte sie geantwortet, »aber das stimmt nicht. Blinde Flecken sind weiß.«
Aber am Anfang war Blau.
Hohes Blau.
Himmelblau.
Nicht nur.
Auch das Grün junger Linden.
Also Lindgrün.
Und Gelb.
Nicht dieses wässrige Gelb von Zitronen, sondern das kräftige Gelb des Löwenzahns.
Also Frühsommer.
Frühsommergelb.
Der Radweg führte schnurgerade durch das hügelige Land, und als sie einen Bauernhof mit Obstwiese passierten, trieb eine kurze Windböe weiße, an den Rändern rosa schimmernde Apfelblüten über den Radweg. Sie tanzten in der Luft wie Schneeflocken.
Also Apfelblüten.
Apfelblütenrosa.
Nils’ Fahrrad war neu. Nicht nagelneu, aber drei Tage zuvor gebraucht gekauft. Zwei Nachmittage hatte sie es mit einer speziellen Politur behandelt, nur ein paar grobe Kratzer am Rahmen waren geblieben.
Die Speichen blitzten silbrig in der Sonne. Ein schönes Fahrrad, und wenn er auf dem Sattel saß, reichten seine Füße nicht ganz bis zum Boden.
Also Fahrradspeichen.
Fahrradspeichensilber.
»Das Fahrrad ist zu groß. Das Fahrrad ist doof, und außerdem ist es gar nicht neu«, maulte Nils.
Es war heiß.
Sie fuhr hinter ihm, hatte die kleine Marie im Kindersitz auf dem Gepäckträger.
Sie schluckte an seinen Vorwürfen und ihrer Unzulänglichkeit.
Also Scham.
Schamröte.
Hundertachtzig Euro. Monatelang hatte sie gespart, war sogar über ihren Schatten gesprungen, hatte ihren Ex-Mann angerufen und ihn um die fehlenden zwanzig Euro gebeten.
Das Himmelblau, das Lindgrün, das Frühsommergelb, das Speichensilber, die Schamröte und, nach einer engen Kurve, ein Vorgarten, in dem Flieder verblühte.
Also Fliederlila.
Nein!
Vorher war noch Maries Lachen.
Gelb. Aber lichter als der Löwenzahn.
Hell und aufsteigend, wie Rapsfelder im Mai.
Also Rapsgelb.
Kinderlachengelb.
Marie trommelte mit ihren kleinen Fäusten gegen ihren Rücken. »Schneller, Mama, schneller! Wann sind wir denn endlich da?«
Maries trommelnde Fäuste vermischten sich mit Nils’ unzufriedenem Schimpfen.
Es ging bergauf.
Die Sonne stand hoch.
Sie mühte sich. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn. Sie dachte an den Picknickkorb, an die Leckereien darin, dachte daran, wie lange sie diesen Ausflug vorbereitet und wie wunderbar sie ihn sich vorgestellt hatte.
Und sie dachte: Der Tag wird so nicht werden.
Dann Zornesrot.
Nein!
Zornesrot war später.
Endlich oben auf dem Hügel angekommen, der freie Blick ins Tal. Der See glitzerte grünlich-blau in der Sonne und versprach Abkühlung.
Also Wasser.
Wasserblau.
Nils raste den Berg hinunter. Sie folgte gemächlicher. Der Fahrtwind trieb ihr Tränen in die Augen, kühlte ihr Gesicht.
Im Tal parkten Autos am Straßenrand.
Ausgebreitete Decken und Handtücher am Seeufer. Badebekleidung, neonfarbene Luftmatratzen und Schwimmhilfen. Es roch nach Sonnenmilch.
Also Familienausflugstag.
Heiles Familienbunt.
Nils warf das Fahrrad in den Sand. Das Vorderrad drehte unnütz in der Luft. Er rannte zum See, zog noch im Laufen T-Shirt und Schuhe aus und warf sich ins Wasser.
Sie sah das Rad achtlos in den Sand geworfen. Sie sah die beiden Nachmittage, die sie im Keller verbracht hatte, damit es wie neu aussah. Sie hörte sich am Telefon um die fehlenden zwanzig Euro bitten.
Sie rief seinen Namen. Ihre Stimme kippte.
Jetzt Zorn.
Jetzt Zornesrot.
Sie hob Marie aus dem Kindersitz, stellte das Rad an einen Baum und rannte zum See.
Über dem Badeanzug trug sie ein tannengrünes Sommerkleid. Sie zog es nicht aus. Im Wasser klebte der Rockstoff an ihren Beinen.
Nils planschte, schleuderte kleine Wasserfontänen in die Luft. Er drehte sich um.
Sie packte ihn.
Die Restbilder sind weiß.
Der Therapeut sagt: »Ein blinder Fleck.«
Sie steht am Fenster und blickt hinaus in den Klinikpark.
Sie wartet.
Wartet, dass die Wildgänse gen Osten ziehen.
Tannengrün
Das kalte, helle Blau des Himmels wölbt sich hoch und still über den Tannen. Tagelang hat es geschneit. Die Zweige beugen sich unter der weißen Last, und nur eine feine Rauchfahne verrät den Schornstein, verrät das Haus.
Karla blickt hinaus auf die Terrasse. Die Nordmanntanne steht hinten an der Treppe in einem schwarzen Plastiktopf. In aller Frühe hat sie die silbernen und blauen Kugeln, die Strohsterne und die Engel aus Goldpapier zurück in die Schachteln gepackt und die Tanne nebst Topf hinausgestellt, so wie sie es dreißig Jahre lang getan hat. Ihre Schritte haben gleichmäßige Ovale in die makellose Schneedecke gestanzt.
Sie fröstelt, zieht die Strickjacke enger um ihren dürren Körper und geht zurück in die Küche. Sie schaltet das Licht ein und füllt den Wasserkocher. Die Uhr über der Tür zeigt elf.
Ein Tee. Ein Tee wird guttun.
Nach all dem Trubel der Weihnachtstage hat sie sich nach Ruhe gesehnt, aber jetzt ist die Stille zäh, scheint von der Decke zu tropfen wie schmelzendes Blei.
Die Kinder waren da. Marlis und Bernd mit den Enkeln Fabian und Leonie. Andreas mit seiner neuen Lebensgefährtin. Die beiden waren extra den weiten Weg von München heraufgekommen. Und Susanne. Zum ersten Mal seit ihrer Scheidung alleine mit den Kindern. Trotzdem war es ein schönes Fest. Ein letztes Mal alle versammelt. Ein schönes Abschiedsfest, denkt sie und erschrickt.
Das Wasser kocht brodelnd auf. Sie zuckt zusammen, als der Kocher sich mit einem lauten Klacken abschaltet.
Fencheltee. Fencheltee beruhigt.
Sie hängt einen Beutel in den roten Becher, gießt Wasser darauf, und wenige Sekunden später steigt ihr ein feiner Anisgeruch in die Nase. In weißen ungelenken Lettern hatte Leonie »Opa« auf die Tasse gemalt. Wie aufgeregt die Kleine war, als er das Papier mit den Sternen auf seine sorgfältige Art langsam öffnete. Und wie stolz, als er sie ungläubig fragte, ob sie das wirklich ganz alleine geschrieben habe.
Sie setzt sich an den Küchentisch und sieht hinaus. Die Äste der Tannen reichen bis ans Fenster.
Damals, als sie die Kate entdeckten, war sie ein verfallenes Häuschen gewesen, umgeben von Feldern und Wiesen. Sie hatten sich sofort verliebt, und Johann verhandelte zäh mit dem wortkargen Bauer Biermann. Über Wochen fuhr er jeden Sonntag zum Hof, bis er endlich mit diesem Pachtvertrag auf Lebzeit nach Hause kam. Die Freude war riesig gewesen. Ein perfekter Ort für ihre kleine Familie, mit einem Blick weit über das Land.
Sie rührt Honig in den Tee.
Lebzeit! Wessen Lebzeit?
1978, vor genau dreißig Jahren – sie war mit Marlis schwanger gewesen –, hatten sie hier ihr erstes Weihnachtsfest gefeiert.
Johann kaufte einen Weihnachtsbaum im Topf. »Zwei Fliegen mit einer Klappe«, sagte er, und der Gedanke, dass man den Kauf des Weihnachtsbaumes mit der Gartengestaltung verbinden könnte, erschien ihr vernünftig.
Nach und nach entstand rund um Haus und Garten ein Ring aus Nadelbäumen: Nordmanntannen, Kiefern, Douglasien, Edeltannen, Blau- und Rotfichten und sogar eine Colorado-Tanne.
Sie nimmt einen Schluck Tee. Zu süß. Zu viel Honig.
Vier Tage lang hat sie ihm den Tee ans Bett gebracht, und immer sagte er: »Zu süß. Zu viel Honig.«
Zehn Jahre nach ihrem Einzug, die erste Weihnachtstanne war bereits gut acht Meter hoch, bat sie Johann, einen geschnittenen Weihnachtsbaum für das Zimmer zu kaufen. Damals hatte sie gescherzt: »Wenn wir so weitermachen, wohnen wir irgendwann in einer lichtlosen Tannenschonung.«
Aber er kaufte weiterhin Topfbäume, schlug weiterhin »zwei Fliegen mit einer Klappe«.
Und sie kamen immer näher. Als die Kinder größer waren, mussten Sandkasten und Schaukel den neuen Weihnachtsbäumen weichen. »In unserem Garten kann man jederzeit nachzählen, wie oft wir hier Weihnachten gefeiert haben«, sagte Johann. »Das ist doch eine schöne Tradition.«
Ihre Einwände, dass sie von jedem Fest ausreichend Fotos hätten und die Alben nach Jahreszahl geordnet im Regal stünden, akzeptierte er nicht.
»Das hat doch jeder«, hielt er dagegen, »aber einen Wald der Weihnachtsfeste, den haben nur wir.«
In der Küche schaltet sie seit einigen Jahren auch tagsüber das Licht an, und auf der Terrasse gibt es nur im Hochsommer, zur Mittagszeit, ein wenig Sonne.
Einmal hatte sie eine kleine Rotfichte, die er pünktlich am Heiligabend ins Wohnzimmer stellte, angesägt. Sie hatte sich unten am Stamm zu schaffen gemacht und anschließend Topf und Schnittkerbe mit goldener Folie umwickelt. Im Januar wurde der Baum braun. Sie hätte tanzen mögen vor Glück. Bis zum März. Im März kaufte Johann eine neue Rotfichte. »Nicht, dass uns ein Weihnachtsfest verloren geht«, sagte er.
Sie legt ihre Hände um den Becher, spürte die Wärme und atmet tief durch.
Sie hatte ihn gewarnt, hatte gesagt: »Ich will nicht lebendig in diesem Tannenwald begraben sein.«
Es war ein schönes Fest, dieses letzte Weihnachten mit der Familie.
Sie nimmt den Teebecher und geht hinauf ins Schlafzimmer. Ihr Blick fällt auf den blauen Becher. »Oma« steht in Leonies kindlicher Handschrift darauf.
Sie stellt den roten Opa-Becher mit dem süßen Fencheltee auf das Nachtschränkchen und nimmt den blauen Oma-Becher mit.
Der Wollige Fingerhut hatte im Sommer am Rand der Terrasse gestanden, sonst wäre sie nie auf die Idee gekommen. Aber er hatte dagestanden wie ein Zeichen. Tagelang betrachtete sie ihn von der Terrassentür aus, und dann sagte Johann: »Morgen mach ich den weg. Der gehört da nicht hin.«
Sie dachte nicht nach, antwortete kurz entschlossen: »Lass nur. Ich kümmere mich darum.«
In der Küche spült sie die »Oma-Tasse« gründlich aus und stellt sie in den Schrank.
Noch einmal geht sie ins Wohnzimmer und betrachtet von der Terrassentür aus die kleine Nordmanntanne.
Im März würde sie ein Gartenbauunternehmen mit dem Fällen der Bäume beauftragen. Schon im Mai könnte sie dann vom Küchenfenster aus das Gelb der Rapsfelder leuchten sehen und im Sommer auf der Terrasse glutrote Sonnenuntergänge beobachten.
Die kleine Nordmanntanne würde sie im Gedenken an dieses letzte Weihnachtsfest in den Garten pflanzen.
Sie lächelt zufrieden.
Dann erst greift sie zum Telefon, wählt den Notruf und sagt atemlos: »Mein Mann. Bitte kommen Sie schnell.«
Die Sonntagsbriefe
Am Heiligabend waren die Kinder und Enkelkinder da gewesen, und es war turbulent zugegangen. Als sie sich weit nach Mitternacht auf den Heimweg machten, stellte die Tochter noch eine kleine Schachtel auf den Gabentisch. Erst am nächsten Morgen öffnete seine Frau Frieda die feine silberne Schnur. »Ein Geschenk, das man nur einmal im Leben macht«, sagte sie. »Sieh nur, Hermann!«
In der Schachtel lag eine Haarlocke ihrer zweijährigen Enkelin, sorgsam mit einem rosa Band zusammengebunden.
Das Geschenk brannte ihm in Augen und Brust.
Vergessen! Vor mehr als fünfzig Jahren hatte er sie vergessen.
Damals hatte er ihr seine Liebe gestanden. Zärtlich, mit Blumen in der Hand, hatte er es ausgesprochen. Sein Gesicht in ihr dichtes dunkles Haar vergraben, hatte er es geflüstert. Sorgfältig, nach Worten suchend, hatte er es in Briefen formuliert.
Geliebte Lisa!
Das Licht, das hinter ihren großen braunen Augen zu leuchten schien, er hatte es gekannt … und vergessen.
Frieda kommt mit dem Tee in den Wintergarten.
»Hermann, jetzt sitzt du schon zwei Stunden hier herum und starrst in den Garten. Was ist denn los mit dir?«
Sie stellt das Tablett auf den kleinen Beistelltisch neben seinem Sessel, rückt eine Tasse, Zuckerdose und Milchkännchen zurecht. Draußen liegt der Garten unter einer weichen Schneedecke, wie ein unbewohntes Zimmer, in dem die Möbel mit weißen Laken sorgsam abgedeckt wurden.
Der Tag ist von einer Klarheit, die ihn angreift.
Er tätschelt Friedas Schulter.
»Nichts, Frieda, nichts. Ich will nur ein bisschen hier sitzen. Ein herrlicher Tag ist das. Lass uns später noch ein Stück gehen, ja?«
Frieda lächelt und geht. Seit zweiunddreißig Jahren sind sie nun verheiratet, und immer macht er Tauschgeschäfte. Kleine Tauschgeschäfte. Jetzt will er seine Ruhe haben und bietet Gesellschaft an. Später!
Er lehnt sich in seinem braunen Ohrensessel zurück und schaut in die nackte Krone des Ahornbaumes am Ende des Gartens. Ein kräftiger Baum. Still und stark steht er da, nur zur Linken dieser längst abgestorbene Ast.
Im Sommer liegt er geschützt im Blattwerk versteckt, aber der Winter legt ihn bloß, zeigt ihn von Wind und Witterung nackt geschält. Warum schmerzt ihn der Anblick erst jetzt?
Lisa Kranz.
Er war Schüler des Gymnasiums gewesen, und sie war – nur einen Steinwurf entfernt – in die Hauswirtschaftsschule gegangen. Über ein Jahr hatte er sie aus der Ferne angesehen und seinen Nachhauseweg so geplant, dass er ihr begegnen und ein Stück des Weges neben ihr gehen konnte.
Diese letzten unbeschwerten Sommerferien. Im folgenden Frühjahr sollte er sein Abitur machen und anschließend Medizin studieren. Das Studium hatte wohl schon mit seiner Geburt festgestanden. Der Großvater war Arzt gewesen, der Vater, und natürlich würde auch er Arzt werden.
In jenem Sommer hatte diese feste Vorstellung von seiner Zukunft Risse bekommen. Sein ganzes Streben galt nicht mehr dem Studium in Heidelberg. Jetzt kreisten seine Gedanken, seine Ängste und Hoffnungen um Lisa. Er wünschte sich sehnlich, sie an seiner Seite zu haben.
Hinter der Schule wartete er auf das Klingelzeichen der Hauswirtschaftsschule, das immer zehn Minuten nach dem Gong des Gymnasiums ertönte, und schlenderte dann, so langsam es ging, die Mozartstraße hinauf. Sie holte ihn ein, grüßte und verlangsamte ihren Schritt. Ihr tiefbraunes Haar trug sie zu einem Zopf zusammengebunden, aber rund um das schmale Gesicht waren im Laufe des Vormittags einzelne Haare und kurze, widerspenstige Locken aus dem Haarband entwischt. Vom schnellen Gehen schimmerten ihre Wangen rosig, und immer sah sie aus, als hätte sie bis eben versucht, die Welt aus den Angeln zu heben.
Über drei Monate gingen sie so nebeneinanderher, erzählten vom Unterricht des Vormittags, schimpften über Lehrer, stöhnten über Hausaufgaben und tauschten vorsichtig stille Seitenblicke.
Sie war es, die den ersten Schritt machte.
Am Wochenende würde ein Zirkus in der Stadt sein, und ihr Vater hatte zwei Freikarten bekommen. Ob er vielleicht mit ihr …?
Er sah nichts von der Vorstellung. Er sah nur sie. Wie sie sich ängstlich zurücklehnte, als die Löwen den Kreis der Manege abschritten. Wie sie lachte, als die Clowns stolpernd und schubsend miteinander stritten. Wie ihr Mund sich staunend rundete, als Akrobaten durch die Luft wirbelten.
Er nahm ihre Hand, als er sie an jenem Abend nach Hause begleitete, strich ihr zärtlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und gestand seine Zuneigung.
Sie lächelte, und er sah dieses Leuchten in ihren Haselnussaugen. Dann beugte sie sich vor, küsste flüchtig seine Wange und lief ins Haus.
Er nickt dem Ahorn zu. Damals hatte er sich zum ersten Mal einen Schritt weit vom sicheren Stamm des Elternhauses entfernt. Die Eltern hatten skeptisch, aber durchaus wohlwollend genickt und lediglich gemahnt, er solle das Abitur und das anschließende Studium nicht aus den Augen verlieren.
Die Sommerferien 1934 waren ihre Zeit gewesen.
Er erinnert sich an dieses Gefühl der Freiheit, eine Weite im Innern, die in seiner jugendlichen Vorstellung von nun an sein Lebensgefühl sein würde.
Jeden Samstag brachte er ihr einen Brief mit. Einen Sonntagsbrief, denn sonntags konnten sie sich nicht sehen. Ihre Eltern bestanden darauf, dass sie den Sonntag zu Hause mit ihren Eltern und Geschwistern verbrachte.
»Damit du mich morgen nicht vergisst«, sagte er jedes Mal, und sie schob den Brief wie eine Kostbarkeit in die Tasche ihres Kleides. Einmal brachte sie ihm, in blaues Seidenpapier eingewickelt, eine Locke mit.
»Die habe ich mir abgeschnitten. Ein Stück von mir, für deine Sonntage«, sagte sie lachend.
Als sie im Herbst an ihre Schulen zurückkehrten, gingen sie Hand in Hand die Mozartstraße hinauf. Sie waren ganz offiziell ein Paar. Der Sohn des Doktor Lahrmann und die Tochter des Herrenausstatters Kranz.
Kurz vor Weihnachten, es war der Freitag vor dem zweiten Advent, und sie waren im Kino gewesen, kamen sie auf dem Heimweg am Juweliergeschäft Tesch vorbei. Auf die Schaufensterscheibe war mit weißer Farbe »Jude« geschmiert. Lisa ging mit gesenktem Kopf eilig vorbei, und als sie den Stadtpark erreichten, flüsterte sie: »Hermann, ich muss dir was sagen. Meine Mutter … Sie ist Jüdin.«
Er greift zur Teetasse. Der Tee ist kalt, und doch beseitigt er die leichte Übelkeit.
Er hatte den Arm um Lisas Schultern gelegt und erwidert: »Aber Lisa, deine Mutter betrifft das doch nicht. Sie ist eine anständige, fleißige Frau! Es geht doch um die Wucherer, um die, die Deutschland ausbluten.«
»Und was ist mit Tesch?«, widersprach sie. »Glaubst du denn wirklich, dass Tesch so einer ist?«
Von übereifrigen, dummen Jungen hatte er geredet, von Auswüchsen, die sich bald geben würden, und dann hatte er seinen Vater zitiert: »Der Führer wird schon dafür sorgen, dass es nicht die Falschen trifft.«
War es da passiert? Hatte er selber geglaubt, was er gesagt hatte, oder war er an jenem Abend bereits einen ersten kleinen Schritt zurückgewichen? Jedenfalls hatte er beim Abschied gesagt: »Das mit deiner Mutter, das bleibt unser Geheimnis.«
Von nun an machten ihn Bemerkungen über Juden, die er bisher ganz selbstverständlich hingenommen hatte, hellhörig.
Der Vater, der zu Hause erklärte, dass die Juden die Wirtschaftskrise in Deutschland zu verantworten hätten. Sein Geschichtslehrer, der im Unterricht mahnte: »Die Juden sind das Unkraut, das sich in Deutschland ausbreitet und den fruchtbaren deutschen Acker zerstört.«
Er war verunsichert, und ihm kam es so vor, als habe Lisa diese Unsicherheit in sein Leben getragen. Ja, er dachte sogar manches Mal: Wenn sie doch still gewesen wäre. All diese Sätze hätten nicht ein solches Gewicht, wenn sie nicht von ihrer Mutter gesprochen hätte!
Er hört, wie Frieda im Esszimmer mit dem Geschirr klappert. Das leuchtende Blau des Himmels verliert sich langsam. Eine rötliche Wolkenbank liegt jetzt auf der Anhöhe. Im Restlicht scheint der tote Ast des Ahorns zu glühen, die äußeren Spitzen der feinen Zweige verlieren sich in der aufkommenden Dunkelheit.
An einem Donnerstag Ende April 1935 wartete er vergeblich vor der Hauswirtschaftsschule. Lisa kam nicht. Stattdessen lief Sonja, ihre Schulfreundin, auf ihn zu.
»Hast du es gewusst?«, rief sie ihm schon von Weitem entgegen.
»Was denn? Was meinst du? Wo ist Lisa?«
»Sie ist ein Mischling! Sie ist zur Hälfte Jüdin. Hast du das gewusst?«
Er schluckt und fährt sich mit der Rechten durch sein dichtes graues Haar.
Da war es passiert. Wenn nicht an jenem Abend nach dem Kino, dann an diesem Tag. Er war zurückgewichen und hatte, ohne nachzudenken, gelogen.
»Nein«, hatte er gesagt, »nein, das wusste ich nicht!«
»Jedenfalls fällt sie unter das Gesetz gegen die Überfüllung von deutschen Schulen. Sie kommt nicht mehr!« Sonja war außer sich, schimpfte auf die Schule und erklärte: »Die Lisa, die gehört doch zu uns. Wir müssen was tun!«
Da hatte er sich umgedreht und war fortgegangen. Nicht die Mozartstraße hinauf, sondern über einen Umweg nach Hause. Er hatte sich geschämt. Hatte sich seiner Lüge geschämt und gleichzeitig immer wieder gedacht: Morgen wissen sie es alle. Morgen wissen es die Eltern, die Lehrer, die Freunde.
Die Dunkelheit breitet sich aus, als würde jemand beständig Tinte in die blaue Weite träufeln. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Vollmond. Der Ahorn scheint verschluckt von der Schwärze, nur der geschälte, tote Ast glänzt silbrig weiß.
Der Vater hatte enttäuscht den Kopf geschüttelt und gesagt: »Du musst einsehen, dass eine solche Verbindung nicht länger möglich ist!«, und die Mutter hatte weinerlich gefragt: »Das willst du uns doch nicht antun?«
Eine Woche verging ohne Lisa. Sie meldete sich nicht, und er wusste nicht ein noch aus. Das enttäuschte Kopfschütteln seines Vaters und das Jammern der Mutter machten ihn mürbe. Auch die Lehrer sprachen ihn an, und ihre Argumente wurden von Tag zu Tag einleuchtender. Er gab sich einsichtig, machte Zugeständnisse, redete sich ein, dass er gar nicht anders handeln könne.
Eine weitere Woche verging. Der Vater legte stolz den Arm um die Schultern seines vernünftigen Sohnes, die Mutter lächelte ihn dankbar und erlöst an. Die Lehrer lobten seine Vernunft.
Er steht auf und betrachtet den silbernen Ast, der seine Spitze dem Mond entgegenschiebt, um sich an seinem Licht zu bereichern.
Frieda ruft aus der Küche. Das Essen ist fertig. Er will nicht essen.
Sie trafen sich heimlich, außerhalb der Stadt. In diesen Stunden entschied er sich für Lisa und schämte sich seiner Zugeständnisse den Eltern und Lehrern gegenüber. Dann stammelte er Entschuldigungen, bat sie um Verständnis für seine Situation und versprach, dass die Heimlichkeit bald ein Ende habe. Er sprach sogar von Heirat und davon, mit ihr gemeinsam nach Heidelberg zu gehen.
Im Herbst ging er dann alleine. »Erst einmal«, wie er ihr versicherte. Der Abschied war eilig. Lisa brachte kein Wort heraus, nickte all seinen Versprechen stumm entgegen.
Schon vierzehn Tage später wurden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Er widmete sich seinem Studium und schrieb ihr weiterhin jede Woche einen »Sonntagsbrief«. Von Heirat und einer gemeinsamen Zukunft in Heidelberg sprach er darin nicht mehr.
Weihnachten kehrte er zum ersten Mal nach Hause zurück. An Heiligabend, es war bereits nach Mitternacht, rief der Vater ihn in sein Arbeitszimmer. Er schenkte guten französischen Cognac ein und prostete seinem Sohn zu. Dann legte er ein Päckchen, gebunden mit einem rosafarbenen Band, auf den Tisch.
»Ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk für dich!«
Er war an den Schreibtisch getreten und hatte sie sofort erkannt. Seine Sonntagsbriefe.
Der Schmerz durchzog seinen ganzen Körper, und er musste mit beiden Händen Halt an der Schreibtischkante suchen.
»Hat sie die gebracht?«
»O nein.« Sein Vater lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Aber schließlich kann man nicht wissen, wie weit dieses Rassengesetz ausgelegt wird. Ich bin hingegangen. Ganz diskret. Ich habe ihr gesagt, dass ich alles haben möchte, was auf eine Beziehung zwischen ihr und dir hinweist.«
Sein Vater hatte ihm mit diesem wohlwollenden Lächeln zugenickt, mit dem man seinem Gegenüber großzügig ein »Danke« erlässt. Dann war er aufgestanden, um den Schreibtisch herumgekommen und hatte ihm auf die Schultern geklopft. »Übrigens, der brauchst du nicht nachzuweinen. Eine schwache Person. Hat hemmungslos geheult.«
»Was stehst du da am Fenster, Hermann? Was siehst du denn da?« Frieda stellt sich neben ihn und starrt angestrengt hinaus.
»Ich betrachte den Ahorn.«
Sie schnalzt rügend mit der Zunge.
»Der wäre ja ganz schön, wenn du endlich den toten Ast herausschneiden würdest. Darum bitte ich dich jeden Herbst, schon seit drei Jahren.«
Hermann nickt.
»Ja, vielleicht. Aber … ich möchte, dass er bleibt.«
Sie atmet hörbar aus und marschiert in die Küche zurück.
»Na schön, wie du meinst. Komm jetzt bitte Abendbrot essen.«
Er hatte es nicht ertragen. Am nächsten Tag hatte er die Briefe genommen und war zu ihr gegangen. Da war sie schon nicht mehr seine Lisa gewesen. Blass und fast ein bisschen ängstlich stand sie auf der obersten Steinstufe. Die braunen Augen hatten das Leuchten, das er so geliebt hatte, verloren.
Er hielt ihr die Briefe mit ausgestrecktem Arm entgegen und entschuldigte sich für seinen Vater. Er befände sich in einer unangenehmen Lage, erklärte er, seine Familie, die politischen Verhältnisse – sie müsse das verstehen. Seine Liebe zu ihr hätte aber nach wie vor Gültigkeit, und bald, da sei er sich sicher, kämen wieder andere Zeiten und dann …
»Für deinen Vater willst du dich entschuldigen?«, hatte sie mit plötzlicher Heftigkeit gerufen und ungläubig den Kopf geschüttelt. »Für deinen Vater? Das ist nicht nötig, Hermann.« Dann hatte sie sich umgedreht und war ins Haus gegangen.
Im Sommer 1936 hörte er zum letzten Mal von ihr. Familie Kranz hatte alles zurückgelassen und war fortgegangen. Nach England, hieß es.
Eine Wolke schiebt sich vor den Mond, der Ahorn ist jetzt gar nicht mehr zu sehen.
Er hatte die Briefe an jenem Abend verbrannt.
Die Haarlocke hob er auf. Erst Jahre später verstand er, was er ihr mit seinem ängstlichen Taktieren angetan hatte.
Im Frühjahr 1952 – er war seit zwei Jahren mit Frieda verheiratet – kauften sie dieses Haus. Frieda räumte Umzugskartons aus, und er richtete den Garten her. Beim Nachmittagskaffee, auf der provisorisch angelegten Terrasse, legte sie das feine blaue Seidenpapier mit der Haarlocke auf den Tisch.
»Was ist das, Hermann?«, fragte sie misstrauisch. Er hatte sein kurzes Erschrecken heruntergeschluckt, das Papier in die Brusttasche seines Arbeitshemdes gesteckt und neckend gesagt: »Meine liebe Frieda, die Locke ist zwanzig Jahre alt. Kein Grund zur Eifersucht.«
Später am Tag pflanzte er den Ahorn ans Ende des Gartens. Beim Ausheben der Erde musste es wohl herausgerutscht sein, denn als er das Papier mit der Locke abends aus seiner Hemdtasche nehmen wollte, war es nicht mehr da.
Ausgegraben
Der Winter war ohne große Kälte vorübergegangen und hatte viel Regen gebracht. Die Wiesen und Felder im Tal lagen Ende März noch satt und schwer, und die Bauern warteten mit dem Pflügen, ließen dem Boden ein paar trockene Tage.
Nur der neue Bauherr wartete nicht. Den Kösterhof hatte er schon im November abgerissen und anschließend dieses große Schild aufgestellt. Es zeigte sechs Einfamilienhäuser und darunter die Namen des Architekten und des Bauunternehmers.
Schon die Zwangsversteigerung zwei Jahre zuvor war erstaunlich verlaufen. Der Hof grenzte an den Naturpark an und war seit über zwanzig Jahren als landwirtschaftliche Nutzfläche festgeschrieben. Die beiden Nachbarbauern wollten das Land ersteigern, aber zwei Fremde hatten das Startgebot von achtzigtausend Euro auf über zweihunderttausend getrieben. Dass jemand für ein marodes Haus und mittelmäßiges Ackerland so viel bot, hatte schnell zu Gerüchten geführt. Von Umwandlung in Bauland war die Rede, von Bestechung und Korruption. Das ganze Dorf war in Aufregung.
Aus solchen Dingen hielt sich Elisabeth Gräser, die Wirtin vom Lokal Mühlenbach, heraus. Empörung war nicht ihre Sache. Außerdem hatte sie sich für Lore, die ihr Leben lang auf dem Hof geschuftet hatte, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen, gefreut. Sie konnte nicht nur ihre Schulden bei der Bank begleichen, sondern hatte auch noch eine schöne Summe übrig behalten.
Als sich die Gerüchte vom Bauland bestätigten, fand im Mühlenbach eine Bürgerversammlung statt. Hermann Sonntag, der im Dorf wohnte und Mitglied im Stadtrat war, geriet in Erklärungsnot. Das Wohnhaus, der Stall und die Scheune würden abgerissen werden, und nur auf diesen Flächen sollten neue Häuser entstehen. Und immer wieder versicherte er, dass das zum Zeitpunkt der Versteigerung noch nicht geplant gewesen sei. Die Dörfler glaubten ihm kein Wort, aber die Wogen glätteten sich.
Und nun das.