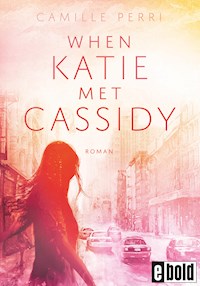Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weiter nach den Regeln spielen oder endlich auch ein Stück vom Kuchen abbekommen? Vor dieser Entscheidung steht Tina Fontana, die als Assistentin für Robert Barlow, den übermächtigen CEO eines internationalen Medienkonglomerats, arbeitet. Ihr Gehalt reicht kaum für ein Leben in New York, geschweige denn dafür, ihren Studienkredit abzubezahlen. Nach sechs Jahren, in denen die 30-Jährige ihrem Boss Tische in Restaurants reserviert hat, die sie sich nicht leisten kann, und ihm Drinks aus Flaschen ausgeschenkt hat, die mehr als ihre Miete kosten, steckt ihre Karriere in einer Sackgasse. Ein Fehler bei der Spesenabrechnung eröffnet Tina die Chance, ihre Schulden auf einen Schlag zu tilgen. Eine Summe, die für sie die Welt bedeutet, für ihren Chef aber nur Taschengeld ist. Ihre Entscheidung setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die das Leben der vielen überqualifizierten und unterbezahlten jungen Frauen der Stadt verändern wird ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 43 min
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Nachwort
Danksagung
Die Autorin
Impressum
CAMILLE PERRI
Die Assistentinnen
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Stefanie Zeller
Zu diesem Buch
Weiter nach den Regeln spielen oder endlich auch ein Stück vom Kuchen abbekommen? Vor dieser Entscheidung steht Tina Fontana, die als Assistentin für Robert Barlow, den übermächtigen CEO eines internationalen Medienkonglomerats, arbeitet. Ihr Gehalt reicht kaum für ein Leben in New York, geschweige denn dafür, ihren Studienkredit abzubezahlen. Nach sechs Jahren, in denen die 30-Jährige ihrem Boss Tische in Restaurants reserviert hat, die sie sich niemals leisten könnte, und ihm Drinks aus Flaschen ausgeschenkt hat, die mehr als ihre Miete kosten, steckt ihre Karriere in einer Sackgasse. Ein Fehler bei der Spesenabrechnung eröffnet Tina die Chance, ihre Schulden auf einen Schlag zu tilgen. Eine Summe, die für sie die Welt bedeutet, für ihren Chef aber nur Taschengeld ist. Ihre Entscheidung setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die das Leben der vielen überqualifizierten und unterbezahlten jungen Frauen der Stadt verändern wird …
Prolog
Sie haben sicher schon mal von meinem ehemaligen Chef gehört. Und selbst wenn nicht, stehen Sie vermutlich unter seinem Einfluss. Zum Beispiel, wenn Sie den 24-Stunden-Nachrichtensender einschalten oder sich einen dieser Sommer-Blockbuster im Kino ansehen.
Das ist er. Lesen Sie Zeitung? Oder diese Hochglanzmagazine, auf deren Cover in schreiendem Magenta prangt: »Heißer Dirty Talk, der seine Boxershorts in Flammen aufgehen lässt.« Das ist er auch. Denn wenn Sie in der modernen Welt leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Robert alle oder zumindest einige der Medien besitzt, die Sie konsumieren. Aktuell steht er, glaube ich, auf Platz fünfunddreißig der Forbes-Milliardärsliste. Ich war seine Assistentin.
Alle wichtigen Männer haben Assistenten. Oder meist Assistentinnen.
Das ist die erste Regel, die Sie sich merken sollten.
Haben wichtige Frauen auch Assistenten? Ja, natürlich. Aber Männer regieren die Welt. Immer noch. Das ist die zweite Regel, die Sie im Kopf behalten sollten. Nicht, weil dies ein feministisches Manifest wäre, sondern weil es erklärt, wie alles angefangen hat. Denn das ist es, was sie alle wissen wollen – die Reporter, die Blogger: Wie haben wir es angestellt?
»Wie konnten zwei kleine Mädchen den mächtigsten Mann New Yorks austricksen?«, lautete die Schlagzeile bei Upworthy. Ich bin dreißig Jahre alt, Emily ist achtundzwanzig. Mit meinen knapp ein Meter dreiundsechzig – auf Zehenspitzen – bin ich zwar kleiner als der Durchschnitt, aber Emily bringt es mit Absätzen auf über eins achtzig. Nicht gerade klein. Was Upworthy meinte, war: machtlos.
Auf BuzzFeed hieß es: »Die modernen Robin Hoods sehen eher aus wie Charlies Engel.« Dazu hatten sie uns in Badeanzüge gephotoshopt, mit Pistolen in den Händen.
Gothamist taufte unser Netzwerk »Die Schwesternschaft der diebischen Assistentinnen!« (Das Ausrufezeichen gehört dazu.)
Alles nur Gerüchte. Internetgerede. Niemand weiß, was wirklich passiert ist.
Deshalb lassen Sie mich eines klarstellen: Diebstahl im eigentlichen Sinne war es nicht. Und wie viel Geld einfach so herumliegt, haben wir auch fast durch Zufall entdeckt. Man muss nur zugreifen.
Das ist die dritte Regel, die Sie sich merken sollten. Es gibt genug Geld.
Mehr als genug.
KAPITEL 1
Und so fing der ganze Schlamassel an: Robert musste nach L. A. zu einem wichtigen Meeting mit der Führungsriege einer Titan-Tochter von der West Coast, und das Triebwerk seiner privaten Boeing besaß die Frechheit, auszufallen.
»Tina!«, schrie er aus seinem schallisolierten, gläsernen Büro.
Robert ist eigentlich von Natur aus kein Schreihals, aber was sollte er tun, wenn er gegen die Schallisolierung ankommen und durch die offene Bürotür gehört werden wollte. An seinem Ton erkannte ich, dass er meinen Namen gerufen hatte. Er hatte für jeden von uns einen eigenen Ton. Ein barsches, einsilbiges Bellen galt dem Ressortleiter, ein raues Brüllen dem Chefredakteur, ein eher schrilles Kreischen dem Produktionsleiter. Für mich war es sehr wichtig, diese Feinheiten unterscheiden zu können, denn es gehörte zu meinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass der, nach dem er rief, auch bei ihm erschien. Wenn er nach mir verlangte, senkte sich seine Stimme und klang beinahe bittend, ja vertraulich. Denn an mich wandte sich Robert mit allen persönlichen Anliegen – wenn sein Magen rebellierte und er etwas gegen Sodbrennen brauchte, wenn er einen Geburtstag vergessen hatte und ganz schnell noch ein Geschenk besorgt werden musste, oder wenn er es ums Verrecken nicht schaffte, eine neue Software auf sein iPad zu laden. Seine Verletzlichkeit bestätigte mich in solchen Momenten darin, dass ich für den Erfolg dieses mächtigen Mannes unerlässlich war – eines Mannes, den die halbe Welt für ein Monster hielt, weil er ein Mysterium für sie war und immer bleiben würde.
In weniger als einer Sekunde stand ich vor seinem Schreibtisch, den Notizblock im Anschlag. Hinter mir an der Wand liefen auf diversen Flatscreens die Nachrichtensendungen von Titan und seinen sogenannten Konkurrenten. Robert verfügte über die unheimliche Fähigkeit, das Geschehen auf allen Bildschirmen gleichzeitig verfolgen zu können.
Insgesamt war er im Besitz von neun Satellitensendern, einhundertfünfundsiebzig Zeitungen, einhundert Kabelsendern, vierzig Buchverlagen, vierzig Fernsehstationen und einer Filmproduktion. Damit erreichte er im Schnitt 4,7 Milliarden Menschen, was ungefähr drei Viertel der Weltbevölkerung entspricht. Aber The News waren sein Baby. Er sah sich jede einzelne Ausgabe an, er nahm Einfluss, er intervenierte. Deswegen lag sein Büro auch in der Zentrale von Titan News, wo er nicht nur die Flatscreens, sondern auch seine Journalisten genau im Auge behalten konnte. Ein so mächtiger Mann wie Robert hätte auch von einem Liegestuhl auf den Seychellen aus die Fäden des Konzerns ziehen können, zurückgezogen, weit weg von seinen Angestellten – aber er wollte hier sein, mitten im Geschehen.
In unseren Büroräumen sah es nicht aus wie in den Nachrichtenredaktionen, die man aus Film und Fernsehen kennt. In den Stockwerken unter uns schon eher – die Fernsehstudios, die Printredaktionen und der Newsdesk hätten dem Film Matrix entsprungen sein können. Die modernen Studios, in denen die 24-Stunden-News und unsere kontroversen Talkshows produziert wurden, nahmen einen ganzen Stock ein. Unsere Büros auf der vierzigsten Etage waren weit weniger aufregend – nur endlose Reihen von Schreibtischen und Trennwänden. Trotzdem waren wir der Kopf des Ganzen, von wo aus alle Befehle nach unten sickerten. Hier saßen auch die Chefredakteure und die Ressortleiter, denen Robert am meisten vertraute; so konnte er sie spontan zu seinen Treffen mit Wirtschaftsbossen und Promis hinzuziehen – und mit Vertretern der politischen Parteien (ja, beider Parteien) bekannt machen, die vorbeikamen, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Was ich damit sagen will: Die vierzigste Etage war zwar nicht sonderlich beeindruckend, dafür aber umso einflussreicher.
Robert hatte die Hemdsärmel hochgekrempelt und rieb sich den Kopf mit beiden Händen, wie immer, wenn er sich aufregte. Für einen Mann seines Alters hatte er erstaunlich volles, dunkles Haar, was er seiner gesunden Ernährung zuschrieb: geräuchertes Fleisch und alter Bourbon.
»Ich muss die nächste Maschine nach L. A. kriegen«, sagte er. »Und sorgen Sie dafür, dass die Sitze drum herum alle mitgebucht werden.«
So was sagte er immer, als würde er beim Deli um die Ecke ein Pastrami-Sandwich bestellen oder in seinem Fall vielleicht die edlere Variante Rinderbraten auf Brötchen.
»Sie fliegen Linie?«, fragte ich.
»Hören Sie bloß auf. Die Boeing hat eine Panne, und angeblich ist den ganzen Nachmittag kein anderer Jet verfügbar. Ist das zu fassen? Nicht ein einziger. Ich war mal wer in dieser Stadt, wissen Sie das?«
In den sechs Jahren, die ich nun schon für Robert arbeitete, hatte er noch nie einen Linienflug genommen. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Wenn er pünktlich zu dem Meeting in L. A. erscheinen wollte, musste er in den nächsten zwei Stunden in einer Maschine sitzen.
»Und nicht, dass die mir was dafür berechnen«, fügte er hinzu.
»Die Fluggesellschaft?« Robert verlangte, dass die halbe erste Klasse für ihn reserviert wurde, und das auf einem Flug, der quasi sofort ging – für lau. Und er erwartete, dass das so einfach war, als würde man sagen: »Ohne Senf, bitte.«
»Okay«, sagte ich.
Robert nahm die Hände vom Kopf, legte sie flach auf den Tisch und sah mich mit seinen großen, braunen Augen freundlich an. »Danke.«
Das ist etwas, was Menschen, die Robert nie persönlich begegnet sind, nicht für möglich halten – seine Liebenswürdigkeit. Sie sehen einen siebzigjährigen Medienmogul, bekannt dafür, Steuern zu vermeiden und Gesetze zu umgehen, um seine internationale Vormachtstellung immer weiter auszubauen. Sie sehen einen skrupellosen Geschäftsmann, der den Nachrichtenjournalismus angeblich im Alleingang zu einer Farce gemacht hat. Sie sehen einen der oberen Zehntausend, an dessen Mercedes hinten ein Sticker mit der Aufschrift Legt euch nicht mit Texas an klebt. Aber eigentlich ist Robert ein sehr netter Mensch.
Deshalb rief ich die Fluggesellschaft an und erklärte mit meiner Managerstimme höflich unsere Krisensituation.
»Sie verstehen sicher, dass dies große Unannehmlichkeiten für unsere Erste-Klasse-Passagiere bedeutet«, sagte die phlegmatische Frauenstimme am Telefon. »Aber weil es Mr Barlow ist, kommen wir ihm gerne entgegen.« Sie klang wie eine von Marge Simpsons kettenrauchenden Schwestern.
»Danke«, erwiderte ich ebenso liebenswürdig wie Robert eben. Immer nett und freundlich, lautete seine Devise. So muss man mit den Leuten reden. Nett und freundlich, aber zäh wie geschmortes Stinktier.
Die Frau klapperte auf ihrer Tastatur. »Das macht insgesamt neunzehntausendeinhundertsiebenundvierzig Dollar.«
Ich schnappte reflexartig nach Luft. Die Summe war derart hoch, dass es gar nicht mal so unvernünftig klang, mit einem Privatjet zu fliegen.
»Ma’am?«, sagte ich. »Ich verstehe, dass es sehr kurzfristig ist und Sie große Anstrengungen unternehmen, um Mr Barlows Bitte nachzukommen, aber wäre es möglich, dass Sie ihm für diesen Flug nichts berechnen?«
Stille.
»Hallo?«
Noch mehr Stille. Dann Gelächter, dann ein schleimlösendes Räuspern. »Was soll der Scheiß? Ist das ein Witz?«
»Wie bitte?«
»Für wen hält sich der Typ?«
»Ma’am«, sagte ich, wobei ich mich ein bisschen wie eine Südstaatlerin fühlte, obwohl ich aus New York stamme, und außerdem auch wie ein kleines Miststück, »haben Sie gerade geflucht? Ich möchte sofort mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.«
»Wir nehmen Robert Barlow auf keinen Fall gratis mit«, sagte sie.
Ich sah auf die Uhr und warf dann einen Blick in Roberts Glaskasten. Da es für ihn unvorstellbar war, dass man seinem Verlangen nicht nachkam, hatte er sich bereits auf den Weg zum Flughafen gemacht. Herrgott, kein Wunder, dass er nie Linie flog, wenn er so behandelt wurde. Okay, er wollte einen Gratisflug, aber wo waren denn die Manieren dieser Leute?
»Na gut«, sagte ich. »Wir bezahlen das Ticket. Aber sobald ich aufgelegt habe, werde ich mich bei der Kundenbetreuung über Sie beschweren.«
»Kreditkartennummer, bitte.«
So unfreundlich wie möglich sagte ich auswendig die Nummer von Roberts AmEx-Geschäftskarte auf.
Zwei Sekunden später antwortete die Frau: »Tut mir leid«, so als täte es ihr überhaupt nicht leid, »diese Karte ist nicht mehr gültig.«
»Unmöglich.«
Ich konnte sie durch die Leitung grinsen hören. »Diese Karte ist nicht mehr gültig.«
Mist. Na gut. Dabei hatte ich doch schon die Oberhand gehabt. Ich wühlte in meiner Handtasche, fand mein Portemonnaie, zückte meine eigene Kreditkarte und las die Nummer ab.
Da bei Titan die Assistentinnen keine Firmenkreditkarten haben durften, musste ich meine private benutzen.
»Einen Moment, bitte«, sagte sie.
Ich lauschte ihrem Atem, der sich anhörte, als würde Darth Vader bei einer Anti-Raucher-Kampagne mitmachen, dann meldete sie sich wieder: »Tut mir leid. Auch diese Karte wurde abgelehnt. Sie haben Ihr Kreditlimit überzogen.«
Das hätte ich mir auch selbst denken können. Keine meiner Kreditkarten hatte ein Limit über elftausend Dollar. »Kann ich es auf zwei Karten aufteilen?« Ich kramte in meinem Portemonnaie.
»Nein«, sagte sie.
»Nein?«
»Nein.«
»Dann möchte ich jetzt auf der Stelle mit Ihrem Vorgesetzten sprechen«, sagte ich. »Und das ist kein Witz.«
»Okay, na gut. Meinetwegen zwei Karten.« Meiner Widersacherin wurde es allmählich langweilig, mir den Tag zu vermiesen. Offenbar störte ich sie in ihrer trägen Teilnahmslosigkeit. »Aber üblich ist das nicht. Ich tue Ihnen einen Gefallen.«
»Das weiß ich zu schätzen«, sagte ich, weil ich im Grunde meines Herzens schwach bin.
Ich las die Nummer meiner zweiten Kreditkarte vor, bekam wieder »einen Moment« zu hören, aber die Tragödie war – endlich – abgewendet.
Ich legte auf und atmete tief durch.
Selbstverständlich reichte ich sofort nach Eingang der E-Mail-Bestätigung für die Abbuchung eine Spesenabrechnung ein. Zwanzigtausend Dollar, das war die Hälfte meines Jahresgehalts.
Meist dachten die Leute, als Assistentin eines der reichsten und mächtigsten Männer dieses Planeten würde ich mehr verdienen, und ich ließ sie in dem Glauben. So war es weniger demütigend. Vielleicht hat man Geschäftsführungsassistentinnen, auch bekannt unter der Bezeichnung Sekretärinnen, früher ja mal besser »versorgt«, aber diese Zeiten waren längst vorbei, zumindest in der Medienindustrie. Genauso wie Mittagessen im Four Seasons, das Rauchen in geschlossenen Räumen und die Existenz des Mittelstands. Alle Assistentinnen, die ich kannte, verdienten unter vierzigtausend im Jahr. Anfängerinnen sogar nur fünfunddreißig, deshalb konnte ich mich nicht wirklich beklagen.
Wenn man etwas per Telefon bestellt, zum Beispiel Flugtickets, bekommt man manchmal, bevor der Gesprächspartner drangeht, eine Bandansage zu hören: Dieser Anruf wird möglicherweise zur Qualitätssicherung aufgezeichnet.
Tja, mein Gespräch mit der unfreundlichen Frau von der Airline war zufällig einer dieser Anrufe. Die Drohung, Beschwerde einzureichen, hatte ich zwar nicht wahr gemacht – für so etwas bin ich viel zu faul –, aber ein paar Tage nach dem Vorfall rief mich die Kundendienstleiterin der Fluggesellschaft an, um sich für das »Missverständnis« zu entschuldigen. Man habe sich von der Mitarbeiterin »getrennt«, mit anderen Worten: Sie wurde gefeuert. Die Airline habe die Abbuchung von Roberts Flugkosten rückgängig gemacht, und man werde ein Geschenk schicken, als Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.
»Würde Mr Barlow sich über eine gute Flasche Rotwein freuen?«, fragte die zu Kreuze kriechende Frau.
»Aber ja, natürlich.«
So was passierte Robert ständig. Seit ich bei der Titan Corporation arbeitete, wusste ich, dass sehr reiche Leute für nichts bezahlen müssen.
(Nennen wir es ruhig Regel Nummer vier: Sehr reiche Leute bezahlen für nichts.)
Früher war ich so naiv. Dieses Geschleime der Airline-Tante hätte ich damals schlimm gefunden – unfair und sogar widersinnig. Warum sollte ein Milliardär etwas gratis bekommen, wofür jeder andere Mensch bezahlen muss? Aber in den vergangenen sechs seelentötenden Jahren hatte ich mich daran gewöhnt, deshalb regte es mich nicht mehr auf. Folglich vergaß ich die ganze Sache schnell wieder, ging nach Hause, guckte irgendwas auf Netflix und schlief ein, die unbezahlten Rechnungen, die sich wie immer auf dem Küchentisch stapelten, geflissentlich ignorierend.
Ein paar Tage später chattete ich per Gmail mit dem hübschen Kevin Hanson aus der Rechtsabteilung (»der hübsche Kevin Hanson«, so nannten ihn alle Frauen im Büro, oder einfach nur »der hübsche Kevin«), während ich mir löffelweise Frozen Yogurt in den Mund schaufelte. Ich erfreute mich gerade an einem heftigen Hirnfrost, gepaart mit einem Hochgefühl, das ich immer empfand, wenn ich mit Kevin chattete, als der interne Bote Billy – genannt »Patschuli«, weil er und folglich auch die Briefe und Päckchen fürchterlich nach dem Zeug stanken – einen weißen, Hippieduft verströmenden Umschlag auf meinen Schreibtisch fallen ließ, auf dem stand: Reise- und Bewirtungskostenerstattung.
Plötzlich fiel es mir wieder ein.
Ich loggte mich bei Google Mail aus, vergewisserte mich, dass Patschuli-Billy in sicherer Entfernung war, und ritzte dann den Umschlag mit meinem silbernen Brieföffner auf. Da war er. Ein nagelneuer, grüner Scheck über den Betrag von 19 147 Dollar, ausgestellt auf meinen Namen.
Logisch. Meine Kreditkarten waren erst belastet worden. Dann war alles wieder zurückgebucht worden. Aber R & B hatte den Antrag bereits bearbeitet und die Erstattung bewilligt.
Ich konnte den Blick nicht von der wunderschönen Zahl abwenden. Neunzehntausendeinhundertsiebenundvierzig Dollar. Das war so ungeheuer viel Geld für mich. Fast auf den Dollar genau mein Studienkredit, den ich seit fast zehn Jahren zurückzuzahlen versuchte. (Vielen Dank auch, NYU!)
Ich faltete den Scheck zweimal und schob ihn in die tiefsten Tiefen meiner Handtasche.
Später wurde mir klar, dass dies der Moment war, an dem ich schwach geworden war, der Wendepunkt. Obwohl ich eigentlich noch gar nichts Unrechtes getan hatte. Ich nahm einfach nur den Scheck mit nach Hause, mehr nicht – mit der festen Absicht, ihn dort zu zerreißen.
Natürlich hätte ich das auch sofort tun können, aber ich wollte ihn mir noch ein Weilchen ansehen. In meinem schimmeligen Miniappartement in Brooklyn, mit dem undichten Dach und den Ratten in den Wänden. Ich musste den Scheck einfach mit nach Hause nehmen und noch eine Nacht drüber schlafen, bevor ich ihn wegwerfen konnte.
Das tat ich dann auch.
Aber aus einer Nacht wurde eine Woche, in der ich neben diesem wunderbaren grün gemusterten Stück Papier schlief, das auf dem Nachttisch lag, unter dem halb leeren, orangefarbenen Pillenfläschchen mit Lexapro. Dann hatte ich einen Albtraum, in dem eine der Ratten während meiner Abwesenheit aus der Wand kroch und den Scheck fraß, deswegen klemmte ich ihn stattdessen unter eine Mausefalle. Ohne Käse, aber entsichert und bereit zuzuschlagen, wie ein aufmerksamer Wachmann.
Während ich die fein schraffierte Oberfläche des Schecks betrachtete, stellte ich mir vor, was passieren würde, wenn ich ihn einlöste und dabei erwischt wurde. Was würde ich dann sagen? Oh, der Scheck? Hatte ich ihn nicht zurückgegeben? Ich habe noch nie absichtlich Geld genommen, das mir nicht gehört. So bin ich einfach nicht erzogen worden.
Was auch stimmt. Ich wurde katholisch erzogen, von altmodischen Italienern (oder wie Robert mit seinem texanischen Näseln sagen würde: Ai-talienern). Meine Eltern glauben an den rachsüchtigen Gott des Alten Testaments, nicht an die nachsichtigere, friedliebende Version aus dem »amerikanisierten« (ihr Wort) Neuen Testament. Mein Vater drohte schon bei weit weniger schwerwiegenden Vergehen als Diebstahl, mir den kleinen Finger abzuschneiden. Aber andererseits, war nicht der Lieblingssatz meines strengen Vaters: Gottes Wege sind unergründlich?
Was, wenn das hier besagter unergründlicher Weg war?
Und hatte ich mir nicht genau das nach der Lektüre des Ratgebers »The Secret – Das Geheimnis« vorgestellt? Zwanzigtausend Dollar, hatte ich dem Universum gesagt. Mehr brauche ich nicht. Es ist vielleicht nicht viel Geld, aber es würde mein Leben verändern. Neunzehntausendeinhundertsiebenundvierzig Dollar war ziemlich nah an zwanzigtausend Dollar dran, und man musste schön blöd sein, eine solche Lieferung des Universums zu verschmähen.
Nach einer Weile merkte ich, wie zerstreut ich war. Ich ging ohne Schuhe aus dem Haus. Oder vergaß, wo ich die Schlüssel hingelegt hatte. Beinahe hätte ich mir die Zähne mit Hämorrhoidencreme geputzt. Dann verstand ich, was los war. Ich war verliebt. Ich hatte mich in die Idee verliebt, keine Schulden mehr zu haben, und die Verzücktheit und Fantasterei, die mit dem Verliebtsein einhergehen, machten mich wirr im Kopf.
Ich gab mich Tagträumen hin, beim Kaffeetrinken oder in der Subway, darüber, wie mein Leben sich zum Besseren wenden würde, wenn ich das Geld behielte. Ich könnte anfangen zu sparen, dachte ich. Ein extra Konto dafür eröffnen, ein sogenanntes Sparkonto. Dann müsste ich mit einem Schlag weniger ängstlich in die Zukunft schauen, könnte großzügiger sein. Oder ich schaffte mir einen Hund an – einen von diesen süßen Mischlingen, zum Beispiel einen Cheagle. Ich könnte auch ins Fitnessstudio gehen, jetzt, wo ich so viel Freizeit hatte, weil ich mir nicht mehr überlegen musste, ob ich den angegammelten Burrito im Kühlschrank essen sollte oder noch Geld für Einkäufe hatte; ob ich mit dem Loch im Backenzahn zum Zahnarzt gehen oder das komische Muttermal in Form eines Pantoffeltierchens auf dem Rücken untersuchen lassen sollte. Diese Socken, die kann ich doch sicher noch mal anziehen, bevor ich in den Waschsalon gehe. Und dieses Stück Alufolie, das ist doch so gut wie neu, ich muss es nur kurz abspülen. Nein. Schluss damit. Stattdessen könnte ich im Luxus schwelgen, das gute Leben leben. Ich könnte meine Telefonrechnung bezahlen und ins Kino gehen, am selben Tag.
Erst als wir in die Station Canarsie einfuhren, kam ich wieder zu mir.
Dieser Zug endet hier. Steigen Sie bitte alle aus.
Es musste etwas passieren. Ich musste diesen verdammten Scheck zerreißen!
Okay, gut, sagte ich mir. Ich mache es.
Zurück in den vier Wänden meines Schlafzimmers, die Jalousien heruntergelassen, den Scheck in der Hand, war ich fest entschlossen, die Sache ein für alle Mal zu beenden. Doch zuerst wollte ich noch schnell ein Foto von dem Scheck machen. Kein Selfie oder so – nur ein altmodisches Foto zur Erinnerung.
Und dann fiel mir diese App auf meinem Smartphone ein, die, mit der man einen Scheck nur fotografieren muss und – schwupps – ist das Geld auf dem Konto.
Böse, böse Technik.
Die Technik machte es so einfach, diesen Scheck einzulösen, dass es mir auch ganz aus Versehen hätte passieren können.
Es war kein Versehen – aber es hätte eins sein können.
Zunächst öffnete ich die magische Scheckeinlöseapp und loggte mich mit Benutzername und Passwort ein. Dann machte ich wie gefordert je ein Foto von der Vorderseite und von der Rückseite des Schecks. Vergewissern Sie sich, dass der Scheck vollständig innerhalb des Rahmens abgebildet ist, und tippen Sie auf das Kamerasymbol, wenn Sie bereit sind.
War ich bereit?
Nein, aber dieses neue Verfahren war so faszinierend, dass ich einfach weitermachen musste. Einen Scheck mit dem iPhone einlösen? Wer hätte gedacht, dass ich das mal erleben würde? Unglaublich. Und irgendwie unwirklich.
Auch, dass ich mich dann in mein Studienkreditkonto einloggte, war kein Versehen. Aber das ist das Verführerische an der Technik, denn wenn ich tatsächlich das Haus hätte verlassen müssen – mich an den Schreibtisch setzen, den Scheck in einen Umschlag stecken und zum Briefkasten bringen –, dann hätte ich es wohl doch nicht durchgezogen. Aber hier so allein, still und leise in meinem dunklen Schlafzimmer auf dem Handy herumzutippen kam mir harmlos vor. Ich war doch anonym. Und konnte die Sache jederzeit wieder rückgängig machen. Wenn man einen Umschlag in einen öffentlichen Briefkasten wirft, hat das etwas Endgültiges. In dem einen Moment hat man den Umschlag noch in der Hand, im nächsten ist er weg, gefolgt von dem schweren, metallischen Geräusch der Klappe. Dann öffnet man die Klappe möglicherweise noch einmal, um sicherzugehen, so als hätte es in der Geschichte der Briefbeförderung mal einer nicht bis nach unten geschafft. Und dann kommt für den Bruchteil einer Sekunde Panik auf. Habe ich an die Briefmarke gedacht? An den Absender? Jetzt ist es zu spät.
Aber einfach auf Senden klicken? Man konnte die Überweisung ja stornieren. Bearbeiten/Annullieren.
Lange starrte ich die Worte auf dem Display an – Den gesamten Betrag auszahlen –, bevor ich die Entscheidung traf. An diesem Tag hatte Robert sich mit seiner Frau darüber gestritten, ob die Chilis, die in seinem Garten wuchsen, Jalapeños oder Habaneros waren. Als sich herausstellte, dass er unrecht hatte, schickte er mich los, um ihr bei Tiffany das Diamantarmband zu kaufen, auf das sie ein Auge geworfen hatte. Für den Preis von 8900 Dollar.
Für Robert bedeuteten 19 147 Dollar also nicht mehr, als zweimal einen Streit zu verlieren.
Und es war noch nicht mal sein Geld. Es gehörte der Titan Corporation, und die war Milliarden, buchstäblich zig Milliarden Dollar schwer. Konnte man es mir wirklich verübeln, wenn ich diese für den Konzern winzige, aber für mich lebensverändernde Summe nicht zurückgab?
Es war schon drei Wochen her, dass mir der Erstattungsscheck ausgestellt worden war, und bisher hatte ihn niemand vermisst. Niemandem war es aufgefallen! Und ich hätte allein mit dem, was ich bislang jeden Monat an Zinsen für meinen Studienkredit bezahlt hatte, eine ganze Horde kambodschanischer Kinder aufziehen können.
Ein Klick. Den gesamten Betrag auszahlen. Das war es, mehr war nicht nötig. Dann war ich frei.
KAPITEL 2
Tage voller Angst und akutem Sodbrennen folgten. Jedes Mal, wenn Robert mich in sein Büro rief, verlor irgendwo ein Engel seine Flügel und mir wurde schlecht. Ich hatte gedacht, es würde mich erleichtern, wenn ich den Scheck erst einmal eingelöst und meinen Kredit abbezahlt hatte – und kurz überkam mich auch tatsächlich ein heftiges Hochgefühl –, aber bald darauf gewannen die Sorgen wieder die Oberhand. Nur dass es nicht die unterschwelligen, alles durchdringenden, leisen Geldsorgen waren, an die ich mich gewöhnt hatte. Dies hier war geballter, konkreter, so wie ein nicht zu übersehender Eiterpickel. Statt Mist, die Miete ist heute fällig, ist noch genug auf dem Konto?, oder: Das kann ja wohl nicht wahr sein, Time Warner hat die Tarife schon wieder erhöht!, dachte ich jetzt: Ich habe gestohlen. Wenn Robert mich fragte, wann sein Smoking aus der Reinigung zurück sein würde: Ich habe gestohlen. Wenn Robert mich bat, zu recherchieren, für welche Parteien sein Drei-Uhr-Termin gespendet hatte: Ich habe keine Moral. Wenn Robert mir bei seiner Rückkehr aus Georgia eine Tüte mit Pfirsichen auf den Schreibtisch stellte, weil er wusste, wie gern ich die mochte: Ich könnte mich umbringen.
Und dann bestellte mich Emily Johnson hoch in den dreiundvierzigsten Stock.
In den drei Stockwerken über unserem befand sich die Verwaltung – die Erbsenzähler –, aus strategischen Gründen. Alle Angestellten in den darunterliegenden Etagen sollten sich bewusst sein, dass man sie stets im Auge behielt, egal, was sie taten, wie ein allwissender Gott. Im dreiundvierzigsten Stock saß die Unternehmensführung. Die edlen Sofas, die in den kaum genutzten Räumen standen, waren ausschließlich für die straffen Hintern der Vorstandsmitglieder der Titan Corporation bestimmt. Hier oben befand sich auch die Abteilung R & B, kurz für »Reise- und Bewirtungskosten«.
Der dreiundvierzigste Stock sah genauso aus, wie man es erwarten würde. Überall glänzendes Messing und poliertes Holz. Es roch nach nichts. Wenn Nichts ein Duft wäre, den man in Flaschen kaufen könnte, würde er nach dem dreiundvierzigsten Stock riechen. Und es war still, so still, dass man durch die Lüftung weißes Rauschen hereinpumpte. Angeblich, um eine intime Atmosphäre zu erzeugen, aber ich denke, dass man auf die Art verhindern wollte, dass die hier arbeitenden Angestellten über die Nichtexistenz dieses Ortes verrückt wurden, dass sie in diesem kühlen Vakuum verschwanden, weil sie irgendwann glaubten, sie wären unsichtbar.
Der Leiter von R & B war ein Mann mittleren Alters, der täglich Fliege trug und in seinem Büro über Kopfhörer Opern hörte. Jede Spesenabrechnung, die in diesem Unternehmen eingereicht wurde, musste von ihm persönlich per Stempel genehmigt werden – selbst die von Robert. Aber in Wahrheit war es seine Sekretärin, die sich durch den ganzen Papierkram kämpfte und die Abrechnungen mit der schnörkeligen Unterschrift des Fliegeträgers versah, während er summend Puccini lauschte.
Alle wichtigen Männer haben Assistenten. Die Assistentin des Leiters von R & B hieß Emily Johnson, eine blonde, blauäugige Zicke aus Connecticut.
Emily war die Sorte Frau, die meine Anträge ablehnte, nur weil ich die Quittungen nicht alle richtig herum eingescannt hatte. »Ich kann dieses Chaos nicht lesen«, sagte sie am Telefon in ihrem herablassenden Tonfall. Der Akzent der Ostküsteninternate. »Wenn die Quittungen auf dem Kopf stehen, wird mir schwindelig.«
Aber noch nie hatte Emily mich deswegen persönlich in den dreiundvierzigsten Stock bestellt. Mir wurde flau, als ich ihre Mail las, und ich rannte auf die Toilette.
Während ich über dem blitzsauberen Marmorbecken hing, warf ich einen Blick in den Spiegel. Dämlich. Was für ein dämliches, anämisches Gesicht ich hatte, und vor lauter Schuldbewusstsein war es jetzt sogar noch blasser geworden. Es war eine gute Woche her, dass ich mit dem Geld für den Flug meinen Studienkredit abbezahlt hatte. Warum hatte ich bloß nicht noch ein bisschen länger gewartet? Jetzt konnte ich den Scheck nicht mehr zurückgeben. Sicher würden sie mich feuern. Oder noch schlimmer: anzeigen. Und Robert … Das Schlimmste wäre Roberts Enttäuschung, die Art, wie er die Hände an den Kopf legen oder unruhig seinen Absolventenring von der University of Texas drehen würde – seine zweite nervöse Angewohnheit. Heute war er Gott sei Dank auf Geschäftsreise, aber es war nur eine Frage der Zeit.
Die Tür zum Toilettenraum schwang auf, und herein kamen zwei Freelancer mit Zahnbürsten in den Händen. Bei Titan hatten alle einen Fimmel mit der Mundhygiene, der auch diejenigen ansteckte, die nur zeitweise für uns arbeiteten. Mit gesenktem Kopf schob ich mich an ihnen vorbei, um nicht in Small Talk verwickelt zu werden.
Mein Herz raste, und ich spürte, wie sich unter meinen Armen Schweißflecken bildeten, während ich zu den Aufzügen ging. Aus Gewohnheit drückte ich die Abwärtstaste und musste, als ich sofort danach zur Aufwärtstaste wechselte, warten, bis das System seine digitale Verwirrung überwunden hatte. Erst dirigierte die Anzeige mich zu Aufzug D, dann zu I und schließlich zu E – wohin ich auch eilig rannte, bevor sie unheimlicherweise das Wort DIEB buchstabieren konnte.
Emily wartete hinter den Glasschiebetüren, als ich im dreiundvierzigsten aus dem Aufzug trat. Sie trug eine weiße Bluse zu einer weißen Hose mit weißen High Heels. Der Winter neigte sich gerade erst dem Ende zu, doch ihre Haut hatte bereits einen leichten Goldbraunton, als hätte sie am Strand gelegen. Lächelnd ließ sie ihren Blick auf mir ruhen.
Meine ID-Karte konnte die Türen, die aus Sicherheitsgründen verschlossen waren, nicht öffnen, deshalb musste ich warten, bis Emily ihre Karte scannte und mich hereinließ. Doch nur so zum Spaß ließ sie mich noch ein Weilchen stehen, hilflos wartend, hyperventilierend.
Als sie schließlich Erbarmen hatte und ihre Karte vor den Scanner hielt, öffneten sich die Türen mit einem metallischen Klacken, wie ein Gefängnistor. Überhaupt erinnerte mich vieles hier an ein Gefängnis – unsere ID-Karten zum Beispiel waren wie elektronische Fußfesseln, denn sie registrierten jeden unserer Schritte. Ganz zu schweigen von den vielen Wachleuten, die überall herumwuselten. Wie um alles in der Welt hatte ich mir nur einbilden können, dass gerade hier das Fehlen von zwanzigtausend Dollar nicht auffallen würde?
Emily führte mich in den nordwestlichen Konferenzraum und schloss uns darin ein. Dann setzte sie sich mir gegenüber und schob geräuschlos eine Aktenmappe über die gläserne Tischfläche.
Ich sah weg. Von hier oben war der Ausblick so viel schöner als drei Stockwerke tiefer. Durch die deckenhohen Fenster konnte ich selbst von meinem Platz am Tisch aus das dichte Gewusel winziger Menschen und gelber Taxis auf der Eighth Avenue beobachten.
»Ich weiß, was du getan hast«, sagte Emily. Und noch bevor ich Unverständnis vortäuschen konnte, fügte sie hinzu: »Streite es nicht ab, Fontana. Damit würdest du nur meine Zeit verschwenden.«
Ich war irritiert. Woher wusste sie, dass mich, außer Robert, alle in der Firma nur beim Nachnamen nannten? Wir waren nicht befreundet.
»Ich verstehe, warum du es getan hast«, sagte sie mit einem Akzent, als wäre ihr Kiefer eingefroren.
Sie verstand es? Diese Frau wusste nichts, aber auch rein gar nichts von mir. Sie war eine Connecticut-Barbie. Ich dagegen war Skipper, und nicht mal die moderne Skipper mit den größeren Brüsten und dem ummodellierten Gesicht. Ich war die Teenager-Skipper aus den Sechzigern, die, die nie wirklich eine Frau wurde. Emily Johnson und ich hatten nichts gemeinsam.
»Eigentlich«, fuhr sie fort und stand von ihrem Stuhl auf, um auf meine Seite des Tisches zu kommen und ihren straffen, muskulösen Unterkörper an die Glaskante zu lehnen, »finde ich, dass du das Richtige getan hast. Mit zwanzigtausend Dollar wischt man sich hier doch den Arsch ab.« Ihr Eliteuni-Akzent war auf einmal wie weggeblasen. Und mit ihm auch der Katherine Hepburn/Bette Davis-Tonfall. »Verstehst du, was ich sagen will?«, fragte sie.
»Hm«, machte ich überrascht. »Ich bin mir nicht sicher.«
»Ich glaube, doch.« Emily öffnete die Aktenmappe und forderte mich mit einer Geste auf hineinzuschauen.
Sie wartete.
Es war ein Kontoauszug des American Education Service mit ihrem Namen drauf.
»Warum zeigst du mir das?«, fragte ich.
Emily tippte mit ihrem french manikürten Nagel auf eine Zahl. Der Gesamtsaldo. Vierundsiebzigtausenddreihundertdreiundzwanzig Dollar und zwanzig Cent.
»Denkst du, du bist die Einzige, die Geldprobleme hat?«, sagte sie. »Denkst du, du bist die Einzige, die fleißig geübt hat, um nicht wie ein Lkw-Fahrer aus der Bronx zu klingen?«
Auch ich erhob mich. »Dann bist du gar nicht aus Greenwich? Und hast kein Pferd namens Dancer?«
»Ich stamme aus den Slums von Bridgeport, und meine Eltern arbeiten bei der Post. Aber ich weiß, wie man einen guten Eindruck macht. Und jetzt setz dich wieder.«
Ich war so überrumpelt, dass ich ihr gehorchte. Sie nahm ihr langes, blondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen, wodurch sie sich sofort in eine gänzlich andere Person verwandelte. Sie war immer noch umwerfend schön – daran konnte wohl nichts etwas ändern –, aber die Überheblichkeit des reichen Mädchens hatte sich in eine irgendwie angriffslustige Härte verwandelt.
»Also, Folgendes wird jetzt passieren«, sagte sie. »Ich werde dich nicht verpfeifen, und du wirst Barlows Spesenabrechnungen dazu benutzen, meinen Studienkredit abzubezahlen. Dann sind wir quitt.«
»Bist du verrückt geworden?« Meine Stimme traf eine Oktave, die Emily kurz vergessen ließ, dass der Konferenzraum schallisoliert war, denn sie warf einen nervösen Blick zur Glastür. »Auf keinen Fall«, sagte ich. »Vergiss es. Das fällt doch auf.«
Sie zeigte ein perlweißes Lächeln, das wieder mehr zu der Emily passte, die ich kannte. »Das ist schon aufgefallen. Mir. Und ich werde mich garantiert nicht selbst hochgehen lassen.«
Sie schlug die Aktenmappe zu und drückte sie an ihre Brust. »Sei kreativ bei den Abrechnungen. Verteile die Beträge. Ein paar Tausend hier, ein paar Tausend da. Ich kümmere mich um den Rest, und in ein paar Wochen ist alles vorbei.«
»Das kann ich nicht tun«, sagte ich. »Das wäre wirklich Diebstahl. Es ist nicht richtig.«
Emily fummelte an ihrem Ohrstecker – ganz sicher kein Zirkonia, sondern ein echter Diamant. Was war echt an ihr und was falsch? Ich wusste es nicht mehr.
»Das ist so typisch«, sagte sie, »für Leute wie dich.«
»Für Leute wie mich? Was soll das denn heißen?«
»Komm schon, Fontana. Du läufst doch den ganzen Tag mit einem Gesicht rum, als würdest du härter arbeiten als alle anderen.«
»Du kennst mich noch nicht mal! In der Kantine hast du mich bisher nicht eines Blickes gewürdigt, und wenn wir nur zu zweit im Aufzug sind, tust du, als wäre ich Luft.« Emily löste ihr goldenes Haar und schüttelte es, sodass es wie ein Wasserfall über ihre Schultern fiel. Ein großer, schlanker Mann in einem zweireihigen Anzug ging im Flur an uns vorbei. Emily lachte laut auf und winkte ihm durch die Scheibe zu wie Miss America.
Dann wurde ihre Miene wieder ernst. »Du wirst es tun, Fontana. Weil du nämlich vor allem eine Kämpferin bist, genau wie ich. Und ich weiß, dass du nicht so dumm bist, wie du aussiehst.«
Bevor ich protestieren konnte, ging sie zur Tür. »Einen schönen Tag noch«, sagte sie, und da war er wieder, ihr Akzent.
KAPITEL 3
Ich hatte keine Ahnung, wie ich es anstellen sollte.
Okay, das ist gelogen. Ich wusste es ganz genau. Alle, die bei Titan Spesenabrechnungen machten, kannten das kleine Kästchen ganz unten auf dem Formular, neben dem stand: Auslagen, Verschiedenes. Dieses Kästchen kreuzte man an, wenn man etwas für die Firma ausgelegt, das heißt, aus eigener Tasche bezahlt hatte. Ziemlich einfach, oder?
Was sagen Sie? Warum nicht einfach irgendwas erfinden?
Weil der Trick an der Sache der war, dass man Belege für diese Auslagen vorweisen musste, als Beweis – das waren die verdammten eingescannten Quittungen, die Emily Johnson alle richtig herum haben wollte, weil ihr sonst schwindelig wurde.
Es war Freitagnachmittag, drei Uhr. Ich warf einen Blick auf das rechteckige Lämpchen an meinem Telefonapparat, um zu sehen, ob Robert im Gespräch war. Nein, war er nicht. Also schlich ich zu seiner Tür und klopfte leise von innen gegen die Scheibe.
Robert blickte auf. Bei meinem Anblick wurde seine strenge Miene gleich weicher. »Tina!«, rief er, als hätte ich ihn überrascht. »Was kann ich für Sie tun?«
»Quittungen«, sagte ich.
»Ist die Woche schon wieder vorbei?« Er verschob ein paar Ordner auf seinem Schreibtisch und klaubte aus verschiedenen Stapeln zerknitterte weiße und rosafarbene Zettel. Dann fischte er in dem Kaffeebecher mit der Aufschrift Longhorns herum, den er nur zu diesem Zweck auf der Ablage hinter seinem Stuhl stehen hatte, um dann zum Schrank zu gehen und die Taschen seiner Anzugjacken zu durchwühlen. Anschließend reichte er mir das wirre Bündel, wobei stets ein oder zwei der kleineren Zettelchen zu Boden schwebten. Ich ließ ihn sie aufheben.
So war es immer. Dieses systematisch chaotische Zusammensuchen der Quittungen, das Zurückverfolgen der Papierspur, die er im Laufe der vergangenen Woche durch Barzahlungen gelegt hatte. Jedes Mal das Gleiche.
Sie würden staunen, wieviel Geld dieser Mann in nur sieben Tagen auf den Kopf hauen konnte. Lassen Sie sich nicht von seiner rauen Art täuschen, Robert liebt Komfort und Luxus. Und ich glaube, er fand es cool, in seine Jackentasche zu greifen, ein Bündel Belege herauszuziehen und sie aufzufächern, als würde er beim Pokern im Per Se oder im Porter House das Gewinnerblatt auf den Tisch legen. Warum sonst bezahlte er nicht alles mit Karte?
Ich würde wetten, wenn er Goldbarren in der Westentasche seiner Armani-Anzugjacke hätte herumtragen können, hätte er am liebsten alles mit Goldbarren bezahlt. Einmal hörte ich, wie ein Bereichsvorstand ihn fragte, ob sein Mercedes geleast sei, woraufhin Robert fast auf den Teppich gespuckt hätte. »Ich will alles besitzen«, erwiderte er. So ähnlich lief es wohl auch ab, wenn ein Verkäufer oder Kellner ihn unschuldig fragte: »Bar oder mit Karte?« Ich sah förmlich vor mir, wie Robert den Betreffenden mit einem bösen Blick bedachte, bevor er ihm ein mit einem Gummiband zusammengehaltenes Bündel Hunderter hinwarf.
Das wöchentliche Prozedere des Einsammelns und Einscannens der Quittungen, um sie bei R & B einzureichen, war schlicht unnötige Mehrarbeit für mich. Aber heute rettete es mich. Heute reichte ich Roberts Auslagen so wie immer ein, methodisch, roboterhaft. Dann klickte ich auf Wiederholen und machte das Gleiche noch mal. Mit denselben Quittungen. Zwei Abrechnungen. Eine für ihn, eine für mich.
Wie ich darauf gekommen bin?
Ich verrate es Ihnen: In den vergangenen sechs Jahren hatte ich oft gedacht: Wow, Robert Barlow vertraut mir wirklich! Denn ich hatte Zugriff auf alle seine persönlichen Daten. Kontonummern, Passwörter, den Termin seiner nächsten Prostatauntersuchung. Ich kannte alle seine Geheimnisse. Und manchmal, an den schlimmsten Tagen, dachte ich auch: Wow, wenn ich wollte, könnte ich Robert Barlow ausnehmen wie eine Weihnachtsgans!
Aber das war die Fantasie der Arbeiterklasse, so wie ich mir als kleines Mädchen immer gewünscht hatte, ich wäre ein Findelkind, und meine wirklichen Eltern wären König und Königin … In Wahrheit war ich stolz auf Roberts Vertrauen in mich. Es schmeichelte mir, genau wie die Tatsache, dass ich mich in seinem Dunstkreis bewegte. Ich selbst war unbedeutend. Doch als Barlows Assistentin kannten die Oberkellner und Hoteliers meinen Namen. Ich konnte es mir nicht leisten, ihre Etablissements zu besuchen, trotzdem kannten sie mich. Zu Weihnachten bekam ich, und nur ich, fünfzehn Pfund schwere Panettones zugeschickt.
Durch Robert war ich wer. Ich hätte ihn ebenso wenig bestohlen wie meine kleinbürgerlichen Eltern.
Und jetzt das. Diese verfluchte Emily Johnson. Trotz ihrer Großspurigkeit hatte ich sie nie für besonders intelligent gehalten. Eher für eine weitere dümmliche Blondine mit einer teuren Ausbildung. Jetzt wusste ich nicht mehr, was ich denken sollte. Immerhin schien sie cleverer zu sein als ich.
Von dem Tag an würde dies meine Methode sein, egal, wie lange es dauerte: die Quittungen für Roberts Auslagen doppelt buchen (total illegal), die falschen Belege erstattet bekommen (alles Lügen), den Scheck einlösen (jetzt gab es kein Zurück mehr) und das Geld Emily in bar übergeben. (Vermutlich würde sie nicht mal danke sagen.)
Dieselben Belege zweimal einzureichen, beim zweiten Mal mit meinen Kontodaten statt mit denen von Robert, war kein besonders genialer Plan. Wenn nicht Emily diejenige gewesen wäre, die das Ganze abzeichnete, wäre ich schon bei der ersten falschen Abrechnung aufgeflogen. Das kann ich gar nicht genug betonen. Wir kamen nur damit durch, weil die Männer, die die große Kohle machten, die Verantwortung für Dinge, mit denen sie nicht belästigt werden wollten (wie eigenhändig zu unterschreiben) auf ihre Assistentinnen übertrugen.
Ein paar Wochen, so lange würde es dauern, hatte Emily gesagt – was sehr optimistisch war. Um die Sache etwas zu beschleunigen, gab ich ein paar Tausend Dollar hier und da mehr in das Formular auf meinem Monitor ein – und klickte jedes Mal das Kästchen Beleg verloren oder beschädigt an. Normalerweise brauchte man für jede Ausgabe über tausend Dollar einen Beleg, aber a) war dies Roberts Firma, und b) war es Emily sowieso egal.
Ich zögerte, bevor ich auf Senden klickte, schloss dann kurz die Augen und beschäftigte mich mit anderen Dingen. Denn wenn ich eines aus der Hamlet-Lektüre im letzten Uni-Jahr oder aus endlos vielen Nike-Werbungen in den Neunzigern gelernt hatte, dann, dass man es verdammt noch mal einfach tun muss.
Zehntausend. Bumm. Gesendet.
Genau in diesem Moment rief Robert etwas aus seinem Büro, und ich verstand, dass er nach dem Chefredakteur verlangte.
Ich streckte den Kopf über die Trennwand vor meinem Schreibtisch, wie ein Maulwurf, der aus seinem Loch späht, und rief über die Reihen der Arbeitsnischen hinweg: »Dillinger! Robert will Sie sehen!«
Auf unserer Etage nannten sich alle beim Nachnamen, so wie es bei den Longhorns üblich ist, dem texanischen Footballteam – eine Sitte, die wohl nur jemand verstehen kann, der in einem von Männern dominierten Büro arbeitet.
Dillinger, der mit Vornamen Jason hieß, eilte in Roberts Büro und schloss die Tür hinter sich. Als ich mich wieder auf meinen Stuhl fallen ließ, bemerkte ich, dass die rechte untere Ecke meines Monitors zum Leben erwacht war.
Mittagessen heute?
Der hübsche Kevin chattete mit mir. »Mittagessen« bedeutete, dass wir zusammen in die Kantine runterfuhren, um uns dort einzudecken, und dann mit dem Aufzug wieder hochfuhren und getrennt an unseren Schreibtischen aßen. Alles in allem war es ein Zehn-Minuten-Date mit maximal fünf Minuten ungestörter Unterhaltung. Und Minimum drei Minuten, in denen ich mich so verrückt machte, dass meine Hände anfingen zu schwitzen. Was will dieser Typ von mir?