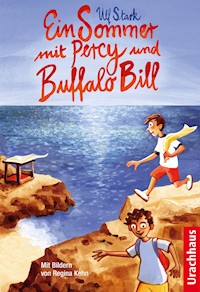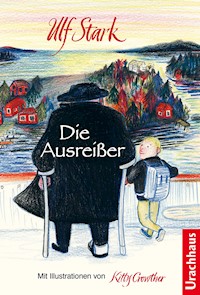
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ja, er ist der Albtraum der Krankenschwestern! Klingelt, flucht, wütet und nörgelt. Ein Sohn muss sich für einen solchen Vater schämen! Und ein Enkel? – Der sieht, dass es Wichtigeres gibt als Vernunft und Sicherheit. Mit Herz, Mut und Erfindungsreichtum machen sich der Junge und sein Großvater für ein Wochenende heimlich aus dem Staub. Ein kleines, verschmitztes und nachdenkliches Abenteuer um der letzten, großen Dinge willen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Ausreißer
Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer
Mit Illustrationen von
Inhalt
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
1.
Die Blätter des Ahorns draußen vor dem Krankenhaus glühten. Ich stand am Fenster und schaute hinaus. Und dachte: Seltsam, dass die Blätter am allerschönsten leuchten, kurz bevor sie abfallen.
»Komm her und guck dir das an«, sagte ich zu Großvater. »Es sieht echt toll aus.«
»Hab keine Lust«, knurrte er. »Ich darf ja sowieso nicht rausgehen.«
Ich war auf eigene Faust zum Krankenhaus gefahren, um Großvater zu besuchen. Davor hatte ich Papa schon ein paarmal dorthin begleitet, darum kannte ich den Weg.
Zuerst nahm man die U-Bahn. Dann fuhr man mit einem roten Bus und stieg aus, wenn man links auf einer Anhöhe eine Kirche sah.
Das war keine Kunst. Papa wollte sowieso nicht allzu oft hinfahren. Großvater war nämlich schwierig. Das war er schon immer gewesen. Aber jetzt war er schlimmer denn je.
Er wurde wütend, brüllte und spuckte die Tabletten aus, die ihn friedlich und brav machen sollten. Und er beschimpfte die Krankenschwestern.
»Hier bin ich eingesperrt wie ein Tier!«, fuhr er sie an.
»Für was haltet ihr mich? Für einen Affen?«
Er wurde knallrot im Gesicht und fluchte so wild, dass Papa mir sagte, ich solle mir die Ohren zuhalten. Papa fand es unnötig, dass ich noch mehr schlimme Ausdrücke lernte, als ich sowieso schon kannte.
Das fand ich nicht.
Mir gefiel es, wenn Großvater sich aufregte. Dadurch wurde das Leben irgendwie spannender.
Aber Papa machte es müde und traurig, sehen zu müssen, wie sein starker, dicker Vater so dalag und immer schwächer und dünner wurde. Darum vermied er es, ihn allzu oft zu besuchen.
»Warum kann er nicht so sein wie alle andern?«, seufzte Papa.
Das war letzten Donnerstag. Papa kam aus der Zahnarztpraxis, hängte seinen weißen Kittel an den Spezialhaken, wanderte durchs Haus und zog sämtliche Uhren auf. Neun Stück.
Das machte er jeden Donnerstag.
Ich lief hinter ihm her.
»Können wir Großvater nicht von dort wegholen?«, fragte ich.
»Nein«, sagte Papa und zog die große Standuhr im Esszimmer auf.
»Warum darf er nicht hier im Altersheim wohnen? Dann könnten wir ihn jeden Tag besuchen!«
Gleich neben unserem Grundstück lag ein Altersheim. In unserer Gegend irrten ständig alte Leute umher, die nicht so recht wussten, wo sie hingehörten. Großvater könnte einer von ihnen werden. Dann könnte er bei uns essen, und ich dürfte ihn so oft treffen, wie ich wollte.
»Großvater ist nicht hier gemeldet, das weißt du doch.«
»Aber er könnte bei uns wohnen. In meinem Zimmer!«
»Nein, hab ich gesagt!«, versetzte Papa. »Die Treppen sind zu anstrengend für sein schwaches Herz. Und überhaupt ist er zu krank und viel zu wütend und dickköpfig und verrückt. Du weißt doch, was letztes Mal passiert ist!«
»Da hat er einfach Pech gehabt«, sagte ich.
»Pech?«, schnaubte Papa. »Sein gebrochener Oberschenkel war gerade erst zusammengeschraubt worden. Und da fiel ihm nichts Besseres ein, als einen riesigen Stein hochzustemmen, sodass alles wieder auseinandergebrochen ist. Nennst du das Pech?«
»Jedenfalls finde ich es gut, dass er nicht so ist wie alle anderen«, sagte ich. »Besuchen wir ihn am Samstag?«
»Mal sehen«, sagte Papa.
Ich wusste, was das bedeutete. Wir würden nicht hinfahren. Wenn der Samstag näher rückte, würde Papa erklären, er habe leider zu viel zu tun.
Jetzt nahm er in seinem Lieblingssessel Platz, setzte den Kopfhörer auf, sah an die Decke und drehte die Musik so laut, dass sie die Gedanken in seinem Kopf übertönte.
»Ich fahre jedenfalls am Samstag zu ihm«, sagte ich.
»Ich hab ihn gern. Und ich will nicht, dass er alleine ist.«
Papa nickte.
Er hatte kein Wort gehört.
2.
Ich behauptete, ich müsse ins Fußballtraining.
Dann bat ich um mein Taschengeld. Das würde fürs Fahrgeld reichen. Schließlich packte ich die Fußballstrümpfe, die kurze blaue Hose und die Fußballschuhe mit den Stollen, die ich mir erbettelt hatte, in meinen Fußballbeutel. Es galt, alles zu bedenken.
»Wenn du was zum Futtern brauchst, kannst du es dir aus dem Kühlschrank holen«, sagte Mama.
»Danke«, sagte ich und machte ein Brot mit Käse und eins mit Hering.
»Seit wann magst du denn Hering?«, fragte Mama erstaunt.
»Wegen dem Salz«, erklärte ich. »Beim Training schwitzt man so viel.«
Schade, dass Papa das nicht hörte. Er schätzte es, wenn man wissenschaftlich argumentierte. Aber er war gerade ins samstägliche Kreuzworträtsel vertieft.
Als Mama die Küche verlassen hatte, holte ich mir auch etwas zu trinken.
»Ein Glück, dass wir beschlossen haben, Großvater nicht zu besuchen, wo du doch zum Training musst«, bemerkte Papa, als ich mich verabschiedete.
»Ja, wirklich ein Glück«, sagte ich.
Dann fügte ich hinzu, ich würde wahrscheinlich etwas später nach Hause kommen, weil ich mit einem der Fußballjungs hinterher noch schwierige Matheaufgaben üben wollte. Mathe war nämlich mein schlechtestes Fach in der Schule.
Papa hob den Blick von der Zeitung und lächelte.
»Schön, dass du etwas Sinnvolles machst, anstatt dir irgendwelche Dummheiten auszudenken«, sagte er.
»Mhm«, sagte ich. Dann machte ich mich auf den Weg.
Die Dummheiten warteten schon.
Zuerst ging ich ein Stück weit in Richtung Fußballplatz, weil Mama am Fenster stand und winkte. Das machte sie immer. Nach einer Weile bog ich dann zum U-Bahnhof ab.
Ich löste meine Fahrkarte, und als die U-Bahn kam, stieg ich ein.
Im U-Bahnfenster sah ich mein Gesicht. Es war halb durchsichtig. Ein guter Geist auf verbotener Mission.
Bei der Haltestelle Slussen stieg ich aus und nahm dort den roten Bus.
Aber vorher blieb ich kurz auf dem Bahnsteig stehen und sah die beste Leuchtreklame der Stadt an, wie Papa immer zu bemerken pflegte: Eine Zahnpastatube, die einen leuchtenden Zahnpastawurm auf eine gelbe Zahnbürste drückte.
Dabei musste ich an Papa denken. Und an Großvater. Daran, wie verschieden sie waren. Papa war lang und dünn und hatte traurige Augen. Großvater dagegen war klein und rund und schien nur ein einziges Gefühl im Leib zu haben: Wut. Wenn er sich ärgerte, konnte man es hören. Papa zog sich lieber zurück und schwieg, wenn er schlecht aufgelegt war.
Kein Wunder, dass sie einander nicht verstanden.
Ich musste immer noch daran denken, wie verschieden sie waren, als ich im Bus saß und sah, wie der Herbst draußen vor dem Fenster vorbeirüttelte.
Nach einer Weile setzte sich eine Frau neben mich. Die Frau war groß und kräftig und hatte einen blauen Mantel an. Sie roch nach Schweiß. Ich rückte näher an sie hin. Vielleicht würden meine Kleider ein wenig von ihrem Schweißgeruch aufsaugen, als Beweis, dass ich beim Fußballtraining gewesen war.
Da wandte sie sich zu mir um.
»Na, mein Kleiner, hast du Hummeln im Hintern?«, fragte sie.
»Nein«, sagte ich.
Was glaubte sie eigentlich?
»Und du bist ganz alleine mit dem Bus unterwegs?«, fuhr sie fort.
»Ja, ich will meinen Großvater besuchen.«
»Wie lieb von dir«, sagte sie. »Holt er dich an der Haltestelle ab?«
»Nein, er ist im Krankenhaus.«
»Und deine Eltern? Sind die nicht dabei?«
»Papa hat keine Zeit. Er muss das Kreuzworträtsel lösen«, sagte ich.
Da legte die Frau mir den Arm um die Schultern. Gut für die Schweißübertragung, dachte ich. Als sie seufzte, klang es, als würden die Bustüren geöffnet.
»Du hast deinen Großvater wohl sehr gern?«, fragte sie.
»Ja, das stimmt«, sagte ich.
Dann begann ich von Großvater zu erzählen. Keine Ahnung, warum. Es war, als würde mein Mund von ganz alleine reden. Er erzählte von Sachen, die wir im Sommer zusammen gemacht hatten. Und davon, wie gemütlich es war, einzuschlafen, wenn Großvater schnarchte. Und wie gut Großvater vieles machte. Große Steinbrocken ausgraben, zum Beispiel. Und neue Dachpappe aufs Dach des Klohäuschens legen.
Je mehr ich erzählte, desto jünger und kräftiger wurde Großvater.
»Um deinen Großvater wirst du dir wohl keine allzu großen Sorgen machen müssen, denke ich«, sagte die Frau.
»Nein«, sagte ich.
»Der ist bestimmt bald wieder auf den Beinen«, meinte sie.
»Ja«, sagte ich.
Dann musste ich an Großvaters Herz denken, das zu groß und zu schwach war, und an sein zusammengeschraubtes Bein und daran, dass Papa gesagt hatte, es könnte nie wieder gut werden.
Dann sah ich die Kirche auf dem Hügel.
Ich sah sie durch Tränen hindurch.
»Auf Wiedersehen«, sagte ich, als ich ausstieg.
»Auf Wiedersehen«, sagte die Frau. »Grüße deinen netten Großvater, einen liebevolleren Enkel hätte er sich nicht wünschen können.«
»Das werde ich«, sagte ich.
3.
Mein netter Großvater drückte soeben auf den Alarmknopf, der über dem Bett baumelte. Er ließ den Knopf erst los, als eine Schwester kam.
»Was ist jetzt schon wieder?«, fauchte sie.
Sie war gereizt. Kein Wunder, Großvater drückte nämlich andauernd auf den Notrufknopf. Weil ihm langweilig war. Weil er die Schwestern ärgern wollte. Weil er sonst nichts zu tun hatte. Hier gab es keine Löcher zu graben. Keine großen Steine aus der Erde zu wälzen. Kein Dach, auf das er klettern konnte, um den Schornstein zu entrußen.
»Bringen Sie dem Jungen ein Glas Saft und eine Rosinenschnecke«, befahl er.
»Nein«, sagte die Schwester. »Das hier ist kein Café.
Und würden Sie bitte damit aufhören, den Notruf unnötig zu benutzen. Sonst schneide ich das Kabel durch.«
»Hol’s der …«
Und dann fluchte er.