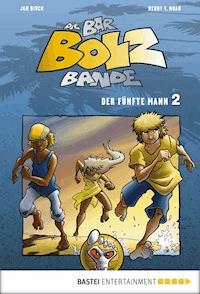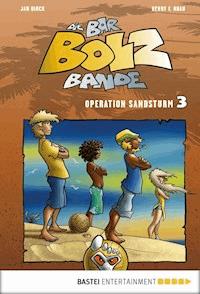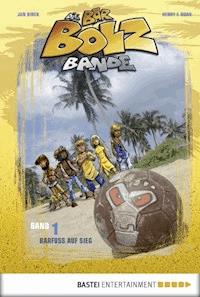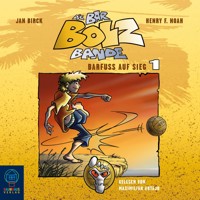9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Bar-Bolz-Bande nimmt Kurs auf Brasilien, das Mekka der Beachsoccer. Endlich wollen sie ihn sich holen: den Cup der Cups, den Beachsoccer-Pokal von Barracuda! Doch als ihr Traum zum Greifen nahe scheint, legen sich die Schatten der Vergangenheit über die Barbolzer. Sie treffen auf einen alten Rivalen, mit dem sie nicht gerechnet haben, und dann verliert einer der fünf Freunde auch noch den Boden unter seinen nackten Füßen ? Die Bar-Bolz-Bande ? Sonne, Sand und Soccer ? das spannendste Fußballabenteuer aller Zeiten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Über die Autoren
JAN BIRCK, geb. 1963, arbeitet als Illustrator und Autor. Von ihm sind über 100 erfolgreiche Bücher und CD-ROM-Gestaltungen für verschiedene Verlage erschienen, und er ist der Gestalter der Bestsellerreihe „Die Wilden Fußballkerle“.
Birck lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in München.
HENRY F. NOAH ist Schauspieler und freier Autor mit Schwerpunkt Kinder- und Animationsfilm. Gemeinsam mit Jan Birck arbeitet er an dessen Jugendbuchreihe „Die Bar-Bolz-Bande“. Noah lebt heute in München und Frankfurt.
Jan Birck / Henry F. Noah
UNTER KNOCHENFUSS-FLAGGE
Mit Illustrationen von Jan Birck
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Redaktion: Sigrid Vieth / Simone Schwarzer, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung E-Book:
Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1638-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Inhalt
Licht und Schatten
Bunte Hunde
Geier über der Barbolzburg
Der Geist aus der Vergangenheit
Sprengkommando
Die Perlen von Barracuda
Winterschlaf
Machtspiele
Die Seele des brasilianischen Fußballs
Unter Knochenfuß-Flagge
Drei sind zwei zu viel
Spezialauftrag
Der Köder
Regatta
Barracuda
Eds Rätsel
Schwarzer Nachmittag
Das Ende vom Ende
Beleza pura
Der Tag der Tage
Endspiel
Vom Siegen und Gewinnen
Schatten und Licht
Spaghetti Vongole
Nachwort
Alex ist die Tochter eines Fußballstars und lebt auf einer Luxusyacht. Doch glücklich ist sie dort nicht. Sie hat das Talent ihres Vaters geerbt, darf aber erst spielen, als Mark, Derik, Yo-Shi und Victor sie aus ihrem goldenen Käfig befreien.
Pizzo spielt mit vier Füßen.
Victor spielt Schlagzeug, liebt Hamburger und hatte einige Kilo zu viel auf den Rippen … bis die Bar-Bolz-Bande ihn aufnimmt. Denn er besitzt Fähigkeiten, von denen er selbst nichts ahnte.
Mark hat seit einem Autounfall ein Handicap: Sein linkes Bein ist zwei Zentimeter kürzer als sein rechtes. Dank harten Trainings und eisernen Willens hat er diesen Nachteil aber längst wieder wettgemacht. Barfuß auf Sand ist er nahezu unschlagbar.
Yo-Shi ist die Tochter einer Japanerin. Klar, dass sie manchmal Beachsoccer und fernöstliche Kampftechniken miteinander vermengt … mit durchschlagenden Ergebnissen.
Derik ist in Brasilien aufgewachsen und mit einem Fußball unter dem Arm geboren worden. Er lässt sich durch (fast) nichts aus der Ruhe bringen und ist auf dem Spielfeld ein wahrer Ballkünstler.
Licht und Schatten
Ich hockte neben Alex und blinzelte in das Licht, das durch das Blätterdach des Dschungels flackerte. In der Ferne der Corcovado, der „Bucklige“, und die berühmte Christus-Statue. Dahinter der Zuckerhut und der Ozean. Rio de Janeiro.
Der Sandsoccer-Worldcup war vorbei, und wir waren seitdem jeden Nachmittag auf den alten, vom Urwald überwucherten Wachturm geklettert. Denn hier vereinten sich die Geräusche und der Geruch des Dschungels mit dem Rauschen der Brandung und der salzigen Seeluft sozusagen zu einem vollendeten Brasilien-Mix. Deshalb hatten wir dann auch genau hier, im Schatten der Baumkronen, begonnen, uns gegenseitig unsere Erinnerungen zu erzählen. Je öfter ich allerdings über die Ereignisse der vergangenen beiden Sommer nachdachte, desto weniger konnte ich glauben, dass das alles wirklich passiert war. Doch wir waren nun mal tatsächlich hier angekommen, und hinter uns lag unsere Geschichte …
Ich beschloss, sie aufzuschreiben.
Alles, von Anfang an. Ich wollte selbst die kleinsten Dinge festhalten, bevor sie verblassen und sich irgendwann im Herbstnebel über Sandorn auflösen würden. Nichts sollte verloren gehen. Denn hier, auf der Insel Barracuda vor der Küste Brasiliens, gibt es keinen Herbstnebel, in dem etwas verblassen könnte. Hier scheint alles einfach so zu sein, wie es ist, haltbar gemacht in einem ewigen Bad aus Licht und Sonne.
Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Ich meine Schatten in seinen verschiedensten Erscheinungsformen. Den eigenen zum Beispiel, über den man – laut meinem Großvater (der es wirklich wissen musste) – manchmal im Leben springen muss. Oder den eines anderen Menschen, in dem zum Beispiel ich, Mark Wiener, schon so oft zu stehen hatte. Noch dazu auf einem kürzeren Bein. Oder den Schatten der Vergangenheit, den Gott uns gelegentlich wie eine dunkle Gewitterwolke hinterherschickt (sofern er überhaupt etwas damit zu tun hat).
Wenn ich übrigens sage, dass ich an diesem Nachmittag gemeinsam mit meinen Freunden hier oben auf dem alten Wachturm saß, dann meine ich Tokio, Victor und Alex und noch jemanden, doch das kommt später. Nur so viel: Ich meine nicht Derik. Denn Derik war weg. Das Einzige, was er zurückgelassen hatte, waren zwei Eigentore und … sein Schatten. In den Erscheinungsformen „Ratlosigkeit“ und „Tränen“ (die in Tokios Augen).
Unten in der Lagune lag Ollie, unser alter Fischkutter, vor Anker und wartete darauf, nach Hause gebracht zu werden. Heim in unsere Soccer-Arena im Inneren von Barefoot-Island, der Felseninsel in der Nordsee, die wir die Barbolzburg nannten. Doch noch war es nicht so weit. Also saßen wir auch an diesem Abend auf unserem alten Turm, um den Sonnenuntergang zu genießen und uns wie einen Akku damit aufzuladen. Bis zum Anschlag, um am nächsten Morgen in Topform zu sein. Was besonders Tokio nötig hatte, die trotz ihres verstauchten Fußes unbedingt wieder mit von der Partie sein wollte. Denn der Cup von Barracuda war zwar gelaufen, aber das letzte Sandsoccer-Duell gegen die „Kakerlaken“ stand uns noch bevor …
Würde es nach dieser Zugabe schließlich einen echten Gewinner geben? Ich meine, neben dem Sieger? Gab es überhaupt einen Unterschied zwischen dem Siegen und dem Gewinnen?
Mit diesem philosophischen Exkurs im Kopf rutschte ich noch ein kleines Stückchen näher an Alex heran, schloss meine Augen und reiste in die Vergangenheit …
Bunte Hunde
Italien. Fast ein ganzes Jahr vorher. Regen prasselte schon seit Tagen auf die Plane des Trucks, in dem wir pennten. Ziel: Sandorn, Nordsee.
Bereits kurz nachdem wir unser angeschlagenes Schiff in der Bucht von Barfurore zurückgelassen und in die geschickten Hände des Fischers und Bootsbauers Sebastiano gegeben hatten, hatte es zu schütten begonnen. Schon in der Po-Ebene. Wir froren erbärmlich, als Deriks Vater, der den LKW steuerte, endlich die Verladestation der Bahnlinie nach Sandorn erreicht hatte.
Wir waren also in einem Lastwagen zurück an die Nordsee gekehrt statt mit unserem Schiff, und es war allein unsere Schuld gewesen. Denn wir hatten erst alle Warnungen in den Wind geschlagen und dann auch noch den letzten Befehl meines Großvaters: „Umkehren, bevor es zu spät ist!“, ignoriert. Jetzt wurde Ollie wohl gerade von Sebastiano und seinen Männern auf den Strand von Barfurore gezogen, um dort wiederbelebt zu werden. Seine alten Planken mussten sich einer Rundumkur unterziehen, der Rumpf musste abgedichtet und neu lackiert werden. Würde Barbados uns dennoch wieder auf der Barbolzburg aufnehmen? Also auch ohne Ollie?
Für diejenigen, die meine Memoiren, beginnend mit dem denkwürdigen Tag im Jahnstadion, noch nicht gelesen haben: Barbados ist der Deckname für ein Dreigespann: für Ed (meinen Großvater), Mbeki (wandelnde Suchmaschine) und Julé (seine Frau und kugelrunde Köchin). Barbados – also die genannten drei – hält die Stellung auf unserer Burg und in unserer Zentrale, einem alten Leuchtturm, der hoch über der Barbolzburg in den Himmel ragt auf unserer Felseninsel nordwestlich von Sandorn, versteckt im Nebel der Nordsee: Barefoot-Island.
Endlich rumpelte der Truck durch die Dünen Sandorns und kam fauchend und quietschend mitten auf dem Parkplatz hinter der Barbar-Bar zum Stehen. Aber der Lastwagen war hier nicht das einzige geparkte Fahrzeug. Ich meine nicht die Luxuskisten der Neureichen, die den Platz im Sommer verstopften, ich meine die Lieferwägen, Aufnahme- und Sendewägen der TV-Teams.
„Was is’n hier los?“, fragte Derik, der als Erster von der Rampe sprang.
Wir folgten ihm fröstelnd, einer nach dem anderen. Wir hatten ja keine Ahnung, dass wir selbst diejenigen waren, deren Ankunft hier erwartet wurde. Nur eben nicht in einem Lastwagen und auch nicht durch den Besuchereingang, sondern auf der großen Bühne der Nordsee und mit wehender Knochenfuß-Flagge über unserem Fischkutter. Deshalb machten wir uns völlig ahnungslos auf den Weg hinüber zur Bar, gefolgt von Deriks Vater und Pizzo, dem Affen, der auf heimatlichem Boden Freudenpurzelbäume schlug.
Auf der Veranda des Holzgebäudes drängten sich Kameraleute, Kabelträger, Techniker, Maskenbildner und Moderatoren unter einer Armee von flatternden und zerzausten Regenschirmen, unter denen der Seewind den Regen hindurchtrieb. Sie spähten aus ihren Kapuzen hinaus über die aufgeworfene See, als würden sie dort den Auftritt des fliegenden Holländers erwarten. Keiner bemerkte die Bar-Bolz-Bande, die im Rücken der Meute in die Bar schlüpfte, um so schnell wie möglich Barbara und Miko, Tokios Mutter, aufzusuchen. Beide standen gerade hinter dem Tresen und polierten Gläser. Daneben Sven Silver, der seinen Kiefer am weitesten aufklappte, als er uns erkannte.
„Aber …“, begrüßte er uns. Mehr kam nicht raus. Die Bar-Bolz-Bande, Sven, Barbara und Miko standen sich gegenüber, wie Kolumbus den ersten halbnackten Indianern gegenübergestanden haben musste. „Aber …“, wiederholte Sven und zeigte mit einem Putztuch in der Hand nach draußen, wo der Großteil der Journalisten im Wind schlotterte, während sich ein paar wenige hier drinnen an den Tischen der Bar eine Aufwärmpause gönnten und heißen Tee mit Rum schlürften.
Doch er wurde von Tokios Mutter unterbrochen, die plötzlich begriffen hatte, dass ihre Tochter tatsächlich und leibhaftig vor ihr stand. Mit freudestrahlenden Mandelaugen wieselte sie hinter dem Tresen hervor, um ihre Tochter in die Arme zu nehmen.
„Yo-Shi!“
„Mama!“
„Yo-Shi! Und da sind ja auch Mark und Derik!“
„Ja, wir sind’s!“, antwortete Yo-shi, also ich meine: Tokio. „Und das sind Alex und Victor“, ergänzte sie, „die ganze Bar-Bolz-Bande steht vor euch. Alle fünf!“
„Das ist ja eine Überra…“, rief jetzt auch Barbara, aber sie kam nicht weiter, denn in diesem Moment wachten die Presseleute an den Tischen auf.
„Die Bar-Bolz-Bande?“, fragten sie hellhörig geworden. Und noch während sie aufsprangen, um uns einzukreisen, hatten sie auch schon einen Boten nach draußen geschickt. „He, die Bar-Bolz-Bande kommt nicht mehr! Die ist schon längst da, und zwar hier drinnen!“, hörten wir ihn in den Wind über dem Terrassendeck brüllen.
Damit brach ein Tumult aus, den ich mit Worten nicht beschreiben kann. Jedenfalls drängten sich jetzt alle gleichzeitig in die Bar und stürzten sich mit ihren Fragen auf uns, als wären sie ausgehungerte Raubkatzen im Kolosseum von Rom. Sie bedrängten uns mit Mikrofonen und blendeten uns mit ihren Blitzlichtern.
Als sie dann erst nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einer nach dem anderen von uns abließen, war es dunkel geworden. Nur ein Haufen umgestürzter Stühle und Tische, eine erschöpfte Bar-Bolz-Bande, ein Pizzo, der sich unter den Tresen gerettet hatte, und – im dunkelsten Eck des Raumes – Deriks Vater blieben zurück. Währenddessen klingelte in unseren Ohren noch die Endlosschleife der offenbar wichtigsten Frage nach: „Wo ist das berühmte Schiff der Bar-Bolz-Bande?“
Inzwischen hatte sich Barbara wieder aus der Küche gewagt, um uns endlich zu begrüßen. Alex und Victor wurden vorgestellt und auch Schulze, Deriks Vater. Außerdem wurde ein Bericht der Ereignisse in Kurzfassung abgegeben. Dann endlich konnten wir die Fragen stellen, die uns auf den Nägeln brannten. Erstens: Weshalb interessiert sich plötzlich die ganze Welt für uns? Und zweitens: Wie kommen wir so schnell wie möglich rüber auf unsere Burg?
Wir wollten nur noch heim auf unsere Felseninsel, wollten in unsere komfortablen Höhlenzimmer, unter die heißen Quellen, die dort aus dem Stein sprudelten, und in Julés bunte Strandbude, wo es den Sound von Ziggy Marley, die köstlichsten Fruchtcocktails des Universums und Julés Toast Hawai „All-you-can-eat“ gab.
„Zu eurer ersten Frage“, antwortete die Wirtin, „euer Neuzugang Alex ist, wie ihr wisst, die Tochter eines ziemlich gesprächigen Prominenten: Antonio Lucca, der sich seit letzter Woche damit brüstet, die beste Sandsoccer-Mannschaft der Welt entdeckt zu haben, euch, die Bar-Bolz-Bande. Seitdem seid ihr bekannt wie bunte Hunde. Und meine Barbar-Bar ebenso. Und unser Sandorn sowieso. Man hat eure gesamte Reise recherchiert, oder besser gesagt, neu erfunden. Glaubt man dem ganzen Klatsch, zieht ihr von einem glorreichen Sieg zum nächsten. Wo immer die Knochenfuß-Flagge am Horizont auftaucht, bricht Panik am Strand aus. Fluchtartig verlassen die Soccer-Teams das Gelände, nur die mutigsten stellen sich euch in den Weg. Ihr seid Sandsoccer-Stars!“
„Quatsch!“, sagte ich. „Außerdem ist Alex nicht mal die wirkliche Tochter von diesem Toni Lucca.“
Alex kochte. Nicht, weil ich das mit ihrem Vater klargestellt hatte, sondern wegen Lucca. So richtig. Tokio und Victor schüttelten sprachlos ihre Köpfe. Nur Derik schien das ganze Tamtam um uns und die Strandbar nicht zu beeindrucken.
„Was eure zweite Frage betrifft“, fuhr Barbara fort, während Pizzo auf ihren Schultern balancierte und Kuckuck mit ihr zu spielen versuchte, „da habe ich keine sehr guten Nachrichten: Ed hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet.“ Sie machte eine Pause, bevor sie fortfuhr: „Wir wissen nicht einmal mehr, ob er, Mbeki und Julé noch drüben auf der Insel sind. Kein Kontakt, kein Licht, nicht einmal Rauchzeichen aus seiner Pfeife. Es ist, als wären sie …“, Pizzo hatte es endlich geschafft, ihr die Augen zuzuhalten, „… unsichtbar!“
Barbara zog den Affen vorsichtig von ihren Schultern und setzte ihn dem verdutzten Schulze in die Arme. Dann ergänzte sie: „Unglücklicherweise können wir erst dann jemanden rüberschicken, um nach dem Rechten zu sehen, wenn der letzte Reporter verschwunden ist. Wir würden sonst riskieren, dass das Geheimnis der Barbolzburg die längste Zeit geheim gewesen wäre.“
„Wir übernehmen das!“, sagte Derik. „Brauchen nur ’n Boot, dann stehlen wir uns noch heute Nacht rüber.“
Barbara rieb sich das Kinn und legte die Stirn in ziemlich ernsthafte Falten. Nach einer Weile sagte sie dann: „Im Schutz der Nacht könnte es gehen. Aber nicht bei diesem Wetter. Ihr müsst abwarten, bis sich die See beruhigt hat.“
Geier über der Barbolzburg
Am nächsten Tag waren die Titelblätter dann vollgepackt mit der Bar-Bolz-Bande. Jedenfalls die der Klatschblätter: „YACHT DER BAR-BOLZ-BANDE GESUNKEN!“ Dazu ein falsches Foto unseres angeblichen Schiffes: ein Bild der Soccer Queen. Oder: „VERSCHOLLENE BAR-BOLZ-BANDE VON TAUBSTUMMEM KRAFTFAHRER GERETTET!“ Schulze hatte sich nämlich taubstumm gestellt.
Wir dagegen versuchten, uns unsichtbar zu machen und den lästigen Reportern auf dem Terrassendeck der Strandbar aus dem Weg zu gehen, während das Wetter sich langsam beruhigte. Aber wir mussten noch Geduld haben. Außerdem wollten wir der Presse ja noch eine Weile vorgaukeln, dass die Strandbar in den Dünen Sandorns unser wahrer und einziger Rückzugshafen war, die angebliche Heimat der Bar-Bolz-Bande. Niemand sollte von unserem echten Versteck erfahren, das draußen am Horizont in den tiefhängenden Regenwolken verborgen lag: die Barbolzburg auf Barefoot-Island.
Wenigstens hatten Derik und sein Vater etwas davon, dass wir hier noch eine Weile festsaßen. Schulze musste zwar irgendwann in seinem Truck weiterreisen, aber er blieb immerhin so lange, bis er sich mit Derik über ihre verkorkste Vater-Sohn-Beziehung ausgesprochen hatte. Jedenfalls nahm ich an, dass die beiden das taten, während sie draußen in den Dünen wanderten und redeten. Stundenlang. Schulze hat nämlich mal auf einer Ölplattform gearbeitet und war wegen seinem Rücken frühpensioniert worden. Hat dann zu trinken angefangen. Bier und Schnaps waren seine „Medizin“, während er sich und seinen Sohn in einer muffigen Wohnung hoch über dem Jahnstadion einsperrte. Derik hat er nur zur Schule und für „eilige Arzneimittel“ an die frische Luft gelassen. Oder wenn er pennte. Wenn Derik dann aber bei einer seiner kleinen Fluchten erwischt wurde, setzte es was. Und das waren nicht nur ein paar Kopfnüsse.
Bis Derik dem Ganzen dann mit seiner – also unserer – großen Flucht nach Sandorn ein Ende gemacht hatte.
Nachdem Schulze schließlich abgereist war, wandte sich Derik prompt den noch verbliebenen Klatschreportern zu. Er gab Interviews und ließ sich fotografieren. Mit unserem Ball auf dem Strand oder in Seefahrer-Position auf dem Sonnendeck der Bar. Hätte ich damals geahnt, was in diesen Tagen mit Derik passierte, hätte ich vielleicht noch was dagegen unternehmen können. Während Derik nämlich für die Fotografen posierte und dabei manchmal auch noch Tokio wie eine Deko-Puppe an seine Seite zog, entfernte er sich in Wirklichkeit von ihr. Und von uns. Aber Derik schnallte gar nichts. Und ich auch nicht, noch nicht. Ganz im Gegensatz zu Tokio, die mich eines Tages zur Seite nahm.
„Mark, hör mir bitte mal zu“, flüsterte sie, obwohl sie mich abhörsicher auf ihre weitentfernte Lieblingsdüne gezogen hatte. „Derik verändert sich! Seit er mit seinem Vater gesprochen hat und die ganzen Pressefritzen um ihn herumkreisen. Ich weiß nicht, wie ich’s sagen soll, aber er ist … irgendwie weit weg.“
Aber ich winkte ab: „Ach was, der fängt sich schon wieder. Ist typisch Derik. Ist halt besonders stolz auf die Bar-Bolz-Bande. Ich gönn’s ihm. Er ist halt ’n halber Brasilianer.“
„Und wenn nicht?“
„Wieso? Er ist ganz sicher ’n halber Brasilianer.“
Ich stand wirklich auf dem Schlauch.
„Mark!“, schimpfte Tokio lauter, als es sonst ihre Art war. „Ich meine: Was ist, wenn sich Derik nicht wieder fängt?“
„Ach so. Also, ich bin sicher, dass er sich wieder einkriegt. Spätestens, wenn der letzte Pressefuzzi verduftet ist. Ich kenn ihn.“
Dachte ich.
Tokio schwieg. Aber dann, nach einer Weile, wechselte sie plötzlich das Thema. „Mark, ich hab von Nash geträumt. Erinnerst du dich an ihn?“
„Natürlich! Sag bloß, du hast geträumt, wo er ist?“
„Ja, so ungefähr.“
„Und, wo isser?“
„Er ist hier.“
„Das war nur ’n Traum, oder?“
„Nein, Mark, das war mehr. Ich spüre, dass er in der Nähe ist. Ist ziemlich gruselig. Außerdem …“ Sie zögerte.
„Was?“, hakte ich nach.
„Außerdem hab ich von Ed geträumt.“
„Und?“
„Er ist in Gefahr!“
„Willst du damit sagen, dass Nash in der Nähe ist und vielleicht auch noch meinen Großvater in Gefahr bringt? Das ist doch Unsinn. Nash ist der harmloseste …“
„Mark, wir müssen so schnell wie möglich rüber zur Barbolzburg!“
Tatsächlich gab es immer noch kein Lebenszeichen von Ed, Mbeki und Julé, obwohl sie wissen mussten, dass wir heimgekehrt waren. Dank dem alten Spionagesatelliten wussten sie fast immer, wo wir waren. Mir wurde angst und bange. Weshalb war nicht einmal ein kleines, windiges Licht drüben auf der Felseninsel am Horizont zu erkennen? Außerdem waren ihre Telefone tot. Selbst auf die E-Mails, die Barbara rüberschickte, war keine Antwort gekommen. Tokio hatte recht: Wir mussten sofort etwas unternehmen!
Und gegen Mitternacht war es dann so weit: Obwohl die See noch ziemlich kabbelig war, wartete ein Boot in den Wellen unterhalb der Düne, auf der die Bar thronte. Die Wirtin hatte den alten Fischer Westerwelle überredet, uns trotz des Seeganges in den frühen Morgenstunden des kommenden Tages überzusetzen. Immerhin hatte sich der Sturm verzogen, sodass unsere Insel wieder von dem schützenden Nebelring umhüllt war, den die Bewohner Sandorns den „ewigen Nebel“ nannten.
Es konnte losgehen.
Um ganz sicherzugehen, dass uns niemand beobachtete, steuerte Westerwelle zunächst in einem weiten Bogen nach Süden, um unsere Felseninsel zu umrunden und erst auf ihrer Rückseite in den Nebelring einzudringen.
Im Morgengrauen durchbrachen wir den Nebel. Nicht nur unsere beiden Neuen, Alex und Victor, hockten in jenem ergreifenden Moment mit offenem Mund im Bug des Motorbootes. Auch mir lief es warm und kalt zugleich den Rücken herunter, als unsere Insel direkt vor uns aus der See wuchs: stolz und mächtig, von der weißen Gischt über der tosenden Brandung umspült. Die Sonne schoss ihre ersten Strahlen durch die Wolken, und alles schien beim Alten zu sein. Ich stellte mir vor, wie wir in wenigen Stunden endlich wieder unsere nackten Füße durch den warmen Sand unserer Arena im Inneren des felsigen Kraters ziehen würden. Hatte bereits unsere Hängematten vor Augen, die vor den Wohnhöhlen baumelten, auf die wir für so lange Zeit hatten verzichten müssen und in die wir uns schon heute Abend plumpsen lassen würden, diesmal gemeinsam mit Alex und Victor. Bereit für das Wintertraining und für die große Überfahrt im nächsten Sommer. Nach Brasilien! Bis dahin würde unser alter Fischkutter in Italien rundum erneuert und von Sebastiano und Paola, Alex’ wahren Eltern, nach Hause gesegelt worden sein: nach Barefoot-Island.
Doch jetzt mussten wir erst einmal Ed, Mbeki und Julé zurückgewinnen, mussten ihnen erklären, warum wir damals unser Schiff bis an seine Grenzen getrieben hatten, um Alex zu befreien. Sie würden es verstehen. Das hoffte ich wenigstens, als wir hoch zum Leuchtturm blickten … und erschraken.
Denn die Flagge der Bar-Bolz-Bande war verschwunden.
Stattdessen wehte dort ein vergleichsweise mickriger Wimpel. Ein Fetzen in den Farben des „British Empires“, das sich eigentlich schon vor sehr langer Zeit aufgelöst hatte.
Westerwelle steuerte das Motorboot um die letzte Felsnase herum, hinter der sich ein mächtiges Steinmaul öffnete: der Eingang zur großen Grotte, dem Hafen der Barbolzburg. Und dort traf uns dann auch schon der nächste Schlag wie eine eiskalte Welle mitten ins Gesicht: Das Tor zu unserer Arena war versperrt. Eine mächtige eiserne Kette, die ein ganzes Kriegsschiff hätte aufhalten können, schwang quer über der Einfahrt. Daran ein rostiges Schild: „Military Area. NO ENTRY!“
Erst jetzt bemerkten wir, dass es nicht die vertrauten Möwen waren, die über der Felseninsel kreisten, auch keine Sterntaucher oder Seeschwalben. Es waren Krähen. Schwarze, widerlich krächzende Krähen, die ihre Kreise über unserem Zuhause zogen, als wären sie Geier über einem Schlachtfeld.
Der Geist aus der Vergangenheit
Die Insel ist überfallen worden!, kippte ein Lastwagen auf meine schon seit Tagen arbeitende Gedankenbaustelle, während ein Kran bereits die nächste Eingebung fallen ließ, die sich donnernd in mein Bewusstsein bohrte: Wer immer sie sind, sie dürfen uns nicht sehen!
„In Deckung!“, befahl ich, ohne das eigentliche Kommando an Bord zu haben. Doch Derik hatte die Situation genauso schnell erfasst wie ich, denn er hatte den Steuermann bereits vom Hocker gestoßen.
„He!“, mehr konnte Westerwelle nicht mehr zum Geschehen beitragen.
Derik riss das Ruder herum und presste den Gashebel nach vorne. Das Aufheulen des Außenborders übertönte sogar das Tosen der Brandung, während das kleine Motorboot mit dem Heck eintauchte, den Bug aus den Wellen hob und sich nach vorne katapultierte. Haargenau auf die scharfkantigen Felsen zu.
„Beim Klabautermann!“, rief Westerwelle, nachdem er rücklings im Heck gelandet war.
Pizzo quiekte wie ein Schwein auf der Flucht und entwischte in die kleine Koje unter der Bugnase des Motorbootes, dessen viel zu nachlässig befestigter Anker schwer hin und her schlug, während der Glasfaserrumpf auf die Wogen donnerte, die sich ihm entgegenschlugen. Alex bohrte ihre Fingernägel in meinen Oberarm, und sogar Victor verlor seine jamaikanische Gelassenheit: „Scheiße!“
Derik steuerte mit Vollgas auf die Klippen zu.
„D… der bringt uns um!“, rief Westerwelle, bevor wir in die dunkelgraue Felswand hineinzoomten, als befänden wir uns im Inneren eines mächtigen Teleobjektivs, das auf das Ende unseres Daseins ausgerichtet war. Der Himmel, die Wolken und die Krähen verschwanden aus dem Bildausschnitt, bis nur noch die grauschwarze Wand vor uns lag. Der Aufprall stand unmittelbar bevor. Westerwelle bekreuzigte sich. Zwischen mir und dem Ende befanden sich nur noch Deriks Rücken und die Bugnase des Motorbootes, die sich in immer kürzerem Rhythmus in die letzte felsengraue Momentaufnahme meines Lebens hob. In meinem Oberarm Alex’ Fingernägel, aus der Koje Pizzos Quietschen, Victors Witze verpufften, und Tokios Glitzermähne war nur noch ein nasser und farbloser Schleier, der in ihrem Gesicht klebte.
Aber meine Reflexe lebten noch. Auch wenn das Adrenalin vermutlich viel zu spät in meinen Kreislauf geschossen war, sie zündeten: Ich riss mich aus Alex’ Griff und stürzte mich auf Derik, der uns alle scheinbar ins Verderben reißen wollte. Doch ich landete im Aus. Denn Derik war alles andere als wahnsinnig geworden. Er hatte just im selben Moment (und zwar im allerletzten) „Festhalten!“ gebrüllt, seinen Oberkörper nach Backbord geschmissen und das Ruder herumgerissen. Mikrosekundenkurz vor dem erwarteten Crash.
Das Motorboot röhrte auf und bretterte um Haaresbreite an den messerscharfen Felszähnen vorbei, die die Insel beschützten wie die gebleckten Zähne eines an die Kette gelegten Raubtieres. Dann, nachdem Derik den Rumpf plötzlich wieder in die Gerade geschwenkt hatte, jagten wir, keine Handbreit von den Klippen entfernt, unter mächtigen Überhängen hindurch und wie ein Torpedo durch die weißkalte Gischt der Brandung. Unsichtbar für jeden, der den Rand und die Kuppen des Kraters, der unsere Soccer-Arena einschloss, besetzt hatte. Derik hatte uns in einer halsbrecherischen Blitzaktion in den toten Winkel unter der Insel katapultiert!
Aber die Achterbahnfahrt war noch nicht zu Ende. Sie ging nur in eine weitere Runde, denn noch konnten wir vom obersten Geschoss des Leuchtturms aus gesehen werden.
„In die Surfbucht!“, brüllte ich. Aber Derik musste sich hundert Prozent darauf konzentrieren, dass wir nicht von einem der Brecher in die Felsen gedrückt wurden. „Tokio!“, rief ich. „Wir müssen die Einfahrt finden!“
Wir starrten auf die vorausliegenden Felsnasen, scannten sie ab und suchten irgendeinen Anhaltspunkt, der uns die Lage der sicheren Surfbucht verraten würde. Wir mussten die Lücke rechtzeitig entdecken, rechtzeitig genug, um nicht daran vorbeizuschießen, damit Derik das Motorboot fullspeed und in einem weiteren Drift einfädeln konnte.
„Da!“, rief Tokio und zeigte mit ausgestrecktem Arm auf mehrere große Steinbrocken, die das Meer für Sekundenbruchteile freigegeben hatte.
Ich hatte nichts gesehen, auch Derik schüttelte den Kopf. „Nein, das ist sie nicht!“, rief er über die Schulter.
„Doch!“, brüllte die Japanerin aus Leibeskräften. „Dahinter ist die Bucht!“
Wir schossen an Tokios vermuteter Felsenlücke vorbei.
„Jetzt!“, kreischte Tokio.
„Nein!“, rief Derik abermals.
Doch Tokio warf sich ins Ruder. Sie riss das nasse Aluminium aus Deriks Griff und drückte es nach Steuerbord.
Im selben Moment warf sich der weiße Bootsrumpf in eine Kurve, aus der er eigentlich nur wieder herausfliegen konnte. Aber die Japanerin schien alles unter Kontrolle zu haben, während wir herumgeschleudert wurden wie die Würfel in einem Würfelbecher.
Danach donnerten wir erneut auf die Felsen zu …
Ich schloss die Augen, zog den Kopf ein und erwartete ein weiteres Mal den Aufschlag. Doch der blieb aus. Also gab ich meiner Sehkraft wieder freie Bahn, gerade noch rechtzeitig, um mich festkrallen und auf ein einmaliges Erlebnis vorbereiten zu können: im Motorboot über einen Strand zu schlittern. Genau auf ein paar alte Boards zu, die am Ende dieser sandigen Sackgasse am Fels lehnten und dort ihren Dornröschenschlaf hielten.
Ein dumpfer Schlag, eine Besatzung, die ins Cockpit gewürfelt wurde, dann pflügte das Motorboot über den Untergrund und grub sich immer tiefer in den Sand ein, statt zum Stehen zu kommen. Mittlerweile lagen wir kreuz und quer im vordersten Teil des kleinen Decks, teilweise sogar bei Pizzo in der engen Kajüte. Einzig Tokio stand noch immer aufrecht und stützte sich mit ausgestreckten Armen auf das Aluminiumrad des Ruders. Dann endlich verlangsamte das Motorboot seine Fahrt über den Sand. Zu spät, denn die Surfboards und die Felsen, an der die Dinger lehnten, rückten noch immer viel zu schnell näher.
Doch plötzlich parkten wir. Das Boot war zum Stehen gekommen. Stillstand ziemlich genau zwei Fingerbreit vor dem grauen Fels. Ich fühlte mich wie Redbull persönlich. Hundert Prozent Koffein im Blut und kurz vor dem Herzstillstand.
Es dauerte ein paar Minuten, bis Tokio, Derik und ich dazu im Stande waren, sowohl unserer Schockstarre als auch dem Motorboot zu entkommen. Auch Alex’ und Victors Gesichter bekamen langsam wieder ihre normale Farbe. Westerwelle dagegen sah weiterhin so aus wie die Leiche aus einer Expedition zum Nordpol: blutleer in tiefgefrorenen Klamotten. Also packten wir ihn in ein paar Decken, die wir in einem seiner Schapps gefunden hatten, versorgten ihn mit dem Flachmann, den wir aus seiner Gesäßtasche gezogen hatten, und hockten uns schließlich in den Sand, um zu beraten.
„Lasst uns erst mal die Lage checken“, schlug ich vor. „Erstens: Die Insel ist in feindliche Hände gefallen. Davon können wir jedenfalls ausgehen. Zweitens: Hier in der Surfbucht können wir nicht entdeckt werden. Drittens: Was ist mit Ed, Mbeki und Julé geschehen? Sind sie Geiseln? Ist ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben bedroht? Wir müssen das wissen, bevor wir was unternehmen! Und schließlich viertens: Wer hat die Insel im Griff und weshalb?“
„Mehr Fragen als Fakten“, sagte Derik.