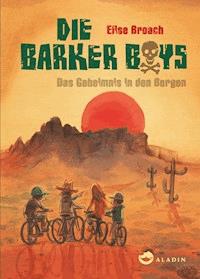
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aladin Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Brüder Simon, Henry und Jack erkunden ihre neue Umgebung in der Wüste Arizonas. Obwohl ihnen ein Ausflug in die Berge strengstens verboten ist, können sie der Versuchung nicht widerstehen. Sie ahnen nicht, dass hier das Abenteuer ihres Lebens auf sie wartet: Inmitten der einsamen Bergwelt entdecken sie drei Totenschädel. Der gruselige Fund lässt die Barker Boys nicht mehr los. Zusammen mit dem Nachbarsmädchen Delilah versuchen sie mehr herauszufinden und stoßen dabei auf einige mysteriöse Vorkommnisse. Die vier sind fest entschlossen, das Geheimnis der drei Verschollenen zu lüften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.www.aladin-verlag.de Alle deutschen Rechte bei Aladin Verlag GmbH, Hamburg 2013 Originalcopyright © Elise Broach Originalverlag: Henry Holt and Company, LLC, New York Originaltitel: Missing on Superstition Mountain Umschlagbild & Illustrationen: Constanze Spengler Aus dem Englischen von Frank Böhmert Umschlagtypografie: Karin Kröll Lektorat: Svenja Drewes Herstellung: Karin Kröll, Hamburg Lithografie: Margit Dittes Media, Hamburg E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-8489-6003-3
Für meine Neffen Nate und Jebbie Bauer
KAPITEL 1
Josie läuft weg
Alles fing damit an, dass Josie weglief – die Knochen im Canyon, der Berg, auf dem es spukte, der vergrabene Schatz, die Stadt voller Geheimnisse –, aber das wussten die Barker-Jungs da noch nicht. Sie wussten nur, dass Josie weg war, wieder mal, und dass sie sie finden mussten. Was schwierig werden würde, hier an diesem fremden Ort mitten in der Wüste. Aber wie schwierig, das ahnten sie nicht, und auch nicht, was sie auf ihrer Suche noch finden würden.
Die Barkers waren gerade erst nach Arizona gezogen, in ein altes, holzverkleidetes Haus in Superstition, einer Stadt im Schatten eines gewaltigen Felsenberges namens Superstition Mountain. Bis jetzt gefiel es den Jungen hier nicht besonders. Das Haus selber war okay. Es hatte ihrem Großonkel gehört, Hank Cormody oder ›der verrückte Onkel Hank‹, wie Mr Barker ihn nannte. Onkel Hank war einmal Cowboy, Spieler und Kundschafter für die Kavallerie gewesen, und als er im reifen Alter von 68 Jahren starb, hatte er Mr Barker das Haus zu dessen Verblüffung vererbt. Der Zeitpunkt für einen Umzug war günstig. Mr Barkers Maurergeschäft in Chicago lief immer schleppender – was die Ursache für viele sorgenvolle, leise spätabendliche Gespräche zwischen Mr und Mrs Barker war, wenn sie glaubten, dass die Jungen nicht lauschten. Da Mrs Barker ihr Geld mit medizinischen Illustrationen verdiente und ihre Abbildungen von arthritischen Hüften und kranken Nieren überall zeichnen konnte, war man rasch zu dem Schluss gekommen, dass ein kostenloses Haus in einer billigen Gegend genau das war, was die Barkers brauchten.
Und es stimmte ja auch. Hier hatte jeder Junge ein eigenes Zimmer und außerdem verfügte das Haus über einen großen ausgebauten Keller, dessen eine Seite mit Onkel Hanks Besitztümern vollgestellt war (zugeklebte Kartons und muffige Möbel, die ihre Mutter von oben verbannt hatte). An der Wand hing eine Dartscheibe, was eine nette Überraschung war, weil ihre Mutter garantiert strikt dagegen gewesen wäre, eine zu kaufen, aber wo dort nun schon eine hing, komplett mit einer Handvoll Pfeilen in der Mitte, konnte sie ja schlecht nein sagen. Und was noch gut war, Onkel Hanks Garten grenzte nicht an einen anderen Garten und auch nicht an eine Straße oder Auffahrt wie andere Gärten. Er lief in ein weites, welliges Nichts aus Hügeln und Feldern aus. Die Jungen fanden das toll – das Gefühl, dass das Grundstück immer weiterging und ein Baseball, den man über die struppige Grenze aus Bäumen und Büschen schlug, leicht für immer weiterfliegen konnte.
Aber … tja, ›Abers‹ gab es jede Menge. Das Haus war weit weg von ihren Freunden in Chicago. Es war weit weg von dem Park, wo sie Baseball spielten. Es war weit weg von dem Hügel, wo sie im Winter Schlitten fuhren und sich Schneeballschlachten lieferten. Überhaupt wurde es in Arizona nie Winter! Was war das denn bitte schön für eine Gegend, in der es nicht schneite? Und das Allerschlimmste war, dass ihr neues Haus in dieser seltsamen Stadt lag, die voller seltsamer Leute war und wo niemand auch nur ein bisschen so schaute oder redete oder sich benahm wie die Leute zu Hause.
»Das kommt euch nur so vor, weil ihr noch niemanden kennt«, sagte ihr Vater. Aber sogar ihre Mutter, die einen mit ihrer ewigen positiven Einstellung richtig nerven konnte, musste zugeben, dass das Städtchen Superstition – ›Aberglaube‹ – seinem Namen gerecht wurde. Als der mittlere der Brüder, Henry, sagte: »Die Leute hier sind zwielichtig«, da lachte sie, weil Henry sie mit seinen ausgefallenen Wörtern immer zum Lachen brachte, aber nach einem Moment nickte sie und sagte: »Weißt du, das ist ein sehr gutes Wort dafür.«
Die Barkers hatten drei Söhne. Simon, der älteste, war elf. Er hatte hochgestellte braune Haare und eine neugierige, wissenschaftliche Art, die zu vielen interessanten Ideen und Experimenten führte. Aber er konnte ein total nerviger Schlaumeier sein und gierig war er manchmal auch. Jack, der jüngste, war sechs. Er war definitiv der mutigste, nicht bloß bei Kleinigkeiten wie Spinnen, sondern auch, wenn es darum ging, mit dem Fahrrad Unfälle zu bauen oder irgendwo runterzuspringen. Aber Jack war auch aufbrausend und prügelte sich eher, als dass er Sachen friedlich regelte.
Henry, der mittlere, war zehn, ein Jahr jünger als Simon und ganze vier Jahre älter als Jack. Aber weil Henry klein und schmal war und Jack groß und kräftig, nahmen die Leute immer an, dass Henry und Jack ungefähr gleich alt waren. Das fand Henry ganz schön peinlich … fast genauso schlimm wie damals mit fünf, als ihn alle wegen seiner langen, lockigen Haare für ein Mädchen gehalten hatten. Henry war eine Leseratte und benutzte gern die ausgefallenen Wörter, die er in den Büchern fand, wobei er sie nicht immer richtig verwendete. Und Henry kam zwar mit fast allen Leuten gut aus, aber einen besten Freund hatte er noch nie. (Mrs Barker sagte: »Ach, Henry … schau dir deinen Vater an! Er ist einundvierzig und hat IMMER NOCH keinen besten Freund.« Irgendwie war das auch kein Trost.)
Eine letzte Sache noch über Henry: Er hieß nach Onkel Hank, der eigentlich Henry Cormody geheißen hatte, aber wie aus dem Namen Henry ein Hank geworden war, das war den Jungen ein Rätsel (und folgte zweifelsohne derselben verdrehten Logik, durch die Sarah zu Sally wurde oder Margaret zu Peggy). Mr Barker hatte Onkel Henry als Junge vergöttert, er hatte seine seltenen Besuche sehnlichst erwartet und eifrig jede Erzählung seiner Abenteuer in sich aufgesogen und viele Jahre später hatte er stolz seinen mittleren Sohn nach ihm benannt. Selbst zu Henrys besten Zeiten lastete dieses Erbe schwer auf seinen Schultern. Sein Großonkel war ein Draufgänger gewesen. Er hatte Rinder mit dem Lasso gefangen, sein Geld in schummerigen Saloons verspielt, mit Fäusten und Pistolen gegen Banditen gekämpft und für das Militär auf seinem großen gefleckten Appaloosa-Pferd die rauesten und entlegensten Winkel des Westens ausgekundschaftet. Henry dagegen war nicht nur klein und wurde gelegentlich für ein Mädchen gehalten, sondern war auch alles andere als ein Draufgänger. Weshalb er fand, dass er besser einen gewöhnlicheren Namen hätte haben sollen, wie John oder David.
Und dann gehörte zu den Barkers noch Josie. War sie die Schwester der Jungen? Nein. Ihr Kindermädchen? Das erst recht nicht! Im Gegenteil, Henry dachte oft, wenn man Josie einmal mit Nana verglich, dem Kindermädchen-Hund in dem Buch Peter Pan, dann war schnell klar, dass man die beiden überhaupt nicht miteinander vergleichen konnte. Josie war die Katze der Barkers und sie hatte wenig Interesse daran, sich um irgendjemanden zu kümmern, schon gar nicht um die Jungen. Sie war schon sehr lange bei Mr und Mrs Barker und sie fand es anscheinend schon schlimm genug, dass die Jungen überhaupt existierten.
Josie war praktisch völlig schwarz, bis auf einen weißen Fleck am Hals, der die Form von Florida hatte. Sie mochte es nicht, gedrückt oder hochgehoben zu werden (was Jack nicht daran hinderte, sie zu drücken und hochzuheben). Henry sagte gern, dass sie fingerfertig war, was bedeutete, dass sie Türen öffnen und Sachen mit ihren Pfoten greifen konnte. Vor allem aber konnte sie gut springen und klettern.
An dem Tag, als Josie weglief, saßen die Jungen nach dem Mittagessen auf der Holzterrasse hinter dem Haus, starrten missmutig auf das steinige Stück Garten hinunter und überlegten fieberhaft, was sie unternehmen konnten. Superstition hatte nicht viel zu bieten. Im Zentrum gab es eine Bücherei, einen Lebensmittelladen, eine Tankstelle, ein Café, ein Rathaus mit angeschlossener Polizei und Feuerwehr, ein Postamt und die Coronado-Grundschule, die bis zur achten Klasse ging. Zwei Firmen kamen noch hinzu – eine Autowerkstatt und Mr Barkers Maurergeschäft. Aber das war es dann. Um die Hauptstraße herum erstreckten sich gitterförmig angeordnete Häuserreihen, und um diese herum? Nichts als leere Wüste. Selbst die Highschool war meilenweit weg, in einer Stadt namens Terra Calde.
Es war die erste Woche der Sommerferien und anscheinend war die halbe Nachbarschaft der Barkers verreist. Was aber keine große Rolle spielte, fand Henry, denn sie hatten sich ohnehin noch mit niemandem angefreundet. Hier in Arizona waren sie auf sich allein gestellt.
»Wir könnten Karten spielen«, schlug Henry vor.
»Zu langweilig«, fand Simon.
»Wir könnten Frisbee spielen«, sagte Jack.
»Zu windig«, fand Simon.
»Wir könnten Dad besuchen«, sagte Henry.
Simon schüttelte den Kopf. »Schon vergessen, was letztes Mal passiert ist?«
Mr Barker zog unter anderem Mauern hoch und legte Terrassen und Gehwege an. Für die größeren Aufträge musste er meistens nach Phoenix, aber ab und zu hatte er auch in Superstition und den Nachbarorten zu tun. Die Jungen besuchten ihn gern während der Arbeit, vor allem wenn er Hilfe mit dem Zement brauchte. Aber letztes Mal hatte das nicht so gut geklappt … der Abdruck von Jacks Turnschuh war immer noch auf dem Gehweg sichtbar.
Sie saßen da und überlegten weiter.
»Ich weiß was«, verkündete Simon. »Wir spielen mexikanisches Gefängnis. Jack, du kriechst unter die Terrasse. Henry und ich sind die Wachen …« Während er es noch genauer erklärte, fuhr Josie, die friedlich in der warmen Sonne gelegen hatte, plötzlich auf und sauste hinunter in den Garten, schnurstracks auf die struppigen Bäume zu, hinten denen der Superstition Mountain aufragte.
»Wo will sie denn hin?«, rief Jack. »Josie!« Er sprang auf und lief ihr nach.
Henry sah zum Haus zurück. Eigentlich durften sie den Garten nicht verlassen. Und auf den Berg durften sie schon gar nicht. Ihre Eltern kannten keinen Spaß, was den Berg betraf.
»Jack!«, warnte Simon. Er sah Henry an und zuckte mit den Schultern. »Josie kennt sich hier nicht aus. Sie könnte sich verlaufen.« Er rannte hinter Jack her und rief über die Schulter zurück: »Sag du Mom Bescheid.«
Henry machte ein finsteres Gesicht. Oft blieb es an ihm hängen, ihren Eltern schlechte Neuigkeiten beizubringen, weil Simon es unter seiner Würde fand, andere auf dem Laufenden zu halten, und man sich bei Jack nicht darauf verlassen konnte, dass er die Botschaft richtig übermittelte. Henry riss die Schiebetür auf und rief in die ungefähre Richtung des Arbeitszimmers ihrer Mutter: »Mom, Josie ist gerade weggelaufen und wir schauen, wo sie hin will!« Er knallte die Tür zu und hörte gerade noch: »Ihr Jungs bleibt hübsch beim Haus.«
Er durchquerte den Garten und trottete dann die holprige Steigung der Bergausläufer hoch. Riesige Saguarokakteen ragten vom Sandboden auf und reckten ihre stacheligen Arme hoch wie Soldaten, die salutierten. In der Ferne erhoben sich die rotbraunen Zacken und Kliffe des Superstition Mountain. Henry konnte Simon und Jack sehen – und weiter vorn Josie, ein schwarzer Strich vor der hellen Erde. Wohin wollte sie denn? Das war das Problem mit Josie. Man wusste nie, was sie dachte. Manchmal, wenn Henry ihren Kopf streichelte, schnurrte sie mit fauler Behaglichkeit und einen Moment später fauchte sie und krallte nach seiner Hand.
Er holte seine Brüder, die langsamer geworden waren, ein. Der Juni war in Arizona brüllend heiß, ganz anders als in Illinois. Wenigstens war es heute windig … auch wenn sie dadurch trockenen Staub ins Gesicht bekamen. Simon und Jack riefen Josie, aber Henry konnte sie nirgendwo sehen. Und sie kam sowieso nie, wenn man sie rief.
»Wo ist sie abgeblieben?«, fragte er und suchte mit zusammengekniffenen Augen die Hügel ab, das stachelige Gras und die hellgelben Büschel von Wildblumen. Die grelle Sonne warf harte Schatten auf den Boden.
»Sie ist über diese Felsen da geklettert.« Simon fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die prompt noch mehr abstanden. Die Jungen drängten sich unsicher aneinander und starrten zum Superstition Mountain hinauf.
Alle drei wussten sie, dass der Berg verboten war. Bloß war ihnen nicht klar, warum. Ihre Mutter hatte etwas von Pumas und Klapperschlangen gesagt. Ihr Vater hatte nur erklärt, dass sie sich verlaufen könnten.
Jack kletterte auf einen Felsbrocken. »Ich sehe sie!«, rief er. »Sie ist weiter oben. Kommt!«
KAPITEL 2
Den Berg rauf
Henry zögerte. »Meint ihr, es ist okay, den Berg raufzugehen?«
Simon dachte einen Moment nach. »Seht mal, da ist so was wie ein Weg. Wir können Zweige von den Büschen abbrechen und sie in den Boden stecken, damit wir wieder zurückfinden.«
Das klang wie etwas, das Onkel Hank in seiner Militärzeit gemacht hätte, fand Henry. Beruhigt fing er an, Zweige von den spröden Büschen abzubrechen und sie im Weitergehen in die Erde zu stecken, während sie den spitzen Stacheln der Feigen- und Riesenkakteen auswichen.
»Die sehen aus wie große, dünne Menschen«, sagte er zu Jack.
»Ja, Stachelmenschen«, sagte Jack zustimmend.
»Stellt euch mal vor, eure Haut wäre so von Stacheln überzogen«, sagte Simon. »Wie bei einem Stachelschwein. Dann könnten wir Leute verscheuchen, indem wir sie einfach bloß streifen.«
»Cool!« Jack tat so, als ob er ein solches Stachelkleid tragen würde, und lief immer wieder in Simon und Henry hinein, bis Simon ihm androhte, ihn in einen Kaktus zu schubsen.
Als Henry sich umwandte, war ihr Haus nicht mehr zu sehen. Aber die Zickzacklinie aus Stöcken ragte aus dem Boden hervor, so deutlich wie die Meilenanzeiger auf einem Highway.
Bald wurde der Anstieg steiler und felsiger. Jack lief immer noch voran, aber Henry konnte hören, dass er vor Anstrengung keuchte. Eidechsen huschten über den Sandboden. Die Felsbrocken, an denen sich Henry nach oben zog, hatten scharfe Kanten. Die Sonne brannte ihm auf den Rücken, Schweiß lief ihm die Stirn hinab. Der Pfad beschrieb eine Kehre. An dichter bewachsenen Stellen verlor er sich und tauchte dann wieder auf. Sie kletterten weiter.
»Schaut euch den komischen Felsen mal an«, sagte Jack nach einer Weile und zeigte auf eine schmale Felsnadel, die einsam aus dem Gewirr von Kliffen aufragte.
Simon nickte wissend. »Das ist Weaver’s Needle. Dad hat sie mir gezeigt. Es ist eine Landmarke.«
»Was ist eine Landmarke?«, wollte Jack wissen.
»Eine Stelle in der Landschaft, die man auch von weitem sehen kann«, erklärte Henry. »Und dann weiß man, wo man ist.« So machten Kundschafter das doch, oder? Sie prägten sich Landmarken ein und konnten so Leute durch die Wildnis führen. Er versuchte sich die Position von Weaver’s Needle einzuprägen.
»Und wo sind wir?«, wollte Jack wissen.
Henry sah sich in der zerklüfteten, von Felsbrocken übersäten Landschaft um. »Keine Ahnung.«
Sie kletterten weiter. Hinter ihnen erstreckte sich das Flachland, gesprenkelt mit den fernen Häusern von Superstition und geteilt durch einen schmalen Streifen Highway. Vor ihnen lag das Gewirr der Kliffe und Gipfel.
Nach einer Weile fragte Jack kläglich: »Seht ihr Josie irgendwo?«
Henry schüttelte den Kopf. War sie wirklich bis ganz hier raufgekommen? Er hatte den Eindruck, dass es schon sehr lange her war, dass sie von zu Hause aufgebrochen waren.
Oben kreiste ein großer schwarzer Vogel vor dem blauen Himmel.
Henry sah Simon an. »Ist das ein Falke?«
»Ja«, sagte Simon. »Oder ein Geier.«
Henry lief es kalt den Rücken hinunter.
Simon trat gegen die trockene Erde, so dass Steinchen in alle Richtungen flogen. Eine fette graue Kröte sprang unter einem Felsen hervor.
»Schaut!«, rief Jack und zeigte dorthin. Keiner von ihnen war mit den seltsamen Tieren der Wüste vertraut, die ganz anders waren als die Eichhörnchen und Rotkehlchen in Chicago. Henry kam sich vor wie in Die Schweizer Familie Robinson, einem Buch, das er gelesen hatte und das von Leuten handelte, die auf einer Insel im Pazifik gestrandet waren und ständig über exotische Tiere stolperten.
Simon, der normalerweise von der Kröte beeindruckt gewesen wäre, würdigte sie kaum eines Blickes. »Wir hätten Wasser mitnehmen sollen«, sagte er und starrte auf die Staubwolke, die sein Turnschuh aufgewirbelt hatte.
Sie gingen weiter bergauf. Hier wuchsen Bäume und die hindurchscheinende Sonne malte Schattenflecken auf den Boden. Die Jungen blieben stehen und verschnauften. Die Einsamkeit des Berges erfüllte die Luft mit leisen, geheimnisvollen Geräuschen … mit dem hohen Zwitschern von Vögeln, dem Rascheln von Zweigen.
Jack drang ins Unterholz ein und Simon fauchte: »Bleib auf dem Weg, Jack.«
»Aber ich kann Josie nirgendwo mehr sehen.«
Henry lehnte sich gegen einen Felsen. Die Sonne stand inzwischen deutlich tiefer. »Es gefällt mir hier oben nicht«, sagte er. »Es … es ist gespenstisch.«
Simon wandte sich zu ihm um. »Wovor hast du Angst? Vor Pumas?«
»Nein«, protestierte Henry. Er hatte schon ein bisschen Angst vor Pumas und vor Klapperschlangen erst recht, aber es war mehr als das. Die Stille war gruselig. Als ob sie beobachtet wurden. Als ob der Berg seinen Atem anhielt.
Simon kletterte auf Henrys Felsen, um einen besseren Überblick zu haben, und schirmte die Augen mit der Hand ab. Er sah richtig wie ein Entdecker aus, dachte Henry neidisch. »Keine Spur von Josie zu sehen«, sagte er nach einem Moment. »Wir sollten umkehren.«
»Und sie hier allein lassen?« Henry war entsetzt. Er wollte ja nach Hause, aber wie konnten sie denn Josie im Stich lassen?
»Ja!« Jack lief den Pfad hinunter zu der Stelle, wo sie saßen.
»Das dürfen wir nicht! Mom sagt, hier gibt es Pumas! Was, wenn sie GEFRESSEN wird?«
»Gefressen?« Simon schnaubte. »Von was soll Josie denn gefressen werden? Sie kann selber auf sich aufpassen.«
»Zu Hause in Chicago konnte sie das«, sagte Henry. »Aber hier ist es anders. Hier kennt sie sich nicht aus.« Er überlegte, wie es ihm damit gehen würde, wenn ihn seine Brüder allein auf dem Berg lassen und es dann dunkel werden würde. Trotz der Hitze überlief ihn ein Schaudern.
Simon sah ihn verzweifelt an. »Hen, wir haben kein bisschen Wasser dabei. Das bringt einen um in einer Gegend wie dieser und nicht irgendwelche Pumas.«
Jack kletterte nun ebenfalls auf den Felsen. »Rückt mal ein Stück.« Er schob Simons Bein beiseite.
Simon machte ein finsteres Gesicht. »Hier ist kein Platz mehr.«
»Und ob.«
»Gar nicht.«
»Und OB.« Jack rammte Henry im Vorbeikrabbeln einen Fuß in den Rücken.
»He!«, protestierte Henry.
»Jack, lass das –«, sagte Simon und versuchte das Gleichgewicht zu halten.
»Nun rück schon«, beharrte Jack.
»Pass doch auf!«, rief Henry, als Jack in seine Schulter rumste.
Aber es war zu spät. Simon wich aus, als Jack ihn erneut schubsen wollte, und Jack purzelte auf der anderen Seite von dem Felsen wieder hinunter.
Rums! Er verschwand in einem Dickicht. Dann war immer wieder ein Knacken zu hören und Henry und Simon begriffen entsetzt, dass Jack nicht bloß auf den Boden gefallen war – er rollte einen Hang hinunter.
»Heeeyyy!«, brüllte Jack.
Sie konnten hören, wie er sich auf der harten Erde überschlug.
KAPITEL 3
Der verborgene Canyon
Henry und Simon kletterten rasch über den Felsen und glitten auf der anderen Seite hinunter, wobei sie sich an Zweigen festhielten, um nicht abzustürzen. Der Boden fiel schroff zu einem kleinen Canyon ab, der hinter den Felsen und Büschen verborgen lag.
»Jack?«, rief Henry.
Sie starrten in die Schlucht hinab. Die steilen Felswände leuchteten in der untergehenden Sonne rötlich braun, hier und dort wuchsen verkümmerte Büsche. Der Grund lag fünfzehn oder zwanzig Meter tiefer, ein schmaler Kieselstreifen, auf dem hier und da graugrüne Büsche und kleine Bäume wuchsen. Früher war dort unten anscheinend einmal ein Bach geflossen, aber jetzt war es nur noch ein trockener, steiniger Pfad. Der Wind blies trostlos durch die enge Kluft.
»Jack!«, rief Simon gellend. Seine Stimme hallte von den Wänden des Canyons wider.
Endlich drang Jacks Stimme zu ihnen herauf. »Ich bin hier!«
Henry konnte mehrere Meter weiter unten Jacks rotblonde Haare im Sonnenlicht schimmern sehen. Jack kauerte auf einer Felskante.
»Rühr dich nicht vom Fleck!«, rief Henry. »Ich glaub, du … du hängst am seidenen Faden.«
»Tu ich gar nicht«, rief Jack nach oben. »Aber ich fall vielleicht runter.«
»Genau das bedeutet es ja«, antwortete Henry.
»Ach so. Dann sag’s doch gleich normal. Und ich fall besser nicht runter, weil ich mir dann nämlich alles breche. Ist ganz schön tief.«
»Halt dich fest, wir kommen.« Simon fing an, die Felswand hinunterzuklettern. »Alles okay mit dir?«
Henry folgte ihm vorsichtig, vom einen Baumzweig zum nächsten, um nicht ins Rutschen zu kommen.
»Glaub schon«, sagte Jack kleinlaut. »Aber macht schnell!«
Wenig später waren sie bei ihm – auf einer Felsplatte, die hoch über dem Grund der Schlucht ins Freie ragte. Als Henry über den Rand lugte, wurde ihm ganz anders.
Jack war von oben bis unten dreckig und hatte Stöckchen und Gräser in den Haaren hängen. »Auuu!«, ächzte er. »Das hat wehgetan.«
»Tja, geschieht dir aber recht, wo du mich runterschubsen wolltest«, beschwerte sich Simon.
»Simon«, sagte Henry, als er sah, was Jack für ein Gesicht machte. Das war nämlich typisch für ihren kleinen Bruder, er konnte schneller von gut gelaunt zu stinkwütend wechseln, als man brauchte, um ihn ein Baby zu nennen. Darin ähnelte er Josie.
»Wir sollten uns auf den Rückweg machen«, sagte Henry rasch. »Es wird bald dunkel.« Er sah zum Himmel hinauf. Wenn die Sonne unterging, dann würden sie die Stöcke nicht mehr sehen können, die ihnen den Weg nach Hause weisen sollten.
Dann fiel ihm etwas auf. Ein paar Meter entfernt lagen auf der Felsplatte, die über dem Canyon hing, sauber aufgereiht drei runde, weiße Gegenstände, die ein Stück größer als Softbälle waren.
»Was sind das für Kugeln?«, fragte er und rutschte auf den Knien nach vorn.
Simon stand langsam auf, eine Hand an die Felswand gepresst. »Ja, genau, was sind das für Dinger?«
Jack kroch hinüber und hob eine der Kugeln auf.
Er drehte sie langsam um. »Sieht aus wie ein –«
Sie keuchten alle auf.
Es war ein Schädel.
Ein menschlicher Schädel.
KAPITEL 4
Wo entlang?
Der Schädel war von der Sonne ausgeblichen, mit gähnenden Augenhöhlen und nur einer Reihe eng stehender Zähne. Henry erstarrte. Jack war so entsetzt, dass er das Ding beinahe fallen ließ. Mit großen Augen setzte er es vorsichtig auf den Boden, von wo aus es die Jungen wild angrinste.
Henry hatte die Schädel gesehen, die ihre Mutter für medizinische Lehrbücher und Zeitschriften zeichnete – bleiche, schattenhafte Kugeln mit leeren Augenhöhlen und einem Grinsen voller Zähne. Aber einen in echt zu sehen war irgendwie etwas anderes.
»Wie kommt der denn hierhin?« Henrys Stimme zitterte.
»Keine Ahnung«, sagte Simon. »Aber seht nur … es sind drei Stück.« Er ging langsam zum Rand des Felsvorsprungs und hob einen zweiten Schädel auf, drehte ihn in seinen Händen. »Das wäre was für Mom«, sagte er leise.
Henry spürte, dass Simon so tun wollte, als hätte er keine Angst, und irgendwie gab ihm das ein noch schlechteres Gefühl. Behutsam hob er den dritten Schädel hoch. Er war schwerer, als Henry erwartet hatte, mit dicken Wellenlinien obendrauf.
»Er sieht aus wie zusammengeklebt«, flüsterte er.

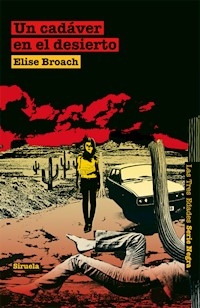
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










