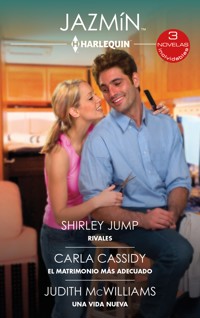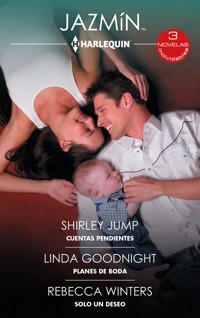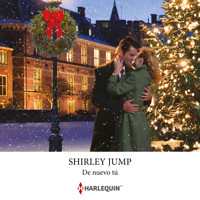8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eBundle
- Sprache: Deutsch
FÜR IMMER ZURÜCK ZU DIR
Ausgerechnet ihre Jugendliebe! Als Meri in ihren Heimatort zurückkommt, um sich um ihren Grandpa zu kümmern, läuft sie prompt Jack Barlow in die Arme. Gegen ihren Willen fühlt sie sich gleich wieder von ihm angezogen. Doch sie darf sich kein zweites Mal das Herz brechen lassen!
PLÖTZLICH VATER, PLÖTZLICH VERLIEBT?
Plötzlich Daddy! Nach dem ersten Schock genießt Luke Barlow das Leben mit seiner süßen Tochter Maddy. Zu seinem Glück fehlt nur noch, dass er auch das Herz ihrer schönen Tante gewinnt. Peyton hingegen sträubt sich. Was muss er tun, damit sie ihn nicht als sorglosen Casanova sieht?
WEIL UNS NICHTS MEHR TRENNEN KANN
Mac Barlows Welt steht Kopf, als er die schöne Savannah trifft. Bei ihr verspürt der erfolgreiche Geschäftsmann nie gekannte Gefühle von Leichtigkeit und Glück. Aber wenn er sich jetzt der Liebe hingibt, verrät er sein Ziel. Denn eigentlich wollte er nur eins: Savannahs Firma!
TRAUMMANN AM HAKEN
Funkenflug bis zum Himmel: Verzweifelt sieht Rachel das Geschäft ihres Vaters in Flammen aufgehen. Doch Colton, neuer Feuerwehrmann von Stone Gap, ist da. Mit starken Armen und einem Kuss, der sagt: Wenn alles zerstört ist, ist die beste Zeit für einen Neuanfang
...
WIE ZWEI INSELN IM STROM
Dich hat der Himmel geschickt!" Dankbar sieht Sam, wie liebevoll Katie mit Libby und Henry umgeht - sie muss bei ihm in Stone Gap bleiben! Er ahnt nicht, dass seine Kinder Katie an ihren größten Verlust erinnern, jeder Tag für sie ein neuer Kampf zwischen Liebe und Trauer ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Shirley Jump
Die Barlow Brüder (5-teilige Serie)
IMPRESSUM
Für immer zurück zu dir erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2015 by Shirley Kawa-Jump, LLC Originaltitel: „The Homecoming Queen Gets Her Man“ erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe BIANCA EXTRABand 27 - 2016 by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg Übersetzung: Valeska Schorling
Umschlagsmotive: Pavel L Photo and Video / Shutterstock
Veröffentlicht im ePub Format in 05/2019 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733746780
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Als Meri Prescott vor fünf Jahren Stone Gap, North Carolina, verlassen hatte, hatte sie sich vorgenommen, nur in ganz großem Stil zurückzukehren, falls überhaupt. Sie hatte sich ausgemalt, wie ihre Limousine an den staunenden blauhaarigen Damen vor Sadie’s Clip ’n’ Curl in der Main Street vorbeiglitt, während die Angler auf der Bank vor der Comeback Bar die Köpfe schüttelten und das Verschwinden der guten alten Zeiten beklagten, in denen es völlig ausgereicht hatte, in einem zweifarbigen Chevy durch die Stadt zu fahren.
In Meris Fantasie hatte sie mit ihrer Heimkehr sämtlichen Einwohnern dieser gottverlassenen Stadt bewiesen, dass sie es geschafft hatte, dass sie mehr aus sich gemacht hatte, als man ihr zugetraut hätte. Dass sie nicht nur ein hübsches Mädchen war, dem ihre Fingernägel wichtiger waren als ihr Notendurchschnitt. Dass sie in New York ihre wahre Bestimmung gefunden hatte, anstatt ihr Leben nach den Vorstellungen anderer Menschen auszurichten.
Okay, sie war ein bisschen verblendet gewesen. Die Meri Prescott, die Stone Gap mit einer Tiara und großen Zukunftsplänen im Gepäck verlassen hatte, war nicht die Meri Prescott, die jetzt zurückkehrte. Noch nicht mal annähernd. Und sie war sich wirklich nicht sicher, dass Stone Gap die Frau akzeptieren würde, die sie geworden war.
Im Grunde genommen war ihr das jedoch egal. Sie war wegen Grandpa Ray gekommen und würde so lange bleiben, wie er sie brauchte. Sie würde dafür sorgen, dass er wieder gesund wurde … und dabei vielleicht sich selbst heilen.
Unwillkürlich hob sie eine Hand zu ihrer linken Wange, zu der langen gebogenen Narbe, die noch nicht verblasst war. Manchmal wachte sie nachts schweißgebadet auf, weil sie im Traum wieder den Überfall in jenem schäbigen Vorort durchlebte. Sie hatte ihr Bestes versucht, in New York zu bleiben und weiter zu fotografieren, doch die Stadt war ihr fremd geworden, und die Häuser, die sie mal geliebt hatte, empfand sie als Gefängnismauern.
Sie sehnte sich nach Luft, Natur und warmen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht. In Stone Gap würde es ihr vielleicht gelingen, die Dämonen zu besiegen, die sie im Schlaf verfolgten und ihre Tage überschatteten. Vielleicht würde sie sich hier dazu überwinden können, wieder zur Kamera zu greifen und etwas anderes durch die Linse zu sehen als den Straßenräuber.
Wer weiß?
Vor dem Stoppschild an der Honeysuckle Lane hustete der Motor ihres zehn Jahre alten Toyota protestierend auf. Die Klimaanlage hatte bereits irgendwo in Baltimore versagt, und Abgase drangen durch das offene Fenster – was Meri das Gefühl gab, Brooklyn noch immer nicht hinter sich gelassen zu haben.
Sie brauchte jedoch nur einen Blick aus dem Fenster auf die pastellfarbenen Häuser im Kolonialstil entlang der Main Street zu werfen, um zu wissen, dass sie im Süden war. Richtung Innenstadt wurden die Wohnhäuser von hübschen Läden mit breiten bunten Markisen und Namen wie Joe’s Barber Shop, Ernie’s Hardware & Sundries und Betty’s Bakery abgelöst. Als ihr Blick auf einen weiteren Namen fiel, trat sie unwillkürlich auf die Bremse.
Gator’s Garage.
Beim Anblick des blauen Gebäudes mit dem handgemalten Schild war Meri wieder fünfzehn und bekam ihren ersten unbeholfenen Kuss von Jack Barlow – der sich ein Jahr später ähnlich unbeholfen von ihr getrennt hatte. Sie hatte wieder den Geruch von Motoröl in der Nase, sah den dunklen Ölfleck auf dem Werkstattboden und Jacks traurige blaue Augen, als er ihr mitteilte, dass sie ihm nicht bodenständig genug war und er mehr wollte als eine Schönheitskönigin.
Seine Worte hatten sie tief verletzt und auch dann nicht losgelassen, als sie eine Woche später zum Miss-America-Schönheitswettbewerb aufgebrochen war und sich geschworen hatte, Jack Barlow ein für alle Mal zu vergessen.
Als jemand hinter ihr hupte, riss sie den Blick von Gator’s Garage los und trat aufs Gaspedal. Sie bog nach rechts in die Maple Street, dann links in die Elm Street und schließlich in die Cherrystone Street, wo sie vor jenem Haus bremste, das sie vor fünf Jahren im Rückspiegel zurückgelassen hatte.
Es thronte am Ende der Sackgasse wie eine Königin, zweistöckig, weiß, holzverschalt und mit zwei sich um das ganze Haus erstreckenden Veranden. Die gepflasterte Einfahrt stammte noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg und wurde von zwei Weiden flankiert, in denen spanisches Moos hing. Man konnte fast den Eindruck bekommen, sich im Jahre 1840 zu befinden anstatt im einundzwanzigsten Jahrhundert.
Der Motor des Toyota hustete ein letztes Mal asthmatisch und verstummte stotternd. Na toll.
Meri seufzte tief, was jedoch nichts gegen ihren verspannen Nacken ausrichtete.
Jetzt, wo der Motor aus war, empfand sie die Hitze North Carolinas als noch erdrückender. Sie unterdrückte einen fast übermächtigen Fluchtimpuls, zog den Zündschlüssel heraus und hielt ihn fest. Das sich in ihre Haut pressende harte Metall verankerte sie in der Realität. Sie würde jetzt nicht nach New York zurückfahren, nicht heute und vermutlich auch nicht nächste Woche. Es gab einen guten Grund hierzubleiben – einen zerbrechlichen vierundachtzigjährigen Grund. Grandpa Ray hatte jetzt Priorität. Er war wichtiger als alles andere.
Meris Mutter betrat die Veranda, lehnte sich gegen den Rahmen der Haustür und verschränkte die Arme vor der Brust. Ihr missbilligender und enttäuschter Gesichtsausdruck war unübersehbar. Er war Meri nur allzu vertraut.
Trotzdem flackerte für eine Sekunde wieder die trügerische Hoffnung in ihr auf, dass sich vielleicht etwas verändert hatte. Doch nein, so wie ihre Mutter sie ansah, bestand wenig Hoffnung, dass sie in den letzten fünf Jahren eine Hundertachtzig-Grad-Wendung gemacht hatte. Im günstigsten Fall eine Fünfundvierzig-Grad-Wendung Richtung gesunder Menschenverstand.
Rasch kämmte Meri sich das windzerzauste Haar, bevor sie die Einfahrt zur Veranda hochging. Der perfekt manikürte Rasen sah aus wie ein üppiger grüner Teppich, flankiert von makellos geschnittenen Rosenbüschen und in Reih und Glied gepflanzten Einjährigen. Eine Holzschaukel hing in einer großen Eiche und schwankte sanft in der Brise. Die idyllische Szenerie sah aus wie einem exklusiven Gartenmagazin entsprungen.
Als Meri mit ihrem rechten High Heel zwischen zwei Pflastersteinen hängen blieb, bereute sie ihre Entscheidung, ihre Flip Flops gegen Schuhe mit hohen Absätzen eingetauscht zu haben. Hunderte von Meilen hatte sie sich einzureden versucht, dass es ihr inzwischen egal war, was ihre Mutter dachte. Fragte sich nur, warum sie sich dann freiwillig eingequetschte Zehen antat. Und warum sie zwanzig Minuten damit verbracht hatte, auf der Toilette einer Tankstelle ihr Haar zu glätten.
Habe ich mir wirklich eingebildet, dass hohe Absätze und glattes Haar alles leichter machen?
Ja, hatte sie. Nur weiter so. Belüg dich ruhig selbst.
Als Meri vor den Verandastufen ankam, setzte sie instinktiv ein breites Lächeln auf. Anscheinend funktionierte ihre Konditionierung noch ausgezeichnet. Sie konnte noch immer in High Heels herumstolzieren und die Glückliche mimen. „Hi, Momma.“
„Sieh mal einer an.“ Anna Lee löste sich vom Türrahmen. „Meine verlorene Tochter ist wieder da.“
Meri beugte sich vor und gab ihrer Mutter einen Kuss auf eine Wange. Ein schwacher blumiger Parfumduft stieg ihr in die Nase, überdeckt vom betäubend süßen Duft von Haarspray und Puder auf makellosem Make-up. Alles an Anna Lee war so perfekt wie der Rasen.
Anna Lee umfasste Meris Gesicht. „Du siehst so erschöpft aus, Schatz. Schläfst du auch genug? Isst du vernünftig?“ Sie wich dem Anblick von Meris Narbe aus. „Komm rein, wasch dir das Gesicht mit etwas kaltem Wasser und trag etwas Make-up auf. Danach fühlst du dich bestimmt wie neugeboren.“
Meri verdrängte ihre Irritation und lächelte schmallippig, um nicht etwas zu sagen, das sie hinterher bereuen würde. „Ich habe eine lange Fahrt hinter mir, Momma, das ist alles.“
Anna Lee ließ einen Daumen über Meris Narbe gleiten. „Wirklich?“
Meri zog die Hand ihrer Mutter weg. „Es geht mir gut, Momma, glaub mir.“
Anna Lee wirkte nicht überzeugt, nickte jedoch und setzte ein ähnlich künstliches Lächeln auf wie Meri. „Lass uns ins Haus gehen. Die Hitze hier draußen ist unerträglich.“ Sie dehnte die Silben auf jene faszinierende melodiöse Südstaaten-Art, die Meri schon immer geliebt hatte. Ihre Mutter war zweifache Witwe, eine sehr wohlhabende Frau, die nach dem Tod ihres zweiten Mannes den Namen ihres ersten Mannes wieder angenommen hatte.
Obwohl Jeremy Prescott aus dem weniger feinen Teil der Stadt gekommen war, hatte er Millionen als Investmentbanker gemacht, bevor ihn mit fünfzig ein Herzinfarkt niedergestreckt hatte. Meri hatte nie verstanden, warum er nicht so bodenständig wie seine Herkunftsfamilie geblieben war – die Menschen, die Meri am meisten bedeuteten. Grandpa Ray war einer der wundervollsten Männer, die sie kannte. Er wohnte in einer Hütte am See, ganze Lichtjahre von seiner Schwiegertochter in ihrem übergepflegten Herrenhaus entfernt.
Meri leistete keinen Widerstand, als ihre Mutter sie durch die Eingangshalle in den Salon führte. Gegen Anna Lee konnte man sowieso nichts ausrichten. Sie wusste genau, warum ihre Mutter sie hierhergebracht hatte, als sie die auf Glasregalen arrangierten strassbesetzten Kronen und Tiaras funkeln sah.
Sie nahm auf einem steifen weißen Sofa Platz, während ihre Mutter sich ihr gegenüber auf einen Sessel setzte, von ihrer Tochter nur durch einen ovalen Mahagoni-Sofatisch und einen Aubusson-Teppich getrennt, der mehr als ein Kleinwagen gekostet hatte. Die antike Standuhr in einer Ecke tickte schwer und bedeutungsschwanger.
Unbehaglich veränderte Meri ihre Sitzposition. Sie kam sich vor wie in einem Mausoleum. „Momma, wollen wir nicht nach draußen auf die hintere Veranda gehen?“
Ihre Mutter machte eine abfällige Geste. „Da draußen sind Handwerker.“
Sie sagte das, als handle es sich um einen Schwarm Heuschrecken. Anna Lee hatte sich in der Gegenwart einfacher Menschen noch nie wohlgefühlt. Vielleicht weil sie Angst hatte, dass man ihr einen Besen in die Hand drücken würde. „Sie bauen gerade eine Gartenlaube“, fügte Anna Lee hinzu. „Du kennst mich ja, irgendetwas muss ich immer verändern.“
„Damit alles perfekt aussieht, vor allem deine Tochter“, entschlüpfte es Meri. Dabei hatte sie sich solche Mühe gegeben, höflich zu bleiben. Kaum fünf Sekunden hatte sie das durchgehalten.
Anna Lee runzelte missbilligend die Stirn. „Ich wollte immer nur, dass du das Beste aus dir machst, Meredith Lee. Du warst so ein schönes Mädchen, so …“
„Ich bin nicht hier, um über längst vergangene Dinge zu reden, Momma. Meine Zeit als Schönheitskönigin ist längst vorbei.“
„Du wirst immer eine Schönheitskönigin sein, das kann dir niemand nehmen. Sieh doch nur all diese Kronen an.“ Anna Lee zeigte auf die funkelnden Tiaras, die Schärpen und Trophäen, alles Erinnerungen an eine andere Zeit, eine andere Meri. „Sie sind der beste Beweis dafür, dass du das schönste Mädchen der Welt bist.“
Meri seufzte. „Ich habe mich verändert, Momma.“
Anna Lee fuhr fort, als habe Meri nichts gesagt: „Du hättest Miss America werden können, wenn du nicht …“ Sie schürzte die Lippen. „Aber na ja, das ist ja jetzt auch egal.“
Sie hatten diese Diskussion schon unzählige Male gehabt. Manchmal kam es Meri so vor, als rede sie gegen eine Wand, so wenig hörte Anna Lee ihr zu. „Momma, bitte! Lass uns nicht schon wieder davon anfangen.“
Anna Lee beugte sich vor und berührte das Gesicht ihrer Tochter, auf der die Narbe wie ein aggressiver roter Halbmond hervortrat. „Wenn du mich dich nur zu einem Gesichtschirurgen bringen lassen würdest. Er könnte dafür sorgen, dass du wieder perfekt aussiehst.“
„Fang nicht schon wieder damit an, Momma!“
Anna Lee seufzte tief. „Denk doch wenigstens darüber nach.“
Meri hatte in den letzten Monaten über fast nichts anderes nachgedacht – seit dem Überfall, nach dem nichts mehr so gewesen war wie vorher. Für ihre Mutter hatte sich jedoch nichts verändert. Sie sah in Meri immer noch das Mädchen, das zig Schönheitswettbewerbe gewonnen hatte und dem es bestimmt gewesen war, Miss America zu werden, bevor sie einfach so die Stadt verlassen hatte.
Warum war sie überhaupt hierhergekommen? Wann würde sie endlich akzeptieren, dass ihre Mutter sich nie ändern würde? Na ja, wenn sie den Zwischenstopp hier hätte vermeiden können, hätte sie es getan.
Meri stand auf. „Kann ich bitte den Schlüssel für das Gästehaus bekommen, damit ich mich dort einrichten kann?“
Ihre Mutter zeigte hinter sich. „Er ist da, wo er immer ist. Ich verstehe nicht, warum du unbedingt in der alten Bruchbude wohnen willst, wo Geraldine doch das Bett in deinem alten Zimmer frisch bezogen hat.“
Meri verzichtete auf eine Antwort. Sie ging zu dem antiken Rollsekretär, zog eine der kleinen Schubladen auf und nahm den alten Schlüssel heraus. Als sie klein gewesen war, hatte ihr Vater das Gästehaus an den Wochenenden zum Angeln benutzt – und, wie Meri vermutete –, um von Momma und ihren ständigen Ansprüchen wegzukommen. Ein paar Mal hatte er Meri mitgenommen. Sie hatte diese Tage genossen, an denen sie sich hatte schmutzig machen und essen dürfen, was sie wollte.
Als Meri den schweren Schlüssel in der Hand spürte, war sie plötzlich wieder sechzehn und schlich sich in einer sternklaren Nacht mit Jack in das Gästehaus, aufgeregt und total verliebt. Am Schluss hatte sie allein am Ufer des Sees gesessen, verwirrt und mit gebrochenem Herzen. Ihr Cousin Eli hatte sie abgeholt und nach Hause gefahren. Er hatte ihr auch geholfen, das Rosenspalier hochzuklettern, bevor Anna Lee herausfand, dass Meri weg war.
Eli …
Gott, war er wirklich nicht mehr da? Unvorstellbar, dass er nicht mehr am Leben war. Er war ihr bester Freund gewesen, eher wie ein Bruder als wie ein Cousin. Sie hörte wieder die Stimme ihrer Tante Betty am Telefon, wie sie Meri von seinem Tod erzählte. Meri vermisste ihn schrecklich. Und jetzt war auch noch Grandpa Ray krank …
Hoffentlich erholte er sich wieder. Noch einen Verlust würde sie nicht verkraften.
Tief Luft holend steckte sie den Schlüssel ein und drehte sich wieder zu ihrer Mutter um. „Ich fahre dann jetzt zu Grandpa Ray.“
Ihre Mutter schürzte die Lippen und nickte. „Geh nur, geh. Aber sei bitte rechtzeitig zum Abendessen wieder da. Geraldine macht Brathähnchen. Sie hat dir das Bett mit der Blumenbettwäsche bezogen, die du so magst, falls du deine Meinung noch änderst.“
Meri seufzte. „Du weißt doch, dass ich in Grandpa Rays Gästehaus wohnen will. Er braucht mich.“
„Da könntest du doch genauso gut im Wald schlafen, Meredith Lee. Dein Großvater haust in seiner Hütte wie ein Wilder, und das Gästehaus ist auch nicht besser.“
„Nur weil Grandpa Ray in einem bescheidenen Haus wohnt und sich einen feuchten Kehricht um das schert, was die Leute über ihn denken, ist er noch lange kein Wilder!“
„Geraldine wird schrecklich enttäuscht sein.“
Das Dienstmädchen war schon seit dreißig Jahren in der Familie, länger als Meri auf der Welt war. Meri fühlte sich für einen Moment schuldig – bis ihr bewusst wurde, dass ihre Mutter von Geraldine gesprochen hatte, nicht von sich selbst.
Nein, nichts hatte sich verändert. Gar nichts. „Ich muss gehen, Momma.“
Meri eilte aus der erstickenden Atmosphäre des Hauses zu ihrem Wagen. Ein Stoßgebet gen Himmel schickend, drehte sie den Schlüssel im Zündschloss. Mit einem Ruck erwachte der Motor des Toyotas zu Leben. Na Gott sei Dank!
Kaum hatte sie die Einfahrt hinter sich gelassen, fühlte sie sich wieder freier. Sie durchquerte das Stadtzentrum und fuhr nach Südwesten in den weniger feinen Teil der Stadt. Hier passte sie hin, hier konnte sie durchatmen. Hier ließen die Menschen ihren Rasen wachsen und ihre Fahrräder im Vorgarten stehen und interessierten sich nicht dafür, ob auf dem Sofatisch ein Glas herumstand.
Sie parkte ihren Wagen in Grandpa Rays Einfahrt, streifte ihre High Heels ab und tauschte sie gegen die Flip Flops aus, die sie unter den Beifahrersitz geschoben hatte. Auf dem Weg zum Haus band sie sich das Haar zu einem Pferdeschwanz hoch. Endlich war sie wieder sie selbst.
Für den Bruchteil einer Sekunde rechnete sie damit, ihren Cousin Eli zu sehen, doch dann fiel ihr wieder ein, dass er tot war. Gefallen im Krieg, auf irgendeiner staubigen Straße in Afghanistan. Er würde nie wieder zurückkommen.
Doch sein Geist war noch lebendig, lebte in den holzverschalten Häusern, den Bäumen und den Vögeln, die in den Zweigen zwitscherten. Die Bäume hatte er vor Jahren gepflanzt, die Fenster eingebaut und die Gartenlaube errichtet. Meri beschloss trotzdem, ihr Bestes zu versuchen, den Tag zu genießen. Eli hätte sich das gewünscht, das wusste sie genau.
Sie lief die Eingangsstufen hoch und klopfte an die Tür. „Grandpa? Ich bin’s, Meri!“
Keine Antwort. Sie rief erneut, doch es herrsche Schweigen. Ihr Magen verkrampfte sich. War Grandpa womöglich auch …
Als sie ein Geräusch hinter dem Haus hörte, atmete sie erleichtert auf. Sie eilte die Stufen wieder hinunter, ging um das Haus herum und duckte sich unter dem spanischen Moos, das von einer Eiche hing, bevor sie lächelnd um die letzte Ecke bog.
„Also, Grandpa Ray“, sagte sie lachend, an ihren in einem Gartenstuhl schlafenden Großvater gewandt. „Ignorierst du die Anordnungen des Arztes etwa schon …“
Die Worte erstarben ihr auf den Lippen, als ihr Blick an dem Gartenstuhl vorbei auf den einzigen Mann in Stone Gap fiel, den sie nie hatte wiedersehen wollen: Jack Barlow.
Jack stand etwa dreißig Meter von ihrem Großvater entfernt, mit einer Axt in einer Hand und einem Haufen Kaminholz zu seinen Füßen. Er trug eine alte, tief in die Stirn gezogene Jagdmütze, eine Khakishorts, die aussah wie durch den Reißwolf gezogen und ein ausgeblichenes T-Shirt, und trotzdem …
Er sah gut aus. Und erschreckend erwachsen, selbstsicher und stark. Außerdem verdammt sexy. Der Jack aus ihrer Erinnerung war ein schlaksiger Teenager gewesen, bevor er zum Militär gegangen war, im Mittleren Osten gekämpft hatte und zurückgekehrt war …
… mit dem Körper eines griechischen Gottes.
Als er spöttisch eine Augenbraue hob, wandte sie verlegen den Blick ab. Verdammt! Er hatte sie dabei ertappt, ihn anzustarren.
Jack legte die Axt weg, wischte sich die Sägespäne von den Händen und kam auf sie zu, größer, schlanker und muskulöser als früher. Ihr verräterischer Magen flatterte, als er vor ihr stehen blieb. „War ja nur eine Frage der Zeit, bis du hier wieder Ärger machst“, sagte er.
„Ich find’s auch schön, dich wiederzusehen, Jack.“
Er grinste, jenes schiefe Grinsen, bei dem sie früher immer dahingeschmolzen war. Jetzt natürlich nicht. Sein Lächeln hatte keine Wirkung mehr auf sie. Absolut nicht. „Schön zu sehen, dass du dich nicht verändert hast.“
Trotzig hob sie das Kinn. „Ich habe mich verändert, Jack Barlow. Mehr als du ahnst.“
Als sein Blick an der Narbe auf ihrer linken Wange hängen blieb, machte ihr Herz einen Satz. Sie hielt die Luft an. Etwas flackerte in seinen Augen auf, etwas Schmerzliches. Für einen Moment hatte sie das Gefühl einer Verbindung zu ihm, doch dann wandte er den Blick ab, und das Gefühl war vorbei.
„Wir beide haben uns verändert, Meri“, sagte er leise.
„Manche Dinge werden nie wieder sein wie früher, oder?“ Sie dachte an ihren Cousin, der kurz nach Jack in den Krieg gezogen war.
Zwei waren fortgegangen. Nur einer war zurückgekehrt.
Brach Elis Tod Jack genauso das Herz wie ihr? Als Kinder waren sie unzertrennlich gewesen. „Das teuflische Trio“ hatte ihre Großmutter sie immer lächelnd genannt. Elis Abwesenheit hinterließ eine große Lücke.
„Ich muss jetzt weiterarbeiten.“ Jack griff wieder nach der Axt. Er schlug so heftig auf die Scheite ein, dass die Botschaft eindeutig war: Das Gespräch war vorbei.
Eins stand fest – der charmante Jack Barlow von der Highschool war verschwunden. Dieser Jack hier hatte etwas an sich, etwas Hartes, das ihr fremd war. Lag es an seiner Zeit beim Militär? Oder am Verlust seines besten Freundes?
Ach, egal. Meri war wegen ihres Großvaters hier, nicht, um irgendwelche Geheimnisse zu lüften. Und ganz bestimmt nicht, um sich Gedanken über einen Typen zu machen, der in ihr nur ein oberflächliches hübsches Mädchen ohne jeden Tiefgang gesehen hatte.
Sie ging zu ihrem Großvater und beugte sich über ihn, um ihm einen sanften Kuss auf eine Wange zu geben. Er sah erschreckend blass und zerbrechlich aus. Dieser einst so robuste Mann, der sie auf den Schultern getragen hatte, schien geschrumpft zu sein.
Er schlug die Augen auf und nahm lächelnd ihre Linke. Seine hellgrünen Augen blitzten erfreut auf. Hinter ihm funkelte der Stone Gap Lake in der Sonne. „Meri-Mädchen“, sagte er und strich ihr liebevoll über die Narbe. „Da bist du ja. Wie geht es meiner Lieblingsenkelin?“
„Gut.“
Er zwinkerte ihr zu. „Ich habe eine Schüssel mit Schokoriegeln auf dem Esszimmertisch stehen. Die wartet nur auf dich.“ Er grinste. „Und auf Jack, falls du bereit bist zu teilen.“
Meri hatte nicht die Absicht, auch nur irgendetwas mit Jack Barlow zu teilen. Nicht jetzt und auch später nicht. Dass er hier war, brachte sie etwas aus dem Konzept, aber irgendwie würde sie es schon schaffen, ihm in Zukunft aus dem Weg zu gehen.
„Ich? Schokoriegel abgeben? Grandpa, du hast wohl vergessen, mit wem du sprichst.“ Hinter sich konnte sie das stetige Geräusch von Axtschlägen und von zersplitterndem Holz hören. Jack hatte ihrem Großvater schon früher oft geholfen, zusammen mit Eli. Es war nach der Trennung unheimlich schwer für sie gewesen. Aber sie war ihm dafür dankbar, dass er zu Ray immer gut gewesen war. Das kurze Magenflattern vorhin – das war nur Überraschung gewesen, weiter nichts. Sie hatte gedacht, er sei noch bei der Armee, aber er schien entlassen worden zu sein. Nicht dass es sie interessierte. Überhaupt nicht.
Fragte sich nur, warum sie dann immer wieder an jenen Moment in Gator’s Garage denken musste. An die schmerzhaften Monate nach ihrer Trennung, als sie versucht hatte, Jack Barlow und sein freches Grinsen zu vergessen.
Jack hackte unbeirrt weiter. Bei dem Tempo, das er an den Tag legte, war er vermutlich nicht der Einzige, den ihr Wiedersehen nicht kaltließ.
Meri verdrängte diesen Gedanken hastig. Jack Barlow gehörte zu ihrer Vergangenheit, und die hatte sie konsequent hinter sich gelassen. „Die Schokoriegel kann ich gut gebrauchen, Grandpa“, sagte sie seufzend.
Er lachte. „Ich nehme an, du warst bei deiner Mutter?“
„Ja. Ich dachte, sie hat sich vielleicht verändert.“ Meri schüttelte den Kopf. „Aber ich bin nicht hier, um über sie zu reden. Ich wollte mich vergewissern, dass es dir gut geht.“
„Ich wärme immer noch einen Stuhl. Mehr erwarte ich heutzutage nicht mehr vom Herrn.“
Meri bekam einen Kloß im Hals, doch sie blinzelte die Tränen weg und lächelte ihrem Großvater tapfer zu. Sie setzte sich auf den Stuhl ihm gegenüber und nahm seine Hände. „Ich bleibe hier, solange du mich brauchst.“
„Das freut mich, Meri-Mädchen.“ Seine Stimme klang belegt.
Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und hielt das Gesicht in die warme Sonne North Carolinas. Hier, im Garten des heruntergekommenen Bungalows, zwischen den Bäumen, dem Gras und den Vögeln, war sie zu Hause. Hier würde sie Frieden finden und endlich wieder durchatmen können – zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit. „Mich auch, Grandpa. Mich auch.“
Die Axtschläge drangen wieder an ihr Bewusstsein. Ihr Blick wanderte zurück zu Jack und blieb an den unter seinem engen T-Shirt spielenden Rückenmuskeln hängen. Verdammtes Magenflattern!
Hier Frieden zu finden, war anscheinend doch schwieriger als gedacht.
2. KAPITEL
Jack Barlow war kein Mensch, der leicht etwas vergaß. Als kleiner Junge hatte seine Großmutter ihn immer mit seinem Elefantengedächtnis aufgezogen. Im Grunde genommen hatte er jedoch nur ein gutes Gespür für Details, was ihm in der Werkstatt seines Vaters beim Zusammenbauen von Motoren zugutegekommen war, und auch bei Streifgängen in Afghanistan. Dort konnte so etwas überlebensnotwendig sein.
Manchmal verfluchte er jedoch seine gesteigerte Wahrnehmung. Zum Beispiel jetzt, wo jemand irgendwo in der Straße eine Autotür zuschlug und Jack sofort zusammenzuckte. Für jeden anderen war das ein banales und alltägliches Geräusch, doch vor Jacks innerem Auge explodierte eine Granate und zerstörte die Beifahrerseite des Armeefahrzeugs und …
Eli.
Jack schloss gequält die Augen, konnte jedoch nicht die Ohren gegen Elis markerschütternde Schreie verschließen. Er sah Blut, überall Blut. Und Elis brechende braune Augen.
Verdammt.
Jack versuchte zu atmen, doch sein Herz raste so heftig, dass er kaum Luft bekam. Sein Hemd war schweißdurchnässt, und ihm war abwechselnd heiß und kalt. Die Panik schlug über ihm zusammen wie eine Welle.
Er zwang sich dazu, die zu Fäusten geballten Hände zu lockern und die Augen zu öffnen. Sein Blick fiel auf die Unterseite des Monte Carlo, die Schlangenlinien des Auspuffs, den rechteckigen Öltank. Er atmete den Geruch von Motoröl ein und spürte den harten kalten Beton unter sich. Er lauschte dem Geräusch vorbeifahrender Autos. Der Realität.
Schließlich kletterte er unter dem Wagen hervor und rieb sich die Augen. Doch immer noch lauerten die Erinnerungen im Hinterhalt wie ein Raubtier.
Seitdem er aus dem Krieg nach Hause gekommen war, hatte er nur einen Ausweg gewusst, seinen Dämonen zu entfliehen: zu arbeiten wie ein Tier, bis er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Er verbrachte seine Zeit entweder in der Werkstatt seines Vaters oder bei Ray, um sich abzulenken. Von der Vergangenheit. Von den Fehlern, die er gemacht hatte. Von seinen Schuldgefühlen.
Und jetzt auch noch von Meri.
Er hatte nicht damit gerechnet, sie wiederzusehen. Ihre Begegnung hatte ihn ganz schön verstört. Meri stand für alles, was er hinter sich lassen und vergessen wollte.
Und nicht konnte.
Wie zum Teufel sollte er ihr erzählen, was passiert war? Es war seine Aufgabe gewesen, Eli zu beschützen und zu gewährleisten, dass er gesund nach Hause zurückkehrte, und er hatte versagt. Wie sollte er Meri je in die Augen sehen und ihr das gestehen?
Es war seine Schuld, das Eli gestorben war. Niemand anders war dafür verantwortlich.
Jack griff nach einem Schraubenschlüssel und warf ihn Richtung Werkbank, doch das Werkzeug prallte davon ab und knallte ihm gegen das Schienbein. Er stieß eine Reihe von Flüchen aus, die seinen Schmerz jedoch nicht linderten.
„Wow, ich bin beeindruckt. Solche Kraftausdrücke höre ich sonst nur von dir, wenn die Yankees verlieren.“
Jack drehte sich um und griff nach einem Lappen, um sich das Öl von den Händen zu wischen und sich zu sammeln – und die Dämonen weiter in den Hinterhalt zu drängen. Sein Bruder Luke hatte soeben die Werkstatt betreten. Er sah aus, als sei er gerade vom Strand oder aus dem Urlaub oder von beidem zurückgekehrt. Sein braunes Haar hatte jenen goldenen Schimmer, der von reichlich Sonne kam. „Bist du gekommen, um mir beim Auswechseln des Getriebes zu helfen?“
Luke lachte. „Ich und arbeiten? Das widerspricht meiner Religion.“
Jack lehnte sich gegen die Werkzeugtruhe. „Seltsam, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man in der Sonntagsschule Faulheit gelernt hätte.“
„Du und Mac, ihr wart einfach zu beschäftigt damit, um die Position des Musterschülers zu konkurrieren.“ Luke griff in den kleinen Kühlschrank neben der Tür, nahm zwei Dosen Limonade heraus und warf Jack eine zu.
Jack öffnete seine und trank. „Während du immer versucht hast, dich durchzumogeln.“
Luke grinste. „Etwas, das ich inzwischen bis zur Perfektion kultiviert habe.“
Jack schnaubte verächtlich. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und stellte einen Fuß auf die vordere Stützstange des Monte Carlo von 1987. Der Wagen hatte mehr Meilen auf dem Tacho als Methusalem Kinder, aber sein Besitzer weigerte sich, ihn verschrotten zu lassen. Die Grundüberholung des Fahrzeugs brachte der Werkstatt jedoch ein hübsches Sümmchen ein. Seit der Knie-Operation seines Vaters Bobby machte Jack die ganze Arbeit – und hatte damit auch volle Verantwortung für das Einkommen von Bobby Barlow, der in etwa einer Woche aus dem Krankenhaus zurückkehren würde.
„Was hältst du davon, früher Schluss zu machen und bei Cooters ein paar Bier zu zischen?“
„Es ist drei Uhr nachmittags, Luke.“
„Umso mehr Grund zum Feiern.“ Luke zeigte mit seiner Limodose auf Jack. „Komm schon, du Workaholic. Die Welt wird nicht gleich untergehen, nur weil du den Laden mal zwei Stunden früher schließt. Außerdem habe ich gehört, dass Meri Prescott wieder in der Stadt ist.“
Jack runzelte die Stirn. „Was hat denn Meris Rückkehr damit zu tun?“
„Ihr wart doch mal ein Paar.“ Luke hob eine Augenbraue. „Und sie ist ziemlich scharf.“
„Großer Gott, Luke, jetzt hör aber auf!“ Jack warf seine leere Dose in den Müll, hob den Schraubenschlüssel auf und rutschte zurück unter den Monte Carlo. Während er eine Schraube anzog, wartete er darauf, dass sein Bruder die Werkstatt verließ. Stattdessen tauchten zwei Sneakers in seinem Augenwinkel auf.
„Willst du etwa behaupten, dass sie dich nicht interessiert?“
„Wir waren vor einer Million Jahren zusammen.“ Vor fünf, korrigierte sein Gehirn ihn. „Natürlich interessiert sie mich nicht.“
Das war gelogen. So wie er gestern bei ihrem Wiedersehen reagiert hatte und so oft er in den letzten Jahren an sie hatte denken müssen, konnte man nicht gerade behaupten, dass sie ihm egal war. Aber das spielte keine Rolle.
Denn wenn er sich auf Meri einließ, würde er ihr sagen müssen, was ihrem Cousin in Afghanistan zugestoßen war, und das brachte er nicht fertig. Himmel, er konnte der Wahrheit kaum selbst in die Augen sehen. Darüber nachzudenken, würde ihn nur in einen Abgrund stürzen, an dessen Rand er sich gerade so eben noch festklammerte. „Lass mich allein, Luke. Ich habe zu tun.“
Es dauerte eine Weile, aber schließlich verschwanden Lukes Füße aus Jacks Gesichtsfeld und dann aus der Werkstatt. Stille breitete sich in der dunklen Welt unter dem Monte Carlo aus. Jack versuchte sich einzureden, dass ihm das Frieden brachte.
Aber leider war er im Lügen genauso schlecht wie im Vergessen.
Meri parkte vor Betty’s Bakery, die sich gleich neben George’s Deli befand – zwei feste Institutionen in Stone Gap in den Händen eines Ehepaars. Jedes Mal, wenn Meri die Bäckerei und den Deli sah, musste sie an ihren wunderbaren und witzigen Cousin Eli denken, der hier jeden Sommer und an den Wochenenden ausgeholfen hatte. Sein Tod hatte eine große Lücke hinterlassen, und hier konnte Meri seine Gegenwart noch spüren.
Ihre Tante Betty – die jüngere Schwester Anna Lees und Mutter Elis – und Onkel George Delacorte liebten gutes Essen und ließen ihre Kunden, Freunde und Familie gern daran teilhaben, doch um den Ehefrieden zu wahren, achteten sie darauf, getrennt zu arbeiten. Deshalb die beiden verschiedenen Läden.
Meri stieg aus dem Wagen und betrat zuerst Bettys Bäckerei. Schon als sie die Tür öffnete, schlug ihr der Duft von frisch gebackenem Brot und Muffins entgegen. Ihr Magen begann auf sehr undamenhafte Weise zu knurren, wie ihre Mutter sagen würde. Himmel, roch das himmlisch! Für einen Moment hallte ein Das darfst du nicht in Meris Kopf wider. Wie viele Jahre hatte sie auf süße Sachen und einen Nachschlag Kohlenhydrate verzichtet?
„Na, sieh mal einer an!“ Betty kam um den Tresen herum und streckte die Arme aus, eine leuchtend rosa Schürze um die Taille. „Meri! Wie schön, dich zu sehen!“
„Ach, Tante Betty, dich auch.“ Meri erwiderte Bettys Umarmung und atmete deren Duft nach Zimt, Vanille und Heimat ein.
Meri sah sich in dem pittoresken Laden um. „Ich rechne immer noch halb und halb damit, Eli durch die Tür kommen zu sehen, wenn ich hier bin.“
„Ich auch, Süße. Gott, ich vermisse den Jungen.“ Tante Betty schüttelte den Kopf. Mit Tränen in den Augen richtete sie den Blick auf eine Zeichnung an der Wand, die Skizze eines Indigofinks, dessen Auftauchen Eli immer für ein gutes Omen gehalten hatte. Solange Meri denken konnte, hatte er Tiere skizziert. Sie hatten im Laufe der Jahre viele gemeinsame Wanderungen unternommen, sie mit ihrer Kamera, er mit seinem Skizzenblock.
„Er war mein Ein und Alles, verstehst du? Keine Mutter sollte ihren Sohn begraben müssen.“
Meri nickte. Auch sie hatte einen Kloß im Hals.
Tante Betty wischte sich die Tränen aus den Augen und bemühte sich um ein Lächeln. „So, und jetzt Schluss mit den Tränen. Eli würde sagen, ‚Mama, spar dir die Tränen für einen anderen Tag. Die Sonne scheint, das ist Grund genug zu lächeln‘.“
„Stimmt. Ich habe ihn keinen einzigen Tag deprimiert erlebt.“
Tante Betty lächelte zittrig. „Er hat allen Freude gebracht, die ihn kannten. Ich bin davon überzeugt, dass er gerade die Engel im Himmel zum Lachen bringt.“
„Kann ich mir auch gut vorstellen. Und dem Heiligen Geist spielt er bestimmt gerade einen Streich.“
Tante Betty musste lachen. „Das sähe ihm ähnlich.“ Sie hielt Meri an den Schultern von sich weg. „Wie geht es dir, mein Schatz?“
Ihre Anteilnahme trieb Meri die Tränen in die Augen. Ihre Tante wusste immer, wie es in ihr aussah, tausend Mal mehr als Anna Lee es je gewusst hatte. „Gut. Vor allem jetzt, wo ich wieder zu Hause bin.“
„Bleibst du für immer?“
Meri schüttelte den Kopf. „Nein, ich bin nur zu Besuch. Irgendwann muss ich wieder nach New York, als Fotografin arbeiten.“ Vorausgesetzt, sie überwand ihre Angst. Hoffentlich würde ihre Rückkehr den Zauber zurückbringen, den sie beim Fotografieren immer empfunden hatte.
„Ich habe ein paar deiner Fotos in einem Magazin gesehen. Eli hat sie mir gemailt. Du hast wirklich ein erstaunliches Talent, Meri.“
„Eli hat dir Fotos von mir gezeigt?“
„Natürlich. Er war total stolz darauf, dass seine Cousine die große Stadt im Sturm erobert hat. Er hielt dich für den nächsten Ansel Adams, und ich finde, er hatte recht.“
Meri umarmte ihre Tante. „Danke, Tante Betty. Dein Lob bedeutet mir sehr viel.“
Die unausgesprochene Botschaft war nicht zu überhören – dass Anna Lee vermutlich nur auf dem Sterbebett so etwas wie ein Lob von sich geben würde. Meri fragte sich oft, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn Tante Betty und Onkel George ihre Eltern wären.
Betty schien ihre Gedanken zu erraten. „Ich habe gehört, dass du bei Ray im Gästehaus wohnst. Deine Mutter ist deswegen völlig entsetzt. Sie findet, ich zitiere, dass du ‚den guten Namen der Familie beschmutzt‘, indem du ihre Gastfreundschaft ablehnst.“
„Ich habe nichts abgelehnt, sondern einfach nur eine andere Entscheidung getroffen.“
Betty nahm Meris Gesicht in die Hände. Im Gegensatz zu Anna Lee schreckte sie nicht vor Meris Narbe zurück. Sie schien sie kaum wahrzunehmen. „Das war eine gute Entscheidung. Lass dich nicht von meiner Schwester herumkommandieren, das hat sie weiß Gott lange genug getan.“
Meri drückte Betty wieder an sich. „Danke, Tante Betty.“
„Gern geschehen.“ Betty ging zurück hinter den Tresen und füllte eine weiße Schachtel mit vier Muffins. „Lass mich raten. Du bist wegen Rays täglicher Muffin-Ration hier?“
„Stimmt. Ich gehe gleich noch zu Onkel George rüber, um Grandpas Lieblingssandwich zu holen.“
Betty klappte den Deckel zu und umwickelte die Schachtel mit einem roten Faden. „Und was willst du für dich?“
„Ach, lieber nichts.“ Die Antwort kam wie ein Pawlowscher Reflex.
„Gönn dir ruhig etwas. Und fang jetzt nicht an, mir einen Vortrag über Kalorien zu halten. Essen ist zum Genießen da, nicht, um ignoriert zu werden.“ Betty reichte Meri einen Schokoladen-Cupcake mit rosa Zuckerguss. „Cupcakes sind wie gute Männer. Wenn du nicht aufpasst, schnappt sie dir jemand vor der Nase weg.“ Sie wedelte damit vor Meris Nase herum. „Komm schon, beiß rein, nur einmal.“
Meri nahm den Cupcake und atmete genießerisch den köstlichen Duft von Schokolade und Himbeerguss ein. Sie zögerte einen Moment, bevor sie seufzend hineinbiss. Der Zuckerguss bröckelte auf ihren Lippen, und Schokoladenkrümel fielen ihr übers Kinn. Es schmeckte wie der Himmel auf Erden. Sie wollte gerade ein zweites Mal reinbeißen, als die Türglocke klingelte.
Und Jack Barlow die Bäckerei betrat.
Sie drehte sich zu ihm um, den Cupcake in einer Hand und Zuckerguss auf den Lippen. Als er ihren Blick auffing, spürte sie wieder jene Verbindung von gestern zwischen ihnen. Sein Auftauchen weckte Erinnerungen in ihr.
Jack, wie er sie am Tag vor einem Schönheitswettbewerb mit einem Cupcake in Versuchung geführt hatte, indem er ihr sagte, dass der Kuchen jeden Bissen wert war. Sie hatte sich geweigert, obwohl sie von Kopf bis Fuß vor Verlangen nach ihm und der Schokolade gezittert hatte – nach allem, was sie sich jahrelang verwehrt hatte. Er hatte ihr etwas Zuckerguss auf die Lippen geschmiert, und sie hatte ihn geschmeckt … und hinterher Jack. Unter seinem Blick war der Kuchen schlagartig vergessen gewesen.
Er war derjenige, der sich an jenem Tag zurückgezogen und ihr gesagt hatte, dass sie recht hatte und sich auf ihren Schönheitswettbewerb vorbereiten musste. Schon damals, eine Woche vor der Trennung, hatte er sich von ihr abgegrenzt.
Als er Bettys Gruß erwiderte, huschte ein Schatten über sein Gesicht.
„Was machst du hier?“, fragte Meri, bekam jedoch keine Antwort. Typisch Jack. Er hatte ihr noch nie anvertraut, was in ihm vorging.
„Du bist ja noch da“, sagte er.
Seine Bemerkung irritierte sie. „Ich bin gerade erst gekommen, Jack. So schnell reise ich nicht wieder ab.“
„Gut.“
Dieser Kommentar überraschte sie. „Warum sagst du das?“
„Weil Ray nie zugeben würde, dass er eine Glucke braucht, aber so ist es. Und niemand kommandiert ihn besser herum als du.“
„Willst du mir damit etwa unterstellen, dominant zu sein?“
Er grinste schief. „Süße, du warst schon immer dominant.“
So gedehnt, wie er „Süße“ sagte, wurde Meri ganz heiß. Unwillkürlich musste sie an die warmen Sommernächte denken, die sie früher zusammen verbracht hatten … und in denen die Versuchung ihr ständiger Begleiter gewesen war.
„Wie ich sehe, stehst du immer noch auf Cupcakes“, sagte er und ging einen Schritt auf sie zu.
Meri bekam weiche Knie. Himmel, an liebsten wäre sie in seinen blauen Augen versunken. Aber sie wusste aus Erfahrung, wie es ausgehen würde, wenn sie sich wieder in ihn verliebte. Er hatte ihr vor acht Jahren mehr als deutlich gesagt, was er von ihr hielt.
Sie stellte den Cupcake auf den Tresen zurück und wischte sich den Zuckerguss von den Lippen. Sie war nicht nach Stone Gap zurückgekommen, um Jack zu beweisen, dass sie sich verändert hatte, sondern um dafür zu sorgen, dass Grandpa Ray wieder gesund wurde. Außerdem hatte sich alles, was sie je für Jack Barlow empfunden haben mochte, damals in der Werkstatt in Luft aufgelöst. Unwiderruflich. „Ich stand noch nie auf Cupcakes“, erwiderte sie kühl. „Ich habe das nur geglaubt.“
Jack rannte durch die Seitenstraßen von Stone Gap. Er schwitzte unerträglich in der Hitze des späten Nachmittags, verlangsamte sein Tempo jedoch nicht. Sein tägliches Jogging hielt seine Dämonen in Schach, also rannte er und rannte, bis er völlig erschöpft und dehydriert war.
Was hatte er sich nur dabei gedacht, gestern Bettys Bäckerei aufzusuchen? Hatte er wirklich geglaubt, diesmal endlich den Mut aufzubringen, mit der Wahrheit herauszurücken? Fast jede Woche machte er einen Abstecher zu Betty oder George, doch jedes Mal blieben ihm die Worte im Hals stecken.
Und Meris Anblick mit Zuckerguss auf den Lippen hatte ihm den Rest gegeben. Für einen Augenblick hatte er sich gefühlt wie mit achtzehn, halb und halb in sie verliebt und ein wundervolles Leben vor sich. Bis er in den Krieg gezogen war und eines Besseren belehrt worden war.
Bei seiner Rückkehr nach Hause sah er Luke auf seiner Veranda sitzen. „Du siehst aus, als würdest du gleich zusammenklappen.“
Keuchend beugte Jack sich vor und stützte die Hände in die Knie. „Mir geht’s gleich wieder gut.“
Verächtlich schnaubend stand Luke auf und hielt Jack seine Wasserflasche unter die Nase. „Hier, du hast es nötiger als ich.“
Jack bedankte sich und stürzte das eiskalte Getränk herunter. „Was machst du hier? Nicht dass ich mich nicht über das Wasser freue, aber du tauchst jetzt schon zwei Tage nacheinander bei mir auf. So oft habe ich dich noch nicht mal gesehen, als wir noch unter einem Dach gewohnt haben.“
Luke zuckte die Achseln. „Mama macht sich Sorgen um dich. Mac ist in der großen Stadt, tut so, als würden wir nicht existieren und arbeitet sich die Finger wund. Ich bin der Einzige, der sich um dich kümmern kann.“
Diesmal war Jack an der Reihe, verächtlich zu schnauben. Er leerte die Flasche, verschloss sie und warf sie in den Recycling-Behälter. „Ich muss jetzt arbeiten.“
Luke trat ihm in den Weg. „Versprich mir, dass du Sonntagabend zum Essen kommst. Mama hat gesagt, dass sie sich uns beide vorknöpft, wenn du ablehnst.“
„Erstens hat sie uns noch nie angerührt, und zweitens kann ich sehr gut allein meine Mahlzeiten einnehmen. Auf Familienidylle kann ich gut verzichten.“
Luke stieß Jack an. „Was ist eigentlich mit dir los? Es kann doch nicht sein, dass du lieber ein Fertiggericht vor dem Fernseher isst als hausgemachten Braten!“
„Was geht dich das überhaupt an?“ Jack schüttelte den Kopf. „Ich bin beschäftigt, Luke. Ich muss in die Werkstatt.“
Luke blieb eine Weile zögernd stehen. Anscheinend gingen ihm die Argumente aus. Ein Teil von Jack wünschte sich, mit Gewalt zu seinen Eltern gezerrt zu werden. Unter anderen Menschen zu sein, würde seine Dämonen vielleicht im Zaum halten. Oder sie entfesseln. Und dann würde er das einzig Gute ruinieren, das ihm noch geblieben war.
„Na schön, ganz wie du willst“, sagte Luke. „Viel Spaß mit deinen Fertiggerichten.“
Nachdem sein Bruder gegangen war, betrat Jack das kleine Häuschen am Stone Gap Lake, das er nach seiner Rückkehr aus dem Krieg gemietet hatte. Es war nichts Besonderes, aber es lag im Wald am Ende einer einsamen Straße, nur eine Meile Luftlinie von Ray entfernt. Wenn Jack nämlich auf eins verzichten konnte, dann auf gesellige und neugierige Nachbarn, die sich ihm aufdrängten.
Als er einen Wagen näher kommen hörte, ging er zurück auf die Veranda und legte sich eine sarkastische Bemerkung für Luke zurecht, doch die Worte erstarben ihm auf den Lippen, als er Meri hinterm Steuer eines staubigen Toyota sitzen sah. Eine Sonnenbrille verbarg ihre grünen Augen, und sie trug das Haar in einem Pferdeschwanz. Sie bremste in der Einfahrt und kurbelte ein Fenster herunter.
„Ich brauche deine Hilfe. Grandpa Ray will die Regenrinnen säubern und weigert sich, auf dich zu warten. Er lässt mich noch nicht mal in die Nähe der Leiter. Ich habe Angst, dass er sich verletzt.“
Jack fluchte. „Ich habe ihm doch gesagt, dass ich das heute Abend nach der Arbeit erledige.“
„Du kennst ihn ja. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, dann muss es sofort passieren.“ Sie schob die Sonnenbrille hoch und sah Jack bittend an. „Würdest du mir helfen? Ich meine, natürlich nur, falls du nicht beschäftigt bist oder so …“
„Ich bin nicht beschäftigt.“ Zumindest nicht beschäftigt genug. Wenn es nach ihm ginge, konnte er gar nicht genug zu tun haben. Außerdem brauchte Ray ihn, und wenn es einen Menschen gab, dem Jack ohne zu zögern half, dann ihm.
Als er Meris flehentlichen Blick sah, so als lege sie ihre ganze Hoffnung in ihn, hätte er ihr am liebsten gesagt, dass sie sich jemand anderen suchen sollte. Doch stattdessen hörte er sich hinzufügen: „Gib mir fünf Minuten zum Duschen.“
„Natürlich. Danke, Jack.“
Er drehte sich um, blieb dann jedoch stehen, als ihm die Manieren einfielen, die seine Mutter ihm eingebläut hatte. „Äh, willst du vielleicht reinkommen? Einen Eistee trinken oder so? Du solltest nicht in dieser Hitze im Auto sitzen bleiben.“
Meri zögerte einen Moment. Anscheinend wog sie den Nachteil, in der Hitze zu schmoren, gegen den seiner Nähe ab. „Ist der Eistee gesüßt?“
Er grinste. „Gibt es einen anderen?“
Sie stieg aus dem Auto, ein langes Bein nach dem anderen. Mit ihren abgeschnittenen Bluejeans, Flip Flops und dem T-Shirt mit V-Ausschnitt wirkte sie erotischer als in den eleganten Kleidern, die sie bei ihren Schönheitswettbewerben immer getragen hatte. Sie sah mehr … wie sie selbst aus, so albern das auch klang. Authentischer irgendwie. Hübscher.
Verdammt!
All die Jahre, und er begehrte sie noch genauso wie damals.
Vor fünf Jahren war er noch jung und dumm gewesen, voll von einem grenzenlosen Optimismus. Ein paar Scherze und ein Kuss von Meri, und die Welt war für ihn in Ordnung gewesen.
Inzwischen wusste er es besser. Er hatte schreckliche Erfahrungen gemacht, schlechte Entscheidungen getroffen und wurde von einer Reue gequält, die ihn innerlich auffraß. Also wandte er den Blick von Meris Beinen und ihrem Lächeln ab und ging ins Haus.
„Die Küche ist da drüben“, sagte er schroff und zeigte den Flur entlang. „Ich bin in ein paar Minuten fertig.“
Erst als er unter der kalten Dusche stand, konnte er wieder durchatmen. Er presste die Hände gegen die Wand, senkte den Kopf und ließ sich das Wasser über den Körper strömen, bis ihm eiskalt war.
Er trat aus der Dusche, trocknete sich ab und öffnete eine Schublade. Fast leer. Er musste dringend mal wieder Wäsche waschen. Er griff nach einem schäbigen T-Shirt, erstarrte jedoch in der Bewegung, als sein Blick auf ein abgetragenes Khaki-T-Shirt fiel, das ganz unten im Stapel lag. Er hatte es ganz vergessen.
Erinnerungen überwältigten ihn. Plötzlich wusste er wieder genau, warum er ein Haus am See gemietet hatte, weit weg vom Rest der Welt.
Und von Menschen wie Meri.
Fluchend griff er nach dem erstbesten Shirt und knallte die Schublade zu, bevor er sich anzog und sein Schlafzimmer verließ. Er nahm sich vor, Ray zwar zu helfen, sich aber von Meri fernzuhalten. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, war ein Gespräch mit ihr. Vor allem eins über Eli.
Die letzte Monate in Afghanistan hatte er nur wie auf Autopilot überstanden, eine bloße Hülle seiner selbst. Nach seiner Rückkehr nach Hause hatte er versucht, den Rat seines Psychologen zu befolgen, alles hinter sich zu lassen und neu anzufangen.
Der Mann hatte gut reden! Wie denn?
Als er seine Küche betrat, stand Meri mit dem Rücken zu ihm in der Hintertür und blickte hinaus in den Garten, ihre Silhouette leuchtete schlank in der hineinströmenden Sonne. Jacks Herz machte bei ihrem Anblick einen Satz. Er unterdrückte den Impuls, sie zu berühren. „Wollen wir los?“
Lächelnd drehte sie sich zu ihm um. „Da draußen steht ein Reh“, flüsterte sie ehrfürchtig. „Ein Kitz.“
Er stellte sich neben sie. Ein Rehkitz stand zwischen den Bäumen. Es hatte gesprenkeltes Fell und knabberte völlig entspannt an den Zweigen. Anscheinend wusste es noch nichts von den Gefahren, die im Wald lauerten.
„Ist es nicht wunderschön?“, fragte Meri.
„Es ist zu vertrauensvoll. Wenn es nicht aufpasst, wird es ein Jäger oder ein frei laufender Hund töten.“
Meri warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. „Du bist ja ganz schön pessimistisch.“
„Ich bin nur Realist, Meri.“ Er nickte Richtung Kitz. „Ich wundere mich, dass du deine Kamera nicht schon gezückt hast. Du hast früher ständig Fotos gemacht.“
Sie wirkte plötzlich ganz verschlossen. „Lass uns einfach den Augenblick genießen, okay?“, sagte sie achselzuckend.
Jack beschlich der Verdacht, dass sich hinter ihren Worten ein paar Geheimnisse verbargen. Früher hätte er nachgehakt, aber heute ließ er solche Bemerkungen auf sich beruhen. Schließlich hatte er selbst keine Lust auf neugierige Fragen.
3. KAPITEL
Während Grandpa Ray und Jack die Regenrinne säuberten, blieb Meri blieb im Haus, um Rays Küche zu putzen. Zumindest redete sie sich das ein. Ihr Blick wanderte nämlich immer wieder nach draußen, wo die beiden Männer entspannt Seite an Seite arbeiteten. Gandpa Ray übernahm den Großteil des Redens, Jack die meiste Arbeit. Meri fiel auf, dass er sich immer wieder unauffällig um Grandpa kümmerte, indem er ihm zum Beispiel schwere Gegenstände abnahm und dafür sorgte, dass er sich öfter hinsetzte.
Der Jack, den sie als Teenager gekannt hatte, war ein wilder Rebell gewesen, der jegliche Verantwortung gescheut hatte. Er war so ganz anders gewesen als sie – mutig und impulsiv. Sie war zum Teil deshalb mit ihm zusammen gewesen, weil sie ihn bewundert und gehofft hatte, dass etwas von ihm auf sie abfärben würde. Dass sie vor allem im Umgang mit ihrer Mutter von ihm profitieren würde. Aber dieser Jack hier, verändert durch den Krieg, wirkte in sich gekehrt und verschlossen. Er strahlte etwas Abweisendes aus. Was wohl dahintersteckte?
Als sie mit der Küche fertig war, machte sie eine Einkaufsliste und griff nach ihrer Handtasche. Sie versuchte, den Gedanken an ihre Kamera zu verdrängen, die sie seit Monaten nicht angerührt hatte. Sie wollte auch nicht an das Jobangebot bei einem Reisemagazin denken. Schon die bloße Vorstellung, wieder zu fotografieren, machte ihr Panik. Nur deshalb flüchtete sie sich in andere Aktivitäten – wie abwaschen, putzen und Listen erstellen.
Sie ging um das Haus herum und fand Grandpa Ray und Jack am Picknicktisch im Schatten. „Ich fahre kurz Lebensmittel einkaufen, Grandpa.“
„Ich habe doch genug im Haus.“
„Trockenfleisch ist nicht gesund. Genauso wenig wie Sprühkäse.“
„Was soll ich sagen? Ich hab’s eben gern einfach.“ Grandpa Ray zuckte die Achseln. „Ich kann nicht kochen.“
Meri lachte. „Gut, dass ich jetzt da bin. Ich werde dir viele gesunde Gerichte kochen, damit es dir bald wieder besser geht. Und Frittiertes ist in Zukunft tabu, Widerstand zwecklos.“
„Abwarten. Wenn du mich fragst, schmeckt im Teigmantel alles besser. Aber wenn du schon mal einkaufst, bring dem Jungen hier was mit.“ Grandpa Ray legte einen Arm um Jacks Schultern. „Er verhungert sonst noch, so ganz allein da draußen am See. Außerdem schulde ich ihm mindestens eine Mahlzeit für seine Hilfe heute.“
„Das war doch nicht der Rede wert, Ray, wirklich.“ Jack stand auf. „Ich muss sowieso noch zum Baumarkt, um ein neues Stück Regenrinne zu besorgen.“
„Fahrt doch zusammen, das spart Benzin. Außerdem habe ich dann zumindest für eine Weile vor euch beiden Ruhe“, fügte er grinsend hinzu.
„Also, das ist wirklich nicht nötig …“
„Nein, ist schon okay…“
„Ihr seid beide so stur wie zwei Ziegen in einem Gemüsebeet.“ Ray nahm Meri ihre Autoschlüssel aus der Hand und steckte sie in die Hosentasche. „So. Jetzt bleibt dir nichts anderes übrig, als mit Jack zu fahren.“
Jack stieß einen leisen Fluch aus. „Ich muss erst was ausmessen.“ Er marschierte zur improvisierten Werkbank – einem Brett auf zwei Holzböcken – und griff nach einem Stück Rinne und einem Zollstock. Er war jedoch zu hastig, sodass das Stück Rinne ihm aus der Hand glitt. Ein hässlicher roter Riss klaffte in seiner Handfläche. Fluchend presste er den Saum seines T-Shirts dagegen. „Hast du vielleicht ein Pflaster, Ray?“
„Ein Pflaster? Der Arm muss abgebunden werden, und dann muss sich jemand die Wunde angucken.“
Jack schüttelte den Kopf. „Halb so wild.“
Meri kannte den sturen Gesichtsausdruck. Jack würde sich eher die Hand abfaulen lassen, als um Hilfe zu bitten. Entschlossen ging sie auf ihn zu und nahm seine Hand, bevor er protestieren konnte. „Lass mich mal sehen.“
„Ich …“
„Du blutest wie ein abgestochenes Schwein. Ich hol mal den Verbandskasten.“ Sie presste wieder sein Shirt auf die Wunde. „Halt fest und beweg dich nicht.“
„Ja, Ma’am.“ Ein Grinsen huschte über sein Gesicht, verschwand jedoch rasch wieder.
Ihr stockte der Atem. Schlagartig vergaß sie, warum sie sich nicht mehr zu ihm hingezogen fühlte. Verdammt!
Sie eilte ins Haus, durchsuchte den Medizinschrank und ging zurück nach draußen. Jack hatte Wort gehalten und war immer noch an Ort und Stelle. Sie wickelte den Gartenschlauch auf, stellte das Wasser an und wartete auf den kühlen Wasserstrahl. „Komm her. Wir müssen die Wunde zuerst auswaschen.“
Als das Wasser seine Hand berührte, japste Jack auf.
Meri schmunzelte. „Jetzt sag bloß, ein Mann, der in einem der gefährlichsten Länder der Welt gekämpft hat, hat Angst vor ein bisschen Wasser!“
„Hey, das brennt wie Feuer!“
„Du wirst es überleben.“
„Wie du meinst. Aber beeil dich und amputier mir nicht die Hand, Mutter Teresa.“
Sie tupfte ihm die Handfläche mit einem sauberen Tuch ab und bat ihn, Druck auf die Wunde auszuüben. „Rate mal, wann ich mein erstes Hilfeabzeichen bei den Pfadfinderinnen bekommen habe. Beim zweiten Anlauf.“
Er lachte. „Wie tröstlich.“
„Keine Bange, ich krieg das schon hin. Nur wenn du dir ein Bein brichst, kann ich dir nicht helfen.“
„Hey, dann mach ich einfach eine Schiene aus zwei Zweigen und einem Stück Efeu, kein Problem.“
Lächelnd sah sie zu ihm auf. Sie fühlte sich plötzlich wieder in die Vergangenheit zurückversetzt. „Erinnerst du dich noch an das Vogelbaby?“
Ein kleines Rotkehlchen war damals aus dem Nest gefallen, hatte sich dabei einen Flügel verletzt und war panisch im Kreis herumgehüpft. Meri war mit ihm zu dem einzigen Menschen gegangen, der in ihren Augen damals alles hatte wiedergutmachen können – Jack.
„Ja. Ich weiß noch, wie du tränenüberströmt damit ankamst und mich angefleht hast, den Flügel zu richten.“ Jack strich ihr das Haar aus der Stirn.
Meris Haut kribbelte unter seiner Berührung. Sie schwankte ein bisschen in seine Richtung, sah nur noch Jacks blaue Augen, hörte seine gleichmäßigen Atemzüge …
„Du hattest schon immer ein Herz für hoffnungslose Fälle, Meri.“
Hoffnungslose Fälle? Oh ja, damit kannte sie sich aus. Aber sie war inzwischen klüger geworden, war nicht mehr das dumme Mädchen, das noch an Märchen glaubte.
„Das ist vorbei.“ Sie senkte den Blick zu Jacks Hand, um die Tränen zu verbergen, die ihr in die Augen schossen. Sich räuspernd nahm sie das Tuch weg, um die Wunde zu desinfizieren. „Halt still, Jack.“
Seine große kräftige Hand fühlte sich fest und warm in ihrer an. Sie hätte sie nur zu gern auf ihrer nackten Haut gespürt. Vor langer Zeit hatte er sie mit seinen Berührungen zum Seufzen und Stöhnen gebracht, fast zum Weinen vor Ungeduld. Verdammt, wieso kam das alles wieder hoch? Wegen der Erinnerung an ein verletztes Vogelbaby?
„Also … ich verbinde das hier jetzt. Mit etwas … also …“ Hilflos hielt sie den Verbandskasten hoch.
„Mit Klebeband?“, half er ihr auf die Sprünge.
„Ja, genau.“ Sie drückte eine Kompresse gegen Jacks Wunde und ließ seine Hand los, um lange Streifen Klebeband abzureißen. Sie schlang sie ihm um die Hand, um die Kompresse zu fixieren. „So, fertig. Jetzt bist du so gut wie neu.“
„Ich werde nie wieder neu sein. Zu viele Wunden.“ Sein Mund lächelte, doch sein Blick war ernst. Wieder sah Meri jenen Schatten über sein Gesicht huschen, einen Schmerz, den sie bei ihm nicht kannte.
„Wir sollten jetzt einkaufen fahren.“ Sie ließ seine Hand los und räumte den Verbandskasten ein, bevor sie Jack womöglich noch fragte, was ihn so verändert hatte. Oder sich Rechenschaft darüber ablegen musste, warum sie das überhaupt interessierte.
Jack sträubte sich mit Händen und Füßen gegen den Arztbesuch. Auf dem Weg in die Stadt versicherte er Meri immer wieder, dass es ihm gut ging, ausgezeichnet sogar, aber sie hatte das durch die Kompresse dringende Blut gesehen und darauf beharrt, dass die Wunde genäht werden musste.
„Komm schon“, drängte sie ihn. „Ich habe mit der Empfangsdame gesprochen, und sie hat gesagt, dass wir gleich drankommen.“
„Mit mir ist alles in Ordnung, Meri.“
Streng sah sie ihn an und zog ihn aus dem Wagen zu Doc Malloys Praxis. „Lass das den Fachmann entscheiden.“
Jack blieb einen Moment in der Tür der Praxis stehen und wartete, bis seine Augen sich an das dämmrige Innere gewöhnt hatten. Meri hatte ihn wieder losgelassen. Aus irgendeinem Grund, über den er lieber nicht nachdenken wollte, empfand er das fast so wie einen Verlust.
Nachdem ihm die Sprechstundenhilfe den Blutdruck gemessen und das Herz abgehört hatte, betrat Doc Malloy das Behandlungszimmer. „Hallo, Jack“, sagte er. „Lange nicht gesehen.“
Jack schüttelte dem älteren Arzt die Hand. Er kannte Doc Malloy schon sein ganzes Leben lang, und bis auf ein paar Pfund mehr und ein paar weiße Strähnen im Haar sah der Arzt genauso aus wie damals, als er Jack seine erste Impfung gegeben hatte. „Schön, Sie wiederzusehen, Sir.“
Doc Malloy zeigte auf Jacks verbundene Hand. „Wo liegt das Problem?“
„Ach, es ist nichts weiter. Meri dachte …“
„Meri Prescott? Sie ist wieder hier?“
Jack nickte. Hoffentlich verwickelte der Doc ihn jetzt nicht in ein längeres Gespräch über Meri. Jack wollte nicht mehr als unbedingt nötig über sie nachdenken … was ihm in den letzten Tagen etwa alle fünf Sekunden passierte. „Sie glaubt, die Wunde muss genäht werden.“
„Wenn ich in dreißig Jahren Ehe eins gelernt habe, dann, dass Ihre Frau immer recht hat.“ Doc Malloy grinste. „Geben Sie ihr auch dann recht, wenn Sie glauben, dass sie unrecht hat. Ist sie glücklich, sind Sie es auch.“
„Also … Meri und ich sind nicht … sie ist nicht …“, stammelte Jack verlegen. Was ist bloß los mit mir? „Sie besucht hier nur ihren Großvater.“
Doc Malloy beugte sich vor und inspizierte Jacks Verletzung. Wie sich herausstellte, hielt er ein paar Stiche ebenfalls für angebracht.
„Da, jetzt sind Sie so gut wie neu“, sagte er, als er mit dem Nähen fertig war.
Meri hatte vorhin fast das Gleiche gesagt. Dachten die Leute wirklich, ein Verband oder ein paar Stiche würden alles wieder in Ordnung bringen?
„Ich habe in den letzten Jahren so viele Verletzungen gehabt, Doc, da werde ich nie wieder so gut wie neu.“ Es waren nicht die äußerlichen Wunden, die Jack meinte – die waren längst verheilt –, sondern seine Schuldgefühle, die er wie eine schwere Bürde mit sich herumschleppte. Er war derjenige, der auf seiner hinteren Veranda sitzen und den schönen See betrachten, die Sonne genießen und die frische klare Luft einatmen konnte. Eli nicht. Wegen Jacks Entscheidungen. Jacks Fehlern.
Doc Malloy legte eine Hand auf Jacks Arm. „Wissen Sie, wie man Stahl härtet? Man bringt ihn immer wieder zum Schmelzpunkt und lässt ihn wieder abkühlen, bis er so hart ist, dass fast nichts und niemand ihn brechen kann. Bei Menschen ist das genauso. Sie durchleiden Tragödien, Schmerz und Verluste, doch am Ende gehen sie stärker daraus hervor.“
„Aber manchmal ist der Druck so groß, dass sie zerbrechen.“
„Menschen? Oder Stahl?“
„Ist doch egal, Doc.“ Jack glitt von der Liege und ging zur Tür. „Danke hierfür.“
„Ich bin nur für die Heilung äußerer Wunden zuständig, Jack. Innere muss jeder selbst heilen.“
Jack nickte nur und ging ins Wartezimmer, wo Meri ein Magazin las, den blonden Kopf über die Hochglanzseiten gebeugt. Ihr Haar schimmerte in der Sonne wie ein Heiligenschein.
Als sie hochblickte und bei seinem Anblick lächelte, verspürte Jack einen Stich in seiner Brust, der sich fast so wie Hoffnung anfühlte. Für einen Moment war er wieder der Junge von damals – bis ihr Lächeln erlosch. Geschäftig legte sie das Magazin weg und holte seine Autoschlüssel aus ihrer Handtasche. „Fertig?“
„Ja.“
Gemeinsam traten sie hinaus in den Sonnenschein. Meri schloss den Truck auf, setzte sich hinters Steuer und wartete, bis Jack eingestiegen war. „Hol du doch schon mal alles, was du brauchst, und ich fahre inzwischen zum Supermarkt“, schlug sie vor, als sie beim Baumarkt ankamen. „Zwei Fliegen mit einer Klappe.“
An jedem anderen Tag hätte Jack sich über die Gelegenheit gefreut, in Ruhe im Baumarkt herumstöbern zu können, doch zu seiner Überraschung hob er seine verbundene Hand und lächelte Meri mitleidheischend an. „Also, ich weiß nicht, ob ich hiermit tragen kann. Die Wunde könnte wieder aufplatzen und sich infizieren. Und dann muss die Hand womöglich noch amputiert werden.“
Lachend schüttelte sie den Kopf. „Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine Dramaqueen bist?“
„Ich will nur weitere Verletzungen vermeiden.“ Er lächelte wieder mitleidheischend. „Wenn du mich in den Baumarkt begleitest, verspreche ich dir auch, mich nachher nicht zu beklagen, wenn du Müsli einkaufst.“
Sie sah ihn aus schmalen Augen an. „Schmerzt deine Hand tatsächlich so schlimm?“
„Der Schnitt war wirklich tief. Doc Malloy hat gesagt, ich hätte fast einen wichtigen Nerv beschädigt.“ Okay, das stimmte zwar nicht, aber Jack fand, dass etwas Mitleid von Meri die kleine Notlüge wert war.
„Na gut. Aber nur, wenn du mir eins versprichst: Kein stundenlanges Sabbern vor den Elektrowerkzeugen.“
„Was die Dauer angeht, kein Problem, aber das mit dem Sabbern? Da kann ich dir nichts versprechen.“
Zumindest nicht, was Meri betraf. Jacks Hormone verdrängten offensichtlich seine Vernunftentscheidung, sich so konsequent wie möglich von ihr fernzuhalten.
Meri stieg aus dem Truck und ging ihm voran in den Baumarkt. Als sich die Glastür hinter ihr schloss, fiel Jacks Blick auf sein Spiegelbild. Er war unrasiert, hatte einen Riss im Ausschnitt seines T-Shirts und ein Loch in einem Knie seiner Jeans. Aber wie Doc Malloy schon gesagt hatte – diese äußerlichen Makel maskierten nur den Schaden darunter.