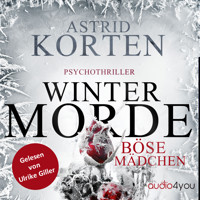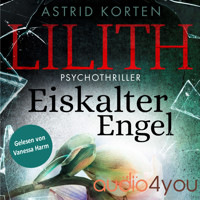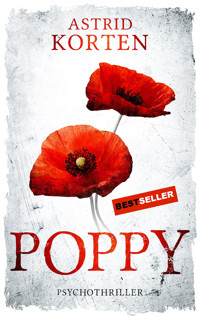4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
„Geh auf das Böse zu. Friss seine Seele.“ Ein grausames Experiment. Ein Psychopath von sibirischer Kälte Ein Häftling und die Behandlung des Bösen Ein Ermittler - am Rande des Wahns. Eine Obsession mit verheerenden Folgen. Moira Becker, Leiterin einer Forensischen Strafanstalt in Berlin, plant eine neue Behandlungsmethode an psychisch-kranken Straftätern. Die Verhandlung über die Bedingungen der Studie wird jedoch jäh unterbrochen, als sie einen Anruf vom Tod ihres Vaters erhält. Parallel erschüttert ein bestialischer Mord die Bundeshauptstadt. Nach der Beerdigung ihres Vaters beginnt Moira mit der Behandlung von Martin Simon, ein psychopathischer Häftling. Danach geschehen seltsame Dinge. Nicht nur Moira, sondern auch ihr siebenjähriger Sohn Josh und Tom, ihr Ehemann und Ermittler beim BKA, geraten ins Visier eines bestialischen Psychopathen von sibirischer Kälte: Janus. Als Moira im Nachlass ihres Vaters einen Hinweis auf ihre wahre Identität findet, bestimmen Gewalt und Tod Moiras Leben ... Ein spannender, hochbrisanter Thriller über eine Behandlung des Bösen mit erschütternden Folgen und eine Familie im Visier eines eiskalten Psychopathen. Ein Thriller - so böse, dass das Blut in den Adern gefriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Verräter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Epilog
Danksagung und Anmerkungen
Impressum
DIE BEHANDLUNG DES BÖSEN
Astrid Korten
Über das Buch
„Geh auf das Böse zu. Friss seine Seele!“
Ein grausames Experiment.
Ein Psychopath von sibirischer Kälte
Ein Häftling und die Behandlung des Bösen
Ein Ermittler - am Rande des Wahns.
Eine Obsession mit verheerenden Folgen.
Moira Becker, Leiterin einer Forensischen Strafanstalt in Berlin, plant eine neue Behandlungsmethode an psychisch-kranke Straftäter. Die Verhandlung über die Bedingungen der Studie wird jedoch jäh unterbrochen, als sie einen Anruf vom Tod ihres Vaters erhält. Parallel erschüttert ein bestialischer Mord die Bundeshauptstadt.
Nach der Beerdigung ihres Vaters beginnt Moira mit der Behandlung von Martin Simon, ein psychopathischer Häftling. Danach geschehen seltsame Dinge. Nicht nur Moira, sondern auch ihr siebenjähriger Sohn Josh und Tom, ihr Ehemann und Ermittler beim BKA, geraten ins Visier eines bestialischen Psychopathen von sibirischer Kälte: Janus. Als Moira im Nachlass ihres Vaters einen Hinweis auf ihre wahre Identität findet, bestimmen Gewalt und Tod Moiras Leben ...
Ein spannender, hochbrisanter Thriller über eine Behandlung des Bösen mit erschütternden Folgen und eine Familie im Visier eines eiskalten Psychopathen.
Ein Thriller - so böse, dass das Blut in den Adern gefriert.
Verräter
„Eine Nation kann ihre Narren und sogar ihre ehrgeizigsten Bürger überleben. Aber sie kann nicht den Verrat von innen überleben. Der Verräter arbeitet darauf hin, dass die Seele einer Nation verfault. Er infiziert den politischen Körper der Nation, bis dieser seine Abwehrkräfte verloren hat. Fürchtet nicht so sehr den Mörder. Fürchtet den Verräter. Er ist die wahre Pest!“
Marcus Tullius Cicero, 34 v.Chr.
Kapitel 1
Psychiatrische Klinik Auxillium Reos, Weichzelle 3c
Projektnummer 27: Martin Simon, Insasse
Der Raum war klein und niedrig, die mit Schaumstoff ausgekleideten Wände mit einer festen Kunststofffolie überzogen. Sie erinnerten ihn an eine mit Laub überwucherte Steppdecke. Auch der Boden war aus gummiähnlichem, dunklem Weichmaterial, selbst das Bett und der Stuhl, auf dem er saß. Es roch nach verfaultem Laub, nach Tod, und es war dunkel. So dunkel, dass jeder, der sich hier aufhielt, Angst haben sollte. Aber die hatte er auf dem Stuhl nie.
Martin Simon war sich sicher, dass die Schwärze eines Tages vorübergehen würde und dass irgendwo in dieser engen, kleinen Weichzelle eine Tür war, vielleicht zwischen den Fugen der gepolsterten Quadrate, ein Wurmloch, das zu einem Zufluchtsort führte, an dem er wieder atmen konnte.
Er tastete blind umher, denn er war sich sicher, der Ausgang musste hier irgendwo sein. Er musste nur lange genug auf dem Stuhl an der Wand ausharren und in die Dunkelheit starren. Irgendwann würden sich die Fugen öffnen und dahinter eine Tür freigeben, die in einen winzigen Gang führte. Er hatte sie schon einmal gesehen. Doch sobald er seine Erinnerungen aufrufen wollte, wo denn nun diese Tür war, lösten sich die Bilder immer genau in diesem Augenblick auf. Die Halluzination verschwand zusehends. Doch etwas anderes trat an ihre Stelle: Ein Atemhauch fegte vorbei. Kalt. Eisig. Er streckte einen Arm nach dem Schatten aus, manchmal auch ein Bein und verharrte in dieser Position, still wie eine Statue.
Dabei hatte er sein Spiegelbild vor seinem inneren Auge. Komisch sah er aus, als wäre er von einer Eismaschine schockgefroren worden. Sein Mund aufgerissen, das Gesicht weiß. Seine Augen dunkel, sein Blick unheimlich, weil er hinter den Fugen etwas wahrnahm. Dort, wo die Wände sich bewegten, der Himmel dunkler war und schwarze Wolken vorbeifegten, dort lag zwischen den ineinandergeflochtenen Blättern etwas Lebendiges, am Stück und doch wieder nicht. Er sah nur Körperteile und Stofffetzen, rot durchtränkt, so schön, so traurig; und hörte das Wimmern, die Schreie, das Schluchzen. Ein Hauch von Eisengeruch, den er nur allzu gut kannte, drang in seine Nase. Der Geruch von Blut und der Gestank des Todes.
Martin war weder geschockt noch beunruhigt, sondern streitsüchtig und widerspenstig; und er fragte sich, wo nun sein Platz in diesem löchrigen Szenario war. Er zeigte den Fugen seine unbändige Wut, streckte der Wand seine geballte Faust entgegen. Auch er wollte schlagen, furchtbar schlagen. Die Sorte von Schlägen, die sehr wehtaten, ohne zum Tod zu führen. Die Art von Schlägen, die sich anfühlten, als seien sie endlos. Die jede Hoffnung töteten, während der Körper am Leben blieb. Er wollte im Blut einer Frau baden, sie mit einem aufgerauten Badetuch abreiben, dort, wo es verboten war und besonders schmerzte. Er wollte ihr Aufheulen aus den Eingeweiden hören, ein seelenzerschmetterndes Geräusch, einen Schrei, lang genug, um die Welt zu zerstören.
Das schwarze Loch umkreiste ihn, wurde zu einem Wirbelsturm. „Hallo Freundchen“, zischte es, „beruhige dich. Ich werde eine Lösung für dich finden.“ Dann verschmolz das Dunkel erneut mit der Wand.
Martin sah sich um. Ihm war immerzu schwindlig. Tag und Nacht. Und das kam nicht davon, dass er nur von Kartoffeln und Brot lebte. Der Dreck kam aus den Nähten dieser Wände – von allen Seiten. Es war, als ob seine Eingeweide beiseitegeschoben wurden oder in ihm vertrockneten und nur ein großes leeres Loch zurückließen. Dieses Etwas, das da hinter den Fugen wimmerte und nach seiner Mutter schrie, hatte seine Finger im Spiel. Vermutlich eine dreckige Hure, die ihren Jesus aus Plastik anhimmelte.
Nein, auf seinem Stuhl in der Gummizelle hatte er nie Angst. Dennoch nahm er immer wieder eine Witterung wahr: Uringestank, und wusste: Er hatte seine Hosen vollgepisst. Es musste an den Pillen liegen, die sie ihm gaben. Er sollte sie nicht mehr schlucken. Dann verabschiedeten sich auch der Schwindel und die Schlaflosigkeit, die albtraumhaften Visionen und der schwarze Tornado. Er würde hier lebendig rauskommen, einen Freudentanz aufführen und mit seinem Schwanz wedeln. Es wurde Zeit, ihn wieder in die Hand zu nehmen. Aber diese verfickten Schatten hinderten ihn daran.
Plötzlich fühlte sich seine Kehle eng an. Er glaubte, drei tiefe Atemzüge zu hören, und lehnte seinen Kopf gegen die Wand, schloss die Augen. Da! Das leise Trippeln kleiner Füße. Gestalten in weißen Nachthemden? Auf seiner Netzhaut tanzte der Nachtglanz der Fugen. Herrgott!
Sekunden später erwachte er jählings aus seinem Albtraum. Sein Herz pochte und er brauchte eine ganze Weile, um zu erkennen, dass er vollbekleidet in seinem Bett lag. Er rieb sich voller Unbehagen die Brust, blinzelte ein paar Mal und richtete sich auf. Es war dunkel in der Zelle, nur unter der Tür schimmerte ein wenig Licht. Er wollte schreien. Über sein Schicksal, sein Leben und das Pendeln zwischen Realität und Wahn. Er sollte Dr. Becker davon erzählen. Ja, das sollte er. Er mochte die Leiterin der Anstalt. Moira Becker war eine echt geile Braut.
Er legte seine Stirn an die Wand; die Kühle wirkte besänftigend und brachte seinem erhitzten Gesicht ein wenig Erleichterung. Die Wände knackten lauter als sonst, die Lüftungsschlitze und Leitungsschächte schienen aktiver zu sein. Dinge bewegten sich, trudelnd und sinkend wie Plankton in einem Teich. Irgendetwas stimmte nicht. Es war nur ein leises Geräusch, das Knarren eines Bettes, ein Atmen, das aus dem Takt geraten war. Draußen entfernten sich Schritte. Er hörte das Knirschen des Kieses, das Quietschen des Flügeltors. Dann war alles wieder ruhig.
Seine Augenlider flatterten. Er strich mit der Zunge im Mund herum, starrte die Fugen an. „Verfickte Nächte auf diesem verfickten Stuhl in dieser verfickten Anstalt. Hörst du mich, du verficktes Arschloch?“
Kapitel 2
Freitag, Berlin-Friedrichshagen
Bereits um 16.30 Uhr setzte allmählich die Dämmerung ein. Ein solches Wetter hatte Moira Becker Ende September in Berlin noch nie erlebt. Die flirrenden Panoramen des Herbstes zogen durch die ganze Stadt an den Gebäuden vorbei. Überall standen Bäume, junge und alte. Immer wieder blinzelte sie, wenn die untergehende Sonne durch die bunten Blätter eine Lücke ergatterte und ihre Strahlen sie für Sekunden blendeten. Es war die Jahreszeit kräftiger, satter Farben.
Moira fuhr ihren Porsche Carrera auf den Parkplatz der Neurotec AG und fragte sich, warum Frank Ponti nun doch in eine Unterredung eingewilligt hatte.
Wochenlang hatte ihre Sekretärin sich um einen Termin mit dem Vorstandsvorsitzenden Ponti bemüht, aber dessen Mitarbeiter hatten sie immer wieder vertröstet. Ponti sei im Ausland, Ponti sei in Leipzig, Ponti sei Gastredner bei einem internationalen Kongress in Saudi-Arabien. Warum also gerade jetzt, spontan und völlig unerwartet? Und dann auf eine so ungewöhnliche Art. Ponti hatte sie vor zwei Tagen sogar persönlich angerufen und die Einladung mit einem seltsamen Klang in der Stimme ausgesprochen. Ich erwarte Sie dann morgen um 17 Uhr. Und ich hasse Unpünktlichkeit.
Einladung, Moira lächelte, Befehl traf wohl eher zu. Ob ihr Vater Bardo die Finger mal wieder im Spiel hatte? Der Gedanke einer Einmischung behagte ihr überhaupt nicht, aber sie beglückte sich im Stillen.
Nach ihrer Heirat mit dem Profiler Tom Diavelli hatte das Innenministerium ihr die Leitung der forensischen Anstalt Auxillium Reos in Berlin übertragen, nachdem sie als Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie in der forensischen Psychiatrie in Hamburg hervorragende Arbeit geleistet hatte. Der Umzug nach Berlin kam ihr sehr entgegen, da ihr Vater auch nach seiner Pensionierung als beratender Kriminologe für den Berliner Maßregelvollzug tätig war. Er saß dort jeden Tag hinter seinem Schreibtisch und es kam Moira vor, als hielte ihr Vater noch immer die Fäden in der Hand.
Auxillium Reos – den Schuldigen helfen. In der forensischen Klinik wurden die Grund- und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen geachtet und geschützt. Einschränkungen dieser Rechte waren ausschließlich begründet zum Schutz der Allgemeinheit, ebenso aller im Maßregelvollzug untergebrachten beschäftigten Menschen und zur Abwendung von Eigengefährdung.
Die ehemalige, weitläufige Kaserne, von der Straße zurückversetzt in einem ummauerten Park gelegen, der von dichten, hohen Zedern umsäumt war, diente als Hauptstandort des Maßregelvollzugs von Berlin. Hier waren die Abteilungen verschiedenster Sicherheitsstufen untergebracht. Neben dem Hochsicherheitstrakt, in dem die Affekttäter verwahrt waren, gab es sogar eine große Parkanlage.
Moira arbeitete mit multiprofessionellen Teams und nutzte alle vorhandenen Fachkompetenzen für das Behandlungsziel: die Besserung und Sicherung psychisch kranker Straftäter. Qualifizierte Diagnostik, Prognose und Behandlungsmaßnahmen waren die Grundlagen der inneren und äußeren Sicherheit. Die Klinik war auch für die Begutachtung von straffällig gewordenen Suchtkranken zuständig. Ihre Arbeit orientierte sich deshalb besonders an wissenschaftlichen Qualitätsstandards und berücksichtigte aktuelle Forschungsergebnisse bei der Weiterentwicklung von Konzepten.
Der Stolz ihres Vaters war schon immer die Forschungsabteilung gewesen, die bei schweren Zwangsstörungen neue Konzepte entwickelte und dabei eng mit den Unternehmen und Gesundheitsbehörden zusammenarbeitete. Ihr Vater kannte viele Entscheidungsträger, wenn es um die Vergabe von wissenschaftlichen Studien ging.
Auch Moira kannte einige von ihnen. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Treffen in der Becker-Villa gegeben. Aber Frank Ponti war sie noch nicht begegnet.
Sie hatte sich im Vorfeld über die Neurotec AG erkundigt, die Apparaturen für die Elektrostimulation und audiovisuelle Stimulationsgeräte produzierte. Neurotec war wieder im Auftrag des Innenministeriums an die Klinik herangetreten und hatte um Unterstützung bei einer Studie gebeten. Der Schwerpunkt lag auf der Behandlung der bipolaren Zwangsstörung bei straffällig gewordenen Triebtätern mittels Einsatz neuer Apparaturen. Moira hatte als Klinikleiterin bereits zugestimmt und Neurotec einen Kostenvoranschlag unterbreitet, doch bis heute keine Nachricht erhalten.
Zu DDR-Zeiten hatte Neurotec ihren Hauptsitz in Ost-Berlin gehabt und war eines der größten Kombinate gewesen. Sie kannte zwar Begriffe wie Kombinat oder VEB, dennoch empfand sie sie fast schon als abstoßend, was vermutlich daran lag, dass sie ein diktatorisches Regime und die Planwirtschaft verabscheute. Die Menschen waren zu DDR-Zeiten unzufrieden gewesen. Tagtäglich hatten die Medien über den Aufruhr gegen die damalige Regierung berichtet. Sie bewunderte den Mut vieler Menschen, die sich gegen das System gestellt hatten und damit das Risiko eingegangen waren, verhaftet zu werden. Aber sie konnte auch jene verstehen, die aus politischer Zweckdienlichkeit den Mund gehalten hatten, weil das Regime Angst verbreitet hatte. An der Spitze der früheren Kombinate hatten schließlich skrupellose Männer gestanden.
Ob Ponti auch einer von ihnen gewesen war? Über den Vorstandsvorsitzenden gab es kaum Informationen, bis auf einige wenige Bemerkungen ihres Vaters.
„Dieser Mann kontrollierte früher die Kombinate und war nur Honecker rechenschaftspflichtig, Moira“, hatte ihr Vater erklärt. „Sei auf der Hut. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Ponti ist ein Fuchs. Er gilt als blitzgescheit und umtriebig, oft auch barsch und ungeduldig. Der Name Ponti zeugt in der Branche mehr von Furcht als von Ehrerbietung für einen Mann, der die schlimmsten Zeiten eines diktatorischen Regimes mit Bravour überstanden hat. Würden wir in Frankreich leben, käme er einem Fouché gleich, der als Drahtzieher für üble Operationen galt.“
„Du machst mir keine Angst, Papa“, hatte sie erwidert.
„Hm ... Jedenfalls ist Vorsicht geboten. Schließlich war jener Fouché für die Hinrichtung von Robespierre mitverantwortlich. Soll ich dich nicht doch begleiten?“
„Papa, ich bin erwachsen und kann auf mich aufpassen!“
Moira schmunzelte bei der Erinnerung an das Gespräch. In der Stimme ihres Vaters hatte eine gewisse Besorgnis gelegen, die für ihn ungewöhnlich war. Bardo Becker zeigte in der Regel keine Gemütsbewegungen, aber ihr hatte die Sorge des Vaters um die Tochter gefallen. In ihrer Jugend hatte es kaum Zeichen der Zuneigung zwischen ihnen gegeben, dafür oft fehlende Nähe und ein frostiges Miteinander. Als sie ihr Studium aufgenommen hatte, war sie froh gewesen, der eisigen Kälte endlich zu entkommen. Nach dem Studium und ihrer Heirat mit Tom Diavelli hatte sich ihr Verhältnis ein wenig entspannt. Ihr Vater mochte Tom, den er immer Dr. House nannte. Als zynischer und ewig nörgelnder Ermittler tyrannisierte er manchmal seine Kollegen, doch Toms analytischer Verstand galt bei ihnen als hochgeschätzt. Hinzu kam die Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Hugh Laurie aus der TV-Serie Dr. House. Tom trug immer wieder gerne graue Anzüge, passend zu seinem graumelierten Haar, was ihm zusammen mit dem markanten Kinn und den stahlblauen Augen eher einen skandinavischen Charakter verlieh statt eines italienischen, weswegen er den Spitznamen Dr. House von seinen Kollegen verpasst bekommen hatte.
Moira parkte den Wagen auf dem Firmenparkplatz für Besucher und stieg aus. Ein seltsamer Geruch drang ihr in die Nase, ein Gemisch von Braunkohle und Chemie. Worte wie beißend, umweltschädigend, gesundheitsgefährdend, tödlich, kamen ihr in den Sinn. Merkwürdig für ein Werk, das Apparaturen herstellt.
Sie betrachtete die verschiedenen Gebäude. Die Fassaden bröckelten an einigen Stellen, und alles erschien grau in grau. Der weitläufige Bau lag abseits der Straße und diente als Hauptsitz der Neurotec AG. Produktion, Forschung und Entwicklung waren in den diversen Häusern hinter Gitterzäunen untergebracht, die von Dutzenden Kameras überwacht wurden.
Moira schauderte, als sich plötzlich Wolken vor die Sonne schoben, und mit einem Mal die feuchte Kälte Berlins durch ihren Regenmantel drang. Zu Hause würde sie jetzt mit ihrem siebenjährigen Sohn Josh spielen, den Jungen ins Bett bringen, mit Tom etwas Gutes essen und mit ihm auf dem Sofa kuscheln und in seine Augen sehen. Sie waren intensiv, umgeben von langen Wimpern, um die jede Frau ihn beneidete. Sie waren zu einer unglaublichen Tiefe imstande, zu unglaublichen Emotionen.
Vor vielen Jahren war sie Tom zum zweiten Mal in der Klinik begegnet. Sein berufliches Interesse hatte damals einem Insassen gegolten. Wilfried Brenner, den sie im Auftrag des Staates therapeutisch betreut hatte. Der drogensüchtige, im Hochsicherheitstrakt verwahrte Mann war wie ein zurückgebliebenes Kind, eingesperrt auf einem der endlos langen Korridore. Brenner hatte damals unter dem Einfluss einer brutalen Gang gestanden, die den Süchtigen zum Mittäter ihrer Verbrechen gemacht hatte. Heute lebte Wilfried Brenner im offenen Vollzug und schrieb ihr regelmäßig eine Karte.
Sie hatte Tom damals gebeten, ihr bei einem Gutachten für Brenner behilflich zu sein. Heute wusste Moira, dass das nur ein Vorwand gewesen war, Tom wiederzusehen. Er hätte von sich aus nie wieder einen Schritt in ihre Richtung unternommen, dafür kannte sie ihren sensiblen Ehemann nur zu gut.
Am ersten Tag ihres Kennenlernens hatte er mit ihr geflirtet und ihr einen riesigen Rosenstrauß geschenkt; am zweiten hatte er sie leidenschaftlich im Kopierraum der Klinik geküsst. Tom wollte eine Beziehung, doch sie erteilte ihm einen Korb. Sie war für ein ernstes Miteinander noch nicht bereit, obwohl Tom genau ihrem Typ entsprach. Zwei Jahre später gab es das zweite Treffen. Sein Anblick hatte ihr Blut sofort in Wallung gebracht. Moira begriff schnell, dass er ein zweites Nein nicht als Antwort gelten lassen würde, wenn er ein Ja hören wollte. Er hatte so eine romantische Aura, die Moira unwiderstehlich fand. Nach der ersten gemeinsamen Nacht hatte Tom ihr einen Heiratsantrag gemacht und ein Jahr später war ihr Sohn Josh auf die Welt gekommen. Heute waren sie eine kleine Familie, die in sechs Monaten Zuwachs bekommen sollte. Tom Diavelli zu heiraten, war die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen.
Moira war irritiert, als sie auf das prächtige Gebäude mit der Hausnummer 26 zuging. Der mehrfach gegliederte Baukörper zeigte eine reiche Formenvielfalt. Turmhaube und Volutengiebel griffen Elemente der Renaissance und der Antike auf. Mit Bedauern stellte sie fest, dass auch dort an vielen Stellen der Putz bröckelte. Alles kam ihr seltsam vertraut vor, als wäre sie schon einmal hier gewesen. Blödsinn! Rasch lief sie die Außenstufen hinauf. Nur der Eingangsbereich und wenige Fenster im ersten Stock waren erleuchtet.
Der Wachposten an der Pforte hob fragend die Augenbrauen. Sie zeigte ihm ihren Ausweis, worauf er sich umwandte, durch einen Computerausdruck blätterte und die Daten mit den Anzeigen auf seinem Monitor verglich.
„Herzlich willkommen, Frau Dr. Becker. Herr Ponti erwartet Sie bereits, dritter Stock, Zimmer 32.“
Moira nickte, passierte das massive Stahltor und blieb in der Halle vor der Tafel mit der Aufschrift NEUROTEC AG BERLIN. Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben stehen.
Die majestätische Treppe mit der Balustrade sah nicht besonders einladend aus. Deshalb entschied sie sich für den Aufzug. Sie war gespannt, wie sie auf Ponti, den ihr Vater so schätzte, reagieren würde und fragte sich, welche Erklärungen dieser Mann für ihr plötzliches Treffen bereithielt.
Der Aufzug hielt mit einem Ruck. Moira betrat einen langen Korridor, der nur von dem gedämpften Licht einiger Wandleuchten erhellt wurde. Vor einer massiven Holztür blieb sie stehen. Aus dem Büro hörte sie Gesprächsfetzen. Die Stimme klang scharf und bohrend. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, und ein junger Mann eilte mit hochrotem Kopf an ihr vorbei.
„Sind Sie Dr. Becker?“, rief die Stimme.
Unsicher, was sie erwartete, betrat Moira das Büro und musterte den Mann, der sich hinter dem Schreibtisch erhob und auf sie zukam.
Ponti war ein großer, weißhaariger Mann von Anfang sechzig in einem zerknitterten Anzug, der aussah, als hätte er darin geschlafen. Beim Anblick des Mannes hämmerte auf einmal ihr Herz.
Sie reichte Ponti die Hand. „Richtig. Becker, Moira Becker.“
Eine seltsame Vertrautheit ergriff sie, als der andere ihre Hand berührte. Der Blick, mit dem Ponti sie sekundenlang fixierte, war so intensiv, dass sich Moira fragte, ob sie sich vielleicht schon mal begegnet waren. Sie sah in dunkle Augen unter weißen Brauen.
„Wir haben miteinander telefoniert. Ich bin Frank Ponti. Herzlich willkommen, Frau Dr. Becker“, sagte ihr Gegenüber, während er ihre Hand noch immer hielt. „Freut mich sehr.“ Endlich ließ er ihre Hand los und machte eine einladende, joviale Handbewegung. „Ich habe Sie schon erwartet. Bitte setzen Sie sich doch.“
Moira wurde leicht schwindlig. Verdammt. Der Zuckerspiegel machte ihr mal wieder zu schaffen. Und das jetzt. Sie hatte Kopfschmerzen, und eine Unruhe erfasste sie, als sie sich in den angebotenen Sessel sinken ließ.
„Unser Berater Torsten Winter wird unserem Gespräch ebenfalls beiwohnen“, fuhr Ponti fort. „Ich nehme an, gerade in Berlin-Grunewald haben die Ereignisse um die Familie Winter Schlagzeilen gemacht. Sie wissen doch sicher über Manfred Winter Bescheid, Torstens Vater?“
Moira nickte. Ihr Vater kannte Winters Vater, der als Halbwaise im Ostberliner Treptow aufgewachsen war. Er hatte während der Wende als einer der renommiertesten Unternehmensberater gegolten und auch der Treuhand als Berater zur Seite gestanden.
Moira hob die Augenbrauen. „Sind Winters Eltern vergangenes Jahr nicht bei einem Brand ums Leben gekommen?“
„Richtig“, erwiderte Ponti, „zwei Monate später wurde ihr älterer Sohn Paul bei einem Verkehrsunfall getötet. Und fünf Wochen danach starb ihre Tochter Julia nach einem Skiunfall.“ Ponti hielt einen Moment lang inne. „Alles sehr merkwürdig. Man könnte auf die Idee kommen, dass die Winters die Kennedys Deutschlands seien. Winter ist der letzte Spross der Familie.“
Moira schwieg betroffen.
„Torsten Winter ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und als Unternehmensberater sehr erfolgreich“, fuhr Ponti fort. „Er genießt einen geradezu sagenhaften Ruf. Außerdem berät er das Innenministerium in Sicherheitsfragen.“
Es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Moira fragte sich erneut, warum ihr dieser Mann so vertraut erschien. Dennoch konnte sie sich nicht daran erinnern, ihn jemals im Haus ihres Vaters gesehen zu haben.
„Geht es Ihnen nicht gut, Dr. Becker? Sie sind ein wenig blass um die Nase.“
Moira um den Mund ein leichtes Kribbeln. „Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich?“
„Aber natürlich. Entschuldigung, ich hätte Ihnen sofort etwas anbieten sollen.“
Ponti eilte zum Waschbecken. Wenig später hielt er ihr ein Glas Wasser hin, reichte ihr ein Stück Traubenzucker und fixierte sie mit seinen grauen Augen. „Kommen Sie, nehmen Sie das. Sie sind wahrscheinlich unterzuckert und haben neuroglykopenische Symptome. Ihr Vater hat mir erzählt, dass Sie an Diabetes leiden.“
Mein Vater? Ihr Vater hatte mit Ponti über sie gesprochen? Warum?
Pontis Augen glänzten. „Meine verstorbene Frau hatte auch Diabetes Typ eins.“ Seine Stimme klang fast, als stammte sie aus einem Computer. Seine Aussprache war sehr präzise. Dennoch passte sie nicht zu seinen Gesichtszügen. „Ich weiß von ihr, wie man sich dabei manchmal fühlt.“ Er wischte sich mit einem weißen Taschentuch über die Stirn, öffnete ein Fenster und schmunzelte vor sich hin. „Es ist aber auch eine stickige Luft hier drinnen.“
Die Vorhänge bewegten sich im kalten Windhauch. Obwohl sie Frank Ponti erst seit wenigen Augenblicken kannte und bereits jetzt spürte, dass er ein sehr distanzierter Mensch war, schoss ihr immer wieder ein Gedanke durch den Kopf. Dieses Lächeln. Diese Stimme. Ich kenne ihn. Aber woher?
Kapitel 3
Drei Tage zuvor - irgendwo in Berlin
Am kommenden Freitag reise ich zum dritten Mal mit einer Delegation nach Moskau und nehme dort an einer Gesprächsrunde mit Sozialwissenschaftlern und Informatikern teil. Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet der Kriminologie. Der Gedanke lässt meinen Bauch erzittern, bis er sich hohl anfühlt.
In Russland können die Menschen davon ausgehen, dass die Gedankenpolizei überall ist, aber sicher kann man nie sein. Der Terror besteht dort nicht darin, dass der Staat das Volk ständig überwacht, sondern dass die Überwachung wie alles andere auch ein Instrument völliger Willkür ist. Die Russen sind allmächtig und allwissend, sie sind das Symbol für ein perfides System der Disziplinierung, dem sich das Volk zu unterwerfen hat. Das typische Kennzeichen einer Diktatur. Das Volk muss fürchten, dass nichts unbeobachtet bleibt. Diese Furcht schätze ich persönlich übrigens sehr.
Dimitri, ein Vertreter der russischen Regierung, hat bei seinem letzten Besuch in Berlin den Eindruck vermittelt, als wolle er mich ins Boot holen, weil er von meinen Fähigkeiten erfahren hat und weil er meine Neigungen kennt. Ich möchte wissen, was es mit diesem Update, das sie STEFKO nennen, auf sich hat, aber Dimitri hielt sich bedeckt. Nachfragen sind unerwünscht.
Ich habe den Russen vor vielen Jahren aus der Patsche geholfen und ihnen ein militärisches Abwehrprogramm geliefert, das als Embargoware auch heute noch nicht nach Russland verkauft werden darf. Seitdem verbindet uns eine tiefe Freundschaft. Womöglich kann ich sie mit unserem Programm CHIMÄRE verblüffen. Mir stellen sich viele Fragen, aber Dimitri mauert.
Unsere Computersoftware kann dank meiner hellseherischen Fähigkeiten nicht nur Verbrechen verhindern. Aber nur ein Verbrechen in der Zukunft vorauszusagen, ist gähnend langweilig. Das machen auch schon andere wie dieser Idiot Kontzen, dem Russland neuerdings die Einreise verweigert hat. Er haust in einem armseligen Büro am Stadtrand von Berlin, hinter einem Wald, der GPS-Signale verschluckt.
In Kontzens Büros spüren Mitarbeiter im Auftrag des Innenministeriums die Täter der Zukunft auf. Sein Berliner Unternehmen steht für die Kombination aus Taten- und Datenanalyse, die die Arbeit von Strafverfolgern verändert. Sie nennen es „Predictive Policing“ oder „vorhersagende Polizeiarbeit“. Dass ich nicht lache. Alles papperlapapp. Unsere Software leistet um einiges mehr. Nicht umsonst haben wir den Auftrag erhalten, CHIMÄRE zu entwickeln – ohne dass „Mutti Merkel“ gefragt wurde. Sie hat wirklich keine Ahnung.
Es hat etwas Berauschendes, dass ein ganzes System durch einen von mir eingegebenen Befehl zum Arbeiten gebracht werden kann. Ich habe diese unvorstellbare Kraft, verborgen im Inneren eines Computers, aufgestöbert und CHIMÄRE neulich mit Informationen gefüttert. Daraufhin hat das Programm die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der in einem bestimmten Gebiet eine Frau am Abend das Haus verlässt. In den gesammelten Daten fand der Algorithmus ein Muster, aus dem er das Verhalten dieser Frau ableiten konnte und sie ausfindig machte. Ich musste mich nur noch in der als „gefährdet“ markierten Gegend umsehen. Es war so einfach.
Tage später habe ich der Schlampe beigebracht, den Kopf ruhig zu halten, als ich ihr den Verband abnahm. Der Wind ließ in jener Nacht mein offenes Hemd flattern. Blitze zuckten vom Himmel und hoch in den Wolken grollte der Donner. Ihr Gesicht war unbewegt, und von ihren Augen waren nur noch Höhlen zu erkennen, als die letzte Bandage fiel. Wie abscheulich das aussah. Sie hatte so nichts mehr von einem menschlichen Wesen. Ein groteskes Knochengerüst, das seinem Ende nahte. Der Wind brüllte sein heulendes Echo und verbreitete ihren Gestank: den Gestank von verfaultem Fleisch. Ein weiß glühendes Objekt tief in ihre Augen zu bohren und das Fleisch zischen zu hören, sobald es verbrennt, hat etwas Magisches. Der Gedanke lässt eine dumpfe Wärme in meinem Rückgrat und meinen Lenden erstrahlen und für einen Moment verschwimmt alles vor meinen Augen.
Hm ... Ich vermute allerdings, dass man den Russen mit nichts mehr in Erstaunen versetzen kann, auch nicht mit meinem Programm. Sie sind schon gestählt. Dennoch ... Gefahren warten doch auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Ich kenne die Bedeutung von Leben und Tod. Letzterer ist mir näher als das Leben. Ich brauche den Tod, um zu überleben.
Obwohl ich erst vor drei Monaten von meiner letzten Russlandreise zurückgekehrt bin, sind meine Erinnerungen an den Tod nicht mehr allzu frisch. Es kommt mir deshalb geradezu unwirklich vor, bei hellem Tageslicht die Straße entlangzugehen, den Gesang der Vögel und das Lachen der Menschen zu hören. In Russland hat es kein Lachen gegeben, nur die Stimmen der Straße und das pfeifende Dröhnen in meinem Kopf.
Ich träume immer häufiger vom Angesicht des Todes. Es ist das schmerzverzerrte Gesicht der Frau, die ich demnächst töten werde. Ich höre, wie ihr Atem sich verheddert, höre ihre qualvollen Schreie, die mein Herz höher schlagen und mich in der Nacht aufwachen lassen. Ich bin verschwitzt, mein Kissen ist nass, die Bettdecke zeigt mir meine Träume, irgendetwas mit Tod, Nässe.
Ich gehe ins Badezimmer, sehe in den Spiegel. Er luchst mir meine finsteren Geheimnisse ab. Ich schließe meine Augen und mein Atem vibriert schon jetzt vor Aufregung. In Gedanken schlage ich mit der Faust zu, in das Gesicht der Hure. Ihre Haut platzt auf, ein roter Fleck erblüht auf ihrer Wange wie eine Rose. Der Fleck ist wunderbar. Ihr Blut sickert tröpfchenweise heraus, auf ihre Bluse – rot auf weiß. Ich sprühe ihr Gesicht mit Rasierschaum ein, rasiere sie, schneide sie, tupfe das Blut mit weißem Toilettenpapier ab. Ich kann es riechen; wenn ich meine Zunge herausstrecke, kann ich die eisenhaltige Trübe schmecken.
Sie ist still. Sie ist keine Heulsuse mehr. Immer wieder sage ich ihr, dass ich der Stärkste bin. Die Starken beherrschen die Schwachen. Das hat mein Vater mich gelehrt, obwohl ich damals nicht dankbar war. Ich war gerade erst sechs! Heute bin ich älter und kenne die Wahrheit. Ich lernte meine Lektion gut. Heute bin ich ein mächtiger Mann und stark, habe wie mein Vater Einfluss und die zwei Gesichter des Gottes wie Janus, weshalb ich mich auch so nenne. Ich bin der Gott allen Ursprungs, des Anfangs und des Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore und ... hui, der Vater des Bösen! Befriedigung finde ich nur, wenn ich die stummen Tränen einer Frau sehe, die nicht antworten kann, nicht einmal mehr blinzeln. Dann lächle ich und senke langsam die Axt. Ich sehe sie zittern, sehe, wie sie sich schüttelt, beobachte, wie ihr Oberkörper vornüber sinkt, ihre Hände sich zu Fäusten ballen. Ich höre sie stöhnen, lang anhaltend, voller nasser, widerlicher Dinge. Sie harmoniert mit meinem misstönenden Geheul. Und dann sehe ich es: ihr volles, stinkendes, klebriges Unterhöschen. Es ist dämonisch. Ich beuge mich noch einmal hinab und bringe den Mund an ihr Ohr. Ich flüstere ihr etwas zu und lege die Macht meines ganzen Ichs in meine Stimme, meinen eigenen Schmerz. Dann schwinge ich die Axt und bin ein Engel mit bleiernen Flügeln. Ich zucke ein wenig, wenn ihr Blut und ihre Gehirnmasse auf mein Gesicht und Brust spritzen. Dieses einmalige Gefühl, wenn etwas widerlich Heißes an meiner Wange hinabgleitet und auf den Boden klatscht oder an meinen Fersen klebt. Wir beide bluten aus Wunden, die nicht heilen wollen. Ich öffne meine Augen und sehe in den Spiegel. Mein Blick ist leer, und ich bilde mir ein, dass schwarzer Speichel von meinen Fängen trieft, über das Kinn läuft und auf meine Brust tropft.
Es ist ein symphonisches Geräusch, der pfeifende Schlag der Axt und das darauffolgende Krachen des Schädels oder der Halswirbelkörper einer Frau in einem abgelegenen Keller am Stadtrand von Berlin. Aber ... Zu einfach ist das Ganze. Ich sollte mir etwas anderes überlegen und mir ein schönes Plätzchen überlegen, wo ich diese Dame zur Schau stellen kann. In einem Keller wird man sie nicht so schnell finden. Raffinesse lautet ab sofort mein Motto.
Tja, Gefahren warten auf jene, die auf fragwürdige Weise auf das Leben reagieren – wie jetzt mein neuer Online-Kontakt: Tanja. Die russischen Internetportale bieten reichlich Konsumgüter für meine Bedürfnisse, ein Grund mehr, mich auf meine Reise zu freuen und mich mental auf Tanja einzulassen.
Tanja – achtzehn Jahre – sie scheint ein wirklich unartiges Mädchen zu sein. Für sie habe ich mir etwas Besonderes, etwas Bedeutendes überlegt. Ich werde vor meiner Abreise noch ein wenig üben, ich muss mich darauf verlassen, dass es klappt. Noch ahnt sie nichts von ihrem Schicksal. Tanja glaubt an die große Liebe und hofft – so sagt sie –, diese Gefühle auch in mir zu wecken.
Drei Monate sind seit meiner letzten Reise vergangen. Ich betrachte mein Regal, das angefüllt ist mit Mitbringseln aus Moskau: kleine Bronzefiguren in unverhüllten, weiblichen Formen und in unterschiedlichen Stellungen, hungrige Heiden, Raubtiere, die Beine gespreizt, das fleischige Geschlecht schamlos zur Schau gestellt.
Moskau ... Mein Schwanz reagiert. Er hebt sich. Ich kann den Drang, zu Tanja zu fahren, nicht mehr länger zügeln. Ich will dieses unartige, ungebändigte Fohlen zureiten, quälen und töten. Ich will die Angst in ihren Augen lesen, wenn ich ihr Blut lecke.
Janus legte den Stift beiseite, schaltete den Laptop ein und begab sich in den geheimen Chatroom Oasis. Tanja wartete bereits auf ihn und zeigte ihm ihre Knospen, weiter unten ihr fulminant entspanntes Reich. Sie gab ihm Anweisungen, ihre Finger bewegten sich flink.
Er starrte angestrengt auf den Bildschirm, in Tanjas Tiefe, begierig darauf, die Distanz zwischen sich und der jungen Frau in Gedanken zu verringern.
„Mach weiter“, knurrte er mit zusammengebissenen Zähnen und lotste seinen Saft in den virtuellen Mund. Tanja streckte ihre Zunge heraus und leckte den Bildschirm. Die Schwungkraft ihrer Zungenspitze verstärkte die Dunkelheit seiner Seele.
Kapitel 4
Freitag, Berlin-Friedrichshagen
„Fühlen Sie sich jetzt besser?“, Pontis Stimme klang fürsorglich.
„Danke. Traubenzucker bewirkt wahre Wunder.“
„Frau Dr. Becker, ich habe mich in den vergangenen Wochen verleugnen lassen, weil ich absolut sicher sein wollte, dass Sie die richtige Ansprechpartnerin sind. Ich habe mit Ihrem Vater über Sie gesprochen, ihm erklärt, welche Bedeutung das Projekt Chimäre für unser Land hat. Das Innenministerium wünscht diese besondere Versuchsreihe, und sie wollen Sie als hervorragende Analytikerin und Ärztin dabeihaben.“
„Was hat mein Vater Ihnen sonst noch über mich erzählt“, fragte Moira nach kurzem Zögern. Hat er dir auch von meiner Schwangerschaft erzählt?
Ponti lächelte. „Dass Sie charmant, hochintelligent und bildschön sind und dass wir uns auf Sie verlassen und Ihnen vertrauen können.“
Moira brannte darauf, mehr von Ponti zu erfahren. Aber es schien ihr im Moment unangebracht, weitere Fragen über das private Gespräch zwischen ihrem Vater und dem Vorstandsvorsitzenden der Neurotec zu stellen. Wieso hatte ihr Vater sich bloß darauf eingelassen? Sie würde morgen mal ein ernstes Wörtchen mit ihrem alten Herrn reden.
Sie mochte Ponti. Das stand fest. Aber das Eindringen in ihre Privatsphäre behagte ihr ebenso wenig wie das unerklärliche Wohlbefinden, das sie in der Gegenwart dieses Mannes empfand, den sie erst vor einer Stunde kennengelernt hatte.
„Und was bedeutet Chimäre?“
„Torsten Winter wird es ihnen näher erklären“, antwortete Ponti.
Er weicht meiner Frage aus. Seltsam.
„Ich bin Torsten Winter noch nie persönlich begegnet.“
„Das überrascht mich nicht“, erwiderte Ponti. „Sie beide bewegen sich auf zwei unterschiedlichen Parketten.“
Sie lächelte. „Das mag wohl sein.“
Die Bürotür wurde schwungvoll geöffnet. Ponti drehte sich um, ging auf den Mann zu, der das Büro betrat, und reichte ihm die Hand. „Wenn man vom Teufel spricht.“
„Hörner und Flügel, sonst gibt es keinen Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Freut mich auch, dich wiederzusehen, Frank.“
Ponti lachte. „Dr. Becker, darf ich Ihnen Torsten Winter vorstellen?“
Leibhaftig sah Torsten Winter noch besser aus als auf den Fotos, die die Medien verbreiteten. Winter war Anfang vierzig, hatte grüne Augen und sprühte förmlich vor Charme, ein Mann, der oft und gern lächelte und dabei makellos weiße Zähne zeigte. Es gab zig verschiedene Versionen darüber, wie er sein riesiges Vermögen angehäuft hatte, darunter auch einige wenig schmeichelhafte. Er reichte ihr die Hand. Ihre Blicke trafen sich. „Freut mich, Frau Dr. Becker.“
Moira sah in Augen, reglos wie Steine, die einen stählernen Charakter spiegelten. Sie mochte ihn nicht!
„Das hätten wir dann. Nehmen Sie doch bitte Platz. Wie wär’s mit einer Stärkung?“ Ponti deutete auf die Bar, wo inzwischen Kaffee bereitgestellt worden war. „Kaffee mit einem Schuss Cognac kann ich wärmstens empfehlen.“
Das belebende Aroma des Kaffees stieg Moira in die Nase.