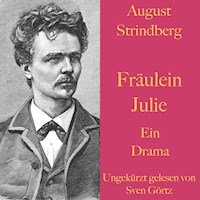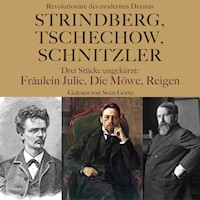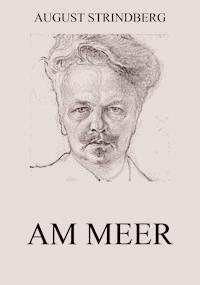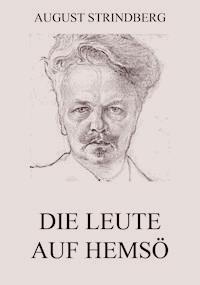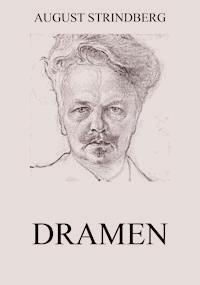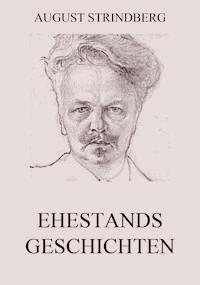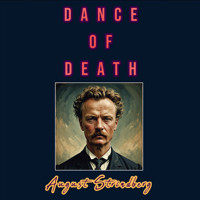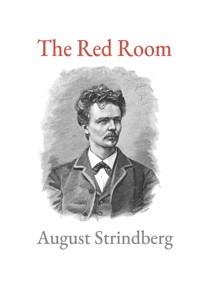Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein weitgehend autobiografisches Werk des großen schwedischen Autors, in dem er u.a. seine Beziehung zu Siri von Essen aufarbeitet.
Das E-Book Die Beichte eines Thoren wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Beichte eines Thoren
August Strindberg
Inhalt:
August Strindberg – Biografie und Bibliografie
Die Beichte eines Thoren
Einleitung.
I
II.
III
IV.
Die Beichte eines Thoren, A. Strindberg
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637231
www.jazzybee-verlag.de
August Strindberg – Biografie und Bibliografie
Schwedischer Schriftsteller, geb. 22. Jan. 1849 in Stockholm, verstorben am 14. Mai 1912 ebenda.War zuerst einige Zeit Lehrer, studierte dann Medizin, besuchte die Theaterschule, jedoch ohne auftreten zu dürfen, und nahm seine Studien 1870–72 wieder auf. Das interessante Drama »Meister Olof« wurde 1872 vom Publikum abgelehnt. Die Enttäuschung fand bitteren Widerhall in den Schilderungen aus dem Stockholmer Künstlerleben »Das rote Zimmer« (1879), das die realistisch-naturalistische Literaturbewegung in Schweden einleitet. Es rief einen Sturm der Entrüstung hervor. S. antwortete mit der bitterbösen Satire »Das neue Reich« (1882). In rascher Folge erschienen jetzt die Schauspiele »Frau Margit« und »Glückspeter«, die satirisch-agitatorischen Gedichte »Wundfieber«, »Schlafwandeln« (1883) u. a. In seiner ersten Periode stellt er die Frau und die Liebe als die tragenden Mächte des Lebens dar; in der zweiten Periode, nach einer europäischen Reise 1883, wird die Frau als der Quälgeist des Mannes geschildert; die aristokratische Kultur gilt ihm als verfehlt, und er tritt als der Verfechter des Utilitarismus auf (»Ehegeschichten«, 1884–85, 2 Tle.; »Die Inselbauern«, 1887; »Unter französischen Bauern«, 1889; die Schauspiele »Kameraden«, 1888; »Fräulein Julie«, 1888; »Der Vater«, 1889, mit einer Vorrede von Zola; »Gläubiger«; »Samum« und seine sehr offenherzige Selbstanalyse »Der Sohn einer Magd«, 1887). Dem Gleichheitsfanatismus folgte alsbald unter Nietzsches Einfluss die Reaktion als Übermenschenkultus (»Tschandala«. 1889; »Am offnen Meer«, 1890). Nach einer Periode von chemischen und alchimistischen Studien (»Gedrucktes und Ungedrucktes«, 1890; »Antibarbarus«, 1894) erschienen die psychologisch verworrenen und verwirrenden Schriften: »Die Beichte eines Toren« (1893), »Inferno« (1897), »Legenden« (1898), die Dramen »Nach Damaskus« (1898–1904, 3 Tle.), »Vor höherem Recht« (1899) u. a. Strindbergs unbarmherzige Kritik richtet sich mit ihrem Vergrößerungsglas jetzt gegen ihn selbst und er analysiert sein Leben, die quälende Kindheit »einer schüchternen und hungrigen Natur«, die gärenden Jugendjahre in Armut und Unverständnis, die Verzweiflung und Zanksucht des Mannes, die Ohnmacht des Alternden, alles, was die Tragödie des Stimmungsmenschen ausmacht. Weder als Gefühlsmensch der ersten Periode noch als Intelligenzaristokrat der zweiten hatte er eine befriedigende Lebenslösung finden können; jetzt sucht er einen dritten Erklärungsgrund und wird Mystiker. Die historischen Schauspiele: »Die Folkunger«, »Gustav Wasa«, »Erik XIV.«, »Gustav Adolf II.«, »Christine«, »Karl XII.«, »Gustav III.« und »Die wittenbergische Nachtigall« (gesammelt 1906–07) drücken den Gedanken aus, dass die Welt von höheren, übersinnlichen Mächten geleitet wird. In seinen späteren Werken entfaltet der frühere Naturalist eine Fülle von romantischer Poesie (»Advent«, »Ostern«, »Mittsommer«, um 1900; »Märchen«, 1903; »Einsam«, 1903; »Historische Miniaturen«, 1905). S. ist in der modernen schwedischen Literatur der größte Spracherneuerer, der kühnste, eigenartigste Geist. Als rücksichtsloser Anbahner hat er mehr Widerspruch und Anfeindung erregt, als seiner überempfindlichen Natur heilsam war. Seine Romane erschienen in schwedischer Volksausgabe 1899 ff., seine Dramen 1903–05, 2 Serien; unter Mitwirkung von E. Schering veranstaltete S. selbst eine deutsche Gesamtausgabe Berlin 1901 ff., 33 Bde. Vgl. Levertin, Diktare och drömmare (Stockh. 1898); H. Lindgren, Skalder och tänkare (das. 1900); D. Sprengel,
Am Tische sitzend, die Feder in der Hand, wurde ich von einem Fieberanfall erfaßt: Seit fünfzehn Jahren war ich nicht ernstlich krank gewesen, darum erschreckte mich dieser plötzliche Anfall. Nicht als ob ich den Tod gefürchtet hätte, nein, durchaus nicht. Mit 38 Jahren hatte ich ein geräuschvolles Leben hinter mir, ohne etwas Tüchtiges geleistet, ohne alle meine jugendlichen Wünsche verwirklicht zu haben; ich hatte den Kopf noch voller Pläne, und so war mir dieser Anfall durchaus unerwünscht. Seit vier Jahren lebte ich mit Weib und Kind in einem halb freiwilligen Exil, ich hielt mich in einem bairischen Weiler verborgen, war abgehetzt, vor Kurzem war ich verklagt und gepfändet worden, ich war verbannt und auf die Straße geworfen; und nun beherrschte mich das Gefühl der Rache selbst noch in dem Augenblick, als ich aufs Bett sank. Jetzt entspann sich ein Kampf. Ohne Kraft, um nach Hülfe zu rufen, lag ich in meinem Dachstübchen allein da, und das Fieber schüttelte mein Inneres durcheinander wie ein Federbett, schnürte mir die Kehle zu, setzte mir die Kniee auf die Brust, meine Ohren glühten und die Augen schienen aus dem Kopf zu dringen. Ich zweifelte nicht daran, daß es der Tod sei, der in mein Zimmer gedrungen war und sich auf mich geworfen hatte.
Doch ich wollte nicht sterben. Ich leistete ihm Widerstand; es war ein erbittertes Ringen; die Nerven spannten sich, das Blut tobte in den Adern, das Gehirn tanzte wie ein Polyp in Essig. Doch plötzlich gewann ich die Ueberzeugung, daß ich in diesem schrecklichen Totentanz unterliegen müßte, ich ließ los, fiel rückwärts über und gab mich ganz dem schrecklichen Würger gefangen.
Doch da überströmte mein ganzes Wesen ein unsagbarer Frieden, eine wollüstige Schlaffheit überlief meine Glieder, eine süße Ruhe ergoß sich über Körper und Seele, die beide in den vielen arbeitsharten Jahren der wohlthätigen Erholung entbehrt hatten.
Das war ohne Zweifel der Tod: allmählich schwand der Wille zum Leben, ich hörte auf zu empfinden, zu fühlen, zu denken. Das Bewußtsein entschwand, und die wohlthuende Empfindung des Nichts füllte die Leere aus, die durch das Schwinden der namenlosen Schmerzen, der beunruhigenden Gedanken, der uneingestandenen Sorgen entstanden war.
Als ich erwachte, saß meine Frau am Bette und sah mich mit ängstlichem Blick forschend an.
– Was ist Dir denn, lieber Freund? sagte sie.
– Ich bin krank, antwortete ich; aber wie gut ist es, krank zu sein!
– Was sagst du? Ist das dein Ernst?
– Das Ende naht heran; ich hoffe es wenigstens.
– Laß uns um Gotteswillen nicht auf dem Stroh zurück, rief sie. Was soll aus uns werden in einem fremden Land, fern von Freunden, ohne Mittel!
– Ich hinterlasse euch meine Lebensversicherung, tröstete ich sie. Es ist nicht viel, aber es reicht hin, um in die Heimat zurückzukehren.
Sie hatte nicht daran gedacht, und etwas ruhiger fuhr sie fort:
– Aber, wir müssen etwas thun, lieber Mann, ich werde den Arzt holen lassen.
– Nein! Ich will keinen Arzt.
– Warum?
– Weil ... weil ich nicht will.
Wir wechselten verständnisvolle Blicke an Stelle von Worten.
– Ich will sterben, erwiderte ich schroff. Das Leben widert mich an, die Vergangenheit erscheint mir wie ein Knäuel Garn, den abzuwickeln ich nicht die Kraft fühle. Mag das Dunkel hereinbrechen! Vorhang herunter!
Sie blieb bei diesen edelmütigen Ergüssen kalt.
– Immer wieder das alte Mißtrauen, sagte sie.
– Ja, noch immer! Vertreibt das Phantom! Du allein, du hättest es gekonnt!
Wie gewöhnlich legte sie die Hand auf meine Stirn.
– Thut dir das wohl, schmeichelte sie mit dem Ton ihrer früheren mütterlichen Zärtlichkeit.
– O, wie wohl das thut!
Die Berührung dieser kleinen Hand, die so schwer auf meinem Geschick lastete, besaß wirklich die Macht, die schwarzen Gespenster zu bannen und die verstohlenen Zweifel zu beschwören.
Nach kurzer Zeit brach das Fieber noch heftiger aus. Meine Frau stand auf, um einen beruhigenden Trank zu bereiten. Als ich einen Augenblick allein war, setzte ich mich auf, um einen Blick durch das Fenster gegenüber zu werfen. Es war ein breites, dreiteiliges Fenster, draußen von Weinranken umrahmt; zwischen den grünen Blättern konnte man noch ein Stück Landschaft sehen: Vorn die Krone einer Quitte, mit ihren schönen, goldgelben Früchten zwischen den dunkelgrünen Blättern, weiterhin die mitten auf den Rasen gepflanzten Apfelbäume, der Turm der Kapelle, ein blaues Fleckchen vom Bodensee und im Hintergrunde die Tyroler Alpen.
Es war mitten im Sommer, rings herum war Alles beschienen von den schrägen Strahlen der Nachmittagssonne – es war ein entzückendes Bild.
Drunten ertönte das Plappern der Staare, welche auf den Leitern der Weinberge saßen, das Piepsen der jungen Enten, das Zirpen der Grillen, die Kuhglocken; und in dieses fröhliche Konzert mischte sich das Lachen der Kinder und die anordnende Stimme meiner Frau, welche mit der Frau des Gärtners über meine Krankheit sprach.
Da ergriff mich wieder die Lust zum Leben, und die Furcht vor der Vernichtung durchbohrte mich. Nein, ich wollte nicht mehr sterben, hatte ich doch noch viele Pflichten zu erfüllen, viele Schulden zu begleichen. Von Gewissensbissen gepeinigt, fühlte ich das dringende Bedürfnis zu beichten, die Welt für irgend etwas um Verzeihung zu bitten, mich, vor wem es auch sei, zu demütigen. Ich fühlte mich schuldig, mein Gewissen wurde von unbekannten Verbrechen gemartert. Ich brannte vor Begierde, mein Herz durch ein vollständiges Bekenntnis meiner eingebildeten Schuld zu erleichtern.
Während dieses Schwächeanfalls, der meiner angeborenen Verzagtheit entsprang, trat meine Frau ein und brachte den Beruhigungstrank in einem Milchnapf. Indem sie auf einen leichten Anfall von Verfolgungswahn anspielte, den ich früher einmal gehabt, kostete sie von dem Getränk, bevor sie es mir reichte.
– Es ist kein Gift drin, sagte sie lächelnd.
Ich schämte mich und wußte nicht, was ich darauf antworten sollte, und mit einem Zug leerte ich den Napf, um ihr eine Genugthuung zu gewähren.
Das einschläfernde Getränk, dessen Duft mich an meine Heimat erinnerte, wo der geheimnisvolle Hollunderstrauch Gegenstand eines populären Kultus ist, brachte einen Hauch von Sentimentalität mit sich, welche schließlich in einen Ausbruch meiner Gewissensbisse überging.
– Höre, liebes Kind, bevor ich den letzten Atemzug thue. Ich bekenne, daß ich ein rücksichtsloser Egoist bin, ich habe, um meines litterarischen Ruhmes willen, deine Theaterlaufbahn zerstört; ich bin bereit, Alles zu gestehen, verzeih mir. Sie wehrte ab und sprach mir Trost ein, ich aber unterbrach sie und fuhr fort:
Wir haben bei unserer Verheiratung nach deinem Wunsche beschlossen, daß deine Mitgift dir verbleiben sollte; dennoch habe ich sie verschleudert, um leichtsinnig übernommene Bürgschaften zu decken; und das bedrückt mich am meisten, weil du im Falle meines Todes nicht den Besitz meiner veröffentlichten Werke wirst antreten können. Laß einen Notar kommen, damit ich dir mein angebliches oder wirkliches Vermögen vermachen kann. Dann aber kehre zu deiner Kunst zurück, die du um meinetwillen aufgegeben hast.
Sie wollte ausweichen, indem sie die Sache scherzhaft nahm, sie empfahl mir, ein wenig zu schlummern, und versicherte mir, es würde sich alles ordnen, der Tod komme nicht so schnell.
Kraftlos faßte ich ihre Hand, bat sie an meiner Seite zu sitzen, während ich schliefe, flehte sie noch einmal an, mir alles Leid zu verzeihen, das ich über sie gebracht, und nahm ihre Hand fest in die meine; nunmehr senkte sich eine süße Müdigkeit auf meine Augen, ich fühlte, wie ich steif wurde wie Eis unter den Ausstrahlungen ihrer großen Augen, die mit unendlicher Zärtlichkeit auf mich blickten, unter ihrem Kusse, den sie wie ein kaltes Siegel auf meine heiße Stirn drückte – wie ich versang in unsagbare Seligkeit.
*
Als ich aus meiner Lethargie erwachte, war es heller Tag. Die Sonne schien auf das mit einer Schlaraffenlandschaft bemalte Rouleau, und nach dem Geräusch unten zu urteilen, mußte es fünf Uhr morgens sein. Ich hatte die ganze Nacht ununterbrochen traumlos geschlafen.
Der Napf mit dem Thee stand noch auf dem Nachttisch; auch der Sessel meiner Frau stand noch auf seinem Platz, ich aber war eingehüllt in einen Fuchspelz, dessen weiche Haare mir liebkosend das Kinn kitzelten.
Es schien mir, als habe ich in den letzten zehn Jahren nicht geschlafen, so frisch und ausgeruht fühlte sich mein bis zum Übermaß angestrengter Kopf. Die sonst wild durcheinander stürmenden Gedanken vereinigten sich zu geordneten, kraftvollen, gefestigten Gruppen, die den Anfällen von krankhaften Gewissensbissen, den Symptomen eines geschwächten Körpers bei degenerirten Personen Stand halten konnten.
Gleich zu Anfang fielen mir die beiden schwarzen Punkte in meinem Leben ein, die ich gestern als Bekenntnis eines Sterbenden der heißgeliebten Frau offenbart hatte, die mich Jahre lang gepeinigt und mir die Augenblicke, welche ich für meine letzten hielt, vergiftet hatten.
Jetzt wollte ich einmal näher an diese Fragen herangehen, die ich bisher in dem unbestimmten Gefühl, daß sich nicht alles in Ordnung befände, nicht gründlich geprüft hatte.
Sehen wir doch einmal näher zu, sagte ich zu mir, worin ich eigentlich gekündigt habe, ob ich mich wirklich als einen feigen Egoisten betrachten muß, der zum Vorteil seiner ehrgeizigen Pläne die Künstlerlaufbahn seines Weibes geopfert hat.
Sehen wir zu, wie sich die Sache in Wirklichkeit zugetragen hat. Zu der Zeit, wo wir uns aufbieten ließen, hatte sie beim Theater schon eine untergeordnete Stellung: man gab ihr mir noch zweite, nein dritte, Rollen. Beim zweiten Auftreten fiel sie durch aus Mangel an Talent, an Aplomb, an Charakteristik, kurz es mangelte ihr jedes Bühnentalent. Am Tage vor der Hochzeit erhielt sie ein blaues Rollenheft, welches nur zwei Worte enthielt, die eine Gesellschaftsdame in irgend einem Stücke zu sprechen hatte. Wieviel Thränen, wieviel Kummer brachte diese Ehe, die den Ruf einer Schauspielerin vernichtete. Noch vor Kurzem war sie als Baronin, die sich der Kunst zu Liebe hatte scheiden lassen, so anziehend.
Daran war sicher ich schuld; der Zusammenbruch begann, er endete mit einer brüsken Entlassung – nach zweijährigem Jammern vor immer dünner werdenden Rollenheften.
Gerade als ihre Theaterlaufbahn zu Ende ging, hatte ich als Romanschriftsteller Erfolg, und zwar einen wirklichen, unbestreitbaren Erfolg. Während ich früher kleine Stücke auf die Bühne gebracht hatte, deren Aufführung für mich ohne Folgen blieb, bemühte ich mich jetzt um die Vollendung eines annehmbaren Stückes, ich will sagen um eine geeignete Maschinerie, die den speziellen Zweck haben sollte, der heißgeliebten Frau wieder zu dem so sehr gewünschten Engagement zu verhelfen. Ich ging allerdings etwas widerwillig an die Arbeit, da ich seit lange Neuerungen in der dramatischen Kunst plante; ich ging daran, indem ich meine litterarische Überzeugung opferte. Ich mußte die geliebte Frau dem Publikum durchaus aufdrängen, sie ihm trotz aller bekannten Schauspielerinnen an den Kopf werfen, sie in die Sympathie dieser widersetzlichen Welt einschmuggeln. Aber, es half nichts.
Das Stück versagte, die Schauspielerin fiel durch, das Publikum remonstrierte gegen eine geschiedene, wieder verheiratete Frau, und der Direktor beeilte sich, einen Vertrag aufzuheben, der ihm nichts nutzen konnte.
Ist das denn meine Schuld, sagte ich zu mir, mich auf meinem Bett ausstreckend, ganz zufrieden mit mir, nach diesem ersten Versuch. O, wie gut ist es doch, ein ruhiges Gewissen zu haben! Und reinen Herzens ging ich drüber hinweg.
Ein trauriges, thränenreiches Jahr verfloß, trotzdem uns ein sehnlichst gewünschtes Töchterchen geboren wurde.
Plötzlich kehrte die Theaterwut mit erneuter Kraft zurück. Die Theaterbureaux wurden abgelaufen, die Direktoren bestürmt, Reklame gemacht, nirgend ein Erfolg, überall wurden wir hinauskomplimentiert und abgewiesen.
Der Abfall meines Dramas ließ mich kalt, hatte ich doch Aussicht eine ehrenvolle Stellung in der Schriftstellerwelt zu erringen, ich wollte kein Stück mehr schreiben für herumziehende Komödianten, da ich keine Lust hatte, unser Zusammenleben durch eine vorübergehende Laune stören zu lassen, ich beschränkte mich darauf, meinen Teil an dem unvermeidlichen Ärger hinunterzuschlucken.
Schließlich ging das über meine Kräfte. Ich benutzte meine Beziehungen zu einem Theater in Finnland und setzte endlich für meine Frau eine Reihe von Gastvorstellungen durch.
Da hatte ich mir aber selbst Ruten auf den Leib gebunden! Nachdem ich als Strohwittwer während eines ganzen Monats für Küche und Haus hatte sorgen müssen, fand ich nur einen mäßigen Trost in den zwei Kisten mit Bouquets und Kränzen, die sie in das eheliche Heim mitbrachte.
Aber sie war so glücklich, so verjüngt und so reizend, daß ich mich veranlaßt sah, sofort an den Direktor wegen eines Engagements zu schreiben.
Man bedenke, ich entschloß mich, meine Heimat, meine Freunde, meine Stellung, meinen Verleger zu verlassen, um eine Laune zu befriedigen. Doch, was hilfts, entweder liebt man, oder liebt man nicht.
Zum Glück hatte der gute Mann keinen Platz für eine Schauspielerin ohne Repertoire.
War das etwa meine Schuld, wie? – Ich wälzte mich vor Vergnügen auf meinem Bett. Wie gut ist es doch, von Zeit zu Zeit eine Enquete zu veranstalten, wie es die Engländer thun. Das macht mir das Herz ganz leicht, ah, ich werde sicher wieder jung und frisch.
Wie aber kam's nachher? Nach und nach kamen Kinder an, eins, zwei, drei, dicht gesät.
Doch die Theaterwut hielt noch immer an. Schließlich mußte aber ein Ende gemacht werden. Es wurde gerade ein neues Konkurrenztheater eröffnet. Was war einfacher, als daß ich demselben ein Stück anbot, diesmal eins mit einer weiblichen Heldenrolle, ein Sensationsstück, da ja die Frauenfrage auf der Tagesordnung stand.
Gesagt, gethan! Denn – wie gesagt, entweder liebt man, oder liebt man nicht.
Also ein Drama, eine Frauenrolle, Kostüme den Umständen angemessen, eine Wiege, Mondschein, ein Bandit als Gegenstück, ein Pantoffelheld, feige, in seine Frau vernarrt (das sollte ich sein); die Frau schwanger (das war etwas Neues), das Innere eines Klosters und das Übrige.
Für die Schauspielerin war es ein kolossaler Erfolg, ein Durchfall für den Autor, ein Durchfall ... ja!
Sie war gerettet und er verloren, total zu Boden geschmettert, trotz alledem, trotz des Soupers für hundert Francs, das wir dem Direktor gegeben hatten.
Daran hatte ich nicht schuld! Wer war der Märtyrer, wer das Opfer? Ich natürlich! Nichts destoweniger bin ich ein Abscheu für alle anständigen Frauen, weil ich die Karriere meiner Frau geopfert habe. Seit Jahren mache ich mir darüber Gewissensbisse, so daß ich meine Tage nicht in Frieden beschließen kann. Wie oft hat man mir ins Gesicht, vor fremden Leuten darüber Vorwürfe gemacht! Ich?! Umgekehrt ist's gerade! Eine Karriere ist zerstört, aber welche? Und durch wen?
Ein grausamer Verdacht steigt auf, und der Humor verfliegt bei dem Gedanken, daß ich hätte als Zerstörer der Karriere dahingehen können ohne einen Verteidiger, der mich hätte reinigen können.
Bleibt noch die verschleuderte Mitgift.
Ich erinnere mich, daß man mich zum Gegenstand eines Feuilletons machte, das den Titel "Mitgiftverschwender" hatte. Ich entsinne mich dessen ganz gut, wie man es mir unter die Nase rieb, daß meine Frau ihren Mann erhalten hatte. Dieses hübsche Wort veranlaßte mich, meinen Revolver mit sechs Kugeln zu laden. Untersuchen wir einmal die Sache, weil man doch untersuchen wollte, fällen wir ein Urteil, weil man es ja für angebracht hielt, ein Urteil zu fällen.
Die Mitgift meiner Frau, welche zehntausend Francs in zweifelhaften Aktien betrug, hatte ich für meine Rechnung auf Hypotheken zu fünfzig Prozent des Nennwerts angelegt. Da kam der allgemeine Krach, und die Effekten waren fast wertlos, da man sie im kritischen Moment nicht verkaufen konnte. Ich war genötigt, meine Anleihe in Höhe von fünfzig Prozent zu zahlen. Später zahlte der Bankier, der die faulen Aktien emittiert hatte, meiner Frau fünfundzwanzig Prozent, so viel Aktiva kamen bei dem Konkurs des Bankgeschäfts heraus.
Das ist nun ein Problem für Mathematiker: Wieviel habe ich eigentlich verschleudert?
Mir scheint: Nichts. Die unverkäuflichen Effekten bringen dem Besitzer ihren wirklichen Wert, während ich ihnen durch persönliche Bürgschaft einen Mehrwert von fünfundzwanzig Prozent gegeben hatte.
Wahrhaftig! Ich bin unschuldig in dieser Sache wie in der anderen.
Und die Gewissensbisse, die Verzweiflung, die häufigen Selbstmordversuche! Und immer wieder regt sich der Verdacht, das alte Mißtrauen, der bittere Zweifel, und ich werde zur Furie, wenn ich daran denke, daß ich nahe daran war, wie ein Elender zu sterben. Mit Sorgen und Arbeiten überlastet, hatte ich niemals Zeit gefunden, mir über das Gewirre des Geräusches, der Töne, die ich hörte, über die versteckten Reden klar zu werden, und während ich ganz der Arbeit lebte, bildete sich aus dem Geschwätz der Neidischen, aus dem Geklatsch der Cafés eine boshafte Legende. Und ich, wahrhaftig, ich glaubte aller Welt, nur nicht mir! Konnte es denn wirklich möglich sein, daß ich nicht verrückt, niemals krank, niemals degeneriert war? Konnte es denn möglich sein, daß ich mich ganz ruhig täuschen ließ, täuschen von einer geliebten Sirene, deren kleine Scheere im Stande gewesen wäre, Simsons Locken abzuschneiden, während er sein Haupt, von Sorgen um sie und die Kinder müde, ihr in den Schoß legte! Vertrauend, ohne Arg hätte er während seines zehnjährigen Schlafes in den Armen der Zauberin seine Ehre verloren, seine Mannhaftigkeit, seinen Willen zum Leben, seine Intelligenz, seine fünf Sinne und noch mehr!
Wäre es möglich – ich schäme mich, es zu denken – daß ein Verbrechen zu Tage käme in all den Wirrnissen, die mich seit Jahren wie ein Phantom verfolgen; ein ganz kleines, unbewußtes Verbrechen, hervorgerufen durch den unbestimmten Wunsch nach der Macht, durch die uneingestandene Lust des Weibes, den Mann zu unterjochen in diesem Kampf zu Zweien, den man Ehe nennt!
Ich war entschlossen, alles zu erforschen, ich erhob mich, sprang aus dem Bette, wie der Gelähmte, der die imaginären Krücken fortwirft, eilig kleidete ich mich an, um nach meiner Frau zu sehen.
Ich blickte durch die halb offene Thür, und ein bezauberndes Bild bot sich meinen entzückten Augen dar. Sie lag da auf ihrem Bette, das Köpfchen in die weißen Kissen vergraben, auf deren Bezug die goldigen Haare wie Schlangen sich ringelten; von den Schultern war das Spitzenhemd geglitten, das den jungfräulichen Busen kaum noch verhüllte; der zarte geschmeidige Körper zeichnete sich unter dem weiß und rot gestreiften Deckbett ab, es zeigte sich der kleine, leicht gewölbte, entzückende Fuß, über dessen rosige Zehen, die durchsichtigen, tadellosen Nagel hervorstanden, es war ein vollkommenes Meisterwerk, ein antiker Marmor, in den menschliches Leben gegossen war. Unschuldsvoll lächeln, betrachtete sie mit keuscher Mutterfreude die drei kleinen Puppen, die in dem geblümten Kissen wie in einem Heuschober herumkletterten und versanken.
Von diesem entzückenden Schauspiel entwaffnet, sagte ich zu mir: Sei vorsichtig, wenn die Baronin mit ihren Jungen spielt.
Von der Majestät der Mutter gebändigt und unterjocht, trat ich ziemlich unsichern Schritts und furchtsam wie ein Schüler ein.
Ah, du bist ja schon aufgestanden, Männchen, begrüßte sie mich überrascht, aber nicht so angenehm überrascht, wie ich es gewünscht hätte. Ich stotterte eine Erklärung und bückte mich, um meine Frau zu küssen, aber die Kinder warfen sich auf mich und erstickten mich beinahe.
Ist das eine Verbrecherin, fragte ich mich, im Fortgehen, besiegt von den Waffen der keuschen Schönheit, durch das offene Lächeln dieses Mundes, der noch von keiner Lüge besudelt war! Tausendmal nein! Ich zog mich, vom Gegenteil überzeugt, zurück. Aber grausame Zweifel peinigten mich von Neuem. Warum hatte meine unverhoffte Besserung sie kalt gelassen? Warum hatte sie sich nicht nach dem Verlauf des Fiebers, nach den Einzelheiten der verflossenen Nacht erkundigt? Und wie sollte ich mir ihre enttäuschte Miene, ihre fast unangenehme Überraschung, ihr überlegenes, spöttisches Lächeln erklären, als sie mich wohl und munter sah. Hatte sie leise gehofft, mich an diesem schönen Morgen tot, zu finden, befreit zu werden von dem Narren, der ihr das Leben unerträglich machte? Hoffte sie die paar Tausend Francs aus der Lebensversicherung zu erhalten, welche ihr einen neuen Weg zu ihrem Ziele eröffnen sollten. Tausendmal nein! Und doch! Die Zweifel bohrten sich mir ins Herz, Zweifel an allem, an der Ehrlichkeit meines Weibes, an der Legitimität der Kinder, Zweifel an meiner Zurechnungsfähigkeit, Zweifel, welche mich erbarmungslos verfolgten.
In jedem Falle muß dieser Gedankenwirrwarr ein Ende nehmen, ich muß Gewißheit haben oder sterben. Entweder ist da ein Verbrechen verborgen, oder ich bin ein Wahnsinniger! Ich muß jetzt die Wahrheit entdecken. Ein betrogener Gatte! Meinetwegen, wenn ich es nur wüßte! Ich könnte mich dann durch ein höhnisches Lachen rächen. Giebt es einen Mann, der sicher ist, der einzig Bevorzugte zu sein? Wenn ich alle meine Jugendfreunde, die jetzt verheirathet find, im Geiste durchgehe, so finde ich keinen, der nicht mehr oder weniger betrogen wird, Und sie ahnen nichts, die Glücklichen! Man muß nicht kleinlich sein, nein! Gleiche Rechte, gleiche Pflichten! Aber nicht wissen, das ist gefährlich! Wissen, das ist die Hauptsache! Wenn ein Mann hundert Jahre lebte, so würde er niemals genau wissen, wie seine Frau lebt. Er kann die Gesellschaft, sogar die ganze Welt kennen, ohne einen Einblick in das Wesen der Frau zu gewinnen, deren Leben an das seine gekettet ist. Darum ist der arme Herr Bovary bei allen glücklichen Gatten in so angenehmer Erinnerung!
Ich aber, ich will Gewißheit haben! Ich will forschen! Um mich zu rächen! Wie thöricht! An wem? An den Bevorzugten? Sie machen nur das Recht des Mannes geltend! An der Frau? Man muß nicht kleinlich sein! Die Mutter dieser Engel ins Verderben stürzen, was fällt dir ein?
Aber ich muß unbedingt Gewißheit haben. Und dazu werde ich eine gründliche, diskrete, meinetwegen auch
Es war am 13. Mai 1875 zu Stockholm, Ich sehe mich noch im großen Saal der Königlichen Bibliothek, die einen ganzen Flügel des königlichen Palastes einnimmt. Die Wandbekleidung von weichem Holz ist allmählich braun geworden wie eine gut angerauchte Meerschaumspitze. Das ungeheuere Gebäude mit seinen Rokoko-Kartuschen, Guirlanden, Ketten, Bindepfeilern und Wappen, das in der Höhe des ersten Stockes von einer Galerie mit toskanischen Säulen umgeben ist, dehnt sich vor meinen innern Blicken aus wie ein Schlund, der mit seinen hunderttausend Bänden einem ungeheuren Gehirn gleicht, worin die Ideen vergangener Generationen ausgespeichert sind.
Die zwei Hauptabteilungen des Saales mit drei Meter hohen Regalen werden durch einen Gang getrennt, der von einem Ende des Saales bis zum andern reicht. Die Frühlingssonne wirft durch die zwölf Fenster ihre goldnen Strahlen und beleuchtet die verschiedenartigen Renaissance-Einbände. Da stehen Folianten in weißem oder goldverziertem Pergament, in schwarzem oder weißem Corduanleder aus dem 17. Jahrhundert, in Kalbleder mit rotem Schnitt aus dem 18. Jahrhundert, in grünem Leder aus der Zeit des Kaiserreichs und in den billigen Einbänden der Jetztzeit. Neben dem Theologen sitzt der Zauberkünstler, neben dem Philosophen der Naturalist, neben dem Historiker der Dichter, ein geologisches Lager von unermeßlicher Tiefe, in welchem alle Schichten wie in einem Pudding lagern, und das die Etappen der Entwickelung, menschlicher Dummheit und Weisheit anzeigt.
Ich sehe mich auf dem Balkon, wie ich eine Fuhre alter Scharteken vernagelte, die der Bibliothek jüngst ein berühmter Trödler geschenkt hatte; er war vorsichtig genug, sich die Unsterblichkeit zu sichern, indem er den Spruch: " Speravit infestis" als Devise auf seine Einbände setzte.
Da ich abergläubisch war wie ein Atheist, so machte dieser Spruch, den ich jedesmal fand, wenn ich einen Band aufschlagen wollte, einen gewissen Eindruck auf mich. Selbst im Unglück hatte er die Hoffnung behalten, dieser Ehrenmann; und das war ein Glück für ihn. Ich aber hatte alle Hoffnung fahren lassen in Betreff meiner Tragödie in fünf Akten, sechs Bildern, und drei Verwandlungen auf offener Bühne, und was meine Beförderung betrifft, so hätten erst sieben Supernumerare sterben müssen, die alle noch vollkommen gesund waren, von denen vier Renten bezogen. Wenn man sechsundzwanzig Jahre alt ist, ein Monatsgehalt von zwanzig Francs hat nebst einer in einer Dachstube aufbewahrten Tragödie in fünf Akten, ist man nur allzu sehr empfänglich für den modernen Pessimismus, diese neue Auflage des Skeptizismus, der sich so trefflich eignet für heruntergekommene Genies, die dann einen Ersatz für ein anständiges Mittagessen und für einen zu früh versetzten Überzieher suchen.
Als Mitglied einer gelehrten Bohême, die der alten Künstlerbohême nachgeahmt war, Mitarbeiter vornehmer Zeitungen und gelehrter Zeitschriften, die schlecht zahlten, als Aktionär einer Gesellschaft für die Übersetzung der Philosophie des Unbewußten, Angehöriger der freien, aber nicht unbezahlten Liebe, Inhaber des allgemeinen Titels eines königlichen Sekretärs, Verfasser von zwei im Theâtre Royal aufgeführten Akten, hatte ich Mühe, die für mein elendes Leben nöthigen Bedürfnisse aufzutreiben. Schließlich fing ich an das Leben zu hassen. Doch hatte ich den Willen zum Leben noch nicht aufgegeben; durchaus nicht, that ich doch mein Möglichstes, dieses verworrene Leben fortzuführen und mich und meine Rasse fortzupflanzen. Und man muß sagen, daß der vom gemeinen Haufen buchstäblich aufgefaßte und fälschlicher Weise mit Hypochondrie verwechselte Pessimismus schließlich dazu führt, die Welt von der heiteren und tröstlichen Seite zu betrachten. Da das All eigentlich ein Nichts ist, warum so viel Lärm darum zu machen, zumal da die Wahrheit etwas Zufälliges ist? Hat man doch jüngst entdeckt, daß die Wahrheit von gestern sich in den Unsinn von morgen verwandelt; warum soll man da seine Jugendkraft opfern, um neuen Unsinn zu entdecken? Der einzige sichere Punkt, der uns bleibt, ist der Tod, darum wollen wir also leben. Aber für wen, für was? Nachdem das ganze Gerümpel, das am Ende des vorigen Jahrhunderts abgeschafft wurde, bei der Thronbesteigung Bernadottes, dieses bekehrten Jakobiners, wieder eingeführt wurde, sah das Geschlecht von 1860, zu dem ich gehörte, alle seine Hoffnungen in Folge der parlamentarischen Reform schwinden, die mit soviel Geräusch ins Werk gesetzt worden. Die beiden Kammern, die an Stelle der Vier Stände traten, bestanden zum größten Teil aus Bauern, die den Reichstag in einen Stadtrat verwandelten wo sie ohne Scheu gemüthlich über ihre kleinen Ausgaben verhandelten und alle Fragen des Fortschritts bei Seite ließen. Die Politik stellte sich uns als ein Kompromiß lokaler und persönlicher Interessen dar, sodaß die letzte Spur eines Glaubens an das, was man damals Ideal nannte, sich zu bitteren Prinzipien zersetzte. Nimmt man hierzu die religiöse Reaktion, die nach dem Tode Karls XV. bei der Thronbesteigung der Königin Sophie von Nassau auftrat, so muß man gestehen, daß für die Entstehung eines aufgeklärten Pessimismus andre Gründe maßgebend waren als individuelle Veranlagung. – Vom Bücherstaub fast erstickt, öffnete ich ein Fenster, das nach dem Löwenhof hinausging, um ein wenig frische Luft zu schöpfen und mich am Anblick der Landschaft zu erfreuen. Eine Brise, die mit dem von den Pappeln ausgehenden Duft gewürzt war, bewegte den völlig aufgeblühten Flieder. Geißblatt und junge Weinranken begannen das Gitterwerk mit hellem Grün zu schmücken; Akazie und Platane halten noch zurück; sie kennen wohl die Launen des Mai. Und doch ist es Frühling, wenn auch das Geäste der Bäume und Sträucher unter dem jungen Laub noch sichtbar ist. Und oberhalb der Rampe, überragt von Delfter Porzellantöpfen mit dem blauen Zeichen Karls XII., treten in Kolonnen die Masten der an der Ufermauer befestigten, zu Ehren des Maifestes bewimpelten Dampfer hervor, weiterhin zwischen den beiden mit Laub- und Nadelholz bestandenen Ufern erscheint der Golf als dunkelgrüner Streifen. Alle Schiffe auf der Rhede haben ihre Nationalflaggen entfaltet, die mehr oder weniger die verschiedenen Länder symbolisieren. England mit dem Rot des blutenden Roastbeef, Spanien rot-gelb gestreift wie die Jalousie eines maurischen Balkons, die Vereinigten Staaten mit gestreiften Bettdrell, die heitere Trikolore neben der finstern Flagge des immer trauernden Deutschlands mit seinem Eisernen Kreuz in der Ecke, das Damenhemd von Dänemark, die verhüllte Trikolore von Rußland. Alles liegt Seite an Seite unter dem marineblauen nordischen Himmel. Dazu der Lärm der Kutschen, der Pfeifen, der Glocken, die Kraniche; der Geruch von Maschinenöl und gesalzenem Hering, von Leder, von Viktualien, in den sich der Duft des Flieders mischte. Diesen Geruch frischte von Zeit zu Zeit von der See her der Ostwind auf, der in die spiegelglatten Wellen der Ostsee rauschte.
Ich hatte den Büchern den Rücken zugewendet und den Kopf aus dem Fenster gebogen, um alle fünf Sinne zu erfrischen, als die Wache aufzog und im Vorbeimarschieren den Marsch aus Faust spielte. Musik, Fahnen, Blumen, der blaue Himmel, Alles fesselte mich dermaßen, daß ich gar nicht bemerkte, daß der Bureaudiener die Zeitung brachte. Er klopfte mir auf den Rücken, übergab mir einen Brief und verschwand alsbald.
Es war ein Brief von einer Dame. Ich beeilte mich, ihn zu öffnen, denn ich witterte schon eine frohe Botschaft. Wahrhaftig, es war eine.
"Kommen Sie heute Nachmittag Punkt fünf Uhr vor das Haus Nummer 65 in der Regentenstraße. Dort werden Sie mich treffen. Erkennungszeichen: Eine Notenrolle."
Das letzte Mal war ich von einer kleinen Hexe genarrt worden; daher war ich sehr geneigt und wollte es tüchtig auskosten, wenn es mir geboten würde. Aber eins ärgerte mich hierbei. Das war der sichere, fast befehlende Ton, der mein Mannesgefühl verletzte. Wie kam diese Kleine dazu, mich so unversehens zu überfallen! Was denken sich denn diese Damen mit ihrer abfälligen Meinung über unsere Tugend? Sie bittet nicht um Erlaubnis, sie läßt ihrem Opfer einfach einen Befehl zukommen. Außerdem war ich nachmittags zu einer Landpartie eingeladen, und ich verspürte keine Lust, am hellen Tage, in einer Hauptstraße die Cour zu machen. Sobald es zwei geschlagen hatte, begab ich mich zur Versammlung meiner Kollegen in das Laboratorium unseres Chemikers. Das Vorzimmer war schon voller Doktoren und Kandidaten der Philosophie und Medizin, welche die Parole für das heutige Fest entgegennehmen sollten. Ich entschuldigte mich, und man fragte mich nach den Gründen meines Ausbleibens bei den für den Abend geplanten Orgien. Der Brief, den ich dem in solchen Dingen erfahrenen Zoologen vorhielt, entlockte ihm nur ein Kopfschütteln, daß er mit einer stoßweise hervorgebrachten Sentenz begleitete:
"Das ist Nichts! Das verheiratet sich, aber verkauft sich nicht! Familientier, das! Das ist was Rechtes! Doch wie du willst! Komm nur nach, du triffst uns im Park, wenn dein Herz dich treibt und die Dame vielleicht doch anderer Art ist.
Und so fand ich mich wirklich zur richtigen Stunde vor dem angegebenen Hause ein und wartete auf das Erscheinen der schönen Unbekannten.
Diese Notenrolle war wie ein Heirathsgesuch in der Zeitung und machte mich unschlüssig, doch da sah ich mich schon einer Dame gegenüber, deren erster Eindruck auf mich, worauf ich viel gebe, ein durchaus unbestimmter war. Alter unbestimmt, zwischen neunundzwanzig und zweiundvierzig; das etwas abenteuerliche Aussehen schwankend zwischen Künstlerin und Blaustrumpf, Haustochter und Freudenmädchen, Emancipirte und Kokette. Sie stellte sich mir als Braut meines alten Freundes, des Opernsängers, vor, der sie unter meinen Schutz gestellt hätte, – doch dies erwies sich später als Lüge.
Sie war so eine Art kleiner Vogel und zwitscherte ununterbrochen; in einer halben Stunde hatte sie mich in Alles eingeweiht, was sie dachte und fühlte. Doch das interessirte mich nur mäßig, und ich fragte sie schließlich, worin ich ihr dienlich sein könnte.
– Ich soll Beschützer eines jungen Mädchens sein? rief ich. Sie wissen ja gar nicht, daß ich der leibhaftige Teufel bin!
– Ach, Sie glauben das nur von sich, ich kenne Sie ganz gut, erwiderte sie; Sie sind nur unglücklich, und man muß Sie Ihren finsteren Gedanken entreißen.
– Ach, Sie glauben mich von Grund aus und wirklich zu kennen; aber Sie kennen nur die Meinung Ihres Bräutigams über meine Person.
Es half keine Widerrede, sie wußte Alles und verstand es, in dem Herzen des Mannes zu lesen. Sie war eine jener zähen Personen, die nach der Herrschaft über die Geister trachten, indem sie sich in die geheimsten Falten des Herzens einschleichen. Sie verstand es, prächtige Briefe zu schreiben, überschüttete alle berühmten Personen mit Briefen, teilte Ratschläge aus, triefte von Ermahnungen an die jungen Leute und machte sich ein Vergnügen daraus, das Geschick der Männer zu leiten. Herrschsüchtig, wie sie war, hatte sie sich zur Leiterin eines Seelenrettungswerkes aufgeworfen und beschützte alle Welt; und so hatte sie sich auch den Beruf auferlegt, mich zu retten; kurz eine Intrigantin vom reinsten Wasser, mit wenig Geist und ungeheurer weiblicher Unternehmungslust.
Ich fing an, sie aufzuziehen, indem ich über die Welt, die Menschen und Gott spottete. Sie erklärte mich für angefault.
Aber liebes Fräulein, was fällt Ihnen ein? Alle, meine höchst modernen Ideen scheinen Ihnen angefault! Und Ihre Ideen, die aus einer vergangenen Epoche stammen, die Gemeinplätze meiner jungen Jahre, das längst Abgestandene, das Alles erscheint Ihnen ganz neu! Offen gestanden, was Sie mir als frisches Gemüse anbieten, sind nur Konserven in weißen, schlecht gelöteten Büchsen. Das riecht ja schon, wissen Sie.
Wütend und außer Fassung lief sie ohne Abschied davon.
Nachdem dies in Ordnung gebracht war, suchte ich meine Kameraden im Park auf, wo wir die ganze Nacht hindurch schwärmten.
Am andern Morgen erhielt ich, noch etwas benebelt, einen Brief voll Weibergeschwätz, strotzend von Vorwürfen, überströmend von Mitleid, von Nachsicht und von guten Wünschen für mein geistiges Wohlbefinden; schließlich bestimmte sie ein neues Rendezvous, ich sollte bei der alten Mutter ihres Bräutigams Besuch machen.
Als Mann von Erfahrung wußte ich, daß ich einen neuen Platzregen würde aushalten müssen: um möglichst billig davon zu kommen, nahm ich die Maske vollkommenster Gleichgiltigkeit in Bezug auf Gott, die Welt und alles Übrige an.
Welches Zusammentreffen! Die junge Dame, eng geschnürt, in pelzbesetztem Kleide, mit einem Rembrandt-Hute, nahm mich freundlich auf; voll Zartgefühl, wie eine ältere Schwester, vermied sie alle gefährlichen Themata, so daß bei unserm gegenseitigen Wunsche einander zu gefallen, sich unsere Geister in einer reizenden, sympathischen Unterhaltung zusammenfanden.
Nach Beendigung des Besuchs gingen wir an dem schönen Frühlingsabend zusammen spazieren.
In einer mephistophelischen Laune, auch in dem Wunsche nach Rache, da ich die langweilige Rolle eines guten Kameraden hatte spielen müssen, gestand ich ihr, daß ich halb und halb verlobt wäre, was angesichts des Umstandes, daß ich einer jungen Dame die Cour machte, nur eine halbe Lüge war.
Darauf nahm sie die Miene einer Großmutter an, fing an, das junge Mädchen zu beklagen, und fragte nach ihrem Charakter, ihrem Aussehen, ihrer Lage. Ich skizzierte ihr ein Portrait, um ihre Eifersucht zu wecken. Darauf wurde die Unterhaltung etwas einsilbig. Wirklich, ihr Interesse nahm in dem Maße ab, als der Schutzengel eine Rivalin in der Seelenrettung auftauchen sah. Wir trennten uns, ohne daß die unmerklich entstandene Kälte zwischen uns geschwunden wäre.
Die Unterhaltung am nächsten Tage drehte sich ausschließlich um die Liebe und um meine angebliche Braut.
Nachdem wir acht Tage lang mit einander Theater und Konzerte besucht und Spaziergänge gemacht hatten, war sie unmerklich in mein Leben als meine Vertraute eingetreten, unser tägliches Beisammensein gehörte zu den festen Lebensgewohnheiten, von denen ich nicht mehr lassen konnte.
Die Kunst der Unterhaltung mit einem gut erzogenen Weibe üben zu können, bot einen fast sinnlichen Reiz, es war ein Berühren der Seelen, eine Liebkosung der Geister, eine Süßigkeit für die Sinne.
Eines Morgens war sie ganz außer sich; sie las mir Stellen aus einem Briefe vor, den sie tags vorher von ihrem Bräutigam erhalten hatte; dieser war wütend vor Eifersucht. Jetzt gestand sie mir auch, daß sie gegen die Weisung ihres Verlobten gehandelt hätte. In richtiger Vorahnung daß die Sache schlecht ablaufen würde, hatte er ihr die größte Vorsicht in Bezug auf meine Person anempfohlen.
– Ich verstehe die schreckliche Eifersucht nicht, sagte sie verdrießlich.
– Weil Sie die Liebe nicht verstehen, Fräulein, antwortete ich.
– Ach, diese Liebe!
– Diese Liebe, Fräulein, ist das aufs Höchste gesteigerte Gefühl des Eigentums, und die Eifersucht ist die Furcht, zu verlieren.
– Eigentum! Pfui, Eigentum!
– Das gemeinsame Eigentum, sehen Sie. Man besitzt sich gegenseitig. Sie wollte diese Art Liebe nicht verstehen; die Liebe wäre etwas Uninteressiertes, Erhabenes, Keusches, Unbeschreibliches!
Kurz, sie liebte ihren Verlobten nicht, der, wie ich aus ihren Worten entnahm, ganz vernarrt in sie war.
Sie wurde wütend und gestand offen, daß sie ihn niemals geliebt habe.
– Und Sie wollen ihn heiraten?
– Weil er ohne mich verloren wäre.
Immer wieder die Seelenrettung!
Sie erregte sich so sehr, daß sie sogar behauptete, sie wäre gar nicht mit ihm verlobt.
Da hatten wir also Beide gelogen. Sehr aussichtsvoll!
Es blieb mir nun nichts Anderes übrig, als offen zu sein und meine Verlobung als unwahr zu erklären; es stände uns ja nun frei, von unserer Freiheit Gebrauch zu machen.
Nun verschwand wieder ihre Eifersucht, und das alte Spiel begann erst recht. Ich machte ihr schriftlich meine Erklärung, die sie versiegelt ihrem Bräutigam übersandte. Dieser zögerte nicht, mir mit wendender Post die größten Injurien anzuhängen.
Nunmehr ersuchte ich die Schöne, sich zu erklären und zwischen uns Beiden zu wählen. Aber sie hütete sich wohl, dies zu thun; sie war bereit, uns alle Beide zu wählen, drei, vier, so viel als möglich zu ihren Füßen zu haben, und verlangte nur die Gunst, anbeten zu können.
Sie war eben eine Kokette, mannstoll, eine keusche Polygamistin!
Ich aber war ganz blind, ich hatte eben nichts Besseres, ich war von der Liebe der Gosse angeekelt und von der Einsamkeit meiner Dachstube gelangweilt.
Gegen das Ende ihres Aufenthalts hatte ich sie aufgefordert, die Bibliothek zu besuchen, ich wollte sie blenden, ich wollte mich in einer Umgebung zeigen, die das kleine Gehirn des etwas dünkelhaften Vögelchens zerdrücken sollte. Ich schleppte sie von Galerie zu Galerie und stellte mein ganzes bibliographisches Wissen zur Schau; ich zwang sie, die Miniaturen gemalter Buchstaben des Mittelalters, die Autographen berühmter Personen zu bewundern; ich citierte die großen Ereignisse der Geschichte, die sich in Manuskripten und Incunabeln wiederspiegelten; und sie fühlte sich wirklich in ihrer Kleinheit niedergedrückt.
– "Sie sind ja ein Gelehrter," rief sie aus.
– "Sicherlich, Fräulein."
– "Armer Komödiant," murmelte sie.
Nun hätte man meinen sollen, der Sänger wäre durch solche Vorgänge aus dem Felde geschlagen. Weit gefehlt! Der Komödiant bedrohte mich brieflich mit einem Revolver, er beschuldigte mich, ihm seine Braut gestohlen zu haben, die er mir anvertraut hätte. Ich machte ihm begreiflich, daß ich Nichts gestohlen hätte, und daß er mir Nichts anvertraut hätte, weil er Nichts besäße, was er in Verwahrung geben könnte. Darauf wurde die Korrespondenz geschlossen, und es entstand ein bedrohliches Stillschweigen.
Der Tag der Abreise nahte heran. Am Abend vorher erhielt ich von meiner Schönen einen aufgeregten Brief, worin sie mir eine angenehme Nachricht mittheilte. Sie hätte mein Trauerspiel einigen Personen aus den vornehmen Kreisen vorgelesen, welche mit Theaterleitern in Verbindung ständen. Das Stück hätte auf genannte Personen einen bedeutenden Eindruck gemacht, und man schmeichelte sich mit der Hoffnung, den Autor kennen zu lernen. Das Nähere würde sie mir noch bei unserem Zusammensein Mittags erzählen. Zur festgesetzten Stunde schleppte mich Fräulein X. in alle Läden, wo sie ihre letzten Einkäufe machte; sie sprach fortwährend von der Lektüre meines Dramas, und von meiner Abneigung gegen Protektion wenig erbaut, nahm sie, um mich zu bekehren, zu anderen Mitteln ihre Zuflucht.
– Aber es widerstrebt mir, liebes Kind, bei fremden Leuten anzuklingeln, über alles zu plappern, nur nicht über die Hauptsache. Ich komme schließlich wie ein Bettler zu fremden Leuten, um bei ihnen anzusprechen.
Ich war im besten Zuge, energisch zu remonstrieren, als sie vor einer eleganten, hübsch gekleideten, schlanken, vornehm aussehenden Dame stehen blieb.
Sie stellte mich der Frau Baronin von Y. vor, die mir einige, im Gewühl der vorübergehenden Menschen kaum verständliche Worte sagte. Ich brachte einige unzusammenhängende Worte vor und war ärgerlich, durch eine seine List in die Falle gelockt worden zu sein. Das war sicherlich ein Komplot.
Beim Fortgehen wiederholte die Baronin die ihr von Fräulein X. nahe gelegte Einladung.
Was mich an der Erscheinung der Baronin überraschte, war die mädchenhaft kindliche Miene bei fünfundzwanzig Jahren. Sie hatte den Kopf einer Schülerin, ein kleines Gesicht, das ganz von blonden, widerspenstigen, goldigen Haaren umrahmt war, die Schultern einer Prinzessin, eine Taille schlank wie ein Peitschenstiel, ihre Art den Kopf zu neigen zeugte von Offenheit, Zuvorkommenheit und Überlegenheit. Sollte man es für möglich halten, daß diese jungfräuliche Mutter mein Trauerspiel ohne Schaden genossen hatte! Sie war an einen Hauptmann bei der Garde verheiratet und Mutter eines dreijährigen Mädchens. Sie hatte große Lust zur Bühne, aber bei der hohen Stellung ihres Gatten keine Aussicht, sie zu betreten, zumal ihr Schwiegervater noch jüngst zum Kammerherrn ernannt worden war.
So standen die Dinge, als mein Maitraum auf einem Dampfschiff, das meine Schöne in die Nähe des Komödianten brachte, verflog. Dieser trat nunmehr in meine Rechte, und es machte ihm Spaß, meine an seine Braut gerichteten Briefe zu lesen als Rache für mein gleiches Verfahren: denn ich hatte seine Briefe zuletzt immer mit seiner Braut zusammen gelesen. Noch auf der Schiffsleiter beschwor sie mich im Augenblick des zärtlichen Abschiedes, schleunigst die Baronin aufzusuchen. Das war ihr letztes Wort.
An Stelle dieser unschuldsvollen Träumereien, die so ganz verschieden waren von dem wilden Leben der gelehrten Bohême, trat nun eine Leere, die ausgefüllt werden mußte. Die enge Freundschaft mit einer gleichstehenden Frau, die Verbindung zweier Persönlichkeiten mit entgegengesetzten Ansichten hatte mir einen köstlichen Genuß bereitet, der mir durch Familienärger lange entzogen gewesen war.
Die Freude an der Häuslichkeit, die durch das Leben im Café unterdrückt gewesen, war durch den Verkehr mit einem sehr einfachen, aber im gewöhnlichen Sinne durchaus anständigen Weibe wieder angefacht worden. So stand ich denn Abends gegen sechs vor dem Thorweg eines Hauses in der Nord-Allee.
Wie fatal! Es war das elterliche Haus, worin ich die härtesten Jahre meiner Jugend verbracht hatte, worin ich alle inneren Stürme der Mannbarkeit erlebt hatte, die erste Kommunion, den Tod meiner Mutter und die Ankunft einer Stiefmutter. Von einem plötzlichen Unbehagen ergriffen, war ich versucht, umzukehren und zu fliehen, ich fürchtete alles Elend meiner Jugendjahre wiederzufinden. Der Hof lag da wie einst, die gewaltigen Eschen, deren Belaubung ich einst jeden Frühling erwartet hatte, das Haus düster, am Rande einer tiefen Sandgrube, deren drohender Einsturz ein Sinken der Mietspreise verursacht hatte.
Doch trotz dieser düsteren Erinnerungen faßte ich mir ein Herz, trat ein, stieg hinauf und klingelte. Beim Klang der Glocke erwartete ich, daß mein Vater mir öffnen würde. Ein Dienstmädchen erschien und ging hinein, um mich anzumelden. Einen Augenblick später erschien der Baron und empfing mich aufs herzlichste. Er war ein Mann von ungefähr dreißig Jahren, stark und groß, von edler Haltung, mit den Formen des vollendetsten Weltmannes. In seinem großen, etwas aufgedunsenem Gesicht leuchteten ein paar blaue Augen, die einen trüben Ausdruck hatten, wie auch sein Lächeln trübe war, das stets in einen merkwürdig bittern Zug überging und von Enttäuschungen und verfehlten Projekten Kunde gab.
Der Salon, unser früheres Eßzimmer, war mit etwas nachlässiger Künstler-Manier möbliert. Der Baron trug den Namen eines der berühmtesten Generale, der ein Condé oder Turenne seiner Heimat gewesen war. Nun hatte er es verstanden, Familienporträts aus der Zeit des 30jährigen Krieges mit weißen Kürassen und Perrücken à la Louis XIV. zusammenzubringen; sie stachen etwas sonderbar ab von den Landschaften der Düsseldorfer Schule, die daneben hingen. Hier und da standen alte aufgearbeitete, vergoldete Möbel mit Stühlen und Puffs neueren Datums zusammen. Alle Ecken waren besetzt, Alles strömte eine Behaglichkeit aus und atmete häuslichen Frieden und Freude an der Häuslichkeit.
Die Baronin trat ein, sie war reizend, herzlich, einfach, zuvorkommend. Aus ihren Mienen sprach aber doch eine gewisse Steifheit und Verlegenheit, deren Grund ich bald erriet. Stimmen, die aus dem nächsten Zimmer drangen, verrieten mir, das dort Besuch sei; ich entschuldigte mich, daß ich zu ungelegener Stunde gekommen wäre. Die Verwandten der jungen Eheleute waren zusammengekommen, um eine Partie Whist zu machen, und einige Minuten später befand ich mich im Kreise von vier Familienmitgliedern: dem Kammerherrn, dem Hauptmann a. D., der Mutter und der Tante der Baronin. Sobald die Alten sich an den Spieltisch gesetzt hatten, begannen wir, die wir die Jugend repräsentierten, eine Unterhaltung, Der Baron erzählte von seiner Vorliebe für die Malerei; mit Hilfe eines von Karl XV. verliehenen Stipendiums hatte er in Düsseldorf Studien gemacht. Da fand sich denn zwischen uns beiden ein Berührungspunkt, denn auch ich war ein früherer Stipendiat dieses Königs und zwar aus dramatischen Gründen. Nunmehr drehte sich die Unterhaltung um die Malerei, das Theater und die Persönlichkeit unseres Protektors. Unsere Mitteilungen wurden aber allmählich kühler, weil die alten Leute sich von Zeit zu Zeit in unser Gespräch mischten, heikle Punkte berührten, kaum geschlossene Wunden aufrissen, so daß ich mich schließlich in dieser heterogenen Gesellschaft unbehaglich und abgestoßen fühlte.
Ich erhob mich, um mich zu empfehlen. Der Baron und die Baronin begleiteten mich in das Vorzimmer, und hier – außerhalb der Hörweite der alten Leute – schienen sie ihre Maske abzulegen, sie luden mich für den nächsten Sonnabend zum Mittagessen im engsten Familienkreise ein. Nach kurzem Geplauder auf dem Treppenabsatz schieden wir als erklärte Freunde.
Am festgesetzten Tage begab ich mich gegen drei Uhr in die Nord-Allee. Die Wirthe nahmen mich wie einen alten erprobten Freund auf und trugen kein Bedenken, mich in die Intimitäten ihres Lebens einzuweihen. Das Mahl wurde durch gegenseitige Geständnisse gewürzt. Der Baron, dem seine Standesgenossen zuwider waren, gehörte zu den Unzufriedenen, welche die Regierung des neuen Königs geschaffen hatte. Neidisch auf die sieghafte Popularität seines verstorbenen Bruders, bemühte sich der neue Herrscher Alles zu beseitigen, was sein Vorgänger mit Liebe gepflegt hatte, so daß die Freunde des alten Regimes mit seiner freien Fröhlichkeit, seiner Toleranz, seiner Freude am Fortschritt eine aufgeklärte Oppositionsgruppe bildeten, ohne sich jedoch in die kleinlichen Kämpfe der Wahlparolen einzumischen.