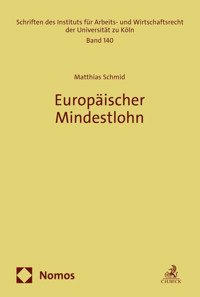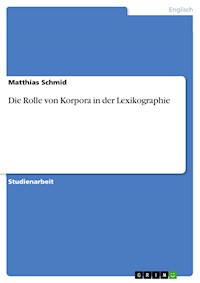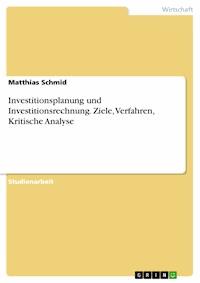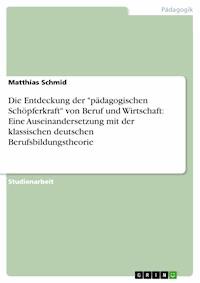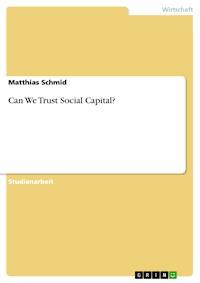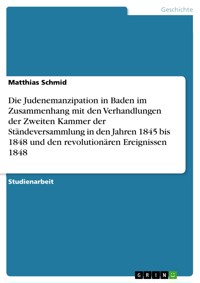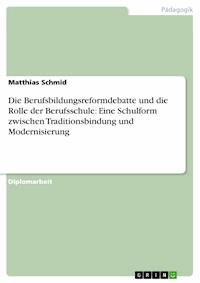
Die Berufsbildungsreformdebatte und die Rolle der Berufsschule: Eine Schulform zwischen Traditionsbindung und Modernisierung E-Book
Matthias Schmid
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Pädagogik - Schulwesen, Bildungs- u. Schulpolitik, Note: 2,0, Universität Konstanz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Berufsbildungssystem der Bundesrepublik Deutschland galt über viele Jahre im internationalen Vergleich als außerordentlich erfolgreich und leistungsfähig . Doch „die Gegenwart belohnt nicht Erfolge der Vergangenheit“ und deshalb steht das deutsche Berufbildungs- und Beschäftigungssystem vor dem Hintergrund der erheblichen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre zunehmend im Mittelpunkt der geäußerten Kritik . Im Hinblick auf die in allen Gesellschaftsbereichen diskutierten „Krisenszenarien“ der dualen Berufsbildung, der berufsbildenden Schulen sowie des deutschen Beschäftigungssystems sind in dieser Arbeit die Überlegungen auf die Berufsschule bzw. die berufsbildenden Schulen in ihrer Einbindung in das duale System der Berufsausbildung fokussiert. Die Berufsschule im dualen System bildet den Kern des beruflichen Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Verbindung mit der betrieblichen Berufsausbildung ist am stärksten auf das beruflich organisierte Beschäftigungssystem orientiert und sie weist deshalb den stärksten Berufsbezug innerhalb des beruflichen Schulwesens auf. Zusätzlich besitzt die Berufsschule die mit Abstand größte quantitative Bedeutung bezüglich der Schüler-, Klassen- und Lehrerzahlen im beruflichen Schulwesen . Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll sich auf die Berufsbildungsreformdebatte und die Rolle der Berufsschule im dualen System als einer Schulform zwischen Traditionsbindung und Modernisierung konzentrieren. Anhand dieser Diplomarbeit soll im folgenden erörtert werden, wie es zur Gründung der Berufsschule kam, wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte bewährte, welche Rolle sie als Partner der Ausbildungsbetriebe einnimmt und welche Modernisierungsaspekte angeführt werden, damit die Berufsschule durch eine innere Modernisierung oder gar durch eine Neupositionierung im Bildungssystem den enormen Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Es wurde versucht, die wichtigsten und weitreichendsten Aspekte der Berufsbildungsreformdebatte und der Rolle der Berufsschule in prägnanter Form darzustellen, um dem Leser die Vergangenheit, die Gegenwart und die mögliche Zukunft des Berufsschulwesens aufzuzeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 6
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis:Seite
Abbildung 1: Die drei Ebenen des dualen Systems.........................................................18
Abbildung 2: Nettokosten (Teilkosten) und Nutzen der betrieblichen
Berufsausbildung 2004..............................................................................69
Abbildung 3: Didaktische Handlungsebenen..................................................................50
Abbildung 4: Vom Schüler zum Lehrer: Das Modell der Arbeitgeber...........................70
Tabelle 1: Ausbildungsplatzangebot und Ausbildungsplatznachfrage
seit 1993 in der Bundesrepublik Deutschland................................................67
Tabelle 2: Durchschnittliche betriebliche Ausbildungskosten 2000
insgesamt und nach Ausbildungsbereichen....................................................68
Tabelle 3: Durchschnittliche betriebliche Ausbildungskosten 1991
und 2000 in Industrie/Handel und Handwerk in den alten Ländern...............68
Tabelle 4: Schulische Vorbildung der Berufsschüler in Prozent.....................................27
Tabelle 5: Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sowie Ausgaben für Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit..............................69
Tabelle 6: Bildungsausgaben von Bund, Länder und Gemeinden im Verhältnis zu den Schüler-/Studentenzahlen im Jahr 2002..............................................32
Tabelle 7: Der Lehrerbedarf an beruflichen Schulen in der BRD bis zum
Jahr 2020.........................................................................................................34
Page 1
Einleitung
Das Berufsbildungssystem der Bundesrepublik Deutschland galt über viele Jahre im internationalen Vergleich als außerordentlich erfolgreich und leistungsfähig1. Doch „die Gegenwart belohnt nicht Erfolge der Vergangenheit“2und deshalb steht das deutsche Berufbildungs- und Beschäftigungssystem vor dem Hintergrund der erheblichen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre zunehmend im Mittelpunkt der geäußerten Kritik3. Im Hinblick auf die in allen Gesellschaftsbereichen diskutierten „Krisenszenarien“4der dualen Berufsbildung, der berufsbildenden Schulen sowie des deutschen Beschäftigungssystems sind in dieser Arbeit die Überlegungen auf die Berufsschule bzw. die berufsbildenden Schulen in ihrer Einbindung in das duale System der Berufsausbildung fokussiert.
Die Berufsschule im dualen System bildet den Kern des beruflichen Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Verbindung mit der betrieblichen Berufsausbildung ist am stärksten auf das beruflich organisierte Beschäftigungssystem orientiert und sie weist deshalb den stärksten Berufsbezug innerhalb des beruflichen Schulwesens auf. Zusätzlich besitzt die Berufsschule die mit Abstand größte quantitative Bedeutung bezüglich der Schüler-, Klassen- und Lehrerzahlen im beruflichen Schulwesen5. Neben der Berufsschule im dualen System beinhaltet das berufliche Schulwesen die Institutionen der Berufsfachschulen, Fachschulen, berechtigungsorientierte berufliche Schulen, Berufsaufbauschulen, Fachoberschulen sowie Berufliche Gymnasien6. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll sich auf die Berufsbildungsreformdebatte und die Rolle der Berufsschule im dualen System als einer Schulform zwischen Traditionsbindung und Modernisierung konzentrieren. Die Berufsschule im dualen System ist unmittelbar mit dem beruflichen Schulwesen verbunden, so dass in manchen Bereichen auch die übrigen beruflichen Schulen von den darzustellenden Problemkontexten und Re-formvorschlägen betroffen sind. In solchen Fällen erscheint eine strikte Trennung zwischen der Berufsschule auf der einen und den übrigen beruflichen Schultypen auf der anderen Seite als nicht sinnvoll.
1Vgl. Kutscha, 1997, S. 140.
2Kutscha, 1997, S. 140.
3Vgl. Pahl, 2001, S. 9.
4Vgl. Deißinger, 1998, S. 53 f; Greinert, 2004, S. 107; Kutscha, 1998, S. 256; Sloane, 2001 a, S. 179.
5Vgl. Kaiser/Pätzold, 1999, S. 133.
6Vgl. Zabeck, 1985, S. 680.
Page 2
„Die Berufsschule ist insgesamt in die Kritik geraten“7und sie steht deshalb vor großen Herausforderungen, um auf die vielfältigen Einflüsse und Probleme bei ihrer Aufgabenerfüllung im dualen System reagieren zu können8.
Anhand dieser Diplomarbeit soll im folgenden erörtert werden, wie es zur Gründung der Berufsschule kam, wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte bewährte, welche Rolle sie als Partner der Ausbildungsbetriebe einnimmt und welche Modernisierungsaspekte angeführt werden, damit die Berufsschule durch eine innere Modernisierung oder gar durch eine Neupositionierung im Bildungssystem den enormen Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Im Rahmen dieser Untersuchung kann jedoch lediglich ein Überblick über die Geschichte der Berufsschule sowie über deren Problemfelder und Re-formvorschläge bezüglich der Berufsschule erfolgen, die nicht den Anspruch der Vollständigkeit für sich in Anspruch nehmen können. Trotzdem wurde versucht, die wichtigsten und weitreichendsten Aspekte der Berufsbildungsreformdebatte und der Rolle der Berufsschule in prägnanter Form darzustellen, um dem Leser die Vergangenheit, die Gegenwart und die mögliche Zukunft des Berufsschulwesens aufzuzeigen. Es ist eine fundamentale Erkenntnis, dass die Gegenwart nur der versteht, der die Vergangenheit kennt. Und dieser Zusammenhang erst lässt in die Zukunft blicken. Deshalb beschreibt das erste Kapitel die Geschichte der Berufsschule von der Gründung der allgemeinen Fortbildungsschulen 1870 bis zu der Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes 1969.
Die Geschichte der Berufsschule wirft zahlreiche Fragen auf, die es zu beantworten gilt:
- Welche Motivation gab es, die Fortbildungsschulen einzurichten und was waren die Kennzeichen dieses Schultyps (2.1)?
- Warum wurden die Fortbildungsschulen vom monarchischen Obrigkeitsstaat missbraucht (2.1)?
- Welche Gründe sprachen für die Umwandlung der Fortbildungsschule in eine Berufsschule und welche Rolle spielte Georg Kerschensteiner (2.1)?
- Wieso konnte die anvisierte institutionelle Weiterentwicklung der Berufsschule während der Weimarer Zeit nicht erreicht werden (2.2)?
- Welche Konsequenzen und Maßnahmen zogen die nationalsozialistischen Machthaber aus dem defizitären Organisationszustand des Berufsschulwesens (2.3)?
- Wie entwickelte sich die Berufsschule nach 1945 und welche Auswirkungen hatte
7Pahl, 2001, S. 10.
8Vgl. Zedler, 2001, S. 167.
Page 3
bzw. hat das Berufsbildungsgesetz für die Berufsschule (2.4)? Mit der Beantwortung dieser Fragen soll der, mit unter steinige Weg, der Berufsschule durch die Geschichte aufgezeigt und die Traditionsbindung der Berufsschule verdeutlicht werden.
Das zweite Kapitel charakterisiert die Rolle der Berufsschule innerhalb des dualen Systems. Im Abschnitt 2.1 wird zunächst das Wesen des dualen Systems anhand seiner drei Ebenen, die die „Dualität“ des Systems deutlich werden lassen, beschrieben. Die expliziten Aufgaben der Berufsschule in diesem dualen System werden dann im Abschnitt 2.2 dargestellt. Hierbei werden unter anderem die Fragen zu beantworten sein, wie die Kultusministerkonferenz die Rolle der Berufsschule definierte bzw. definiert und was mit dem Schlagwort der „Berufskompetenz“, die im Mittelpunkt des Bildungsauftrages der Berufsschule stehen sollte, gemeint ist.
Das dritte Kapitel untersucht die derzeitige Situation und die Entwicklungen an den Berufsschulen. Dabei sollen auch vor allem die Probleme der Berufsschulen im dualen System herausgearbeitet werden. Von der allgemeinen Problemlage der dualen Berufsausbildung ist die Berufsschule als ein Teil von dieser unmittelbar betroffen. Mit den folgenden Fragenkomplexen werden in diesem dritten Kapitel die Probleme der Berufsschulen näher erleuchtet:
- Wie kennzeichnet sich die allgemeine Problemlage des dualen Systems, d. h. welche Gründe gibt es für die sinkende Ausbildungsplatznachfrage der Jugendlichen (3.1.1) und wieso lässt sich in den letzten Jahren ein stetiger Rückgang des Angebots an Ausbildungsplätzen erkennen (3.1.2)?
- Welche Entwicklung zeigt sich bei der schulischen Vorbildung der Auszubildenden, und wie sollte diese Entwicklung in der Berufsschule berücksichtigt werden (3.2)?
- Welche Probleme treten bei der Einhaltung der Stundenpläne auf und wie lautet die Kritik am Ausbildungsumfang an den Berufsschulen (3.3.1)?
- Wieso gibt es eine curriculare Kritik und inwiefern wird diese von den Schwachstellen der schulischen Lernsituation beeinflusst (3.3.2)?
- Wie ist es um die finanzielle Förderung der Berufsschule bestellt (3.4)?
- Wie steht es um die Versorgung der Berufsschulen mit jungen, gut qualifizierten Lehrkräften und was sind die Schwächen der Lehreraus- und -weiterbildung (3.5)?
- Wie ist der Stand der Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und den Ausbildungsbetrieben einzuschätzen (3.6.1), welche individuellen Schwierigkeiten der Lernortkooperation sind vorherrschend (3.6.2) und wie sehen die institutionellen Hindernisse der Lernortkooperation aus (3.6.3)?
Page 4
Die Probleme bzw. die neuen Anforderungen, vor denen die Berufsschulen stehen, lassen sich mit den herkömmlichen Strategien nicht mehr ausreichend beantworten9. Welche Strategien bzw. Reformen für die Berufsschulen vonnöten sind, um die zahlreichen Probleme und neuen Anforderungen zu lösen, soll mit Hilfe des vierten Kapitels beant-wortet werden. Der Abschnitt 4.1 behandelt die herausragende Bedeutung der Lernortkooperation als Reformoption. Eine effektive Lernortkooperation gilt als Grundvoraussetzung für das Gelingen weiterer Reformvorstellungen und deshalb treten alle an der Berufsausbildung beteiligten Experten und Institutionen für den Ausbau der Lernortkooperation ein. Mit differenzierten und flexiblen Bildungsangeboten und Organisations-formen für die Berufsschule beschäftigt sich Abschnitt 4.2. Das Ziel dieser Reformmaßnahmen besteht darin, den unterschiedlichen Bildungsprofilen der Auszubildenden gerecht zu werden und ihnen die Möglichkeit doppelqualifizierter Maßnahmen zu eröffnen. Die Einführung des Lernfeldkonzeptes im Jahre 1996 eröffnete die große Chance, curriculare und didaktische Revisionen in der Berufsschule umzusetzen (4.3). Erste Ansätze für eine Neupositionierung der Berufsschule im Bildungssystem lassen sich in den institutionellen Revisionen erkennen (4.4). Die Vorschläge reichen von der Umwandlung der Berufsschule in ein modernes Dienstleistungsunternehmen oder eine teilautonome Schule, über die Bildung von regionalen Bildungszentren, bis zu der Errichtung autonomer „Produktionsschulen“. Die Lehrerinnen und Lehrer sind der entscheidende Schlüssel für die Umsetzung aller berufsschulpolitischen Reformen, denn „jede Qualitätsverbesserung in der Schule kann nur über die Lehrer erreicht werden“10. Deshalb beschreibt Abschnitt 4.5 mögliche Lösungsansätze einer besseren und praxisorientierteren Lehreraus- und -weiterbildung, damit die Lehrkräfte sukzessive auf die neuen An-forderungen im Berufsbildungswesen vorbereitet werden können.
Letztlich soll in einer Schlussbetrachtung ein Überblick in konzentrierter Form über alle erarbeiteten und dargestellten Ergebnisse geliefert werden. Ferner soll zur Abrundung der Arbeit, in bezug auf die zahlreichen Reformvorschläge, ein Versuch zur Beantwortung der zukünftigen Rolle der Berufsschule im dualen System unternommen werden.
9Vgl. Harney, 1994, S. 102.
10BDA, 2001, S. 49.
Page 5
1. Die Geschichte der Berufsschule
Die Geschichte der berufsbildenden Schulen in der Bundesrepublik Deutschland als explizite Systemkonzepte reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück11. Ihre Geschichte ist unmittelbar mit der Entwicklung von Gewerbe, Industrie, Naturwissenschaft und Technik sowie mit der Gesellschaft insgesamt verbunden. Zu den Gründern „dieses nicht leicht durchschaubaren Zweiges des Schulwesens“12gehörten Kirchen, Verbände von Gewerbetreibenden, gemeinnützige Vereine, Privatpersonen, Kommunen und der Staat13.
Seit ihren Anfängen befinden sich die berufsbildenden Schulen in einem Spannungsfeld zwischen pädagogischen (schulischen) Interessen und wirtschaftlichen (beruflichen) Intentionen und in diesem Spannungsfeld befinden sie sich bis in die Gegenwart14. Um die Stellung der Berufsschule im Bildungssystem, ihre Probleme innerhalb des dualen Systems sowie die Reformvorschläge für die Berufsschule verstehen zu können, ist ein Blick auf die Entstehungsgeschichte dieses Schultyps unverzichtbar15.
1.1 Von der Fortbildungsschule zur Berufsschule
Die Fortbildungsschule, die als unmittelbare organisatorische Vorläuferin der Berufsschule bezeichnet werden kann, entsprang in Deutschland ab 1870 als allgemeine Fortbildungsschule aus der Tradition der säkularisierten religiösen Sonntagsschule16. Unter dem Druck der sich veränderten Produktionsverhältnisse löste „die Welt der verstädterten Industriegesellschaft die patriarchalischen Berufserziehungssysteme“17mit den ihnen zugehörigen ständisch gefestigten Gesamterziehungsprozessen weitgehend auf18. Diese Auflösung der patriarchalischen Berufserziehungssysteme führte zu einem Defizit im Sozialisationsprozess bei den vor allem klein- und unterbürgerlichen männlichen Jugendlichen, was sich besonders ausgeprägt in Gestalt einer Erziehungslücke zwischen dem Volksschulabgang und dem Beginn des Militärdienstes bemerkbar machte19. Vor allem die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Organisationen der besitz-
11Vgl.Grottker, 2001, S. 32.
12Grüner, 1986, S. 644.
13Vgl. Grüner, 1986, S. 644.
14Vgl. Grottker, 2001, S. 32.
15Vgl. Manstetten, 2002, S. 4.
16Vgl. Blankertz, 1969, S. 128; Greinert, 2001, S. 48.
17Blankertz, 1969, S. 129.
18Vgl. Blankertz, 1969, S. 129; Greinert, 1998, S. 46.
19Vg. Greinert, 1998, S.46.