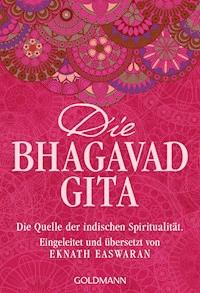
Die Bhagavad Gita E-Book
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die bedeutendste Quelle indischer Spiritualität
Die Bhagavadgita gilt als das grundlegende mystischspirituelle Werk der Inder. Entstanden vor Tausenden von Jahren, diskutiert und kommentiert die Gita grundlegende Seinsfragen wie Liebe, Freundschaft, Tod, Sinn und Ziel des Lebens und den Zyklus der Wiedergeburten. Easwaran schafft den Zugang zu diesem Werk von seiner historischen Bedingtheit her, aber er erschließt auch die universelle Gültigkeit und Zeitlosigkeit seiner Lehren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Die Bhagavad Gita gilt als das grundlegende mystisch-spirituelle Werk der Inder. Der, vermutlich zwischen dem fünften und dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstandene Text, hat die Form eines spirituellen Gedichts. Sie vereint verschiedene Denkschulen des damaligen Indien und steht den Upanischaden inhaltlich am nächsten. Im Dialog zwischen dem jungen Arjuna und Gott Krishna diskutiert und kommentiert die Gita, wie sie verkürzt genannt wird, grundlegende Seinsfragen des Lebens.
Easwaran schafft den Zugang zu diesem Werk von seiner historischen Bedingtheit her, aber er erschließt auch die universelle Gültigkeit und Zeitlosigkeit seiner Lehren.
Autor
Sir Eknath Easwaran wurde 1910 in Kerala in Südindien geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur wurde er Professor in Nagpur/ Zentralindien. 1959 kam er als Universitätslehrer nach Kalifornien. Dort wurde er bald als Buchautor, Übersetzer, als spiritueller Lehrer und vor allem als Meditationslehrer bekannt. 1961 gründete er das Blue Mountain Center of Meditation. Während er als Lehrer kleine Gruppen und den unmittelbaren Kontakt mit seinen Zuhörern bevorzugte, erreichten seine mehr als zwei Dutzend Buchveröffentlichungen weltweit ein riesiges Publikum. Er starb 1999.
Von Eknath Easwaran ist bei Goldmann außerdem erhältlich:
Die Upanischaden (21826)
Die Essenz der Upanischaden (21920)
Meditation (21848)
Das Mantra-Buch (21894)
Dhammapada (21764)
Die Bhagavad Gita
Eingeleitet und übersetzt von
Eknath Easwaran
Aus dem Amerikanischen von
Peter Kobbe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die amerikanische Originalausgabe erschien 1985, 2007 unter dem Titel »The Bhagavad Gita« bei Nilgiri Press (Blue Mountain Center of Meditation), Tomales, Kalifornien, USA.
Deutsche Erstausgabe Dezember 2012
© 2012 der deutschsprachigen Ausgabe
Wilhelm Goldmann Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
© 1985 The Blue Mountain Center of Meditation
By arrangement with Nilgiri Press, P.O. Box 256, Tomales, California 94971, www.easwaran.org.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Bildagentur FinePic, München
Lektorat: Mareike Fallwickl, Hallein
SSt · Herstellung: cb
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-08907-8 V004
www.goldmann-verlag.de
DIE BHAGAVAD GITA
Auf diesem Pfad wird Bemühung nie zunichte,
und es gibt kein Misslingen. Schon ein bisschen Bemühen
zu spirituellem Gewahrsein hin wird dich beschützen
vor der größten Angst. (2:40)
Vorwort
Die Klassiker der indischen Spiritualität
STELLEN SIE SICH einen weitläufigen Saal im angelsächsischen England vor. König Artus ist noch nicht lange tot. Es ist mitten im Winter, und draußen tobt ein grimmiger Schneesturm, aber ein großes Feuer erfüllt das Innere des Saals mit Wärme und Licht. Ab und an schießt ein Sperling herein, auf der Suche nach Zuflucht vor dem Wetter. Er taucht wie aus dem Nichts auf, flitzt freudig im Licht herum und verschwindet wieder. Woher er kommt und wohin er in jener stürmischen Dunkelheit fliegt, wissen wir nicht.
Ungefähr so ist unser Leben, einer alten Erzählung in der mittelalterlichen Kirchengeschichte des englischen Volkes von Beda dem Ehrwürdigen zufolge. Wir verbringen unsere Tage in der vertrauten Welt unserer fünf Sinne, aber von dem, was womöglich jenseits davon liegt, haben wir keine Ahnung. Jene Sperlinge sind Hinweise auf das, was draußen ist – eine riesige Welt vielleicht, die darauf wartet, erkundet zu werden. Aber die meisten von uns bleiben gerne, wo sie sind. Möglicherweise fürchten wir uns ein bisschen davor, uns ins Unbekannte zu wagen. Was würde das bringen?, fragen wir. Warum sollten wir die Welt verlassen, die wir kennen?
Und doch gibt es immer ein paar wenige, die sich nicht damit zufriedengeben, ihr Leben im Haus zu verbringen. Das bloße Wissen, dass es etwas Unbekanntes außerhalb ihrer Reichweite gibt, macht sie ruhelos. Sie müssen sehen, was draußen liegt – und wenn auch nur, wie der englische Bergsteiger George Mallory vom Everest sagte, »weil es da ist«.
Das trifft auf alle Abenteurer zu, aber insbesondere auf jene, die nicht Berge oder Dschungel, sondern das Bewusstsein selbst zu erkunden suchen: deren eigentlicher Antrieb nicht so sehr darin besteht, das Unbekannte zu kennen, als vielmehr darin, den Wissenden zu kennen. Solche Männer und Frauen kann man in allen Zeitaltern und allen Kulturen finden. Während wir Übrigen uns nicht vom Fleck rühren, schlüpfen sie leise hinaus, um zu sehen, was jenseits der Mauern und Grenzen liegt.
Dann verschwinden sie. Wir haben keine Ahnung, wo sie sind, wir können es uns nicht einmal vorstellen. Aber dann und wann schicken sie, wie Freunde, die in einem exotischen Land unterwegs sind, Berichte: atemlose Botschaften, die von fantastischen Abenteuern zeugen, weitschweifende Briefe über eine Welt jenseits der alltäglichen Erfahrung, dringende Telegramme, die uns inständig bitten, zu kommen und uns all die Wunder selbst anzuschauen. »Sieh dir dieses Panorama an! Ist es nicht atemberaubend? Ich wünschte, du könntest das sehen. Ich wünschte, du wärst hier.«
Die Werke in dieser Übersetzungsreihe – die Upanischaden, die Bhagavad Gita und das Dhammapada – zählen zu den frühesten und universalen Botschaften solcher Art. Sie wurden abgesandt, um uns zu informieren, dass das Leben mehr in sich birgt als die Alltagserfahrung unserer Sinne. Die Upanischaden sind die ältesten dieser Berichte, und sie sind so unterschiedlich, dass wir den Eindruck haben, als hätten irgendwelche unbekannten Sammler sämtliche auffindbaren Fotos, Postkarten und Briefe aus dieser Welt zusammengeworfen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Quelle oder Sachlage. Solchermaßen zusammengewürfelt bilden sie eine Art ekstatische Slideshow – Schnappschüsse von himmelhohen Gipfeln des Bewusstseins, aufgenommen zu verschiedenen Zeiten von unterschiedlichen Beobachtern und abgeschickt mit nur knappen Erläuterungen. Aber diejenigen, die jene Höhen bereist haben, werden die Bilder wiedererkennen: »Oh, ja, das ist der Everest vom Nordwesten aus – muss Spätfrühling sein. Und hier sind wir südlich, im vollen Winterschnee.«
Auch das Dhammapada ist eine Sammlung – der Tradition nach von Aussprüchen des Buddha, der zu den allergrößten unter diesen Erforschern des Bewusstseins gehört. In diesem Fall sind die Botschaften sortiert, aber nicht nach einem Schema, das uns heute einleuchtet. Statt nach einem Thema oder Gegenstand, sind sie gemäß irgendeines dominanten Merkmals wie etwa eines Symbols oder einer Metapher – Blumen, Vögel, ein Fluss, der Himmel – gruppiert, wodurch sie sich leicht auswendig lernen lassen. Wenn die Upanischaden wie Dias sind, ist das Dhammapada wie ein Feldführer. Das ist überliefertes Wissen, zusammengestellt von jemandem, der jeden Schritt auf den Wegen durch diese fremdartigen Länder kennt. Er kann uns nicht dorthin bringen, erklärt er, aber er kann uns den Weg zeigen: uns sagen, wonach wir suchen sollen, vor Fehlschritten warnen, uns über Umwege beraten, uns sagen, was wir meiden sollen. Und was am wichtigsten ist: Er drängt uns dazu, diese Reise selbst zu machen, weil es unsere Bestimmung als Mensch ist. Alles andere ist zweitrangig.
Der dritte dieser Klassiker, die Bhagavad Gita, gibt uns eine Karte und einen Reiseführer. Sie enthält einen systematischen Überblick über das Gebiet, zeigt uns verschiedene Arten der Annäherung an den Gipfel mit ihren Vorteilen und Tücken, bringt Empfehlungen vor, sagt uns, was wir dabeihaben und was wir zurücklassen sollen. Die Bhagavad Gita empfinden wir als einen persönlichen Führer. Sie stellt und beantwortet die Fragen, die Sie oder ich stellen könnten – Fragen, in denen es nicht um Philosophie oder Mystik geht, sondern darum, wie man in einer Welt der Herausforderung und Veränderung leben kann. Von den drei genannten Botschaften ist es die Gita, die mein eigener persönlicher Reiseführer war und ist, genauso wie sie Mahatma Gandhi angeleitet hat.
Diese drei Texte sind sehr persönliche Aufzeichnungen einer Landschaft, die sowohl real als auch universal ist. Ihre Stimmen, leidenschaftlich menschlich, sprechen direkt zu Ihnen und zu mir. Sie beschreiben die Topografie des Bewusstseins selbst, die zu uns heutigen Menschen ebenso gehört wie zu den größtenteils anonymen Sehern vor Tausenden von Jahren. Sie sagen uns, dass auch jene Landschaft, die im Licht der Sinneswahrnehmung dunkel zu sein scheint, doch eine ganz eigene Beleuchtung hat. Und sobald sich unsere Augen anpassen, können wir in dem sehen, was westliche Mystiker dieses »göttliche Dunkel« nennen, und ihre Beschreibungen selbst überprüfen.
Diese Welt, behaupten sie beharrlich, ist es, wohin wir gehören. Dieses weitere Bewusstseinsfeld ist unser Heimatland. Wir sind keine zu einem eingeengten Leben geborenen Kajütenbewohner. Wir sollen, bestimmungsgemäß, unser Potenzial als Menschen erkunden, seine Erfüllung anstreben und es beständig vergrößern. Die Welt der Sinne ist nur ein Basislager: Wir sollen im Bewusstsein ebenso sehr zuhause sein wie in der Welt der physisch-materiellen Realität. Das ist unsere Bestimmung.
Diese Botschaft begeistert Männer und Frauen in allen Zeitaltern und Kulturen. Genau für solche Gleichgesinnte wurden diese Texte ursprünglich verfasst, und genau für sie in unserer eigenen Zeit habe ich diese Texte übersetzt, in der Überzeugung, dass sie heute ebenso eine Leserschaft verdienen wie zu allen Zeiten. Sollten diese Bücher auch nur eine Handvoll solcher Leser ansprechen, dann haben sie gewiss ihren Zweck erfüllt.
Einführung
Die Bhagavad Gita
VOR VIELEN JAHREN, als ich noch Student im Aufbaustudium war, reiste ich mit dem Zug von Zentralindien nach Simla, dem damaligen Sommersitz der britischen Regierung in Indien. Wir hatten Delhi noch nicht lange zuvor verlassen, als plötzlich Stimmengeschnatter meine Träumerei störte. Ich fragte den Mann neben mir, ob irgendetwas passiert sei. »Kurukshetra!«, erwiderte er. »Der nächste Halt ist in Kurukshetra!«
Ich konnte die Aufregung verstehen. Kurukshetra, »das Feld der Kurus«, ist der Schauplatz für die den Höhepunkt bildende Schlacht im Mahabharata, dem größten Epos der Weltliteratur, auf dessen Basis praktisch jedes hinduistische Kind in Indien großgezogen wird. Seine zeitlich etwa dreitausend Jahre entfernten Figuren sind uns so vertraut wie unsere Verwandten. Der Grundtenor der Handlung ist äußerst zeitnah. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich im Atomzeitalter ebenso leicht entfaltet wie zu Beginn der indischen Geschichte. Das Mahabharata ist Literatur in ihrer großartigsten Form – tatsächlich hat man es als Literatur für sich bezeichnet, in ihrer Breite und Tiefe und Figurengestaltung vergleichbar mit der gesamten griechischen Literatur oder mit Shakespeare. Was dieses literarische Meisterwerk aber einzigartig macht, ist, dass es, eingebettet in seine Handlung, eines der vortrefflichsten mystischen Dokumente enthält, welche die Welt kennt: die Bhagavad Gita.
Ich muss die Gita, während ich aufwuchs, gewiss tausende Male gehört haben, aber sie hatte damals keine besondere Bedeutung für mich. Erst als ich aufs College ging und Mahatma Gandhi kennenlernte, begann ich zu verstehen, warum nichts in dem langen, reichhaltigen Kontinuum der indischen Kultur eine größere Breitenwirkung nicht nur innerhalb Indiens, sondern auch außerhalb gehabt hat als die Gita. Heute, nach mehr als dreißig Jahren hingebungsvollen Studiums, zögere ich nicht, sie als Indiens bedeutsamstes Geschenk an die Welt zu bezeichnen. Die Gita ist in alle größeren Sprachen übersetzt worden, hundertmal allein ins Englische. Die Kommentare dazu sollen angeblich zahlreicher sein als zu jeder anderen heiligen Schrift. Wie die Bergpredigt hat die Bhagavad Gita eine Unmittelbarkeit, die Zeit, Ort und Umstände hinwegfegt. An jedermann, egal, mit welchem Hintergrund oder Status, gerichtet, destilliert die Gita die erhabensten Wahrheiten von Indiens uralter Weisheit zu einfacher, einprägsamer Poesie, die den Geist nicht mehr loslässt und das Alltagsleben durchdringt.
Alle in unserem Waggon stiegen aus dem Zug aus, um ein paar Minuten lang über das jetzt friedvolle Feld zu schlendern. Tausende Jahre vorher war dies Armageddon. Achtzehn Tage lang vibrierte die Luft von den Muschelhörnern und dem Schlachtgeschrei. Große geschlossene Schlachtreihen, wie Adler und Fische und die Mondsichel geformt, wogten hin und her und rangen um den Sieg, bis am Ende fast alle Krieger des Landes erschlagen dalagen.
»Stell dir das vor!«, sagte mein Gefährte respektvoll und ergriffen. »Bhishma und Drona befehligten hier ihre Heere. Arjuna fuhr hier in seinem Kampfwagen, mit Sri Krishna selbst als seinem Wagenlenker. Wo du jetzt grade stehst, könnte – wer weiß? – Arjuna gesessen haben, seinen Bogen und seine Pfeile auf dem Boden, während Krishna ihm die Worte der Bhagavad Gita mitteilte.«
Der Gedanke war erregend. Ich fühlte mich so, wie Schliemann sich gefühlt haben muss, als er endlich jenes öde Felsufer in der Westtürkei erreichte und wusste, dass er »auf den widerhallenden Ebenen des windigen Troja« stand und denselben Boden beschritt wie Achilles, Odysseus, Hektor und Helena. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich den Schauplatz der Gita viel inniger, intimer kannte, als ich dieses friedvolle Feld je würde kennen können. Das Schlachtfeld ist eine ideale Kulisse, aber der Gegenstand der Gita ist der Krieg im Innern, der Kampf um die Beherrschung seiner selbst, den jeder Mensch führen muss, wenn er oder sie aus seinem Leben siegreich hervorgehen soll.
Die Gita und ihr Schauplatz
Historiker mutmaßen, dass das Mahabharata wie die Ilias durchaus auf tatsächlichen Geschehnissen basieren könnte, die in einen Krieg gipfelten, der zirka 1000 v. Chr. stattfand – das heißt nahe beim unmittelbaren Beginn der aufgezeichneten indischen Geschichte. Diese Vermutung wurde vor nicht allzu langer Zeit durch Ausgrabungen bei der antiken Stadt Dvaraka gestützt, die, dem Mahabharata zufolge, nach dem Weggang ihres göttlichen Herrschers, Krishna, zerstört und im Meer versenkt wurde. Nur etwa fünfhundert Jahre zuvor waren einer allgemein akzeptierten Theorie zufolge arische Stämme in den indischen Subkontinent eingewandert, die ursprünglich aus der Region zwischen dem Kaspischen Meer und dem Hindukusch-Gebirge stammten. Sie brachten den Prototyp der Sanskrit-Sprache sowie zahllose Glaubens- und Kulturelemente mit, die seitdem zur hinduistischen Tradition gehören. Der älteste Teil der hinduistischen heiligen Schriften, der Rigveda, stammt aus diesem Zeitraum um 1500 v. Chr., wenn er nicht sogar noch älter ist.
Doch der Urquell des indischen religiösen Glaubens kann, meiner Überzeugung nach, in eine viel frühere Epoche zurückverlegt werden. Als die Arier durch die Berge des Hindukusch in den indischen Subkontinent eindrangen, trafen sie auf eine Zivilisation an den Ufern des Indus-Flusses, die Archäologen auf eine Zeit bis 3000 v. Chr. zurückdatieren. In etwa zeitgleich mit den Pyramiden-Erbauern am Nil erreichten diese Bewohner der Indusregion ein vergleichbares Technologieniveau. Sie hatten Metallarbeiter, die begabt waren im Herstellen von Blechplatten, im Vernieten und im Kupfer- und Bronzeguss; Handwerk und Gewerbe mit standardisierten Produktionsmethoden; Land- und Seehandel mit Kulturen, die so weit entfernt waren wie beispielsweise Mesopotamien; und gut geplante Städte mit Wasserversorgung und öffentlichem Kanalisationssystem, das bis zu den Römern beispiellos blieb. Die Anzeichen sprechen dafür, dass sie möglicherweise ein Dezimal-Maßsystem verwendet haben. Was aber am bemerkenswertesten ist: Darstellungen von Shiva als Yogeshvara, der Herr des Yoga, legen nahe, dass Meditation in einer Zivilisation praktiziert wurde, die bereits ein Jahrtausend, bevor die Veden einer mündlichen Überlieferung anvertraut wurden, florierte.
Das würde implizieren, dass die Industal-Bewohner sich nicht nur systematisch mit ihrer Technologie beschäftigten, sondern auch mit dem Studium des Geistes. Das war Brahmavidya, die »höchste Wissenschaft« – die höchste, weil Brahmavidya im Unterschied zu anderen Wissenschaften, welche die Außenwelt studierten, Kenntnis einer zugrunde liegenden Wirklichkeit suchte, die alle anderen Studien und Aktivitäten beeinflussen und durchdringen sollte.
Welches auch immer ihre Ursprünge sein mögen, im frühen Teil des ersten Jahrtausends v. Chr. finden wir sowohl die Methoden als auch die Entdeckungen von Brahmavidya klar angegeben. Mit diesem introspektiven Werkzeug analysierten die inspirierten Rishis (wörtlich »Seher«) Altindiens ihr Gesamtgewahrsein der menschlichen Erfahrung, um zu sehen, ob es darin irgendetwas gab, das absolut war. Ihre Untersuchungsergebnisse lassen sich in drei Aussagen zusammenfassen, die Aldous Huxley, in Anlehnung an Leibniz, die Ewige Philosophie (oder: Philosophia perennis) genannt hat, weil sie in allen Zeitaltern und Zivilisationen auftauchen: (1) Es gibt eine unendliche/unbegrenzte, unveränderliche Wirklichkeit unter der Welt der Veränderung; (2) ebendiese Wirklichkeit liegt im Innersten einer jeden menschlichen Persönlichkeit; (3) der Zweck des Lebens besteht darin, diese Wirklichkeit empirisch, durch eigene Erfahrung, zu entdecken: das heißt, Gott während des eigenen Erdendaseins zu realisieren. Diese Prinzipien und die inneren Experimente zu ihrer Gewahrwerdung wurden systematisch in »Waldakademien« oder Ashrams gelehrt – eine Tradition, die sich nach etwa dreitausend Jahren auch heute noch ungebrochen fortsetzt.
Die Entdeckungen der Brahmavidya wurden ins Gedächtnis eingeprägt (und letzten Endes niedergeschrieben), und zwar in den Upanischaden, visionären Dokumenten, welche die früheste und reinste Darlegung der Ewigen Philosophie sind. Wie viele von diesen kostbaren Aufzeichnungen einst existierten, weiß niemand. Ein Dutzend Upanischaden, die auf vedische Zeiten zurückgehen, sind als Bestandteil des autoritativen hinduistischen Kanons, der vier Veden, erhalten geblieben. Alle haben ein unverkennbares Qualitätsmerkmal: die lebendige Prägung persönlicher mystischer Erfahrung. Das sind Aufzeichnungen von einer direkten Begegnung mit dem Göttlichen. Die Überlieferung nennt sie shruti: wörtlich »gehört«, im Gegensatz zu gelernt; sie sind ihre eigene Autorität. Der Konvention nach gelten nur die (ihre Upanischaden enthaltenden) Veden als shruti, auf direkter Gotteskenntnis beruhend.
Dieser Definition zufolge sind alle anderen indischen heiligen Schriften – einschließlich der Gita – zweitrangig, von der höheren Autorität der Veden abhängig. Allerdings ist das eine konventionelle Unterscheidung und eine, die das Wesen der von ihr klassifizierten Dokumente womöglich verschleiert. Im wörtlichen Sinne ist auch die Gita shruti, verdankt sie doch ihre Autorität nicht anderen heiligen Schriften, sondern der Tatsache, dass in ihr die direkte mystische Erfahrung eines einzelnen Autors niedergeschrieben ist. Shankara, ein überragender Mystiker des neunten Jahrhunderts v. Chr., dessen Wort die Autorität von Augustinus, Meister Eckhart und Thomas von Aquin gesamtumfänglich in sich trägt, muss das ebenso empfunden haben, denn bei der Auslese der Mindestquellen des Hinduismus überging er fast einhundert Upanischaden von vedischer Autorität, um schließlich zehn zentrale Upanischaden und die Bhagavad Gita auszuwählen.
Die Gita ist in meinen Augen kein integraler Bestandteil des Mahabharata. Sie ist im Grunde genommen eine Upanischad, und meine Vermutung ist, dass sie von einem inspirierten Seher (traditionellerweise Vyasa) niedergeschrieben und an der geeigneten Stelle in das Epos eingefügt wurde. Andere Elemente wurden auf ebendiese Weise zum Mahabharata sowie anderen populären zweitrangigen heiligen Schriften hinzugefügt. Das ist eine effektive Methode, neues Material in einer mündlichen Überlieferung zu bewahren. Dieser Gedanke hat auch traditionelles Gewicht, denn so weit man es zurückverfolgen kann, endet jedes einzelne Kapitel der Gita immer schon mit der Formel: »In der Bhagavad-Gita-Upanischad, dem Text über die höchste Wissenschaft [brahmavidya] des Yoga, ist dies das Kapitel mit dem Titel …«
Schließlich können wir, zur weiteren Untermauerung, beobachten, dass die Gita, mit Ausnahme ihres ersten Kapitels, das den szenischen Rahmen herstellt, die Handlung des Mahabharata nicht fortführt und auch noch geradezu im Widerspruch zu ihr steht. Die Schlachtlinien sind gegeneinander aufgestellt – der Höhepunkt jahrzehntelanger Zwietracht –, und am Vorabend des Gefechts verliert Prinz Arjuna die Nerven und fragt seinen Wagenlenker, Krishna, was er tun soll. Und dann? Krishna – kein gewöhnlicher Wagenlenker, sondern eine Inkarnation Gottes – beginnt eine sublime Unterweisung von etwa siebenhundert Versen über das Wesen der Seele und ihre Beziehung zu Gott, die Ebenen des Bewusstseins und der Wirklichkeit, die Beschaffenheit der Erscheinungswelt und so weiter, gipfelnd in einer stupenden mystischen Erfahrung, in der er sich Arjuna als der transzendente Herr des Lebens und des Todes offenbart. Er rät Arjuna, gegenüber Freund und Feind gleichermaßen mitfühlend zu sein, sich selbst in jedem Menschen zu sehen, den Kummer anderer als seinen eigenen zu erleiden. Dann ist die Gita zu Ende, die Erzählung wird fortgesetzt, und es geht hinein ins Schlachtgetümmel – ein schreckliches, verzweifeltes Gemetzel, das die Ehre eines jeden in Frage stellt, aus dem schlussendlich Arjunas Seite siegreich hervorgeht. Aber auf beiden Seiten ist fast jeder Mann kampffähigen Alters tot. Nur ein Genie würde die Gita in solch einen dramatischen Handlungsrahmen stellen, und sie ragt aus dem Übrigen heraus als eine zeitlose, praktische Anleitung für das tägliche Leben.
Für diejenigen, die sich fragen, ob dieser dramatische Handlungsrahmen zur spirituellen Unterweisung gehört und ob die Gita den Krieg rechtfertigt, hatte Gandhi eine praxisnahe Antwort: Gründe doch einfach dein Leben ernsthaft und systematisch auf der Gita, und schau, ob es mit ihren Lehren vereinbar ist, andere zu töten oder auch nur zu verletzen. (Das gleiche Argument bringt er in Bezug auf die Bergpredigt vor.) Der innerste Kern der Botschaft der Gita ist, den Herrn in allen Geschöpfen zu sehen und entsprechend zu handeln, und diese heilige Schrift ist voller Verse, die auf den Punkt bringen, was das bedeutet:
Ich bin immer anwesend für jene, die mich in jeglichem
Lebewesen klar gewahrt haben. Alles Leben als meine
Manifestation sehend, werden sie nie von mir getrennt.
Sie verehren mich in den Herzen aller, und all ihr Tun
geht aus von mir. Wo auch immer sie leben mögen,
sie weilen in mir. (6:30-31)
Wenn ein Mensch auf die Freuden und Leiden anderer
so reagiert, als ob sie seine eigenen wären, hat er
den höchsten Zustand spiritueller Vereinigung erreicht.
(6:32)
Den liebe ich, der unfähig ist zu Feindseligkeit,
der freundlich und mitfühlend ist. (12:13)
Sie allein sehen wirklich, die den Herrn als denselben in jedwedem Geschöpf sehen, die das Todlose in den Herzen aller sehen, die sterben. Überall denselben Herrn sehend, schaden sie sich und anderen nicht. Somit erreichen sie das höchste Ziel. (13:27-28)
Gelehrte können den Punkt immerfort erörtern, aber wenn die Gita praktiziert wird, denke ich, wird es klar, dass der Kampf, mit dem sich die Gita befasst, der Kampf um die Beherrschung seiner selbst ist. Es war eine geniale Idee von Vyasa, das ganze große Mahabharata-Epos herzunehmen und es als Metapher für den immerwährenden Krieg zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Finsternis in jedem menschlichen Herzen anzusehen. Arjuna und Krishna sind dann nicht mehr bloß Figuren in einem literarischen Meisterwerk. Arjuna wird zu einem Jedermann, der dem Herrn selbst, Sri Krishna, die ewigen Fragen über Leben und Tod stellt – nicht als Philosoph, sondern als der exemplarische Mann der Tat. So gedeutet ist die Gita kein äußerer Dialog, sondern ein innerer: zwischen der gewöhnlichen menschlichen Persönlichkeit, voller Fragen nach dem Sinn des Lebens, und unserem tiefsten Selbst, das göttlich ist.
Es gibt in der Tat keine andere Deutungsmöglichkeit der Gita als ebendie, sie als spirituelle Unterweisung zu begreifen. Wenn ich nur einen Schlüssel zum Verständnis dieses göttlichen Dialogs anbieten könnte, wäre es der, sich zu vergegenwärtigen, dass er in den Tiefen des Bewusstseins stattfindet und dass Krishna nicht irgendein äußeres, menschliches oder übermenschliches Wesen ist, sondern der Funke Göttlichkeit, der im Innersten der menschlichen Persönlichkeit liegt. Das ist keine literarische oder philosophische Vermutung; Krishna sagt das zu Arjuna immer und immer wieder: »Ich bin das wahre Selbst im Herzen aller Kreaturen, Arjuna, und der Anfang, die Mitte und das Ende ihres Daseins.« (10:20)
In solchen Aussagen destilliert die Gita die Essenz der Upanischaden, nicht stückchenweise, sondern umfassend, indem sie deren erhabene Einsichten als eine Anleitung nicht für Philosophie, sondern für alltägliche menschliche Aktivität darbietet – ein in der Weltgeschichte einzigartiger Leitfaden der Ewigen Philosophie.
Der upanischadische Hintergrund
Die Gita setzt natürlich als selbstverständlich voraus, dass ihre Leserschaft mit den grundlegenden Ideen des hinduistischen religiösen Denkens vertraut ist, von denen man fast alle in den Upanischaden finden kann. Außerdem wird darin Fachvokabular aus der Yoga-Psychologie verwendet. All das muss in heutigen Begriffen erläutert werden, wenn der moderne Leser begreifen soll, was an der Botschaft der Gita wesentlich und zeitlos ist, und sich nicht in fremdartiger Terminologie festfahren soll.
Zunächst jedoch sieht sich der Nicht-Hindu einem dritten Hindernis gegenüber: der Vielzahl von Namen und Bezeichnungen, die für verschiedene Aspekte Gottes verwendet werden. Von den frühesten Zeiten an hat der Hinduismus einen Gott verkündet, während er die Verehrung von ihm (oder ihr, denn für Millionen Menschen ist Gott die Göttliche Mutter) in vielen verschiedenen Namen und Bezeichnungen unterbringt. »Die Wahrheit ist eine«, lautet ein berühmter Vers des Rigveda, »die Menschen bezeichnen sie mit unterschiedlichen Namen.« Monastische Gottesverehrer oder Devotees könnten finden, dass Shiva die strenge Losgelöstheit verkörpert, nach der sie streben; Devotees, die »in der Welt« leben wollen, an deren unschuldigen Freuden teilhabend, aber dem Dienst an ihren Mitgeschöpfen gewidmet, könnten in Krischna die vollkommene Inkarnation ihrer Ideale sehen. In jedem Fall dient diese Einkleidung des Unendlichen in menschliche Gestalt dazu, die Liebe eines Devotees oder einer Devotee zu fokussieren und ein inspirierendes Ideal zu bieten. Aber welche Gestalt auch immer verehrt wird, sie ist nur ein Aspekt desselben Gottes.
In der Gita – genau genommen praktisch überall in hinduistischem Mythos und Schrifttum – begegnen wir außerdem auch »den Göttern« im Plural. Das sind die Devas, Gottheiten, die mit den Ariern gekommen sind und erkennbare Gegenspieler in anderen arisch beeinflussten Kulturen haben: Indra, Gott des Krieges und Sturmes; Varuna, Gott der Gewässer und ein moralischer Aufpasser; Agni, Gott des Feuers, der dem Hermes ähnliche Vermittler zwischen Himmel und Erde; und so weiter. Die Gita zeigt die Devas als Instanzen, die von jenen verehrt werden, die natürliche und übernatürliche Mächte versöhnlich stimmen wollen, weitgehend auf die gleiche Weise, wie man Ahnen verehrte. Aus heutiger Sicht lassen sie sich am besten als Personifizierungen der Naturgewalten verstehen.
Da dies nun geklärt ist, können wir zum upanischadischen Hintergrund weitergehen, den die Gita als gegeben voraussetzt.
Atman und Brahman
Die Upanischaden sind keine systematische Philosophie. Sie gleichen eher ekstatischen Diashows mystischer Erfahrungen – sie sind lebendig, unzusammenhängend, geprägt von der Kraft direkter persönlicher Begegnungen mit dem Göttlichen. Wenn sie Widersprüche in sich zu bergen scheinen, so liegt das daran, dass sie nicht versuchen, die Kanten und Fugen dieser Erfahrungen zu glätten. In ihnen wurde nur schriftlich niedergelegt, was die Rishis sahen, als sie die letztgültige Wirklichkeit von verschiedenen Ebenen des spirituellen Gewahrseins aus betrachteten. Die Upanischaden sind wie Schnappschüsse des gleichen Gegenstandes aus verschiedenen Blickwinkeln: Gott jetzt beispielsweise als absolut transzendent, dann gleichermaßen als immanent. Diese Unterschiede sind nicht wichtig, und die Upanischaden stimmen in ihren Hauptideen überein: Brahman, die Gottheit; Atman, der göttliche Kern der Persönlichkeit; Dharma, das Gesetz, das die Einheit der Schöpfung zum Ausdruck bringt und aufrechterhält; Karma, das Gewebe von Ursache und Wirkung; Samsara, der Kreislauf von Geburt und Tod; Moksha, die spirituelle Befreiung, die das höchste Ziel des Lebens ist.
Während in Altindien Durchbrüche in den Naturwissenschaften und der Mathematik gelangen, wandten sich die weisen Meister der Upanischaden nach innen, um die Daten zu analysieren, welche die Natur dem Geist darbietet. Unter die Sinne vordringend fanden sie nicht eine Welt fester, gesonderter Objekte, sondern einen unaufhörlichen Prozess der Veränderung – Materie, die zusammenkam, sich auflöste und in anderer Form wiederum zusammenkam. Unter diesem Fluss der Dinge mit »Name und Form« entdeckten sie jedoch etwas Unveränderliches: eine unendliche, unteilbare Wirklichkeit, in der die vergänglichen Informationen der Welt zusammengehalten werden. Diese Wirklichkeit nannten sie das Brahman: die Gottheit, den göttlichen Seinsgrund.
Diese Analyse der Erscheinungswelt stimmt ganz gut mit der zeitgenössischen Physik überein. Ein Physiker würde uns daran erinnern, dass die Dinge, die wir »da draußen« sehen, nicht grundlegend voneinander und von uns getrennt sind. Wir nehmen sie aufgrund der Beschränkungen unserer Sinne als getrennt wahr. Wenn unsere Augen auf ein viel feineres Spektrum reagierten, könnten wir die Welt womöglich als ein kontinuierliches Feld aus Materie und Energie sehen. Nichts in diesem Bild ähnelt einem festen Gegenstand nach unserem gewöhnlichen Verständnis des Wortes. »Die Außenwelt der Physik«, schrieb der britische Astrophysiker Sir Arthur Eddington, »ist somit zu einer Schattenwelt geworden. Indem wir unsere Illusionen beseitigen, beseitigen wir die Substanz, denn tatsächlich haben wir gesehen, dass die Substanz eine der größten unserer Illusionen ist.« Wie die Physiker suchten die antiken Weisen eine Invariante. Sie fanden sie im Brahman.
Bei der Untersuchung der Erkenntnisse über uns Menschen machten die weisen Meister eine ähnliche Entdeckung. Statt einer einzelnen zusammenhängenden Persönlichkeit fanden sie Schicht um Schicht von Komponenten – Sinne, Emotionen, Willen, Intellekt, Ego –, von denen jede sich im Fluss befindet. Zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlicher Gesellschaft scheint dieselbe Person verschiedene Persönlichkeiten zu haben. Stimmungen wechseln und flackern, selbst bei jenen, die emotional stabil sind. Wünsche und Ansichten verändern sich mit der Zeit. Veränderung ist das Wesen des Geistes. Die weisen Meister beobachteten diesen fortwährenden Fluss von Gedanken und Empfindungen und fragten: »Wo bin denn dann ich?« Die Teile summieren sich nicht zu einem Ganzen, sie fließen einfach nur vorüber. Wie physikalische Phänomene ist der Geist ein Kräftefeld. Er ist nicht der Sitz der Intelligenz. Geradeso wie die Welt sich in ein Meer aus Energie auflöst, löst sich der Geist in einen Fluss aus Eindrücken und Gedanken auf, er ist ein Fließen fragmentarischer Daten ohne Zusammenhalt.
Westliche Philosophen sind auf argumentativem Weg zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt, aber bei ihnen war das eine intellektuelle Übung. David Hume gesteht ein, dass er jedes Mal, wenn er gezwungen war, zu schlussfolgern, dass sein empirisches Ich substanzlos sei, einen Spaziergang machte, ein gutes Essen genoss und überhaupt nicht mehr dran dachte. Für die altindischen Weisen hingegen waren das keine logischen Schlussfolgerungen, sondern persönliche Entdeckungen. Sie erkundeten tatsächlich den Geist und prüften jede einzelne Gewahrseinsebene, indem sie das Bewusstsein auf die jeweils darunter liegende Ebene zurückzogen. In tiefer Meditation fanden sie heraus: Wenn das Bewusstsein so überaus fokussiert ist, dass es aus dem Körper und dem Geist völlig zurückgezogen ist, tritt es in eine Art Einzigkeit ein, in der die Empfindung von einem gesonderten Ich verschwindet. In diesem Zustand, dem äußersten Höhepunkt der Meditation, machten die Seher einen Bewusstseinskern jenseits von Zeit und Veränderung aus. Sie nannten ihn einfach Atman, das Selbst.
Ich habe die Entdeckung von Atman und Brahman – Gott immanent und Gott transzendent – als jeweils gesondert beschrieben, aber es gibt keine wirkliche Unterscheidung. Im Höhepunkt der Meditation entdeckten die weisen Meister Einheit: die gleiche unteilbare Wirklichkeit außen und innen. Sie war advaita, »nicht zwei«. Die Chandogya-Upanischad sagt epigrammatisch: Tat tvam asi – »Das bist du«. Atman ist Brahman: das Selbst in jeder Person unterscheidet sich nicht von der Gottheit.
Und es unterscheidet sich auch nicht von Person zu Person. Das Selbst ist eines. Es ist das gleiche Selbst in allen Kreaturen. Das ist kein sonderbarer Glaubenssatz der hinduistischen heiligen Schriften. Es ist das Zeugnis eines jeden, der diese Experimente in den Tiefen des Bewusstseins durchlebt hat und sie ganz zu Ende geführt hat. Hier ist dazu ein Zitat von Jan van Ruysbroeck, ein großer niederländisch-flämischer Mystiker des mittelalterlichen Europa, jedes Wort ist äußerst sorgfältig gewählt:
Das Bild Gottes findet sich wesentlich und persönlich in allen Menschen. Jeder besitzt es ganz, vollständig und ungeteilt, und alle zusammen nicht mehr als einer allein. Auf diese Weise sind wir alle eins, innig vereinigt in unserem ewigen Bild, welches das Bild Gottes ist und die Quelle unseres gesamten Lebens.
Maya
In der Einheitserfahrung verschwindet jede Spur von Getrenntheit. Das Leben stellt sich als ein nahtloses Ganzes dar. Aber der Körper kann in diesem Zustand nicht lange bleiben. Nach einer Weile kehrt das Gewahrsein von Geist und Körper zurück, und dann stürmt die konventionelle Vielheitswelt mit solcher Heftigkeit und Lebendigkeit wieder herein, dass die Erinnerung an die Einheit, obwohl von Wirklichkeit geprägt, so fern zu sein scheint wie ein Traum. Der Einheitszustand muss wieder und wieder meditativ erlangt werden, bis ein Mensch in ihm gegründet ist. Aber sobald er darin gründet, sieht er, auch mitten im gewöhnlichen Leben, das dem Vielen zugrunde liegende Eine, das Ewige unter dem Kurzlebigen.
Was verleiht der ungeteilten Wirklichkeit den Anschein, eine Welt voll gesonderter, vergänglicher Objekte zu sein? Was lässt jeden von uns glauben, dass wir der Körper sind und eben nicht unser eigenes Selbst? Die weisen Meister antworteten mit einer Geschichte, die nach Tausenden von Jahren noch immer erzählt wird. Stell dir einen Mann vor, sagten sie, der träumt, dass er von einem Tiger angegriffen wird. Sein Puls wird rasen, seine Fäuste werden sich ballen, seine Stirn wird nass sein vom Tau der Angst – alles genauso, als ob der Angriff real wäre. Er wird das Aussehen seines Tigers beschreiben können, die Art, wie er riecht, den Klang seines Brüllens. Für ihn ist der Tiger real, und in gewissem Sinne liegt er da nicht falsch: Die Evidenz, die er hat, unterscheidet sich nicht qualitativ von der Art Evidenz, der wir vertrauen, wenn wir wach sind. Menschen sind sogar schon an den physiologischen Auswirkungen von wirkmächtigen Träumen gestorben. Erst wenn wir aufwachen, können wir erkennen, dass unsere Traum-Sinneswahrnehmungen zwar für unser Nervensystem real sind, aber auf einer niedereren Wirklichkeitsebene als der Wachzustand.
Die Upanischaden skizzieren drei normale Bewusstseinszustände: Wachen, Träumen und traumlosen Schlaf. Jeder einzelne ist real, hat jedoch einen jeweils höheren Wirklichkeitsgrad. Denn jenseits dieser drei, sagen die Upanischaden, sei der Einheitszustand, der als »der Vierte« bezeichnet wird: Turiya. Das Eintreten in diesen Zustand ähnelt dem Aufwachen aus dem Traumschlaf: Die Einzelperson geht von einer niedereren Wirklichkeitsebene in eine höhere über.
Die weisen Meister bezeichneten den Traum des Wachlebens – den Traum von einer abgetrennten, bloß physischen Existenz – mit einem vielsagenden Namen: Maya. In allgemeinem Gebrauch stand das Wort für eine Art von Magie, für das Vermögen eines Gottes oder Zauberers, ein Ding als etwas anderes erscheinen zu lassen. In der Gita ist Maya die Schaffenskraft der Gottheit, des göttlichen Seinsgrundes, die ursprüngliche schöpferische Energie, welche die Einheit als die Welt unzähliger gesonderter Dinge und Wesen mit »Namen und Form« erscheinen lässt.
Später erklärten Philosophen die Maya in erstaunlich modernen Worten. Der Geist, sagten sie, beobachte die sogenannte Außenwelt und sehe seine eigene Struktur. Er meldet, dass die Welt aus einer Vielzahl gesonderter Objekte in einem Bezugssystem von Zeit, Raum und Kausalität besteht, weil das die Bedingungen der Wahrnehmung sind. Kurzum: Der Geist schaut die Einheit an und sieht Vielfalt; er schaut an, was zeitlos ist, und meldet Vergänglichkeit. Und in der Tat sind die Wahrnehmungsobjekte seiner Erfahrung vielfältig und vergänglich. Auf dieser Erfahrungsebene ist Getrenntheit real. Unser Irrtum liegt darin, das für die letztgültige Wirklichkeit zu halten, wie der Träumende, der glaubt, dass nichts real sei außer seinem Traum.
Nie ist dieser »mysteriöse östliche Gedanke« prägnanter formuliert worden als in dem Epigramm von Ruysbroeck: »Wir betrachten, was wir sind, und wir sind, was wir betrachten.« Wenn wir die Einheit durch das Instrument des Geistes anschauen, sehen wir Vielfalt; wenn der Geist transzendiert wird, treten wir in eine höhere Wissens- und Erkenntnisweise ein – in Turiya, den vierten Bewusstseinszustand –, in dem die Dualität verschwindet. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erscheinungswelt eine Illusion oder irreal ist. Die Illusion ist das Gesondertheitsempfinden.
Dies können wir wiederum mit Physik veranschaulichen: Die Welt von »Name und Form« existiert nur als eine Wahrnehmungsbedingung. Auf der subatomaren Ebene lösen sich getrennte Phänomene in einen Energiefluss auf. Die Wirkung der Maya ist ähnlich. Die Welt der Sinne ist real, aber sie muss als das erkannt werden, was sie ist: Einheit, die als Mannigfaltigkeit erscheint.
Jene, die sich von den Wahrnehmungsbedingungen in Maya entidentifizieren, können eine höhere Wissens- und Erkenntnisweise nutzen und die Einheit des Lebens unmittelbar erfassen. Die Übungsdisziplinen zum Erlangen des Einheitszustands sowie dieser Zustand selbst werden als Yoga bezeichnet: Das Wort leitet sich von der Wurzel yuj, zusammenjochen oder -binden, her. Die »Erfahrung« selbst (streng genommen liegt das jenseits von Erfahrung) wird Samadhi genannt. Und der erlangte Zustand ist Moksha oder Nirvana, von denen beide für das Transzendieren der Konditionierung von Maya – Zeit, Raum und Kausalität – stehen.
In diesem Zustand erkennen wir klar, dass wir kein physisches Geschöpf, sondern der Atman, das Selbst, und somit nicht von Gott getrennt sind. Wir sehen die Welt nicht als Stücke, sondern als Ganzes, und wir sehen dieses Ganze als eine Manifestation Gottes. Sobald wir mit dem Selbst identifiziert sind, wissen wir, dass, obwohl der Körper sterben wird, wir nicht sterben werden. Unser Gewahrsein dieser Identität wird durch den Tod des physischen Körpers nicht zerrissen. Somit haben wir die wesenhafte Unsterblichkeit realisiert, die das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Für einen solchen Menschen, sagt die Gita, sei der Tod nicht traumatischer als das Ausziehen eines alten Mantels (2:22).
Das Leben kann keine höhere Verwirklichung bieten. Das höchste Ziel der menschlichen Existenz ist erreicht. Der Mann oder die Frau, der/die Gott realisiert, hat alles und entbehrt nichts: dies besitzend »begehren sie sonst nichts und können von der schwersten Leidenslast nicht erschüttert werden« (6:22). Das Leben kann einen solchen Menschen nicht bedrohen. Alles, was es bereithält, ist die Gelegenheit, zu lieben, zu dienen und zu geben.
Dharma, Karma, Wiedergeburt und Befreiung
Es heißt, dass man, wenn man bloß zwei Worte, dharma und karma, versteht, die Essenz des Hinduismus begriffen hat. Das ist eine Simplifizierung, aber diese Konzeptionen sind tatsächlich sehr bedeutsam. Beide sind tief im hinduistischen Denken eingebettet, und die Gita, wie andere hinduistische heilige Schriften, setzt sie als selbstverständlich voraus, nicht als theoretische Prämissen, sondern als Lebenstatsachen, die in persönlicher Erfahrung nachgeprüft werden können.
Das Wort dharma hat viele Bedeutungen, aber sein zugrunde liegender Sinn ist »das, was stützt«, von der Wurzel dhri, stützen, emporhalten oder tragen. Im Allgemeinen impliziert dharma Stützung von innen: die Essenz eines Objekts oder eines Wesens, seine Grundeigenschaft, das, was es zu dem macht, was es ist.
Eine alte Geschichte erhellt diese Bedeutung mit dem höchsten Ideal des Hinduismus. Ein neben dem Ganges sitzender weiser Meister bemerkt einen Skorpion, der ins Wasser gefallen ist. Er greift hinein und rettet ihn, nur um gestochen zu werden. Einige Zeit später blickt er hinunter und sieht den Skorpion neuerlich im Wasser herumzappeln. Abermals greift er ins Wasser, um ihn zu retten, und abermals wird er gestochen. Ein Schaulustiger, der das alles beobachtet, ruft aus: »Heiliger, warum machst du das ständig? Siehst du nicht, dass die gemeine Kreatur dich dafür nur stechen wird?« »Freilich«, erwidert der weise Meister. »Es ist der Dharma eines Skorpions, zu stechen. Aber es ist der Dharma eines Menschen, zu erretten.«
In größerem Maßstab bedeutet Dharma die wesenhafte Ordnung der Dinge, eine Integrität und Harmonie im Universum und den Angelegenheiten des Lebens, die nicht gestört werden kann, ohne Chaos herauszufordern. Somit bedeutet er Richtigkeit, Gerechtigkeit, Tugendhaftigkeit, Bestimmung statt Zufall.
Dieser Idee liegt das Einssein des Lebens zugrunde: die upanischadische Entdeckung, dass alle Dinge miteinander verbunden sind, weil die Schöpfung auf ihrer tiefsten Ebene unteilbar ist. Dieses Einssein verleiht der Natur eine elementare Ausgeglichenheit. Jede Störung an einer Stelle sendet unweigerlich überallhin kleine Wellen aus, wie eine makellose Blase, die, wenn sie leicht an einer Stelle berührt wird, überall, rundherum zittert, bis die Ausgeglichenheit wiederhergestellt ist. Die Implikationen werden vollendet eingefangen von jenen berühmten Zeilen (aus der Meditation XVII) von John Donne, die es verdienen, jetzt mit einem frischen Blick als nicht bloß großartige Rhetorik, sondern als eine getreue Wiedergabe der Wirklichkeit gelesen zu werden:





























