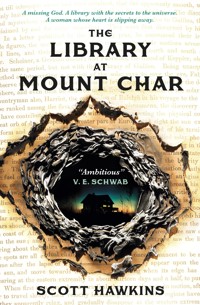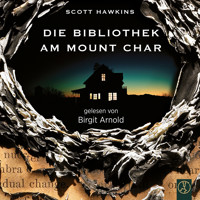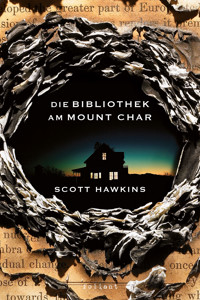
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: foliant Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein verschwundener Vater. Eine Bibliothek voller Geheimnisse. Und eine Frau, die alles riskiert. Carolyn war einmal eine ganz normale Amerikanerin. Heute trägt sie Weihnachtspullover über goldenen Fahrradhosen und beherrscht Geheimnisse, die kein Mensch kennen sollte. Denn sie und ihre Geschwister wurden von "Vater" erzogen – einem grausamen Lehrer, der vielleicht mehr war als nur ein Mensch. Nun ist er verschwunden. Und die Bibliothek, in der er das Wissen um Leben, Tod und Schöpfung verwahrte, liegt offen – ein Preis, für den ihre Rivalen über Leichen gehen. Doch Carolyn hat einen Plan. Einen, der die Welt retten könnte. Oder sie endgültig zerstören. "Schmerzhaft schön." – Christoph Hardebusch "Tragisch, düster – und doch witzig und berührend." – Nora Bendzko
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
The Library at Mount Char by Scott Hawkins
1. Auflage: 2024
Copyright © 2015 by Scott Hawkins
Diese Ausgabe erscheint in Zusammenarbeit mit Crown, einem Imprint der Crown Publishing Group, einem Geschäftsbereich von Penguin Random House LLC.
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by foliant Verlag, Hegelstr.12, 74199 Untergruppenbach
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen jeglicher Form.
Dies ist ein Werk der Fiktion. Namen, Personen, Orte und Begebenheiten sind entweder der Phantasie des Autors entsprungen oder werden fiktiv verwendet, und jede Ähnlichkeit mit realen lebenden oder toten Personen, Geschäftseinrichtungen Ereignissen oder Orten ist rein zufällig.
Umschlaggestaltung © HildenDesign
Fotografien: (verbranntes Buch) Mark Hooper/Gallery Stock;
(Haus) Mathias Clamer/Getty Images
Übersetzung: Tanja Ohlsen
Satz: Kreativstudio foliant
eBook Ausgabe
ISBN 978-3-910522-99-2
www.foliantverlag.de
Für meine gutmütige und äußerst geduldigeFrau Heather mit viel Liebe und großem Dank
Inhalt
Teil I - Die Bibliothek
Kapitel 1. Sonnenaufgang
Kapitel 2. Buddhismus für Arschlöcher
Zwischenspiel I - Der Donner aus dem Osten
Kapitel 3. Eine reißende Barriere
Zwischenspiel II - Uzan-Iya
Kapitel 4. Donnerstag
Kapitel 5. Das glücklichste Hühnchen der Welt
Kapitel 6. Eine halbe Tonne gequirlte Kacke
Teil II - Die Anatomie der Löwen
Kapitel 7. Garrison Oaks
Kapitel 8. Kaltes Heim
Zwischenspiel III - Jack
Kapitel 9. Ein Knochen, den man nicht brechen kann
Kapitel 10. Asuras
Zwischenspiel IV. Verletzt und trostbedürftig
Kapitel 11. Bemerkungen zur Unterwerfung kriegstechnisch überlegener Feinde
Kapitel 12. Die Bibliothek
Kapitel 13. Sing, sing, sing!
Zwischenspiel V - Titan
Kapitel 14. Der zweite Mond
Epilog - Und was geschah mit Erwin?
Danksagung
Teil I
Die Bibliothek
Kapitel 1
Sonnenaufgang
I
Blutverschmiert und barfuß lief Carolyn allein die zweispurige Asphaltstraße entlang, die die Amerikaner Highway 78 nannten. Die meisten Bibliothekare, Carolyn eingeschlossen, betrachteten sie eher als Tacostraße, zu Ehren eines mexikanischen Restaurants, zu dem sie sich gelegentlich schlichen. Die Guacamole ist richtig gut da, erinnerte sie sich. Ihr knurrte der Magen. Unter ihren Füßen raschelte orangefarbenes, knisterndes Eichenlaub und kurz vor der Dämmerung stieg ihr Atem in kleinen Wölkchen in die Luft. Das scharfe Obsidianmesser, mit dem sie Detective Miner getötet hatte, lag gut verborgen an ihrem Rücken.
Sie lächelte.
Auf dieser Straße war zwar nicht viel Verkehr, aber ein paar Autos sah man gelegentlich. Im Laufe ihrer Wanderung durch die Nacht hatte sie fünf gesehen. Der zerbeulte alte Ford F-250, der jetzt neben ihr abbremste, war das dritte, das anhielt, um näher hinzusehen. Der Fahrer fuhr auf den knirschenden Kies am gegenüberliegenden Straßenrand und ließ den Motor laufen. Als das Fenster heruntergelassen wurde, roch sie Kautabak, altes Fett und Heu. Am Steuer saß ein weißhaariger Mann, neben ihm ein Schäferhund, der sie misstrauisch beäugte.
Oh Mistkram. Sie wollte ihnen nichts tun.
»Um Himmels willen«, sagte der Mann. »Hat es einen Unfall gegeben?«
In seiner Stimme lag Anteilnahme – echte, nicht die gespielte, raubtierhafte, wie bei dem letzten Mann, der es versucht hatte. Sie konnte es hören und wusste, dass der alte Mann sie betrachtete, wie ein Vater seine Tochter ansehen würde. Es entspannte sie etwas.
»Nein«, antwortete sie und beobachtete den Hund. »Nichts dergleichen. Nur etwas Stress in der Scheune. Eines der Pferde.« Es gab zwar kein Pferd und keine Scheune, aber der Geruch des Mannes sagte ihr, dass er Sympathie für Tiere empfand und wusste, dass der Umgang mit ihnen manchmal ein blutiges Geschäft sein konnte. »Schwierige Geburt – für sie und für mich.« Sie lächelte bedauernd und deutete auf ihr Kleid, dessen grüne Seide schwarz und steif war von Detective Miners Blut. »Hat mir das Kleid ruiniert.«
»Versuch es mit etwas Club Sody«, empfahl der Mann trocken. Der Hund knurrte leise. »Still, Buddy!«
Carolyn war nicht ganz klar, was »Club Sody« sein sollte, aber sein Tonfall sagte ihr, dass es ein Scherz war. Keiner, bei dem man laut herauslachte, eher von der mitfühlenden Sorte. Sie lachte leise. »Werde ich machen.«
»Geht es dem Pferd gut?« Wieder klang er aufrichtig besorgt.
»Ja, ihr geht es gut. Und dem Fohlen auch. Aber es war eine lange Nacht. Ich laufe nur etwas, um den Kopf frei zu bekommen.«
»Barfuß?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Hierzulande ist man hart im Nehmen.« Das stimmte sogar.
»Möchtest du mitfahren?«
»Nein danke. Das Haus meines Vaters ist gleich da vorne. Es ist nicht weit.« Auch das stimmte.
»Welches, das bei der Post?«
»In Garrison Oaks.«
Einen Moment lang sah der alte Mann in die Ferne, als er versuchte, sich zu erinnern, woher er den Namen kannte. Er dachte kurz darüber nach, gab dann aber auf. Carolyn hätte ihm sagen können, dass er tausend Jahre lang viermal täglich an Garrison Oaks vorbeifahren könnte, ohne sich je daran zu erinnern, doch sie ließ es bleiben.
»Ohh«, meinte er schließlich. »Na gut.« Dann sah er in nicht gerade väterlicher Art auf ihre Beine. »Bist du sicher, dass du nicht mitfahren willst? Buddy macht es nichts aus, stimmts?«
Er tätschelte den Hund auf dem Beifahrersitz, der sie nur wild und misstrauisch ansah.
»Ganz sicher.«
Der alte Mann legte den Gang ein und fuhr weiter. Carolyn blieb in einer warmen Wolke aus Dieselabgasen zurück.
Sie beobachtete ihn, bis die Rücklichter um eine Biegung verschwanden. Das war genug Gesellschaft für eine Nacht, dachte sie, stieg die Böschung hinauf und ging in den Wald. Der Mond stand noch am Himmel und war noch voll. Die Amerikaner nannten diese Jahreszeit »Oktober«, gelegentlich auch »Herbst«. Aber Bibliothekare berechneten die Zeit nach dem Himmel. Heute war der siebte Mond, der Mond der schwarzen Trauer. Unter seinem Licht huschten die Schatten kahler Äste über ihre Narben.
Ungefähr eine Meile weiter kam sie zu dem hohlen Baumstamm, in dem sie ihr Gewand verstaut hatte. Sie schüttelte die Rindenstückchen heraus und klaubte sie so gut wie möglich sauber. Einen Fetzen des blutigen Kleides hob sie für David auf, den Rest warf sie weg, dann hüllte sie sich in das Gewand und zog die Kapuze über den Kopf. Sie hatte das Kleid gemocht, die Seide hatte sich gut angefühlt auf der Haut, aber die grobe Baumwolle der Robe wirkte beruhigend. Sie war ihr vertraut und mehr erwartete sie von Kleidung nicht.
Sie lief tiefer in den Wald hinein. Die Steine unter den Blättern und Fichtennadeln fühlten sich gut an unter ihren Füßen, sie kratzten sie an einer juckenden Stelle, die ihr bisher gar nicht aufgefallen war. Nur noch über den nächsten Hügel, dachte sie. Garrison Oaks. Am liebsten hätte sie den Ort niedergebrannt, aber gleichzeitig wäre es auch schön, es wiederzusehen.
Zuhause.
II
Carolyn und die anderen waren keine geborenen Bibliothekare. Einst – es schien sehr lange her zu sein – waren sie sogar sehr amerikanisch gewesen. Sie erinnerte sich ein wenig daran, dass es so etwas wie Die Sieben-Millionen-Dollar-Frau oder Reese’s Peanut Butter Cups gegeben hatte. Aber als Carolyn etwa acht Jahre alt gewesen war, griffen in einer Sommernacht Vaters Feinde an. Vater überlebte, ebenso Carolyn und ein paar andere Kinder. Ihre Eltern nicht.
Sie erinnerte sich an Vaters Stimme, die durch dichten schwarzen Rauch drang, der nach geschmolzenem Asphalt roch, und wie tief der Krater war, wo einst ihre Häuser gestanden hatten. Er glühte dunkel orange hinter Vater.
»Ihr seid jetzt Pelapi«, hatte Vater gesagt. »Das ist ein altes Wort. Es bedeutet etwas zwischen »Bibliothekar« und »Schüler«. Ich nehme euch in mein Haus auf und werde euch großziehen, so wie ich selbst erzogen wurde. Ich werde euch die Dinge beibringen, die ich gelernt habe.«
Er hatte nicht gefragt, was sie wollten.
Carolyn war nicht undankbar und anfangs tat sie ihr Bestes. Ihre Eltern waren beide fort, für immer, so viel hatte sie verstanden. Vater war alles, was sie noch hatte und anfangs schien es, als ob er nicht so viel verlangte. Aber Vaters Zuhause war anders. Anstelle von Süßigkeiten und Fernsehen gab es Schatten und alte Bücher, handgeschrieben auf dickem Pergament. Bald verstanden sie, dass Vater schon sehr lange lebte. Und im Laufe dieses langen Lebens hatte er gelernt, Wunder zu wirken. Er konnte Blitze herbeirufen oder die Zeit anhalten. Steine sprachen ihn beim Namen an. Theorie und Praxis dieser Künste waren in zwölf Kataloge eingeteilt – zufälligerweise eine für jedes Kind. Alles, worum er bat, war, dass sie fleißig lernten.
Ein paar Wochen später erhielt Carolyn den ersten Hinweis darauf, was das wirklich bedeutete. Sie lernte an einem der beleuchteten Arbeitsplätze die hier und da in der jadegefliesten Bibliothek standen. Margaret, ungefähr neun Jahre alt, kam aus den hohen, dunklen Regalen des grauen Katalogs gerannt. Sie schrie. Blind vor Panik stolperte sie über einen Tisch und stolperte fast bis vor Carolyns Füße. Carolyn bedeutete ihr, sich unter ihrem Tisch zu verstecken.
Dort zitterte Margaret mindestens zehn Minuten lang. Carolyn stellte ihr leise Fragen, doch sie sprach nicht, vielleicht konnte sie es gar nicht. Doch in Margarets Tränen mischte sich Blut und als Vater sie zurück zwischen die Regale schleifte, machte sie sich in die Hose. Das war Antwort genug. Carolyn dachte manchmal an den heißen Ammoniakgestank von Margarets Blut, vermischt mit dem muffigen Staub alter Bücher und wie ihre Schreie aus den Regalen hallten. Erst in diesem Moment begann sie zu verstehen.
Carolyns eigener Katalog war eher langweilig als furchterregend. Vater hatte ihr das Studium der Sprachen zugewiesen und fast ein Jahr lang war sie sorgfältig ihre Lehrbücher durchgegangen. Aber die Routine langweilte sie. Im ersten Jahr ihrer Ausbildung, als sie neun Jahre alt war, war sie zu Vater gegangen und hatte mit dem Fuß aufgestampft.
»Ich will nicht mehr«, hatte sie gesagt. »Ich habe genug Bücher gelesen. Ich kenne genug Worte. Ich will raus.«
Die anderen Kinder schraken vor Vaters Gesichtsausdruck zurück. Wie versprochen zog er sie so auf, wie er selbst erzogen worden war. Die meisten von ihnen – Carolyn eingeschlossen – hatten bereits ein paar Narben.
Doch obwohl sich sein Gesicht verfinsterte, schlug er sie dieses Mal nicht. Stattdessen sagte er nach einem Moment: »Oh? Nun gut.«
Vater schloss die Tür zur Bibliothek auf und führte sie zum ersten Mal seit Monaten hinaus in den Sonnenschein unter blauem Himmel. Carolyn war entzückt, besonders, als Vater das Gelände verließ und zum Wald ging. Unterwegs sah sie David, dessen Katalog Mord und Krieg waren, auf dem Feld am Ende der Straße ein Messer schwingen. Michael, der lernte, Vaters Botschafter der Tiere zu werden, balancierte auf einem Ast und beriet sich mit einer Eichhörnchenfamilie. Carolyn winkte beiden zu. Vater blieb am Ufer des kleinen Sees hinter dem Gelände stehen. Carolyn bebte förmlich vor Vergnügen, plantschte barfuß ins Wasser und versuchte, Kröten zu fangen.
Vom Ufer aus rief Vater nach der Hirschkuh Isha, die kürzlich ein Junges bekommen hatte. Isha und ihr Kitz Asha kamen natürlich aufs Kommando. Sie begannen ihre Audienz damit, Vater recht ausgedehnt und mit großem Ernst ihre Treue zu schwören. Den Teil ignorierte Carolyn. Leute, die vor Vater krochen, langweilten sie mittlerweile. Und Hirschsprache war schwer.
Als die Formalitäten überstanden waren, befahl Vater Isha, Carolyn zusammen mit ihrem Kind zu unterrichten. Er bemühte sich, kurze Worte zu benutzen, damit Carolyn sie verstehen konnte.
Zunächst zögerte Isha. Rotwild hat ein Dutzend Worte für Anmut und keines davon passte auf Carolyns menschliche Füße, die neben den zierlichen Hufen von Asha und den anderen Kitzen so groß und klobig aussahen. Aber Isha war loyal gegenüber Nobununga, dem Kaiser dieser Wälder, und daher auch Vater treu ergeben. Außerdem war sie nicht dumm und äußerte keinen Einwand.
Den ganzen Sommer über lernte Carolyn vom Rotwild im Tal. Es war die letzte friedliche Zeit in ihrem Leben und vielleicht auch die glücklichste. Unter Ishas Anleitung lernte sie immer schneller auf den Pfaden des unteren Waldes zu laufen, über die umgestürzte, bemooste Eiche zu springen, im Knien Klee zu knabbern und am Tau zu nippen. Zu dieser Zeit war Carolyns Mutter bereits ein Jahr tot. Ihre einzige Freundin war verbannt. Vater war vieles, aber mit Sicherheit nicht sanft. Als daher Isha Carolyn in der ersten kalten Nacht des Jahres zu sich rief, um bei ihr und ihrem Jungtier zu liegen, um sich zu wärmen, brach etwas in ihr auf. Sie weinte nicht oder zeigte Schwäche – so etwas lag nicht in ihrer Natur – aber sie schloss Isha voll und ganz ins Herz.
Kurz darauf kündigte sich der Winter mit einem schrecklichen Gewitter an. Carolyn hatte vor so etwas keine Angst, aber bei jedem Blitz zitterten Isha und Asha. Die drei waren jetzt eine Familie. Sie suchten gemeinsam Schutz in einem Birkenhain, wo Carolyn und Isha Asha in die Mitte nahmen, um sie zu wärmen. Die ganze Nacht lagen sie zusammen. Carolyn fühlte ihre Körper beben und bei jedem Donner zusammenzucken. Sie versuchte, sie mit Liebkosungen zu beruhigen, doch sie schreckten vor ihrer Berührung zurück. Sie suchte in ihrem Gedächtnis in den Lektionen bei Vater nach Worten, die sie beruhigen konnten. »Keine Angst«, wäre schon gut, oder »Das ist bald vorbei«, oder »Morgen früh gibt es Klee.«
Aber Carolyn war eine schlechte Schülerin gewesen. So sehr sie sich auch bemühte, sie konnte keine Worte finden.
Kurz vor Morgengrauen spürte Carolyn, wie Isha zuckte und mit den Hufen auf den Boden trommelte. Sie trat das tote Laub beiseite und legte den Lehmboden darunter frei. Gleich darauf war der Regen, der über Carolyns Körper floss, warm und es schmeckte salzig.
Ein Blitz zuckte auf und Carolyn sah David. Er stand auf einem Ast über ihr, etwa zehn Meter entfernt, und grinste. Von seiner linken Hand hing das Ende einer feinen Silberkette mit einem Gewicht daran. Ohne es zu wollen, sah sie im letzten Mondlicht an der Kette entlang. Als erneut ein Blitz zuckte, starrte Carolyn in die leblosen Augen von Isha, die zusammen mit ihrem Kitz Asha von Davids Speer durchbohrt war. Carolyn streckte die Hand aus und berührte den Bronzegriff, der aus dem Körper des Rehs ragte. Das Metall war warm und bebte leicht unter ihren Fingerspitzen, wo es das letzte, verebbende Zucken von Ishas sanftem Herzen verstärkte.
»Vater sagte, ich solle dich beobachten und lauschen«, berichtete David. »Hättest du die Worte gefunden, hätte ich sie leben lassen sollen.« Er zog an der Kette und der Speer glitt aus den Tieren. »Vater sagt, es sei an der Zeit, nach Hause zu kommen«, fuhr er fort und rollte die Kette mit geschickten, geübten Bewegungen ein. »Es wird Zeit, dass du richtig anfängst, zu lernen.« Dann verschwand er wieder im Sturm.
Carolyn erhob sich und stand allein im Dunkeln, sowohl in diesem Moment als auch für alle Zeit danach.
III
Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, kniete Carolyn auf allen Vieren hinter dem Stumpf einer umgestürzten Fichte und sah durch ein dichtes Stechpalmengebüsch. Wenn sie ihren Kopf ein klein wenig neigte, hatte sie einen ungehinderten Blick den Hügel hinab auf die Lichtung mit dem Bullen. Sie war etwa zwanzig Meter breit und weitgehend leer. Das einzige Bemerkenswerte waren der Stier selbst und der Granitturm von Margarets Grab. Der Stier, eine etwas überlebensgroße Hohlbronze, stand genau in der Mitte der Lichtung. In der Sonne glänzte er sanft golden.
Auf einer Seite wurde die Lichtung von wilden Zedern begrenzt, hinter denen sich Carolyn jetzt versteckte. Auf der gegenüberliegenden Seite standen David und Michael am Rand eines steilen Einschnitts im Hügel, durch den der Highway 78 verlief. Auf der anderen Seite der Straße, etwa sieben Meter tiefer, hing das verwitterte Schild nach Garrison Oaks an einer rostigen Kette. Wenn der Wind richtig stand, konnte man das Knarren bis hier oben hören.
Carolyn hatte sich sehr dicht herangeschlichen, so dicht, dass sie die struppigen Zöpfe von Michaels blonden Rastalocken zählen konnte, dicht genug, um die Fliegen um Davids Kopf herum summen hören zu können. David machte sich einen Spaß daraus, Michael über seine Reisen auszuquetschen. Carolyn verzog das Gesicht. Michaels Katalog waren Tiere und er hatte ihn vielleicht etwas zu gut gelernt. Die menschliche Sprache war für ihn mittlerweile schwierig, wenn nicht sogar schmerzhaft – besonders, wenn er frisch aus dem Wald kam. Und was noch schlimmer war, er war ohne jede Arglist.
Emily hatte in der Nacht zuvor die Träume der Bibliothekare heimgesucht und gesagt, dass David wollte, dass sie sich »vor Sonnenuntergang« alle beim Stier versammelten. Das war etwas anderes als »so schnell wie möglich«, ein Unterschied, der allen außer Michael auffiel. Aber vielleicht war es so am besten. Jennifer war seit Wochen mit David allein gewesen und sie hatten auf Nachrichten von Vater gewartet. Jetzt, während David Michael quälte, war Jennifer, die kleinste und zierlichste der Bibliothekare, damit beschäftigt, Margarets Grab niederzureißen. Sie lief auf der Lichtung hin und her, ächzend unter dem Gewicht kopfgroßer Granitsteine, ihr rotblondes Haar schweißnass. Trotzdem war nach Wochen allein mit David sogar Steineschleppen eine Erleichterung.
Carolyn seufzte innerlich. Ich sollte wohl hinuntergehen und ihnen helfen. Zumindest müsste David seine Aufmerksamkeit dann drei statt nur zwei Opfern schenken.
Aber Carolyn verstand sich durchaus auf Arglist. Sie würde zuerst zuhören.
David und Michael sahen zu Garrison Oaks. Michael war nackt, wie die Jaguare um ihn herum. David trug eine Schutzweste der israelischen Armee und ein lavendelfarbenes Tutu mit Blutflecken. Die Weste gehörte ihm, das Tutu stammte aus dem Schrank von Mrs. McGillicuttys Sohn. Das war zumindest zum Teil Carolyns Schuld.
Als es klar wurde, dass sie zumindest in nächster Zeit nicht in die Bibliothek zurückkehren konnten, hatte Carolyn den anderen erklärt, dass sie amerikanische Kleidung tragen mussten, um nicht aufzufallen. Sie hatten genickt, ohne es genau zu verstehen, und hatten Mrs. McGillicuttys Schränke durchsucht. David wählte das Tutu, weil es seinem üblichen Lendenschurz am nächsten kam. Carolyn hatte überlegt, ob sie ihm erklären sollte, warum das nicht unauffällig war, entschied sich aber dagegen. Sie hatte gelernt, die kleinen Freuden zu genießen.
Sie rümpfte die Nase. Fäulnisgeruch lag in der Luft. Ist Margaret auch zurück? Doch nein, der Gestank kam von David. Nach einer Weile fiel es einem nicht mehr so auf, aber sie war fort gewesen. Um seinen Kopf summten Fliegen.
Vor ein oder zwei Jahren hatte David damit begonnen, sich das Blut aus dem Herzen seiner Opfer ins Haar zu tropfen. Er war ein stark behaarter Mann und ein Herz ergab nur ein paar Esslöffel voll Blut, aber es hatte sich schnell angesammelt. Im Laufe der Zeit war aus Blut und Haaren eine Art Helm geworden. Einmal hatte sie Peter neugierig gefragt, wie stark die Konstruktion wohl wäre. Peter, zu dessen Katalog Mathematik und Technik gehörten, sah einen Moment nachdenklich an die Decke.
»Ziemlich stark«, meinte er, »geronnenes Blut ist härter als man denkt, aber es ist brüchig. Die Haarsträhnen gleichen das ein wenig aus. Es ist das gleiche Prinzip wie bei Stahlbeton. Hmmm.« Er beugte sich über sein Klemmbrett und schrieb ein paar Zahlen auf, dann nickte er. »Ja, ziemlich stark. Würde eine Zweiundzwanziger aufhalten. Vielleicht sogar 9 Millimeter.«
Eine Zeitlang hatte David das Blut auch in seinen Bart tropfen lassen, aber Vater hatte verlangt, dass er ihn abmeißelte, als es für ihn schwierig wurde, den Kopf zu drehen. Jetzt war nur noch ein halblanger Fu-Manchu-Bart übrig.
»Wo warst du?«, wollte David wissen und schüttelte Michael an den Schultern. Er sprach Pelapi, das keinerlei Ähnlichkeit mit Englisch oder irgendeiner anderen modernen Sprache aufwies. »Du hast im Wald gespielt, oder? Du bist seit Wochen fertig! Lüg mich nicht an!«
Michael bekam fast Angstzustände, verdrehte die Augen und als er sprach, war es abgehackt und er fand die Worte nur mit großer Mühe. »Ich war … wech.«
»Wech? Wech? Meinst du weg? Wo weg?«
»Ich war bei … bei … den kleinen Dingern. Hat Vater gesagt. Vater hat gesagt, lern von den kleinen und unbedeutenden.«
»Vater wollte, dass er alles über Mäuse lernt«, übersetzte Jennifer über die Schulter hinweg und ächzte unter dem Gewicht eines Steins. »Wie sie sich bewegen, verstecken und so weiter.«
»Zurück an die Arbeit!«, schrie David ihr zu. »Du verschwendest Tageslicht!«
Jennifer tappte zurück zum Stapel und wuchtete keuchend einen weiteren Stein hoch. David mit seinen muskulösen 1,90 m beobachtete sie dabei. Carolyn glaubte, ein Lächeln auf seinem Gesicht sehen zu können. Dann wandte er sich wieder an Michael und sagte kopfschüttelnd: »Ausgerechnet Mäuse. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, du bist noch nutzloser als Carolyn.«
Carolyn machte aus ihrem sicheren Versteck eine rüde Geste.
Jennifer ließ mit trockenem Knacken einen weiteren Stein ins Gebüsch fallen, richtete sich keuchend auf und wischte sich mit zitternder Hand den Schweiß von der Stirn.
»Carolyn? Was? Ich … weiß nicht … ich …«
»Hör auf zu reden«, verlangte David. »Also, damit ich das richtig verstehe … während wir anderen uns abgeplagt haben, um Vater zu suchen, hast du mit einem Haufen Mäuse gespielt?«
»Mäuse … ja. Ich dachte …«
Ein Klatschen erklang auf der Lichtung. Carolyn, die mit Davids Ohrfeigen eine Menge Erfahrung hatte, zuckte neuerlich zusammen. Das musste ja kommen.
»Ich habe dich nicht gefragt, was du denkst«, sagte David. »Tiere denken nicht. Und willst du das nicht sein, Michael? Ein Tier? Ist es letztendlich nicht das, was du eigentlich bist?«
»Wie du meinst«, erwiderte Michael sanft.
Obwohl David mit dem Rücken zu ihr stand, wusste Carolyn genau, wie sein Gesicht in diesem Moment aussah. Er lächelte sicher, wenigstens ein bisschen. Wenn Michael blutete, dann zeigte er vielleicht auch seine Grübchen.
»Du … sei einfach still. Du verursachst mir Kopfschmerzen. Geh und hilf Jennifer oder so.«
Einer von Michaels Jaguaren knurrte leise. Michael antwortete mit einem halblauten Jaulen und er verstummte.
Carolyn runzelte die Stirn. Am Gras auf dem Kamm zum Tal hinter David erkannte sie, dass der Wind drehte. Gleich würden sie in Windrichtung zu den drein sein, nicht umgekehrt. Während ihrer Zeit bei den Amerikanern hatte sich Carolyn so weit angepasst, dass ihr Geruch – Marlboro, Chanel, Vidal Sassoon – nicht mehr ihre Augen tränen ließ, aber Michael und David nicht. Wenn der Wind aus Westen kam, würde sie nicht mehr lange verborgen bleiben.
Sie ging um den Hügel herum nach Südosten. Nach etwa einer Viertelmeile ging sie zurück, dieses Mal, ohne besonders vorsichtig zu sein, und kündigte ihre Anwesenheit mit dem Knacken eines absichtlich zertretenen trockenen Zweiges an.
»Aha«, bemerkte David. »Carolyn. Lauter und ungeschickter als zuvor. Bald bist du eine echte Amerikanerin. Ich habe dich schon vom Fuß des Hügels aus gehört. Komm her.«
Carolyn gehorchte.
David sah ihr in die Augen und strich ihr sanft über die Wange. Seine Finger waren schwarz von geronnenem Blut. »Wenn Vater nicht da ist, müssen wir alle auf Sicherheit achten. Diese Bürde lastet auf uns allen. Verstehst du das?«
»Selbstver…«
Mit der einen Hand streichelte er immer noch ihre Wange, während er sie mit der anderen in den Solarplexus schlug. Obwohl sie das – das oder etwas Ähnliches jedenfalls – erwartet hatte, nahm ihr der Schlag die Luft. Dennoch ging sie nicht in die Knie. Das ist jedenfalls gleichgeblieben, dachte sie. Sie genoss den Kupfergeschmack ihres Hasses.
David betrachtete sie einen Augenblick lang mit seinen Killeraugen. Da er kein Anzeichen für Rebellion erkannte, nickte er und wandte sich ab. »Geh und hilf ihnen mit dem Grab.«
Sie zwang sich, tief Luft zu holen. Einen Moment später lichtete sich der Nebel vor ihren Augen und sie ging zu Margarets Grab. Das trockene Herbstgras strich um ihre nackten Beine. Durch die Bäume gedämpft klang das Geräusch eines Lastwagens herauf, der auf dem Highway 78 vorbeidonnerte.
»Hallo Jen«, sagte sie. »Hallo Michael. Wie lange ist sie schon tot?«
Michael sagte nichts, doch er kam näher und schnüffelte liebevoll an ihrem Nacken. Sie schnüffelte höflich zurück.
»Hallo Carolyn«, begrüßte sie Jen.
Jennifer ließ den Stein, den sie trug, ins Unterholz fallen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Sie ist seit dem letzten Vollmond unten.« Ihre Augen waren stark blutunterlaufen. »Das ist dann … etwa zwei Wochen her?«
Ehrlich gesagt waren es eher vier Wochen. Sie ist wieder zugedröhnt, dachte Carolyn und runzelte ein wenig die Stirn. Doch dann war sie gnädiger. Wer könnte es ihr verübeln? Sie war allein mit David. Doch sie sagte nur: »Wow. Das ist um einiges länger als üblich. Was macht sie?«
Jennifer sah sie verwundert an. »Sie sucht natürlich nach Vater. Was hast du denn gedacht?«
Carolyn zuckte mit den Schultern. »Man kann ja nie wissen.« So wie Michael die meiste Zeit mit den Tieren verbrachte, fühlte sich Margaret bei den Toten am wohlsten. »Hatte sie Glück?«
»Das sehen wir bald«, meinte Jennifer und zeigte demonstrativ auf den Steinhaufen. Carolyn verstand den Hinweis, ging hinüber und hob einen mittelgroßen Stein hoch. Mit schnellen, effizienten Bewegungen arbeiteten sie schweigend und zu dritt dauerte es nicht lange, bis der Haufen abgetragen und im Unterholz verstreut war. Der Boden darunter war seit der Beerdigung ein wenig eingesunken. Er war noch relativ weich. Sie knieten sich hin und gruben mit den Händen. Nach 20 Zentimetern konnten sie Margarets Körper riechen. Carolyn, die das schon eine Weile nicht mehr gemacht hatte, musste einen Brechreiz unterdrücken und bemühte sich, dass David es nicht sah. Als das Loch etwa einen halben Meter tief war, trafen ihre Finger auf etwas Glitschiges.
»Ich habe sie«, verkündete sie.
Michael half, die Erde abzufegen. Margaret war aufgedunsen, blau angelaufen und modrig. In ihren Augenhöhlen krochen Maden herum. Jennifer hievte sich aus dem Grab und ging ihre Sachen holen. Sobald Margarets Gesicht und Hände freigelegt waren, beeilten sich Carolyn und Michael, aus dem Grab zu kommen.
Jennifer nahm eine kleine Silberpfeife aus ihrer Tasche, zündete sie mit einem Streichholz an und nahm einen tiefen Zug. Dann sprang sie mit einem Seufzer wieder hinunter und machte sich ans Werk. Egal ob sie high war oder nicht, sie war überaus begabt. Vor einem Jahr hatte Vater ihr das höchste aller Komplimente gemacht und ihr das weiße Band der Heilerin übergeben. Damit war jetzt sie und nicht mehr Vater die Herrin ihres Katalogs. Sie war die einzige von ihnen, die er mit so einer Ehre bedacht hatte.
Dieses Mal war die tödliche Wunde ein vertikaler Schnitt in Margarets Herz, der genau die Breite und Tiefe von Davids Messer aufwies. Jennifer setzte sich rittlings auf die Leiche und legte ihr die Hand auf die Brust. Dort hielt sie sie drei Atemzüge lang. Carolyn sah gespannt zu und merkte sich die Stellen, an denen Jennifer Geist, Körper und Sinn sagte. Doch sie achtete sorgfältig darauf, sich nicht anmerken zu lassen, was sie tat. Etwas jenseits des eigenen Kataloges zu lernen – nun, dabei wollte man sich lieber nicht erwischen lassen.
Michael zog sich auf die andere Seite der Lichtung zurück, weg von dem Gestank, und rang lächelnd mit seinen Jaguaren. Er schenkte den anderen keine Aufmerksamkeit. Carolyn saß mit dem Rücken an eines der Bronzebeine des Bullen gelehnt, dicht genug, um Jennifer arbeiten sehen zu können. Als diese ihre Hand wegzog, war die Wunde in Margarets Brust verschwunden.
Jennifer richtete sich im Grab auf. Carolyn vermutete, dass das wohl weniger aus medizinischen Gründen geschah, als deshalb, dass sie selbst Luft schöpfen musste. Der Geruch war schon dort, wo Carolyn saß, unerträglich, aber unten in der Grube musste er überwältigend sein. Jennifer holte tief Luft und kniete sich wieder hin. Sie runzelte die Stirn, fegte die meisten Insekten weg und legte ihren warmen Mund auf Margarets kalte Lippen. Drei Atemzüge lang hielt sie sie in dieser Umarmung, zog sich dann würgend zurück und begann Margarets Haut mit verschiedenen Lotionen einzureiben. Interessanterweise trug sie die Lotion in Mustern auf, in den Glyphen der Pelapi-Schrift, zuerst Ehrgeiz, dann Wahrnehmung und schließlich Bedauern.
Als sie fertig war, stand Jennifer auf und kletterte aus dem Grab. Sie kam auf Carolyn und Michael zu, doch nach zwei Schritten riss sie plötzlich die Augen auf, hielt sich die Hand vor den Mund und rannte ins Unterholz, wo sie sich übergab. Als ihr Magen leer war, ging sie zu Carolyn. Ihr Gang war unsicherer und langsamer als zuvor und auf ihrer Stirn glänzte ein leichter Schweißfilm.
»Schlimm?«, erkundigte sich Carolyn.
Statt einer Antwort wandte Jennifer den Kopf und spuckte. Dann setzte sie sich dicht neben sie und legte einen Moment den Kopf an ihre Schulter. Danach nahm sie ihre kleine Silberpfeife – amerikanisch, ein Geschenk von Carolyn – und zündete sie wieder an. Süßer, dicker Marihuanageruch zog über die Lichtung. Sie bot die Pfeife Carolyn an.
»Nein, danke.«
Jennifer zuckte mit den Schultern und nahm dann einen zweiten, tieferen Zug. Die Glut in der Pfeife spiegelte sich in der polierten Bronze des Stierbauches. »Manchmal frage ich mich …«
»Fragst du dich was?«
»Ob es sich überhaupt lohnt. Nach Vater zu suchen, meine ich.«
Carolyn lehnte sich zurück. »Meinst du das ernst?«
»Ja, ich …«, seufzte Jennifer. »Nein. Vielleicht. Ich weiß nicht. Es ist nur … Ich frage mich halt. Wäre es wirklich so viel schlimmer? Wenn wir die Sache einfach … laufen ließen? Den Duke übernehmen lassen, oder wen auch immer.«
»Wenn der Duke sich soweit wiederherstellen kann, dass er wieder Nahrung braucht, wird komplexes Leben Geschichte sein. Und das würde nicht lange dauern. Vielleicht fünf Jahre, eventuell zehn.«
»Ja, ich weiß.« Jennifer zündete erneut die Pfeife an. »Stattdessen haben wir Vater. Der Duke … na, das wäre wenigstens schmerzlos. Sogar friedlich.«
Carolyn verzog säuerlich das Gesicht und lächelte dann. »Du hattest wohl ein paar schwere Wochen mit David, oder?«
»Nein, das ist es nicht«, begann Jennifer. »Oder vielleicht doch. Es waren tatsächlich ein paar verdammt harte Wochen, jetzt wo du es sagst. Und wo warst du eigentlich? Ich hätte deine Hilfe brauchen können.«
Carolyn klopfte ihr auf die Schulter. »Tut mir leid. Gib mir das mal.« Jennifer reichte ihr die Pfeife und sie nahm einen kleinen Zug.
»Trotzdem«, fuhr Jennifer fort. »Wird es dir nicht auch manchmal zu viel? Im Ernst?«
»Was?«
Jennifer machte eine Armbewegung, die das Grab, Garrison Oaks und den Stier einschloss. »All das hier.«
Carolyn dachte einen Augenblick lang nach. »Nein. Nicht wirklich. Nicht mehr.« Sie sah Jennifers Haar an und zupfte eine Made heraus, die sich zwischen ihren Fingerspitzen krümmte. »Früher schon, aber ich habe mich angepasst.« Sie zerquetschte die Made. »Man kann sich an fast alles gewöhnen.«
»Du vielleicht.« Jennifer nahm die Pfeife wieder. »Manchmal glaube ich, wir beide sind die einzigen hier, die noch bei Verstand sind.«
Carolyn kam der Gedanke, Jennifer die Schulter zu tätscheln oder sie in den Arm zu nehmen. Doch sie ließ es lieber bleiben. Das Gespräch war sowieso schon viel zu gefühlsbetont für ihren Geschmack. Also wechselte sie lieber das Thema und deutete auf das Grab. »Wie lange wird es dauern, bis …«
»Ich bin nicht sicher«, antwortete Jennifer. »Wahrscheinlich eine ganze Weile. Sie war noch nie so lange da unten.« Wieder verzog sie das Gesicht und spuckte. »Uäh!«
»Ich habe dir etwas mitgebracht«, sagte Carolyn, suchte in ihrer Plastiktüte und zog eine halbleere Flasche Listerine heraus.
»Was ist das denn?«, fragte Jennifer, als sie die Flasche nahm.
»Du nimmst etwas in den Mund und spülst ihn damit aus. Nicht herunterschlucken. Nach ein paar Sekunden kannst du es ausspucken.«
Jennifer sah die Flüssigkeit misstrauisch an und versuchte herauszufinden, ob Carolyn sich über sie lustig machen wollte.
»Vertrau mir«, sagte Carolyn.
Nach kurzem Zögern nahm Jennifer einen Schluck und riss die Augen auf.
»Spül es im Mund herum«, forderte Carolyn sie auf und demonstrierte es, indem sie erst die rechte und dann die linke Backe aufblies. Jennifer tat es ihr nach. »Und jetzt spuck es aus.« Jennifer tat es. »Besser?«
»Wow!«, machte Jennifer. »Das ist …« Sie sah über die Schulter zu David. Er sah zwar nicht zu ihnen, doch sie senkte trotzdem die Stimme. »Das ist unglaublich. Normalerweise brauche ich Stunden, um den Geschmack loszuwerden.«
»Ich weiß«, erwiderte Carolyn. »Das ist so ein amerikanisches Ding. Nennt sich Mundwasser.«
Jennifer ließ einen Moment lang mit kindlichem Erstaunen die Finger über das Etikett gleiten. Dann hielt sie die Flasche mit offensichtlichem Widerwillen Carolyn wieder hin.
»Nein«, sagte diese. »Du kannst sie behalten. Ich habe sie für dich mitgenommen.«
Jennifer sagte nichts, aber sie lächelte.
»Bist du fertig?«
Jennifer nickte. »Ich glaube schon. Margaret ist auf jeden Fall bereit. Sie hat den Ruf gehört.« Sie hob die Stimme. »David? Ist noch etwas?«
David hatte ihnen den Rücken zugekehrt. Er stand am Rand des Einschnitts und sah über den Highway 78 nach Garrison Oaks hinüber. Abwesend wedelte er mit der Hand.
Jennifer zuckte mit den Schultern. »Das heißt wohl, dass ich fertig bin.« Sie wandte sich an Carolyn. »Also, was meinst du?«
»Ich weiß nicht recht«, meinte Carolyn. »Wenn Vater bei den Amerikanern ist, kann ich ihn nicht finden. Habt ihr etwas erfahren?«
»Michael sagt, er sei nicht bei den Tieren, weder bei den toten noch bei den lebenden.«
»Und die anderen?«
Jennifer zuckte mit den Achseln. »Bislang sind es nur wir drei. Die anderen kommen sicher gleich.« Sie streckte sich im Gras aus und legte den Kopf in Carolyns Schoß. »Danke für das … wie nanntest du das?«
»Listerine.«
»Lis-ter-ine«, wiederholte Jennifer. »Danke.« Sie schloss die Augen.
Den ganzen Nachmittag lang trudelten die anderen Bibliothekare einzeln oder zu zweit ein. Manche von ihnen hatten etwas im Gepäck. Alicia hielt die schwarze Kerze, die noch brannte, wie sie es in der goldenen Ruine am Ende der Zeit getan hatte. Rachel und ihre Phantomkinder flüsterten untereinander von der Zukunft, die nie kommen würde. Die Zwillinge Peter und Richard beobachteten genau, wie die Bibliothekare die zwölf Punkte des Kreises einnahmen und suchten nach einer tieferen Ordnung, die den anderen verborgen blieb. Der Schweiß auf ihrer tiefschwarzen Haut glänzte im Licht des Feuers.
Und kurz vor Sonnenuntergang streckte Margaret eine bleiche, zitternde Hand ans Licht.
»Sie ist wieder da«, verkündete Jennifer.
Lächelnd ging David zum Grab und fasste nach Margarets Hand. Mit seiner Hilfe erhob sie sich auf zittrigen Beinen und die Erde fiel an ihr herunter. David hob sie aus dem Grab. »Hallo, meine Liebe!«
Wie sie so vor ihm stand und lächelnd den Kopf in den Nacken legte, reichte sie ihm kaum bis zur Brust. David wischte den gröbsten Dreck ab, hob sie dann an den Hüften hoch und küsste sie lange. Ihre kleinen Füße baumelten gut zwanzig Zentimeter über der schwarzen Erde. Carolyn fiel auf, dass sie nicht erkennen konnte, welche Farbe das Gewand hatte, in dem Margaret beerdigt worden war. Aschgrau vielleicht, oder die ausgebleichte Fleischfarbe einer Puppe, die zu lange in der Sonne gelegen hatte. Welche Farbe es auch gewesen sein mochte, jetzt passte sie genau zu Margaret selbst. Sie ist kaum noch hier. Alles, was wirklich noch von ihr da ist, ist der Geruch.
Margaret wankte einen Moment, dann setzte sie sich in den weichen Erdhaufen neben dem Grab. David winkte ihr kurz zu und strich mit der Zunge über seine Zähne. Margaret kicherte. Jennifer würgte erneut.
David ließ sich neben Margaret nieder und raufte ihr das staubige schwarze Haar.
»Nun«, rief er Richard, Peter und den anderen zu. »Worauf wartet ihr? Es sind alle da. Nehmt eure Plätze ein!«
Sie standen in einem unregelmäßigen Kreis. Carolyn beobachtete David, der unsicher den Stier betrachtete und sich schließlich so hinstellte, dass er ihm den Rücken zuwandte. Selbst jetzt kann er ihn nicht ansehen. Nicht, dass sie es ihm verdenken konnte.
»Nun«, begann er. »Ihr hattet alle einen Monat Zeit. Wer hat Antworten für mich?«
Niemand sprach.
»Margaret? Wo ist Vater?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Er ist nicht in den vergessenen Ländern. Er wandert nicht in der äußeren Dunkelheit.«
»Also ist er nicht tot.«
»Vielleicht nicht.«
»Vielleicht? Was soll das heißen?«
Margaret schwieg eine ganze Weile. »Wenn er in der Bibliothek gestorben wäre, wäre das etwas anderes.«
»Wieso anders? Würde er nicht in die vergessenen Länder kommen?«
»Nein.«
»Wohin dann?«
Margaret wirkte unsicher. »Das sollte ich nicht sagen.«
David rieb sich die Schläfen. »Ich will ja gar nicht, dass du über deinen Katalog sprichst, aber … er ist schon so lange weg. Wir müssen alle Eventualitäten in Betracht ziehen. Ganz allgemein, was würde denn passieren, wenn er in der Bibliothek stirbt? Würde er …?«
»Mach dich nicht lächerlich«, warf Carolyn mit hochrotem Gesicht ein. Beinahe hätte sie ihn angeschrien. »Vater kann nicht tot sein – nicht in der Bibliothek und auch sonst nirgendwo!« Die anderen murmelten zustimmend. »Er ist … er ist Vater!«
Davids Gesicht verfinsterte sich, doch er sagte nichts. »Margaret? Was glaubst du?«
Margaret zuckte desinteressiert mit den Achseln. »Wahrscheinlich hat Carolyn recht.«
»Hmm.« Er schien nicht überzeugt. »Rachel? Wo ist Vater?«
»Das wissen wir nicht«, sagte sie und breitete die Arme aus, um auf die stummen Reihen der Geisterkinder hinter ihr zu zeigen. »Er ist in keiner möglichen Zukunft, die wir sehen können.«
»Alicia? Was ist mit der tatsächlichen Zukunft? Ist er da?«
»Nein.« Nervös strich sie sich mit den Fingern durch das schmutzigblonde Haar. »Ich habe gesucht bis zum Hitzetod im Weltall. Nichts.«
»Er ist in keiner Zukunft und er ist nicht tot. Wie kann das sein?«
Alicia und Rachel sahen einander an und zuckten mit den Achseln. »Das ist mir echt ein Rätsel«, sagte Rachel. »Ich habe keine Erklärung dafür.«
»Das ist keine gute Antwort.«
»Vielleicht stellst du die falschen Fragen.«
»Tatsächlich?« Gefährlich grinsend baute sich David vor ihr auf und ließ die Kiefernmuskeln spielen. »Tue ich das?«
Rachel wurde bleich. »Ich wollte nicht …«
David ließ sie einen Moment leiden, dann legte er einen Finger an ihre Lippen. »Später.« Sichtlich zitternd sank Rachel im Mondlicht zu Boden.
»Peter, du bist doch angeblich gut mit so abstraktem Kram. Zahlen und so. Was meinst du?«
Peter zögerte. »Einige Aspekte von Vaters Arbeit habe ich nie sehen dürfen …«
»Vater hat vor uns allen Dinge verborgen. Beantworte meine Frage.«
»Als er verschwunden ist, hat er an etwas gearbeitet, was er Regressionsfinale nannte«, berichtete Peter. »Das ist die These, dass das Universum so beschaffen ist, dass, egal wie viele Rätsel man löst, es immer noch ein tieferliegendes Geheimnis gibt. Vater schien sehr …«
»Oh verdammt! Weißt du, wo Vater ist oder nicht?«
»Nicht genau, aber wenn man den Gedanken weiter spinnt, könnte das erklären …«
»Egal.«
»Aber …«
»Sei still! Carolyn, du gehst später mit Peter und übersetzt das, was er sagt, in eine normalverständliche Sprache.«
»Natürlich«, antwortete sie.
»Michael, was ist mit dem Fernen Berg? Gab es dort irgendwelche Zeichen?«
Der Ferne Berg war die Heimat des Waldgottes. Dorthin gingen alle schlauen kleinen Tiere, wenn sie starben – so in etwa jedenfalls. Carolyn hatte nicht gewusst, dass er real war. Aber bis jetzt hatte sie ja nicht einmal gewusst, dass der Waldgott real war.
»Nein. Nicht da.« Er sprach jetzt besser.
»Und der Waldgott? Ist er …«
»Der Waldgott schläft. Er hat keine Armee gegen uns aufgestellt. Es herrschen die üblichen Intrigen unter seinen Anhängern, aber nichts, was uns direkt betrifft. Ich sehe keinen Grund, zu glauben …«
»Glauben? Du? Das ist geradezu lustig.« David wandte sich ab. »Emily, was ist mit …«
»Da ist noch etwas«, unterbrach ihn Michael. »Wir bekommen Besuch.«
David starrte ihn an. »Besuch? Warum hast du mir das nicht früher erzählt?«
»Du hast mich auf den Mund geschlagen und mir befohlen, zu schweigen«, antwortete Michael.
Wieder zuckten Davids Kiefermuskeln. »Jetzt befehle ich dir nicht zu schweigen«, sagte er. »Wer kommt?«
»Nobununga.«
»Was? Hierher?«
»Er sorgt sich um Vaters Sicherheit«, sagte Michael. »Er will Nachforschungen anstellen.«
»Oh Scheiße!«, entfuhr es Carolyn. Sie hatte Nobununga nicht so schnell erwartet. Doch sie war geistesgegenwärtig gewesen, leise und englisch zu sprechen, daher bemerkte es keiner.
»Wann wird er ankommen?«
Michael runzelte die Stirn. »Er kommt … hmm … wenn er da ist?«
David knirschte mit den Zähnen. »Haben wir irgendeine Vorstellung davon, wann das sein könnte?«
»Das ist später.«
»Und wann genau?« Davids Hand ballte sich zur Faust.
»Er versteht das nicht, David«, warf Jennifer leise ein. »Er sieht Zeit nicht so wie andere Menschen. Nicht mehr. Und es nutzt gar nichts, ihn zu schlagen.«
Panisch sah Michael zwischen Jennifer und David hin und her. »Die Mäuse haben ihn gesehen! Er kommt!«
David öffnete die Faust und rieb sich die Schläfen. »Na gut«, meinte er. »Spielt keine Rolle. Er hat ja recht. Nobununga kommt, wenn er kommt. Wir können ihn nur willkommen heißen. Peter, Richard, sammelt die Totems ein.«
Gehorsam sprangen die Zwillinge auf.
»Carolyn, du musst zurück nach Amerika. Wir brauchen ein unschuldiges Herz. Das werden wir Nobununga opfern, wenn er kommt. Glaubst du, du kriegst das hin?«
»Ein unschuldiges Herz? In Amerika?« Sie zögerte. »Vielleicht.«
Er missverstand sie und erklärte: »Das ist ganz einfach. Du schneidest einfach durch die Rippen.« Er schnitt mit den Fingern in die Luft. »So etwa. Wenn du es nicht selbst herausbekommst, schick nach mir.«
»Ja, David.«
»Das ist alles für heute Abend. Carolyn, du gehst, sobald du bereit bist. Der Rest von euch bleibt in der Nähe.« Besorgt sah er den Stier an. »Richard, Peter, beeilt euch. Ich will … äh … zurück zu Mrs. McGillicutty«, sagte er und blinzelte Margaret zu. »Das Abendessen ist bald fertig.«
Rachel setzte sich auf den Boden und ihre Kinder versammelten sich um sie. Gleich darauf war sie völlig hinter ihnen verborgen. Carolyn hätte gerne mit Michael gesprochen, doch der war mit seinen Jaguaren im Wald verschwunden. Jennifer rollte ihre Schlaffelle aus und legte sich ächzend darauf. Margaret kreiste um David herum.
Der wühlte einen Augenblick in seinem Rucksack. »Hier, Margaret«, sagte er. »Ich habe dir etwas mitgebracht.« Er zog den abgetrennten Kopf eines alten Mannes an seinem langen, zotteligen Bart heraus. Er schwang ihn ein paar Mal hin und her, dann warf er ihn ihr zu.
Margaret fing ihn mit beiden Händen und ächzte ein wenig unter dem Gewicht. Erfreut grinste sie und zeigte dabei schwarze Zähne. »Danke!«
David setzte sich neben sie und strich ihr das Haar aus den Augen. »Wie lange dauert es noch?«, rief er über die Schulter hinweg.
»Eine Stunde«, sagte Richard und rührte mit der Hand in der Schüssel mit den Totems. Michaels Haar vom Waldgott, das blutgetränkte Stoffstück von Carolyns Kleid, ein Tropfen Wachs von der schwarzen Kerze. Es waren die Knotenpunkte eines n-dimensionalen Trackers, von dem sie ziemlich sicher waren – nun, wenigstens relativ sicher … dass er sie zu Vater führen würde. Nun, wahrscheinlich. Carolyn hatte ihre Zweifel.
»Nicht länger«, bestätigte Peter.
Margaret nahm den Kopf auf den Schoß und begann damit zu spielen. Sie streichelte die Wangen, sprach zärtlich mit ihm, und strich ihm über die buschigen Augenbrauen. Nach einigem Zögern zuckten die Augenlider des Mannes, dann öffneten sie sich.
»Blaue Augen!«, rief Margaret entzückt. »Oh, David, danke!«
David zuckte mit den Achseln.
Carolyn warf einen Blick hinüber. Die Augen des Mannes waren vielleicht einmal blau gewesen, aber jetzt waren sie nur noch eingefallen und trübe. Aber sie erkannte ihn. Er war ein minderer Höfling in einem von Vaters Kabinetten gewesen und früher einmal der Premierminister von Japan. Normalerweise wäre ein solcher Mann geschützt. David muss sich sehr stark fühlen. Wieder blinzelte der Kopf und richtete seinen Blick auf Margaret. Seine Zunge bewegte sich und seine Lippen begannen sich zu bewegen, doch ohne Lunge brachte er keinen Laut hervor.
»Was sagt er?«, wollte David wissen. Nach sechs Wochen in der Verbannung hatten die meisten von ihnen ein paar Brocken Amerikanisch aufgeschnappt, aber Carolyn war die einzige, die Japanisch sprach.
Sie neigte sich zu ihm und rümpfte die Nase wegen des Geruchs. Dann legte sie den Kopf schief und berührte die Wangen des Mannes. »Moo ichido itte kudasai, Yamada-San.« Der tote Mann versuchte es erneut und flehte sie mit blicklosen Augen an.
Carolyn setzte sich zurück und faltete demütig die Hände im Schoß, die linke über der rechten, so dass die Handfläche der einen Hand die Finger der anderen verbarg. Ihr Gesichtsausdruck war friedlich, sogar freundlich. Sie wusste, dass Emily leicht ihre Gedanken lesen konnte. Auch David konnte Gedanken spüren, zumindest deren Grundtenor. Er wusste es, wenn ihm jemand nicht wohlgesonnen war. Im Kampf konnte er tiefer in den Geist seiner Feinde eindringen und ihre Strategien erkennen, sowie die Waffen, die sie möglicherweise gegen ihn einsetzten. Carolyn vermutete, dass er, wenn es nötig sein sollte, auch noch tiefer in sie hineinsehen konnte. Aber es spielte keine Rolle. Wenn Emily oder David jetzt in Carolyns Gedanken sahen, sahen sie dort nur den Wunsch, zu helfen.
Natürlich sind wahre Gefühle die Essenz des Daseins. Man kann sie nicht »ent-fühlen«, sie ignorieren oder auch nur für lange Zeit umleiten.
Doch mit Übung und Sorgfalt kann man sie verbergen.
»Er fragt nach Chieko und Kiko-Chan«, sagte Carolyn. »Ich glaube, es sind seine Töchter. Er will wissen, ob es ihnen gut geht.«
»Ah«, machte David. »Sag ihm, ich habe sie zur Übung aufgeschlitzt. Und ihre Mutter auch.«
»Stimmt das?«
David zuckte mit den Schultern.
»Sorera wa anzen desu, Yamada-san. Ima yasumu desu nee.« Carolyn sagte ihm, dass es ihnen gut ging und dass er in Frieden ruhen könne. Der tote Mann senkte den Blick. Am linken Augenlidrand bebte eine einzelne Träne. Margaret betrachtete sie mit leuchtenden, gierigen Augen. Als sie sich löste und Yamadas Wange hinunterlief, senkte sie wie ein Vogel den Kopf und leckte sie mit einem geschickten Zungenschlag auf.
Carolyns Lächeln war angemessen gezwungen. Vielleicht hatte sie ja das Mitleid mit dem armen Mann überwältigt? Vielleicht war es aber auch nur der Geruch. Wieder würde jemand, der sich die Mühe machte, in ihren Gedanken zu lesen, nur die Sorge um Vater finden und ein ernstes – wenn auch leicht nervöses – Verlangen, es David recht zu machen. Doch in ihren Fingerspitzen saß noch die Erinnerung an das leichte, verblassende Beben am Schaft eines Bronzespeers und in ihrem Herz glühte der Hass auf sie wie eine schwarze Sonne.
Kapitel 2
Buddhismus für Arschlöcher
I
Also, willst du in ein Haus einbrechen?«, fragte sie.
Steve erstarrte und der Mund blieb ihm offen stehen. An der Bar ertönten eine Reihe von Klicks im Inneren der Musikbox. Jemand hatte einen Penny eingeworfen. Er stellte sein Bier auf den Tisch, ohne auch nur einen Schluck genommen zu haben. Wie hieß sie noch gleich? Christy? Cathy?
»Wie bitte?«, sagte er schließlich. Endlich fiel es ihm ein: Carolyn. »Du machst wohl Witze?«
Sie zog an ihrer Zigarette. Die Asche glühte und warf einen orangen Schein über ein halbes Dutzend schmutziger Schnapsgläser und einen kleinen Haufen Hühnerknochen. »Nein, es ist mein voller Ernst.«
In der Musikbox surrte es und gleich darauf erschallte das Schlagzeug zu Benny Goodmans »Sing, Sing, Sing« wie die Kriegstrommeln eines vergangenen wilden Stammes durch die Bar. Steves Herz begann plötzlich laut zu schlagen.
»Na gut, du machst also keine Witze. Aber du sprichst da von einem ziemlich schweren Vergehen.«
Sie sah ihn nur schweigend an.
Gerne hätte er etwas Kluges von sich gegeben, aber alles, was er hervorbrachte war: »Ich bin Klempner.«
»Das warst du nicht immer.«
Steve starrte sie an. Das stimmte, aber woher um alles in der Welt wusste sie das? Diese Art von Unterhaltung hatte ihm Albträume beschert. In dem Bemühen, seinen Schrecken zu verbergen, nahm er den letzten Chicken-Wing und tunkte ihn in die Käsesoße, ohne ihn letztendlich zu essen. Diese Dinger hier taugten nichts. Der Geruch nach Essig und Pfeffer stieg ihm wie eine Warnung in die Nase.
»Ich kann nicht«, sagte er. »Ich muss nach Hause und Petey füttern.«
»Wen?«
»Meinen Hund. Petey. Er ist ein Cocker…«
»Das kann warten«, unterbrach sie ihn kopfschüttelnd.
Wechsle das Thema. »Wie gefällt es dir hier?«, grinste er hilflos.
»Ehrlich gesagt, ziemlich gut«, antwortete sie und blätterte in der Zeitschrift, die Steve gelesen hatte. »Wie heißt das noch mal?«
»Warwick Hall. Es war in den Zwanzigerjahren mal eine illegale Kneipe. Cath – die Besitzerin – hat es zusammen mit ein paar Fotos davon, wie es mal ausgesehen hat, von ihrem Großvater geerbt. Sie ist ein großer Jazzfan und als sie pensioniert wurde, hat sie den Laden restauriert und als privaten Club wiedereröffnet.«
»Genau.« Carolyn nippte an ihrem Bier und betrachtete die gerahmten Plakate an den Wänden – Lonnie Johnson, Roy Eldridge mit seiner Trompete und eine Werbung für eine Jamsession am 3. und 4. Oktober neunzehnhundertirgendundzwanzig. »Es ist anders.«
»Das stimmt.« Steve schüttelte eine Zigarette aus der Packung und hielt sie ihr hin. Als sie sie nahm, bemerkte er, dass die Fingernägel an ihrer rechten Hand unlackiert und bis aufs Fleisch abgekaut waren, während die an der linken lang, gut manikürt und knallrot lackiert waren. Seltsam. Er zündete ihre Zigarette mit einem einzigen Streichholz an. »Anfangs bin ich nur hergekommen, weil es die einzige Bar ist, in der man noch rauchen darf, aber jetzt gefällt es mir auch so hier.«
»Denk mal einen Augenblick darüber nach«, schlug Carolyn vor. »Ich weiß, dass das etwas plötzlich kam. Wo ist die Toilette?«
»Darüber brauche ich nicht nachzudenken. Die Antwort ist Nein. Und die Damenklos sind da hinten.« Er deutete mit dem Daumen über die Schulter. »Da bin ich zwar noch nie gewesen, aber bei den Männern muss man an einer Messingkette ziehen, um zu spülen. Ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe.« Er hielt inne. »Wer bist du eigentlich?«
»Habe ich dir doch gesagt«, antwortete Carolyn. »Ich bin eine Bibliothekarin.«
»Okay.« Zuerst hatte ihn ihr Aussehen – Weihnachtspullover komplett mit Rentieren über Fahrradhosen, roten Gummistiefeln und Legwarmern aus den 80ern – vermuten lassen, dass sie schizophren war, doch daran zweifelte er mittlerweile.
Okay, dachte er, also nicht schizophren. Aber was dann? Carolyn war nicht übermäßig gepflegt, aber sie war auch nicht unattraktiv. Er hatte den Eindruck, dass sie überaus klug war. Vor etwa eineinhalb Stunden war sie mit ein paar Bier angekommen, hatte sich vorgestellt und gefragt, ob sie sich neben ihn setzen durfte. Steve, ein Junggeselle ohne andere Bindungen als die an seinen Hund, hatte Ja gesagt. Sie hatten sich eine Weile unterhalten. Sie hatte ihn mit Fragen gelöchert und auf seine nur sparsam geantwortet. Dabei hatte sie ihn mit dunkelbraunen Augen angesehen.
Steve war irgendwie zu dem Schluss gelangt, dass sie an der Universität arbeitete, vielleicht als eine Art Linguistin? Sie hatte Cath auf Französisch angesprochen und einen weiteren Stammgast, Eddie Hu, mit fließendem Chinesisch überrascht. Bibliothekarin passt auch irgendwie, dachte er. Er stellte sich vor, wie sie mit wirren Haaren zwischen wackeligen Bücherstapeln saß und leise in ihre Kaffeetasse aus der Personalkantine murmelte, während sie ihren Einbruch plante. Grinsend schüttelte er den Kopf. Auf keinen Fall. Er bestellte einen weiteren Krug Bier.
Das Bier kam einige Minuten früher an als Carolyn. Er goss sich ein Glas ein. Während er es trank, änderte er seine Diagnose von schizophren zu »völlig desinteressiert an ihrem Äußeren«. Es gab viele Leute, die behaupteten, sich nichts aus Kleidung zu machen, aber nur wenige, bei denen es wirklich so war. Aber nicht unmöglich.
Ein Kerl, mit dem Steve auf der Highschool gewesen war, Bob irgendwas, hatte mal zwei Jahre auf einer Insel im Südpazifik verbracht, im Rahmen eines irre erfolgreichen Drogenprogramms. Als er zurückkam, war er unglaublich reich – zwei Ferraris, zum Himmel nochmal – aber er zog immer einfach irgendetwas an. Bob, erinnerte er sich, hatte mal …
»Ich bin wieder da«, sagte Carolyn. »Sorry.« Sie hatte ein hübsches Lächeln.
»Ich hoffe, du hast Lust auf noch eine Runde«, meinte er und deutete auf den Krug.
»Klar doch.«
Er goss ihr ein. »Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist schräg.«
»Was meinst du?«
»Die Bibliothekarinnen, die ich kenne, stehen mehr auf so was wie Tee und schaurig-schöne Romane als auf Diebstahl und Einbruch.«
»Nun, das ist eine etwas andere Bibliothek.«
»Ich fürchte, da brauche ich schon ein wenig mehr Information.« Sobald er ausgesprochen hatte, bereute er es. Du denkst doch nicht im Ernst darüber nach, oder? Schnell lauschte er in sich hinein. Nein, tue ich nicht. Aber neugierig war er schon.
»Ich habe ein Problem«, sagte Carolyn. »Und meine Schwester sagt, du hättest die Art von Erfahrung, die uns dabei helfen kann, es zu lösen.«
»Und von was für einer Art von Erfahrung sprechen wir da?«
»Türschlösser – nichts Besonderes – und ein Lorex-Alarmsystem.«
»Das ist alles?« Er dachte an die Werkzeugkiste hinten in seinem Laster. Er hatte natürlich sein Klempnerwerkzeug dabei – Lötkolben, Zinn, Bolzenschneider, Rohrzange – aber auch noch andere Dinge. Drahtscheren, Brechstange, ein Universalmessgerät und ein kleines Metalllineal, mit dem er … Nein! Er drängte den Gedanken zurück. Aber es war zu spät. Etwas in ihm war erwacht und begann sich zu regen.
»Das ist alles«, bestätigte sie. »Kinderspiel.«
»Wer ist deine Schwester?«
»Sie heißt Rachel. Du kennst sie nicht.«
Er dachte darüber nach. »Stimmt. Ich kann mich nicht an jemanden mit diesem Namen erinnern.« Sie gehörte auf jeden Fall nicht zu dem kleinen – sehr kleinen – Kreis von Leuten, die von seiner früheren Karriere wussten. »Und woher weiß diese Rachel so viel über mich?«
»Ehrlich gesagt ist mir das auch nicht ganz klar. Aber sie ist sehr gut darin, Dinge herauszufinden.«
»Und was genau hat sie über mich herausgefunden?«
Carolyn zündete sich eine neue Zigarette an und blies zwei kleine Rauchsäulen aus der Nase. »Sie sagt, dass du gut bist in mechanischen Dingen und dass du etwas von einem Outlaw hast. Und dass du über hundert Einbrüche verübt hast. Ich glaube, sie sagte einhundertzwölf.«
Das stimmte, wenn es auch fast zehn Jahre her war. Plötzlich verkrampfte sich sein Magen. Die Dinge, die er getan hatte, und was noch schlimmer war, die, die er damals nicht getan hatte, hingen immer über ihm und ließen sich nie ganz verdrängen. Bei ihren Worten kamen sie ihm wieder schmerzhaft ins Bewusstsein.
»Ich möchte, dass du jetzt gehst«, sagte er leise. »Bitte.«
Er wollte die Sportzeitschrift lesen. Er wollte über die Angriffstaktik der Colts nachdenken und nicht darüber, dass er sogar ohne das richtige Werkzeug ein Kwikset-Türschloss in weniger als dreißig Sekunden öffnen konnte. Er wollte …
»Entspann dich. Das könnte sich für dich lohnen.« Sie schob etwas auf dem Boden zu ihm hinüber. Ein Blick unter den Tisch zeigte ihm eine blaue Stofftasche. »Sieh hinein.«
Er nahm die Tasche am Griff hoch. Er vermutete bereits, was er darin finden würde, zog den Reißverschluss auf und sah nach. Bargeld. Jede Menge. Hauptsächlich Fünfziger und Hunderter.
Steve stellte die Tasche wieder ab und schob sie zurück. »Wie viel ist das?«
»Dreihundertsiebenundzwanzigtausend Dollar.« Sie drückte ihre Zigarette aus. »So ungefähr.«
»Das ist eine seltsame Summe.«
»Ich bin eine seltsame Person.«
Steve seufzte. »Ich höre.«
»Machst du es also?«
»Nein. Auf gar keinen Fall.« Der Buddhist bemüht sich, nichts zu nehmen, was nicht gegeben wird. Er hielt inne und verzog das Gesicht. Letztes Jahr hatte er bei der Steuer 58.000 Dollar angegeben. Die Schulden auf seiner Kreditkarte beliefen sich auf nicht viel weniger. »Vielleicht.« Er zündete sich eine neue Zigarette an. »Das ist eine Menge Geld.«
»Ja? Ich glaube schon.«
»Für mich jedenfalls. Bist du reich?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Mein Vater ist es.«
»Aha.« Reicher Daddy. Das erklärte so einiges. »Wie bist du auf … wie viel ist das noch mal? … gekommen?«
»Dreihundertsiebenundzwanzigtausend Dollar. Ich bin zur Bank gegangen. Geld ist nicht das Problem. Ist es genug? Ich kann noch mehr bekommen.«
»Es sollte reichen«, sagte er. »Früher habe ich mal Leute gekannt – qualifizierte Leute – die so einen Job für dreihundert Dollar gemacht hätten.« Er wartete ein wenig hoffnungsvoll darauf, dass sie ihr Angebot zurückzog oder ihn darum bat, sie den qualifizierten Leuten vorzustellen. Doch sie starrten einander nur eine Weile an.
»Ich will dich«, sagte sie. »Wenn es nicht am Geld liegt, was hindert dich dann?«
Er überlegte, ob er ihr erklären sollte, dass er es besser machen wollte. Er könnte sagen: Ich komme mir manchmal vor wie eine junge Pflanze, die gerade aus der Erde hervorsprießt und versucht, sich zur Sonne zu strecken. Stattdessen sagte er: »Ich versuche, herauszufinden, was für dich dabei herausspringt. Ist das so eine Art Spiel von reichen Kids? Ist dir langweilig?«
Sie lachte leise. »Nein. Ganz im Gegenteil.«
»Also was ist es dann?«
»Vor ein paar Jahren wurde mir etwas weggenommen. Etwas Kostbares.« Sie lächelte ihn eisig an. »Das will ich wiederhaben.«
»Ich brauche ein paar mehr Details. Von was reden wir? Diamanten? Schmuck?« Er zögerte. »Drogen?«
»Nichts dergleichen. Es hat mehr sentimentalen Wert. Mehr kann ich dir nicht sagen.«
»Und warum ich?«
»Du wurdest wärmstens empfohlen.«
Steve überlegte. Hinter Carolyn übten Eddie Hu und Cathy auf der Tanzfläche Charleston. Sie werden ziemlich gut. Steve erinnerte sich daran, wie es war, in etwas gut zu sein. Eine Zeitlang war er in gewissen Kreisen ein bisschen bekannt gewesen. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand an mich.
»Na gut«, sagte er schließlich. »Damit kann ich wohl leben. Aber ich habe noch ein paar Fragen.«
»Schieß los.«
»Du bist sicher, dass es sich nur um einfache Türschlösser und Alarmanlagen handelt? Keine Safes, keine exotischen Schlösser oder so?«
»Ganz sicher.«
»Woher weißt du das?«
»Wieder von meiner Schwester.«
Steve öffnete den Mund um nach der Zuverlässigkeit ihrer Informationen zu fragen, doch dann fiel ihm auf, dass er nicht hätte sagen können, wie viele Einbrüche er verübt hatte, selbst wenn man ihm eine Pistole an den Kopf gehalten hätte. Einhundertundzwölf klingt allerdings richtig. Also sagte er nur: »Letzte Frage: Was ist, wenn das, was du suchst, nicht da ist?«
»Dann bekommst du trotzdem das Geld.« Sie lächelte leicht und beugte sich etwas näher zu ihm. »Vielleicht sogar einen Bonus.« Mit einem Anflug von Flirt zog sie eine Braue hoch.
Steve überlegte. Bevor sie die Bombe mit dem Einbruch hatte platzen lassen, hatte er gehofft, dass ihr Gespräch in einem Flirt enden würde. Aber jetzt …
»Halten wir die Dinge unkompliziert«, meinte er. »Das Geld sollte mir reichen. Wann willst du es machen?«
»Dann tust du es?« Ihre Beine waren kräftig und gebräunt. Wenn sie sich bewegte, konnte man die Muskeln unter der Haut arbeiten sehen.
»Ja«, sagte er, obwohl ihm klar war, dass das eine ganz schlechte Idee war. »Ich denke schon.«
»Dann jetzt oder nie.«
II
Eines der Dinge, die Steve an Warwick Hall mochte, war, wie sauber es war. Alles bestand aus poliertem Holz, leuchtendem Messing und gepflegten Ledersofas, deren Form wie eine Einladung an den Hintern war, und schwarz-weiße Fliesen auf dem Boden, deren Muster Euklid interessiert hätte.
Doch sobald man durch die Eingangstür ins Freie trat, änderte sich die Atmosphäre. Um in die moderne Welt zurückzukehren, musste man eine schmutzige Betontreppe zur Straße hinaufgehen. Die Stufen waren schwarz vor Dreck, es war ein Ort, an den sich Straßenkatzen zum Sterben zurückzogen. In den Ecken sammelte sich McMüll – Zigarettenstummel, Fastfood-Packungen, eine Wasserflasche halb voll mit Tabaksaft. Heute Abend war es kühl, was den Geruch dämpfte, aber im Sommer musste er die Luft anhalten, wenn er die Stufen hinaufging.
Carolyn gefiel er auch nicht. In der Bar hatte sie die Gummistiefel ausgezogen, doch an der Tür hatte sie sie angezogen und oben an der Treppe wieder abgelegt. Die Legwarmer waren in unmodernen Regenbogenfarben gestreift wie eine Zuckerstange. Verdammt, ich muss einfach fragen. »Wo hast du diese Sachen eigentlich her?«
»Hmm?«
Er deutete auf die Stiefel.
»Ich wohne bei einer Frau. Sie hatte sie im Schrank.« Ohne die Gummistiefel war sie barfuß. Der Schotter auf dem Parkplatz schien ihr dennoch nichts auszumachen.
»Mein Truck steht da drüben.« Es war ein weißer Arbeitswagen, der schon ein paar Jahre alt war. Auf der Tür stand HODGSON PLUMBING. Die Schlösser an seinen Werkzeugkisten waren die besten, von Medeco. »Die Mädels stehen darauf, ich weiß. Versuch, dich zu beherrschen.« Nach Sonnenuntergang war es kalt geworden und sein Atem stand in weißen Wölkchen in der Luft.
Mit fragend schiefgelegtem Kopf sah sie ihn an.
»Nicht lustig. Egal.« Er stieg auf der Fahrerseite ein, während sie am Türgriff hantierte.
»Klemmt er?«
Sie lächelte etwas nervös und bemühte sich mehr. Schließlich griff er hinüber und öffnete die Tür von innen.
»Danke.« Sie warf die Gummistiefel und die Tasche mit den dreihundertsiebenundzwanzigtausend Dollar auf den Boden, wo sie zwischen Flaschen mit Mountain Dew und leeren Beef-Jerky-Tüten liegen blieb. Sie rollte sich auf dem Beifahrersitz zusammen und schlug mit der Gelenkigkeit einer Achtjährigen die Beine unter.
»Ich habe hinten noch eine Jacke, wenn du sie haben willst. Es ist kalt draußen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein danke, schon gut.«
Steve ließ den Motor an und der Wagen bebte. Aus den Lüftungsschlitzen strömte kalte Luft. Letzte Chance, dachte er. Die letzte Chance, es sich anders zu überlegen. Er warf einen Blick in den Fußraum. Im phlegmatisch gelben Licht einer Straßenlaterne konnte er ein Geldscheinbündel sehen, das sich unter dem Stoff der Tasche abzeichnete. Er verzog das Gesicht, als würde er bittere Medizin schlucken. »Hast du eine Adresse?«