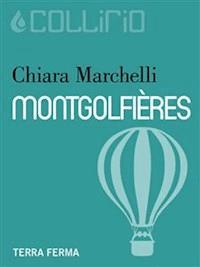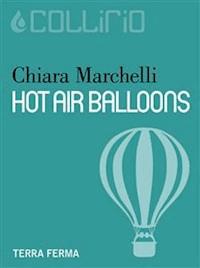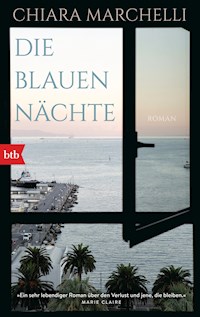
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Shortlist Premio Strega. Für alle Leserinnen von Joan Didion.
Was bleibt, wenn ein Mensch verschwindet? Larissa und Michele kennen sich bereits seit einer Ewigkeit. Das Ehepaar lebt in New York, wo Michele als Professor für Spieltheorie an der Universität lehrt. Mirko, der einzige Sohn, lebte mit seiner Frau in Genua, bis er sich vor fünf Jahren überraschend das Leben nahm. Seitdem versucht das Paar so gut es geht Trost im Alltag zu finden, doch die Frage nach dem Warum quält sie und zehrt an ihrer Beziehung. Da erreicht sie eines Tages ein Anruf von einer Frau, die behauptet, eine Affäre mit Mirko gehabt zu haben – und ein Kind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Was bleibt, wenn ein Mensch verschwindet? Larissa und Michele kennen sich bereits seit einer Ewigkeit. Das Ehepaar lebt in New York, wo Michele als Professor für Spieltheorie an der Universität lehrt. Mirko, der einzige Sohn, lebte mit seiner Frau in Genua, bis er sich vor fünf Jahren überraschend das Leben nahm. Seitdem versucht das Paar, so gut es geht Trost im Alltag zu finden, doch die Frage nach dem Warum quält sie und zehrt an ihrer Beziehung. Da erreicht sie eines Tages ein Anruf von einer Frau, die behauptet, eine Affäre mit Mirko gehabt zu haben – und ein Kind …
CHIARA MARCHELLI, geboren 1972 in Aosta, lebt als Lektorin und Übersetzerin in New York. Ihr Roman »Die blauen Nächte« war für den renommierten italienischen Literaturpreis Premio Strega nominiert.
Chiara Marchelli
Die blauen Nächte
Roman
Aus dem Italienischenvon Verena von Koskull
Die italienische Originalausgabe erschien 2017
unter dem Titel »Le notti blu« bei Giulio Perrone editore, Rom.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2021
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Chiara Marchelli
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published in agreement with the author through
MalaTesta Lit. Ag., Milano
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © plainpicture/Roberto Manzotti
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
SL · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-22419-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebooks.com/btbverlag
Denen, die bleiben
1.
Als es passierte, aß Michele gerade frittierte Sardellen.
»Das ist keine gute Idee«, hatte Larissa zu ihm gesagt.
Musste das sein, ausgerechnet vor dem Silvesteressen?
»Ja«, hatte er geantwortet, »damit ich mich in New York noch daran erinnere.«
Die frittierten Sardellen in Ivana Mussos Rosticceria. Frisch, saftig, der Teigmantel kross und golden. So hauchzart bekam ihn nur diese begnadete Schwerhörige hin, die Michele jedes Mal »Na, ham se dein lodderiges Amerika noch immer nich plattgemacht?« entgegenbrüllte, sobald er in den engen Altstadtgassen auftauchte.
Der Geschmack von Ivanas frittierten Sardellen sollte ihm trotz des in den Hals gesteckten Fingers bis zum nächsten Morgen aufstoßen. Es kam einfach nichts raus. Alles blieb drin und grub sich in die Erinnerung ein, zusammen mit dem ganzen Rest: Die mit geweiteten Augen verbrachte Nacht, der Krankenhausflur, Larissas Starre, die sie vor der Ohnmacht bewahrte, das Hin und Her der Ärzte und Krankenpfleger, der Geruch der Sardellen.
Seitdem wird ihm jedes Mal unvermeidlich schlecht, wenn er sie isst.
»Du könntest es einfach lassen«, meint Larissa, »niemand zwingt dich dazu.«
»Nein«, entgegnet er, »das geht schon vorüber.«
Eine der zahlreichen logischen Verbohrtheiten, die es ihm erlauben weiterzumachen.
So wie heute.
Er betritt den Hörsaal, ohne den Gruß der Studentin zu erwidern. Offenbar besucht sie seine Vorlesung, denn sie kennt seinen Nachnamen. Ohne sie eines näheren Blickes zu würdigen, steigt Michele zum Pult hinab und legt seine Karteikarten zurecht. Die Mikros pfeifen, als er zweimal heftig dagegen klopft, der Techniker fragt ihn, ob alles in Ordnung sei, doch Michele gibt auch ihm keine Antwort.
Heute sind es fünf Jahre. Statt die Last erträglicher zu machen, vervielfältigt die Zeit ihr Echo: Heute Abend wird er noch verstörter als letztes Jahr nach Hause kommen. Und obendrein womöglich betrunken.
»Du hättest zu Hause bleiben können«, wird Larissa sagen.
»Du weißt, dass ich hinmusste.«
Weil er der Einzige am Institut ist, der sich mit der Spieltheorie auskennt, und weil von seinen Kollegen nur Brian in der Stadt geblieben ist.
»Nash hatte wohl nichts Besseres vor«, witzelt Brian, dem dieses etwas andere Silvester eigentlich ganz gelegen kommt. Seine Frau ist vor drei Monaten abgehauen und hat die gesamte Habe mitgenommen.
Außerdem sind nur Studenten und Angestellte des Fachbereichs dort. Einbestellt um sieben Uhr, wenn der Vortrag – hoffentlich – vorbei sein wird.
»Was soll’s«, hat Michele geantwortet.
Außerdem wissen alle, dass Nash verrückt ist.
Als Nash eintrifft, sind bereits alle auf ihren Plätzen. Eigentlich hätte er vorher in Micheles Büro vorbeischauen sollen, um sich über den Vortrag abzustimmen, doch der Zug hatte eine Stunde Verspätung, und nun ist dafür keine Zeit mehr. Man kann schon von Glück sagen, dass er nicht kehrtgemacht hat.
»Professor.«
Michele hält ihm die Hand hin, und Nash scheint sie prüfend zu mustern, ehe er danach greift. Er sieht aus wie jemand, der möglichst schnell wieder nach Hause will. Doch wer weiß schon, was im Kopf dieses Mannes vorgeht. Dem berühmtesten Gelehrten, der sich mit der Spieltheorie befasst hat, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 1994. Dreißig von akademischen Erfolgen und Krankheit geprägte Jahre. Brillante Forschungstätigkeit in Princeton für die RAND Corporation im Dienst der Regierung. Elektroschock, Insulinschock, epileptische Anfälle, chemische Zwangsjacken. Ein leidendes Genie, das mit einundzwanzig Jahren bereits den Artikel verfasst hatte, der ihn zum Nobelpreis führen sollte.
Über sein Leiden würde Michele ihn gern befragen: über die Wahnzustände, die halluzinatorischen Phasen, die Paranoia.
Denn diese Einsicht geht ihm ab. Die Erfassung eines Unglücks, das so groß ist, dass es einem den Willen, die Gesundheit, das Leben raubt.
»Where shall I sit?«, fragt Nash.
Mirko war aber nicht schizophren, denkt Michele, deutet auf den Sessel und tritt ans Mikrophon.
»Dear colleagues …«
Mirko war kein Genie.
»Dear students …«
Mirko war nur sein Sohn.
Der Vortrag ist kurz. So kurz, dass die im Hörsaal versammelten Studenten, die auf ihre Ferien daheim verzichten, um heute Abend hier zu sein, auch zehn Minuten nach Nashs Verschwinden noch auf ihren Plätzen sitzen. Vielleicht haben sie mit einer Zugabe gerechnet. Doch Nash hat seine Forschung zum Ideal Money vorgestellt, sich mit einem ungerichteten Nicken ins Publikum verabschiedet und das Podium verlassen. Micheles abschließende Dankesworte haben sie nicht überzeugt, abwartend sitzen sie da und überlegen womöglich, welches Gewicht sie der Tatsache, für einen halbstündigen Vortrag ohne abschließende Diskussion auf ein Silvester mit ihren Freunden in Ohio verzichtet zu haben, in ihrem jugendlichen Wertesystem beimessen sollen.
»Ging es ihm schlecht?«, fragt Brian.
»Glaube ich nicht.«
»Findet das Abendessen statt?«
Seine Frau ist erst seit so kurzer Zeit fort, dass Brian noch keine Gelegenheit hatte, sich ein anderes Leben vorzustellen. Und heute ist der 31. Dezember.
»Nein, Nash war da kategorisch. Willst du mit zu uns kommen? Larissa und ich …«
»Nein«, erwidert er, »ich möchte nicht …«
»Du störst nicht, Brian. Es wäre uns eine Freude.«
»Wirklich. Aber trotzdem danke«, sagt er hastig und sucht seine Sachen zusammen, »grüß mir Larissa ganz herzlich, habt ein …«
Er bricht ab. Wer sie kennt, weiß nie, was er ihnen zum neuen Jahr wünschen soll. Seit Mirkos Tod sind erst fünf Jahre vergangen, es ist noch zu früh. Genau deshalb sollte Brian die Einladung annehmen. Doch offenbar will er dem, was ihn bei den beiden daheim erwarten würde, aus dem Weg gehen, weshalb er die Nacht damit zubringen wird, in einem Pub mit dem Barmann anzustoßen.
»Guten Rutsch.«
»Dir auch, Brian.«
Michele geht hinaus, Taxis verstopfen die Straße. Er bückt sich zu einem hinab, das am Bordsteinrand parkt, doch inzwischen wird Nash bereits an der Penn Station sein. Als der Fahrer das Fenster herunterlassen will, winkt Michele ab, schaltet sein Handy wieder ein und macht sich zu Fuß auf den Weg.
»Wie ist es gelaufen?«
»Gut. Jetzt folgt der Empfang.«
»Mit Nash?«
»Nein, nur wir. Ich versuche es kurz zu machen.«
»Grüß mir Brian, frag ihn, ob er zum Abendessen kommen will.«
»Mach ich«, antwortet Michele und biegt in Richtung Bowery ab.
Gleich jenseits der Houston liegt eine Bar, deren schummrige Beleuchtung den Abgrund mancher Tage verschleiert und ihn weniger tief erscheinen lässt.
Mirko, denkt er. Mirko Mirko Mirko Mirko Mirko Mirko Mirko Mirko. Wie ein hohler Kinderreim, der durch ständiges Aufsagen seinen Sinn verliert.
»Mirko«, sagt er laut, als er an der Ampel wartet.
Der Mann vor ihm dreht sich um, Michele sieht ihn an, er tritt zur Seite.
Mirko Mirko Mirko Mirko. Unmöglich, diesen Namen zu entleeren. Ihn zu einem Geräusch werden zu lassen, das weniger taub macht, zu einer Last, die sich für einen kurzen Moment ein Stückchen anheben lässt.
Dabei hat er den Namen nie gemocht. Für Michele hatte er schon immer nach Schausteller geklungen, doch Larissa mit ihren slawischen Wurzeln und ihrer Schwäche für den Schriftsteller Mirko Kovač hatte die Namensgebung des Sohnes zur Bedingung gemacht, ihm nach Amerika zu folgen.
Obwohl Michele befürchtete, die Schwangerschaft habe seine Frau geistig umnebelt, hatte er ohne weitere Diskussionen zugestimmt: Die ihm angebotene Stelle war eine einmalige Chance, und vielleicht hätte Larissa die Sache bis dahin vergessen.
Hatte sie nicht. In der stürmischen Frühlingsnacht des 26. März 1974 hatte sie die Hebamme um 23:11 Uhr mit einer Nachricht für den Ehemann in den Wartesaal geschickt: »Mirko«.
Und getreu seinem Namen wuchs Mirko mit einem Zigeunergesicht heran.
Lockiges, rabenschwarzes Haar, wie es Michele als Kind gehabt hatte, große Augen, die glänzten, als stünden sie stets voller Wasser, schmale Lippen, hohle Wangen und einen von Natur aus athletischen Körper, der ihm gegen seinen Willen stets einen Platz in der Basketball-Schulmannschaft einbrachte. Denn Mirko war anders als seine Schulkameraden. Das war schon in der Mittelstufe so gewesen. Seine Freunde waren entweder gesunde, lärmende Sportskanonen oder das Gegenteil: Kleine Gelehrte, die sich in der Stadtbibliothek vergruben, um eifrig an ihrer Zukunft zu tüfteln. Zu seinem elften Geburtstag hatte Mirko sich eine Konzertkarte für Roger Waters in der Radio City Music Hall schenken lassen und angefangen, über Charles Lyell zu forschen. Damals war seine Leidenschaft für Geologie erwacht. Aufgeregt kam er zu seinen Eltern gerannt und schlug ihnen Sätze um die Ohren wie »Die Erde ist kein traumatisierter Planet!«, die Michele und Larissa sprachlos machten.
Eine frühreife und heftige Leidenschaft, die dem Zureden des Vaters widerstand: »Princeton, Mirko, dort lehrt Nash.«
Doch für Nash, Wirtschaft und eine gesicherte Zukunft hatte Mirko nichts übrig. Und trotz der Weltwirtschaftskrise schrieb er sich 1991 für Geologie ein.
Die Bar ist voll.
Wäre es ein anderer Abend, würde Michele sie nicht betreten, doch er braucht jetzt Erholung, und heute Nacht ist es ohnehin überall dasselbe. Also kann er sich ebenso gut dort an den Tresen klemmen und bei null anfangen. Keine halben Sachen: Direkt zum Lagavulin. Larissa wird sauer sein, doch dann wird sie sich wie jeden Abend neben ihn aufs Sofa setzen, ihm die Füße unter die Schenkel schieben und ein Buch lesen.
»Mr Torre«, grüßt ihn der Barmann.
Ein raffinierter Junge, der seine Vorlieben sofort durchschaut hat. Er hat ihm den Ardbeg empfohlen, und dienstagabends, wenn der Laden leer und der Manager nicht da ist, schaut Michele immer vorbei, um ein Schwätzchen zu halten und heimlich ein paar überaus teure Single Malts zu kosten.
»Womit fangen wir an?«
»Lagavulin bitte, Francisco.«
»Sie bleiben nur kurz?«
Franciscos Bewegungen sind gekonnt und präzise, fast tänzerisch. Er sieht Michele gerade lang genug an, um ihm zu verstehen zu geben, dass er seine besondere Aufmerksamkeit hat.
»Meine Frau erwartet mich.«
»Es ist Silvester«, bestätigt der Junge.
Francisco hat keine Ahnung, obwohl Michele seit fünf Jahren jede Woche hierherkommt.
Francisco kippt die bernsteinfarbene Flasche, gießt den Whisky ein und fügt einen einzigen Eiswürfel hinzu, damit sich das Bouquet entfalten kann.
»Enjoy.«
Michele ist noch nicht einmal auf der Hälfte, als der Lärmpegel steigt. Eine Gruppe Frauen ist hereingekommen und steht im Eingang. Sie maunzen, krähen, schnattern, wiehern. Michele dreht sich um: hohe Absätze, nackte Schenkel. Es sieht eher nach einem bewaffneten Überfall als nach einem Mädelsabend aus.
»Alles Gute«, sagt er, als er sich wieder umdreht.
Francisco lächelt, hält ein Glas ins Gegenlicht und greift nach einem Geschirrtuch.
»Weißt du, was mein Sohn mir gesagt hat, als er elf Jahre alt war? Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Gegenwart.«
Ein unmerkliches Seitwärtszucken des Kopfes, das Geschirrtuch bewegt sich weiter am Glasrand entlang. »Kluges Kerlchen.«
»Ja«, sagt Michele und steht auf.
»Ist irgendwas nicht in …?«
»Alles bestens«, unterbricht Michele ihn, »aber heute Abend ist mir hier zu viel Rummel. Wir sehen uns nächste Woche.«
Francisco nickt, und Michele schlüpft mit schwerfälligen Bewegungen, die ihm jetzt richtig in den Knochen sitzen, in seinen Mantel.
»Guten Rutsch, Mr Torre.«
Michele hebt grüßend die Hand, drängt sich durch das Grüppchen Vierzigjähriger und tritt in die kalte Luft hinaus.
»Caterina hat angerufen.«
»Schon wieder?«
»Sie hat nach dir gefragt.«
»Was wollte sie?«
Larissa stochert mit der Gabel in ihrem Stück Gužvara herum: Sie hat sie auch dieses Jahr gebacken, weil sie weiß, wie gern ihr Mann sie isst. Doch Michele hat nur wenig davon probiert, von den zwei Fingerbreit Whisky auf leeren Magen ist ihm übel. »Man soll nie aus Traurigkeit trinken«, hatte ihm Francisco vor einer Weile gesagt und auf einen Mann gedeutet, der zusammengesunken über dem Tresen hing. »Der Alkohol wird böse.«
»Reden.«
»Und sie wollte mit mir reden?«
Larissa steht abrupt auf, das Tellerchen in der Hand, die Gabel fällt zu Boden. Michele will sich danach bücken, doch sie geht hastig in die Hocke und hebt sie auf.
»Geht es ihr gut?«, fragt er.
»Nein«, entgegnet seine Frau und verschwindet in der Küche.
Der Abend ist ruhig. Die Nachbarn von oben sind wohl mit den Kindern ausgegangen, das Hin-und-her-Getrappel über ihren Köpfen ist nicht zu hören. Manchmal ist Michele davon so genervt, dass er sich zusammenreißen muss, um nicht nach oben zu gehen und sich zu beschweren, doch heute Abend bräuchte es den Radau: Es ist zu still. Vielleicht hat es auch etwas mit dem Wissen zu tun, dass Caterina angerufen hat und Larissa bei dem Telefonat allein war. Was haben sie einander gesagt? Bei diesen Anrufen verkriecht sich Larissa immer in ihrem Zimmer und kommt erst nach einer ganzen Weile wieder heraus, wenn sie sich ganz sicher ist, dass man ihrem Gesicht nichts mehr ansieht. Deshalb wird Michele so wütend: Mach das mit dir allein aus, würde er Caterina am liebsten sagen, lass uns in Ruhe. Doch das kann er nicht. Einmal ist es ihm herausgerutscht, und Larissa hatte zwei Tage lang nicht mit ihm geredet.
»Ist dir eigentlich klar, was du da gesagt hast?«, hatte sie ihn gefragt, als sie sich wieder eingekriegt hatte.
Nein, das war Michele nicht klar. Er versuchte nur, sie vor dieser Extraportion Schmerz zu bewahren, die Caterina jedes Mal, wenn sie sich meldete, bei ihr ablud, und deshalb verstand er beim besten Willen nicht, was an dem, was er gesagt hatte, so abwegig sein sollte.
»Sie war seine Frau.«
Ja, hatte Michele zugegeben. Irgendwann war Mirko nicht mehr nur sein Sohn gewesen. Er war der Mann einer Frau geworden, ehe er sie alle alleingelassen hatte.
Es war einfach so passiert.
Silvester vor fünf Jahren, Michele und Larissa machten Ferien in Genua, das reservierte Abendessen in Camogli, nur für sie zwei, die Verabredung zum Neujahrsmittagessen mit Mirko und Caterina am nächsten Tag.
An dem Nachmittag hatte Mirko früh Schluss, und sie wollten kurz bei ihm vorbeischauen, doch er hatte nicht aufgemacht. Das Auto parkte im Hof, im Schlafzimmer brannte Licht. Sie hatten geklingelt, ihn auf dem Handy angerufen: Vielleicht fühlte er sich nicht gut, also hatten sie ihren Ersatzschlüssel geholt.
Mirko lag auf dem Bett, die leeren Schlaftablettenschachteln standen gut sichtbar auf dem Nachttisch, damit sie sofort Bescheid wussten und sich keine Vorwürfe machten.
Er hatte sie alle auf einmal genommen.
2.
Larissa rutscht unruhig auf dem Sofa herum, ab und zu starrt sie ins Leere, Michele streichelt ihren Fuß, die Spannung ist vorüber, jetzt will er sich entschuldigen, doch sie kommt ihm zuvor: »Caterina hat einen Brief gefunden.«
»Was für einen Brief?«
»Vom Jugendgericht in Turin. Offenbar hat eine Frau über einen Anwalt geschrieben wegen …«
»Was?«
Larissa zieht ihre Füße unter Micheles Schenkeln hervor. »Einer Vaterschaftsanerkennung.«
Michele starrt sie entgeistert an.
»An Mirko.«
Ein paar Tage später wird Michele beim Gedanken an diesen erklärenden Zusatz fast lachen. An Mirko. Nur für den Fall, dass das nicht klar sein sollte. Doch in diesem Moment folgt ein verdattertes Innehalten, der Augenblick, den es braucht, um eine unverständliche Information – einen Hinweis in einer fremden Sprache – zu erfassen. Dann steht Michele auf, stößt gegen den Couchtisch, blickt sich um und befühlt seine Taschen.
»Sie schläft bestimmt, in Italien ist es halb vier in der Früh.«
»Na und?«
»Michele.« Larissa legt ihm eine Hand auf den Arm. »Lass. Wir rufen sie morgen an.«
Michele hört sie nicht, suchend blickt er sich nach dem Telefon um und schiebt ihre Hand fort.
»Michele.«
Er geht in die Küche, kehrt ins Wohnzimmer zurück.
»Michele.«
Larissa stellt sich ihm in den Weg, greift wieder nach seinem Arm, drückt ihn fest und zwingt Michele, sie wahrzunehmen: »Beruhige dich.«
»Setzen wir uns«, sagt sie und zieht ihn zum Sofa, während er noch immer suchend umherblickt. »Hörst du mir zu?«
Michele schaut sie mit einem Ausdruck an, der sagt, du vergeudest meine Zeit. Das musst du dir abgewöhnen, mahnt ihn Larissa inzwischen häufig, du siehst aus wie ein verblödeter Greis.
»Hörst du mir zu?«
Die grünen Augen seiner Frau taxieren ihn.
»Was hat sie dir gesagt?«
»Dass der Brief an Mirko adressiert war und dass eine Frau, deren Namen ich vergessen habe, ihm eine Vaterschaftsklage anhängen wollte. Das ist acht Jahre her.«
»Acht Jahre? Und welche Frau?«
»Ich sage doch, ich weiß es nicht mehr.«
»Hättest du dir das nicht aufschreiben können?«
Michele ist laut geworden, Larissas Augen werden schmal. »Das ist nicht der Punkt.«
»Und was ist der Punkt?«
Seine Stimme poltert, die Brust zieht sich zusammen, Hitze wallt auf, ein Schwindel. Während Michele noch versucht zu begreifen, was zum Teufel seine Frau ihm sagen will, reagiert sein Körper bereits.
»Hör auf zu schreien.«
Michele holt schnaubend Atem, wie ein Pferd, das die Luft durch die verschwitzten Nüstern zieht.
»Morgen lassen wir es uns noch einmal erzählen. Caterina kennt sie nicht, verstehst du?« Larissa beugt sich vor, um ihm in die Augen zu sehen. »Sie hat keine Ahnung, wer die Frau ist.«
»Wundert dich das?«
Gütiger Himmel, denkt Michele.
»Es könnte ein Irrtum sein. Oder …«
»Betrug?«
»Auch.«
Larissa löst ihren Blick, und ein schmerzhafter Stich durchfährt Micheles Brust. Er nimmt ihre Hand und streichelt ihr flüchtig über die Fingerknöchel. »Weißt du, ob Mirko Geld hatte?«
»Es kann tausend Gründe dafür geben, dass …«
Michele hört ihr nicht mehr zu. Er stiert blind vor sich hin, mechanisch fährt sein Daumen über die spröde Haut seiner Frau.
»Hat sie noch etwas gefunden?«
»Nein. Sie meint, sie hätte überall nachgesehen, doch da ist nur dieser Brief. Sie wollte ein paar Sachen von Mirko wegräumen, und da …«
»Hat sie dir gesagt, woher er kommt?«
»Courmayeur.«
Er sieht sie an. »Courmayeur?«
Die Spieltheorie ist eine mathematische Wissenschaft, die sich mit unterschiedlichen Konfliktsituationen befasst und anhand von Modellen wettbewerbsfähige und kooperative Lösungskonzepte erforscht. Sie analysiert die individuellen Entscheidungen interagierender gegnerischer Spieler, die, einem Rückwirkungsmechanismus folgend, einen Einfluss auf die Ergebnisse des oder der Konkurrenten nehmen können (also die Fähigkeit eines dynamischen Systems, die eigenen Ergebnisse zu nutzen, um sich zu verändern), um dem Spieler zu maximalem Gewinn zu verhelfen.
Die Ersten, die über die Spieltheorie geschrieben haben, waren der Mathematiker John von Neumann und der Wirtschaftswissenschaftler Oskar Morgenstern, die in ihrem 1944 verfassten Buch Theory of Games and Economic Behaviour das menschliche Verhalten in interaktiven, mit der Sicherung oder Aufteilung von Ressourcen befassten Situationen mathematisch zu beschreiben versucht haben.
Bis John Forbes Nash kam.
Das Nash-Gleichgewicht ist eine Kombination von Strategien, in der jeder Spieler in einem nichtkooperativen Kontext (wenn man agiert, ohne sich vorher abzusprechen) die bestmögliche Entscheidung umsetzt – seinen strategischen Schachzug –, um den eigenen Vorteil hinsichtlich des gegnerischen Verhaltens zu maximieren. Somit stellt jeder Spieler Hypothesen zur Entscheidung des anderen an und richtet seine Strategie danach aus.
Allerdings ist nicht gesagt, dass das Nash-Gleichgewicht für alle die bestmögliche Lösung bedeutet; die Spieler könnten ihren Gewinn ebenso gut steigern, indem sie ihre Strategien gemeinsam ändern und sich gemeinsam vom Gleichgewicht entfernen. Eine solche Situation ist denkbar, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Spieler miteinander in Kooperation treten.
Und das Leben ist, wie man weiß, ein nichtkooperatives Spiel.
Die Milch im Topf fängt an zu zischen. Michele sieht zu, wie die Oberfläche sich wölbt, eine Blase wirft und langsam am Topfrand emporsteigt. Kurz bevor sie sich über die Flamme ergießt, dreht er das Gas ab. Larissa ist gerade ins Bett gegangen, und er sollte keine Milch trinken. Er verträgt sie nicht und kauft sie nur für seine Frau, die jeden Abend ein Glas davon trinkt. Doch ihm ist gerade danach. Vielleicht wird die Laktose durch das Kochen zerstört – völlig unsinnig; als würde man behaupten, dass der Zucker aus den Bananen verschwindet, wenn man sie zerdrückt.
Wenn Mirko nachts nicht schlafen konnte, hatte er ihm immer heiße Milch gemacht. Und das oft – allzu oft für ein Kind. Sie hörten ihn nicht immer. Manchmal, wenn sie mitten in der Nacht aufstanden, um aufs Klo zu gehen, saß er wach im Wohnzimmer vor dem stumm gestellten Fernseher, das Gesicht vom kalten Flackern der Trickfilme beleuchtet.
»Ich mache dir eine Milch mit Honig«, sagte Michele dann.
Sie half nichts, ebenso wenig wie der Gang zum Kinderarzt. »Das geht vorüber«, hatte der gesagt.
Mirko hüpfte vom Sofa und folgte ihm in die Küche, sie knipsten die Beleuchtung der Dunstabzugshaube an und bewegten sich leise.
»Wieso schläfst du nicht?«, fragte er ihn.
Sein Sohn blickte ihn an, als hätte er wissen wollen, wieso Äpfel von Bäumen fallen, und zuckte die Achseln, die Hände um die Milchschale gelegt.
Er sieht sie genau vor sich, diese Hände: zuerst klein und kindlich, dann größer und kräftiger.
Mirko hatte sich von ihm Milch mit Honig machen lassen, bis er fünfzehn war. Es war für sie beide zu einer Art nächtlichem Ritual geworden, häufig hatte sich Michele sogar extra den Wecker gestellt, und fast immer war Mirko auf gewesen. Als er klein war, hatte er vor dem Fernseher gesessen; später dann hatte er mit Kopfhörern auf seinem Bett gehockt und mit dem Kopf im Takt gewippt. Er blieb in seinem Zimmer, um an Gott weiß was zu denken. Doch er hatte nichts dagegen, dass sein Vater hereinkam und ihm eine Tasse heiße Milch anbot. Er wirkte fast erleichtert.
Michele hatte aufgehört zu fragen, ob er schlecht geträumt habe, und abgewartet, dass Mirko etwas sagte. Doch sein Sohn setzte sich mit einem »Ich weiß nicht« an den Tisch, damit sein Vater sich seiner annehmen konnte.
Michele hatte das nie als einen Akt des Mitgefühls empfunden. Für ihn war es das, wonach es aussah: Ein Vater, der sich um seinen Sohn kümmert. Erst später hatte er begriffen, dass es genau umgekehrt war.
Michele war schon immer überzeugt gewesen, dass sein Sohn Caterina aus Mitgefühl geheiratet hatte. Instinktiv dreht er sich zur Küchentür um, als könnte dieser Gedanke Larissa wecken. Schon immer hatte er das gedacht: Dass Caterina Mirko nicht das Wasser reichen konnte und er sie nur geheiratet hatte, weil dieses Mädchen ohne ihn nichts wert gewesen wäre.
»Schwiegermuttergedanken«, hatte Larissa zu ihm gesagt.
Weitherzig und doch im Inneren verschlossen; hätte Mirko sich bloß geöffnet, hätte er bloß versucht, ihm zu sagen, was ihm durch den Kopf ging, wäre es nicht passiert.
Ja, sagt er sich noch einmal und leert den heißen Milchtopf, diesen väterlichen Anspruch hat er: Wenn sein Sohn sich ihm anvertraut hätte, hätte er sich niemals umgebracht.
Es ist nur Blütenhonig da, dieses speisüße Zeug, das er nicht ausstehen kann. Der Kastanienhonig ist alle, sie haben vergessen, auf dem Chelsea Market neuen zu kaufen, und bei Agata & Valentina gibt es keinen. Dann eben nicht, er trinkt sowieso höchstens die Hälfte, falls er nicht schon vorher Bauchweh bekommt. Eigentlich geht es ihm nur darum, die heiß werdende Milch zu riechen, den Honig, der sich darin auflöst. Ein echter Kindheitsgeruch. So stark und eindeutig, dass Larissa ihn nicht mehr erträgt.
Ihm dagegen verschafft er die Illusion, es sei eine jener längst vergangenen Nächte, Mirko ist gerade auf dem Klo, während die Milch warm wird. »Lass sie nicht kochen«, hatte er immer gesagt. Michele starrt auf die geronnene Milchhaut, die am Topf kleben bleibt und über der Tasse schlabbert. »Wie eklig!«, hätte sein kleiner Sohn gerufen.
»Wie eklig«, sagt Michele, während er den Topf in die Spüle stellt und die Milchhaut schlaff in das Abflusssieb klatscht.
Der Tag zieht auf. Er hatte gar nicht gemerkt, wie spät es geworden war. Zum Glück haben sie heute nichts vor, und Larissa kann ausschlafen. Er hat versprochen, mit dem Anruf bei Caterina auf sie zu warten, also bleibt Michele wie erstarrt am Fenster stehen und blickt hinaus. Auf der Straße geht jemand mit einem Hund vorbei: unförmige Mütze, Jogginganzug, schwer zu sagen, ob Mann oder Frau. Auf die Vorhersage, die Larissa früher an jedem Neujahrstag machte, könnte er keine Antwort geben: Sieht man einen Mann, bringt es Glück; sieht man eine Frau, Pech. Larissa achtet nicht mehr darauf. Und fast hat es etwas Komisches, dass sich diese Person, die jetzt mit ihrem Hund um die Ecke biegt, beim besten Willen nicht definieren lässt.
Ein neues Jahr, denkt er und pustet auf die Milch. Die Flasche Sekt, gekauft in einem unbesonnenen Moment in dem Irrglauben, sie könnten sie öffnen, ist im Kühlschrank geblieben. Wenn Michele an diesem Morgen hinuntergeht, um bei dem heute hoffentlich geöffneten Deli auf der Sechsten die Zeitung zu kaufen, wird er sie dem Doorman schenken.
Sämtliche Regeln zu kennen und sich über die Folgen jedes einzelnen Zuges bewusst zu sein ist für das Modell der Spieltheorie unerlässlich. Der Spielzug oder die Gesamtheit aller Spielzüge nennt sich Strategie. Entsprechend der von allen Mitspielern angewandten Strategien erhält jeder eine Auszahlung beziehungsweise einen Pay-off, der positiv, negativ oder gleich null sein kann. Das Nash-Gleichgewicht ist ein stabiles Gleichgewicht, weil jeder Spieler nach der Umsetzung seiner Strategien die eigene Entscheidung unter Berücksichtigung des gegnerischen Zuges bestätigt und kein Spieler sein Ergebnis durch die ausschließliche Änderung der eigenen Strategie verbessern kann: Jedwede strategische Variation würde seine Position nur verschlechtern.
Das Nash-Gleichgewicht stellt das optimale Gleichgewicht eines nichtkooperativen Spiels dar, weshalb es auch als nichtkooperatives Gleichgewicht bekannt ist. Es ergibt sich nicht aus dem Einvernehmen der Mitspieler, sondern aus der allseitigen Anwendung dominanter Strategien, die sowohl das bestmögliche Resultat für jeden, als auch das bestmögliche kollektive Gleichgewicht garantieren.
Für Nash ist es also möglich, dass die Entscheidungen der Spieler einen Vorteil für alle darstellen beziehungsweise den Nachteil auf ein Minimum reduzieren.
1. Unerlässliche Voraussetzung ist, dass alle die Spielregeln kennen.
2. Kein Spieler kann das eigene Ergebnis dadurch verbessern, dass er nur seine Strategie ändert: Jede strategische Variation würde seine Position nur verschlechtern.
3. Das Nash-Gleichgewicht ist auch als nichtkooperatives Gleichgewicht bekannt.
4. Laut Nash ist es möglich, dass die Entscheidungen der Spieler den Nachteil auf ein Minimum reduzieren.
Seit zwanzig Minuten hat Michele Lust auf einen Kaffee, doch er hat sich noch immer nicht entschließen können aufzustehen. Er glaubte, sich durch Arbeit ablenken zu können, normalerweise funktioniert das. Die Vorlesungen vorbereiten, ein paar Gedanken für das Seminar zu Papier bringen, einen Artikel fertig schreiben. Stattdessen hat er angefangen, unzusammenhängende Sätze zu unterstreichen, sinnlose Gliederungen aufzustellen. Er sollte schlafen. Sich mit einer Wolldecke über den Beinen aufs Sofa legen, um Larissa nicht zu wecken, und versuchen, sich wenigstens für ein paar Stunden auszuruhen. Stattdessen tanzen ihm die vier Punkte, die er unterstrichen hat, verschwommen vor den Augen.
1. Alle müssen die Spielregeln kennen.
So war es nicht. Larissa und ihm sind sie nicht mitgeteilt worden. Es war von vornherein ein unfaires, falsches Spiel.
2. Jede strategische Abweichung würde seine Position nur verschlechtern.
Die einzige Strategie, die er hatte umsetzen können, war das Überleben und, soweit es ihm möglich war, Larissa zu schützen. Jedoch nachdem er bei der wichtigsten Aufgabe versagt hatte. Als der Umfang seiner Intervention lächerlich geworden war, ganz gleich wie seine strategische Variation ausgesehen hätte.
3. Das Nash-Gleichgewicht ist auch als nichtkooperatives Gleichgewicht bekannt.
Gar kein Gleichgewicht. Mirko hat sich umgebracht, und sosehr sich Larissa und er auch bemühen, fürs Überleben zu kooperieren, werden sie auch weiterhin scheitern.
4. Laut Nash ist es möglich, dass die Entscheidungen der Spieler den Nachteil auf ein Minimum reduzieren.
Ein abgrundtiefer Nachteil, denkt Michele, bodenlos. Die Entscheidung des wichtigsten Spielers hat sie in ein chaotisches, undurchschaubares System katapultiert, in dem Regeln gelten, die weder er noch Larissa kannten. Die Spielfiguren sind am Leben geblieben: Die, die nichts wert sind, die, die nur Feld für Feld vorrücken und gemäß den Schachregeln extrem angreifbar sind, sobald sie isoliert stehen, weil man sie nicht verteidigen kann.
Michele steht auf und öffnet den Küchenschrank mit dem Kaffee.
Die in die Spüle gegossene Mich hat eine schlierige Pfütze um den Ausguss gebildet, die, wenn man sie trocknen lässt, zu einer dünnen gelblichen Kruste auf dem glänzenden Edelstahl gerinnt.
»Hast du ein bisschen geschlafen?«
»Ich kann mich später ausruhen. Ich mache dir einen Kaffee.«
Larissa setzt sich, ihre Finger streichen das Haar im Nacken glatt.
»Hast du gearbeitet?«
Michele nimmt die Kekse, den Zucker, sucht die Lieblingstasse seiner Frau, die sie vor vielen Jahren in Venedig gekauft haben. Sie ist ganz angeschlagen, aber sie mag sie noch immer.
»Nein.«
Auch wenn die vier Punkte, die er unterstrichen hat, auf dem Computerbildschirm leuchten. Kaum hatte er Larissa an der Schlafzimmertür gehört, hat er die Seite, auf der er gerade unterwegs war, geschlossen.
Unglaublich, was man online alles findet. Sogar eine internationale Seite von Anwälten, denen man jede erdenkliche Frage stellen kann – er hat sich ein paar ganz unglaubliche durchgelesen – und die einen gratis und in Echtzeit beraten. Der Anwalt, den er gefunden hat, kennt sich mit dem italienischen Rechtssystem aus.
Weiß die Person, die rechtliche Schritte einleiten wollte (die Mutter des Kindes, richtig?, die, wie ich annehme, ein Verhältnis mit Ihrem Sohn hatte), dass Ihr Sohn verstorben ist?
Michele:
Das weiß ich nicht.
Was die Einzelheiten betrifft, müsste ich noch einmal das italienische Zivilgesetzbuch konsultieren, doch die Klage kann auch gegen die Erben vorgebracht werden, und wenn die Klägerin (die Mutter des Kindes), wie ich annehme, über den Tod Ihres Sohnes im Bilde ist, ergeben sich drei Möglichkeiten: 1) sie hat geklagt, als Ihr Sohn noch am Leben war, und wir sind über den Ausgang der Klage nicht im Bilde; 2) aus irgendeinem Grund hat sie die Sache seinerzeit fallen lassen – eine außergerichtliche Einigung mit Ihrem Sohn? Andere Gründe? 3) sie hat mindestens drei Jahre abgewartet, die Klage im Jahr 2009 oder später erneuert, und nachdem sie vom Tod Ihres Sohnes erfahren hat, wurde sie darüber ins Bild gesetzt, dass sie Ihre Schwiegertochter und eventuelle Kinder verklagen kann. In dem Fall hätte Ihre Schwiegertochter die Aufforderung erhalten, sich an einen Anwalt zu wenden und eine Verteidigung vorzubereiten, und hätte als Erbin Ihres Sohnes eine Einlassungserklärung abgeben müssen. Es kann allerdings auch sein, dass die Klägerin zu warten beschlossen hat und diesem Brief noch nichts gefolgt ist.
Michele:
Wieso warten? Worauf?
Kommt darauf an. Die Klägerin könnte beschlossen haben, die Volljährigkeit des Kindes abzuwarten, oder gewisse Umstände haben sie 2006 zu dem Schluss kommen lassen, dass es besser ist, nicht weiterzumachen, oder es war ihr nicht möglich. Es kann viele Gründe geben. Entscheidend ist, dass der Tod Ihres Sohnes leider keinen Hinderungsgrund für das Verfahren darstellt, sollte die Frau irgendwann beschließen, die Klage erneut zu erheben, und dass sie sich ebenso an die Erben Ihres Sohnes richten kann. Sollte es dazu kommen, könnte das Gericht sogar eine Exhumierung des Leichnams zum Zweck eines DNA-Tests veranlassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Haben Sie weitere Fragen?
Micheles Kehle ist wie ausgetrocknet, die Zunge verklebt. Wohl zum hundertsten Mal fährt er sich damit über die papiertrockenen Lippen. Er nimmt sich ein Glas, trinkt.
»Geht es dir gut?«
»Lass uns Caterina anrufen.«
Larissa steht auf und geht das Telefon holen. Michele legt die Fingerspitzen an die hämmernden Schläfen, ihm droht der Schädel zu platzen.
Exhumierung des Leichnams.
Das Echo der Worte pulsiert vor seinen Augen. Sie sind absurd. Alles ist absurd. Der Brief, der Anwalt, das hier. War alles Bisherige nicht schon grausam genug?
»Michele.«
Larissa hält ihm das Telefon mit Caterinas Namen auf dem Display hin.
3.
Von Caterina hatte Mirko ihm eines Morgens beim Frühstück erzählt.
Eine Idee seines Sohnes: Mit dem Moped nach Arenzano fahren und Focaccia essen. Seit dem Gymnasium hatten sie das nicht mehr gemacht: Mirko vorn und er hinten.
Michele war überrascht gewesen: »Mal sehen, ob Mama was vorhat.«
»Nur du und ich. Mit der Vespa.«
Micheles erste Reaktion war Scham gewesen. Es war ihm peinlich, nicht mehr zu wissen, wie man auf den Sattel eines Motorrollers steigt. Sich zu fest an die Taille seines Sohnes zu klammern, aus Angst, hinunterzurutschen, sie beide zu Fall zu bringen.
»Ich fahre langsam.«
»Wir haben keinen Helm.«
»Ich hab den alten dabei.«
Ein völlig zerkratzter roter Helm, beklebt mit Stickern aus halb Europa.
»Wir holen uns Focaccia bei Gambino und essen sie am Strand von San Pietro.«
Die von Gambino ist Micheles Lieblingsfocaccia. Sie ist sogar noch besser als die bei Priano. Seit einer Ewigkeit hat er sie nicht mehr gegessen. Seit einer Ewigkeit hat er keine Zeit mehr mit seinem Sohn verbracht.
»Zum Mittagessen sind wir wieder zurück«, hatte Mirko gedrängt.
»Und Mama …«
»Mama lässt du meine Sorge sein.«