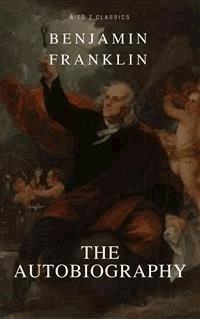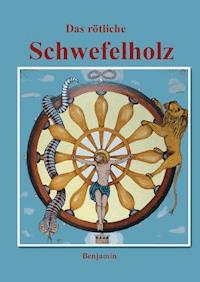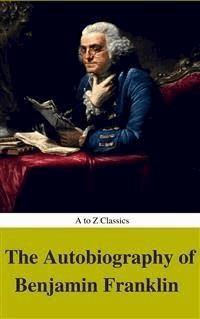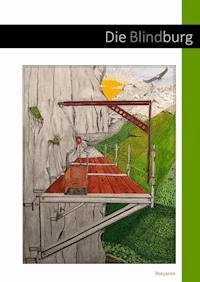
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Fantasieroman zeigt der Autor zwei völlig unterschiedliche Menschen, sowohl im Alter, als auch vom Stand her, der eine ist reich, der andere arm wie eine Kirchenmaus. Als sie sich fanden, ahnten sie noch nicht, dass ihre Vergangenheit eng miteinander verwoben war. Beide haben sie Intelligenz und ein gutes Herz und streben gemeinsam nach oben, so auch nach höherem Wissen. Sie bekämpfen das Böse, das sich im Hochtal festgesetzt hat und sein Unwesen treibt. Sie bauen sich den vorgegebenen Weg und erreichen schließlich den hohen Tempel. Die Güte der beiden unterschiedlichen Freunde lässt den Wohlstand wieder in das verarmte Dorf einfließen. Ein spannender Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ansgard Lerhome
Das Erbe der Väter
Der fehlende Weg
Die Wegbauer
Die Blindburg
Die ersten Tage auf der Burg
Veränderungen
Das Gericht
Die neue Ordnung
Die Erlaubnis für das Betreten des Heiligtums
Die Grablegung
Der Duft des Friedensfürsten
Grünes Gift
Die Kalvarien-Schalen
Das Böse kommt immer von unten
Ansgard Lerhomes Heimkehr
Vorwort
Die Geschichte, die ich nun erzählen will, spielte sich hauptsächlich in unseren Schweizer Bergen ab, weit oben, wo die kräftigen Adler stolz und leise ihre mächtigen Schwingen ausbreiten und ihr Flug beginnt, wo sie ihre Kreise gleitend ziehen und ihr scharfes Auge auf die Erde richten, um ein Beutetier zu erspähen, das geeignet wäre, um es in den Horst zu bringen und damit die ewig hungrigen Schnäbel der Jungen zu stopfen. Doch soll sich nicht nur des Adlers Auge dort oben aufhalten, sondern ich will den Leser gerne mitnehmen in diese karge Welt, wo schroff die scharfen Grate der Felsen dräuen, scheinbar unüberwindbar! Der Wind über die scharfen Kanten der Felsen fegt und sein heulendes Lied singt, und des Adlers Ruf schrill in ihnen verhallt oder allenfalls an ein menschliches Ohr dringt!
Ich will den Leser von Anfang an mitnehmen auf eine wunderbare Reise in eine Geschichte, die man mir glauben mag, oder eben nicht! Wen interessiert das schon?
Benjamin
Ansgard Lerhome
In einer Schweizer Stadt lebte ein Mann alleine in einem schönen Haus am Stadtrand. Das Haus machte einen gepflegten Eindruck, auch der Garten, in dem es stand, wurde sorgfältig unterhalten von einer Hand, die nicht müde wurde, die störenden Unkräuter auszuziehen, dort etwas zu schneiden und da etwas zu richten, um so dem betrachtenden Gartenfreund stille Freude zu bereiten. Auch dem Haus selber sah man an, dass es dem Besitzer nicht egal sei, was für einen Eindruck sein Äusseres auf den Besucher mache, denn es war eindeutig, dass die Handwerker schon oft an diese Adresse gerufen wurden, um dieses Haus immer in einem tadellosen Zustand zu halten.
Der Bewohner dieses Hauses hiess Ansgard Darius Lerhome, ein Mann in den hohen fünfziger Jahren. Er war ein eher ruhiger, angenehmer Mensch mittlerer Grösse mit vollem, dichtem und dunklem Haar, das er kurz geschnitten trug und in dem man die ersten Silberfäden sofort bemerkte, denn die Schläfen leuchteten schon weiss. Seine Statur war mittelgross und kräftig; man sah ihm an, dass er in seinem Leben etwas gearbeitet hatte, denn seine Schultern waren breit und seine Hände eher gross vom Anpacken. Lerhomes Teint war aber eher dunkel, er schaute aus gütigem, blauem Auge auf seine Gesprächspartner und alle Nachbarn waren sich einig; er war ein eher sonderbarer, aber sehr angenehmer Mensch!
Ansgard Lerhome lebte seit dem frühen Tod seiner Frau alleine in dem schönen Haus, auch hatte er es zu etwas gebracht, denn man glaubte, zu wissen, dass er ein vermögender Mann sei, der für manche Witwe eine gute Partie wäre. Deshalb schauten viele Frauen in der Stadt mit freundlichem Gesicht auf ihn und die Gleichaltrigen besuchten dieselben Cafés wie er oder wählten den gleichen Arzt und puderten ihre Altersflecken sorgsam weg. Die Jüngeren erlaubten sich einen Spass mit ihm, den er immer erwiderte und dann sein angenehmes Lachen hören liess, das ihn noch anziehender machte.
Allein mit seinem Namen hatte man seine liebe Mühe, denn niemand wusste etwas Genaues, Lerhome war nicht ein Name, den man im schönen Schweizerland kennt und üblich ist! Ansgard war mit seiner Frau als junges Paar zugezogen, und man munkelte sogar, dass er als armes Verdingkind in eine Schweizer Familie gekommen sei. Wenn er auf solches angesprochen wurde, pflegte er ganz klar zu antworten, dass er Schweizer sei und brach alsbald das Thema ab. Aber einige waren sich nicht sicher, sie fanden seinen Hautteint etwas dunkel und tippten auf eine Heimat etwa in Südamerika oder gar Indien. Darauf angesprochen erklärte er, dass er als Ingenieur in warmen Ländern gearbeitet hätte und dass er vielmals in der Wüste von Saudi Arabien auf Baustellen selber Hand angelegt hätte, auch in Peru sei er am Bau von Wasserkraftwerken beteiligt gewesen und hätte als Vorarbeiter vor Ort seine Pflichten erfüllt!
Wie dem auch sein mag, seine handwerklichen Fähigkeiten hatte er an seinem Haus unter Beweis gestellt, denn ein eher seltener Besucher vermochte zu erzählen, dass es im Hausinnern wirklich schön und genial ausgebaut sei und dass Lerhome meist alles selber mache! Vielfach war er auch wirklich immer noch auf Geschäftsreisen, aber niemand wusste, wohin es ihn gerade verschlagen habe und in welchem Land er Gast gewesen sei. Nun aber gab es immer längere Zeiten, in denen er in seinem Haus weilte, längere Spaziergänge unternahm oder ein Wochenende in die Berge fuhr, um an Wanderungen teilzunehmen. Wenn er im Frühling von solchen Wanderungen wieder nach Hause kam, war seine Haut wieder braungebrannt und man war sich wieder gewiss, dass er ursprünglich aus einem ferneren Lande stamme. Irgendwann tauchte auch das Gerücht auf, seine Frau habe sich früher, als er im Ausland weilte, mit einem anderen Mann vergnügt und sei dann an einer bösen Krankheit gestorben. Aber diese Variante drang nicht bis an sein Ohr, denn das hätte er mit Bestimmtheit zurückgewiesen.
Oft sah man ihn an einem frühen Morgen in einem Caféhaus sitzen mit einem Buch in den Händen. Manchmal kam ein anderer Mann dazu, den man nicht kannte und dann, in solchen Fällen, waren die beiden Männer in ein angeregtes Gespräch verwickelt, das niemand zu stören oder gar zu unterbrechen wagte. Dieser Mann pflegte Ansgard immer mit Meister Lerhome anzusprechen, einige wollten wissen, dass er eigentlich ein Doktor sei, aber in den Telefonbüchern und sonstigen Adressen war das nirgends erwähnt.
An einem schönen Montagmorgen früh, sass Ansgard wieder in seinem Kaffeehaus vor einer duftenden Tasse, dazu ein wohlriechender, frischer Buttergipfel. Vor ihm lagen viele Dokumente, in denen er Notizen anbrachte, einzelne Zeilen strich und neue Sätze hinzuschrieb. Seine Tätigkeit unterbrach er nicht, bis schliesslich um neun Uhr der fremde Mann auftauchte und sich nach kurzer Begrüssung zu ihm hinsetzte. Ansgard steckte seine Schriften weg, unterhielt sich mit dem Mann, holte wieder etwas hervor und gab es ihm, damit er es lese. Danach stöberten beide darin herum unter angeregten Diskussionen. Erst gegen elf Uhr bezahlten die beiden Herren und verliessen das Lokal, draussen umarmten sie sich kurz und trennten sich, jeder ging nun seines Weges. Ansgard trat seinen Heimweg an, machte ein zufriedenes Gesicht, grüsste jeden freundlich, der ihm begegnete und beim Nachbarn blieb er sogar kurz stehen, um ihm einen schönen Tag zu wünschen. Endlich zuhause, sah er schon von weitem einen gelben Zettel an seiner Haustüre kleben; er zog ihn ab und las, was die Botschaft darauf sei. Es war ein Zettel der Post mit der Aufforderung, ein wichtiges Dokument abzuholen, wenn möglich mit einem Ausweis. Gleich am Nachmittag ging er deshalb der Altstadt zu und suchte die Hauptpost auf. Man händigte ihm dort einen eingeschriebenen Brief aus, den er vom Zivilstandsamt bekommen hatte. Er schnitt ihn gleich in der Hauptpost auf, um zu sehen, was man von ihm wolle. Es war eine Aufforderung, umgehend die Amtshäuser aufzusuchen mit sämtlichen Ausweisen, die ihm zur Verfügung standen. Es handle sich um eine Erbschaftssache, die bis zum heutigen Tage ungeklärt geblieben sei.
Wieder zuhause angekommen, öffnete er seinen Sekretär und entnahm ihm ein Bündel Akten, aus denen er nun seine Ausweise herausklaubte. Es war dies ein Pass und ein Schriftenempfangsschein und eine Identitätskarte. Mit diesen Dokumenten in der Tasche machte er sich am nächsten Tag auf und begab sich in die Amtshäuser der Stadt, er eilte nun die breiten Treppenhäuser hinauf, die langen Korridore entlang, bis er schliesslich bei der angegebenen Nummer des zuständigen Büros angekommen war. In dem Büro sassen drei Beamte in ihre Arbeiten vertieft, keiner nahm Notiz von ihm! So trat er an einen der Tische und legte seinen erhaltenen Brief vor.
Der Beamte sah daraufhin auf und nahm den Briefbogen in die Hand, darauf sah er seinem Besucher ins Gesicht und fragte: „Sind sie Herr Lerhome?“
„Ja, natürlich!“, sagte darauf Ansgard. Nun erhob sich der Beamte und trat zu seinen Büromitarbeitern hin und besprach etwas; darauf bat er Ansgard zu einem Besprechungstisch und hiess ihn, er solle doch Platz nehmen. Die anderen zwei Männer kramten in ihren Akten, erhoben sich ebenfalls und kamen mit einem grauen Dossier auch an den Tisch und setzten sich dazu. Der Erste richtete sein Wort an Ansgard und sagte: „Könnten sie sich ausweisen, Herr Lerhome?“
Daraufhin zog Ansgard seine Ausweise aus der Tasche und gab jedem einen. Die Beamten prüften die Papiere und einer stand auf mit seinem Pass und verliess das Büro. Die anderen zwei Beamten klaubten in den Papieren herum, bis der Dritte wieder mit seinem Pass zurückkam. Er bestätigte kurz, dass alles in Ordnung sei, man gab ihm seine Ausweise zurück und er steckte sie wieder ein. Nun erhob endlich einer seine Stimme und sagte: „Herr Lerhome, wir sind seit Längerem mit einer Erbschaftssache beschäftigt, die verschiedene Ämter schon seit Jahren vor sich herschieben, weil man einfach die rechtmässigen Nachkommen nicht finden konnte. Jetzt hat man aber doch eine Spur gefunden und die Sache ist zu uns gekommen. Nach unseren nun schon seit Wochen dauernden Nachforschungen sind wir auf sie gestossen, weil wir glauben, dass sie der einzige Nachfahre unseres Erblassers sind!“
„Da kann ich ihnen leider auch nicht helfen“, sagte darauf Ansgard, „ich bin bei Zieheltern aufgewachsen, die sind aber schon seit Längerem verstorben. Von meinen richtigen Vorfahren habe ich keine Kenntnis, ich weiss nicht einmal, woher sie stammen und ob ich eventuell Geschwister habe oder nicht!“
„Sie wissen also nicht einmal, aus welchem Land sie stammen?“
„Ich bin Schweizer!“, entgegnete Ansgard sofort. „Ja, das sehen wir aus ihrem Pass! Aber hat ihre Ziehmutter nie zu ihnen gesprochen, wer ihre richtigen Eltern waren?“
„Sie wusste es anscheinend auch nicht recht, sie sagte einmal, meine Mutter wäre eine waschechte Schweizerin gewesen, mein Vater aber ein Ausländer, woher er aber stamme, wusste oder sagte sie mir nicht. Meine Zieheltern sind auch früh gestorben und meine diversen eigenen Nachforschungen verliefen ergebnislos!“
„So, so, aha“, brummten da die Beamten und kratzen sich an den Köpfen. „Sie haben also nie etwas herausgefunden?“ „Nein“, sagte erneut Ansgard, „es ist mir auch egal geworden!“
Die Beamten machten nun verschiedene Notizen, dann zog einer seine Lesebrille von der Nase und sagte:„Wir werden nun ihre Angaben zu prüfen haben und der Erbrichter wird einen Entscheid fällen müssen. Wenn nichts anderes herauskommt, werden sie benachrichtigt und sie können ihr Erbe antreten.“
„Wer ist denn überhaupt gestorben und was wird vererbt?“
„Es handelt sich um einen Jacub Lerhome, der in Südamerika verstorben ist und ein beträchtliches Vermögen besass. Was aber das delikate an der Sache ist, ist die Tatsache, dass zu seinem Vermögen auch ein Haus in der Schweiz gehört. Die südamerikanischen Behörden sind auf Grund dieses Hauses an uns gelangt und wir sind, wegen ihres Namens, auf sie gekommen. Nun gehen unsere Vermutungen dahin, dass dieser Jacub Lerhome bei seinem Aufenthalt in der Schweiz mit ihrer Mutter ein Kind gezeugt hat, das dann sie wären. Wir werden nun noch die Daten überprüfen, auch mit den südamerikanischen Behörden, ob sie mit ihrer Geburt und dem Aufenthalt Jacub Lerhomes in der Schweiz übereinstimmen.“
„Wo ist denn dieses Haus und wie sieht das Vermögen aus, das vererbt wird?“ „Das dürfen wir nicht preisgeben, bis das Erbe an sie ausgehändigt wird!“ Man entliess nun Ansgard und versprach, ihm möglichst schnell Bescheid geben zu wollen. Er verliess nun die Amtshäuser mit ganz anderen Gedanken im Kopf als die, mit denen er gekommen war! Würde er nun, mit bald sechzig Jahren, herausfinden, wer sein Vater gewesen sei? Aufgrund dieses Wissens würde man vermutlich auch den Namen der Mutter ermitteln können. Wenn das so wäre, so könnte er sicher eine Familie mütterlicherseits finden, so wäre er nicht mehr alleine in dieser grossen, weiten Welt! Aber, wie würde diese Familie diesen neuen Zuwachs aufnehmen? Wären sie erfreut, einen Sechzigjährigen aufzunehmen? Andererseits ergäbe sich vielleicht einen Erben für sein Vermögen, er würde seinen Erben kennen lernen! Zudem ja auch noch für das neue Erbe, das ja jetzt eventuell ihm zukommt! Ein beträchtliches Vermögen, hatte der Beamte gesagt, was das wohl heissen mag! Für einen armen Schlucker sind tausend Franken schon ein beträchtliches Vermögen, für einen Millionär sicher nicht! Das kann also alles heissen! Aber wie dem auch sein mag, für Ansgard war Geld nie das Wichtigste, es war gut, wenn es ihm nicht mangelte, aber ein Geldmensch war er nie gewesen, er besass zwar ein anständiges Vermögen, aber seine Hand tat sich dem Bedürftigen gerne auf. Es machte ihm immer grosse Freude, jemandem helfen zu dürfen oder einfach so etwas zu geben. In Südamerika hatte er sogar einem Dorf eine Schule gebaut mit schönen Fenstern und einer Klimaanlage; man hatte sie dann eingeweiht und es gab ein grosses Dorffest! Es tat ihm so gut, als er sah, wie alle sich freuten und sich bei ihm bedankten. Aber schon damals sagte er den Menschen, sie sollten sich nicht bei ihm bedanken, sondern bei dem Herrn.
Das Erbe der Väter
Nach diesem eigenartigen Zwischenfall vergingen Wochen, Monate. Ansgard dachte schon nicht mehr an sein Erbe. Anderes war an ihn geraten, er hatte eine scheinbar nette, anständige Frau kennen gelernt, die auch über ein gewisses Niveau zu verfügen schien. Er hatte sich dazu hinreissen lassen, zwei-, dreimal mit ihr auszugehen; er hatte über ein verlängertes Wochenende einen Städteflug nach Prag mit ihr unternommen. Ja, es hatte ihm Spass gemacht, sie hatten anregende Gespräche und er fand, dass die Zeit wie im Flug vergangen sei! Nun sprach Irene, so hiess die Frau, dass sie Schmetterlinge im Magen verspüre und war aufgeregt und immer vergnügt! Aber er spürte die Schmetterlinge nicht und wusste nicht, wie er ihr das sagen sollte. Er hatte ihr von der Begebenheit in den Amtshäusern erzählt und Irene war begeistert, sie wollte schon Pläne schmieden und gab das Geld in ihren Gedanken schon aus. Das neue Haus wollte sie zu einem Ferienhaus machen, sie würde alles nach ihren Plänen und nach ihrem Gutdünken umbauen lassen!
Ansgard musste sie bremsen, er sagte: „Du weisst doch gar nicht, wo das Haus steht! Vielleicht steht es ja in unserer Stadt und ist am Verfallen! Du glaubst doch nicht, dass es in Arosa oder in Sankt Moritz steht? Vielleicht ist es ein Werksgebäude, wo Jacub eine Firma gründen wollte! Ausserdem muss das Haus seit sechzig Jahren unbewohnt sein, sicher ist es eine Ruine! Man weiss nichts, also lass die Pläne, wir wissen ja auch nicht, ob mir das Erbe übergeben wird oder nicht!“
„Ja Ansgard“, sagte darauf Frau Irene, „lass mich doch einfach Pläne schmieden, es ist so schön, auch mir die Zeit mit dir vorzustellen, wir könnten nur noch die Welt geniessen und uns verwöhnen lassen! Deshalb bin ich so aufgeregt! Ich finde nichts so aufregend wie dies!“ Dies hörte Ansgard aber gar nicht gerne, er hatte eigentlich andere Pläne, als mit einer Frau durch die Welt zu ziehen und wenn möglich noch an Partys teilzunehmen. Seine Interessen lagen ganz anders, als sich das Frau Irene vorstellte, aber er mochte ihr das jetzt nicht sagen und so liess er sie gewähren. Ihn nahm vielmehr die Sache mit seinem Herkommen in Bann. Er spürte, dass er seine Herkunft einfach auf die Seite geschoben hatte, weil ihm kein Anhaltspunkt zur Verfügung stand! Seine Stiefmutter war zu früh verstorben, sie hatte ihm nichts erzählt. Vermutlich wollte sie warten und hatte es auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und geplant! Und jetzt, vierzig Jahre später, wurde sein Interesse doch geweckt mit seinem Besuch in den Amtshäusern. Er war der einzige Lerhome in der Schweiz! Der Name seines Vaters Jacub, was war das für ein Name? War das nicht ein jüdischer Name? Lerhome tönte zwar nicht jüdisch, eher amerikanisch oder eben südamerikanisch, aber auch aus einem nördlichen Land könnte er stammen, aber Südamerika war wahrscheinlicher, dies würde seinen eher dunkleren Teint erklären, doch auch die Juden waren zum Teil dunkelhäutige Menschen! Doch mit dem, was er jetzt wusste, war ja noch nichts anzufangen, eigentlich wusste er noch nichts; er musste eben warten. Doch je länger die Zeit verfloss, umso gleichgültiger wurde er wieder dieser Sache gegenüber.
Aber dann nach bald einem halben Jahr fand er wieder eine Aufforderung der Amtshäuser in seinem Briefkasten, er möchte kommen und die Beamten besuchen! Dies scheint zu bedeuten, dass die Ämter weitergekommen waren in ihren Ermittlungen, dass neue Erkenntnisse ihre Arbeit belohnt haben, dachte er! Diese Vermutungen liessen ihn nicht mehr ruhen. Er sagte es auch Irene und sie kam sofort, um dabei sein zu können, sein Inneres erzitterte und machte ihn nervös. Gleich am nächsten Tag machte er sich frei und nahm den Weg in die Amtshäuser unter die Füsse. „Guten Tag, Herr Lerhome!“, wurde er diesmal von den Beamten begrüsst, „man nennt sie ja auch Meister Lerhome, wie sollen wir sie nennen?“
„Das ist mir nun egal“, sagte Ansgard, „man nannte mich im Ausland auf den Baustellen Meister, weil ich die Menschen dort zu führen hatte.“ „Ach so“, sagte der Beamte, „das hat also keinen weiteren Grund?“ „Nein, warum kommen sie darauf?“ „Es gibt Menschen, die nennen sie Meister Lerhome! Das könnte auf Zeiten hinweisen, die wir noch nicht kennen, aber ihre Erklärung ist nachvollziehbar, gehen wir also weiter.“ Alle drei Beamten kramten nun wieder in ihren Akten und zogen dann einige davon heraus und begaben sich an den Besprechungstisch, man lud ihn mit einer Handbewegung ein, er möge sich dazusetzen und Ansgard folgte der Aufforderung. Der erste Sprecher, scheinbar der Bürovorsteher, fing nun an und sprach: „Nun, Meister Lerhome, wir sind in Zusammenarbeit mit den uruguayischen Behörden zu dem Schluss gekommen, dass dieser Jacub Lerhome nicht ihr Vater war, sondern ihr Onkel! ihr Vater war der Bruder des Verstorbenen Jacub und hiess Abraham Lerhome. Schon ihr Grossvater, Moshe Lerhome, war in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Er wurde ein schwerreicher Mann, er vermählte sich mit einer Uruguayerin und betrieb Geschäfte in der ganzen Welt. Am Ende seines Lebens wollte er sich in die Schweiz absetzen, weil er das Schweizerland als ein sicheres Land betrachtete. Er liess sich von uruguayischen Handwerkern eine Klause in den Bergen bauen und wohnte dort die letzten Jahre seines Lebens, umgeben von seinen liebsten und treuesten Bediensteten. Als er starb, wurde das Erbe an die beiden Brüder zu gleichen Teilen übergeben, an Jacub und Abraham Lerhome. Jacub führte die Geschäfte des Vaters weiter. Abraham wollte in die Nähe seines Vaters ziehen und kam ihm nach in die Schweiz. In dieser Zeit lernte er die Schweizerin Constanze Billing kennen, die als deutsches Findelkind in der Schweiz Aufnahme und Zieheltern fand. Schon nach einem halben Jahr ehelichte Lerhome die Schweizerin, weil sie ein Kind erwartete! Abraham Lerhome reiste nach Uruguay zurück, um seine Habe in die Schweiz zu transferieren und seine Abreise zu regeln. In dieser Zeit verstarb der alte Lerhome in seiner Klause und Abraham kehrte nicht zurück! Constanze Lerhome brachte ihr Baby bei Pflegeltern unter und reiste nach Uruguay, um ihren Mann zu suchen, doch auch sie kehrte niemals wieder zurück! Nach zehn Jahren wurden die beiden Verschollenen als verstorben erklärt und ihr Besitz ging als Erbe in Jacubs Hände, weil man in Uruguay nichts von ihnen wusste! Erst jetzt, als auch Jacub verstarb, fand man in seinen Schriften die Briefe ihres Vaters, in denen sie erwähnt sind! So, nun geht also das ganze Erbe der Lerhomes an sie über, denn Jacub Lerhome blieb kinderlos, sie sind der einzige Erbe!“
Ansgard sass da mit gesenktem Haupt, diese Fülle von Nachrichten seines Herkommens erschlug ihn fast! Er hatte nun Namen von Vater und Mutter, er wusste, wer sein Grossvater war! Ansgard blieb sprachlos, da unterbrach der Wortführer die Stille und sagte: „Wollen sie denn gar nicht wissen, wie ihr Erbe aussieht?“
„Ach so, doch natürlich, darauf bin ich noch gar nicht gekommen!“ „Wir haben das Barvermögen in Schweizerfranken umgerechnet, das ergibt einen Betrag von rund siebenundzwanzig Millionen Franken, dazu kommen die Ländereien in Uruguay und das Berghaus in der Schweiz.“
„Mein Gott“, entfuhr es Ansgard. „Ja, Meister Lerhome, sie sind nun ein reicher Mann!“, sagte ein Beamter. Doch Ansgard mochte sich nicht freuen, ihm war die Flut der Neuigkeiten zu viel! Er unterschrieb die Akten, die man ihm vorhielt, wie ein Roboter und kein Lachen wollte aufkommen in seinen Zügen! Viele Angaben musste er nun machen: den Namen seiner Bank, die Kontonummer, wohin man sein Vermögen einbezahlen musste; alles wurde geprüft und festgehalten. Das Haus in der Schweiz war aber irgendwie nicht klar, die Beamten wussten nur, dass es irgendwo im Berner Oberland sein müsse, sie könnten ihm aber keine genauen Angaben machen! Doch hätten sie ihm da eine Adresse der Gemeindeverwaltung von Interlaken, dort wüssten sie Bescheid und würden ihm die Schlüssel aushändigen. Als alles gestempelt und unterschrieben war, machte er sich auf nach Hause, wo ihn Irene erwartete:„Hast du nun geerbt oder war es ein Reinfall?“
„Ja, ja, ich habe geerbt!“, gab er an. „Nun sag doch schon, wie viel?“
„Ich weiss es nicht genau, wegen dem Haus in der Schweiz, man weiss nicht genau, wo es liegt und dann sind es eben noch Ländereien in Uruguay.“
„In Uruguay? Ja und Geld ist keines dabei?“, drängte sie. „Doch, auch Geld ist dabei, viel Geld!“ „Ja nun sag doch endlich, wie viel es ist!“ Irene platzte fast der Kragen. „Ungefähr siebenundzwanzig Millionen.“ Ansgard sagte das wie nebenbei. „siebenundzwanzig Millionen!“, schrie Irene, „Ansgard, wir sind reich!“ sie packte ihn und zog ihn tanzend im Wohnzimmer herum und schrie und lachte in einem, bis Ansgard plötzlich sagte: „Was heisst reich, Irene, ich will gar nicht reich sein!“ „Was soll das heissen, Ansgard?“ Irene hielt inne und schaute ihn betroffen an. „Nun was soll das schon heissen? Ich habe gesagt, dass ich reich sei, aber dass ich es gar nicht möchte! Ich muss erst in Ruhe überlegen, was nun zu tun ist!“ „Ja willst du denn nicht alles mit mir verprassen und verjubeln?“
„Nein Irene, das will ich nun schon gar nicht!“ Irene schaute ihn zuerst verständnislos an, dann eilte sie in den Hausflur, packte ihre Tasche und schmiss die Türe zu und ging aus dem Haus und eilte nun die Strasse entlang, nicht ohne sich hin und wieder umzusehen. Aber Ansgard folgte ihr nicht, er zuckte mit den Schultern und liess sie ziehen! „Frauengeschichten, das hat mir gerade noch gefehlt!“, sagte er vor sich hin und verschloss die Haustüre und ging in die obere Etage, um seinen Rollkoffer hervorzuziehen, den er immer bereithielt, um sofort verreisen zu können; dies war ihm noch geblieben aus seiner Ausland-Tätigkeit her. Er prüfte kurz, ob alles noch vorrätig sei, und zog dann den Reissverschluss zu, schob den Zugbügel hinein und trug das Gepäck hinunter in die Garage. Dann holte er Regenschirm und Brieftasche, packte auch ein paar Papiere ein, die er von den Amtshäusern hatte und fuhr sich mit dem Kamm durch die Haare. Danach ging er wieder in die Garage und lud alles säuberlich ein, öffnete das Tor und fuhr weg. Vor der Haustüre aber sah er Irene stehen! Aber er fuhr weiter, er wollte und brauchte jetzt keine Auseinandersetzungen, sie war ja schliesslich selbst gegangen! Er war nicht der Typ Mann, der einer Frau nachläuft!
Ansgard lenkte seinen Wagen dem Berner Oberland zu; er fuhr über den Brünigpass gegen Interlaken. Unterwegs ging ihm so viel durch den Kopf: War er nun unfair gewesen gegen Irene? Aber die Gier, die in ihrem Gesicht aus ihr herausgeschaut hatte, stiess ihn dermassen ab, dass er selber eigentlich am liebsten davongelaufen wäre; Irene hatte ihm dies eigentlich nur abgenommen!
Als er seinen Wagen in einem Parkhaus in Interlaken abgestellt hatte, trat er wieder auf die Strasse und hielt ein Taxi an. Er liess sich vom Chauffeur zum besten Hotel des Ortes fahren und hiess ihn, er solle auf ihn warten. Im Hotel liess er sich ein schönes Zimmer geben und eine Visitenkarte. Darauf liess er sich direkt zum örtlichen Amtshaus fahren und betrat nun mit gemischten Gefühlen die Stube der Obrigkeit. Man schickte ihn erst von Büro zu Büro, bis er schliesslich bei einer älteren Frau landete, der er nun sein ganzes Anliegen erzählte. Die Frau folgte interessiert seinen Ausführungen und schaute ihn aus dicken Brillengläsern an, die ihre Augen zu verschwindend kleinen, kurzsichtigen Knöpfen machten. Wie er geendet hatte, fragte sie ihn noch mal nach seinem Namen. „Lerhome“, sagte er deutlich, „Ansgard Darius Lerhome!“
„Also L“, sagte die Dame für sich, stand auf und ging auf ein riesiges, blechernes Ungeheuer zu, das viele Zugschubladen in seinem Inneren barg. Dort deutete sie mit ihrem Zeigefinger auf die Aufschrift der Schubladen und flüsterte das ABC leise mit. Beim L hielt sie inne und zog die grosse, schwere Lade auf. „Lanter, Lässer, Lauterbach, Lehmann, Lehner flüsterte sie nun und ihr Zeigfinger glitt über die dünnen und dicken Dossiers. Es ging eine Weile, bis sie endlich fündig wurde und sagte: „Ach ja, da habe ich etwas, Lerhome, tatsächlich! Was ist denn das für ein komischer Name? Sind sie denn nicht Schweizer?“ „Doch, gute Frau, aber meine Vorfahren kamen halt aus Amerika!“ „Ach so, ja dann wollen wir doch einmal sehen.“ sie ging wieder an ihren Platz und sah das dünne Dossier durch. Mit einer Handbewegung lud sie Ansgard ein, auf dem Besucherstuhl bei ihrem Schreibtisch Platz zu nehmen. Sie zog, während sie las, ständig an ihrer Bluse herum, als ob das alte Kleidungsstück sie zwicken würde. Endlich legte sie das Dossier weg und nahm nur ein Blatt, das sie nun näher an ihre Augen hielt. Endlich sagte sie: „Da haben sie aber Glück gehabt, Herr Lerhome, in zwei Monaten wäre das Haus an den Staat übergegangen, weil niemand sich meldete, alle die Jahre!“ Ansgard sagte darauf nichts, er wartete ruhig, bis die Frau gelesen hatte. Dann sagte sie endlich: „Nun, sie können selber sehen, das Haus ist in den Bergen, auf über zweitausend Meter Höhe! Aber es ist unzugänglich. Im Jahre 1932 hat ein Felssturz den Zugang mit ins Tal gerissen, ein neuer Zugang wäre viel zu teuer. Seitdem ist niemand mehr dort gewesen, halt, doch, da im Jahre 1975 ist ein Bergsteiger mit einem Seil von oben herab zugestiegen, er meldete, dass er nicht hinein konnte, denn die Türe sei sehr massiv und die Fenster mit massiven Metall-Läden verriegelt! Aber es sei wunderschön, er hätte niemals etwas Vergleichbares gesehen! Hier liegt ein altes Foto bei, das damals vom Hochtal aus gemacht wurde, aber man kann nicht alles genau erkennen!“ Die Frau schob ihm das genannte Foto hin, er sah darauf ein weit oben in den Felsen eingebettetes, verriegeltes Etwas, das er nicht genau bestimmen konnte. Ein weiteres Blatt, das ihm die Frau hinschob, zeigte ihm den Weg auf, wie er an sein Eigentum kommen würde. In dem Hochtal gab es noch einen kleinen Ort namens Hochauen, von da her gab es keine Strasse mehr, um näher heranzufahren. Die Frau mit der zwickenden Bluse fragte ihn nun noch, ob er sein Erbe anzunehmen gedenke. Er antwortete auf diese Frage: „Natürlich, gute Frau, dies muss ein Haus meines Grossvaters sein, natürlich nehme ich es in meinen Besitz!“ „Aber ich mache sie darauf aufmerksam, dass sie nicht bloss Rechte, sondern auch Pflichten übernehmen! Der Zugang zum Haus ist, wie gesagt, abgestürzt und die Kosten werden als zu gross erachtet, um einen Nutzen sinnvoll zu machen! Wenn nun aus irgendeinem Grund Gefahr von der Liegenschaft droht, seien es jetzt Abstürze oder Ähnliches, so wird man sie dafür belangen!“ „Ist gut, ich bin mir nun meiner Pflichten bewusst“, sagte Ansgard. Die Frau schob ihm nun noch ein Formular hin, damit er es unterschreibe. Als Ansgard seine Unterschrift darunter gesetzt hatte, nahm die Frau es zurück und liess es wieder im Dossier verschwinden. „Gut“, sagte sie darauf und legte das vergilbte Mäppchen auf die Seite ihres Schreibtisches, „Sie können ihre Unterlagen und die Hausschlüssel innert nützlicher Frist abholen, geben sie mir noch ihre Anschrift, damit ich sie anrufen kann, wenn alles erledigt ist!“
„Können sie mir denn das nicht jetzt gleich geben? Ich bin doch von auswärts und wohne hier in einem Hotel!“, sagte Ansgard enttäuscht. „Nein, das kann ich nicht“, sagte die Frau, „das muss ihnen ein Notar aushändigen, das muss seine Ordnung haben!“ „Aber können sie meine Anliegen nicht etwas vorziehen?“ „Doch, ich werde mich bemühen“, versprach die Frau und zog wieder an ihrer Bluse, dieses mal aber am Rücken! Ansgard nannte ihr nun sein Hotel und die Zimmernummer; er gab ihr auch seine Karte mit einem kleinen Geldschein dazu und verliess das Amtsgebäude. Die Frau erhob sich darauf und bedankte sich überschwänglich, nun schien sie sogar der Büstenhalter zu zwicken, aber ihr Gesicht blieb freundlich!
Er schlenderte nun zum Bahnhof und schaute dort auf eine Karte, die er in einem Schaukasten fand und suchte dort nach Hochauen. Dies musste aber ein sehr kleiner Ort sein, denn er fand es erst nach einigem Suchen. Nach dem Plan musste dies ein Ort mit vielleicht zwanzig Häusern und einem kleinen Kirchlein sein. Er machte sich einige Notizen und drehte sich dann um, um ins Hotel zurückzugehen und das Abendessen einzunehmen. Er ging wieder am Taxistand vorbei und sah seinen Chauffeur wieder, der ihn vorher gefahren hatte. Er sprach ihn an und bestellte ihn auf morgen früh um halb Acht, dass er ihn nach Hochauen fahre. Der Mann zeigte seine Freude, indem er versprach, pünktlich da zu sein. Den Rest des Nachmittags beschäftigte er sich damit, hohe, stabile Bergschuhe und Wanderkleider einzukaufen, auch ein Rucksack gehörte dazu, damit er für die Bergwelt ausgerüstet sei. In einem Optikerladen kaufte er einen guten Feldstecher und eine dunkle Sonnenbrille. Er trug dann alles in das Hotel und begab sich zum Abendessen. Danach langweilte er sich und trank an der Bar noch einen Whisky und legte sich dann zu Bett. Aber er konnte lange nicht einschlafen, denn all die Begebenheiten schienen ihm unglaublich! Warum und wofür hatte sein scheinbar reicher Grossvater dieses Haus dort oben in die Berge bauen lassen? Waren sein Vater und sein Onkel auch dort oben oder kannten sie das Felsenhaus überhaupt nicht? War dieses Haus für seinen Grossvater eine Art Versteck oder ein Rückzugsort? Hatte er gar etwas auf dem Kerbholz und wollte sich verstecken? Auf jeden Fall würde er in dem Haus sicher Unterlagen oder Botschaften finden, wenn so lange Zeit niemand mehr seinen Fuss hineingesetzt hat. Ansgard war sich nun sicher, dass er diesen Geheimnissen seiner Familie nun bald auf die Spur kommen würde und fiel schliesslich doch in einen tiefen Schlaf, aus dem ihn erst das Telefon des Portiers riss, mit der Meldung, dass nun halb sieben sei! Er sprach sein Morgengebet und ging anschliessend ins Badezimmer. Dann zog er seine neuen Bergkleider und die Wanderschuhe an, bepackte seinen Rucksack und begab sich zum Morgenmahl. Der Taxichauffeur kam pünktlich und Ansgard nahm neben dem Chauffeur Platz. Die Fahrt war ziemlich lange und holprig. Als sich der Morgennebel verzogen hatte, sahen die beiden die Bergwelt aufglühen; je höher sie kamen, desto klarer wurde die Sicht! Der Chauffeur gab zu, dass er noch nie hier hinaufgekommen sei, er hätte das Nest auch zuerst auf der Karte suchen müssen! Das Auto zog eine Staubwolke hinter sich nach, denn sie fuhren auf einer ausgefahrenen Naturstrasse. Nach anderthalb Stunden schliesslich passierten sie eine heruntergekommene Ortstafel, auf der sie den gewünschten Ortsnamen Hochauen lasen. Ansgard war erfreut ob dem Anblick, denn der Ort war eingebettet in einem grünen Hochtal und es blühten rundherum bunte Fettwiesen, umrandet von Bäumen wie Tannen und Kiefern. Etwas weiter oben sah man bereits die Baumgrenze, dort wuchsen nur noch ein paar wilde Wettertannen mit schrägem Wuchs. Die Fettwiesen wurden getränkt von vielen kleinen Bergbächen, die lustig und verspielt dem tiefer gelegenen See zueilten. Im Hochtal aber fanden sie einander und wurden zu einem stattlichen Bergbach, der wohl bei Gewittern gefährlich anschwellen konnte. Als sie nach der Tafel um die nächste Kurve kamen, sahen sie zuerst erhöht auf einer Kuppe die kleine Kapelle hoch über den Häusern, ihren Mahnfinger gegen den Himmel reckend. Sie sah aus wie ein Mahnmal für die sündigen Menschen, die ihr unterstanden. Die Häuser waren klein und gedrungen, die Fundamente waren aus Steinen gebaut. Die erhöhten Zimmer waren alle aus Holz in massivem Blockhaus-Stil gezimmert. Kleine Fenster lugten aus den runden Balken; es sah aus, als kniffen die Häuser die Äugelein zu, als Ansgard mit seinem Chauffeur in den Ort einfuhr! Der Wagen fuhr auf den grossen Platz mitten im Ort, den ein mächtiger Dorfbrunnen zierte, der aus einer anderen Welt zu stammen schien, denn auf der Brunnensäule stand ein grosser Engel, der mit einer Feder etwas in ein Buch eintrug, dort hielt er an. Ansgard bezahlte seine Rechnung und fragte den Chauffeur, ob er ihn hier am Abend wieder abholen würde. Natürlich war der gute Mann gern bereit, die Fahrt zu wiederholen, denn es war ihm auch nicht entgangen, dass sein Fahrgast den Preis grosszügig aufgerundet hatte! Nun stieg er aus und der Wagen wendete und war bald seinen Augen entschwunden. Allein auf dem Dorfplatz schaute er sich um, an was und wie er sich irgendwie orientieren könnte. Er ging etwas im Dorf herum. Ganz hinten im Dorf sah er wieder den Kapellenturm. Er ging und schaute die Kapelle an. Es war eine alte, schöne Kapelle, aber verwittert und vernachlässigt. Die Türe war mit eisernen Ketten und einem Vorhängeschloss gesichert, das verrostet und schon lange nicht mehr gebraucht schien. Alles machte auf ihn zuerst den Eindruck einer heilen Bergwelt, die sein Städterherz nun in tiefen Zügen in sich einsog. Er ging weiter und es fiel ihm auf, dass keine Blumen auf den Fensterbrettern standen, dass es keine schönen Vorgärtchen gab, die bunt blühten, sondern es waren höchstens Nutzgärten mit Blumenkohl und Salaten! Die Menschen, die er sah, machten ihm einen verbitterten Eindruck, nur in einem Hinterhof lachte eine Gruppe Kinder bei einem Spiel! Andere Kinder sah er in einem Schuppen arbeiten, wieder andere spielten ein ruhiges Spiel! Nach kurzer Zeit ging eine Haustüre auf und es trat eine ältere Bäuerin auf den Dorfplatz, als er wieder zurückgekommen war. Ansgard sprach die Frau höflich an: „Guten Tag, liebe Frau, darf ich sie etwas fragen?“ „Ja bitte“, entgegnete die Frau, nicht mürrisch, aber auch nicht unbedingt freundlich. „Ich habe hier in den Bergen etwas zu tun, kann man hier im Dorf ein Zimmer mieten?“
„Ja natürlich, wir haben ein Gasthaus hier; dort sind zwei Zimmer, die man mieten kann! Aber sie sind nicht billig!“ Ansgard erkundigte sich nun, wo denn das Gasthaus sei. Da wies die Frau auf eines der grösseren Häuser und sagte: „Dort, es ist ja angeschrieben!“ Erst jetzt sah Ansgard, dass das Haus wirklich mit verwitterter Schrift über der Türe angeschrieben war. Er dankte nun der Frau wieder höflich, worauf sie ihren Weg fortsetzte. Ansgard trat nun näher und las über der Türe:
(Zum Goldenen Engel)
Er ging zum Eingang und drückte auf die Klinke; es war offen und er trat in die Gaststube ein. Ein junges Mädchen war gerade damit beschäftigt, die Stühle von den Tischen zu nehmen, nachdem sie wohl den rohen Holzboden gescheuert hatte. Ansgard wollte sofort die Türe wieder leise schliessen, denn er sah, dass noch nicht geöffnet war! Da sprach das Mädchen freundlich: „Chömid nume iche!“ Also stiess er die Türe vollends auf und betrat die Gaststube etwas unsicher. „Hockid nech, woder weit!“, sagte das Mädchen freundlich und Ansgard setzte sich an einen der vielen, groben Holztische. Das Mädchen beendete erst ihre Arbeit und kam dann an seinen Tisch, um ihn nach seinem Begehr zu fragen. „Bringen sie mir bitte einen heissen Kaffee und ein Brötchen.“ Das Mädchen ging, um das gewünschte zu holen. Ansgard sah sich in der Gaststube um, es war alles aus Holz gemacht und sah recht heimelig aus. An der Wand über ihm tickte bedächtig eine alte Wanduhr, deren gemütliches Pendel den Takt des Lebens hier oben wohl langsamer angab. Gegenüber der Uhr war ein Hirschkopf mit gewaltigem Geweih, der aus der Holzwand zu schauen schien; einst eine Trophäe eines einheimischen Jägers! Ob der Jäger wohl noch lebt? Oder schaut sein Kopf auch irgendwo aus einer Wand? Dies ging ihm durch den Kopf sowie ein „armer Kerl“ ging über seinen Mund aus seinem Herzen. An einer anderen Wand hing eine grosse Fotografie von Zürich, mit dem See und dem Limmatausfluss mit den Brücken und dem Bellevue, dem Bürkliplatz und dem Grossmünster. Daneben hingen Bilder mit Fotografien von Vorfahren, vermutlich Ahnen der Wirtsleute. Die einfachen Holztische und Stühle waren sauber und dick lackiert, im Hintergrund neben der Küchentüre machte sich ein mächtiger Kachelofen breit, an seiner rechten Seite zwängte sich ein „Cheuschtli“ bis zur Ecke. Vor dem Kachelofen auf seiner Länge war eine starke Holzbank angebracht, auf die sich nun grad eine ältere Frau setzte, die aus der Küche kam. Beim Sich-Setzen entfuhr ihr ein Seufzer, dann kramte sie in einem Korb und entnahm ihm frische Wäsche, die noch zu flicken war. Sie setzte sich eine halbe Lesebrille auf und steckte nun den Faden durch das Nadelöhr. Inzwischen war der Kaffee fertig und das Mädchen brachte ihn mit einem frischen Brötchen. Wortlos setzte sie das Tablett vor seine Nase und verschwand in der Küche, um sogleich wieder zu kommen mit einem neuen Tablett, reichlich beladen mit Milch, Kaffee und Brot sowie frischer Butter, Konfitüre und anderes. Sie stellte das auf einen der Tische und brachte nun noch Geschirr. Sie deckte den Tisch sorgfältig mit Servietten und allem, was für einen Morgentisch notwendig ist. Ansgard wagte, das Mädchen anzusprechen und fragte: „Fräulein, haben sie ein Zimmer frei im Haus, für vermutlich längere Zeit?“ Das Mädchen drehte sich wortlos von ihm ab und sagte freundlich in die Ofenecke: „Muetter, ä Hotelgascht, chum einisch!“ Die ältere Frau erhob sich und kam zu Ansgard an den Tisch: „Dir wöischid?“ Ansgard wiederholte seine Frage und die Frau, anscheinend die Wirtin, setzte sich nieder. Ja, sie hätten Zimmer im ersten Stock, sagte die Mutter des Mädchens, es sei per Zufall gerade eines frei geworden, aber sie seien nicht billig! Ansgard erkundigte sich darauf, was denn das Zimmer kosten soll. Die Wirtin nannte den Preis und Ansgard nickte mit dem Kopf und sagte, dass er einverstanden sei, denn es war für ihn eher günstig. Nun fragte die Wirtin, ob er denn eine oder zwei Nächte bleiben wolle. Als Ansgard erklärte, dass er noch nicht wisse, wie lange er in den Bergen aufgehalten würde, es könne sein, dass er ein halbes Jahr bis ein Jahr hier wohnen würde, zog die Wirtin ihre Augenbrauen hoch und ein nettes Lächeln erschien auf ihrem verhärmten Gesicht. Sie drehte sich um und rief in die Küche: „Meitschi, mach ume gäng di schöni Chammere parat!“ Aber Ansgard sagte: „Das pressiert nicht, gute Frau, denn ich gehe am Abend nach Interlaken ins Hotel und komme erst Morgen!“ In der Zwischenzeit ging die Türe auf und ein grosser, klotziger Mann mit verbranntem Gesicht und wirrem Bart erschien in der Gaststube, er brummte etwas und riss einen Stuhl unter dem Tisch hervor und liess sich darauf fallen. Er nahm einen der Teller und füllte ihn ab dem Tablett. Die Wirtin stand auf; sie versprach, dass auf Morgen das Zimmer parat sei und ging nun auch an den Tisch.„Hesch Hunger, Vatter?“ Doch der grobe Mann sagte nichts und schlang alles in sich hinein, dann nahm er zwei Servietten und reinigte Mund und Hände, zerknüllte sie und warf sie zurück auf das Tablett in den Brotkorb auf das noch frische Brot, das für die Frauen war. Das Mädchen kam und nahm das Tablett wieder mit und brachte es gesäubert wieder. Nun setzten sich die Mutter und das Mädchen an den Tisch und assen. Der Mann stand auf und leerte seine Kaffeetasse, warf sie in den Spültrog und nahm ein Bierglas und füllte es am Zapfhahn. Er schüttete das Bier in einem Zug hinunter und füllte es erneut, dann setzte er sich wieder und rülpste gemächlich. Die Wirtin schien jetzt dem grobschlächtigen Mann zu erzählen, dass Ansgard vorhabe, für länger ein Zimmer zu mieten, gerade zum gesagten Preis! Nun drehte sich der Grobe um und sah sich den einzigen Gast an, anscheinend war er der Wirt und Bauer. Er fragte etwas zurück zu seiner Frau und erhob sich dann und kam auf Ansgard zu: „Was weiter hie i üsne Bärge?“ Auch die Wirtin war inzwischen aufgestanden und kam nun an Ansgards Tisch. „Ich suche ein Haus, das hier oben in die Felsen gebaut sein soll! Ich wollte sie gerade Fragen, ob sie mir den Weg weisen können, dass ich nicht so lange suchen muss!“ „Hier gibt’s kein Haus ausserhalb des Dorfes, ausser Heugaden!“, sagte der Wirt barsch und klopfte dazu mit seiner derben Faust auf den Holztisch.
„Doch, die Blindburg!“, rief das junge Mädchen hinter dem Schanktisch hervor und legte aber sofort ihre Hand über den Mund. „Wotsch ächt dis Schandmul zue ha?“, donnerte sie der Wirt an und die Mutter bekreuzigte sich dreimal. „Was meint sie mit der Blindburg?“, fragte Ansgard nach. „Nichts, sie fantasiert, das hat sie oft, hier gibt es kein Haus in den Felsen!“ Er klopfte ein letztes Mal auf den Tisch, dass Ansgards Tasse aufsprang, drehte sich um und verliess die Gaststube. Scheue Blicke erhielt Ansgard nun seitens der Tochter sowie von der Mutter, man sah ihn ängstlich und bewundernd an. Er trank nun seinen Kaffee fertig und rief dann, dass er bezahlen möchte. Es kamen Mutter und Tochter zusammen an den Tisch, das Mädchen mit der Geldbörse, die Mutter nannte ihm den Preis. Als Ansgard grosszügig bezahlt hatte, fragte die Mutter: „Ja, wann kommen sie denn jetzt morgen und beziehen das Zimmer?“ „Nun, wenn es hier weit und breit kein Haus in den Bergen gibt, suche ich hier ja am falschen Ort! So muss ich in anderen Gegenden suchen gehen, tut mir leid!“ „Es hat aber ein Haus, weit oben, die Blindburg!“, sagte das junge Mädchen und die Alte faltete ihre Hände. „Warum sagen sie die Blindburg?“ „Weil es eine Burg ist, die ihre Fenster fest verschlossen hat mit dicken Holzbohlen oder Metall. So sieht es aus, wie wenn die Burg aus blinden Augen schauen würde! Ich selber war einmal auf der Gämsweid und habe es durch Vaters Feldstecher gesehen!“ „Das ist wahrscheinlich mein Haus! Wie lange geht man dorthin?“ „Vielleicht fast eine Stunde, Herr, aber man kann nicht hingehen, denn der Weg ist abgestürzt, schon vor vielen Jahren!“ „Ja“, sagte nun Ansgard, „das ist mein Haus, ich bin richtig! Kann mich jemand dort hinaufführen?“ „Nei, um Gotts Wilche, nei!“, stöhnte die Wirtin und bekreuzigte sich wieder, „was weit ihr i dem Tüfelshus?“ „Ich habe es geerbt!“, sagte Ansgard. „Das ist doch kein Teufelshaus!“ „Dir chöit nit dört ueche, dir bringit ds Uglück ids Dorf!“
„Können sie mich dahin bringen, noch heute Morgen?“, fragte er das Mädchen, aber die Alte umarmte ihre Tochter und fing an zu weinen. „Ums tuusigs Gott wilche, nei!“, klagte sie erbärmlich und schnäuzte sich. Nach einer Weile sagte das Mädchen: „Ich werde ihnen jemanden bringen, der sie hinführt!“ sie löste sich von der Alten und verschwand durch die Küche. Die Mutter stand ganz sprachlos da mit verweinten Augen. „Setzen sie sich hin und erzählen sie mir, was sie so ängstigt an dem Fels-Haus!“ Die Alte schnäuzte sich wieder und begann dann endlich zu erzählen:
„Vor vielen Jahrzehnten kam ein reicher Fürst aus einem fremden Land hierher. Er suchte nach einer Stelle in den Bergen, aber was er gesucht hat, weiss niemand so recht, aber hier scheint er das richtige gefunden zu haben, denn er liess viele Menschen aus dem fremden Land kommen, lauter Männer mit dunkelbrauner Haut und pechschwarzen Haaren! Der Grossvater meinte, dass dies alles Teufel gewesen seien, denn niemand sonst könne so etwas bauen! Sie hätten auch Zauberwerkzeuge gehabt, wie sie sonst niemand gesehen hätte. Diese Menschen hätten einen langen Weg in den Fels gehauen und dann die Burg gebaut. Unsere Leute vom Dorf durften aber nicht mehr hinauf, sonst habe sie ein Teufel ins Tobel gestossen!
Aber der Grossvater hat mit dem Fürsten Geschäfte gemacht. Er hat ihm mit seinem Fuhrwerk Esswaren und Wein geliefert, dann hat er ihm auch diese Alp hier verkauft. Durch diese Geschäfte ist der Grossvater reich geworden und konnte diese Wirtschaft bauen!“ „Das ist doch aber nichts Ungewöhnliches, ich verstehe ihren Schrecken nicht!“
„Ja, plötzlich sind andere Männer gekommen und der Fürst musste weg; er nahm alle seine Teufel mit. Da wollte der Grossvater mit seinem Knecht, dem Chüene Hänsi, die Burg ansehen. Er ging mit ihm hinauf und als sie mit dem Ochsenkarren über den Steinweg nach oben fuhren, donnerte es in den Bergen und eine Steinlawine fegte den Weg mit dem Grossvater und dem Hänsi weg ins Tal hinunter. Später wollten zwei Bergsteiger in die Burg; auch sie sind zu Tode gekommen. Auch der Deutsche, der vor zwei Jahren gekommen ist und in die Burg wollte, ward nie mehr wiedergesehen, dabei wollte er mich mitnehmen nach Deutschland; er versprach mir ein besseres Leben, aber er kam nie mehr!“ sie nahm ihre beiden Hände vor ihr Gesicht und weinte hinein. „Ums tuusigs Gotts Wilche, hebid d’Finger vo dem Hus, ihr chömid susch nüme ufe Wäg!“ Jetzt kam die Tochter wieder zurück; sie brachte einen jungen Burschen mit sich und stellte ihn vor Ansgard: „Das isch ume dä Findel Christeli, er zeiget’nech, wo’d Blindburg tronet!“ Der Christeli war ein scheuer junger Mann, etwa neunzehn Jahre alt und mager von Gestalt, seine Hände waren gross und voll von Schwielen, die von harter Arbeit zeugten. Er wusste nicht, wohin mit seinen grossen Händen, so steckte er sie einfach in seine Hosentaschen und starrte vor sich auf den Boden. „Du bist also der Christeli, warst du denn schon mal auf der Blindburg oben?“
„Nei um Gotts Wilche“, sagte der Junge, „ich war nur schon auf der Gämsweid und habe die Burg von dort gesehen, zu der Burg kann man nicht, es kommt niemand hin!“
„Nun gut“, sagte Ansgard, „aber du bist bereit, mir die Felsenburg zu zeigen und mich auf diese Gämsweid zu führen?“
„Ja, Herr“, sagte Christeli, „ich führe sie wirklich gern dort hin!“ „Also, so wollen wir keine Zeit verlieren, Frau Wirtin, packen sie uns Esswaren und etwas zu trinken für zwei Personen ein, wir treffen uns in einer halben Stunde hier. Sie Fräulein, zeigen mir nun mein Zimmer, das ich ab morgen belegen werde, damit ich ablegen kann!“ Ansgard stieg nun mit dem Mädchen ins erste Stockwerk hinauf, hinterher kam die Wirtin. Sie führten ihn in ein reinliches Zimmer, das ganz aus Holz bestand, es hatte ein anständiges Bett und eine Kommode und eine gemütliche Ständerlampe, rot-weiss karierte Vorhänge zierten die kleinen Fenster. Es war alles da, was Ansgard benötigte. Er nahm nun den Schlüssel in Empfang und leerte seinen Rucksack. Er gab ihn der Wirtin, dass sie ihn mit Proviant füllen solle und schickte sie an die Arbeit. Als er mit dem Mädchen alleine war, fragte er sie, wer denn der Findel Christeli sei und was es mit ihm an sich habe. Das Mädchen antwortete scheu: „Ich betrachte ihn als Halbbruder, aber eigentlich ist er der Knecht des Vaters. Er ist als Verdingbub zu uns gekommen und mit mir aufgewachsen, nun betreibt er das Bauerngut meines Vaters, aber er behandelt ihn schlecht!“
„Aha“, sagte Ansgard, „wenn sie mit ihrem Vater Ärger bekommen, sagen sie ihm, dass ich für die Stunden bezahlen werde, die er mit mir unterwegs sei!“
„Ja, Herr“, antwortete das Mädchen sichtbar erleichtert, „ich werde es so sagen!“ Nun schloss Ansgard das Zimmer ab und ging mit ihr in die Wirtsstube hinunter. Der Christeli wartete dort schon auf ihn, die Wirtin hatte den Rucksack bereit und Ansgard warf ihn auf den Rücken. Doch Christeli wollte das nicht, er bestand darauf, dass es an ihm sei, das Gepäck zu tragen! So zogen sie los. Sie gingen noch durch den Rest des kleinen Dorfes und dann stieg ihr Weg steil an. Christeli zog nun aus und Ansgard folgte ihm. Plötzlich hielt ihm sein Führer seinen Stock hin und Ansgard sah ihn fragend an! „Weiter nech nid hebe, ig ziene nech, es geit ume steil obsi!“
„Wie kommst du darauf, wo hast du das gelernt?“, fragte Ansgard und blieb stehen. „Ig füere öppe’ne Tourist id Höger!“ “Ach so“, sagte Ansgard, „was verdienst du denn so im Tag dabei?” „Ig verdiene nüt, dä Wirt verrächnets!“ Ansgard brummte nun etwas und ging weiter hinter Christeli her, dabei bemerkte er, dass der Junge barfuss ging. Sie stiegen nun gut eine Stunde aufwärts durch Gestrüpp und Felsbrocken, die irgendwann einmal abgestürzt sein mochten. ihr Weg war verwachsen, doch Ansgard erkannte, dass man einst mit einem Ochsenkarren hier hinauffahren konnte, man hatte diesen Weg einst ausgeebnet, doch die Jahrzehnte hatten ihn wieder zuwachsen lassen. Auch sah er immer wieder nach oben, ob er sein Erbe ausmachen könne in der Höhe, doch erkannte er nichts, bis Christeli stehen blieb und mit seiner Hand in die Berge zeigte und sagte: „Luegit Herr, da obe heiter d’Blindburg!“ Ansgard richtete sein Auge dem Arm des Burschen nach und blickte nach oben. Da sah er nun die Felsenburg, hoch oben im Gestein eingeklemmt war sie, lang gezogen und trutzig erschien sie dem Betrachter. Nun verstand er auch den Ausdruck „Blindburg“, denn es schien wirklich, als hätte sie die grossen Augen geschlossen. Vorne schienen mächtige Steinsäulen das obere Gestein zu tragen, dahinter blickten die geschlossenen Augen der Burg hervor, als wären sie in einem Verlies eingeschlossen. „Du meine Güte“, entfuhr es Ansgard, „das sieht ja wirklich wie eine Blindburg aus!“ Nun nahm er seinen Feldstecher an die Augen und sah lange hindurch. Die Fenster waren mit dicken Läden verschlossen, die mit einem Metall überzogen schienen. Der Ort, an den die Burg gebaut wurde, mochte einst ein mächtiger Felsvorsprung gewesen sein, der in der Tiefe in eine natürliche Höhle überging, denn der Vorsprung ging noch ein wenig weiter dem Zugangsweg zu, der oberste Teil des Weges mochte natürlich gewesen sein. Erst weiter unten sah Ansgard, dass er künstlich aus dem Berg herausgehauen worden war. Nun folgte er dem Weg herab bis zu der Stelle, da er abgebrochen war. Christeli zeigte auch dort hin und erklärte: „Luegit dört, Herr, dört sind d’Manne achigheit!“ Ansgard sah ein weites Stück, an dem die obere Wölbung noch bestand, aber die Wegfläche war abgestürzt, später führte der Weg dann weiter bis zu ihnen auf die Gämsweid herab.
Inzwischen war es Mittag geworden. Ansgard sagte seinem Führer, er solle den Rucksack auspacken und das Essen herrichten. Er selber konnte sich nicht sattsehen an dem unglaublichen Bau! Es waren noch einmal etwa tausendfünfhundert Meter Weg in diversen Windungen bis zur Burg hinauf, aber etwas über hundert Meter davon waren abgestürzt, schätzte er! Der Weg führte sehr steil empor und am Ende des Weges sah er eine mächtige Türe mit eisernen Beschlägen. Das ganze Gebäude war sehr lang, aber wie tief es in den Fels gebaut worden war, blieb dem Betrachter verborgen. Vorne an der Krete, wo es wieder in den Abgrund ging, war aus Stein eine gewaltige Brüstung gebaut, die mit dicken Steinplatten abgedeckt war. Sie erstreckte sich entlang des Gebäudes und hatte die gleiche Länge. Etwas vorgebaut, darum auch höher als der Rest des Gebäudes, war das Hauptgebäude mit den zwei grossen Fenstern, die mit gewaltigen Läden versehen, eben den Namen Blindburg bei den Dorfbewohnern hervorriefen, weil die zwei vorderen grossen Fenster von weitem wie blinde Augen aussahen. Ansgard fotografierte alles genau und sagte zu Christeli, dass er noch bis zum Abbruch aufsteigen werde, er komme aber gleich zurück. Am Abbruch prüfte er das Gestein und machte auch Nahaufnahmen davon. Er wollte einfach gut dokumentiert heimkehren, damit er zuhause ausdächte, was er als Nächstes tun wolle. Der Fels war hier bergseitig fast bündig abgeschert. Als er sich alles eingeprägt und fotografiert hatte, ging er zur Gämsweid zurück und genoss mit Christeli das Mittagsmahl, das ihnen die Wirtin eingepackt hatte. Sie machten es sich gemütlich im hohen Gras und Ansgard fragte nun seinen Führer einiges über sein Leben: „Christeli“, fragte er, „ich habe gehört, dass man dir Findel Christeli sagt, warum heisst du so hier bei deinen Leuten?“
„Das weiss ich auch nicht genau, man sagte mir, dass man mich eines Morgens als Neugeborenes neben dem Dorfbrunnen gefunden habe, die Wirtin habe mich dann zu sich genommen und gesäugt. Der Wirt habe ihr das erlaubt, aber er habe ihr das Versprechen abgenommen, dass das Kind später alles zurückbezahlen müsse bis auf den letzten Rest!“ „Und, hast du denn einmal eine Abrechnung gesehen, hat man dir deine Schulden gezeigt?“, fragte er weiter. „Nein, natürlich nicht! Ich arbeite einfach, der Wirt zeigt mir doch nichts!“„Du hast eine sehr braune Hautfarbe und dein Haar ist pechschwarz, hast du denn eine Ahnung, wer deine Eltern gewesen sein könnten?“
„Nein, Herr, das weiss ich nicht, ich weiss nur, dass die Wirtin sich sehr für mich eingesetzt hatte, entgegen den Wünschen ihres Mannes.“ „Hast du denn nie versucht, etwas herauszufinden über die Ämter oder so?“ „Nein, Herr, dafür müsste ich doch meinen ursprünglichen Namen wissen, den weiss ich aber nicht und der Wirt würde mich sowieso nicht mit nach Interlaken nehmen, denn ich habe ja das Bauerngut zu bewirtschaften!“ Ansgard räusperte sich und dachte eine Weile nach, dann sagte er weiter: „Nun, Christeli, auch ich war ein Findelkind und nun nehme ich von meinen Vorfahren mein Erbe entgegen, wie du selber siehst!“ „Sie, Herr, sie waren ein Findelkind? Das kann ich ja fast nicht glauben! Ein so feiner Herr ein Findelkind, ja was soll ich denn da jetzt sagen?“ Nun kam Christeli ins Studieren und es entstand eine kleine Pause, Ansgard sah den jungen, hübschen Mann mit den derben Händen an, es kam eine Sympathie in ihm auf, er spürte nun ganz deutlich, dass er Christeli mochte. „Warum bist du denn barfuss hier hinaufgekommen, gehst du gerne so?“ „Ich besitze keine Schuhe, Herr!“ Ansgard schwieg nun eine Weile betroffen, dann sagte er weiter: „Ich werde dir helfen, etwas Licht in deine Vergangenheit zu bringen, ich weiss nun von mir selber, wie das geht. Hast du denn Schulen besucht?“ „Ja, Herr, ich ging acht Jahre in die Volksschule, weil man den Wirt zwang, mich dort hinzuschicken. Darum muss ich jetzt noch lange arbeiten, weil er das Schulgeld für mich bezahlt hatte!“ „Ach so“, sagte Ansgard, „hat er denn gesagt, wie lange du zu arbeiten hättest? Hat er diese Zeit irgendwie begrenzt?“ „Nein, Herr, ich glaube, dass ich immer für ihn arbeiten muss!“ „Nein, Christeli, das ist unmöglich! Wir werden mit ihm sprechen müssen, er muss das vorrechnen können, du bist ihm eigentlich nichts schuldig!“ „Au Herr, das ist keine gute Idee, er wird bitterböse werden!“ „Nun, wir werden sehen, was sich da machen lässt, hast du denn je einen Berufswunsch gehabt?“ „Ich weiss nicht, Herr, ich bin eigentlich ganz zufrieden, ich arbeite alleine, der Wirt interessiert sich nicht, wie und was ich mache, er kommt nur jede Woche einmal, das ist zu ertragen.“ „Was macht er dann, wenn er kommt?“ „Dann schimpft und flucht er und sagt, ich sei ein fauler Hund!“„Unmöglicher Mensch!“, entfuhr es Ansgard. „Sonst wäre ich gerne Mönch geworden oder Theologe, ich hätte gerne studiert!“, sagte Christeli wie für sich selber. „Aber das war schon immer ganz unmöglich!“ „Warum denn?“, fragte Ansgard. „Ja, dann hätte der Wirt ja noch länger für mich bezahlen müssen, wie hätte ich ihm dann das alles zurückgeben können?“ Christeli zog dabei die Schultern hoch und seine Augen blickten traurig zu Boden.Ansgard schaute den jungen Mann an und studierte seine Erscheinung, er war ein hübscher Junge und sehr sympathisch, nur waren seine dunklen Haare ungepflegt und einfach abgeschnitten, wahrscheinlich war er noch nie bei einem Haarschneider und seine Hände sollten dringend gepflegt werden. Die kurze Geschichte, die er jetzt von ihm gehört hatte, erinnerte ihn so an seine eigene, dass Mitleid in seinem Herzen hochkroch und er ihn am liebsten in seine Arme genommen hätte. So fing er wieder an und sagte:„Christeli, was würdest du sagen, wenn wir……!“ Er unterbrach seine Frage selber wieder und besann sich anders. „Was meinen sie, Herr?“ „Ach nichts, ich werde zu einem späteren Zeitpunkt darüber mit dir reden!“ Nun nahm Ansgard einen Schreibblock aus seinem Rucksack und begann mit diversen Aufzeichnungen. Christeli räumte derweil die Essensresten weg und verpackte alles säuberlich wieder. Ansgard rechnete und zeichnete weiter und Christeli schaute ihm geduldig zu. Hin und wieder hielt er seinen Bleistift gegen den Berg und versuchte, einiges zu messen, bis er fragte: „Schau einmal recht hin, Christeli, was meinst du, wie viele Meter Weg sind abgestürzt?“ „Das könnten etwa achtzig Meter sein“, meinte er langsam. „Ja“, sagte Ansgard, „ich bin auf fast hundert Meter gekommen, was meinst du, ist das Gestein dort bröcklig, oder wurde es effektiv von einer Steinlawine hinuntergerissen?“ „Ich bin fast sicher, dass es festes Gestein ist Herr, die dunklen Leute haben gute Arbeit geleistet! Mit Steinschlag muss man in den Bergen rechnen!“ „Ist denn, seit du hier bist, wieder einmal Steinschlag niedergegangen?“ „Nein, Herr, ich mag mich an nichts erinnern.“„Wäre es demnach möglich, dass der Steinschlag damals von Menschen geplant worden ist?“ „Ui Herr, dir chömid aber uf Gedanke, ig wills nid deiche!“ Ansgard schrieb und zeichnete weiter, bis ihn Christeli auf den Abend aufmerksam machte, indem er sagte: „Herr, ig will nit stürme, aber wenn wir bei Tag heimkommen wollen, müssen wir aufbrechen.“ „Ja, du hast Recht“, sagte Ansgard und räumte seine Sachen in den Rucksack, dann standen sie auf und machten sich an den Abstieg. Ansgard ging wortlos hinter Christeli her. Die Eindrücke, die er mitgenommen hatte, beschäftigten ihn. Als sie Hochauen näherkamen, fing es bereits an einzudunkeln. Sie schritten nebeneinander ins Dorf und die Leute blieben stehen, als sie vorübergingen, denn es hatte sich bereits herumgesprochen, dass ein Fremder gekommen sei, der sich für die Blindburg interessiere.
Auf dem Dorfplatz wartete schon der Chauffeur mit dem Wagen. Ansgard gab ihm ein Zeichen, dass er gleich kommen würde und ging in das Gasthaus in sein Zimmer. Er deponierte dort seinen Rucksack und schloss das Zimmer ab. Unten erwartete ihn schon der Wirt: „Dir heit mer dä Bueb vo der Arbet gno!“ „Was kostet sie der Ausfall?“, fragte Ansgard, er ging gar nicht auf ein Gespräch ein, denn er dachte, dass dies nicht gut käme! Er bezahlte dem Wirt den Preis, den er genannt hatte und ging zum Auto hinaus. Der Chauffeur startete gleich und sie fuhren den langen weg nach Interlaken zurück. Im Hotel bezahlte er seinen Chauffeur und bot ihn auf den nächsten Tag wieder auf. Danach ging er noch aus und besorgte sich ein paar wichtige Dinge und begab sich aber gleich wieder zurück ins Hotel. Den ganzen Abend lang brütete er über seinen Aufzeichnungen, zeichnete Möglichkeiten für den Ersatz des fehlenden Weges. Aber bald zerknüllte er eine Zeichnung wieder und machte sich hinter eine neue!
Endlich im Bett aber kam ihm Christeli in den Sinn! Dieser Junge war ihm in der kurzen Zeit, die sie miteinander verbrachten, richtig ans Herz gewachsen! In seinem Innern wusste er, dass etwas mit dem netten Jungen nicht stimmen konnte, dass man ihn regelrecht ausnützen würde, dabei fühlte er, dass sein Schicksal mit seinem eigenen verwoben war, und diesen Gedanken nahm er mit in seinen Schlaf.