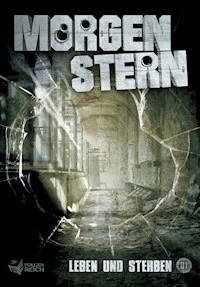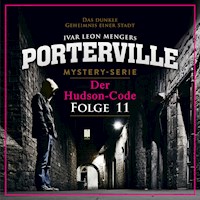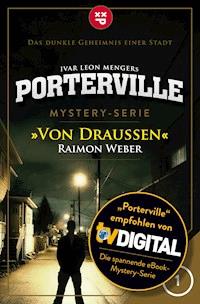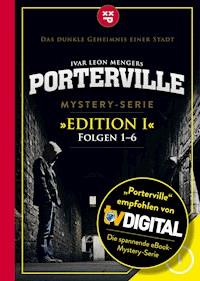3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Potsdam im Dezember 1989. Seit wenigen Tagen ist die Mauer geöffnet. Die Bürger der DDR verlassen ihr Land in Scharen. Inmitten der zerfallenden Strukturen versucht Martin Keil, Hauptmann der Kriminalpolizei, eine Mordermittlung zu leiten: Am Ufer des Potsdamer Jungfernsees wurde die nackte Leiche eines hochrangigen Lokalpolitikers gefunden. Er wurde zusammengeschlagen und erdrosselt. Hilfe erhofft sich Martin Keil von der Gerichtsmedizinerin Anne Rösler, mit der er ein Verhältnis hat. Beide sind in einem staatlichen Heim aufgewachsen. Was Keil nicht weiß: Der Täter hat sich bereits sein nächstes Opfer gesucht. Und es gibt Videoaufnahmen von der Tat. Keil traut seinen Augen kaum, denn er ist sich sicher, den Mörder zu erkennen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Autor
Raimon Weber, geboren 1961, ist Schriftsteller, Hörspielautor und Medientrainer. Er leistet regelmäßig Beiträge zum Krimifestival "Mord am Hellweg". Bei seinen Lesungen trägt der Autor die merkwürdigsten Methoden vor, wie man ums Leben kommen kann und plaudert aus seinem Berufsleben als Autor. Schließlich treibt ihn die Recherche auf hohe Schornsteine und in die geschlossene Forensik oder er lässt sich von Spezialisten vor Ort über die Entsorgung amputierter Gliedmaßen aufklären. Raimon Weber lebt in Kamen.
Das Buch
Thriller
Ullstein
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
April 2019 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019
© Originalausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Umschlaggestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
Autorenfoto: © Ivar Leon Menger
ISBN 978-3-96048-231-4
E-Book-Konvertierung: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Prolog
Er war nackt und stank. Übermäßiges Schwitzen war schon in jungen Jahren ein Problem für ihn gewesen. In der Schule hatte deshalb niemand neben ihm sitzen wollen. Die besonders intensiven Deos aus der BRD, die er in den Intershops kaufte, brachten dann später ein wenig Linderung. Aber gegen seine Todesangst kamen auch sie nicht an. Eine Mixtur aus säuerlich riechendem Schweiß und Urin – er hatte sich vor einer Minute eingenässt – erfüllte das Innere des Wagens.
Er betete. Zum ersten Mal seit über vierzig Jahren. Es waren zusammenhanglose Fragmente, die aus den Tiefen der Erinnerung aufstiegen.
… der Herr lasse Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig …
Gefolgt von dem Bild der Großmutter. Wie sie an seinem Bett saß und ihm aus der Bibel vorlas. Immer nur dann, wenn sie sicher sein konnte, mit ihrem Enkel ganz allein zu sein.
Und wanderte ich auch im finsteren Tal …
Er hatte damals nicht verstanden, wovon die Geschichten handelten. Einige hatten ihm sogar ein wenig Furcht eingeflößt. Aber jetzt hoffte er darin Trost, vielleicht sogar Hilfe zu finden.
Er versuchte die Fesseln von seinen Handgelenken zu streifen, bis ihm dabei eine grelle Lanze aus Schmerz durch den rechten Arm fuhr. So heftig, dass er beinahe erneut das Bewusstsein verlor. Der Schrei wurde von dem Knebel mit dem scharfen Geschmack nach Reinigungsmitteln in seinem Mund erstickt. Fast wäre es ihm gelungen, sich aufzurichten, aber die Bewegung sorgte dafür, dass der Draht an den nackten Fußgelenken noch tiefer ins Fleisch schnitt. Nur die Augenbinde war ein wenig verrutscht. Durch den winzigen Spalt über seinem linken Auge sah er den Nachthimmel, ab und zu unterbrochen vom trüben Licht einer Straßenlaterne.
Der Geruch, diese Mischung aus dem Qualm der filterlosen Zigaretten, von denen er zuletzt so viele geraucht hatte, bis er morgens von langanhaltenden Hustenanfällen geschüttelt wurde, und den Benzindämpfen, die trotz mehrerer Werkstattbesuche einen Weg vom Tank in den Innenraum fanden, machten ihm klar, dass er sich auf der Ladefläche seines eigenen Ladas befand. Hinzu kam das vertraute Knirschen im Getriebe, wenn vom dritten in den zweiten Gang zurückgeschaltet wurde.
Der Kombi fuhr jetzt langsamer, rumpelte durch ein so tiefes Schlagloch, dass die Federung durchschlug, und hielt so abrupt an, dass er mit dem Kopf gegen die Seitenwand stieß.
»Ich bringe dich auf der Stelle um, wenn du versuchst, irgendwelchen Ärger zu machen«, sagte die Gestalt auf dem Fahrersitz mit ihrer rauen, heiseren Stimme, in der mühsam unterdrückte Wut mitschwang. So, als würde sein Entführer es kaum noch erwarten können, ihm weitere, noch schlimmere Schmerzen zuzufügen. Die Erinnerung daran, wie etwas Hartes, Metallisches direkt gegen seinen Kiefer prallte, Ober- und Unterlippe wie überreifes Obst aufplatzten und Zähne wie morscher Gips zersprangen, ließ ihn erzittern und in den Knebel winseln. Gedanken rasten unkontrolliert und panisch durch seinen Verstand.
Bedeutet der Satz, dass ich noch nicht umgebracht werde? Vielleicht sogar mit dem Leben davonkomme, wenn ich mich füge?
Er hörte, wie der Entführer ausstieg und die Heckklappe öffnete. Ehe er auch nur einen Blick auf die Gestalt erhaschen konnte, wurde ihm die Augenbinde zurechtgerückt. Er war wieder vollständig blind.
»Wie du stinkst!«, sagte der Entführer. »Widerlich!«
Mit einem Ruck wurde er an den Schultern aus dem Wagen gezerrt. Er spürte kalten und feuchten Boden unter seinen nackten Füßen. Feiner Regen fiel auf sein Gesicht.
Fast schon sachte wurde er auf dem weichen und völlig durchnässten Untergrund abgelegt. Dass man ihn nicht einfach grob fallengelassen hatte, ließ ihn hoffen, das Schlimmste überstanden zu haben. Er hatte eine Abreibung, sogar eine überaus schlimme, die ihn womöglich auf immer entstellen würde, erhalten, aber damit würde er schon zurechtkommen.
Es war jetzt ganz still. Die Regentropfen fielen senkrecht auf ihn herab. Er wünschte sich so sehr, dass der Entführer, von dem er noch nicht einmal mehr ein Atmen vernahm, ihn hier einfach zurückließ. Er wartete darauf, dass der Motor des Ladas startete und der Entführer mit dem Wagen für immer aus seinem Leben verschwand. Sollte der Kerl den Kombi doch behalten. Das war ein geringer Preis fürs Überleben.
Was dann geschah, dauerte nicht lange.
Sein Kopf wurde an den Haaren nach oben gerissen, und er stellte noch erstaunt fest, mit welcher Lautlosigkeit der Entführer sich bewegen konnte.
»Du hast es gründlich versaut«, sagte die heisere Stimme direkt neben seinem rechten Ohr.
Etwas, das noch kälter war als die eisige Nacht, die ihn umgab, wurde um seinen Hals geschlungen. Er zappelte, ruckte mit dem Kopf hin und her, und es gelang ihm, den Knebel auszuspucken. Aber so sehr er sich auch anstrengte, er brachte dennoch keinen Laut hervor. Schlimmer noch, er bekam keine Luft mehr in die Lunge. Die Welt war plötzlich von einem tosenden Geräusch, dem Rauschen seines Blutes in den Ohren, erfüllt. Sein Bewusstsein schwand, und ehe es vollständig erlosch, fühlte er sich mit einem Mal ganz leicht. Fast schwerelos.
Dann war es vorbei. Bis auf ein paar schwache elektrische Impulse in seinem Hirn, die nach und nach erloschen.
Kapitel 1
21. November 1989
Martin Keil erwachte aus einem Alptraum. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und stellte fest, dass er geweint hatte. Die Erinnerung an den Traum verflüchtigte sich wie feiner Rauch im Wind. Für ein, zwei Sekunden glaubte er den Geruch von Bohnerwachs wahrzunehmen, und er wusste, dass ihn im Schlaf die Erinnerungen an seine Kindheit eingeholt hatten.
Keil drehte ganz langsam den Kopf zur Seite und hörte die Sehnen in seinem Hals knacken. Die schwach grün leuchtenden Zeiger des Weckers standen auf halb sechs. Sein Dienst begann heute erst um acht. Er fühlte sich, als hätte er die Nacht bei schwerer Arbeit in einem Steinbruch verbracht. Dennoch war ihm klar, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Wenn er die Augen schloss, würden die alten Bilder zurückkehren. Wie er im Schlafsaal vor den anderen Jungen stand und sie ihn mit einer Mischung aus Verachtung und Ungeduld anstarrten. Weil er zum wiederholten Male ins Bett gemacht hatte und so lange barfuß auf dem kalten Betonboden ausharren musste, bis das nasse Bettlaken, das ihm die Erzieherin um die Schultern gelegt hatte, halbwegs getrocknet war. Auch die anderen Jungen mussten auf das Frühstück verzichten. Kollektivstrafe. Dafür hatten sie sich jedes Mal an ihm gerächt. Nicht alle, aber die meisten.
Keil schaltete die Nachttischlampe ein, zog den Morgenmantel über und schlurfte zuerst ins Badezimmer. Die verrosteten Leitungen ächzten und gurgelten. Er klatschte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, auf die Unterarme und in den Nacken, in der Hoffnung, anschließend etwas klarer im Kopf zu sein. Er betrachtete sich im Spiegel über dem Waschbecken. Martin Keil war achtunddreißig, und normalerweise wurde er mit seinen schwarzen Haaren, den stechend blauen Augen und der durchtrainierten Statur für jünger gehalten, aber heute sah er blass, rotäugig und so mitgenommen aus, als hätte er mehrere Nächte durchzecht. Mit einem mürrischen Seufzer betastete er sein rechtes Ohr. Ein allmorgendliches Ritual, das er kaum noch wahrnahm. Bei einer Razzia im Frühjahr des Jahres 1980 hatte sich ein Volltrunkener der Festnahme widersetzt und ihm ein Stück des Ohrläppchens abgebissen und verschluckt. Obwohl damals sein Blut auf das Lenkrad des Gefangenentransporters getropft war, hatte Martin Keil darauf bestanden, den Barkas selbst zum Revier zurückzufahren.
Er hockte sich mit einer Tasse Mocca Fix mit extra viel Zucker an den Küchentisch und vervollständigte sein Frühstück mit der ersten Club Filter des Tages. Zu früher Stunde brachte er nie einen Bissen herunter. Vor ihm lag eine Zeitung vom Vortag, die er vom Revier mitgenommen hatte. Er versuchte, die Entwicklungen nach der Maueröffnung genau zu verfolgen, aber am gestrigen Abend war er einfach zu erschöpft gewesen, um auch nur einen Blick in die Zeitung zu werfen.
Die Schlagzeile lautete Volkskammer wählt neue DDR-Regierung. In dem dazugehörigen Bericht las Keil, dass es einen Ausschuss der Volkskammer zur Überprüfung von Fällen des Amtsmissbrauchs, der Korruption und anderer Handlungen mit Verdacht auf Gesetzesverletzungen geben sollte. Allein die Erwähnung, dass es in offiziellen Stellen möglicherweise Korruption gegeben haben könnte, war ungeheuerlich. Noch vor wenigen Wochen wäre eine solche Formulierung absolut undenkbar gewesen. Keil fragte sich, ob die neue Regierung unter Hans Modrow es mit ihren Reformen tatsächlich ernst meinte.
Im selben Artikel wurde auch erwähnt, dass der Generalstaatsanwalt einen Bericht über die Überprüfung der Übergriffe der Sicherheitsorgane auf Demonstranten am 40. Jahrestag der Republik vorgetragen hatte.
Keil hätte zu gern gewusst, ob er dabei die Formulierungen der Parteipresse in den Tagen nach den Ereignissen aufgegriffen hatte. Da war von gezielten Störaktionen die Rede gewesen. Angezettelt von Vorbestraften, Randalierern und westlichen Provokateuren. Er selbst hatte am 7. Oktober am Bassinplatz Position beziehen müssen und eine friedliche Menschenmenge erlebt, die sich mit Sprechchören wie »Wir bleiben hier, verändern wollen wir!« gegenseitig Mut gemacht hatte.
Einen Monat später war die Grenze geöffnet worden, Tausende Bürger waren nach Westberlin geflutet. Das Innenministerium hatte bereits vor Tagen mitgeteilt, dass die neuen Reiseregelungen auch für Angehörige der Volkspolizei gültig waren. Er selbst hatte sich dort noch nicht umgesehen. Zu viel Arbeit. Manchmal kam ihm die Stadt wie ein defekter Dampfkessel vor, der kurz davor stand, in die Luft zu fliegen.
Auf der Titelseite fand er ein Foto der Glienicker Brücke, auf der sich in beiden Fahrtrichtungen Autos aus Ost und West stauten. Allein am letzten Samstag sollten 800 000 DDR-Bürger Westberlin einen Besuch abgestattet haben.
Martin Keil zerdrückte die Zigarettenkippe im Aschenbecher und blickte zu dem Bild an der Wand. Es war der Nachdruck eines Gemäldes und zeigte zwei kleine Jungen, die am Strand miteinander spielten und Sand in eine Gießkanne schütteten. Ihre Gesichter zeigten dabei äußerste Konzentration und eine Ernsthaftigkeit, als ginge es darum, eine Arbeit von allerhöchster Wichtigkeit zu vollenden. Martin Keil hatte den gerahmten Druck gekauft, um der Küche ein wenig Farbe und so etwas wie eine persönliche Note zu verleihen. Seine Freundin Anne hatte nach kurzer Betrachtung bemerkt, die Kinder sähen wie Roboter aus.
Er hatte einfach kein Händchen für solche Dinge, sagte er sich.
Nach zwei weiteren Zigaretten klingelte das Telefon im Flur. Keil hatte den Kollegen vom Revier in der Bauhofstraße gesagt, dass sie ihm bei besonderen Vorkommnissen auch außerhalb seiner Dienstzeit Bescheid geben sollten. Unter allen Umständen wollte er verhindern, dass die ihm unterstellten Polizisten in dieser ungewissen Zeit nachlässig wurden. Erst vor zwei Tagen hatte er einen Wachtmeister streng verwarnen müssen, der angetrunken zum Dienst erschienen war.
Leutnant Harald Gröben war am anderen Ende der Leitung und hielt sich nicht mit langen Vorreden auf. »Wir haben eine männliche Leiche am Jungfernsee. Ecke Weideweg/Bertinistraße. Die Kollegen von der Schutzpolizei sind bereits vor Ort.«
»Verdacht auf Fremdeinwirkung?«, fragte Keil.
»Anzunehmen.« Gröben hustete kurz und heiser. »Was die durchgegeben haben, hört sich, sagen wir mal ungewöhnlich an.«
»Ich mache mich sofort auf den Weg.«
*
Keil stieg aus seinem Wartburg und hielt sein Gesicht in den Nieselregen. Die feinen Tropfen fühlten sich sehr kalt an. Nur ein, zwei Grad niedrigere Lufttemperatur würde sie in Eis verwandeln.
Am Straßenrand standen drei weitere Fahrzeuge: ein Barkas von der SMH, der Schnellen Medizinischen Hilfe, Leutnant Gröbens grauer Wartburg und ein Streifenwagen. Das Signallicht auf dem Dach blinkte unentwegt blau-weiß, blau-weiß …
Im Fahrzeug der SMH konnte er im Schein der Armaturenbeleuchtung zwei Männer ausmachen. Sie rauchten beide. Wenn der Gefundene tot war, wurden sie hier nicht mehr gebraucht, aber sie nutzten die Gelegenheit für eine Pause mit anschließendem Nickerchen. Beim Vorübergehen klopfte Keil gegen die Seitenscheibe. »Morgen, Jungs!«
Die beiden Männer zuckten zusammen, und der Fahrer kurbelte eilig das Seitenfenster herunter. »Wir konnten nichts mehr machen!«, rief er. »Mehr tot geht gar nicht. Sie werden es ja sehen.«
Ein weiteres Fahrzeug, ein Kombi der Spurensicherung, hielt hinter Keils Wagen. Drei Männer stiegen aus, murmelten einen Gruß in Keils Richtung. Mit lautem Getöse, als müssten sie so die Wichtigkeit ihrer Arbeit hervorheben, luden sie ihr Material aus.
Die Leiche befand sich etwa zwanzig Meter weiter im Gebüsch vor der Hinterlandmauer, die das Ufer des Jungfernsees vor unerlaubten Grenzüberschreitungen sichern sollte. Dort tanzten die Lichtkegel von zwei Taschenlampen über den Boden. Keil ging langsam näher. Eine Gestalt, die er zuvor nicht bemerkt hatte, löste sich aus dem Dunkel. »Genosse Hauptmann«, sagte eine jungenhafte Stimme. »Der Tatort wurde umgehend gesichert.«
Keil erkannte einen jungen Uniformierten, der erst vor kurzer Zeit den Dienst in der Bauhofstraße angetreten hatte. Den Kopf vermutlich noch voll von Studienfächern wie Marxismus-Leninismus, Sozialistisches Recht und Polizeitaktik. Sein Arbeitsalltag prallte jetzt mit einer sich beinahe täglich verändernden Realität zusammen, auf die ihn seine ideologisch geprägte Ausbildung nicht vorbereitet hatte. Soweit es möglich war, achtete Keil darauf, dass die Neulinge nur mit besonders erfahrenen und besonnenen Kollegen Dienst taten.
Einer von der Spurensicherung schleppte ein Stativ mit einem Scheinwerfer an ihnen vorbei, ein zweiter folgte mit einer Metallkiste, die seinem Ächzen zufolge ziemlich schwer sein musste.
»Scheißwetter«, knurrte er.
Aus dem halb geöffneten Fenster des Streifenwagens drang scharf das Knistern des Funkgeräts, unterbrochen vom Schnarren einer monotonen Stimme.
»Die Gerichtsmedizin ist ebenfalls verständigt«, meldete der junge Polizist und stand weiterhin stocksteif.
»Gut gemacht«, lobte Keil und machte sich auf zum Tatort. Dort flammte gerade der erste Scheinwerfer der Spurensicherung auf und tauchte Mauer und Gebüsch in grellweißes Licht. Keil erkannte dort Leutnant Gröben und einen weiteren Uniformierten. Im Gebüsch zu ihren Füßen schimmerte etwas fahl.
»Platz machen!«, bellten die Spurensicherer. »Obacht!« Ein weiterer Scheinwerfer wurde herangeschleppt.
»Was für eine Sauerei!«, empfing ihn Gröben. »Ich hätte dich ja nicht geweckt, wenn du nicht ausdrücklich darauf bestanden hättest.«
Keil schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter und schüttelte dann dem zweiten Uniformierten, der ein wenig amüsiert wirkte, die Hand. Gröben hingegen strahlte auf Keil, wie immer angesichts eines schweren Verbrechens, eine Mischung aus Trauer und Verzweiflung aus. Als wäre er für so viel Leid einfach nicht geschaffen. Mit seinen blonden Haaren, die trotz aller Bemühungen zerzaust in die Höhe standen, erinnerte er Keil an einen jungen Albert Einstein. Keil wusste, dass Gröbens äußere Erscheinung über seine kriminalistischen Qualitäten hinwegtäuschte und er sich jederzeit auf den 33-jährigen Leutnant verlassen konnte.
Der zweite Scheinwerfer wurde eingeschaltet, und Keil schloss für einen Moment geblendet die Augen. Ihn umgab ein intensiver Geruch nach Verfall: feuchte, ausgelaugte Erde, Schimmel, verrottende Vegetation. Als er die Augen wieder öffnete, sah er die Leiche unmittelbar vor sich. Es war der Körper eines älteren Mannes, etwa fünfzig Jahre alt, mit leichtem Bauchansatz, erschlaffter Muskulatur und ergrauten Brusthaaren.
Der Mann war nackt. Nur seine behaarten Beine steckten in schwarzen Nylonstrümpfen.
»Vermutlich ein Homosexueller«, bemerkte der ältere Uniformierte mit einem verächtlichen Unterton in der Stimme.
Keil ging in die Hocke, achtete aber auf genügend Abstand zur Leiche, um keine Spuren zu verwischen. Die starken Scheinwerfer offenbarten jedes Detail des Toten: eine nicht besonders kunstfertig vernähte Blinddarmnarbe, den zusammengeschrumpften Penis, der in der dichten, drahtartigen Schambehaarung beinahe verschwand, und vor allem das schlimm zugerichtete Gesicht. Auf die Mundpartie war mit Wucht eingedroschen worden. Zerplatzte Lippen, zertrümmerte Zähne, die nur noch als scharfkantige Stummel im geöffneten Mund zu erkennen waren. Über den weit aufgerissenen Augen klaffte eine Platzwunde auf der Stirn, und es schien so, als seien dem Mann, angesichts der unregelmäßig verteilten Kahlstellen auf dem Kopf, die grauen Locken büschelweise ausgerissen worden. Die Einschnitte am Hals deuteten auf Erdrosseln hin. Vermutlich mit einem Draht, der tief in die dünne Haut an der Kehle eingedrungen war.
Gröben wies auf die Einschnitte an den Handgelenken. »Der Mann war gefesselt.«
»Wer hat den Toten gefunden?«, fragte Keil.
»Ein Spaziergänger. Rentner. Hat mit seinem Hund eine Runde gedreht«, erwiderte Gröben. »Der Mann wartet in meinem Wagen. Die Personalien wurden bereits aufgenommen. Er heißt Karl Rossbach.«
»Vor kurzem hätte hier niemand so einfach eine Leiche ablegen können.« Keil deutete mit einem Kopfnicken auf die Mauer vor dem Jungfernsee. »Finden hier keine Kontrollen mehr statt?«
»Eher nicht«, antwortete der Uniformierte. »Wo die Leute doch überall über reguläre Grenzübergänge in den Westen können.« Es klang nicht so, als würde er diese Tatsache gutheißen. »Unsere Grenzer müssen jetzt die Westler kontrollieren. Die kaufen doch unsere Läden leer und schmuggeln alles nach drüben. Es soll schon vereinzelt zu Versorgungsengpässen gekommen sein.«
In der Nähe erstarb ein Zweitaktmotor, Wagentüren wurden geöffnet und zugeschlagen. Schritte näherten sich.
»Anne ist da. Sie hat heute Dienst«, sagte Gröben leise. »Mit ihrem Hugo.«
Anne Rösler trug einen weißen Overall und schützte sich gegen den anhaltenden Nieselregen mit einer schwarzen Wollmütze. Eine einzelne rotblonde Strähne war darunter hervorgerutscht. Sie arbeitete für das Potsdamer Institut für Gerichtsmedizin und war dort unter anderem für die Untersuchung von Leichen zuständig, deren Todesursachen nicht eindeutig auf natürliche Umstände zurückzuführen waren. Was bei diesem Toten absolut der Fall war.
Einer der Spurensicherer hielt sie mit erhobenen Armen auf. »Momentchen noch, die Dame! Wir sind gleich so weit.« Er wandte sich an Keil. »Wäre hilfreich, wenn Sie und Ihre Leute ebenfalls mal woanders hingehen.«
Anne Röslers Assistent, den alle nur als Hugo kannten, lugte über die Schulter seiner Vorgesetzten. »Herrje!« Beim Anblick des Toten in Damenstrümpfen stieß er einen leisen Pfiff aus. Hugo war geradezu erschütternd übergewichtig. Immer, wenn Keil ihm begegnete, verblüffte ihn die Leibesfülle des Mannes von neuem. Jedes Mal hatte er das Gefühl, ihn nicht dermaßen fett in Erinnerung gehabt zu haben. Schon die wenigen Meter vom Fahrzeug bis zur Leiche hatten ihn völlig außer Puste gebracht. Er schnaufte und wischte sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn. Er trug ebenfalls einen Overall, der sich wie eine zweite Haut über seinen Körper spannte. Aber von Anne wusste Keil, dass sie sich keinen gewissenhafteren Mitarbeiter wünschen konnte. Seine ungewöhnliche Figur änderte nichts an der Tatsache, dass er ein überaus freundlicher und intelligenter Mann war. Mit einem Hang zum Spott über die Partei und ihre Vertreter, der ihn schon beinahe in den Knast gebracht hatte.
Um der Spurensicherung nicht im Wege zu stehen, kehrten sie alle zur Straße zurück. Dort stand der übereifrige junge Volkspolizist weiterhin auf Posten, als gelte es den Tatort von einer neugierigen Menschenmenge abzuriegeln. Dabei war weit und breit niemand zu sehen.
Am Himmel zeigte sich noch immer kein Anzeichen von Tageslicht, nur Westberlin strahlte hell am Horizont. Ein Windstoß bewegte die Äste der Bäume und schüttelte die Tropfen von ihnen ab.
Die zwei Männer von der Schnellen Medizinischen Hilfe waren in der Zwischenzeit in ihrem Einsatzfahrzeug eingeschlafen. Anne griff in der Dunkelheit nach Keils Hand und drückte sie kurz. Obwohl sie seit über zwei Jahren zusammen waren, vermieden sie den Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Vor allem in der Gegenwart von Kollegen. Diese Übereinkunft war in erster Linie von Keil ausgegangen. Die Beziehung zu der Gerichtsmedizinerin war die erste, die länger als ein paar Wochen andauerte. Obwohl sie wie er in einem Heim aufgewachsen war, hatte Anne keine Probleme, sich anderen Menschen zu öffnen und ihre Gefühle zu artikulieren. Bis heute war es Keil nicht gelungen, die richtigen Worte zu finden, um ihr mitzuteilen, was er für sie empfand.
Keil wollte die Zeit nutzen, um mit dem Rentner zu sprechen, der die Leiche entdeckt hatte. Er setzte sich neben ihn auf die Rückbank von Gröbens Wartburg. Der alte Mann machte einen nervösen Eindruck und wich vor Keil zurück, bis er mit dem Rücken gegen die Tür stieß. Der Dackel auf seinem Schoß stieß ein leises Knurren aus. Beide waren durchnässt und rochen ein wenig nach alter Matratze.
Keil stellte sich vor und bemühte sich um eine sanfte Stimme, als er sagte: »Guten Morgen, Herr Rossbach. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie.«
»Guten Morgen, Genosse Hauptmann! Ich … ich wohne hier gleich um die Ecke.« Mechanisch streichelte er das Fell des Hundes. »Ich bin schon immer hier spazieren gegangen. Die Jungs vom Grenzschutz kannten mich und Samson. Die waren in Ordnung.«
»Ihr Hund heißt also Samson«, stellte Keil ruhig fest. »Und Sie beide sind allem Anschein nach Frühaufsteher.«
Der Mann nickte eifrig, sein Gesicht wurde vom Drehlicht auf dem Dach des Streifenwagens der Schutzpolizei immer wieder für Sekundenbruchteile in gespensterhaftes Blau getaucht.
»Seit meine Frau im Frühjahr gestorben ist, muss ich einfach früh raus.« Der Blick des Mannes verlor sich für einen Moment in weiter Ferne. »Samson hat den Toten gefunden«, fuhr er dann fort. »Dann bin ich zum nächsten Telefon gelaufen und habe die 110 gewählt. Ihre Kollegen sagten, dass ich zum Fundort zurückkehren soll. Ich habe da auch nichts angerührt.«
»Sind Ihnen hier Leute oder Fahrzeuge aufgefallen?«
»Nein, um diese Uhrzeit bin ich hier ganz allein.« Der Mann kramte eine kleine Taschenlampe aus der Manteltasche hervor. »Die habe ich stets dabei. Damit konnte ich sehen, dass der Tote ganz feine Frauenstrümpfe trägt. Das ist doch völlig verrückt. War das ein Mord unter Perversen? Vielleicht kommt der Kerl aus dem Westen.«
»Wir werden das schon noch feststellen«, sagte Keil mit sanfter Stimme. »Falls wir noch weitere Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen. Sollen wir Sie nach Hause fahren, Herr Rossbach?«
Der alte Mann winkte ab. »Wie gesagt, ich habe es nicht weit.«
»Noch etwas.« Keil legte seine Hand auf Rossbachs Arm. Der Hund knurrte wieder und fletschte die Zähne. »Bitte bewahren Sie Stillschweigen. Sonst gefährden Sie möglicherweise unsere Ermittlungen.«
Ein Ruck ging durch den Mann. »Da können Sie sich auf mich verlassen, Genosse Hauptmann!«
Kaum war Keil ausgestiegen, näherte sich Annes Assistent Hugo mit seinem typisch wiegenden Schritt. »Wir haben unter der Leiche etwas gefunden«, schnaufte er. »Könnte wichtig sein.«
Anne und Hugo hatten den Toten in der Zwischenzeit umgedreht. Einer der Spurenermittler verpackte das Fundstück vorsichtig in einem transparenten Plastikbeutel.
»Lassen Sie mal sehen«, verlangte Keil.
»Es ist das Sandmännchen«, sagte Anne.
Der Spurenermittler hielt den Beutel direkt in das Licht eines Scheinwerfers. Es war eine mit Lehm verschmutzte Nachbildung des Sandmännchens aus dem Fernsehen. Seit Ewigkeiten schickte es die Kinder mit einem Abendgruß ins Bett. Die Puppe war etwa zwanzig Zentimeter groß, trug eine grüne Jacke aus einem Material, das Keil für Filz hielt, eine gleichfarbige Mütze und eine braune Hose.
»Kann die nicht schon vorher hier gelegen haben?«, fragte Keil.
»Möglich«, erwiderte der Spurenermittler. »Aber nicht allzu lange. Abgesehen davon, dass der arme Sandmann nass und verdreckt ist, ist seine Kleidung noch kein bisschen verrottet.«
Anne kniete neben der Leiche im Schlamm. »Der Mann wurde heftig geschlagen. Der Kiefer ist gebrochen, aber der Tod trat durch Erdrosseln ein. Die Leichenstarre ist noch nicht abgeschlossen«, erläuterte sie. »Unter Berücksichtigung der niedrigen Außentemperatur, bei der er wegen der fehlenden Kleidung noch schneller auskühlte, schätze ich, dass der Tod vor vier bis sechs Stunden eintrat. Für weitere Details muss ich ihn zur Sektion ins Bezirkskrankenhaus bringen.«
Hugo klatschte mit einem Mal so laut in die Hände, dass sich alle zu ihm umdrehten. »Jetzt weiß ich es!«, rief er. »So wie der Mann zugerichtet wurde … und dann noch nackt bis auf diese schwarzen Strümpfe, habe ich ein wenig gebraucht.«
»Wer ist es?«, fragte Gröben.
»Er heißt Illner, den Vornamen habe ich vergessen. Oder Moment! Erwin … oder Erich.«
»Woher kennen Sie ihn?«, wollte Keil wissen.
»Der ist von der Bezirksleitung der Partei. Dieser Illner war Mitte Oktober bei uns im Club der Volkssolidarität. Machte auf offenherzig und freundlich. Von wegen Die SED sucht den Dialog und so ein Blabla.«
Der ältere Uniformierte musterte den Assistenten skeptisch. Hugos Tonfall schien ihm nicht zu gefallen.
»Das bringt uns weiter«, sagte Keil und wandte sich an den Uniformierten. »Stellen Sie über Funk fest, wo ein gewisser Erich oder Erwin Illner von der Bezirksleitung wohnt. Und ob er vermisst wird.«
»Jawohl!« Der Mann warf Hugo einen letzten Blick zu, der besagte, dass er den Assistenten der Gerichtsmedizin vor nicht allzu langer Zeit noch wegen seiner forschen Ausdrucksweise an entsprechender Stelle gemeldet hätte.
»Es gibt Reifenspuren im Schlamm am Straßenrand«, berichtete der Leiter der Spurensicherung. »Sonst nichts.«
»Keine Fußspuren?«, fragte Keil.
»Fein säuberlich verwischt.«
Keil deutete auf den Beutel mit dem Sandmann in der Hand des Mannes. »Vielleicht bringt uns dieser kleine Bursche weiter.«
Anne betrachtete noch immer die geschundene Leiche. »Hier war viel Wut im Spiel«, stellte sie fest. »Aber gleichzeitig hatte der Täter sich genügend unter Kontrolle, um sein Opfer nicht gleich mit den ersten Schlägen zu töten.«
»Sehen wir uns?«, fragte Keil Anne so leise, dass nur sie ihn hören konnte.
»Bleibt das dein Fall?«
»Bisher ja.«
Sie sah ihn ernst an. »Es geht hier um einen Funktionär. Um solche Dinge kümmert sich die Staatssicherheit.«
Er zuckte mit den Schultern. »Die Zeiten ändern sich. Das Ministerium für Staatssicherheit hat jetzt sogar einen neuen Namen.«
Anne senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Ich weiß: Amt für Nationale Sicherheit. Geleitet von Mielkes Stellvertreter. So viel zur Erneuerung.« Sie rollte mit den Augen. »Dann komm doch erst einmal am Nachmittag gegen vier ins Schloss. Dann habe ich weitere Ergebnisse von der Sektion.« Sie zog die Einweghandschuhe aus und strich ihm über die Wange. »Sei bloß vorsichtig, Martin.«
Er unterdrückte den Drang, sich umzusehen, ob sie bei dieser intimen Geste beobachtet worden waren. Leutnant Gröben wandte ihnen den Rücken zu, die anderen schienen sehr beschäftigt.
*
Der Morgen dämmerte, und mit ihm zog grauer Nebel auf. Himmel und Stadt verschmolzen zu einem diffusen Grau. Die Sichtweite jenseits der Frontscheibe schrumpfte auf wenige Meter. Passanten und parkende Fahrzeuge huschten als undeutliche Schlieren vorüber. Keil drosselte die Geschwindigkeit seines Wagens, bis er beinahe im Schritttempo fuhr.
Er hatte Leutnant Gröben zur SED-Bezirksleitung am Brauhausberg geschickt. Normalerweise wäre der Kollege von dem Auftrag wenig angetan gewesen, konnte er doch nur damit rechnen, auf mürrische Männer zu treffen, die seine Fragen bestenfalls wortkarg und von oben herab beantworteten. Aber für den sensiblen Gröben war das immer noch bedeutend erträglicher, als die Familie des Ermordeten aufzusuchen.
Die Nachfrage hatte ergeben, dass der Tote korrekt Erwin Illner hieß, einundfünfzig Jahre alt, verheiratet mit Sophie Illner, keine Kinder. Er wohnte im Stadtteil Waldstadt, in einem erst vor wenigen Jahren errichteten, fünfstöckigen Gebäude in Großblockweise.
Über dem Hauseingang leuchtete eine runde Deckenlampe, in ihrem gelblichen Lampenschirm zeichneten sich die Umrisse einer Hundertschaft toter Insekten vom letzten Sommer ab. Noch ehe Keil nach der richtigen Klingel Ausschau halten konnte, näherten sich Schritte, und eine forsche Stimme hinter ihm fragte: »Kann ich Ihnen helfen?«
Er wandte sich um und sah sich einem gedrungenen Mann in einer Latzhose gegenüber. In seinen Händen hielt der einen großen, lilafarbenen Pappaufsteller mit der Aufschrift Milka.
»Hauptmann Keil, Volkspolizei Potsdam. Und wer sind Sie?«
»Oh!«, machte der Mann. »Meier! Ich bin hier der Hausvertrauensmann.« Er setzte den Aufsteller ab. »Den habe ich von drüben mitgebracht. Für meinen Sohn. Er will ihn als Regal für seine Schallplatten benutzen. Sie wissen ja, die jungen Leute stehen auf dieses West-Zeug.« Der Hausvertrauensmann lächelte unsicher. »Das Hausbuch ist einwandfrei geführt. Wenn Sie es überprüfen möchten …«
Es war die Aufgabe des Hausvertrauensmanns, in einem Meldebuch alle Daten über die Mieter aufzulisten. Besucher aus der DDR, die länger als drei Tage zu Besuch waren, mussten sich vorstellen und wurden eingetragen. Bei Besuchern aus dem Ausland hatte der Eintrag bereits nach 24 Stunden zu geschehen.
»Später vielleicht.«
»Ach, dann wollen Sie gar nicht zu mir.« Meiers Erleichterung war offensichtlich.
»Zur Familie Illner.« Es machte keinen Sinn, es dem Mann zu verschweigen. Es würde ihm ohnehin nicht entgehen, und wahrscheinlich musste Meier noch befragt werden.
»Gute Nachbarn. Wohnen im zweiten Stock, die Tür links«, beeilte sich der Hausvertrauensmann zu sagen und blickte Keil neugierig an. Es war schließlich nicht alltäglich, dass ein ranghoher Volkspolizist in Zivil einen SED-Funktionär aufsuchte.
Keil ließ Meier mit seinem Regal aus lilafarbener Pappe im Treppenhaus vorangehen und klopfte dann an die Tür der Familie Illner. Der Hausvertrauensmann blieb ein paar Stufen höher stehen und glotzte über das Geländer.
»Wir sehen uns später«, sagte Keil, ohne sich umzuwenden, und hörte, wie Meier langsam weiterging. Pappe kratzte über Wandverputz.
Die Tür wurde von einer blonden Frau mit einem müden, hübschen Gesicht geöffnet. Obwohl Keil sich schon lange darum bemühte, unauffällig und halbwegs modisch gekleidet zu sein, und mittlerweile auch auf die SED-Anstecknadel verzichtete, konnte er ihr ansehen, dass sie ihn sofort als einen Offiziellen identifizierte.
»Frau Sophie Illner?«
Sie nickte.
Keil zeigte seinen Dienstausweis. »Ich muss mit Ihnen reden, Frau Illner. Darf ich hereinkommen?«
Ihre Stirn legte sich in Falten, als ahnte sie bereits, dass sein Besuch mit etwas sehr Unangenehmem verbunden war. Keil wartete, bis die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, weil er damit rechnete, dass Hausvertrauensmann Meier im Treppenhaus auf Lauschposten war.
»Können wir uns setzen?«, fragte er.
Sie sah ihn nachdenklich an, brachte erst nach einigen unendlichen Sekunden ein »Selbstverständlich« hervor und führte Keil ins geräumige Wohnzimmer. Moosgrüne Sitzgarnitur, runder Tisch mit weißer Decke, an der Wand eine riesige Spanplatten-Schrankwand mit künstlichem Furnier. In den Regalen exakt platzierte Kristallvasen und zwei Dutzend gleichförmiger Bücher, die nach politischem Inhalt aussahen. Auf der Fensterbank standen Topfpflanzen, eine Glastür führte auf den Balkon. Eine typische Wohnung, gediegen, ohne Protz. Bis auf den modernen Farbfernseher aus westlicher Fabrikation und einen Videorekorder der japanischen Marke Sanyo. Die Geräte gab es seit September für über 7000 Mark zu kaufen. Gröben hatte ihm davon erzählt, weil er von der Möglichkeit, Filme im Fernsehen aufzuzeichnen, fasziniert war. Der Preis überstieg aber die finanziellen Möglichkeiten des Kollegen bei weitem.
»Ich habe gleich gewusst, dass Sie nicht von der Staatssicherheit sind«, sagte Frau Illner leise und setzte sich auf das Sofa. »Die sehen immer irgendwie gleich aus. Mit ihren komischen Gummijacken und diesen albernen Täschchen am Handgelenk.«
Keil nahm auf einem der beiden Sessel Platz und sank tief in die weichen Polster. Es kam ihm so vor, als wollte die Frau das Unausweichliche aufschieben: den Grund für seine Anwesenheit.
»Frau Illner, es geht um Ihren Mann«, begann er ruhig. »Er ist tot.«
Es war so, als würde der letzte Satz einfach in der Luft stehen bleiben.
Sophie Illners Haut wurde ganz blass, beinahe durchsichtig. Ihre Nasenflügel bebten. Sie strich mit den Handflächen immer wieder über ihre geblümte Nylonschürze und erzeugte dabei ein leises statisches Knistern.
»War es ein Autounfall?«, fragte sie.
»Allem Anschein nach war es Mord.« Keil beugte sich leicht nach vorn, bereit, sofort aufzuspringen, falls die Frau die Kontrolle über sich verlor. In solchen Momenten musste er immer an die junge Mutter denken, die, nachdem sie vom Tod ihrer fünfjährigen Tochter erfahren hatte, ihren Kopf ohne Vorwarnung gegen die Wand geschlagen hatte. Mit solcher Wucht, dass sie mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus hatte eingeliefert werden müssen. Den Kerl, der sich an dem kleinen Mädchen vergangen hatte, um sie anschließend wie Abfall im Wald zu entsorgen, hatte Keil nur wenige Tage später gefasst. Bis dahin war es ihm nicht möglich gewesen, die Augen länger als für ein, zwei Stunden zu schließen.