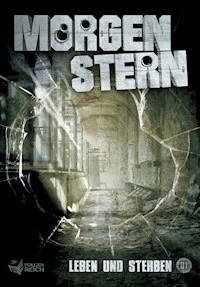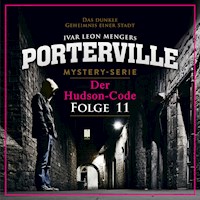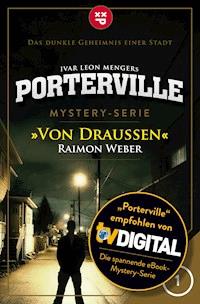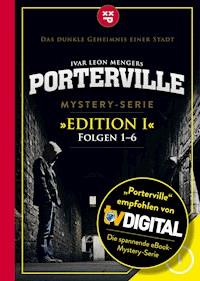
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Porterville (Darkside Park) Edition
- Sprache: Deutsch
Die junge Emily lebt in Porterville. Die Stadt ist umzingelt vom so genannten "Draußen". Es heißt, dass dort der Schmerz von allen Seiten angreift. Ein Mensch würde dort keine fünf Minuten überleben. Aber auch Porterville ist nicht mehr sicher. Es sind die Erdbeben. Sie reißen Lücken in die Struktur der Stadt. Meistens sind sie nur groß genug, um Greybugs durchzulassen. Graue Käfer ohne Kopf und sichtbare Sinnesorgane. Aber manchmal reichen sie auch für mächtigeren Besuch. Emily folgt ihrem Freund in längst vergessene Geheimgänge. Sie führen ins "Draußen" …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PORTERVILLE
Edition I
Folgen 1-6
Raimon Weber
Anette Strohmeyer
Simon X. Rost
John Beckmann
- Originalausgabe -
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-942261-49-4
Lektorat: Hendrik Buchna
Cover-Gestaltung: Ivar Leon Menger
Fotografie: iStockphoto
Psychothriller GmbH
www.psychothriller.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Ein Buch zu schreiben, dauert Monate. Es zu kopieren, nur Sekunden. Bleiben Sie deshalb fair und verteilen Sie Ihre persönliche Ausgabe bitte nicht im Internet. Vielen Dank und natürlich viel Spaß beim Lesen! Ivar Leon Menger
Folge 1
„Von Draußen“
Raimon Weber
Prolog
„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Porterville! Im Angesicht nie gekannter Gefahren ist es mein unumstößliches Ziel, die Freiheit und Sicherheit unserer wunderschönen Stadt zu bewahren. Und ich gelobe feierlich: Ich werde jeden einzelnen von euch, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, wieder heil nach Hause bringen.“
Angus Hudson
Bürgermeister von Porterville
- 1 -
Porterville ist Geborgenheit und Glück!
Draußen bedeutet Verlust und Chaos!
Ich fixiere die Leitsätze unter dem Portrait des Bürgermeisters Takumi Sato an, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Es hätte auch jeder andere Punkt im Klassenzimmer sein können. Ein winziger Schmutzfleck oder ein vergessener Klebestreifen, an der einst ein Poster mit gut gemeinten Ratschlägen hing.
Ich kann mich noch genau an die bunten Poster erinnern, die damals im monatlichen Rhythmus wechselten. Wenn sie von der Klassenleiterin an die Wand geheftet wurden, folgte im Anschluss stets eine zweistündige Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema. Dabei ging es um Körperhygiene, Energieeinsparung oder Mülltrennung. Oder, wie vor drei Jahren, um Partnerschaft. Das Motiv habe ich mir eingeprägt. Das Poster war durch eine rote Linie in zwei Hälften geteilt. Auf der linken betrieb eine Gruppe junger Mädchen Gymnastik, in dem sie überaus geschickt bunte Bänder durch die Luft wirbeln ließen. Die rechte Seite zeigte vier Jungen mit verbissenen Gesichtern, die um einen Football rangen. Drei von ihnen lagen bereits am Boden, der vierte, ein mächtiger Bursche mit Kriegsbemalung, warf sich gerade auf sie. Er war inmitten des Sprungs festgehalten worden, so dass er trotz seines massigen Körpers wie schwerelos wirkte.
Über den gegensätzlichen Szenen prangte die Losung: Lebt eure Jugend! Lasst euch Zeit!
Unsere damalige Klassenleiterin hatte uns klargemacht, dass man die kostbare Zeit der Jugend nicht mit Schwärmereien für das andere Geschlecht vertun soll. Dafür wäre im späteren Leben noch genügend Zeit. Außerdem seien flüchtige Emotionen ohnehin nicht dazu geeignet, um eine Partnerschaft einzugehen. Die städtische Instanz für Lebensgemeinschaften würde in jedem Einzelfall erkennen, wer füreinander bestimmt ist. Und auch den richtigen Zeitpunkt mitteilen. Bis dahin hat all unser Streben dem Wohl der Stadt Porterville zu dienen.
Damals, als Zwölfjährige, klang das für mich plausibel. Wer, wenn nicht die zuständige Instanz, sollte wissen, was richtig ist. So ist es doch in allen Bereichen. Doch als ich Jonathan vor drei Monaten kennenlernte, wuchsen in mir Zweifel an der Richtigkeit.
Während ich die Leitsätze anstarre, denke ich nur an Jonathan. Mrs. Gratschow referiert monoton über ethische Grundlagen der Gemeinschaft. Ihre Sätze zerfasern in meinem Kopf zu einem monotonen Rauschen.
„Miststück!“, kreischt Carmen neben mir.
Ich blicke zur Seite. Ein Greybug, ein besonders fettes Exemplar mit mindestens drei Zentimeter Durchmesser, krabbelt vor ihr über die Tischplatte.
Carmen schlägt mit der Faust auf den Tisch. Die Vibration lässt den Greybug auf der Stelle verharren. Carmen zückt ihr Cuttermesser und schneidet das Ding in der Mitte durch. Dabei muss sie einige Kraft aufwenden. Ein Greybug ist sehr zäh. Eine gelbliche Masse dringt aus den Körperhälften. Zum Glück ist sie absolut geruchlos. Greybugs stinken nicht, sie fressen dafür aber alles Mögliche an. Kunststoff, Holz, Kleidung und natürlich Lebensmittel. Es heißt, sie würden auch nicht vor hilflosen Menschen zurückschrecken. Kranke und Säuglinge verbringen die Nächte daher unter einem Netz aus Leichtmetall.
„Gut gemacht!“, vernehme ich Mrs. Gratschows Stimme. Sie eilt mit einer Sammelbox herbei. Die Lehrerin streift sich Latexhandschuhe über, lässt die beiden Hälften des Greybugs in der metallenen Box verschwinden und reicht meiner Nachbarin ein Papiertuch, um den Tisch abzuwischen.
Mrs. Gratschow schüttelt den Kopf. „Die Viecher werden immer aufdringlicher“, murmelt sie und schaut kurz in die Sammelbox. Ich vermute, dass sich darin schon mehrere Dutzend Exemplare befinden müssen. Das Ergebnis von weniger als einer Woche.
Ein Gongschlag beendet in diesem Moment den Unterricht. Alle Mädchen stehen wie in einer einzigen Bewegung auf, verharren kerzengerade und sehen zu, wie Mrs. Gratschow sich dem Bild des Bürgermeisters zuwendet und eine Verbeugung andeutet. Dann sind wir an der Reihe, Takumi Sato unsere Ehrerbietung zu erweisen.
Was wird der Bürgermeister dazu sagen, wenn er erfährt, dass ich mich ausgerechnet in seinen Enkel verliebt habe? Entgegen aller Vorschriften.
Beim Verlassen des Klassenraums treffe ich auf dem Flur den Hausmeister. Er ist das einzige männliche Wesen in diesem Teil der Schule. Mädchen und Jungen werden getrennt unterrichtet.
Der Hausmeister sprüht etwas aus einer grellroten Flasche in einen schmalen Spalt auf dem gefliesten Fußboden. Gift gegen die Greybugs, vermute ich. Manchmal bebt die Erde. Erst in der letzten Nacht wurde ich durch eine Welle von Erschütterungen wach. Fundamente verschieben sich, Risse entstehen auf Straßen und an Gebäuden. Daraus kommen dann die widerlichen Greybugs hervor. Ovale, graue Käfer ohne Kopf und sichtbare Sinnesorgane. Sie sind extrem widerstandsfähig. Wenn man versucht, sie zu zertreten, glaubt man nachgiebiges Gummi unter der Schuhsohle zu spüren. Anschließend flitzen sie völlig unversehrt davon. Man muss sie vergiften, zerschneiden oder verbrennen.
Ich habe jetzt einige Stunden Freizeit, die ich bei meinem Großvater verbringen möchte. Er ist der einzige Verwandte, den ich habe. Ich glaube, dass er nur mir zuliebe noch nicht gestorben ist. Obwohl er sehr krank ist und unter ständigen Schmerzen leidet. Meine Besuche, so betont er immer wieder, sind die einzigen Lichtblicke in seinem ansonsten so tristen Dasein. Manchmal, von einem Moment zum anderen, beginnt er zu weinen. Wenn ich ihn nach dem Grund frage, gibt er mir keine vernünftige Antwort.
An meine Eltern kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war keine zwei Jahre alt, als sie durch das Draußen getötet wurden. Wie alle aus ihrer Generation.
Im Bedarfs-Center werde ich ein kleines Geschenk für Großvater besorgen.
- 2 -
Die Bedarfs-Center sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Das Größte befindet sich zum Glück in der Nähe der Schule. Hier kann man sicher sein, fast alles Notwendige zu bekommen. Das Center ist im Parterre eines riesigen Gebäudes untergebracht. Von außen wirkt es mit seinen Erkern und Verzierungen, umrahmt von quadratischen Wohn- und Verwaltungsblöcken, völlig deplaziert. Ich will gerade die ausladenden Treppenstufen erklimmen, als ein riesiger Schatten über den Himmel gleitet. Ich richte den Blick reflexartig in die Höhe. Doch was immer da über die Stadt gleitet, ist zu schnell, um von mir erfasst zu werden. Normalerweise gibt es nichts Ungewöhnliches am Himmel zu entdecken. Wolken und Sonne am Tag, unzählige Sterne und einen blassen Mond in der Nacht. Und den Regen. Aber der kann uns nicht erreichen. Die Tropfen prallen am Schutzschild ab.
Jetzt bemerke ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den Spruch über dem Eingang des Bedarf-Centers.
Beurteile den Tag nicht nach dem was du geerntet hast, sondern danach, was du ausgesät hast.
Die einzelnen Wörter sind verblasst. Irgendwann in naher Zukunft werden sie vollständig verschwunden sein. Sie passen so gar nicht an diesen Ort. Vielleicht weiß Großvater etwas über den Ursprung der Worte.
Im Eingangsbereich stehen noch mehrere Einkaufswagen. Würden alle benutzt, müsste ich warten, bis ein Kunde seinen Wagen nicht mehr benötigt und ihn wieder abstellt. Manchmal bilden sich so lange Warteschlangen, aber dafür herrscht im Inneren des Centers nie ein Gedränge.
Heute ist der hintere Teil des Centers unbeleuchtet und durch gelbe Bänder abgesperrt. Das bedeutet, dass es weder Fleisch, noch Obst oder Gemüse gibt. Bei diesen Nahrungsmitteln kommt es immer wieder zu Engpässen, da sie von Tieren und Pflanzen stammen, die innerhalb der Stadt gezüchtet werden. Nahrung von außerhalb ist, so haben Untersuchungen in der Vergangenheit gezeigt, ungenießbar und nicht selten sogar hochgiftig.
Die Regale sind mäßig gefüllt. Nur die Dosen mit der gelben Beschriftung Supreme sind allgegenwärtig. Sie enthalten eine hellbraune, halbfeste Masse, die durch Erhitzen ein entfernt nussig schmeckendes Aroma entwickelt. Supreme enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe. Nimmt man zusätzlich ausreichend Flüssigkeit zu sich, benötigt man eigentlich keine anderen Lebensmittel. Aber der Bürgermeister und seine Mitarbeiter setzen natürlich alles daran, den Menschen Abwechslung, ja, sogar ein wenig Luxus zu ermöglichen. Letzte Woche gab es jeden Tag Speiseeis.
Zu meiner Freude entdecke ich in einer Regalreihe eine kleine Schachtel Schokomints. Ich weiß, dass Großvater sie ganz besonders mag. Sie kostet nur noch acht Mac-Kingsley-Punkte. Früher lag der Preis bei einem nahezu unerschwinglichen Boy. Ich hole die Karten aus meiner Jackentasche: drei Zweier, zwei Vierer. Das ist nicht viel. Normalerweise würde ich mit den Karten an der Kasse ein Spielchen wagen. Gewinne ich die Partie, gibt es die Schokomints umsonst und vielleicht sogar ein paar Extrapunkte. Aber heute will ich das Risiko nicht eingehen. Auf dem Schulhof habe ich bereits zwei wertvolle Neuner verloren. Ausgerechnet an Debra, die Klassenzicke. Nach meiner Niederlage hat sie ein so hämisches Gesicht gezogen, dass ich ihr am liebsten die Nase gebrochen hätte.
An der Wand hängt ein riesiges Plakat. Darauf ist natürlich Bürgermeister Sato abgebildet. Er tätschelt einer Kuh den mächtigen Schädel. Diese Tiere kenne ich nur aus dem Biologie-Unterricht. Ich habe keine Ahnung, wo das Foto gemacht wurde. Tier und Bürgermeister scheinen auf einer Wiese zu stehen. Im Hintergrund sind weitere Kühe zu erkennen. Im blauen Plakathimmel prangt in schwungvollen Lettern der Slogan Trinkt mehr Milch!
Ich kann mich schwach an dieses Getränk erinnern. Im Kinderhort bekamen wir es manchmal. Damals muss ich etwa vier Jahre alt gewesen sein.
Der Kassierer, ein schlaksiger junger Bursche mit enormen Ohren, erwartet mich an der Kasse.
Ich deute auf das Plakat. Es ist selbst von hier nicht zu übersehen. „Wo steht denn die Milch?“
Er blickt völlig desinteressiert. „Haben wir nicht. Vielleicht kommt sie irgendwann.“
Ich reiche dem Kassierer meine beiden Vierer-Karten.
„Oh, schade“, macht er. „Das könnte doch heute dein Glückstag sein.“ Wie alle in Porterville liebt er das Spiel mit den Mac-Kingsleys.
„Oder deiner!“, erwidere ich und versuche, dabei nicht auf seine abstehenden Riesenlauscher zu starren.
Schade, denke ich, Großvater hätte sich bestimmt über etwas Milch zu den Schokomints gefreut.
- 3 -
Ich habe zwar einen eigenen Schlüssel zu Großvaters Wohnung, aber der Höflichkeit halber kündige ich mein Kommen immer durch zweimaliges Drücken auf den Klingelknopf an. Dann warte ich einen Moment. Manchmal geht es Großvater gut genug, um aufzustehen und die Tür von innen zu öffnen. Heute bleiben seine schlurfenden Schritte aus. Ich betrete den Flur und rufe halblaut: „Großvater! Ich bin es!“
Keine Antwort. Es ist absolut still in der Wohnung. Staubpartikel blitzen in einem gebündelten Sonnenstrahl, der durch den Schlitz einer dunklen Gardine vor dem Fenster dringt. In Großvaters Wohnung ist es immer düster.
„Hier ist Emily!“
Noch immer meldet er sich nicht mit seiner heiseren Stimme. Mit einem Mal bekomme ich Angst. Angst, dass er doch gestorben ist. In meiner Abwesenheit und vergessen von allen Menschen.
Ich haste ins Wohnzimmer. Großvater sitzt in seinem Lieblingssessel. Der Kopf ist ihm auf die Brust gesunken. Zu seinen Füßen liegt ein aufgeschlagenes Buch. Eine Seite ist geknickt. Großvater geht mit seinen Büchern sehr sorgsam um. Es muss ihm aus den Händen gerutscht sein, als er ...
„Großvater!“, rufe ich jetzt, so laut ich kann.
„Häh?“, höre ich ihn sagen und atme erleichtert aus. Er hustet und richtet seine Augen auf mich. Er gestikuliert fahrig mit seinen Händen.
Die Brille!, fällt mir ein. Sie liegt ebenfalls auf dem Boden. Er muss eingenickt sein, dabei ist sie ihm von der Nase gerutscht. Ich hebe die Brille auf und setze sie Großvater behutsam auf.
„Emily!“, stellt er fest und sein Blick klärt sich. Großvater entdeckt das Buch auf dem Fußboden. „Würdest du mir das bitte geben?“
„Gern.“
Er versucht, die geknickte Seite zu glätten. „Ich bin wohl eingeschlafen“, murmelt er dabei und gähnt.
„Ich habe dir Schokomints mitgebracht.“
Großvater betrachtet erstaunt die Schachtel aus Metall. „Das sollst du doch nicht. Die sind viel zu teuer.“
Ich winke ab. „Der Preis wurde auf acht Punkte gesenkt. Toll, nicht wahr?“
Er öffnet die Schachtel. Es freut mich, wie er die Lippen zu einem schmalen Lächeln verzieht und eine Weile die Köstlichkeit nur mit seinen Augen verschlingt. Zartbitter-Schokolade mit einer erfrischenden Cremefüllung aus echter Pfefferminze. Ganz langsam und vorsichtig, als könnte sie zwischen seinen Fingern zerbrechen, nimmt er eine der flachen Pralinen aus der Schachtel und steckt sie sich in den Mund.
„Bitte, Emily, greif zu.“
Wir lutschen schweigend die Schokomints. Die Umhüllung aus Schokolade ist viel süßer, als ich sie in Erinnerung habe, und als ich auf die Füllung stoße, schmeckt sie kaum noch nach Minze sondern eher nach ...
„Sie haben die Rezeptur geändert“, bemerkt Großvater.
„Supreme!“, entfährt es mir. „Da ist Supreme in der Füllung. Deshalb ist es auch so billig.“
„Macht nichts“, erwidert Großvater. „Es schmeckt trotzdem noch ganz gut.“ Er stellt die Schachtel auf den kleinen Tisch neben dem Sessel.
Ich erkenne deutlich, dass er schwindelt, denn sonst hätte er nicht auf einen zweiten oder dritten Schokomint verzichtet.
„Immerhin soll es bald wieder Milch geben“, erwähne ich.
„Milch?“ Er sieht mich ungläubig an.
Ich nicke eifrig. „Im Bedarfs-Center hängt ein Werbeplakat.“
„Die machen sie garantiert auch aus Supreme“, murmelt er und fragt dann: „Wie läuft es in der Schule?“
Ich zucke mit den Schultern. „Meistens ist es langweilig.“
„Auch der Geschichtsunterricht?“ Er beugt sich ein wenig nach vorn.
Wir haben erst kürzlich die Historie von Porterville als Unterrichtsfach erhalten. Großvater ist sehr daran interessiert, was wir dort lernen. Den Inhalt der ersten beiden Geschichtsstunden hat er lediglich mit hochgezogenen Augenbrauen kommentiert.
„Würdest du bitte zusammenfassen, was man dir beigebracht hat, Emily?“
Ich erkläre ihm, dass Porterville der letzte Ort ist, an dem die menschliche Rasse noch existieren kann. Seit eine alles umfassende Katastrophe die Welt jenseits der Stadtmauern radikal verändert hat. Das geschah vor vielen Jahren. Damals regierte ein ebenso brutaler wie unfähiger Bürgermeister namens Hudson die Stadt. Er trägt die Hauptverantwortung dafür, dass eine ganze Generation vom Draußen getötet wurde. Also auch meine Eltern und die Eltern meiner Mitschülerinnen.
„Hat man dir erzählt, wie sie alle ums Leben gekommen sind?“, fragt Großvater nach.
„Noch nicht“, erwidere ich.
„Und was erfährst du über das so genannte Draußen?“
„Dass dort der Schmerz von allen Seiten angreift. Ein Mensch würde dort keine fünf Minuten überleben.“
Er schließt die Augen, presst die Lippen fest zusammen, und ich weiß, dass sein ganz persönlicher Schmerz gerade überaus heftig in seinem Körper wütet. Es dauert eine ganze Weile, bis Großvater wieder sprechen kann. Es ist furchtbar für mich, dass ich ihm nicht helfen kann. Er bekommt Medikamente, aber die scheinen seinen Zustand nicht zu verbessern, sondern höchstens zu stabilisieren.
„Glaubst du diese Dinge?“, fragt er schließlich mit schwacher Stimme.
Ich zögere mit der Antwort. Er bemerkt es und lächelt sanft. „Du weißt, dass du immer ehrlich zu mir sein kannst.“
„Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Manches klingt eben zu ... einfach. Es bleiben immer Fragen offen.“
„Die du hoffentlich nicht stellst“, sagt er und sein Lächeln verschwindet, als hätte er es einfach ausgeknipst. „Keine Fragen, Emily! Keine Zweifel! Dann wird dir nichts geschehen. Neugierde zahlt sich in Porterville niemals aus. Unwissenheit ist Trumpf!“
Ich nehme aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr und wende mich gerade noch schnell genug zur Seite, um zu sehen, dass ein Greybug unter ein Bücherregal huscht.
„Lass ihn“, sagt Großvater, als er meine sofortige Anspannung bemerkt.
Ich habe gelernt, einen Greybug sofort unschädlich machen zu müssen.
„Die bleiben hier nicht lange“, erklärt Großvater. „Fühlen sich bei mir nicht wohl.“
Für mich ist einfach unvorstellbar, wissentlich einen Greybug zu verschonen. In meinem Zimmer im Schulheim hätte ich notfalls das Regal zerlegt, um ihn zu töten.
„Und?“, setzt Großvater an. „Was macht die Liebe?“
Ich spüre wie ich augenblicklich erröte. „Was soll die Frage?“
Er grinst und scheint mit einem Mal ganz ohne Schmerzen. „Du trägst dein Haar offen, hast dir die Augenbrauen gezupft und wenn mich nicht alles täuscht, duftest du nach parfümierter Seife. Von der ich annahm, sie wäre in der Schule verboten.“
„Aber nicht außerhalb der Schule“, erwidere ich kleinlaut.
„Wie heißt er?“, hakt Großvater nach.
Ich konnte ihm tatsächlich immer vertrauen. Wenn er jemals die Stimme erhob, was sehr selten vorkam, dann nur um mich vor irgendetwas Törichtem zu bewahren.
„Jonathan.“
„Existiert auch ein Nachname?“
Ich weiß nicht, wie er reagieren wird, wenn ich verrate, dass es sich um den Enkel des Bürgermeisters handelt.
Er wartet geduldig und ich nehme allen Mut zusammen und sage: „Jonathan Sato.“
Ich habe meinen Großvater noch nie mit einer, wie es heißt, frischen Gesichtsfarbe gesehen. Sein Teint war stets so eine Mischung aus gelb und grau. Aber jetzt wird er ganz blass, fast weiß. Er bekommt einen schlimmen Hustenanfall. Ich laufe in die Küche, um ihm ein Glas Wasser zu holen. Er trinkt es in hektischen Schlücken aus, bekommt wieder etwas Luft und krächzt: „Lass das!“
„Warum?“, frage ich. „Wegen der Instanz für Lebensgemeinschaften?“
Er wedelt hektisch mit der Hand. „Vergiss diese Instanz! Vergiss überhaupt jede beschissene Instanz!“
So habe ich ihn noch nie reden gehört.
„Du darfst dich nicht in die Umgebung von Takumi Sato wagen“, fährt er aufgebracht fort. „Dieser Mann ist gefährlich. Er wird es nicht dulden, dass du mit seinem Enkel zusammen bist.“
Der Greybug hat Gesellschaft bekommen. Drei weitere Exemplare laufen eilig über den abgewetzten Teppich. Aber die sind mir jetzt völlig egal. Ich bin erschüttert über die Reaktion meines Großvaters.
„Was soll er denn gegen unsere Liebe tun?“
Großvater sieht sich nach allen Seiten um. So, als wären wir gar nicht allein. Er senkt die Stimme. „Du weißt, was die IFIS ist?“
Ich nicke. „Die Instanz für Innere Sicherheit. Sie sorgt dafür, dass wir keine Angst vor Kriminellen jeglicher Art haben müssen.“
Großvater schlägt mit der flachen Hand auf die Lehne des Sessels. „Sie sorgt aber auch dafür, dass jeder, der dem Bürgermeister und seiner Clique nicht passt, auf Nimmerwiedersehen verschwindet.“
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erst vor einer Woche besuchten uns zwei Frauen der IFIS in der Schule. Sie redeten mit uns ganz freundlich und fragten nach einigen Dingen. Was wir so in der Freizeit treiben und wer mit wem befreundet ist. Ihre weißen Uniformen sahen ziemlich schick aus. Tori, meine beste Freundin, war ganz begeistert und will sich später unbedingt bei der Instanz für Innere Sicherheit bewerben. Da sie weiß, dass dort nur die Besten genommen werden, lernt sie seitdem wie verrückt.
Tori würde nie jemanden verschwinden lassen.
Ich weiche unwillkürlich zwei Schritte zurück. Großvater bemerkt es und versucht, seiner Stimme einen versöhnlichen Klang zu geben. „Emily, ich will dich doch nur schützen.“
„Aber ich liebe Jonathan. Und selbst wenn es wirklich so ist, wie du sagst, wird er nicht zulassen, dass mir etwas Schlimmes geschieht.“
„Liebe.“ Großvater seufzt. „Glaube mir, ich weiß, was Liebe anrichten kann.“ Er winkt mit seiner Hand. „Komm wieder her zu mir.“
Ich mache einen Schritt auf ihn zu.
„Ich möchte dir etwas erzählen“, beginnt er. „Damit du alles besser verstehst. Setz dich bitte.“
Ich schüttele den Kopf.
„Auch gut“, fährt er fort. „Was weißt du über meinen früheren Beruf?“
„Nur, dass du mit Büchern gearbeitet hast.“
Großvater lässt seinen Blick kurz durch das Zimmer wandern. Die Bücher sind überall. In den Regalen, auf der Fensterbank. Oder einfach zu wackeligen Türmen an den Wänden gestapelt.
„Ich leitete die Stadtbibliothek. Später machten sie dann ein Bedarfs-Center daraus. In der Nähe deiner Schule. Da, wo du die Schokomints gekauft hast.“
Ich kenne die Bibliothek unserer Schule. Ein vielleicht dreißig Quadratmeter großer Raum mit Lehrbüchern. Die meisten wurden von Bürgermeister Sato persönlich verfasst. Unfassbar, dass es einmal so viele Bücher gegeben haben soll, um ein riesiges Gebäude damit zu füllen.
„Der Spruch über dem Eingang?“, frage ich. „Ist der von Sato?“
Großvater lacht. Aber es klingt gar nicht belustigt, eher traurig. „Das ist ein Zitat des Schriftstellers Robert Louis Stevenson. Der ist schon lange tot. Sato ist kein Schriftsteller, sondern ein Tyrann.“
Einmal in der Woche kommt ein junger Mann von der Instanz für Gesundheit bei Großvater vorbei. Er bringt dann neue Medikamente. Einmal, als ich zufällig auch anwesend war, nahm er mich beiseite und eröffnete mir, dass mein Großvater im Laufe der Zeit ein wenig verwirrt werden könnte. Das sei eine Folge der Erkrankung. Ich frage mich, ob dieser Zustand soeben eingetreten ist. Das macht mich so traurig, dass ich nur mit Mühe die Tränen zurückhalten kann.
„Sato lügt“, fährt Großvater fort. „Was über das Draußen verbreitet wird, entspricht nicht der Wahrheit.“
Er fährt zusammen, als die Türklingel schrillt. Unsere Blicke treffen sich. Großvater hat eindeutig Angst. Warum?
„Erwartest du Besuch?“, frage ich. Der Mann von der Instanz für Gesundheit kann es nicht sein. Der kommt immer nur montags. Heute ist Freitag.
„Ich sehe nach“, beschließe ich. Ich habe gerade den Flur erreicht, als die Tür geöffnet wird. Ein kleiner korpulenter Mann in einem grauen Overall steht im Eingang. Ein zweiter, wesentlich größerer Mann schaut ihm über die Schulter.
„Wir vermuten, dass sich in diesem Gebäude eine inakzeptable Populationsdichte von Greybugs befindet“, verkündet er und lässt seinen gezückten Ausweis so schnell verschwinden, dass es mir unmöglich ist, auch nur einen Blick darauf zu werfen. „Wir haben die Anweisung, die Wohnung auch dann zu betreten, wenn niemand anwesend ist.“
„Sie haben nur einmal kurz geklingelt“, erwidere ich.
„Mädchen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Du lernst doch in der Schule, wie schädlich diese Greybugs sind.“ Mit beinahe lustig anzusehenden Trippelschritten tänzelt er an mir vorbei. Sein Kollege trägt einen feuerroten Sprühbehälter auf dem Rücken und grunzt nur: „Wir machen sie alle fertig.“
Ich folge ihnen ins Wohnzimmer. Der Dicke reicht Großvater ein Formular. „Mr. Prey? Sie sind Martin Prey, der Eigentümer dieser Wohnung?“
Großvater starrt ihn mit großen Augen an.
„Unten rechts auf der Linie unterschreiben, Mr. Prey“, fährt der Mann fort.
„Muss mein Großvater die Wohnung vorübergehend verlassen?“, frage ich.
Der lange Kerl schüttelt den Kopf und schnallt den Behälter von seinem Rücken. „Nö, das Zeug macht nur die Viecher fertig. Nicht deinen Opa.“
„Geh jetzt besser“, höre ich Großvater sagen. Sein Lächeln ist nicht echt.
- 4 -
Der Weg zu Jonathan ist leicht zu finden. Er wohnt mit seinen Großeltern im mit Abstand höchsten Gebäude der Stadt. Das Hochhaus ist nach dem Bürgermeister benannt. Man kann den Sato-Tower von fast allen Orten in Porterville sehen.
Ich hoffe, dass es Großvater gut geht. Dieser letzte Blick von ihm, ehe ich die Wohnung verließ, schien so sorgenvoll und verzweifelt.
Warum glaubt er, dass Bürgermeister Sato gefährlich ist? Was wollte er mir über das Draußen mitteilen?
Der Mann von der Instanz für Gesundheit gab mir strikte Anweisung, jegliche Aufregung von meinem Großvater fernzuhalten. Daher habe ich verschwiegen, dass auch Jonathan Zweifel an dem hat, was uns über die Welt außerhalb von Porterville gelehrt wird. Jonathan versucht ständig, an Informationen zu gelangen, wagt es aber nicht mehr, seinen eigenen Großvater, den Bürgermeister, danach zu fragen. Beim letzten Versuch wurde er dazu verdonnert, einen ausführlichen Aufsatz über die Logistik des urbanen Zusammenlebens zu verfassen. Eine Woche hat er dazu gebraucht. Aber sein Interesse am Draußen und vielen anderen Dingen wurde dadurch nicht geschmälert. Dafür bewundere ich ihn. Er gibt einfach nicht auf.
Ich benötige zu Fuß über eine halbe Stunde bis zum Sato-Tower. Das macht aber nichts. Durch den überraschenden Abbruch meines Besuchs bei Großvater habe ich mehr als genug Zeit.
Einer der wenigen Busse rauscht fast lautlos an mir vorbei. Die Scheiben des riesigen Fahrzeugs sind verspiegelt. Ich bin erst einmal mit einem solchen Bus gefahren. Bei einem Ausflug ins historische Museum. Ansonsten transportieren die Busse nur wichtige Leute wie Mitarbeiter der verschiedenen Instanzen zu ihren Arbeitsplätzen. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Vom Achtsitzer bis zu riesigen Ungetümen mit Platz für zweihundert Fahrgäste.
Ich nähere mich einem prunkvollen Gebäude. Es trägt den Namen Olympic Regent. In vergangenen Zeiten, bevor sich alles veränderte, war es ein Hotel. Gäste aus anderen Städten, die Porterville besuchten, wohnten dort. Jetzt kommt niemand mehr. Woher auch? Es heißt, dass außerhalb von Porterville kein menschliches Wesen existiert. Die Katastrophe hat sie alle getötet.
Das ehemalige Hotel wird heute nur noch bei feierlichen Anlässen genutzt. Wie etwa beim Geburtstag des Bürgermeisters. Dann werden dort verdiente Mitbürger eingeladen. Ein paar Mal im Jahr finden im Olympic Regent auch öffentliche Gerichtsverhandlungen statt. Bei besonders schwerwiegenden Straftaten, die eine Gefährdung der Stadt bedeuten. Selbst diese Kriminellen verschwinden nicht einfach, wie Großvater behauptete, sondern müssen Arbeiten verrichten. Manchmal sieht man sie in ihren orangefarbenen Overalls bei der Ausbesserung von Straßen und Gebäuden. Sie steigen auch in die Kanalisation, um Greybugs zu vernichten. Natürlich immer unter Bewachung.
Heute stehen mehrere Kleinbusse der IFIS vor dem Eingang des Olympic Regent. Sicherheitsleute rennen geschäftig hin und her. Sie tragen nicht die üblichen weißen Uniformen, sondern schwarze Schutzkleidung und Helme mit Visier. Ein bewaffneter Mann bedeutet mir mit herrischer Geste, die Straßenseite zu wechseln.
Mir ist sofort klar, dass dort weder eine Feier noch eine Gerichtsverhandlung abgehalten wird. Eine Person wird auf einer Trage aus dem Hotel zu einem der Busse gebracht. Ich bin immer noch nahe genug, um zu erkennen, dass sie schwer verletzt ist. Ihr Gesicht und die ganze Kleidung sind voller Blut.
„Weitergehen!“, brüllt mich der Uniformierte an. Er wirkt schon ziemlich betagt für diesen Job. Aber wie in allen Bereichen arbeiten bei der IFIS alte und junge Menschen. Die Generation dazwischen ist nun mal nicht mehr vorhanden.
Ich beschleunige meine Schritte, lasse aber dabei den Eingang des Hotels nicht aus den Augen. Ein tiefes Grollen dringt aus dem Gebäude, wird lauter und schwingt sich dabei zu einem schrillen Kreischen empor. Abrupt bricht es ab und hinterlässt eine Sekunde absoluter Stille. So, als würden alle Anwesenden, ja, die ganze Stadt, die Luft anhalten. Ohne es zu bemerken, bin ich auf der Stelle erstarrt.
Dann sind seltsam abgehackte Geräusche zu hören. Ich brauche einen Moment, um sie zu identifizieren. Es sind Schüsse. Ganze Salven.
Ein weiterer Bus der IFIS rast heran. Ein Dutzend schwarz Uniformierter springt heraus. Zwei von ihnen tragen Sprühbehälter. Sie erinnern an den Behälter der Greybug-Vernichter in Großvaters Wohnung. Nur glänzen diese hier wie poliertes Silber.
Ich wüsste zu gern, was in dem ehemaligen Hotel geschieht. Ein letzte Salve, dann nichts mehr. Auf wen wurde dort geschossen? Ich muss unbedingt mit Jonathan über den Vorfall reden.
Die bellenden Kommandostimmen der Einsatzkräfte bleiben hinter mir zurück. Die breite Straße vor mir ist völlig unbelebt. Das ist nicht allzu außergewöhnlich, denn schließlich ist die Bevölkerungsentwicklung stark rückläufig. Ganze Viertel sind nahezu unbewohnt.
Ein infernalisches Knistern lässt mich instinktiv zusammenzucken. Weit über mir entlädt sich Energie in zuckenden Blitzen. Sie bilden ein wildes, sich permanent veränderndes Adergeflecht auf dem unsichtbaren Schutzschirm. Dieses Phänomen kommt in letzter Zeit immer häufiger vor. Die Verantwortlichen lassen aber verlauten, dass keinerlei Grund zur Beunruhigung vorliege.
Eine massige Gestalt katapultiert sich aus dem Eingang eines Hauses. Es ist ein alter Mann. Keine zwei Meter vor mir ringt er um sein Gleichgewicht, rudert mit den Armen und sucht Halt am Pfahl einer Straßenlaterne. „Uff!“, macht der Fremde und „Puh!“ Er schwitzt sehr stark. Sein teigiges Gesicht ist ganz bleich, bis auf die leuchtend violetten Flecken auf den Wangen.
Ich fürchte mich nicht vor ihm. Porterville ist sicher, heißt es doch.
„Kann ich Ihnen helfen?“, frage ich. Der Mann pumpt Luft in seine Lungen, wedelt ungeduldig mit der Hand und ächzt: „Sekunde, Kleine! Ich ... ich muss dir etwas Wichtiges sagen.“
Ich habe ihn nie zuvor gesehen. Seine äußere Erscheinung ist ziemlich ungewöhnlich. Trotz einer gefühlten Außentemperatur von etwa fünfundzwanzig Grad trägt er einen langen grauen Mantel mit hochgestelltem Kragen. Ein wirrer, schulterlanger Haarkranz umrahmt seinen ansonsten kahlen Schädel. Er spuckt geräuschvoll aus und schüttelt den Kopf so heftig, dass seine schlaffen Wangen in heftige Wellenbewegungen geraten.
Ich kann mir vorstellen, dass der Mann mal eine eindrucksvolle Erscheinung abgegeben hat. Aber jetzt ist sein Körper zusehends dem Verfall preisgegeben.
„Du bist Emily Prey!“ Keine Frage, sondern eine Feststellung. „Ich musste mich sehr beeilen, um dich noch rechtzeitig abzupassen“, fährt er fort und findet langsam wieder zu normaler Atmung zurück.
„Was kann ich für Sie tun?“ Wir sind in der Schule zu höflichem Benehmen erzogen worden. Besonders gegenüber den älteren Mitmenschen. Und mein Gegenüber wirkt in der Tat sehr alt.
„Du musst deinem Großvater etwas ausrichten. Sag ihm, dass ich sie gefunden habe.“ Er wartet auf meine Reaktion.
„Wen oder was haben Sie gefunden?“ , frage ich zurück.
„Sarah Freeman.“
„Wer soll das sein?“ Der Name sagt mir gar nichts.
„Gut! Das ist sehr guuut!“ Er dehnt den Vokal und grinst breit. „Du weißt nichts. Das freut mich für dich. Wirklich, kleine Emily. Unwissenheit ist Trumpf.“
Diesen Satz habe ich heute schon einmal gehört. Von meinem Großvater.
Der Mann ist mir unsympathisch. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er seine Worte nicht ernst meint. Oder ist er vielleicht nur verwirrt? Und in welchem Verhältnis steht er zu Großvater?
„Darf ich fragen, wer Sie sind?“
Er reagiert nicht und sieht an mir vorbei. Dorthin, wo die Einsatzkräfte der IFIS ihrer rätselhaften Arbeit nachgehen. „Es wird immer schlimmer“, murmelt er dabei. „Von Tag zu Tag. Sie verlieren noch die Kontrolle.“
„Haben Sie eine Ahnung, was im Olympic geschehen ist?“
„Ja“, sagt er und seine Stimme hat mit einem Mal jegliche Kraftlosigkeit verloren. „Aber es ist besser, wenn ich es dir nicht verrate. Zu deiner eigenen Sicherheit.“
„Ich verstehe kein Wort“, erwidere ich.
„Aufgemerkt!“ Er klatscht in die Hände. „Einigen wir uns darauf, dass du keine Fragen stellst und nur zuhörst.“
Er kann den Widerwillen von meinem Gesicht ablesen. „Kein Grund zum Schmollen. Ich will nur dein Leben retten.“ Er legt eine fleischige Pranke auf meine Schulter. Es kostet Überwindung, sie nicht abzuschütteln. Erst jetzt wird mir bewusst, dass es sich hier um eine Belästigung, einen so genannten sexuellen Übergriff, handelt. In der Schule haben wir gelernt, in einer solchen Situation sofort um Hilfe zu rufen. Doch der Fremde scheint auch meine Gedanken erahnen zu können und lässt die Hand in seiner Manteltasche verschwinden.
„Ich will dir nichts tun. Mir ist bekannt, dass du mit Jonathan Sato ... wie sagt man? ... zusammen bist.“
„Woher wissen Sie das?“
„Pst!“, macht er. „Ich weiß eben sehr viel. Sogar, dass er plant, mit dir das Draußen zu erforschen.“
„Das stimmt nicht.“ Ich verschweige, dass ich sehr wohl über Jonathans innigen Wunsch, mehr über das Draußen zu erfahren, Bescheid weiß. Aber wie soll er es denn erforschen können? Das ist absolut unmöglich.
Der Mann lässt nicht locker. „Wenn er dich auffordert, ihm in verbotene Bereiche zu folgen, darfst du dich darauf nicht einlassen. Außerhalb der Stadt wartet nur der Tod auf euch. Sonst nichts.“
Ich nicke eingeschüchtert, wage aber dennoch eine Frage: „Waren Sie schon mal außerhalb der Stadt?“
Er sieht zum Himmel empor. Ein blaugrüner Blitz schlängelt sich über den Schutzschirm. Dabei verursacht er ein deutlich hörbares Zischeln. Beinahe scheint er lebendig zu sein.
„Nein“, sagt der Mann schließlich. „Dann würde ich hier nicht stehen.“
Ein großer Transporter fährt laut hupend an uns vorbei. Auf seiner Seite grinst ein aufgemaltes Schwein. Dass man dem Tier bereits ein üppiges Filetstück aus dem Rücken geschnitten hat, scheint es nicht zu stören. Der Transporter bremst und fährt rückwärts auf den Eingang des Hotels zu. Ein Mann der IFIS weist ihn dabei ein.
„Wirst du auf mich hören?“, fragt der Fremde.
Ich nicke erneut.
Der Mann mustert mich, als würde er mir nicht so recht trauen, seufzt dann und sagt: „Und vergiss nicht, deinem Großvater zu erzählen, dass ich Sarah Freeman gefunden habe.“
„Ist es nicht besser, wenn ich dazu auch Ihren Namen erfahre?“
Er überlegt kurz. „Sag ihm, du hast den alten Parker getroffen.“
„Und woher kennen Sie meinen Großvater, Mr. Parker?“
Er glotzt mich an und ich glaube schon, dass ich ihn mit meiner Neugierde verstimmt habe. Doch dann verzieht er die fleischigen Lippen zu einem Lächeln und sagt: „Kennst du den Darkside Park, Emily?“
„Nein.“
„Gut! Sehr guuut!“ Er kneift ein Auge zu und verschwindet wieder im Hauseingang. Er bewegt sich trotz seines Alters völlig lautlos.
- 5 -
Ich betrete zum ersten Mal in meinem Leben den Sato-Tower. Alles im Foyer ist von einem so intensiven Weiß, dass es beinahe in den Augen schmerzt. Weiße Wände, weißer Fußboden. Eine Empfangsdame im weißen Kleid sitzt an einem Schreibtisch und sieht mir mit einem strahlenden Lächeln entgegen. Sie ist nur ein paar Jahre älter als ich. Das trifft auch für die drei jungen Männer im Hintergrund zu. Ihre IFIS-Uniformen machen sie in dieser Umgebung fast unsichtbar.
„Willkommen, Emily Prey“, begrüßt mich die Frau. „Du bist bereits angemeldet.“
Sie nickt einem der Uniformierten zu. Er tritt vor und deutet auf eine der sechs verschlossenen Aufzugtüren. Sie ist wesentlich größer als die anderen fünf.
Er drückt einen Knopf und die Tür gleitet zur Seite. Wie erwartet ist auch das Innere des Aufzugs weiß, aber bei weitem nicht so schmucklos wie das Foyer des Towers. Mindestens ein Dutzend gerahmter Fotos hängt an den Wänden. Es gibt auch zwei Monitore, aber ihre Bildschirme sind schwarz.
Der IFIS-Mann folgt mir in den Aufzug und drückt den Knopf für die 55. Etage.
Alle Fotos zeigen den Bürgermeister mit einem immer gleichen Gesichtsausdruck. Mit wissendem Blick und angedeutetem Lächeln steht er hinter einem Rednerpult, pflanzt einen jungen Baum oder hält ein Baby auf dem Arm. Ich entdecke auch das Foto mit der Kuh, das die Vorlage für das Plakat mit der Aufforderung Trinkt mehr Milch! sein muss. Allerdings fehlen hier die anderen Tiere im Hintergrund. Kuh und Bürgermeister stehen ganz allein auf der Wiese.
Der Fahrstuhl hält an und nach einem hellen Klingelton öffnet sich die Tür. Ich stehe Jonathan gegenüber. Mein erster Gedanke ist es, ihm um den Hals zu fallen. Aber ich halte mich zurück. Zwar hat mir Jonathan versichert, dass seine Großeltern nichts gegen meinen Besuch haben, aber etwas Zurückhaltung erscheint mir angebracht.
„Danke, Jeremy“, verabschiedet Jonathan den IFIS-Mann. Der Fahrstuhl kehrt zurück ins Foyer. Jonathan umarmt mich und drückt mir einen Kuss auf die Lippen.
„Nicht“, ziere ich mich, obwohl mir der Sinn nach viel mehr davon steht. „Wenn uns dein Großvater erwischt.“
„Der ist gar nicht hier.“ Jonathan lässt mich dennoch los, nimmt meine Hand und sagt: „Du möchtest doch sicher die Wohnung sehen.“
Die Einrichtung ist überwältigend. Geschnitzte Möbel aus dunklem Holz, überall stehen hohe Vasen und Skulpturen, die zumeist Jagdszenen nachstellen. In einer erleuchteten Vitrine entdecke ich eine Miniaturlandschaft mit einem Wasserlauf, der sich durch einen Wald aus winzigen Bäumen windet.
„Ein Hobby meines Großvaters“, erklärt mir Jonathan. „Die Pflanzen sind echt, aber der Fluss ist natürlich nur ein Wasserkreislauf, der durch eine elektrische Pumpe angetrieben wird.“ Er deutet auf eine Baumreihe auf dem Kamm eines höchstens zwanzig Zentimeter hohen Hügels. „Wenn du genau hinsiehst, stellst du fest, dass sich diese Bäume alle nach rechts neigen. In der Vitrine weht nämlich permanent ein leichter Windzug von links. Alles soll so wirklichkeitsnah wie möglich sein.“
„Bewohnt ihr die ganze Etage?“, frage ich.
Jonathan lacht. „Nein, so viel Platz braucht selbst mein Großvater nicht. Es existieren noch Versammlungsräume und Büros für seine engsten Mitarbeiter.“
Eine Seite des Raumes ist vollständig verglast und gibt den Blick über die gesamte Stadt frei. Der Sato-Tower bildet ihren Mittelpunkt.
Weit unter mir sind nur wenige Menschen und noch weniger Fahrzeuge unterwegs. Die Luft ist so klar, dass ich deutlich die hohe Stadtmauer sehen kann. Auf ihr befinden sich in regelmäßigen Abständen die Energieprojektoren für den Schutzschirm. Von hier oben müsste ich eigentlich erkennen, was sich jenseits der Mauer befindet. Aber da ist nur ein diffuser Nebel, der sich erst in vielleicht hundert Metern Höhe lichtet.
„Enttäuscht?“, fragt Jonathan neben mir.
„Besteht die Welt etwa nur aus Nebel?“ Die Vorstellung ist deprimierend.
Jonathan schüttelt den Kopf. „Ich vermute, dass es sich eher um eine künstlich hervorgerufene Trübung des Energieschirms handelt. Damit niemand, der sich in einem höheren Gebäude aufhält, erkennen kann, wie es dort wirklich aussieht.“
„Vielleicht, weil der Anblick so furchtbar ist.“
„Ich werde es sehr bald erfahren“, erwidert er leise.
„Dann bist du also mit deinen Nachforschungen vorangekommen.“
Jonathan zeigt ein zufriedenes Grinsen. „Und ob!“
Plötzlich streckt er den Arm aus und deutet zum Horizont. „Dort! Kannst du es auch sehen?“
Es sind nur zwei, dann drei Punkte in der Ferne zu erkennen. Sie schweben vor dem Blau des Himmels, halten eine Weile Distanz und stürzen dann im Steilflug auf die Erde zu.
„Man kann so etwas nur von hier, vom höchsten Punkt der Stadt verfolgen“, sagt Jonathan.
„Was kann das gewesen sein?“ Ich spüre den Herzschlag in meiner Brust. Habe ich gerade einen Beweis für die Existenz von Leben außerhalb der Stadt gesehen?
„Keine Ahnung. Jedenfalls kommen sie nie nahe genug, um sie identifizieren zu können. Als würden sie sich vor uns fürchten.“
Ich suche den Himmel ab, aber es tauchen keine weiteren Objekte auf. „Ich glaube aber, dass heute etwas über die Stadt hinweg flog“, sage ich. „Leider war es zu schnell. Außerdem war die IFIS mit einem Riesenaufgebot im Olympic Regent. Ich hörte, wie darin geschossen wurde.“
Jonathan öffnet den Mund zu einer Frage.
Schritte nähern sich und eine helle Frauenstimme ruft: „Ah, da seid ihr ja!“
Ich wende mich um. Die Frau muss Jonathans Großmutter sein. Eleanor Dare-Sato. Sie wirkt in der engen Hose aus schwarzem Leder, die ihre schlanke Figur unterstreicht, beinahe jugendlich. Ihre Haarfarbe ist recht ungewöhnlich. Die sorgsam gelegten Locken sind von einem intensiven Rot.
Sie eilt auf ihren hohen Absätzen auf mich zu und legt mir für ein paar Sekunden die Hand an die Stirn. Als wolle sie sicher sein, dass ich kein Fieber habe. Eine eigenartige Form der Begrüßung. Sie trägt einen klobigen Ring an einem Finger. Ich kann die Kälte des Metalls auf meiner Haut spüren.
Aus der Nähe schwindet der Eindruck ihres jugendlichen Aussehens. Falten umrahmen ihre Augen und den Mund. Die lassen sich auch nicht von dem großzügig aufgetragenen Make-up verdecken.
Das optische Erscheinungsbild der Gattin des Bürgermeisters unterscheidet sich sehr von dem, was sie uns in der Schule eintrichtern. Dort heißt es immer: Sei bescheiden und kleide dich nicht eitel! Würde ich es wagen, mein hellbraunes Haar auch nur dezent zu tönen, hätte das eine sofortige Abmahnung und mindestens einen zusätzlichen Arbeitseinsatz zur Folge.
„Es freut mich, dich kennenzulernen“, verkündet Mrs. Dare-Sato und stemmt die Arme in die Hüften. „Ich war sehr gespannt darauf, wie du aussiehst.“ Sie droht ihrem Enkel scherzhaft mit dem Zeigefinger. „Der Junge ist ja so was von verschwiegen. Ich musste ihn förmlich verhören.“
Jonathan verdreht die Augen.
„Du bist hübsch“, sagt sie. „Setzen wir uns. Ich lasse uns einen Tee bringen.“
Wir folgen ihr zu einer der vielen Sitzgruppen in dem saalartigen Wohnzimmer. Auf einem Tisch steht eine Schale mit Obst. Orangen, Weintrauben und eine Frucht von der Größe und Form eines Footballs. Die violette Schale ist von winzigen gelben Flecken übersät. Frisches Obst bekomme ich nur selten zu sehen, aber diese Sorte ist mir völlig unbekannt.
Mrs. Dare-Sato hat mein Erstaunen bemerkt.
„Eine neue Züchtung meines Mannes“, erklärt sie. „Schmeckt wie eine sehr aromatische Mischung aus Ananas und Banane.“
Ich verschweige, dass ich bisher keine der genannten Früchte probieren konnte. In der Schulkantine geben sie uns bei besonderen Anlässen Rosinen.
Eine junge Asiatin serviert uns Tee und Gebäck und verschwindet ebenso lautlos, wie sie aufgetaucht ist.
„Wie geht es deinem Großvater?“ Mrs. Dare-Sato nippt an ihrem Tee. „Er hatte lange Zeit vor deiner Geburt einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Wusstest du davon? Er war sozusagen der Herr der Bücher.“
„Ja“, erwidere ich nur und verschweige, dass ich es erst vor wenigen Stunden erfahren habe.
„Heute liest bedauerlicherweise niemand mehr.“ Mrs. Dare-Sato wiegt den Kopf bedauernd hin und her. Ich denke daran, dass fast alle alten Bücher verschwunden sind. Bis auf die paar hundert Exemplare, die Großvater hortet. Vor ein paar Jahren habe ich versucht, eines von ihnen zu lesen. Großvater hatte es mir empfohlen. Es handelte von einem kleinen Mädchen, dass von einem Sturm in ein fremdes Land getragen wurde. Dort traf es auf seltsame Gestalten, deren Bedeutung ich mir von Großvater erklären lassen musste. Das war sehr mühselig und ich schaffte es nicht bis zum Ende des Buches. In Porterville erfährt man eben nichts über Hexen, Vogelscheuchen und Zauberer. Und von Orten wie Kansas und dem Land Oz hatte ich auch noch nie gehört.
„Spricht Mr. Prey mit dir über die Vergangenheit?“, fragt Mrs. Dare-Sato.
Ich greife bereits nach dem dritten Keks. Das mag vielleicht unhöflich und gierig erscheinen, aber sie schmecken einfach viel zu köstlich. Sie wurden garantiert nicht mit Supreme zubereitet.
„Eigentlich gar nicht“, erwidere ich. „Meistens rede ich. Er will immer wissen, was ich in der Schule lerne und so.“
Die Antwort scheint Mrs. Dare-Sato zufriedenzustellen. „Greif nur zu.“ Sie schiebt den Teller mit den Keksen näher zu mir. „Und was habt ihr zwei heute vor?“
Ich suche nach einer Antwort. Schließlich kann ich ihr nicht sagen, dass ich hoffe, mit ihrem Enkel allein sein zu können. Um mehr zu erleben als ein paar eilige Küsse.
Ihr Gesicht verzieht sich zu einer angeekelten Grimasse und mir kommt augenblicklich der verrückte Gedanke, dass sie meine Gedanken lesen kann. Aber sie sieht in Wirklichkeit an mir vorbei zur Fensterfront. Ich wende mich um und entdecke mehrere Greybugs auf dem Glas. Sie marschieren auf der Außenseite munter umher. Reflexartig greife ich nach dem Cuttermesser, das wir jederzeit bei uns führen müssen. Jonathan hat meine Bewegung richtig gedeutet und sagt amüsiert: „Die Fenster lassen sich nicht öffnen. Du wirst sie also verschonen müssen.“
„Jetzt sind sie schon hier oben!“, klagt Mrs. Dare-Sato. „Man muss noch intensiver gegen diese Viecher vorgehen.“ Sie steht auf, läuft durch den Raum und schlägt mit der Faust gegen die Glasscheibe. Die Greybugs verharren kurz, wie sie es immer tun, wenn sie eine Erschütterung spüren und flitzen dann umso schneller nach oben. Einen Moment später sind sie aus unserem Sichtfeld verschwunden.
Die Frau des Bürgermeisters atmet hörbar ein und kehrt zu uns zurück.
„Entschuldige, Emily“, sagt sie und tätschelt mir die Wange. „Aber immer wenn ich diese widerwärtigen Käfer sehe, werde ich daran erinnert, wie isoliert Porterville ist. Völlig allein auf sich gestellt. Mein Mann arbeitet so hart dafür, dass diese Stadt überlebt.“ Mrs. Dare-Sato wischt sich eine Träne aus dem Auge.
„Aber wenn die Greybugs von Draußen kommen, sind sie dann nicht der Beweis dafür, dass dort Leben möglich ist?“, fragt Jonathan. Ich glaube aus seiner Stimme herauszuhören, dass ihn das Verhalten seiner Großmutter nervt.
„Pah!“, macht Mrs. Dare-Sato. „ Das nennst du Leben?“
„Es heißt doch, dass man sie eingehend studiert“, fährt Jonathan ungerührt fort. „Und doch hört man nie irgendein Ergebnis.“
Seine Großmutter schenkt mir Tee nach. Sie hat sich wieder vollkommen unter Kontrolle. Ihre Hände sind ganz ruhig. „Weil es nur hirnlose Krabbeltiere sind. Angefüllt mit gelben Schleim. Das ist schon alles.“
„Wäre es in Ordnung, wenn Emily und ich ins Kasino gehen?“, fragt Jonathan.
Ich bin enttäuscht. An keinem Ort der Stadt trifft man mehr Menschen als im Kasino. Sie verzocken dort ihre kostbaren Mac-Kingsley-Karten. Zum Alleinsein findet man dort keine Möglichkeit. Außerdem bin ich nach dem Kauf der Schokomints fast pleite.
„Eine wunderbare Idee!“ Mrs. Dare-Sato springt so plötzlich auf, dass sie beinahe den Tisch umgeworfen hätte. „Ich bin sofort wieder da!“
Als sie den Raum verlassen hat, zwinkert mir Jonathan zu. „Keine Sorge! Wir gehen nicht ins Kasino. Sondern an einen ganz anderen Ort. Er ist streng geheim.“
Sollte er etwa ein verborgenes Liebesnest für uns geschaffen haben? Ehe ich ihn nach Einzelheiten fragen kann, kehrt seine Großmutter zurück. Sie überreicht ihrem Enkel einen Stapel Mac-Kingsley-Karten. „Damit ihr euch auch richtig amüsieren könnt.“
Jonathan zählt geschickt die Karten durch und ich kann erkennen, dass sich neben Zehnern und Assen sogar ein Green Goblin unter ihnen befindet. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals Karten von einem solchen Wert in den Händen einer einzelnen Person gesehen zu haben.
„Danke“, sagt Jonathan nur. Er ist nicht im Geringsten beeindruckt.
„Einen Moment noch, Emily.“ Mrs. Dare-Sato zupft meinen Hemdkragen zurecht. „Und mach dir keine Gedanken um die Zeit. Die Direktorin deiner Schule ist unterrichtet worden, dass es heute später werden kann.“
Auf dem Weg zum Fahrstuhl frage ich ihn, ob er ständig solche Summen zugesteckt bekommt.
„Nein“, erwidert er. „Großmutter wollte vor dir wohl nicht knauserig erscheinen.“
„Nicht knauserig!“, entfährt es mir. „Mein Großvater hat die Ersparnisse meiner Eltern für mich aufgehoben. Wenn ich mit der Schule fertig bin, sollen mir die Karten einen guten Start ermöglichen. Ihr Wert beträgt noch nicht einmal die Hälfte von dem, was dir deine Oma mal eben zum Verjubeln im Kasino geschenkt hat.“ Ich gerate ein wenig in Rage. Weil ich keinen verwöhnten Bengel zum Freund haben möchte. Und weil mir wieder bewusst wird, wie wenig mein Großvater zum Lebensunterhalt übrig hat.
Die Aufzugtür öffnet sich. Jonathan schiebt mich sanft in den Lift. „Der Wert der Karten bedeutet mir gar nichts.“ Er will mich in den Arm nehmen und ich lasse es trotz meiner Verstimmung zu. Großvater könnte ein paar Karten gebrauchen. Aber ich bin zu stolz, um Jonathan darum zu bitten.
Jonathan flüstert in mein Ohr. „Mir war klar, dass Großmutter etwas rausrückt, wo du uns zum ersten Mal besuchst. Ich habe nur nicht mit einer solchen Summe gerechnet.“
„Was hat es mit dem geheimen Ort auf sich, von dem du gesprochen hast?“, frage ich.
„Dort können wir für die Karten Wissen kaufen. Und Wahrheit. Begleitest du mich, Emily?“
Der Aufzug stoppt. „Ich habe mir unser Zusammensein zwar etwas anders vorgestellt ... aber meinetwegen.“
Wir treten Hand in Hand in das grelle Weiß des Foyers. Die Wächter und die Empfangsdame schauen dezent zur Seite.
- 6 -
Die Dämmerung ist angebrochen.
Keine zwei Kilometer östlich des Sato-Towers ist ein Teil der Stadt wie ausgestorben. Es gibt kein Licht in den schmutzigen Fenstern. Selbst die Straßenlaternen funktionieren nicht. Aus einer dunklen Ecke dringt ein stetiges Rascheln. Es sind Greybugs. Ein ganzes Nest. Hunderte wuseln übereinander und verursachen dabei dieses Geräusch.
„Man hat die Gegend praktisch aufgegeben“, erklärt Jonathan und drängt mich zum Weitergehen. „Der Verfall dringt mittlerweile bis ins Zentrum vor.“
Am Straßenrand steht sogar noch das ausgebrannte Wrack eines Fahrzeugs. Eine Gestalt rennt gebückt über die Neal Street und taucht in den Schatten unter. Hier gefällt es mir überhaupt nicht. Jonathan muss meine Unruhe spüren. „Ich war hier schon öfters“, sagt er. „Es wird dir nichts geschehen.“
Nach ein paar Schritten verharrt er vor einem Gebäude, das so aussieht, als würde es in naher Zukunft einfach von selbst einstürzen. Im Erdgeschoss gab es mal einen Laden. Die Schaufensterscheibe wurde zerschmettert. Solche Läden waren die unpraktischen Vorläufer der Bedarfs-Center. Manche spezialisierten sich damals auf den Verkauf von Obst, Männerkleidung oder Schreibwaren. Heute bekommt man alles an einem Ort. Vorausgesetzt, dass es keine Engpässe bei der Zuteilung gibt.
Irgendwo schreit ein Baby. Das ruft bei mir blankes Entsetzen hervor. Was macht ein Baby in dieser Gegend? Es muss doch allerbeste Pflege und Versorgung erhalten. Schließlich gibt es nur sehr wenige von ihnen.
Jonathan scheint den Schrei gar nicht wahrgenommen zu haben. „Wir sind da.“ Er öffnet die Tür und verschwindet im Inneren des leerstehenden Ladens. „Kommst du?“, klingt seine Stimme aus dem Dunkel. Ich folge ihm in der Hoffnung, dass er weiß, was er tut.
Jonathan schaltet eine Taschenlampe ein. Obwohl sie nicht größer als ein Schreibstift ist, wirft sie einen fast zwei Meter großen Kreis in die Schwärze. Ein länglicher brauner Körper huscht mit seltsam bucklig-schaukelnden Bewegungen aus dem Licht. Ohne es zu wollen, stoße ich einen spitzen Schrei aus.
„Ratten“, kommentiert Jonathan. „Im Gegensatz zu den Greybugs halten sie sich schon immer in der Nähe von uns Menschen auf.“
„Parole?“, höre ich eine fremde Stimme und klammere mich an Jonathans Arm fest.
„Donuts sind ausverkauft“, erwidert Jonathan gelassen.
Ein junger Mann, nur wenig älter als wir, tritt vor und schirmt sein Gesicht mit der Hand gegen den Schein der Lampe ab. „Rein mit euch“, sagt der Fremde und gibt den Weg in einen schmalen Flur frei.
„Wo sind wir?“, frage ich. „Und was soll das mit der Parole?“
„Das war hier früher Amy’s Bakery. Wir gehen in die Backstube. Da wurde der Kuchen gebacken, um ihn dann vorn im Laden zu verkaufen. Heute ist die Backstube ein Treffpunkt für alle, denen das offizielle Porterville zu langweilig ist. Man könnte es auch als illegale Bar bezeichnen.“
„Was ist eine Bar?“, frage ich.
„Ein Ort, an dem sich die Menschen früher getroffen haben, um miteinander zu reden und Alkohol zu trinken.“
Der Flur endet vor einer Metalltür. Jonathan legt die Hand auf die Klinke. „Es ist besser, wenn niemand weiß, dass ich der Enkel des Bürgermeisters bin.“
Die ehemalige Backstube ist voller Menschen. Sie sind bis auf ein paar Ausnahmen alle ungefähr in unserem Alter. Sie hocken dicht gedrängt an Tischen, lehnen an Wänden oder hocken auf dem Boden und reden. Es wird viel gelacht. Ein mir unbekannter Geruch liegt in der Luft.
Jonathan steckt einem Typen, der direkt neben der Tür steht eine Mac-Kingsley-Karte, einen Sechser, zu. Der Türsteher führt uns quer durch den Raum zu einem freien Tisch. Die Menge teilt sich vor ihm. Er lässt das Schild mit dem Schriftzug Reserviert in der Jackentasche verschwinden.
„Du bist wohl öfters hier“, bemerke ich und sehe mich um. Niemand der Anwesenden kommt mir bekannt vor. Auffällig ist das enge Miteinander beider Geschlechter, das ansonsten in Porterville nicht gern gesehen wird. Ich frage mich, ob die zuständige Instanz von der Existenz dieses Ortes weiß.
Eine junge Frau stellt uns zwei Gläser auf den Tisch. Sie sind zur Hälfte mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt. Jonathan gibt der Frau eine Karte und nimmt einen kleinen Schluck. Ich rieche an meinem Glas und erkenne, dass der allgegenwärtige Geruch von diesem Getränk stammt.
„Was ist das?“, frage ich.
„Alkohol“, erwidert Jonathan und nimmt einen zweiten Schluck. „Den stellen sie hier selbst her.“
Ich habe nie zuvor in meinem Leben Alkohol gesehen, geschweige denn probiert. Alkohol ist in Porterville verboten. Im Unterricht hat man uns geschildert, wie er früher die Menschen verrohen ließ und krank machte.
„Ich möchte das nicht“, sage ich und schiebe das Glas von mir weg. Jonathan zuckt mit den Schultern. „Wir sind ohnehin nicht wegen diesem Zeug hier. Ich erwarte hier wichtige Informationen.“ Er senkt die Stimme. „Informationen, die mich nach Draußen bringen.“
Meint Jonathan das wirklich ernst?
„Erzähl mir von dem, was du im Olympic Regent gesehen hast.“ Er blickt mich erwartungsvoll an. Sein Mund ist nur Zentimeter vor meinem Gesicht. Ich kann nicht anders, ich küsse ihn. Lang und intensiv. Trotz all der Leute um mich herum. Irgendwie ist dieser Ort sogar stimulierend.
Ich berichte vom Einsatz der IFIS. Jonathan hört konzentriert zu und nickt. Ich zögere noch, ob ich ihm vom Zusammentreffen mit dem alten Mann namens Parker berichten soll, da stürzt er den Inhalt beider Gläser in sich hinein und springt abrupt auf. „Alles passt zusammen!“, sagt er laut.
Ich sehe fragend zu ihm auf.
„Komm, ich muss dir unbedingt noch etwas zeigen“, fordert er mich auf. Er geht mit mir zu einer improvisierten Theke, wo der Alkohol aus großen Metalltöpfen in die Gläser gefüllt wird. Ein alter Mann mit großporiger Knollennase kommandiert hier eine Gruppe Gehilfen herum. Er hat sich ein schmutziges Handtuch vor den Bauch gebunden. Jonathan hält ihm eine Achter-Karte hin. „Meine Freundin würde gern das Fundstück sehen.“
Der Mann grabscht nach der Karte. „Nicht sehen, mein Freund! Nur hören!“
Er winkt einen seiner Gehilfen herbei und gibt ihm eine kurze Anweisung. Der Bursche geleitet uns in ein Hinterzimmer, in dem der Gestank des Alkohols in der Nase beißt. Wir durchqueren zwei weitere Räume, die voller Säcke und Kisten sind und verharren schließlich vor einer Treppe, deren Stufen nach einigen Metern vor einer Gittertür enden. Ich starre in absolute Finsternis und höre nur das Geräusch von plätscherndem Wasser.
Jonathan hält mich an der Schulter fest. „Geh bitte nicht zu nahe an das Gitter. Man kann nie wissen.“
„Da geht es zu irgendwelchen Kanälen“, erklärt der junge Mann. „Vermutlich hatte die Bäckerei mal einen separaten Anschluss an die Wasserversorgung.“ Das schwache Licht, das vom oberen Treppenabsatz fällt, reicht nicht aus, um seinem Gesicht Kontur zu verleihen. Aber ich kann hören, dass er sich unwohl fühlt. „Wir haben das Gitter bisher nur einmal geöffnet, aber in Zukunft werden wir das besser ganz lassen.“
Jonathan schaltet seine Taschenlampe ein. Ihr Schein entreißt der Dunkelheit ein Stück des Betonbodens jenseits des Tores und verliert sich dann in einer gefühlten Unendlichkeit.
„Kann sein, dass es das nicht mag“, sagt der junge Mann und tritt noch einen Schritt zurück.
Er soll Recht behalten, denn aus der Schwärze dringt ein animalisches Grollen. Nicht so laut, wie das Geräusch aus dem Olympic Regent, aber doch ganz ähnlich. Ich beginne zu zittern und kann mich nicht dagegen wehren.
Jonathan schaltet die Lampe aus und legt den Arm um meine Schulter.
„Das muss reichen“, sagt unser Begleiter und eilt die Stufen hinauf. Das Grollen verebbt zu einem leisen Dröhnen.