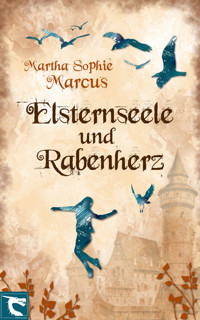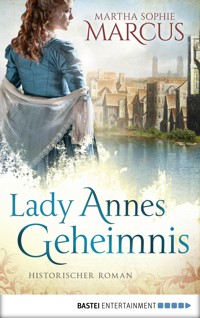5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MSMbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zu Beginn des 15.Jahrhunderts in der Mark Brandenburg: Während des Kampfes um die Burg ihres Vaters geht die kleine Tochter des Raubritters Dietrich von Quitzow im Wald verloren, wird dort zuerst von Köhlern aufgenommen, dann von einem geächteten Adligen aufgezogen. Jahre später macht sie sich allein auf den Weg, um ein Versprechen einzulösen, das sie ihrem sterbenden Ziehvater Richard gegeben hat. Auf der Suche nach dessen Sohn und ihrer eigenen Familie muss sie sich nicht nur mit Bogen und Dolch in der Hand in gefahrvollen Situationen behaupten, sondern sich immer wieder mit den strengen Normen und Verhaltensregeln auseinandersetzen, denen sie als Frau unterworfen ist. Werden ihre besonderen Fähigkeiten und ihre neugewonnenen Freunde ihr helfen, Richards letzten Wunsch zu erfüllen und ihren angestammten Platz als Adlige wieder einzunehmen? Oder muss sie sich verleugnen, um ihr Glück zu finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Table of Contents
Überblick
Impressum
Titel
Es geschah im Jahre ...
Es geschah im Jahre ... Barrierefreie Textform
Ballade
Ballade. Barrierefreie Textform
Prolog. Brandenburg, 1414
1. Der Wilde Mann, 1422
2. Die Kunst des Spielmanns
3. Eine vortreffliche Gemeinschaft
4. Richards Schwert
5. Wilkins Brüder
6. Agnes von Quitzow
7. In Friedrichs Diensten
8. Huldigungen
9. Der goldene Schleier
10. Hochzeit
11. Drachen und Wölfe
12. Abseits aller Wege
13. Im Drachental
14. Das Versteck der Hussiten
15. Heldenlohn
16. Die Krieger Gottes
17. Das neue Leben
18. Angeklagt
19. Der Wahrheitsfinder
20. Das Ordal
21. Der letzte Dienst
22. Bitterer Triumph
23. Die Reise nach Friesack
Übersichtskarte
Wichtige Personen
Historische Personen
Bedeutung der ungarischen Sätze
Glossar
Danksagung
Weitere Bücher der Autorin
Überblick
Zu Beginn des 15.Jahrhunderts in der Mark Brandenburg:
Während des Kampfes um die Burg ihres Vaters geht die kleine Tochter des Raubritters Dietrich von Quitzow im Wald verloren, wird dort zuerst von Köhlern aufgenommen, dann von einem geächteten Adligen aufgezogen.
Jahre später macht sie sich allein auf den Weg, um ein Versprechen einzulösen, das sie ihrem sterbenden Ziehvater Richard gegeben hat. Auf der Suche nach dessen Sohn und ihrer eigenen Familie muss sie sich nicht nur mit Bogen und Dolch in der Hand in gefahrvollen Situationen behaupten, sondern sich immer wieder mit den strengen Normen und Verhaltensregeln auseinandersetzen, denen sie als Frau unterworfen ist.
Werden ihre besonderen Fähigkeiten und ihre neugewonnenen Freunde ihr helfen, Richards letzten Wunsch zu erfüllen und ihren angestammten Platz als Adlige wieder einzunehmen? Oder muss sie sich verleugnen, um ihr Glück zu finden?
Über die Autorin
Martha Sophie Marcus wurde 1972 im Landkreis Schaumburg geboren und verbrachte dort ihre Kindheit zwischen zahllosen Haustieren und Büchern.
Die Autorin studierte in Hannover Germanistik, Pädagogik und Soziologie mit dem Schwerpunkt auf geschichtlichen Aspekten. Anschließend lebte sie zwei Jahre lang in Cambridge, UK, und genoss die malerische historische Kulisse.
Ihre Leidenschaft für Literatur brachte sie früh zum Schreiben. 2010 erschien mit „Herrin wider Willen“, einer Geschichte aus dem Dreißigjährigen Krieg, ihr erster historischer Roman, dem bald weitere folgten.
Heute wohnt Martha mit ihrer Familie in Lüneburg und ist Vollzeit-Schriftstellerin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.martha-sophie-marcus.de
Deutsche Erstausgabe Dezember 2012
© 2012 by Martha Sophie Marcus
Gestaltung dieser E-Book-Ausgabe: M.S.Marcus/H.Oltrogge, 2025
MSMbooks
In der Twiete 3, 21365 Adendorf
Titelillustration unter Verwendung von Motiv © fotorince, shutterstock
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung bedarf der ausschließlichen
Zustimmung der Autorin
Weitere Informationen:
www.martha-sophie-marcus.de
Martha Sophie Marcus
Die Bogenschützin
Historischer Roman
Am Ende des Buches finden Sie ein Glossar, eine Liste der Personen und eine Übersichtskarte.
Diese Neuausgabe ist all den netten und begeisterten Bogenschützinnen und -schützen gewidmet, mit denen ich in den vergangenen achtzehn Jahren wunderbare Tage auf Bogenparcours verbracht habe.
Es geschah im Jahre 1414
König Sigismund von Ungarn stellt dem Böhmen Jan Hus einen Geleitbrief aus, der ihm den sicheren Besuch des Konstanzer Konzils garantiert, wo er seine religiösen Überzeugungen darlegen möchte. Ein Jahr später wird Jan Hus in Konstanz auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.
König Sigismund wird zum römischen König gekrönt.
Markgraf Friedrich von Brandenburg aus Nürnberg unterwirft mit Waffengewalt die machthabenden märkischen Rittergeschlechter, allen voran die Brüder von Quitzow.
Markgraf Friedrichs dritter Sohn Albrecht wird geboren.
Die Quitzowschen schwuren einen Eid:
»Wir machen ihm das Land zuleid«,
Und dazu waren sie wohl bereit
Mit ihrem Ingesinde.
»Was soll der Nürrenberger Tand?
Ein Spielzeug nur in unsrer Hand,
Wir sind die Herren in diesem Land
Und wollen es beweisen.
Und regnet's Fürsten noch ein Jahr,
Das macht nicht Furcht uns und Gefahr,
Er soll uns krümmen nicht ein Haar,
Nach Hause soll er reisen.
Und kommt zu Fuss er oder Pferd,
Mit Büchse, Tartschen oder Schwert,
Uns dünkt es keinen Heller wert,
Er muss dem Land entsagen.
Und will er nicht, es tut nicht gut,
Wir stehen mutig seinem Mut,
Zehn Schlösser sind in unsrer Hut,
Er soll uns nicht verjagen.«
Aus einer zeitgenössischen Ballade von Niklas Uppschlacht, aus: Altes und Neues aus Mark Brandenburg, 1888/89: Fünf Schlösser, Quitzöwel, Kapitel 9
Prolog
Brandenburg, 1414
»KOMM doch, Kind«, flüsterte die Amme und zerrte an Hedwigs Arm. Die alte Frau atmete schwer und blickte immer wieder gehetzt zurück zu der Burg, in der sie beide zuhause gewesen waren, bevor Markgraf Friedrich seine riesige Kanone vor den Mauern in Stellung gebracht hatte.
Um den Rhin zu überqueren, der nördlich der Burg Friesack floss, schoben sie ein Ruderboot aus dem Schilf und über das Eis zum offenen Wasser. Als sie auf der anderen Seite des kleinen Flusses die steile Böschung erklommen, schlugen ihnen die nassen Rocksäume schwer um die Beine. Oben hielt die Amme inne und fasste sich an die Brust.
Diesmal war es Hedwig, die nach der Hand der alten Frau griff. »Komm, Amma. Mutter hat gesagt, wir sollen in den Wald gehen.«
Die moorige Auwiese war überfroren, sie brachen bei jedem Schritt durch die dünne Eisschicht. Erst als es ein wenig hügelan ging, wurde das Vorankommen leichter.
Die Amme sprach noch immer nicht, obwohl weit und breit niemand mehr war, der sie hätte hören können. Sie keuchte nur und stöhnte dann und wann, während sie auf den Waldrand zuhumpelte.
Hedwig hatte immer gebettelt, die Edelfrauen in den Wald begleiten zu dürfen, wenn sie im Kreis der Herren und Jäger in ihren schönen Gewändern zu einer Jagd aufbrachen. Früher, vor ihrer letzten Schwangerschaft, hatte auch ihre Mutter sich dieses Vergnügen nicht nehmen lassen. Hedwig hatte sie noch vor Augen, wie sie auf ihrem weißen Zelter saß, einen Falken auf der Hand trug und einem Herrn zulachte. Nicht Hedwigs Vater, denn der war selten auf der Burg.
Fröhliche Tage waren das gewesen, auch wenn ihre Mutter Hedwig nie erlaubt hatte, mit in den Wald zu reiten.
Nun würde sie den Wald sehen und wünschte, sie dürfte in ihr sicheres Bett zurückkehren. Finstere Schatten lauerten zwischen den Bäumen, es raschelte, und ein Stück voraus brach etwas so laut durchs Gesträuch, dass Hedwig zusammenzuckte. Ein Hirsch, sagte sie sich fest, denn erlegte Hirsche und Hindinnen brachten die Jäger am liebsten aus dem Wald heim. Sie wollte kein Feigling sein. Feiglinge wurden gepeitscht, mit Honig bestrichen und den Bienen überlassen, hatte ihr Bruder Köne ihr erzählt.
Die Amme blieb stehen und hielt sich mit einer Hand an einem Baum fest. »Ach, Kind. Dass ich das noch erleben muss.«
»Wir müssen noch weiter. Bis zur Kreuzung nach Zootzen, hat Mutter gesagt. Du weißt doch, wo das ist?«
»Ja, ja. Da lang«, gab die Amme zurück, doch sie klang merkwürdig gleichgültig.
Das Laub auf dem Boden war mit fiederigem Reif überzogen und knisterte, Hedwigs Atem wurde zu weißem Hauch. Beides erinnerte sie daran, wie gefährlich es war, in der Winterkälte draußen den Weg zu verlieren. Doch daran durfte sie nicht denken. Sie beschäftigte sich damit, die unheimlichen Schatten des Waldes in ihrer Vorstellung mit Hirschkälbern, Eichhörnchen und Vögeln zu bevölkern statt mit Wölfen und Bären, stinkenden Keilern, Drachen, Auerochsen und Wegelagerern. So bemerkte sie es zuerst nicht, als die Amme zurückblieb.
»Amma?« Sie lief zurück und kniete sich zu der alten Frau, die an einen Baum gelehnt dasaß.
Die Amme umfasste schmerzhaft fest Hedwigs Arm. »Dass du mir nicht umkehrst. Sie werden dir wehtun. Hörst du? Dass du mir nicht umkehrst.« Selbst mit ihrem letzten Atemzug formten ihre Lippen die Worte noch einmal. Nicht umkehren.
Hedwig hatte mit ihren zehn Jahren noch nicht viele Tote gesehen. Doch sie wusste, dass ein Mensch aufhörte zu atmen, wenn er starb. Weinend setzte sie sich neben die Tote ins bereifte Laub.
Es dauerte nicht lange, bis ihre Zähne vor Kälte zu klappern begannen. Sie dachte daran, dass in manchen Wintern draußen steifgefrorene Leute gefunden wurden. Da lang, hatte die Amme gesagt. Da lang musste sie gehen und die Kreuzung nach Zootzen allein finden, um dort die anderen zu treffen, denen es gelungen war, aus der belagerten Burg zu fliehen. Die würden sie am Ende zu dem Zufluchtsort bringen, an dem sie ihre Mutter, ihre Brüder und ihre Schwester wiederträfe. Und vielleicht ihren starken, mächtigen Vater, der stolz auf sie sein würde, weil sie es allein geschafft hätte.
Benommen vor Kummer und Kälte lief sie weiter. Es wurde schwierig mit dem »Da lang«, denn dichtes Unterholz und moorige Lichtungen zwangen sie zu Umwegen.
In den noch dunklen Morgenstunden gestand sie sich schließlich ein, dass sie weder wusste, wohin sie gehen musste, noch, woher sie gekommen war.
Am anderen Ufer eines Waldsees sah sie Rauchschwaden aufsteigen. Der Rauch war seltsam hell, so weiß wie ihr Atemhauch, und ein Feuerschein war nicht zu sehen. Aber wo Rauch war, musste auch Wärme sein, deshalb umwanderte sie den See. Hätte es nicht nach schwelendem Holz gerochen, hätte sie nun vielleicht wirklich gedacht, dass es sich um Atem handelte, denn die Schwaden stiegen von drei großen Hügeln auf, die in der Dunkelheit dalagen wie riesige, kauernde Tiere. Drei Drachen, die zusammengerollt hier im Wald schliefen.
Hedwig spürte die Hitze, die von ihnen ausging. An einer besonders warmen Stelle des einen ließ sie sich nieder und schmiegte sich an seine Wölbung, um auszuruhen. Es war so angenehm, dass sie sich die nassen Schuhe auszog und ihre Füße wärmte, bis das Leben in die Zehen zurückkehrte. Der Schmerz und der Gedanke an die Amme trieben ihr wieder die Tränen in die Augen.
Als der Köhler zurückkehrte, um seine Meiler ein letztes Mal in dieser Nacht zu überprüfen, sah er nicht das schlafende Kind zuerst, sondern die kleinen, ruinierten, doch einst kostbaren Lederschuhe, die am Fuße des ersten Meilers lagen. Gerade dieser hatte ihm in den Vortagen viel Ärger gemacht. Erst wollte sich die Schwelung darin nicht gleichmäßig ausbreiten, sodass er ständig Luftlöcher hatte stechen und wieder verschließen müssen. Dann hatte der blaue Rauch verraten, dass es im Inneren des Holzhaufens brannte. Verhext hatte er das Ding genannt, und nun stand er da und starrte auf das Häufchen Mensch, das aus ihm herausgewachsen zu sein schien. Wenn es denn ein Mensch war, und keine Fee oder Schlimmeres. Teure Schuhe hatte es mitgebracht, und das hellblaue Kleid, das unter dem einfachen grauen Wollmantel hervorlugte, war nicht weniger fein.
Was bekam ein armer Mann, der sechs Mäuler zu stopfen hatte, dafür, wenn er der Burgherrin von Friesack ihr Kind zurückbrachte? Mehr jedenfalls, als er in einem Jahr für seine Köhlerei erhielt, so viel war gewiss.
»Holla, du«, sagte er und stieß das Kind mit dem Störhaken an, bis es aus dem Schlaf hochfuhr.
Hedwig erzählte dem Schwarzen Mann, dass ihre Mutter nicht mehr auf Friesack sei, dennoch ging er nachsehen und ließ sie bei seiner Frau und seinen Kindern in der Hütte. Das spelzige Brot, das die Frau ihr reichte, brachte sie kaum herunter, aber immerhin fühlte sie sich sicher. Das änderte sich, als der Mann wiederkehrte. Sie begrüßte ihn aufgeregt, woraufhin er sie wütend ohrfeigte, nicht anders, als er seine Frau und seine Kinder schlug. »Unnütz«, schrie der Köhler sie an. »Unnütz bist du!« Und er schlug sie noch einmal, so hart, dass sie stürzte.
Von da an sprach Hedwig kein Wort mehr mit ihm, und auch keines mit seiner Frau oder seinen Kindern, die sie nun ebenso unfreundlich und grob behandelten wie er. Sie sprach nicht, als sie statt ihres Kleides Kohlensäcke anziehen musste und ihr Kleid auf dem Balken verwahrt wurde. Nicht, als die Kinder hohnlachend an ihren blonden Zöpfen zogen und sie mit Ruß einrieben, weil ihre Haut so weiß war. Nicht, als sie gezwungen wurde, die gleiche harte Arbeit zu tun wie alle, obwohl sie zierlicher war und unter den Wassereimern, die sie zu den Meilern schleppen musste, beinah zusammenbrach. Sie sprach nicht und sie weinte nicht, denn so jung sie war, kannte sie ihren Stand. Das Gesindel würde seine Strafe erhalten, wenn die Männer ihres Vaters sie fänden und befreiten.
Der Taumonat Hornung verging, aber der Winter zeigte sich mit Schneestürmen und scharfem Frost noch auf dem Höhepunkt seiner Macht. Niemand erschien, um nach Hedwig zu fragen, die wie die anderen Kinder im hohen Schnee dabei helfen musste, den ausgeschwelten Meiler abzubauen und die Kohle in Säcke zu schaufeln.
Eines Tages erwachte sie in ihrem Winkel der Laubschüttung, auf der die Kinder ihr Ruhelager hatten, und schrie auf. Ein Monster stand über sie gebeugt und gaffte sie mit glänzenden Augen an. Es ging auf zwei Beinen und war doch von oben bis unten mit braunem, zottigem Fell bedeckt. Hedwig wusste gleich, dass es sich um ein Wesen handelte, vor dem sie immer gewarnt worden war: Es war ein Wilder Mann, einer, der im Wald wie ein Tier lebte und dabei vergessen hatte, dass er einmal ein Mensch gewesen war. Er hatte eine so gewaltige Mähne um seinen Kopf, dass außer den Augen und der Nasenspitze von seinem Gesicht nichts mehr zu erkennen war. In der Hand trug er einen knorrigen, langen Ast.
Sie holte tief Luft. »Guter Mann«, sagte sie in dem beruhigenden Ton, in dem ihr großer Bruder mit seinem Lieblingshund sprach. »Sei brav und tu mir nichts.«
Der Mann sah sie verdutzt an, dann gab er einen Laut von sich, der belustigt klang.
Hedwig setzte sich auf. »So ist es fein. Kannst du auch sprechen?«
Wieder staunte er mit großen Augen, dann schüttelte er das wüste Haupt, wandte sich ab und ging zum Köhler hinüber, der steif mit dem Rücken zur Wand dastand und ihn beobachtete.
»Du bist ein Schwein, Köhler. Ich nehm sie mit«, sagte der Wilde Mann.
Der Köhler sah aus, als wolle er widersprechen, kniff jedoch im letzten Moment die Lippen zusammen, als der Wilde Mann sich vor ihm ganz aufrichtete. »Wo ist ihr Zeug?«
Kurz darauf verließ Hedwig mit dem Fremden die Köhlerhütte. Kurz hatte sie Angst gehabt, doch als er ihr zunickte und ihr wortlos die Hand hinhielt, war sie auf einmal sicher, dass es ihr bei ihm besser gehen würde als beim Köhler.
Voller Vertrauen stapfte sie an seiner Hand weiter in den geheimnisvollen, tiefen Wald hinein, in den sich sonst kein Mensch jemals verlief.
1
Der Wilde Mann, 1422
DER Wald duftete nach jungen Knospen, feuchtem Humus, den letzten blühenden Buschwindröschen und den ersten Veilchen. Nach dem langen und harten Winter war jeder Sonnenstrahl ein willkommenes Himmelsgeschenk. Hedwig spürte dankbar die Wärme auf ihrem Gesicht, ließ jedoch ihre angespannte Aufmerksamkeit nicht sinken. Seit drei Stunden saß sie auf dem hohen Ast einer günstig gewachsenen alten Eiche und beobachtete die Lichtung unter sich. Ebenso lange hielt sie bereits ihren schussbereiten Bogen in der Hand. Sie dachte nicht daran, aufzugeben. Er würde ganz sicher kommen, so wie er jeden Tag kam. Nichts würde ihm verraten, dass sie ihm auflauerte. Die Tage, in denen sie sich durch ihr Ungeschick verraten hätte, lagen hinter ihr. Acht Jahre lang hatte sie geübt, ein Teil des Waldes zu sein.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung wackelte die Krone eines Holunderbusches, einige leichte Schläge gegen Holz erklangen, und eine Birke zitterte. Hedwig hob langsam den Bogen, spannte ihn ein wenig. Nur keine schnelle Bewegung, nur kein aufgeregter Herzschlag, kein hastiger Atemzug.
Nun trat er zwischen den Büschen hervor auf die Lichtung. Er war kein Prachtbock, aber ausgewachsen. Tagelang Fleisch. Hedwig verbot sich, daran zu denken. Sie durfte nicht schlucken, ihr Magen durfte nicht knurren und ihre Gier ihr nicht den Schuss verderben.
Der Bock kam weiter heran, mit den stockenden Schritten eines Tieres, das auf der Hut war. Er hob den Kopf und sicherte, Hedwig hielt die Luft an und regte sich nicht. Endlich begann er zu äsen, die Flanke zu ihr. Sie sah die Stelle, an der sie ihn treffen würde, und zog die Sehne mit einer für ihn unsichtbaren, gleichmäßigen Bewegung bis zur Wange. Noch während ihr Pfeil in der Luft war, dankte sie dem Rehbock für das Geschenk seines Lebens. Seine Kraft würde ihre und die ihres Ziehvaters stärken.
Hedwig war klug genug, keine Spuren zu hinterlassen, als sie den toten Rehbock auf ihren Schultern zu der kleinen Einsiedlerhütte trug, in der sie mit ihrem geliebten »Wilden Mann« wohnte. Sie wusste, dass ihre Jagd Diebstahl war, auch wenn es hier in der Einsamkeit schien, als wäre es gleichgültig, wem das Wild gehörte.
Richards Hütte hatte sich äußerlich nur wenig verändert, seit er Hedwig als Kind dorthin mitgenommen hatte. Sie war zwischen Bäumen und Gesträuch kaum zu sehen, so bemoost und mit Efeu bewachsen waren die Holzwände und das Dach.
Hedwig war noch nicht in Sichtweite der Behausung, da kam ihr der Hund entgegen. Der braune Jagdhund sprang aufgeregt an ihr hoch und untersuchte den Rehbock, der ihr inzwischen schmerzhaft auf die Schultern drückte. »Aus, Tristan! Du bekommst schon deinen Teil. Wo ist Richard?«
Tristan ließ von ihr ab und lief voraus bis zu seinem Herrn, der neben der Hüttentür stand, sich mit einer Hand an der Wand abstützte und ihr entgegenblickte.
Es gab Hedwig einen Stich ins Herz, ihn so zu sehen. Noch im Herbst war er ihr in seiner Kraft und Geschicklichkeit unbezwingbar vorgekommen. Im Winter hatte er jedoch angefangen zu husten, und seitdem hatte er sich noch immer nicht erholt. Seit damals, als sie zu ihm gekommen war, hatte er sich regelmäßig seine Haare und seinen Bart gestutzt. Deshalb war deutlich zu sehen, wie hager er durch seine Krankheit geworden war. Als er sie sah, formte er die Lippen kurz zu seinem üblichen schwachen Lächeln, das wohl nur sie als solches erkannt hätte. Ihr genügte es.
»Fleisch, Richard. Nun können wir endlich den Hund wieder anständig füttern«, sagte sie, und er belohnte sie mit einem weiteren Lächeln. Es war ein alter Scherz zwischen ihnen, dass sie nur jagten, um Tristan füttern zu können, den sie gemeinsam aufgezogen hatten.
Obwohl sie den Rehbock gern abgeworfen hätte, tat sie es nicht. Bevor Richard in Versuchung kommen konnte, ihn ihr abzunehmen, hatte sie ihn zu dem Baum gebracht, wo sie ihre Beute zum Schutz vor den Wölfen und Füchsen vorerst aufhängten. Sogar das Tier dort hochzuziehen, schaffte sie allein. Fest entschlossen wollte sie es diesmal auch übernehmen, es aus der Decke zu schlagen und aufzubrechen, doch bei dem Gedanken daran entkam ihr ein Seufzen.
»Geh, Zaunkönigin, wasch dich«, sagte Richard mit seiner warmen Stimme. Schwach, wie er auf den Beinen war, stand er doch längst hinter ihr.
Von ihren Gefühlen überwältigt, wandte sie sich um, umarmte ihn und drückte ihr Gesicht an seine Brust. Wortlos ließ er sie eine Weile gewähren, dann schob er sie auf Armeslänge von sich und musterte sie. Mit einem Kopfnicken wies er sie darauf hin, dass sie ihren Rock noch geschürzt trug. Rasch berichtigte sie den Fehler und sah ihrem Ziehvater danach in die Augen. »Richard, –«
Er schüttelte langsam und nachdrücklich den Kopf. Mehr musste er nicht sagen. Sie seufzte noch einmal tief und ging bedrückt zum Bach. Dort wusch sie sich Gesicht und Hände und kämmte ihr Haar, bis sie es neu zu der blonden Krone einflechten konnte, von der sie wusste, dass Richard sie besonders gern an ihr sah.
Sie tat es nicht deshalb, weil sie hoffte, ihn nachgiebig zu stimmen. Sein Entschluss stand fest. Sobald er ganz genesen war, wollte er mit ihr auf die Suche nach ihrer Familie gehen, obwohl er selbst den Gedanken daran hasste. Nur aus Sorge um sie wollte er es auf sich nehmen, seinen Wald zu verlassen. Nur weil seine Krankheit ihm Angst davor gemacht hatte, dass er sterben und sie ohne ihn in der Wildnis zurückbleiben könnte. Und so wenig sie daran denken mochte, dass er sterben könnte, wusste sie doch, dass er nicht unrecht mit seiner Sorge hatte. Im Sommer hätte sie allein im Wald leben können, doch die Vorstellung, einen Winter überstehen zu müssen, in dem niemand ihr mit dem Feuerholz, dem Heranschaffen von Vorräten wie Korn und Salz, dem Heizen und Kochen half und niemand ein Wort mit ihr sprach, machte ihr selbst Angst.
Während Richard draußen mit dem Reh beschäftigt war, bereitete Hedwig in der Hütte einen Brei aus Emmerschrot mit den letzten getrockneten Pilzen des Vorjahres zu. Später, als er zu ihr hereinkam, briet sie noch ein wenig von dem frischen Fleisch als Dreingabe. Richard aß mit Lust, und Hedwig war zwischen Freude und Wehmut hin- und hergerissen, weil sie glaubte, dass er die Krankheit endgültig besiegt hatte.
Zu ihrem Kummer wurde sie noch in derselben Nacht eines Besseren belehrt, denn das Fieber kehrte zurück. Er hustete stark, seine Atemzüge rasselten, und am nächsten Morgen war er zu matt, um sein Lager zu verlassen.
Hedwig schürte das Feuer, brühte die letzten Krümel Fenchel, Weidenrinde und Honig zu einem Sud und reichte ihn Richard. Anschließend fütterte sie erst Tristan und dann Isolde, das Habichtweibchen, das auf seiner Jule in der Ecke saß, wo auch der Hund seinen Schlafplatz hatte. Richard sah ihr schweigend zu, bis sie hinausgehen wollte, um den Rest der alltäglichen Arbeiten in Angriff zu nehmen. Seine Stimme war leise und heiser, als er sie aufhielt. »Warte. Komm her zu mir.«
Hedwig gehorchte und setzte sich auf den Rand seiner Bettstatt. Er überraschte sie damit, dass er ihre Hand ergriff, denn seit sie kein Kind mehr war, berührte er sie kaum noch.
»Zaunkönigin, es mag sein, dass wir beide diesen Sommer am Ende doch nicht gemeinsam auf die Suche nach deiner Familie gehen.«
Hedwig wusste, worauf er hinauswollte, und schüttelte den Kopf. »Ach was, nun glaub nicht wieder das Schlimmste. Einige Tage in der Sonne, und du bist gesund.«
»Ich weiß, dass du es nicht hören willst. Aber du musst. Du musst mir versprechen, dass du unseren Wald verlässt, wenn ich nicht mehr bin. Und –«
Hedwig versuchte, ihm ihre Hand zu entziehen, doch er hielt sie fest. Bei aller Schwäche war er noch immer stärker als sie. »Du wirst gesund«, beharrte sie.
»Vielleicht. Aber wenn nicht, dann musst du mir meine letzten Wünsche erfüllen. Denn außer dir gibt es niemanden, der es tun könnte. Ich bin in der Nacht zu dem Schluss gekommen, dass der Herrgott dich mir auch deshalb geschickt hat. Gibst du mir also dein Wort?«
»Richard, sie haben mich nie gesucht. Vielleicht sind sie alle tot. Niemand würde mich erkennen. Was sollte ich den Menschen sagen?«
»Du wirst ihnen sagen, wer du bist. Und es wird sich jemand finden, der für dich sorgt. Ein Bruder, ein Onkel, ein Schwager. Es ist dein Recht, und du sollst es einfordern. Aber das ist nicht alles, worum ich dich bitte. Du sollst auch etwas für mich allein tun. Weißt du noch, wie oft du als Kind gefragt hast, warum ich hier im Wald lebe?«
»Weil du mit meinem Vater und seinen Freunden gestritten hast und sie dich deshalb verstoßen haben.«
»Ja. Obgleich der Streit nicht deinen Vater betraf. Er hat nur Recht gesprochen, so gut er es vermochte.«
Ein Hustenanfall unterbrach seine Rede, und Hedwig half ihm, sich aufzusetzen, damit er leichter Luft holen konnte. Es dauerte lange, bis er sich, erschöpft von Schmerz und Atemnot, wieder auf sein Kissen sinken ließ.
»Lass uns später weiterreden«, sagte sie.
Diesmal umfasste er ihren Unterarm. »Nein. Hör mir zu. Noch einmal finde ich nicht den Mut. Ich habe einen Sohn, der mich nicht kennt. Den sollst du finden.«
Er atmete tief, schloss die Augen und ließ damit Hedwig Zeit, ihrer Verblüffung Herr zu werden. Ihre Gedanken und Gefühle überschlugen sich. Sogar eine Prise Eifersucht mischte sich in ihre Aufregung. »Wie alt ist dein Sohn? Wo ist er? Warum … Was soll ich tun, wenn ich ihn gefunden habe?«
Richard lächelte sein zartes Lächeln, ohne die Augen zu öffnen. »Das ist mein Mädchen! Du wirst ihn finden. Ich danke dir schon jetzt, Zaunkönigin. Er denkt, er wäre Hans von Torgaus Sohn. Sein Name ist Wilkin. Bring ihm mein Schwert und sieh nach, ob es ihm gut geht. Von mir erzählen musst du ihm nicht.«
»Das verstehe ich nicht. Warum kennt er dich nicht?«
»Weil seine Mutter eine verdorbene Schlange war. Ihretwegen wollte ich nicht mehr unter Menschen leben. Ihr fiel spät ein, dass sie einen von Torgau wollte und keinen von Restorf. Da trug sie schon mein Kind unter dem Herzen. Damit ich ihr nicht ihre Heirat verderben konnte, hat sie mich geschmäht und verleumdet. Begegnest du diesem Weib, trau ihm nicht.«
Wieder übermannte ihn der Husten, schüttelte ihn bis halb zur Ohnmacht, bevor er wieder sprechen konnte. Eine ganze Stunde behielt er Hedwig auf diese Art bei sich, zwischen Husten und seinen Erinnerungen. Stück für Stück erfuhr sie, was er ihr nie zuvor preisgegeben hatte. Anschließend fiel er in einen unruhigen Schlaf, und sie verließ verwirrt die Hütte. Er mochte glauben, dass sie nun alles Nötige wusste, doch sie hatte nur die Hälfte verstanden. Wie kam es, dass eine Frau sein Kind empfangen hatte, die nicht sein Eheweib war? Hatte Richard nicht immer gesagt, zwei Menschen müssten heiraten, um Kinder zu bekommen? Selbst Tristan und Isolde aus dem alten Pergament, mit dessen Hilfe Richard sie das Lesen gelehrt hatte, hatten doch keine Kinder bekommen, obwohl sie sich liebten.
Danach fragen konnte sie Richard nicht, denn was zwischen Mann und Weib geschah, darüber hatte er mit ihr nie sprechen wollen. Gerade jetzt würde sie ihn damit nicht belästigen.
Ohnehin dauerte es nicht lange, bis sie ihre Fragen vergaß, denn Richard wurde so krank, dass sie bald nur noch Gedanken für seine Pflege und für Gebete übrig hatte, in denen sie um sein Leben flehte.
Beides reichte nicht aus, um ihn zu retten. Stunden vor seinem Tod kam er zu sich und sprach seine letzten Worte. »Zaunkönigin,« sagte er, »nimm den Hund und das Ross, und lass den Habicht zurück. Ich werde bei dir sein.«
Richard zu begraben, wurde die härteste Arbeit, die Hedwig je geleistet hatte. Es war nicht einfach, zwischen den Wurzeln alter Bäume ein Grab auszuheben, wie sie es sich vorstellte. Noch schwerer fiel es ihr, den einzigen Menschen, den sie kannte und liebte, mit Erde zu bedecken, um ihn niemals wiederzusehen. Sie hatte nicht aufgehört zu weinen, seit sein gequälter Atem verstummt war.
Und danach, als sie glaubte, sich gefasst zu haben und bereit für ihren großen Aufbruch war, kamen ihr erneut die Tränen, weil sie schon den geringsten seiner letzten Wünsche nicht erfüllen konnte. Isolde, der Habicht, den er zur Beizjagd abgerichtet hatte, wollte sich nicht freigeben lassen. Der Greifvogel folgte Hedwig in den Baumkronen und ließ sich bei jeder Rast bettelnd in ihrer Nähe nieder, den ganzen Weg bis zu ihrem ersten Ziel, dem Kloster.
Der Abt des Zisterzienserklosters St. Michaelis, dem Richard vor langer Zeit all seine Habe überlassen hatte, hielt ein Pferd bereit, das ein Nachfahr seines Streitrosses war. Das Kloster hatte das Pferd für die tägliche Arbeit nutzen dürfen, bis Richard kommen und es zurückverlangen würde. Hedwig hoffte, dass der Abt den Hengst nun stattdessen ihr geben würde und dass ihre wenigen Reitstunden ausgereicht hatten, um mit ihm zurechtzukommen. Nur wenige Male hatte Richard vom Kloster ein Reitpferd ausgeborgt, um ihr das Nötigste beizubringen.
St. Michaelis lag auf einer sich allmählich ausweitenden Lichtung und war nicht mehr als ein Bauernhof mit einer winzigen Kapelle. Sechs Mönche lebten und beteten dort, rodeten Wald und legten Felder an, um den Reichtum ihrer Kirche zu mehren und dem Allmächtigen damit wohlgefällig zu sein. Einer von ihnen zog eben Wasser aus dem Brunnen, als Hedwig die Lichtung betrat. Zu ihrer Erleichterung war das Habichtweibchen endlich ein wenig zurückgeblieben. Richard hatte ihr eingeschärft, dass es nicht jedem zustand, einen Beizvogel zu besitzen. So gern Hedwig Isolde auch behalten hätte, konnte das Tier doch Schwierigkeiten bereiten.
Der Mann beim Brunnen war nicht Abt Claudius, sondern einer der fünf Mönche, denen sie zuvor nie begegnet war. Ihr schlug das Herz bis zum Hals, als sie sich ihm näherte. Es war ihr in den vielen Jahren, die sie allein mit Richard verbracht hatte, fremd geworden, auf Menschen zuzugehen. Doch immerhin hatte ihr Ziehvater Wert darauf gelegt, dass sie nicht vergaß, wie sie sich Fremden gegenüber zu benehmen hatte.
Tapfer holte sie Luft und sprach den Mönch an, bevor er sich zu ihr umgewandt hatte. »Gott zum Gruß, Bruder. Ich wünsche Euch einen gesegneten Tag.«
Der Mann ließ die Brunnenkurbel los, fuhr herum, dass seine braune Kutte wirbelte, und ergriff mit beiden Händen das Joch für die Wassereimer wie eine Waffe. »Weiche von mir!«, sagte er.
Verwirrt wollte Hedwig ihn beschwichtigen, doch ihr Hund, der sie bisher folgsam und so gut wie unsichtbar begleitet hatte, fasste die Geste des Mönches als Bedrohung auf. Mit gesträubtem Fell und gebleckten Zähnen baute er sich vor ihr auf und knurrte den Mann an.
Dieser blieb mit seinem Joch in Händen standfest, riss jedoch die Augen weit auf. »Verschwinde!«, schrie er schrill.
Hedwig schüttelte verständnislos den Kopf. Warum fürchtete sich der Mann vor ihr? Sie hatte sich Mühe mit ihrer äußeren Erscheinung gegeben, so wie Richard es sie gelehrt hatte. Natürlich trug sie viel Gepäck, doch ihr Haar war aufgesteckt und mit der Kapuze ihrer leichten Gugel bedeckt, ihr gutes, graues Überkleid hatte keine Flecken, und der weite Rock bedeckte ihre Beine bis zu den Fuchsfellstiefeln. Nicht einmal barfuß war sie gegangen, wie sie es sonst bei diesem Wetter getan hätte. War es am Ende nur ihr Hund, der ihm Angst machte? Hedwig wusste, dass Tristan den Mönch nicht angreifen würde, solange dieser nicht vorher angriff. Es sei denn, sie befahl es ihm.
»Ich möchte zu Abt Claudius. Könnt Ihr ihn holen? Der Hund wird Euch nichts tun«, sagte sie.
Eine Antwort gab er ihr nicht, nicht einmal ein Nicken, aber immerhin setzte er sich in Bewegung. Ohne den Blick von ihr zu lösen, ging er mit erhobenem Joch rückwärts zur Kapelle und flüchtete sich hinein. Hedwig hörte ihn darin mit jemandem sprechen, und eine Weile darauf kam Abt Claudius aus der Tür.
Er sah nicht erfreut aus, als er sie sah, doch auch nicht ängstlich. In einigen Schritten Entfernung von ihr und dem Hund verneigte er sich. »Gottes Segen. Ist Euer Ziehvater nicht wohl, edle Jungfer?«
Hedwig wappnete sich, um mit fester Stimme zu sprechen. »Er ist gestorben. Und mich hat er auf eine Reise geschickt, für die ich Eure Hilfe brauche. Ich hoffe, Ihr werdet sie mir gewähren, Abt Claudius.«
Falls der Abt über die Nachricht von Richards Tod betroffen war, zeigte er es nicht. Er nickte würdevoll.
»So wie ich es mit Herrn von Restorf besprochen habe. Obgleich ich denke, dass Ihr mit dem Pferd … Nun, darüber müsst Ihr selbst entscheiden. Ich habe Anweisungen, was ich Euch auszuhändigen habe, und vertraue darauf, dass Ihr Euch, wenn Ihr zu Eurem angestammten Recht und Wohlstand gekommen seid, unserer bescheidenen Abtei erinnern werdet.«
Hedwig war sich nicht sicher, dass sie auch nur den Weg nach Friesack finden würde, geschweige denn ihr angestammtes Recht, doch das wollte sie dem Abt nicht eingestehen.
»Das werde ich gewiss.«
Der Abt ließ ein mageres schwarzes Pferd mit unansehnlichem Ramskopf vom Acker holen, wo es vor dem Pflug gearbeitet hatte, und zäumte es eigenhändig mit einem schäbigen Kopfstück und einem einfachen alten Sattel auf. »Ihr tut besser daran, wenn Ihr das Tier sparsam füttert, denn sonst wird es zu lebhaft. Lasst es zudem ruhig aussehen wie einen Klepper, damit es die Armen weniger in Versuchung führt.«
Hedwig nickte einsichtig, obwohl sie schon wieder unsicher war. Wie sah ein Klepper aus, im Gegensatz zu einem Ross?
Nun, vielleicht genügte es, wenn sie das Ross »Klepper« nannte und es nicht allzu sauber putzte.
*
Einige Stunden, nachdem sie in die Richtung, die der Abt ihr wies, aus dem Kloster aufgebrochen war, nannte sie den hässlichen Rapphengst voller Überzeugung »Klepper«. Er schien ihr das trägste Wesen auf Erden zu sein, versuchte, bei jedem Grashalm anzuhalten und hob kaum die Hufe, sodass er auf den Waldpfaden immer wieder über Wurzeln stolperte. Als sie für die Nacht ihr Lager aufschlug, blieb er mit hängendem Kopf bei dem Baum stehen, an dem sie ihn angebunden hatte.
Es war das erste Mal, dass sie eine ganze Nacht allein im Wald verbrachte, ohne ein Dach über dem Kopf zu haben, und sie legte ihr Lager mit Bedacht an. Der Dunkelheit und den meisten Gefahren der Wildnis war sie im Laufe der Jahre begegnet, und nicht immer war Richard an ihrer Seite gewesen. Sie fürchtete sich nicht, doch sie war vorsichtig. Nicht genug, um auf einem Baum zu schlafen, doch genug, um einen auszuwählen, auf den sie sich flüchten konnte, wenn Wölfe oder Wildschweine ihr zu nahe kamen. Stets einen Bogen schussbereit in Reichweite zu halten, war sie ohnehin gewöhnt. Seit sie eigene Bögen besaß, nahm sie jeden Abend von einem die Sehne ab, damit sich das Holz erholen konnte, und spannte dafür einen anderen auf. Am Morgen wechselte sie sie wieder aus. Ebenso hatte Richard es gemacht. Zur Sicherheit spannte sie an diesem Abend einen zweiten ihrer Bögen und hängte ihn mit ihrem Köcher und einigen Pfeilen in ihrem Fluchtbaum auf. Isolde verstand die vertrauten Gegenstände als Markierung ihres neuen Schlafplatzes und ließ sich auf einem Ast in der Nähe nieder.
Die Mainacht war warm, und Hedwig fiel bald in einen leichten Schlaf, der nur vom Seufzen des an ihre Beine geschmiegten Hundes, dem Schnauben ihres Pferdes und den raschelnden Tritten harmloser Tiere gestört wurde.
Erst als die Sonne bereits aufgegangen war und Hedwig eben den Klepper wieder bepackt hatte, hörte sie Laute, die sie beunruhigten. Seit sieben Jahren hatte sie nichts Ähnliches gehört. In weiter Ferne ertönten das Geklingel von Schellen und der Gesang eines Mannes.
Eilig zog sie das widerwillige Pferd zurück auf den Pfad, der sie vom Kloster bis zur Straße nach Friesack führen sollte. Es stellte sich heraus, dass sie der Straße näher gewesen war, als sie geglaubt hatte. Bald konnte sie den breiten Weg sehen, verharrte jedoch in der Deckung hoher Sträucher, weil der Gesang und die Schellen rasch lauter wurden und sie die unbekannten Menschen lieber vor sich als hinter sich wissen wollte. Neugierig spähte sie durch die Zweige.
Ein farbenfroh gekleideter Mann und eine zierliche Frau auf Pferden führten jeder einen beladenen, mit Schellen behängten Maulesel als Lasttier mit sich. Der Mann sang auf Latein, das Hedwig nur in kleinen Fetzen verstand. Immer wieder brach er ab, sprach ein paar Worte mit der Frau und wiederholte dann einen Vers oder eine Strophe. Die beiden waren so beschäftigt mit sich, dass sie zu Hedwigs Erleichterung auf nichts anderes achteten als auf den Weg.
Sie waren schon vorübergezogen, da schüttelte Hedwigs Pferd ihre Hand von seiner Nüster und wieherte den Fremden nach. Hedwig zuckte ebenso zusammen wie die beiden Leute auf dem Weg. Der Sänger hatte bereits ein langes Messer gezogen, bevor sie sich von ihrem Schreck erholt hatte.
»Es ist schon gut, das bin nur ich«, rief sie schnell. Da ihr nun nichts anderes übrig blieb, beeilte sie sich, Bogen und Pfeil in die Hand zu nehmen und aus ihrem Versteck auf die Straße zu gelangen. »Dummer Klepper«, flüsterte sie dabei.
Der Sänger und die Frau staunten sie mit offenen Mündern an, als sie ihnen mit Pferd und Hund auf dem Weg gegenübertrat. Der Mann ließ sein Messer sinken.
»Eine Fee«, entfuhr es ihm. »Habe ich nicht gesagt, dass dies ein wundersamer Wald ist, Irina? Holde, hohe Frau, ich hoffe, Ihr wollt uns nichts Böses antun. Wir sind nur harmlose Spielleute und wollten Euren Frieden nicht stören.«
Die Irina genannte, hübsche Frau warf ihm einen Blick zu, der ihn als Narren bezichtigte, starrte Hedwig dann jedoch selbst weiter an, als gleiche sie einem Geschöpf aus einer anderen Welt.
Ausgerechnet jetzt erinnerte sich auch noch der Klepper daran, dass er von feurigem Geblüt war. Mit einem Ruck riss er sich los und strebte zu Irinas Schimmelstute hinüber. Im Nu bildete sich ein Pulk aus Pferden und Mauleseln, und die Stute quiekte schrill.
»Adam! Halt ihn mir vom Leib«, schrie die Frau und versuchte vergeblich, Hedwigs aufdringlichen Hengst von ihrem Reittier abzuwehren.
Erschrocken stürzte Hedwig sich ins Getümmel, doch der Hengst wich ihr aus, und sie erwischte seine Zügel nicht. Stattdessen trat ihr ein Maulesel auf den Fuß, und sie hatte Mühe, weitere Verletzungen zu vermeiden.
Endlich hatte Adam, der Sänger, von seinem Pferd aus den Hengst erwischt und brachte ihn ihr.
Sie nahm die Zügel an sich. »Ich danke Euch, mein Herr.«
Die Augen des Sängers funkelten belustigt. »Es ist mir eine Ehre. Adam von Himmelsfels ist mein Name, und jenes gute Weib ist meine Gemahlin. Wir sind unterwegs nach Friesack, um dort unsere Künste darzubieten. Betrachtet mich als Euren untergebenen Diener, falls Ihr meiner Hilfe bedürft.«
Hedwig hatte zwar das Gefühl, dass der Anfang ihrer Bekanntschaft mit dem Sängerpaar gründlich missraten war, wollte jedoch den Vorteil nutzen, jemandem begegnet zu sein, der sich offenbar in der Gegend auskannte.
»Ich muss ebenfalls nach Friesack. Könntet Ihr mir den Weg weisen?«
Adam von Himmelsfels musterte sie und betrachtete dann mit neugierigem Blick ihr Pferd.
»Wenn es Euch angenehm ist, dann begleitet uns. So verfehlt Ihr den Weg nicht.«
»Adam!«, warf seine Frau ein.
»Was, mein Turteltäubchen?«
»Du bist ein unbedachter Holzkopf. Die Jungfer besitzt ein schnelles Pferd und hat keinen lahmen Maulesel zu führen. Sie wird sich nicht mit uns belasten wollen.«
Hedwig seufzte und machte sich daran, auf ihr Pferd zu steigen, was sich mit dem umgehängten Pfeilköcher, den Bögen und Richards Schwert, die sie auf den Rücken geschnürt trug, stets etwas mühsam gestaltete. Der Hengst machte es ihr nicht leichter, sondern trat unruhig von einem Bein auf das andere. »Ein ungeheuerlicher Klepper ist dieses Tier. Ich werde nicht schneller vorankommen als Ihr und bin dankbar dafür, mich Euch anschließen zu dürfen.«
Adam konnte den Blick kaum von ihrem Pferd losreißen.
»Nun, schlecht in Form ist er, und er hat gewiss den hässlichsten Ramskopf, den ich je gesehen habe, aber ein Klepper? Nein, verehrte Jungfer, das ist er nicht. Etwas Pflege, gutes Futter, und dann … Wenn Ihr ihn verkaufen wollt, will ich Euch gern behilflich sein, einen –«
Hedwig sah den Anflug von Gier in seiner Miene und beschloss, auf der Hut zu sein.
»Nein, verkaufen will ich ihn vorerst nicht. Lasst uns aufbrechen.«
Mit einer Handbewegung und einem leisen Befehl rief sie Tristan zu sich, und die kleine Reisegesellschaft setzte ihren Weg fort. Zu Hedwigs Erleichterung passte sich der Klepper dem Schritt der anderen an und benahm sich anständig, solange er an der Seite von Irinas Stute gehen durfte.
Adam war es offensichtlich gewöhnt, zu unterhalten, sobald er ein Publikum hatte. Er unterrichtete Hedwig auf kurzweilige Weise über die besonderen Geschehnisse in der Mittelmark und der Uckermark, in Tangermünde, Brandenburg und Magdeburg, erzählte, wie er vor einigen Jahren auf dem Konzil zu Konstanz gewesen sei und zugesehen habe, wie Markgraf Friedrich zum Kurfürsten eingesetzt worden war. Außerdem sprach er davon, dass die Böhmen König Sigismund als Herrscher abgesetzt hatten und dass dieser deshalb einen Feldzug gegen die böhmischen Hussiten, diese entrüstungswürdigen Ketzer, begonnen hatte. Hedwig nickte, lachte und tat, als ob ihr die Namen und Orte bekannt waren, die er nannte. Seine Laune wurde immer überschwänglicher, bis er schließlich wieder anfing zu singen, während seine Frau Irina zu allem lächelte, aber kaum ein Wort sagte. Immer wieder fühlte Hedwig den Blick ihrer sanften, dunklen Augen auf sich ruhen. Als nach Stunden die Burg Friesack in Sicht kam, war sie froh darüber, dass sie die beiden bald wieder los sein würde.
Der Anblick der Burg erschütterte sie. Sie erkannte ihr früheres Zuhause und sah doch, dass es nicht mehr dasselbe war. In der Mauer, gegen die sieben Jahre zuvor Markgraf Friedrichs große Kanone gewütet hatte, klafften noch immer Lücken. Die Trümmer und das Vorfeld der Festung waren mit Birkenschösslingen, Gras, Holunder- und Weißdornbüschen bewachsen. Hedwig wusste, dass dies niemals der Fall gewesen wäre, hätten ihre Eltern hier noch das Sagen gehabt. Ihr Vater hätte befohlen, die Burg wieder wehrhaft zu machen, und ihre Mutter hätte dafür Sorge getragen, dass die Arbeit getan wurde. Nein, die beiden waren nicht mehr hier, doch es war der naheliegendste Ort, um die Suche nach ihnen oder ihren Verwandten zu beginnen.
Richard hatte um ihretwillen nachgeforscht, was mit ihren Eltern geschehen war, nachdem der Markgraf die von Quitzows und deren Verbündete besiegt hatte. Doch die Auskünfte waren ungenau gewesen. Ihr Vater Dietrich sollte mit einigen treuen Anhängern zum Herzog von Stettin entkommen sein und anschließend in ganz Brandenburg Rachefeldzüge und Überfälle unternommen haben. Markgraf Friedrich hatte ihn geächtet und ihm all seinen Besitz entzogen.
Sogar als Kind hatte Hedwig bereits verstanden, warum der Markgraf so gehandelt hatte. Richard hatte ihr erklärt, dass ihr Vater und sein Bruder Johann sich mit allen Mitteln zu den mächtigsten Männern der Mark Brandenburg aufgeworfen hatten, bevor Friedrich von König Sigismund als Markgraf eingesetzt worden war. Viele Leute hatten sie dafür als üble Raubritter beschimpft. Da sie sich Friedrich nicht freiwillig hatten beugen wollen, hatte er gegen sie zu Felde ziehen müssen.
Über den Verbleib ihrer Mutter war noch weniger bekannt als über den ihres Vaters. Gewiss hatte sie ihn nicht begleitet. Hedwig hatte sie als durchsetzungsfähig und stark in Erinnerung, aber für ein Leben an der Seite eines Rechtlosen, zwischen räuberischen Überfällen und Flucht, wäre sie eine zu vollendete Edelfrau gewesen. Zudem hatte sie für einen vierjährigen Sohn und einen Säugling zu sorgen gehabt. Sie musste eine andere Zuflucht gefunden haben.
Und gewiss hatten gewichtige Gründe sie daran gehindert, nach ihrer verschollenen Tochter suchen zu lassen.
Jedenfalls war es das, womit Hedwig sich seit ihrer Zeit beim Köhler immer wieder getröstet hatte.
Ein quäkender Trompetenstoß holte sie unsanft in die Gegenwart zurück. Adam hatte eine Schalmei aus seinem Gepäck gezogen und sich damit im Dorf angekündigt. Die ärmlichen Gebäude lagen verstreut zu Füßen der Burg, und ihr Weg führte zwischen ihnen hindurch. Vor allem Kinder und alte Leute kamen aus den Häusern und Gärtchen herbei, um die Spielleute zu sehen. Hedwig war es unangenehm, von so vielen Menschen begafft zu werden. Als Adam und Irina vor einem Haus hielten, dessen Tür durch ein Bild mit einem Krug darauf geschmückt war, ergriff sie die Gelegenheit und verabschiedete sich.
Zu ihrem Erstaunen begleitete ein großer Teil der Kinder sie, anstatt bei den Spielleuten zu bleiben. Sie hielten sicheren Abstand von ihr und ihrem Hund und blickten mit großen Augen zu ihr auf.
»Was habt ihr denn? Sehe ich so unheimlich aus?«, fragte sie.
Ein mutiger kleiner, blonder Junge, der nur ein langes Hemd trug und keine Bruche, ging neben dem Klepper einige Schritte rückwärts. »Was seid Ihr denn? Eine Fee?«
»Unsinn. Wie kommst du darauf? Ich bin eine gewöhnliche Sterbliche.«
»Warum tragt Ihr so viele Bögen auf dem Rücken? Und warum habt Ihr so ein großes Pferd? Warum kommt Ihr hierher?«
Hedwig lächelte über die hervorsprudelnde Neugier. Es kam ihr vor, als hätte sie an diesem einzigen Tag bereits mehr Worte gehört als vorher in einem ganzen Jahr.
»Es ist gut, mehr als einen Bogen zu haben, falls mir einmal einer zerbricht. Ich wollte keinen davon zurücklassen. Und das Pferd ist groß, weil es eben so ist. Ein anderes besitze ich nicht.«
»Meine Mutter hat keinen Bogen und kein Pferd. Warum habt Ihr das, wenn Ihr auch ein gewöhnliches Weib seid?«
Nach dieser Frage blieb der Junge stehen, weil der Weg zwischen der Umzäunung eines Schweinekobens, einem Schlammloch und der Flechtwand eines Stalles eng wurde. Der Klepper rutschte mit einem Fuß in den tiefen Schlamm, befreite sich mit einem ausgreifenden Satz nach vorn und trabte an. Hedwig hatte Mühe, ihr Gleichgewicht wiederzufinden, sodass es ihr vorerst nicht gelang, den Hengst zu zügeln. Zielstrebig trabte er durch das offene Burgtor auf den Hof und kam dort von allein zum Stehen. Aufatmend ließ Hedwig sich von seinem Rücken gleiten, noch bevor der Knecht bei ihr war, der offenbar den Hof überwachte.
Auch dieser Mann betrachtete sie staunend, half ihr aber höflich, indem er ihr den Weg zum Grafen von Friesack wies, das Pferd vor dem Stall anband und es tränkte.
Vor dem breiten Eingang des grauen Steinhauses, das einmal das Herz der Burg und ihr Heim gewesen war, hielt Hedwig inne. Die schwere Tür stand halb offen, und ihr Holz wies auf beiden Seiten Kerben und Löcher auf, als wäre sie mit Schwert und Axt misshandelt worden. Beschläge und Riegel waren rostig. Der neue Herr schien wahrhaftig nicht viel Wert auf die Wirkung seines Anwesens zu legen.
Mit einer Geste rief Hedwig Tristan zu sich und befahl ihm, auf das Bündel aus Bögen und Schwert achtzugeben, das sie vom Rücken genommen hatte und nun hinter der Tür an die Wand lehnte. Den gespannten Bogen stellte sie mit Köcher und Pfeilen griffbereit daneben.
Der Burgherr saß in Gesellschaft von vier Männern zu Tisch, einer von ihnen war ein Geistlicher. Der Geruch von gekochtem Fleisch, Zwiebeln und Soße erinnerte Hedwig bei aller Aufregung daran, wie hungrig sie war. An der Wand hinter der Tafel hatte früher ein von ihrer Mutter mit einer Jagdszene bestickter Wandteppich gehangen, erinnerte sie sich. Nur die eisernen Haken, an denen er befestigt gewesen war, steckten noch im rohen Stein.
Die Männer bemerkten sie sofort. Sie ließen ihre Hände mit den Messern oder ihrem Brot darin auf die Tafel sinken und starrten unverhohlen. Ihre Blicke wirkten weniger neugierig als missbilligend. Hedwig überlief es heiß und kalt, als sie einen Knicks andeutete. Als Erste zu sprechen, wagte sie nicht.
»Noch mehr Gäste?«, fragte der Burgherr in kühlem Tonfall.
Er sah sie an, als wäre sie ein Bettelweib. Hedwig fühlte Ärger in sich aufsteigen. Ihre Abstammung war gewiss nicht schlechter als seine. Stolz richtete sie sich auf und streifte ihre Kapuze ab.
»Hedwig von Quitzow. Ich möchte eine Auskunft erbitten.«
Im Durchgang zur Küche fiel etwas scheppernd zu Boden, als wollte jemand ihre unerwarteten Worte unterstreichen. Sie konnte beobachten, wie sich die Mienen der Männer veränderten. Nun staunten sie, und das sollten sie ruhig.
»Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Elisabeth von Quitzow.«
Der Burgherr nahm einen Schluck Wein aus einem matten Glas und lehnte sich in seinem hölzernen Sessel zurück.
»Was für ein merkwürdiger Einfall, sie hier zu suchen. Und was für ein merkwürdiger Zeitpunkt. Elisabeth von Quitzow ist seit Jahren tot, ob sie nun deine Mutter war oder nicht. Man spinnt, sie sei ihrem irrsinnigen Gatten aus gebrochenem Herzen gefolgt. In welchem Kloster warst du begraben, dass du das nicht weißt? Mich deucht, es ging ein Freudengesang durch die Mark, als der alte Räuber endlich sein Leben ausgehaucht hatte. Drei Jahre muss das nun schon her sein.«
Die anderen lachten spöttisch. Nur einer von ihnen, ein langhaariger Blonder mit auffallend glatter Haut, musterte sie weiterhin scharf.
»Bredow, warte. Das ist bemerkenswert. Die Maid mag klüger sein, als du denkst. Hat Kurfürst Friedrich sich doch mit Johann von Quitzow im letzten Jahr öffentlich versöhnt. Er hat ihn freigelassen und ihm einen guten Teil seiner Besitzungen zurückgegeben. Hofft die verlorene Nichte vielleicht auf ein Erbteil ihres kinderlosen Onkelchens?«
Hedwig war zu erschüttert, um seinen Worten viel Aufmerksamkeit zu schenken. Die Möglichkeit, dass ihre Eltern beide tot sein könnten, hatte sie nicht in Betracht ziehen wollen. Nun konnte sie sich noch weniger vorstellen, wie es sein würde, zu ihrer Familie zurückzukehren. An ihren Onkel Johann konnte sie sich kaum erinnern, nur daran, dass ihm ein Auge fehlte. Da fühlte sie sich noch eher zu ihrem Bruder und ihrer Schwester hingezogen. »Wisst Ihr vielleicht, wohin es meinen Bruder verschlagen hat, Köne von Quitzow? Oder meine Schwester Margarete?«
»Nein. Und ich will es auch nicht wissen«, sagte der Burgherr. »Die von Quitzows waren Ungeziefer. Je weniger von ihnen überlebt haben, desto besser. Und nun geh mir aus den Augen, du langweilst mich. Wenn du ein Stück Brot brauchst, sollst du es haben, trotz deines lächerlichen Ansinnens. Mit etwas mehr Geschick hättest du es dahin bringen können, dass wir unsere Mahlzeit und ein Glas Wein mit dir teilen.«
»Oder gar unser Bett«, warf sein Tischnachbar ein. Bis auf den Geistlichen lachten die Männer.
Der widerwärtige Klang ihres Lachens ließ Hedwig schaudern, aber sie war nicht bereit, sich so schnell in die Flucht schlagen zu lassen. »Und was ist mit meinem Onkel? Über ihn scheint Ihr doch mehr zu wissen. Wo ist er?«
»Möge ihn der Teufel holen, so wie er seinen Bruder schon geholt hat«, sagte der Burgherr und leerte mit grimmiger Miene sein Glas vollends.
Der glatte Blonde hob sein Glas. »Da dies ganz im Sinne meines Herrn und Bruders ist, trinke ich darauf mit, Bredow.«
Der Burgherr stellte sein Glas mit einem kleinen Knall ab.
»Nennt mich nicht immer Bredow. Ich bin Burggraf von Friesack. Weiß Gott, ich hätte weit mehr verdient als das. Und du, scher dich hinaus, Metze, und erzähl deine Märchen woanders, bevor ich etwas Kurzweiligeres mit dir anzufangen finde.«
Hedwig trug griffbereit rechts und links an ihrem Gürtel zwei scharfe Jagdmesser, mit denen sie schon mehr als einem bedrohlichen Tier ein Ende bereitet hatte. Sie wusste, dass sie keine leichte Beute für diese Männer gewesen wäre, doch der Graf von Friesack klang wütend. Mit Beharrlichkeit würde sie hier nichts mehr erreichen.
Anmutig, wie Richard es sie gelehrt hatte, verabschiedete sie sich mit einem Knicks und ging mit gebeugtem Kopf einige Schritte rückwärts, bevor sie sich umwandte. Als sie aufsah, flüsterte des Grafen Tischnachbar ihm eben etwas ins Ohr. Beide blickten ihr auf eine Weise nach, die nichts Gutes verhieß.
Eilig lud sie sich draußen ihr Bündel und ihren Köcher wieder auf den Rücken, behielt den Bogen aber in der Hand. Ihrem Gefühl nach hätte sie die Burg möglichst rasch verlassen sollen, doch ganz aufgeben wollte sie noch nicht. Sie erinnerte sich daran, welche Tür vom Hof direkt in die Küche führte. Immerhin hatte der Burgherr ihr ein Stück Brot angeboten, das gab ihr einen guten Grund, dort hineinzuschauen. Wieder ließ sie ihren Hund vor der Tür Wache halten.
Fünf Menschen waren um die Herdfeuer herum beschäftigt: ein Koch, drei Mägde und der Knecht vom Hof. Ihr lebhaftes Gespräch brach ab, als Hedwig den Raum betrat, und sie sahen sie mit schuldbewussten Mienen an.
Die älteste Magd, der dünne, graue Haare unter der Haube hervorquollen, nickte unaufhörlich, als spräche sie ein stummes »Ich habe es ja gesagt.«
Sie war die Einzige, die Hedwig bekannt vorkam. »Kenne ich dich von früher, als ich noch ein Kind war?«, fragte sie die alte Frau.
Diese zuckte verlegen mit den Schultern. »Ich kenne Euch.«
Hedwig setzte ihren Bogen auf ihrem Schuh auf und seufzte. »Dann hilf mir, ich bitte dich. Wenn du auch nur von einem einzigen aus meiner Familie weißt, wo er ist, sag es mir.«
Statt der Frau sprach der Knecht. »Köne von Quitzow und sein Onkel Johann dienen Kurfürst Friedrich. Sie werden beide in Böhmen auf dem Feldzug gegen die verdammten Hussiten sein.«
Hedwig ließ sich nicht anmerken, dass sie nicht einmal wusste, wo Böhmen lag.
»In Böhmen? Wo?«
»Ich weiß bloß, dass der Kurfürst seine Männer in Aussig sammelt.«
Sie lächelte dankbar. »Dann werde ich dort suchen.«
Der Mann zog ungläubig die Brauen hoch, schwieg aber dazu. Eine der jüngeren Frauen dagegen brachte Hedwig ein großes Stück Brot.
»Euer Vater war nicht schlimmer als andere. Ich bete für Euch«, sagte sie.
Nun war es an Hedwig, zu staunen. »Hab Dank«, sagte sie berührt und verstaute verlegen das Brot in der kleinen Jagdtasche an ihrem Gürtel. Bevor sie noch etwas hinzufügen konnte, hörten sie durch den offenen Gang zur Halle, wie dort Lärm ausbrach. Es polterte, Metall klirrte. »Ergreift sie«, rief der Burgherr.
Hedwig stürmte aus der Küche und mit Tristan auf den Fersen zu ihrem Pferd. Um vom Hof zu fliehen, konnte die Zeit nicht mehr ausreichen. Noch während sie herumwirbelte, hob sie ihren Bogen und legte einen Pfeil auf. Erst dann erkannte sie, dass die Aufregung nicht ihr galt.
Mit fliegenden bunten Gewändern rannten Adam und seine Frau Irina auf das Burgtor zu, den neuen Grafen von Friesack und die anderen Herren dicht hinter sich. Irina hatte einen Vorsprung, sie war verblüffend schnell und hätte den Männern vielleicht davonlaufen können. Doch der Blonde bekam Adam am Umhang zu fassen und riss ihn zu Boden. Ohne nachzudenken, trat Hedwig einige Schritte vor.
»Halt!«, rief sie laut, als würde sie einen ungehorsamen Hund zurückrufen.
Tatsächlich wandten sich die Männer zu ihr um, wenn auch eher aus Belustigung als aus Respekt. Die Heiterkeit verließ sie sichtlich, als sie sahen, dass sie einen Pfeil auf den Blonden richtete.
»Mit solchen Waffen spielt man nicht. Senk den Bogen!«, befahl einer der anderen.
»Ich spiele nicht. Lasst den Sänger und seine Frau gehen«, sagte sie.
Der Graf von Friesack spuckte aus. »Ach, steckst du mit denen unter einer Decke? Hätte ich mir gleich denken können. Die Unehrlichen ziehen sich an.«
Hedwig sah aus dem Augenwinkel, dass Irina einen großen Bogen schlug und zu ihr gelaufen kam. Doch sie hatte gelernt, sich nicht von ihrem Ziel ablenken zu lassen.
»Auch die, denen es an ritterlicher Ehre mangelt, ziehen sich an, wie es scheint. Der Spielmann soll aufstehen und zu mir kommen. Und hofft nicht darauf, dass ich nur einen von Euch treffen kann. Bevor Ihr mich erreicht, habe ich fünf Pfeile verschossen, und keiner von Euch trägt eine Rüstung.«
Graf von Friesack kam drohend einen Schritt auf sie zu.
»Ein ekelhaftes Mundwerk für ein Weib. Aber ein rechtes Weib bist du wohl nicht, eher eine Missgeburt, die nicht weiß, wo ihr Platz ist. Einen Augenblick geben wir dir noch zur Besinnung. Danach fangen wir dich und prügeln dir deinen hässlichen breiten Rücken in Fetzen. Lass den Bogen fallen!«
Verachtenswürdig, wie sie den Mann fand, gelang es ihm dennoch, sie mit seinen Worten zu verletzen. So sehr, dass sie keinen kühlen Kopf mehr behielt. Sie änderte die Richtung ihres Pfeils, löste ihn und griff nach einem neuen, bevor der erste sein Ziel erreicht hatte. Graf von Friesack schrie auf und riss seinen Fuß zurück, als das Geschoss vor ihm in den Boden einschlug. Sie sah den Schnitt, den die scharfe Pfeilspitze in seinen weichen Schnabelschuh gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte sie ihm die Zehen angeritzt.
Adam nutzte aus, dass seine Gegner abgelenkt waren. Er befreite sich von seinem Umhang, auf dem der Blonde mit einem Fuß stand, rollte außer Reichweite und sprang auf. Hedwig wusste, dass sein Weib inzwischen hinter ihr stand.
»Mach den Klepper los«, befahl sie ihr, ohne sich umzusehen.
»Das habe ich schon getan«, gab Irina zurück.
Graf von Friesack trug einen buschigen braunen Bart und ebensolche Augenbrauen, deshalb war von seinem Gesicht nicht viel zu sehen, doch was man sah, war rot vor Wut.
»Das bezahlst du«, sagte er.
»Ich bin hergekommen, weil ich dachte, dass ein Ritter mir seine Hilfe nicht versagen würde. Statt mir zu helfen, habt Ihr meine Familie und mich beleidigt und Leute bedroht, die mir ihren Beistand freigebig angeboten haben. Ich glaube nicht, dass ich Euch etwas schuldig bin. Lasst uns ziehen, bevor noch Ärgeres geschieht.«
Ohne eine Antwort abzuwarten oder den Bogen zu senken, ging sie Irina voraus, die das Pferd hinter ihr herführte. Von Adam war nichts mehr zu sehen.
Erstaunlich gelassen verharrten die Männer um den Burgherrn an ihren Plätzen. Hedwig ließ sich nicht täuschen. Unberechenbarer und bösartiger als jeden Bären und Wolf hatte Richard Männer wie diese genannt, als er sie vor den Gefahren ihrer Reise gewarnt hatte. Wenn diese Kerle so ruhig blieben, dann nur deshalb, weil sie trotz ihrer Lage überzeugt waren, dass sie am Ende siegen würden.
Sie blieb den Männern zugewandt, während sie mit Irina den Hof verließ. Tristan machte es ebenso. Der Hund hatte verstanden, wer der Feind war, und beobachtete jede Bewegung der schweigenden Gruppe mit gesträubtem Nackenfell.
Die letzten Schritte aus dem Tor hinaus ging Hedwig rückwärts. »Steig auf, Irina.«
Dem Hufgescharr und Irinas leisem Schelten nach machte der Klepper es ihr nicht leicht, doch es gelang.
Kurz darauf hatte das Spielweib ihr die Hand und den Steigbügel gereicht, und sie saßen gemeinsam auf dem Pferd, Hedwig hinter dem Sattel. Im Galopp preschten sie zwischen Hühnern und Hunden hindurch, am Wirtshaus vorbei und aus dem Dorf, zu der Stelle, wo Adam bereits mit den anderen Pferden und Mauleseln wartete. Flink sprang Irina ab und auf ihr eigenes Pferd.
»Du verdammter Schafskopf«, schleuderte sie ihrem Gatten entgegen.
»Lass uns später darüber reden, mein Morgenstern. Jetzt müssen wir erst einmal –«
»In den Wald«, befahl Hedwig. An keinem anderen Ort würde sie sich sicher fühlen.
Selbst die Maulesel mit ihrer hastig mehr schlecht als recht wieder befestigten Ladung wurden zum Galopp gezwungen, bis sie den nächstgelegenen Waldessaum erreichten. Eilig trieben Hedwig und ihre Begleiter die Tiere auf einem kleinen Pfad zwischen die Bäume. Erst als sie vom Weg aus nicht mehr gesehen werden konnten, hielt Hedwig inne. »Sie werden uns folgen«, sagte sie.
»Bei Gott, das werden sie. Was ist Euch eingefallen, Jungfer, uns so einen Ärger einzuhandeln? Ihr könnt doch nicht einen Haufen Ritter mit einer Waffe bedrohen«, sagte Adam und hielt sich stöhnend die Hand vor die Augen.
Hedwig hatte diesen Vorwurf von ihm nicht erwartet, wusste aber, dass er recht hatte. Auch Richard hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn er gewusst hätte, wie ungeschickt sie ihre Suche begonnen hatte.
Bevor sie sich dazu äußern konnte, kam Irina ihr zuvor. »Schäm dich, Adam. Wie kannst du das Mädchen dafür schelten, dass sie unsere Haut gerettet hat? Was glaubst du, was Herr Gerhardt von Schwarzburg von dir übrig gelassen hätte? Und du weißt, womit du es dir verdient hast, du …! Ich habe doch gesagt, dass sie dich damit nicht davonkommen lassen. Aber du musstest ja –«
»Konnte ich ahnen, dass die Herren den Teufel auf ihrer Seite haben und so schnell der Wunsch in ihnen aufsteigt, sich zu beschweren, dass uns von Schwarzburg sogar überholt? Ira, du hast die Tiere gesehen. Sie waren wirklich nicht in bestem Zustand. Um mir zu unterstellen, ich hätte bei dem Geschäft betrügerische Absichten gehegt, muss jemand doch selbst eine schlechte Seele besitzen.«
Der Name »von Schwarzburg« brachte in Hedwig eine Erinnerung zum Klingen. Günther von Schwarzburg war der Erzbischof von Magdeburg und ein erbitterter Feind der von Quitzows. Während ihr Vater den Kurfürsten nur überheblich ›den Tand aus Nürnberg‹ genannt hatte, war von Schwarzburg ihm ›der Erzbuschklepper‹ gewesen. »Welcher war Gerhardt von Schwarzburg? Hat er mit dem Erzbischof von Magdeburg zu tun?«, fragte sie.
Adam sah sie mit großen Augen an. »Ob er …? Woher kommst du unwissendes Geschöpf denn bloß? Das hellhaarige Biest ist der Bruder des Erzbischofs.«
»Und offenbar habt ihr beide es euch mit ihm ebenso verdorben wie ich. Wir sollten jetzt aufhören, zu schwatzen, und versuchen, zu entkommen«, erwiderte sie und trieb den Klepper an.
Mit einer tragischen Geste legte Adam sich die rechte Hand auf die Brust.
»Wozu unsere Herzen in verzweifelter Flucht erschöpfen? Sie werden uns ohnehin fangen. Wir werden sie hier erwarten und uns ihnen zu Füßen werfen.«
Irina hieb ihrem Pferd die Fersen in die Weichen, um Hedwig zu folgen.
»Das kannst du allein tun, mein Lieber. Ich für meinen Teil habe weniger Angst vor dem Wald als vor den hohen Herren.«
Er seufzte geräuschvoll. »Nun, wenn es so ist … Ich kann euch Weiber ja nicht ohne Schutz lassen.«
Hedwig führte die Spielleute so rasch wie möglich tiefer in den auch ihr unbekannten Wald. Je weiter sie sich von Dorf und Burg entfernten, desto dichter wurde das Unterholz, und die Pferde der Spielleute ließen sich nur noch mühsam voranbewegen. Hedwigs Klepper dagegen fühlte sich in seiner Führungsrolle wohl und war zu ihrer Freude gehorsam. Es schien, als wäre er erst an diesem Tag richtig aufgewacht.
Nachdem sie sich lange Zeit durch das Gestrüpp gequält hatten, stießen sie auf eine von einem Sturm geschaffene kleine Lichtung mit einem Tümpel. Die noch mit grünen Trieben besetzten Reste dreier umgestürzter Baumriesen lagen in einem niedrigen Bett aus Blaubeersträuchern, Binsen und jungem Gras. Hier hielt Hedwig an und stieg ab. Verunsichert folgten Irina und Adam ihrem Beispiel. Zu Hedwigs Unverständnis schien ihnen der Wald tatsächlich kaum weniger Angst zu machen als die Männer, die ihnen vielleicht folgten.
»Was hast du vor?«, fragte Adam.
»Ihr lagert hier, und ich schleiche zurück und sehe nach, ob die Männer uns auf den Fersen sind.«
Irina stieg ebenfalls ab und griff in eine ihrer Satteltaschen. »Das ist gut. Du scheinst dich im Wald weit besser auszukennen als wir. Aber wenn es dir geht wie mir, musst du vorher etwas essen.« Sie hielt Hedwig Brot und Käse hin.