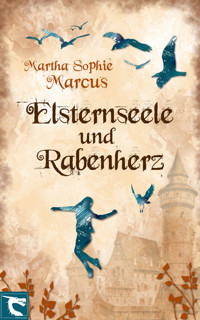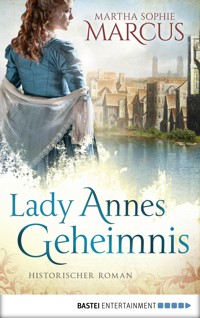6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Meisterdiebin am Hofe des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg
Venedig, 1667. An einem einzigen Tag gerät Alessas Leben völlig aus den Fugen: Ihre Tante stirbt und hinterlässt ihr ein geheimnisvolles Medaillon und noch am selben Abend wird ihr Großvater ermordet, der sie großgezogen und zur Diebin ausgebildet hat. Alessa selbst kann dem Mörder entkommen und schließt sich einer Truppe Schauspieler an, die bis an den Hof des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg reisen. Doch auch hier ist die junge Frau nicht sicher. Die Gaukler sorgen für Misstrauen bei Hauptmanns Arthur Kühne, der insbesondere Alessa nicht über den Weg traut, sich aber gleichzeitig stark zu ihr hingezogen fühlt. Auch der Mörder ihres Großvaters ist ihr dicht auf den Fersen - und er ist nicht mehr der Einzige, der es auf das Medaillon abgesehen hat ...
Lassen Sie sich von Martha Sophie Marcus in die farbenfrohe höfische Welt des 17. Jahrhunderts entführen! Mitreißende Lektüre für Fans von Philippa Gregory, Elizabeth Chadwick und Elizabeth Fremantle.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nachwort
Personen
Glossar
Weitere Titel der Autorin bei Bastei Lübbe
Das Mätressenspiel
Lady Annes Geheimnis
Über dieses Buch
Eine Meisterdiebin am Hofe des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg
Venedig, 1667. An einem einzigen Tag gerät Alessas Leben völlig aus den Fugen: Ihre Tante stirbt und hinterlässt ihr ein geheimnisvolles Medaillon und noch am selben Abend wird ihr Großvater ermordet, der sie großgezogen und zur Diebin ausgebildet hat. Alessa selbst kann dem Mörder entkommen und schließt sich einer Truppe Schauspieler an, die bis an den Hof des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg reisen. Doch auch hier ist die junge Frau nicht sicher. Die Gaukler erregen das Misstrauen des Hauptmanns Arthur Kühne, der insbesondere Alessa nicht über den Weg traut, sich aber gleichzeitig stark zu ihr hingezogen fühlt. Auch der Mörder ihres Großvaters ist ihr dicht auf den Fersen – und er ist nicht mehr der Einzige, der es auf das Medaillon abgesehen hat …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Martha Sophie Marcus wurde 1972 im Landkreis Schaumburg geboren und verbrachte dort ihre Kindheit zwischen zahllosen Haustieren und Büchern. Sie studierte in Hannover Germanistik, Pädagogik und Soziologie. Anschließend lebte sie zwei Jahre lang in Cambridge und genoss die malerische historische Kulisse Großbritanniens. Ihre Leidenschaft für Literatur brachte sie früh zum Schreiben. 2010 erschien ihr erster historischer Roman, dem bald weitere folgten. Heute wohnt Martha Sophie Marcus mit ihrer Familie in Lüneburg und ist Vollzeit-Schriftstellerin. Im Herbst 2016 erhielt sie den Kulturförderpreis des Landkreises Lüneburg in der Sparte Literatur.
Homepage der Autorin: http://martha-sophie-marcus.de/, Blog: http://martha-s-marcus.blogspot.com/.
Martha Sophie Marcus
Das blaue Medaillon
HISTORISCHER ROMAN
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2017 by Martha Sophie Marcus und Bastei Lübbe AG, Köln
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln
Für diese Ausgabe:Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Eva Wagner, DorfenCovergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von © Richard Jenkins Photography; shutterstock/Rudy Bagozzi; shutterstock/Nik Merkulov; shutterstock/mountainpix; © Richard Jenkins eBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0524-0
www.be-ebooks.dewww.lesejury.de
1
Venedig, 1667
Behütete Mädchen aus guten Häusern glaubten, dass alle Nächte gleich dunkel seien. Hinter ihnen wurden abends die Türen geschlossen, sodass sie nur durchs Fenster aus der Geborgenheit hinausspähen konnten, oder ihre Eltern fuhren mit ihnen im flackernden Schein von Laternen mit der Gondel zu hell beleuchteten Vergnügungen, die mit ihrem Prunk alles andere in den Schatten stellten.
Alessa kannte alle Spielarten venezianischer Dunkelheit. Schon als kleines Mädchen hatte ihr Großvater sie nachts durch die Gänge und niedrigen Tore der Serenissima geführt. Sie wusste, wie pechschwarz die Schatten in den Gewölben der Fondamentas bei mondlosem Himmel waren. Doch sie hatte auch erlebt, wie erschreckend hell sogar die schmalste Gasse zwischen hoch aufragenden Palazzi bei Mondlicht sein konnte, wenn man dringend ein Versteck suchte.
Sie stand am Ende der Gasse neben dem Ca’Massio an der eisernen Gittertür, die den Zugang zum Canal Grande versperrte. Der Wind kam von Norden und trug den Sumpfgeruch zu ihr, den die Barene bei Niedrigwasser verströmte. Es war die eine Stunde der Nacht, in der auch die letzten vom Tage Übriggebliebenen endlich zu Bett gegangen waren und die ersten dem Tagesanbruch Vorauseilenden noch nicht ihre Häuser verlassen hatten. Kein singender Ruderer steuerte sein Boot durch den Canal, kein Karren wurde polternd über Brückenstufen gezerrt, kein Fass durch die Gassen gerollt. Alessa hörte nur das Gluckern, Blubbern und Schwappen der Kanäle und das Knarren der Gondeln, die sich an den Pali und Tauen rieben, an denen sie festgemacht waren. Sie lauschte angespannt. Eine Flagge schlug in der unruhigen Brise, und in der Ferne jaulten streitende Kater. Der Himmel war klar, der Mond jedoch nur eine schmale Sichel, die gleichmäßiges, schwaches Licht spendete.
Alessa blickte an dem Haus hoch, dessen Fassade hier längst nicht so prächtig gestaltet und gepflegt war wie an der dem Canal Grande zugewandten Seite. Für sie war das ein Vorteil, denn die maroden Fugen zwischen den Ziegeln würden ihr beim Klettern Halt bieten. Noch einmal beugte und streckte sie die Arme, ballte die Hände zu Fäusten und lockerte sie wieder. Die Streben der Gittertür stellten die ersten Stufen ihrer Leiter in die Schatzkammer des Ca’Massio dar, die Risse in der Wand und der wuchernde Efeu die nächsten. Zu Anfang wusste sie, wohin sie greifen und ihre nackten Füße setzen konnte, weil sie die Wand bei Tageslicht genau gemustert hatte. Weiter oben würde es schwieriger werden, sodass sie ihre Geschwindigkeit beim Klettern mäßigen musste.
Obwohl das Fenstergitter des ersten Geschosses ihr einen bequemen Halt geboten hätte, hielt sie sich davon fern. Ihr Ziel lag nicht in diesem Stockwerk des Hauses, und sie würde nicht riskieren, zufällig von einem schlaflosen Gast entdeckt zu werden, der sich die Zeit im Saal oder in der Bibliothek vertrieb. Doch auch am darüber liegenden Fenster kletterte sie vorbei – inzwischen hoch genug, um sich zu Tode zu stürzen. Wann aber würde ein Gecko je abstürzen? So nannte ihr Großvater sie oft, wenn niemand sonst es hören konnte. Gecko. Nicht schmeichelhaft für eine junge Frau, genannt zu werden wie ein Reptil, aber auf solche Eitelkeiten hatte er noch nie Rücksicht genommen.
Ihre knielange Pumphose blieb flüchtig an einer schartigen Stelle der steinernen Regenrinne hängen, als sie auf das Dach des Hauses stieg. Es war ein tückischer Übergang von der Wand auf die schräge Fläche aus flachen, zerbrechlichen Ziegeln. Jedes Knacken und Bersten würde die Dienerschaft aufstören, die das oberste Geschoss bewohnte. War wirklich niemand auf der Dachterrasse? Sie nahm sich die Zeit, hocken zu bleiben und sicherzugehen. Erst danach richtete sie sich auf und setzte behutsam ihre Schritte, bis sie die gegenüberliegende Seite des Dachs erreichte. Nun begann der schwierige Teil ihres Plans, denn sie kletterte ungern abwärts. Immerhin würde sie hier nach einem Absturz im Wasser des kleinen Rio landen, der am Ca’Massio entlangfloss, und wahrscheinlich überleben.
Auf der Höhe des zweiten Stockwerks blieb ihr nichts anderes übrig, als sich auf die Vorderseite des Hauses zu wagen, die sogar vom Gegenufer des Canal Grande aus zu überblicken war. Hier würde ihre schwarze Kleidung sie nicht davor schützen, entdeckt zu werden, deshalb war Eile geboten. So zügig wie möglich wand sie sich um die Hausecke herum und kletterte zu dem schmalen Altan vor den Wohnräumen des Hausherrn. Aufatmend lockerte sie dort ihre Hände und Finger. Das nächste Stück würde ihre Kräfte weniger herausfordern.
Geräuschlos erreichte sie den Abschnitt des Altans, von dem aus sie ins Haus einbrechen wollte. Mit dem Glasschneider aus Diamant, den sie zu ihrem zwanzigsten Namenstag bekommen hatte, schnitt sie ein rundes Loch in die Scheibe der Tür. Fenster und Türen auf diese Weise von außen zu öffnen, hatte sie tausendmal geübt. Auch dieses Mal stellte es keine Schwierigkeit dar, das herausgeschnittene Glas mit einem klebrigen Stück Pech daran zu hindern, dass es klirrend zu Boden fiel. Zu ihrem Ärger konnte sie jedoch nicht verhindern, dass die Tür leise quietschte, als sie sie aufdrückte. Lauschend verharrte sie, doch es blieb ruhig – bis auf das Schnarchen des Mannes, der drinnen in seinem großen Himmelbett schlief.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich, als sie in der Dunkelheit durch das Schlafgemach des Hausherrn glitt. Mit einem raschen Stoßgebet zu San Marco bat sie darum, dass die Tür zum Flur besser geschmiert war als die zum Balkon. Nach Beute sah sie sich nicht um, denn auf Fingerringe, kleine Münzen und Firlefanz war sie in dieser Nacht nicht aus.
San Marco erhörte sie und ließ die Türangeln gefettet sein wie ein Tranfass. So verließ sie das Gemach, während der Nobile Huomo in seinem Bett friedlich weiterschlief.
Der Flur war von einem gleichmäßig brennenden Nachtlicht schwach beleuchtet. Sie wandte sich nach links, der nächstgelegenen Tür zu. Triumphierend zog sie den Schlüssel hervor, der an einem Band in ihrem Ausschnitt gehangen hatte. Das Geräusch des aufschnappenden Schlosses ließ sich nicht vermeiden, doch es war nicht laut genug, um die Schläfer im Haus zu wecken. Sie öffnete die Tür.
»Ich habe dich gehört, Tochter des Ungeschicks. An einem tauben Säufer kämest du auf diese Art vielleicht vorbei, aber nicht an einem Nobile mit leichtem Schlaf. Soll ich nun also die Signori di notte al criminal rufen? Oder hast du mir etwas anzubieten, was mich zufriedener macht, als Abschaum wie dich im Kerker zu wissen?«
Mit einem verächtlichen Schnauben nahm Alessa gegenüber dem alten Mann Platz, der in Schlafrock und Nachtmütze beim Licht einer funzligen kleinen Kerze in einem Armlehnstuhl saß und sie böse anfunkelte. »Du willst mich gehört haben? Warum sagst du das jedes Mal? Es ist nicht wahr. Du willst nur nicht zugeben, dass ich dich überrumpeln könnte. Wahrscheinlich hast du dir Nadeln ins Gewand gesteckt, damit du nicht einschläfst, sondern mich gleich anfahren kannst, wenn ich hereinkomme.«
»Du hast die Tür geöffnet, wie ein Bauerntrampel eine Stalltür öffnet. Wo ist das Fingerspitzengefühl, das ich dich gelehrt habe?«
»Ein schweres Schloss lässt sich nie geräuschlos öffnen. Aber das ist gleichgültig, denn außer dir hat es niemand gehört. Und du bist gar nicht hier. Hier ist nur eine volle Geldkassette, und die werde ich nun so leise aufschließen, dass jedes Mäuserascheln im Vergleich dazu Getöse ist.«
Ihr Großvater wedelte ungeduldig mit der Hand. »Dann mach endlich, statt mich mit deinen vorlauten Dummheiten zu ärgern. ›Ein schweres Schloss lässt sich nicht geräuschlos öffnen‹, pah! Selbst wenn es so wäre: Ich habe dich auch vorher schon gehört.«
Alessa hatte sich bereits erhoben, um die Geldkassette aus der Truhe zu holen, in der sie ihrer Vermutung nach aufbewahrt wurde, doch nun hielt sie inne und wandte sich ihrem Großvater wieder zu. »Das hast du nicht!«
Pietro Ferretti, der ehemals wohl geschickteste Einbrecher Venedigs, verschränkte die Arme und betrachtete sie hochmütig unter dem Rand seiner roten Nachtmütze hervor. »Das habe ich doch!«
Seine bockige Haltung war der beste Beweis dafür, dass er log. Sie zuckte kühl mit den Schultern und setzte ihr Vorhaben fort, obwohl er nun die Kerze ausblies. Es war nicht das erste Mal, dass Erinnerungsvermögen und Tastsinn ihr das Licht ersetzen mussten. Bei den Scharnieren der Truhe ging sie kein Risiko ein. Ein wenig Schmalz aus der kleinen Dose, die sie bei sich trug, verhinderte jedes Quietschen. »Dann sag mir doch, wo genau du mich gehört hast. Auf welchem Weg bin ich ins Haus gekommen?«
Die Antwort kam ohne Zögern. »Du bist von der Calle aus aufs Dach geklettert, durch die Tür zur Dachterrasse eingebrochen und über die Treppen heruntergekommen.«
Weder das Schloss der Truhe noch das der Geldkassette stellten Alessa vor Schwierigkeiten. Sie besaß ein Bund von Diebeshaken in verschiedenen Größen. Schlösser damit zu überlisten, übte sie seit ihrer Kindheit. Leise klappte sie den Deckel der Kassette auf. Sehen konnte sie nicht, was darin lag, doch ihre Finger verrieten ihr, dass es weder Papiere noch Münzen waren, sondern samtweiches Gewebe. »Was ist das?«, fragte sie.
Ihr Großvater seufzte und schwieg einen Augenblick. Der Kampfgeist war aus seiner Stimme verschwunden, als er wieder sprach. »Etwas, was wir schon heute oder morgen brauchen werden. Das mit den Schlössern hast du nicht schlecht gemacht. Lass es für dieses Mal gut sein und zieh dich um. Wir sollten versuchen, noch ein paar Stunden zu schlafen.«
Sie nickte, obwohl er es in der Dunkelheit nicht sehen konnte. Für gewöhnlich war ihre Aufgabe erst beendet, wenn sie das Haus mit der Beute erfolgreich wieder verlassen hatte. Doch nachdem ihr Großvater sie nun an ihren gemeinsamen Kummer erinnert hatte, war ihr so wenig wie ihm danach zumute, das Spiel zu Ende zu spielen. Sie ging mit der erloschenen Kerze auf den Flur und nutzte die Flamme des Nachtlichts, um sie wieder zu entzünden. Als sie ins Zimmer zurückkam, hatte Pietro den Kopf müde gegen die Kopfstütze sinken lassen und die Augen geschlossen.
Auf dem Bett lag ihr Nachthemd neben dem Kleid, das sie am nächsten Morgen anziehen würde. Sie hatte es erst vor wenigen Tagen beim Schneider abgeholt, verzückt von der überbordenden Pracht der Schleifchen, Falbeln und kleinen Stickereien. Manch einer hätte gesagt, dass es kein Kleid sei, in dem man einen Besuch bei einer Schwerkranken machen durfte. Doch sie war sich gewiss, dass ein zurückhaltendes Trauergewand ihre Tante Zenobia eher enttäuscht hätte. Sich mit auffallenden Gewändern und Verkleidungen zu beschäftigen, Rollen zu spielen und das richtige Kostüm zu wählen war Zenobias Lebensinhalt gewesen.
Alessa schlüpfte aus ihrer eigenen schwarzen Verkleidung, die sie über Jahre hinweg erfunden und verbessert hatte. Robuste, eng anliegende, aber dehnbar gestrickte Beinlinge und Armlinge, eine nicht zu weite Pluderhose und eine Weste mit der richtigen Anzahl von verschließbaren Taschen für ihre Ausrüstung boten ihr volle Bewegungsfreiheit beim Klettern und verschmolzen mit den Schatten, in denen sie sich verbarg. Sollte sie als Frau in dieser Männerkleidung erwischt werden, konnte sie nur auf die venezianische Großzügigkeit hoffen, was Karnevalskostüme anging. Doch diese Sorge war nur eine von vielen, die sie haben würde, falls man sie je erwischte.
Tief durchatmend zog sie ihre langen Locken aus dem Kragen des Nachthemds. »Nicht über die Dachterrasse, Nonno. Ich bin über die Altana vor dem Schlafgemach von Signor Bartoldo eingestiegen. Dabei habe ich ein Loch in die Scheibe seiner Tür geschnitten. Du wirst das mit ihm klären müssen.«
Er hob den Kopf und sah sie an. »Über die Altana? Bist du etwa vom Canal her an der vorderen Fassade hochgeklettert? Wie lebensmüde bist du denn, du Huhn?«
Sie seufzte und streckte sich wohlig auf dem Bett aus. »Hör auf zu schimpfen. Ich bin über das Dach gekommen und dann von der Seite her geklettert.«
»Über das ganze Dach? Dächer sind immer gefährlich, Alessa! Wie oft habe ich dir das erklärt? Die Ziegel …«
»Ich weiß. Die Ziegel bersten leicht. Aber du hast mich nicht gehört, nicht wahr? Und auch sonst niemand.«
Er schwieg, und sie begann schon, ins Reich der Träume zu schweben, als er doch noch etwas zu sagen fand.
»Werde Bartoldo das Glas der Tür vom Feinsten ersetzen. Wird ihn belustigen zu hören, dass du durch seine Kammer geschlichen bist. Ist ein guter Freund, Bartoldo. Aber alt ist er geworden. Das habe ich gemerkt, als wir vorhin zusammen Wein tranken. Ich werde ihn nicht noch einmal um einen Gefallen bitten. Es wird zu gefährlich, wenn so ein Alter seine Sinne nicht mehr beisammenhat. Am Ende beginnt er doch noch, Dinge auszuplaudern, die dafür nicht gedacht waren. Du kannst nicht vorsichtig genug sein, kleiner Gecko. Das musst du dir merken. Auch wenn du jemandem vertrauen möchtest, frag dich erst, ob derjenige allein Meister seines Willens ist.«
Alessa murmelte eine Bestätigung, stellte aber für sich fest, dass ihr Großvater ihr schon seit langer Zeit keine neuen Weisheiten mehr mitzuteilen hatte. Er wiederholte sich nur noch, und sie hatte den Verdacht, dass er bald selbst einer von diesen wenig vertrauenswürdigen »Alten« sein würde, von denen er gerade etwas überheblich gesprochen hatte. Sie hatte ihm schon als Kind viel von dem verschwiegen, was sie tat und dachte. Damals hatte sie die Wahrheit aus Angst vor ihm für sich behalten. Inzwischen wollte sie es sich einfach ersparen, mit ihm streiten zu müssen.
»Weck mich früh genug, sodass ich mich in Ruhe ankleiden lassen kann«, bat sie ihn noch, bevor sie sich dem Schlaf überließ.
*
Noch bei ihrem vorherigen Besuch hatte Zenobia Buccolini sich nicht einmal ihrem Vater und ihrer Nichte gegenüber die Blöße gegeben, sie unfrisiert im Bett liegend zu empfangen. An diesem Tag jedoch hatte ihr offenbar die Kraft gefehlt, sich lange genug aufzurichten, um die Zofe ihre Arbeit tun zu lassen. Mit geschlossenen Augen ruhte sie auf den Seidenkissen ihres prunkvollen Bettes, das Zeuge so vieler ihrer Geheimnisse war. Statt der kostbaren Perücke trug sie nur eine Nachthaube über dem kurz geschorenen blonden Haar, und ihr weißes Hemd war ein wenig fleckig. Wächsern, fahl und eingefallen wirkte ihr Gesicht, so, als wäre sie schon tot. Zwischen den Falten des Nachthemds ruhte auf ihrer Brust an einem schwarzen Seidenband ein Medaillon, das sie niemals ablegte. Sein Deckel bestand aus einer in Silber gefassten blauen Achatgemme mit dem Motiv einer schlichten Rosenblüte und war so groß wie der Daumenabdruck einer Männerhand. Kleine Saphire säumten den Rand. Zum ersten Mal fand Alessa das funkelnde Schmuckstück unpassend. Zenobia hatte es immer als ihren Glücksbringer bezeichnet, und ihr jetziger Zustand sprach diesem Glauben Hohn.
Obgleich Alessa gewusst hatte, wie es um ihre Tante stand, wurde ihr erst in diesem Augenblick deutlich, dass Zenobia sich niemals wieder maskieren würde, niemals wieder eine ihrer Rollen spielen, von denen sich so viele Menschen mit großem Vergnügen hatten täuschen lassen. Alessa ließ den Arm ihres Großvaters los, bei dem sie sich untergehakt hatte, und trat zu ihr ans Bett. Es erschien ihr ungehörig, die Schlafende zu wecken, deshalb blieb sie nur stehen und betrachtete die Frau, die für sie einer Mutter am nächsten gekommen war. Alles, was ein Mädchen wissen musste und nicht von einem Großvater erfahren konnte, hatte Zenobia ihr erklärt.
»Du kannst sie ruhig wecken. Schließlich sind wir hier, um mit ihr zu sprechen. Und schlafen wird sie noch lange genug«, sagte Pietro. Seine Miene war grimmig und sein Tonfall grob, doch das verriet Alessas Erfahrung nach nur wenig über seine wahren Gefühle.
»Zia Zenobia, bist du wach?«, fragte Alessa leise.
Zenobia schlug die Augen auf und verzog die Lippen zu einem verächtlichen Lächeln. »Sag dem alten Furz, dass er mich mal gernhaben kann. Das hier ist mein Sterbebett, auf dem ich tue und lasse, was ich will. Er hat mich nicht herumzukommandieren«, flüsterte sie.
»Als hättest du jemals nicht getan, was du tun willst, du halsstarriges Weibsstück. Aber nun vergeude keine Zeit. Du hast uns rufen lassen, also nehme ich an, dass wir etwas Wichtiges zu bereden haben«, sagte Pietro. Auch er war näher getreten, setzte sich nun aber halb auf die Armlehne eines Sessels neben dem Bett und verschränkte die Arme. Kaum eine Haltung konnte gleichgültiger wirken, doch Alessa sah, dass seine Knie zitterten.
Zenobia setzte zu einer Antwort an, musste aber husten und konnte sich für längere Zeit nicht wieder fangen, weshalb ihre Zofe ins Gemach geeilt kam und sie aufsetzte, um ihr das Atmen zu erleichtern. Als sich der Husten gelegt hatte, klopfte Zenobia ihrer Dienerin zärtlich die Hand. »Danke, aber nun geh wieder hinaus. Ich muss mit Signor Ferretti und meiner Nichte allein sprechen.«
Die Zofe knickste und verließ den Raum, woraufhin Alessa sich zu ihrer Tante auf die Bettkante setzte. Matt streckte die Kranke die Hand aus, um spielerisch an einer der Zierschleifen von Alessas Kleid zu zupfen. »Wie erwachsen du geworden bist, Alessandra. Ich weiß noch, wie Vater dich zum ersten Mal hergebracht hat. So ein kleines Ding warst du, das noch keine zwanzig Worte sprechen konnte. Und du hast geheult, weil du zu deiner Mamma wolltest. An dem Tag hat er mir auch das hier gegeben. Heute gebe ich es zurück.«
Sie legte die Hand um das blaue Medaillon, war jedoch zu schwach, sich das Band über den Kopf zu streifen. Alessa half ihr dabei und ließ sich von ihr das Schmuckstück in die Hand drücken. Dass es kein Geheimnis enthielt, sondern enttäuschend leer war, wusste sie schon lange. »Großvater hat es dir gegeben? Ich dachte, es wäre von deinem ersten Gönner?«, fragte sie.
Ihr Großvater starrte an die Decke und tat mürrisch und unbeteiligt. Er hatte widersprüchliche Einstellungen zum Lebenswandel seiner Tochter und mochte es nicht, wenn andere darauf anspielten. Mit dem Wohlstand, den sie sich verschafft hatte, war er durchaus einverstanden. Ihr glanzvoller Erfolg und die Berühmtheit, die sie als Schauspielerin und Kurtisane erworben hatte, gefielen ihm im Grunde ebenfalls. Das hatte ihn jedoch nie davon abgehalten, sie für ihre »Hurerei« zu verachten. Er lebte in vielerlei Hinsicht nach einer doppelten Moral, das hatte Alessa schon früh festgestellt. Mit dem Diebstahl war es nicht anders. Er hatte nichts daran auszusetzen, in die Unterkunft eines Fremden einzusteigen, der in der Serenissima zu Gast weilte, und ihm die Reisekasse zu stehlen. Doch er spuckte Gift und Galle, wenn er davon hörte, dass ein ach-so-gemeiner Dieb seinen liebsten Muschelfischer um die schlanke Geldkatze gebracht hatte.
»Du wirst es ihr erklären müssen, Signor Ferretti. Mir fehlt der Atem dazu«, sagte Zenobia.
»Was gibt es da groß zu erklären? Das Medaillon gehörte deiner Mutter, Alessa. Ich gab es Zenobia, damit sie es für dich aufbewahrt. Am besten, wir …«
Zenobia unterbrach ihn. »Es ist zu gefährlich, sie zu belügen. Du bist ein Greis und weißt nicht, wie lange du noch Geheimnisse für sie hüten kannst. Alessa ist alt genug. Sie muss selbst entscheiden, wie sie mit der Wahrheit umgeht.«
»Sie ist nicht alt genug, um zu begreifen, dass man manche schlafenden Hunde niemals wecken sollte. Wir sind bisher gut zurechtgekommen, ohne in dieser alten Lumpentruhe zu wühlen«, erwiderte Pietro.
»Warum haben wir die blaue Rose nicht längst fortgeworfen, wenn du so denkst?«, fragte Zenobia.
Alessa war es gewöhnt, von ihrem Großvater wie ein Kind behandelt zu werden. Ihre Tante allerdings hatte ihr nie den Eindruck vermittelt, dass sie ihr etwas wegen ihres Alters vorenthalten würde. Im Gegenteil: Sie hatte schon in jüngsten Jahren Dinge zu Gesicht bekommen, die andere Mädchen sich nur vage vorstellen konnten.
»Wenn diese Geschichte etwas mit meinen Eltern zu tun hat, will ich sie hören. Ich bin einundzwanzig Jahre alt und habe ein Recht darauf«, sagte sie.
Ihr Großvater knurrte wie ein mürrischer alter Hund und verließ seinen unbequemen Platz auf der Armlehne, um sich im Sessel niederzulassen und die Beine lang auszustrecken.
»Die Fehde, die deine Eltern das Leben gekostet hat, war der Höhepunkt langer Kämpfe zwischen zwei Sippen, die um die Oberhand über gewisse gewinnbringende Geschäfte stritten, die meistens bei dämmrigem Licht abgewickelt werden. Die Sippe deines Vaters hat am Ende verloren, und die Fehde wurde vor langer Zeit beendet. Fast alle Mörder von damals sind längst selbst begraben. Kurz bevor deine Eltern umgebracht wurden, hat allerdings dein Vater erfolgreich einige seiner reichsten Gegner beraubt. Dabei fiel ihm eine Schatulle voller Briefe und Urkunden in die Hände, mittels derer man mindestens einen der mächtigsten Männer Venedigs als Verbrecher überführen könnte. Deine Eltern haben nun schnell und klug gehandelt. Sie haben einen Teil ihres Vermögens zusammen mit diesen Unterlagen heimlich bei einem Bankier in Sicherheit gebracht und ihn darauf eingeschworen, dass er es nur demjenigen wieder aushändigen wird, der ihm das blaue Medaillon vorweisen kann, das du gerade in der Hand hältst. Giulietta, deine Mutter, brachte es mir, zusammen mit dir, als sie schon um ihr Leben fürchtete. Was dein Vater seinen Feinden gestohlen hatte, haben sie ebenfalls versteckt. Und sie haben das Versteck preisgegeben, als die Mörder zu ihnen kamen. Dass die Unterlagen fehlten, können die Bastarde erst gemerkt haben, als deine Eltern schon tot waren. Die größte Kostbarkeit ist ihnen damit entgangen, denn die Männer, die man damit erpressen könnte, sind heute reicher und mächtiger denn je. Nun könntest du fragen, warum ich den Schatz nicht geborgen habe. Ich sage dir, warum: Erpressung ist ein widerliches und gefährliches Geschäft. Ich hätte keine Nacht mehr ruhig schlafen können, wenn ich diesen Schmutz im Haus gehabt hätte. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, dass ich, deine Tante oder du irgendetwas über die Geheimnisse deiner Eltern wissen. So wollte ich es haben. Und so solltest du es beibehalten, wenn du meine Meinung hören willst. Niemand verdächtigt eine kleine Diebin und ihren alten Großvater, die von der Hand in den Mund leben, dass sie ein Geheimnis hüten, das sie reich machen könnte.«
Alessa hatte gewusst, dass ihre Eltern ermordet worden waren und dass ihr Vater sich und seine kleine Familie nicht von seinem mehr schlecht als recht vorgetäuschten Tischlerhandwerk ernährt hatte. So viel hatte Zenobia ihr verraten. Außerdem hatte sie keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich mit ihrer Halbschwester Giulietta nicht verstanden hatte. Immer wieder hatte sie es bedauert, dass sie aus ihrer Nichte keine Schauspielerin machen durfte. Du wärst sooo talentiert. Aber der Alte musste deiner Mutter ja versprechen, dass er dich keine Schauspielerin werden lässt. Sie hat Schauspieler gehasst, weißt du? Angeblich, weil sie die Verstellung verabscheute. Dabei hat sie doch ihr eigenes Leben auf Heuchelei aufgebaut. Braves Eheweib eines Tischlers, dass ich nicht lache, ha!
Viel mehr als das wusste sie nicht über Valentiano und Giulietta Sala. Sogar die Namen ihrer Eltern hatte sie erst mit siebzehn Jahren erfahren – und auch das nur, weil ihre Tante sich verplappert hatte. Sie hatte ihr anschließend versprechen müssen, die Namen nie zu erwähnen. Obwohl sie die Angst ihres Großvaters vor dem versteckten Nachlass verstand, wünschte sie sich, ihn betrachten zu können. Sie war sicher, dass es ihr etwas über ihre unbekannten Eltern verraten würde. Doch diesen Wunsch würde sie gewiss nicht vor ihrer todkranken Tante äußern.
»Wie kommst du bloß darauf, dass ich mit Erpressung mehr zu tun haben will als du, Nonno? Ich werde die Unterlagen nicht anrühren. Glaubst du denn, dass uns jemals jemand in Verdacht hatte, etwas zu wissen?«
Pietro wiegte das Haupt und zuckte dann doch mit den Schultern. »In den ersten Jahren war ich sicher, dass ich beobachtet werde. Es war für diese gerissenen Schweine nicht schwer herauszufinden, dass Giulietta ihr Kindchen beim Großvater untergebracht hatte. Und zu viele von ihnen wussten, dass mir ihre Art von Geschäften nicht ganz fremd ist. Da hätte es ja auf der Hand gelegen, bei mir nach dem zu suchen, was verschwunden war. Aber es hat mich nie einer von ihnen beiseitegenommen. Mag auch sein, dass nicht viele von den schmutzigen Briefen wussten. Vielleicht waren es nur ein paar Aaskrähen, die darauf gewartet haben, dass ich mir hole, was Valentiano an Gold und Juwelen versteckt hat.«
»Sag ihr den Namen des Bankiers. Was er aufbewahrt, ist das Einzige, was ihre Eltern ihr hinterlassen haben. Vielleicht braucht sie es eines Tages«, verlangte Zenobia mit schwacher Stimme.
»Es ist nicht so, als würde sie von mir gar nichts erben«, widersprach Pietro mit finster zusammengezogenen Brauen.
»Lass ihn, Zia Zenobia. Für heute habe ich genug erfahren. Er kann es mir später sagen«, wandte Alessa ein. Sie sah, wie sehr das Gespräch ihre Tante anstrengte, und fand es nicht anständig, sie weiter zu beanspruchen.
Zenobia seufzte und schloss die Augen. »Mir fällt so vieles ein, was ich dir hätte erzählen sollen. Aber ich muss jetzt schlafen. Kommst du morgen noch einmal zu mir?«, flüsterte sie.
Alessa beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Natürlich, wenn du es wünschst. Ich komme gleich morgens. Und wenn du zu müde zum Sprechen bist, dann lese ich dir etwas vor. Falls du das möchtest.«
Ihre Tante drückte ihre Hand, antwortete jedoch nicht und behielt die Augen geschlossen.
»Wir müssen gehen«, sagte Pietro mit rauer Stimme. Steifbeinig trat er neben sie an das Bett seiner Tochter und blickte auf sie hinab. »Hast mir viel Kummer gemacht«, stieß er plötzlich hervor.
Nun schlug sie die Augen noch einmal auf. »Du mir auch, Padre.«
Die Gasse, die von Zenobia Buccolinis Haus zum Campo San Samuele führte, war vom warmen Aprilsonnenschein erfüllt, der mittags für kurze Zeit seinen Weg zwischen die eng stehenden Häuserzeilen fand. Vor dem Teatro San Samuele tummelte sich ein kostümiertes Völkchen, das sich offenbar von einer Schauspielprobe erholte. Ein Arlecchino schlenkerte mit den Gliedmaßen wie eine durchgeschüttelte Marionette, und eine Ballerina streckte und dehnte sich anmutig, während eine als Magd gekleidete Colombina auf sie einredete.
Alessa war in Gedanken noch bei ihrer Tante, als sie hinter ihrem Großvater aus der Tür trat. Dennoch wunderte sie sich über den seltsamen Blick der Zofe, die sich an der Schlafkammertür ihrer Tante mit einem Knicks von ihnen verabschiedet hatte. Die Dienerin war ihr gegenüber in all den Jahren, die sie für Zenobia gearbeitet hatte, immer verschlossen gewesen. Doch sie hatte nie das Gefühl gehabt, dass Abneigung dahintersteckte. Der Blick, bei dem sie die Zofe eben ertappt hatte, war ihr jedoch feindselig vorgekommen. Hatte sie sich etwas zuschulden kommen lassen? Oder war das Weib nur bedrückt, weil es sich um seine Zukunft sorgte?
Vom Haus bis zum Theater waren es nur wenige Schritte, die sie schnell hinter sich gebracht hatten. Die Schauspieler schienen auf sie gewartet zu haben, denn sie hielten inne und wandten sich ihnen zu. Ihr Anführer, der das traditionelle schwarz-rote Kostüm eines Pantalone und den dazu passenden Spitzbart trug, kam auf ihren Großvater zu und umschloss mit seinen beiden Händen dessen rechte Hand.
»Signor Ferretti, darf ich Euch sagen, wie sehr ich mit Euch fühle? Wie geht es unserer verehrten Zenobia heute? Besteht noch Hoffnung auf eine Genesung?«
»Sie selbst schließt es aus. Ihr Leiden ist weit fortgeschritten, Signor Sartori. Ich rechne damit, dass es bald zu Ende geht«, erwiderte Pietro.
Alessa erinnerte sich an die schwarzen Bänder aus der Schatulle, die sie nachts aufgebrochen hatte. Sie lagen nun in dem Henkelkorb, den sie über dem Arm trug. Ein bitterer Hinweis ihres Großvaters darauf, dass sie bald Trauerkleidung tragen würden.
Vitale Sartori seufzte tief. »Ach, ›vielgestaltig ist der Menschen Leid. Mit immer neuem Fittich stürmt das Weh heran‹. So sprach schon vor langer Zeit mein hochverehrter Aischylos. Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Ihr Verlust wird alle Liebhaber des Theaters schwer treffen.«
Alessas Großvater stieß einen sarkastischen Laut aus. »Ja. Ihr Leichenzug wird an Länge und Lautstärke kaum zu überbieten sein. Jeder kleine Faxenmacher wird ihn begleiten.«
Der Schauspieler legte sich die Hand aufs Herz. »Auch ich würde es mir nicht nehmen lassen, der großen Zenobia Buccolini diese Achtung zu erweisen. Doch es hat sich ergeben, dass ich mit meiner Truppe einen Ruf ins Ausland erhielt. Wir reisen schon übermorgen nach Deutschland ab. Der Herzog von Braunschweig-Lüneburg wünscht seine Hofgesellschaft mit unseren Vorführungen zu erfreuen.«
Alessas Aufmerksamkeit war geweckt. »Sprecht Ihr etwa von Herzog Georg Wilhelm?«
Sartori nickte. »Eben dem Selbigen.«
»Dann seid so gut und erwähnt ihn und Eure Reise nicht vor meiner Tante, falls Ihr sie besucht. Der Herzog …«
»Der Herzog stand ihr einmal nahe. Ich habe davon gehört. Selbstverständlich werde ich vor ihr nicht darauf zu sprechen kommen, falls sie mir die Ehre erweist, mich noch einmal vorzulassen«, sagte der Schauspieler mit ernster Miene.
Alessas Großvater ergriff ihren Arm und zog sie weiter. »Wir müssen gehen. Komm jetzt, Mädchen.«
Seine grimmig verkniffenen Lippen ließen sie ahnen, dass sie einen Fehler gemacht hatte.
»Was ist denn? Was habe ich nun wieder getan?«, fragte sie, als sie außer Hörweite des Theatervolks waren.
»Ist dir nichts zu peinlich? Musst du diesen Popanz unbedingt mit der Nase auf die alte Geschichte stoßen? Es hat lang genug gedauert, bis sie aufgehört haben, darüber zu schwatzen. Der verdammte Tedesco! Als er mit dem kleinen Bastard fort war, dachte ich, die Zügellosigkeit würde ihr das Genick brechen, die sie auf einmal an den Tag legte. Ein Wunder, dass sie sich wieder gefangen hat. Nun … Geholfen hat es nichts.«
»Der Herzog hat sich ganz nach ihren Wünschen gerichtet, als er ihr Verhältnis beendet hat. Das hat sie immer wieder betont«, wandte Alessa ein.
»Aber gewiss doch. Alles verlief ganz nach ihrem Willen. Ha!« Er spuckte auf den Boden und machte deutlich, dass er nicht weiter über die Angelegenheit sprechen wollte.
Alessa erinnerte sich gut an den Tedesco, den Herzog aus Germania, der in ihrer Kindheit ganze Monate in Zenobias Haus verbracht hatte. Seinetwegen sprach sie seit ihrem siebten Lebensjahr fließend Deutsch und leidlich gutes Französisch, denn Zenobia hatte in den Jahren ihrer Bekanntschaft mit Herzog Georg Wilhelm Sprachunterricht genommen und darauf bestanden, dass sie, Alessa, daran teilnahm. Einige Jahre lang hatte sie in ihrer Gegenwart ausschließlich Deutsch oder Französisch sprechen dürfen. Wie ein wohlwollender Onkel war der Herzog entzückt gewesen, wenn sie ihm auf seine Fragen in seiner eigenen Sprache antwortete. Er hatte sie ebenso mit süßen Leckereien gefüttert wie ihren jüngeren Cousin – Zenobias Sohn Lucas. Dass der Herzog Lucas’ Vater war, hatte sie erst begriffen, als es zum Bruch zwischen ihm und ihrer Tante kam. Georg Wilhelm hatte angekündigt, dass die Verpflichtungen in seiner Heimat ihn zwängen, Venedig in Zukunft fernzubleiben. Zenobia hatte daraufhin wütend darauf bestanden, dass er den damals achtjährigen Lucas mit sich nahm. Seitdem hatte Alessa nichts mehr von ihrem Cousin gehört. Ihre Tante hatte alle Spuren ihres Sohns so gründlich aus ihrem Leben getilgt, dass es bald war, als hätte es ihn nie gegeben. Ob sie auch darüber vor ihrem Tod noch mit ihr sprechen würde? Oder ging es um Alessas Eltern?
In Gedanken versunken schritt sie neben ihrem ebenfalls schweigenden Großvater her und stieg schließlich mit ihm in eine Gondel, die sie beinah bis an ihr Ziel im Sestiere di Cannaregio brachte. Um einige Ecken gingen sie noch zu Fuß, in immer schmaler werdende, lückenlos bebaute, schummrige Gassen hinein, in die um keine Tageszeit Sonnenlicht fiel. Vor einer unscheinbaren Tür hielten sie an. Dreimal nacheinander klopfte Alessa drei kurze Schläge mit der flachen Hand gegen das raue Holz, woraufhin ihnen geöffnet wurde. Sie erklommen die Stiegen des Hauses bis in das zweite Stockwerk und vermieden es dabei, in die gefährliche Mitte der brüchigen Holzstufen zu treten. Die stehende Luft stank nach gekochtem Fisch, Katzenpisse und fauligem Gemüse und war so dick, dass man sie kaum atmen konnte. Alessa raffte ihren Rock, damit er weder den schmutzigen Boden noch die Wände berührte.
Die Wohnung im Obergeschoss bestand auf den ersten Blick aus einer kleinen Küche und einem Schlafraum, der so winzig war, dass kaum mehr als das Bett hineinpasste. Sie wurde von einer einarmigen alten Frau bewohnt, der sie eine Miete für die Bodenkammer zahlten, die nur von ihrer Schlafkammer aus durch eine kaum sichtbare Luke in der Decke zu erreichen war. Um hineinzugelangen, musste eine Leiter aufgestellt werden, die neben dem Bett lag. Während ihr Großvater einige höfliche Worte mit ihrer verschwiegenen Vermieterin wechselte, kletterte Alessa in ihr verstecktes Nest. Rasch nahm sie das schwarze Kostüm aus ihrem Henkelkorb, das sie in der Nacht getragen hatte, und brachte es wieder in der Kiste unter, die dafür vorgesehen war. Wenn sie es das nächste Mal brauchte, würde sie es hier anziehen und die Bodenkammer anschließend über die Dachluke verlassen. Üblicherweise kehrte sie auch über die Dächer hierher zurück, um wieder in ihr gewöhnliches Kleid zu schlüpfen, nur dieses Mal hatten sie es ausnahmsweise anders gemacht.
Als sie eine knappe Stunde später endlich in ihrem eigenen Haus im Sestiere San Polo angekommen waren, das zwar bescheiden, aber weit behaglicher ausgestattet war als die schäbigen Unterkünfte in Cannaregio, wo sie ihr Versteck gemietet hatten, konnte ihr Großvater vor Müdigkeit kaum noch die Augen offenhalten. Auch sie spürte die Folgen der kurzen Nacht und lockerte nur noch ihr Mieder, bevor sie Pietros Beispiel folgte und sich auf ihrem Bett ausstreckte.
Sie hätte lange geschlafen, wenn nicht noch vor Einbruch der Dunkelheit ein lautes Klopfen an der Haustür sie geweckt hätte. Verschlafen verbarg sie ihre zerwühlten Locken unter der Haube, die auf einem Bettpfosten gehangen hatte, bevor sie dem Besucher öffnete. Der junge Mann musste gar nichts sagen, um ihr seine Botschaft auszurichten. Er war einer von Zenobias Hausknechten, und seine Miene war so betrübt, dass sie gleich wusste, was geschehen war.
»Ist meine Tante gestorben?«, fragte sie, und er nickte.
Als sie die Nachricht ihrem Großvater überbrachte, überraschte er sie wieder einmal. Obwohl er sich mit dem Rücken zu ihr ans Fenster stellte und sich um eine besonders aufrechte Haltung bemühte, konnte er nicht vor ihr verbergen, dass er weinte.
»Ich habe es mir überlegt. Sie hatte recht«, sagte er heiser. »Der Tod wartet nicht, bis wir endlich ausgesprochen haben, wogegen wir uns sträuben. Der Bankier, bei dem der Nachlass deiner Eltern liegt … Sein Name ist Ulrico Benedetti.«
2
Alessa verbrachte den ganzen Tag nach dem Tod ihrer Tante in deren Haus. Zuerst ging es ihr nur darum, in Ruhe Abschied von der Toten zu nehmen. Doch im Laufe des Tages erschienen mehr und mehr Besucher auf der Schwelle, die zwar unter dem gleichen Vorwand kamen, sich aber mit auffällig gierigen Blicken in den Räumen umsahen. Das bescherte ihr das Gefühl, Zenobias Nachlass bewachen zu müssen. Daher blieb sie noch lange, nachdem ihr Großvater wieder gegangen war. Erst bei Anbruch der Dunkelheit verließ sie das Trauerhaus und befahl Zenobias Dienerschaft, die Türen hinter ihr zu verriegeln.
Auch an diesem Abend standen Schauspieler vor dem Theater, als Alessa vorüberging, doch da sie keine Anstalten machte, bei ihnen stehen zu bleiben, beschränkten sie sich darauf, Beileidsbekundungen zu murmeln. Alessa kannte viele von ihnen flüchtig, doch niemanden näher. Ihr Großvater und ihre Tante hatten darauf geachtet, dass sie sich dem bunten Volk nicht anschloss. Es war eine weitere Ungereimtheit in ihren Moralvorstellungen, dass sie selbst mit den Theaterleuten vertraut umgingen, sie aber nicht als vertrauenswürdigen Umgang für Alessa betrachteten.
Sie hatten Erfolg damit gehabt, bei ihr leises Misstrauen gegen die Lebensart dieser Menschen zu säen. Obwohl sie als Kind viel Zeit bei Zenobia verbracht hatte, die häufigen Theatervorstellungen geliebt und mehr über die Schauspielerei gelernt hatte, als ihrer Mutter vermutlich recht gewesen wäre, zog es sie nicht auf die Bühne. Sosehr sie ihre Tante bewundert hatte, war sie ihr doch ein abschreckendes Beispiel. Zenobia hatte geradezu zwanghaft in ständiger Verstellung gelebt, was ein Grund dafür war, dass sie einander nie wirklich nahegekommen waren. Alessa hatte nicht erkannt, wer ihre Tante unter all den Rollen eigentlich war. Lebte sie aus Überzeugung gern in Venedig, oder bedauerte sie, dass sie nichts anderes kennengelernt hatte? Waren ihre zahlreichen Liebhaber Ausdruck ihrer Lebenslust oder schiere Überlebensnotwendigkeit? Liebte sie Hündchen, oder verachtete sie die »Schoßratten«? Je nachdem, wer sie gefragt hatte, war die Antwort unterschiedlich ausgefallen und hatte dennoch immer überzeugend geklungen.
Umgekehrt hatte auch Alessa selbst nie offen über die Dinge sprechen dürfen, die ihr Großvater sie lehrte. Daher trauerte sie zwar um ihre Tante, die sie mit ihrem Großvater als letztem Verwandten zurückließ, doch es war nicht die Trauer um jemanden, der ihr liebevolle Zuwendung und Vertrautheit entgegengebracht hatte. Besonders nach dem Abschied von Lucas hatte Zenobia niemandem mehr Zuneigung gezeigt – außer ihren Liebhabern. Und auch das hatte Alessas Einschätzung nach wenig mit echten Gefühlen zu tun gehabt.
Die Gedanken an ihre Tante beschäftigten sie den ganzen Heimweg, sodass sie wenig von ihrer Umgebung wahrnahm. Deshalb erschrak sie umso heftiger, als sie ins Haus eintrat. Im Obergeschoss polterte es, als hätte ihr Großvater einen Stuhl umgeworfen und würde nun aus Wut über das Missgeschick unbeherrscht dagegentreten. Was ihm nicht unähnlich gesehen hätte. Vorsichtig lauschend stieg sie die Treppe empor. Worüber war er wütend? Vom oberen Treppenabsatz aus konnte sie in sein von Kerzenlicht erleuchtetes Gemach blicken. Ihr Herz überschlug sich, und sie stürzte vor. Ihr Großvater lag reglos am Boden.
»Nonno?«
Seine offenen Augen starrten ins Leere. Aus einer Kopfwunde floss Blut und versickerte in seinem geliebten indischen Teppich.
Bevor sie sich neben ihm niederknien konnte, wurde ihr mit einem kalten Schauder die Gegenwart eines weiteren Menschen im Raum bewusst. Hinter der Tür stand ein dunkel gekleideter Mann. Er rechnete offenbar nicht mit ihrer Schnelligkeit, denn die Bewegung, mit der er auf sie zukam, war halbherzig. Sie sprang mit einem Satz zur Tür und versetzte ihr im Hinauslaufen mit aller Kraft einen Stoß. Hart prallte das massive Holz gegen den Eindringling.
»Porca puttana!«, hörte sie den Kerl fluchen. Doch sie sah sich nicht nach ihm um, denn auf der Treppe wartete eine weitere schwarze, maskierte Gestalt auf sie – die Arme weit ausgebreitet. Sie raste in ihr eigenes dunkles Gemach, knallte die Tür hinter sich ins Schloss und schob den Riegel vor. Hastig riss sie den Beutel mit ihren Ersparnissen unter ihrer Matratze hervor und stopfte ihn in eine Tasche, die sie sich umhängte.
»Aber Kleine, das war ein Unfall! Ich wollte deinem Nonno nichts tun! Sei vernünftig und gib mir ein paar Antworten, dann kannst du dich um ihn kümmern, und dir geschieht nichts«, hörte sie durch die Tür.
Alessa nahm an, dass der Mann sprach, der ihren Großvater niedergeschlagen hatte. Seine kalte Stimme verriet, dass ihm Mitgefühl fremd war. Er konnte sie nicht täuschen. Ihr Großvater war tot. Sie hatte den Tod oft genug gesehen, um ihn zu erkennen. Ohne innezuhalten, steckte sie auch noch ihren Schmuck und ihre Schuhe in die Tasche.
»Was für Antworten?«, fragte sie, während sie sich schon barfuß zum Fenster bewegte und dabei ihren Rock schürzte.
»Öffne die Tür. Dann können wir uns unterhalten. Wenn du mir hilfst, bekommst du eine Belohnung, was hältst du davon? Und du stehst fortan unter meinem Schutz.«
»Ich glaube nicht, dass ich etwas Wichtiges weiß«, sagte sie und ließ ihre Stimme jämmerlich klingen.
»Den Namen des Bankiers. Hat dein Großvater ihn dir gesagt?«, fragte er.
Alessa entriegelte ihr Fenster. Die Angeln der Fensterflügel waren vorbildlich gefettet und quietschten nicht. Ein flinker Blick hinab auf den schmalen Rio zeigte ihr ein verdächtiges kleines Ruderboot, in dem ein Mann mit hochgeschlagenem Kragen in der Dunkelheit hockte.
»Mezzanotte! Das Weib steigt aufs Dach!«, brüllte er.
Mit einem dumpfen Knall rammte etwas ihre Zimmertür, als wollte ihr Gegner sie aufbrechen. Doch der erste Hieb war offenbar nur ein Ausdruck von Zorn, denn gleich darauf sah sie den Mann, den sie für den Mörder ihres Großvaters hielt, auf der Fensterbank des benachbarten Raums erscheinen. Sein Gesicht war von einem steifen runden Filzhut beschattet, die Gestalt von einer weiten grauen Jacke verhüllt. Mezzanotte. Jeder Venezianer hatte den Namen schon einmal gehört. Er war ein Mann, der im Auftrag mordete.
Den Weg von ihrem Fenster aus auf die Dächer hätte sie auch mit geschlossenen Augen zurücklegen können, so oft hatte sie die Mulden und Fugen der Wand für Hände und Füße schon genutzt. Sie spürte bereits die rauen Dachschindeln unter ihren nackten Fußsohlen und lief los, als ihr Verfolger noch überlegte, ob er sich ans Klettern heranwagen sollte. Der Mann im Boot allerdings folgte ihr unten auf dem Rio. Und dem Geräusch klappernder Holzschuhe nach zu urteilen, rannte auf der anderen Seite ihrer Häuserreihe jemand die Gasse entlang, der ihr vermutlich ebenfalls nichts Gutes wollte. Vorsichtig näherte sie sich dem Rand des Dachs, um Ausschau nach dem Läufer zu halten. Gerade als sie ihn zwischen den gewöhnlichen abendlichen Vorübergehenden entdeckte, stieß er gegen einen Muschelkarren, weil er den Blick während des Laufens nach oben gewandt hielt. Der Muschelverkäufer beschimpfte ihn, und Alessa war schon drauf und dran, die Ablenkung zu nutzen, als auch noch der Mörder auf der Gasse angerannt kam.
Eilig zog sie sich vom Rand des Dachs zurück und lief so schnell und so leichtfüßig wie möglich weiter. Den Ruderer auf dem Rio hatte sie bald hinter sich gelassen, und diesen kleinen Vorsprung nutzte sie, als sie in der Nähe der nächsten Brücke eine leere Gondel sah, die bei einem Hauseingang festgemacht war. Mit katzenhafter Geschwindigkeit kletterte sie nach unten, machte die Gondel los, stieß sie ab und sprang hinein – nur um sie an der Brücke bereits wieder zu verlassen. Einige Schritte lief sie am anderen Ufer in die Gasse hinein, die zur Brücke führte, bis sie vom Rio aus nicht mehr zu sehen war. Dann schlüpfte sie in einen ihr wohlbekannten, stets offenen Hauseingang, ging über einen Flur und durch eine Hintertür, die sich auf ein Gärtchen hin öffnete. Von hier aus kletterte sie erneut auf die Dächer, ohne auf das Schimpfen eines alten Weibes zu hören, das sich über sie beschwerte.
Für kurze Zeit hoffte Alessa, dass es ihr mit diesem Schachzug bereits gelungen war, die Verfolger zu überlisten. Doch Mezzanotte stellte sich als widerwärtig schlau heraus. Er fand den Weg, den sie genommen hatte, und folgte ihr von da an über die Dächer. Mehrfach schlug sie Haken, nahm verborgene Wege durch fremde Häuser, über Altane, durch Bootsgewölbe, über festgemachte Kähne und Gondeln. Immer wieder begriff er, was sie vorhatte, und blieb ihr auf den Fersen.
Sie war zum Umfallen erschöpft, als es ihr endlich gelang, ihn abzuschütteln. Den Stundenschlägen der Glocken nach lag sie eine ganze Stunde bäuchlings am Rande eines Dachs im Schatten des großen Schornsteinkopfs und hielt Ausschau in die Richtungen, aus denen Mezzanotte oder seine Helfer hätten auftauchen können. Ungefähr von der elften Stunde bis Mitternacht harrte sie reglos aus. Erst dann wagte sie es, ein bequemeres Versteck auf dem Dach zu suchen, sich dort auf den Rücken zu legen und in den Sternenhimmel zu blicken.
Mitternacht. Mezzanotte. Ihre Brust krampfte sich zusammen, weil auf einmal die Angst über sie herfiel, an die sie auf ihrer wilden Flucht keine Gedanken hatte verschwenden können. Wer hatte den Mörder geschickt? Wie hatte er so schnell von ihrem gefährlichen Geheimnis erfahren? Was sollte sie nun tun? In das Haus ihres Großvaters durfte sie nicht zurückkehren, das wurde gewiss beobachtet. Ausgeschlossen war auch, dass sie sich an die Polizia oder den Rat wandte, da sie nicht wusste, wer ihrem Großvater und ihr den Mörder auf den Hals gehetzt hatte. Falls der unbekannte mächtige Mann dahintersteckte, der sich von ihrem Geheimnis bedroht fühlte, konnte es geschehen, dass sie sich ungewollt selbst auslieferte. Die mächtigen Nobiles hatten überall Leute in ihrem Sold stehen.
Auch das Haus ihrer Tante kam als Zuflucht nicht infrage. Ein Mann von Mezzanottes Gerissenheit würde auch dort jemanden postiert haben, der auf sie lauerte. Wo also konnte sie sich verstecken? Nur zwei alte Freunde ihres Großvaters fielen ihr ein, die ihr vielleicht helfen konnten.
Leise seufzend richtete sie sich auf und bereitete sich gedanklich darauf vor, sie aufzusuchen.
*
Rebarino war ein dickwanstiger Hehler, mit dem Alessas Großvater sein Leben lang Geschäfte gemacht hatte. Ihn als Freund zu bezeichnen war möglicherweise zu hoch gegriffen. Aber zweifellos hatte die beiden ein Vertrauensverhältnis verbunden, und Rebarino kannte Alessa von klein auf. Weil er sie so gut kannte, ließ er sie keinen Augenblick draußen stehen, als sie in den frühen Morgenstunden bei ihm klopfte, sondern zog sie eilig ins Haus und verriegelte hinter ihr die Tür. Mit misstrauisch zusammengekniffenen Augen musterte er ihr vom Klettern zerschlissenes Kleid und schob sich die Nachtmütze aus der Stirn.
»Was ist los, Signorina? Hast du heute Nacht Pech gehabt? Ist dir jemand auf den Fersen? Dann schlüpf am besten gleich wieder aus der Hintertür.«
»Ich bin sicher, dass mir niemand hierher gefolgt ist. Aber ich bin in Schwierigkeiten. Großvater ist ermordet worden, Signor Rebarino. Und ich habe Angst um mein eigenes Leben. Verzeiht, wenn ich Euch so damit überfalle.«
Sie hielt inne, weil die Nachricht ihn doch schwerer zu treffen schien, als sie vermutet hatte. Er fasste sich ans Herz und verzog das Gesicht. »Da du zu mir kommst, statt zur Polizia zu gehen, kann ich mir vorstellen, dass es um schmutzige Verwicklungen geht. Fang gar nicht erst an, mir die Sache zu erklären, denn ich will nichts darüber wissen. Und erhoff dir nicht zu viel von mir. Ich konnte meinen Geschäften nur deshalb so lange nachgehen, weil ich mich stets herausgehalten habe, wenn etwas nach adligem Verbrechen roch. Pietro würde das verstehen. Wo ist sein Leichnam?«
Er fragte es so nüchtern, dass ihr gruselte. Für ihn war »der Leichnam« bereits nicht mehr ihr Großvater, dessen Tod sie selbst noch nicht fassen konnte. Sie fühlte sich wie betäubt, wenn sie an ihn dachte. »Ich weiß es nicht. Es ist in unserem Haus geschehen, aber ich war seitdem nicht mehr dort. Vielleicht haben die Mörder …«
Mit einer Geste wehrte er jede weitere Erklärung ab. »So viel kann ich dir zusagen, dass ich mich darum kümmern werde, ihm ein anständiges Begräbnis zu verschaffen, wenn es noch möglich ist. Du solltest dann nicht mehr in Venedig sein. Hast du Bekannte auf dem Festland, zu denen du gehen kannst?«
Wenn es noch möglich ist? Schmerzhaft verengte sich Alessas Kehle. Sie spürte, wie ihr die Tränen kamen, doch sie drängte sie zurück. Für Weinen und Wehklagen war keine Zeit. Sie sollte die Serenissima verlassen? In ihrem ganzen Leben hatte sie noch nicht einmal einen Fuß auf das Festland gesetzt, und sie kannte dort niemanden. Sie wusste beim besten Willen nicht, wohin sie gehen konnte. Ratlos zuckte sie mit den Schultern.
Mit sorgenvoller Miene rieb er sich die Stirn. »Hast du wenigstens Geld bei dir?«
Sie zögerte mit der Antwort. Bei aller Vertrautheit war Rebarino kein Mann, den man leichtfertig wissen ließ, wie viel Geld man bei sich trug. »Ich musste in aller Eile fliehen«, sagte sie daher nur.
»Aha. Also nicht. Oder zu wenig. Gewiss zu wenig. Nun, da können wir uns einigen. Ich strecke dir etwas vor, und dafür überschreibst du mir einen Anteil an dem, was dein Großvater hinterlassen hat. Da werde ich schon Mittel und Wege finden, zu meinem Recht zu kommen. Warte, ich setze gleich eine Urkunde auf. Vierzig Prozent? Ich denke, das ist gerecht, wenn man bedenkt, in welche Gefahr ich mich begebe.« Ohne ihre Entscheidung abzuwarten, schlurfte er in seinen Pantoffeln in das Nebenzimmer, in dem er seinen Schreibtisch stehen hatte. Doch bevor er den Federkiel zur Hand nahm, schloss er eine Truhe auf, nahm Münzen aus verschiedenen Gefäßen und zählte sie in einen Beutel, den er Alessa hinhielt. »Das sollte für eine Weile reichen. Bis sich die Wogen geglättet haben.«
Sie nahm den Beutel nicht. »Ihr glaubt, ich überschreibe Euch vierzig Prozent meiner Erbschaft, nur weil ich es etwas eilig habe? Signor Rebarino, ich brauche Hilfe, weil ich mich in Gefahr befinde – nicht, weil ich völlig verblödet bin. Was Ihr in diesen Beutel gesteckt habt, ist nur ein Bruchteil von dem, was Ihr Euch aneignen wollt.«
Rebarino verengte die Augen, was seinen Ärger verriet, obwohl seine Lippen lächelten. »Was hast du noch von deiner Erbschaft, wenn der Mörder dich erwischt, he? So werden Geschäfte nun mal gemacht, wenn das Risiko groß ist.«
»Ich werde dafür sorgen, dass er mich nicht erwischt. Ihr könnt den Beutel behalten. Wegen Geld bin ich nicht zu Euch gekommen«, sagte sie.
»Aber du brauchst Geld«, wandte er ein.
»Macht Euch darum keine Sorgen. Ich werde zurechtkommen. Um Eurer alten Freundschaft mit meinem Großvater willen möchte ich Euch um etwas anderes bitten. Ihr sollt Euch nicht dafür in Gefahr begeben. Aber Ihr kennt viele Menschen, und wenn Ihr die Ohren aufhaltet, werdet Ihr vielleicht einen Hinweis darauf finden, wer den Mörder auf Großvater und mich gehetzt hat. Ich werde Euch eines Tages schreiben. Und wenn Ihr mir dann einen Namen nennen könnt, werde ich Euch entlohnen, so gut es mir möglich ist.«
Mit einem Blick des Bedauerns legte er den Beutel zurück in die Truhe. »Das ist machbar. Obgleich ich natürlich nichts versprechen kann.«
Alessa hatte sich zwar mehr Unterstützung von ihm erhofft, doch im Grunde hatte er ihre Erwartungen erfüllt. Seine Habgier war stärker als jedes Pflichtgefühl einem toten Bekannten gegenüber. Vielleicht würde Rebarinos Habgier ihr aber immerhin Aufklärung über die Geschehnisse und die drohende Gefahr bringen – solange sie ihm keine Möglichkeit gab, sie zu verraten. Außerdem hatte er bestätigt, was sie sich bis dahin noch nicht hatte eingestehen wollen: Sie musste fort aus Venedig.
Dieses Mal stieg Alessa nicht durch das Fenster von Signor Bartoldos Schlafgemach in sein Haus ein, sondern klopfte frühmorgens an die Haustür. Sie hatte ihre Sachen aus dem Nest in Cannaregio geholt und sich bei der Gelegenheit in die Tracht einer Ordensschwester gekleidet, die ihr schon bei früheren Gelegenheiten nützlich gewesen war. In dieser Verkleidung war es ihr möglich, sich völlig unerkannt durch die Stadt zu bewegen.
Sie erinnerte sich noch an die warnenden Worte ihres Großvaters, was den schwächer werdenden Geist seines Freundes Bartoldo betraf. Doch nachdem der alte Nobile seine Bestürzung über die schlimme Nachricht von Pietros Tod überwunden hatte, fand sie ihn vernünftig und klarsichtig. Mit aller nötigen Vorsicht würde er die Verwaltung der Nachlässe ihrer Tante und ihres Großvaters in Auftrag geben, versicherte er.
Wenig später hatte sie sich ein weiteres Mal umgekleidet und ihr Haupt mit einem großen Umschlagtuch verhüllt. So schlüpfte sie mit dem Bündel ihrer Besitztümer unter dem Arm in einem einfachen Alltagsgewand durch die Hintertür ins Teatro San Samuele. Mit klopfendem Herzen hoffte sie, dass sie noch nicht zu spät kam.
In dem Gang hinter der Bühne, von dem die Garderoben abgingen, lungerte ein etwa elfjähriger Knabe herum. Er hatte die Hände in den Bund seiner Hose gesteckt, lehnte an der Wand und blickte nicht auf, als sie sich näherte.
»Buongiorno. Kann ich dich etwas fragen, Kleiner?«, sprach sie ihn an.
Auf einmal stand er stramm und sah ihr in die Augen. »Pronto, Signorina. Was möchtet Ihr wissen?«
»Weißt du, ob die Sartoris schon abgereist sind?«
Er runzelte die Stirn. »Das kommt darauf an.«
»Worauf denn?«
»Ob einer von ihnen Euch etwas schuldet.«
Sie konnte sich vorstellen, worauf die Auskunft hinauslief. »Wenn sie mir nichts schulden, sind sie noch da, nehme ich an?«
Der Knabe nickte. »Aber nur knapp. Sie warten schon am Anleger bei der Gondel, die sie auf die Terraferma bringen soll.«
»Danke.« Sie wollte ihm eine kleine Münze als Belohnung geben und zum Anleger eilen, als ihre Neugier doch noch siegte. »Worauf warten sie denn?«
»Auf Ottavio. Er ist da drin.« Er zeigte auf einen der beiden Garderobenräume.
Da Ottavio der Sohn von Vitale Sartori war, wie sie sehr wohl wusste, musste sie sich also nicht beeilen. Ohne ihn würde die Reise gewiss nicht beginnen.
»Was macht er denn noch da drin, wenn alle auf ihn warten?«, fragte sie.
»Er muss sich von der Signorina verabschieden, die ihn heiraten möchte. Sie will nicht, dass er weggeht.«
»Du weißt ja gut Bescheid.«
»Vitale hat gesagt, ich soll hier warten, bis die Glocke von San Samuele das nächste Mal läutet, und dann …« Die Glocke begann zu läuten. »Verzeihung, Signorina. Die Glocke!«
Der Kleine wandte sich der Garderobentür zu und hämmerte wild mit der Faust ans Holz. »Ottavio! Ottavio! Du musst kommen! Schnell! Deiner Mutter geht es schlecht!«
Die Tür wurde aufgerissen, und Ottavio Sartori stürzte heraus. Seiner tadellosen Kleidung nach war er nicht bei einer unziemlichen Tätigkeit unterbrochen worden. »Was ist mit Mamma? Ist etwas geschehen?«, fragte er, während er mit langen Schritten aus dem Theater stürmte. Alessa strengte sich an, um mit ihm und dem Botenjungen mitzuhalten.
»Das ist nur das, was ich sagen sollte, damit du herauskommst«, erklärte der Kleine, während sie über den Campo San Samuele liefen.
Ottavio verlangsamte seinen Schritt. »Soll euch doch der Teufel holen«, murmelte er, machte jedoch keine Anstalten umzukehren.
»Vitale sagt, du willst sie sowieso nicht heiraten«, sagte der Knabe.
»Weißt du, Flori, ich hätte ihr das gern in Ruhe erklärt. Man muss doch nicht immer lügen«, erwiderte Ottavio.
»Das ist eine ehrenwerte Haltung«, mischte Alessa sich ein und zog das Tuch etwas tiefer in ihr Gesicht. »Vielleicht war nur der Moment für die Erklärung nicht ganz passend gewählt?«
Erst jetzt schien der junge Schauspieler sie zu bemerken. »Wer …? Signorina Ferretti? Was machst du denn hier? Verzeihung! Was macht Ihr denn hier?«
Sie legte den Finger an ihre Lippen. »Tu mir den Gefallen und nenn mich für den Augenblick nur Alessa, ja? Oder Signorina … Signorina Rizzi. Ich bin in einer misslichen Lage und möchte deinen Vater bitten, mich mit aufs Festland zu nehmen. Ohne Aufsehen, wenn es möglich ist.«
Er sah sie mitleidig an. »Hat es etwas mit dem Tod deiner Tante zu tun? Musst du ihre Angelegenheiten regeln? Sag einfach, du musst noch etwas für Zenobia tun, dann wird Papa nicht weiter fragen und dich mitnehmen.«
Die Sartoris fuhren auf einer großen, von zwei Männern geruderten Gondel zum Festland, wurden jedoch von einem weiteren, breiten Lastenboot begleitet, das ihre zahlreichen Truhen, Körbe und Taschen beförderte. Immerhin waren sie keine bettelarmen Straßenkomödianten, sondern begehrte Künstler ihres Fachs, denen schon so manche hohe Herrschaft ihre Gunst erwiesen hatte. Ihr Anführer Vitale hatte es so eilig aufzubrechen, dass er Alessa in die Gondel steigen ließ, ohne vorher Erklärungen von ihr zu verlangen.
Während die beiden Gondolieri die Gondel auf den Canale della Giudecca hinauslenkten, war Alessa hin- und hergerissen zwischen dem Vorsatz, sich unter ihrem Umschlagtuch zu verstecken, und ihrem Bedürfnis, noch einmal den Anblick ihrer Heimatstadt in sich aufzusaugen. Der Dogenpalast war bereits außer Sicht. Sie konnte sich nicht verkneifen, sich nach Santa Maria della Salute umzudrehen. Würde das prachtvolle Kirchengebäude fertiggestellt sein, wenn sie es wiedersah? Oder würde sie etwa die Schönheit Venedigs nie wieder genießen dürfen? Nie wieder die Palazzi sehen, die Brücken und Türme, in deren Glanz sie aufgewachsen war?
Vitale, der eben noch neben seinem Sohn gesessen hatte, nahm nun bei ihr auf der Bank Platz. »Willst du mir erzählen, warum du so dringend aufs Festland musst, Signorina Rizzi? Zwar haben wir strikte Reisepläne, aber vielleicht kann ich dir dennoch bei der Erledigung deiner Angelegenheiten zu Diensten sein. Man sieht ja, wie ungern du die Serenissima verlässt. Gewiss möchtest du schnell wieder zurück zu deinem Großvater?«
Auch die Kirchenbaustelle hatten sie hinter sich gelassen, und so, wie die kräftigen Gondoliere ruderten, würde es nicht lange dauern, bis sie an Land gehen mussten. Alessa hatte sich genau überlegt, was sie Vitale Sartori sagen wollte, doch als er ihren Großvater erwähnte, blieben ihr die Worte im Hals stecken. Ausgerechnet jetzt holte ihre Trauer sie ein. Sie musste mit den Tränen kämpfen, was ihrem Gegenüber nicht entging.
»Ach du lieber Gott, hast du dich mit ihm zerstritten? Ich weiß, Pietro Ferretti ist kein sanfter Mann, aber er meint es sicher gut mit dir. Du solltest nicht davonlaufen, das bricht ihm das Herz.«
Alle wohlbedachten Worte kamen Alessa nun schal vor, und die üble Wahrheit brach aus ihr hervor. »Mein Großvater ist tot. Er wurde gestern ermordet. Ich ersuche Euch um Euren Schutz, Signor Sartori. Wenn ich in Venedig bleibe, ist mein Leben in Gefahr. Könnt Ihr mich mit nach Deutschland nehmen? Dort habe ich einen Verwandten, und Herzog Georg Wilhelm wird mir in Erinnerung an alte Zeiten vielleicht Zuflucht gewähren.«
Erschrocken blickte er über die Schulter zurück. »Porca miseria. Was für schreckliche Neuigkeiten, Signorina! Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist, als du zu uns kamst?«
»Ich habe mir die größte Mühe gegeben, nicht entdeckt zu werden und geheimzuhalten, dass ich die Stadt verlassen will. Wenn ich mich Euch anschließen kann und mich ganz unauffällig verhalte, wird er … werden sie meine Spur nicht wiederfinden.«
Vitale warf ihr einen halb entsetzten, halb belustigten Blick zu. »Wie würdest du es anstellen, dich bei einem Trupp von Schauspielern unauffällig zu verhalten? Wir spielen alle unsere Rollen, das weißt du doch wohl? Als braves und anständiges junges Weib stichst du zwischen uns heraus wie ein Täubchen aus einem Schwarm Papageienvögel.«
»Wenn Ihr mir ein paar bunte Federn leiht, die ich mir ins Gefieder stecken kann, werde ich schon nicht auffallen. Bitte!«, flehte sie.
»Aber was, wenn sie dir doch auf die Schliche kommen? Ich trage die Verantwortung für meine Leute. Wir geraten alle in Gefahr, wenn …«
Alessa schüttelte den Kopf. »Meine Feinde können nicht wissen, dass ich Venedig verlassen habe. Und wenn wir alle so tun, als würde ich zu Euch gehören, dann werden sie meine Spur nicht finden. Außerdem … Ich kann mich sicher nützlich machen. Wollt Ihr unterwegs auftreten? Ein paar kleine Kunststücke werde ich schon hinbekommen. Tante Zenobia hat mich viel tanzen und turnen lassen.«
Vitale seufzte. »Bei der vielen Zeit, die du bei ihr und im Theater verbracht hast, sollte man meinen, dass du etwas von der Schauspielkunst verstehst. Aber …«
Sie fiel ihm wieder ins Wort. »Und ich beherrsche fließend die deutsche Sprache. So gut wie meine eigene. Außerdem spreche ich Französisch. Das könnte für Euch von großem Nutzen sein.«
Tatsächlich schien ihm dieser Umstand zu denken zu geben. Angespannt schaute er noch einmal über die Schulter zurück und ließ den Blick über die Fassaden der Häuser schweifen, die den Canale della Giudecca säumten. »Gut, wir nehmen dich vorerst mit. Aber wenn ich eine Möglichkeit sehe, dich sicherer unterzubringen, dann musst du gehen. Mir käme es viel passender vor, wenn du dich in einem Kloster in den Bergen verstecken würdest. Dein Großvater hätte dich nicht bei uns sehen wollen. Auch Zenobia hätte es nicht gefallen.«
Alessa zuckte mit den Schultern. »Sie würden es verstehen. Ich danke Euch.«