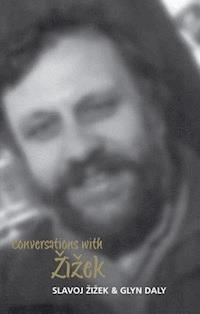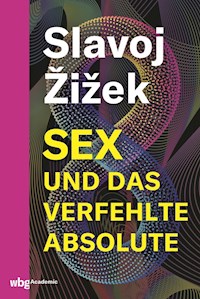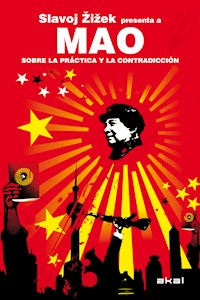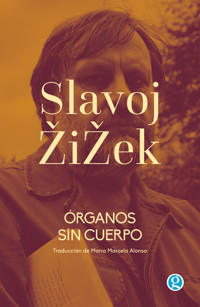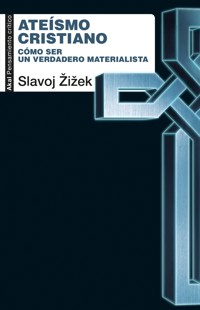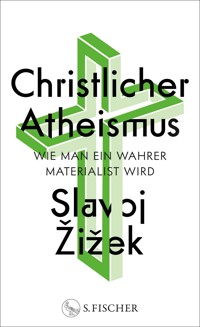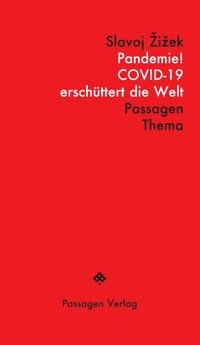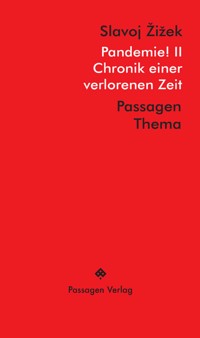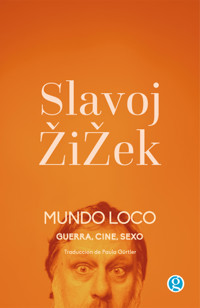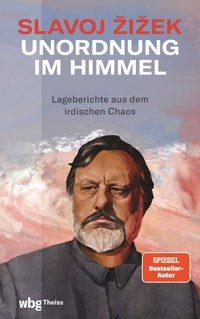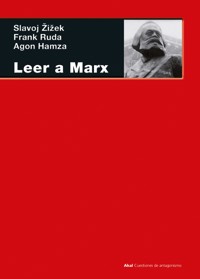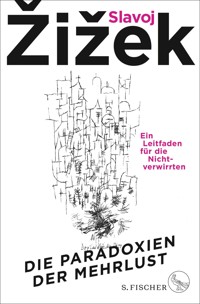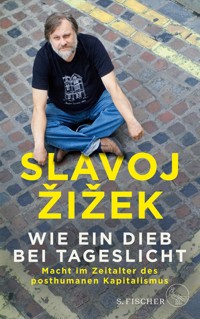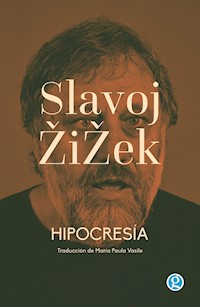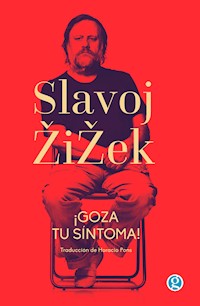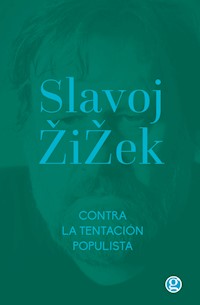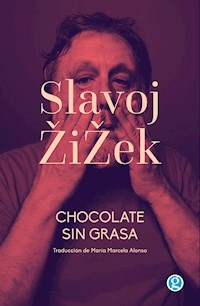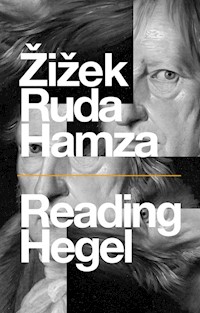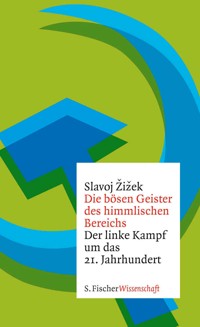
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»ein kluges Buch voll radikaler Gedanken – und trotzdem eine durchaus angenehme Überraschung.« Kölner Stadt-Anzeiger »Der wilde Denker hilft uns, aus unseren Träumen zu erwachen und dem Alptraum unserer Zeit ins Auge zu sehen. In diesem Sinne ist Slavoj Žižek wohl einer der letzten großen Realisten.« 3sat Kulturzeit Seit Jahren verflogt Slavoj Žižek das Projekt, eine Ideologiekritik der Gegenwart aus kommunistischer Perspektive zu betreiben. Ausgangspunkt ist die Diagnose, dass unsere liberale Kultur nicht einmal mehr an ihre eigenen Überzeugungen glaubt. Unter dem Motto des Apostels Paulus, dass es »gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs« zu kämpfen gelte, analysiert Žižek mit Parteilichkeit, Leidenschaft und Witz das Versagen der Linken im 20. Jahrhundert. Was kann man daraus lernen, um das linke Projekt für das 21. Jahrhundert zu wappnen? Anstatt der weichen Politik der Vermeidung des Schlimmsten zu folgen, geht es darum, den utopischen Kern einer besseren Gesellschaft zu stärken und dem globalen Kapitalismus eine Alternative entgegenzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Slavoj Žižek
Die bösen Geister des himmlischen Bereichs
Der linke Kampf um das 21. Jahrhundert
Über dieses Buch
In seinem neuen Buch führt Slavoj Žižek das Projekt fort, eine Ideologiekritik der Gegenwart aus kommunistischer Perspektive zu betreiben. Ausgangspunkt ist die Diagnose, dass unsere liberale Kultur nicht einmal mehr an ihre eigenen Überzeugungen glaubt. Unter dem Motto des Apostels Paulus, dass es »gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs« zu kämpfen gelte, analysiert Žižek mit Parteilichkeit, Leidenschaft und Witz das Versagen der Linken im 20. Jahrhundert. Was kann man daraus lernen, um das linke Projekt für das 21. Jahrhundert zu wappnen? Anstatt der weichen Politik der Vermeidung des Schlimmsten zu folgen, geht es darum, den utopischen Kern einer besseren Gesellschaft zu stärken und dem globalen Kapitalismus eine Alternative entgegenzustellen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Slavoj Žižek, geboren 1949, ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er lehrt an der Universität von Ljubljana in Slowenien und ist derzeit International Director am Birkbeck Institute for the Humanities in London. Seine zahlreichen Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt.
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
© Slavoj Žižek 2011
Für die deutsche Ausgabe:
© 2011 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401400-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung: Scilicet
1 Radikale Intellektuelle oder: Warum Heidegger 1933 den richtigen Schritt machte
Den Baum im Wald verbergen
Eine Domestizierung Nietzsches
Michel Foucault und das iranische Ereignis
Immer Ärger mit Heidegger
Ontologische Differenz
Schlagende Beweise gegen Heidegger?
Die Wiederholung und das Neue
Von Heidegger zum Trieb
Heideggers »göttliche Gewalt«
2 Revolutionärer Schrecken von Robespierre bis Mao
»Was wollt ihr denn?«
Das Unmenschliche geltend machen
Transsubstantiationen des Marxismus
Die Grenzen von Maos Dialektik
Kulturrevolution und Macht
3 Eine Neubetrachtung des Stalinismus oder: Wie Stalin die Menschlichkeit des Menschen rettete
Die stalinistische Gegen-Kulturrevolution
Ein Brief, der seinen Adressaten nie erreichte (und dadurch vielleicht die Welt rettete)
Kreml-Astrologie
Von der objektiven zur subjektiven Schuld
Schostakowitsch in Casablanca
Der stalinistische Karneval…
… in den Filmen Sergej Eisensteins
Die minimale Differenz
4 Von Anfang beginnen
Menschliches, Allzumenschliches …
Der »neue Geist« des Kapitalismus
Zwischen den zwei Fetischismen
Kommunismus, noch einmal!
Die neue Eingrenzung der Commons
Sozialismus oder Kommunismus?
Die kapitalistische Ausnahme
Vom Profit zur Rente
»Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben«
Einleitung: Scilicet
Die rhetorische Figur »das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce« beschäftigte Marx seit Beginn seiner kritischen Arbeit. Schon in seiner Schrift »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie« diagnostiziert er den Verfall des deutschen Ancien Régime in den 1830er und 40er Jahren als farcehafte Wiederholung des tragischen Sturzes des Ancien Régime in Frankreich:
»Es ist lehrreich für sie [die modernen Völker], das ancien régime, das bei ihnen seine Tragödie erlebte, als deutschen Revenant seine Komödie spielen zu sehen. Tragisch war seine Geschichte, solange es die präexistierende Gewalt der Welt, die Freiheit dagegen ein persönlicher Einfall war, mit einem Wort, solange es selbst an seine Berechtigung glaubte und glauben mußte. Solange das ancien régime als vorhandene Weltordnung mit einer erst werdenden Welt kämpfte, stand auf seiner Seite ein weltgeschichtlicher Irrtum, aber kein persönlicher. Sein Untergang war daher tragisch.
Das jetzige deutsche Regime dagegen, ein Anachronismus, ein flagranter Widerspruch gegen allgemein anerkannte Axiome, die zur Weltschau ausgestellte Nichtigkeit des ancien régime, bildet sich nur noch ein, an sich selbst zu glauben, und verlangt von der Welt dieselbe Einbildung. Wenn es an sein eignes Wesen glaubte, würde es dasselbe unter dem Schein eines fremden Wesens zu verstecken und seine Rettung in der Heuchelei und dem Sophisma suchen? Das moderne ancien régime ist nur mehr der Komödiant einer Weltordnung, deren wirkliche Helden gestorben sind. Die Geschichte ist gründlich und macht viele Phasen durch, wenn sie eine alte Gestalt zu Grabe trägt. Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Gestalt ist ihre Komödie. Die Götter Griechenlands, die schon einmal tragisch zu Tode verwundet waren im gefesselten Prometheus des Äschylus, mußten noch einmal komisch sterben in den Gesprächen Lucians. Warum dieser Gang der Geschichte? Damit die Menschheit heiter von ihrer Vergangenheit scheide. Diese heitere geschichtliche Bestimmung vindizieren wir den politischen Mächten Deutschlands.«[1]
Man beachte die präzise Charakterisierung des deutschen Ancien Régime: Es »bildet sich nur noch ein, an sich selbst zu glauben« – man kann sich an dieser Stelle sogar Gedanken über die Bedeutung der Tatsache machen, dass Kierkegaard etwa zur selben Zeit die These aufstellte, wir Menschen könnten niemals sicher sein, dass wir wirklich glauben: Letztlich »glauben wir nur, dass wir glauben« … Die Formel des Regimes, das »sich nur noch ein[bildet], an sich selbst zu glauben« gibt sehr treffend die Auflösung der performativen Kraft (der »symbolischen Wirksamkeit«) der herrschenden Ideologie wieder: Diese hat aufgehört, als Grundstruktur der bestehenden Sozialität zu fungieren. Sind wir heute in der gleichen Situation? Bilden sich unsere Prediger und Praktiker der liberalen Demokratie ebenfalls nur noch ein, an sich selbst und an ihre eigenen Worte zu glauben? Treffender erscheint mir, den aktuell vorherrschenden Zynismus als exakte Umkehrung der Marx’schen Formel zu beschreiben: Wir bilden uns nur ein, nicht mehr »wirklich« an unsere Ideologie zu glauben – trotz dieser imaginären Distanz üben wir sie weiterhin aus. Wir glauben nicht weniger, sondern viel stärker als wir uns zu glauben einbilden. Insofern war Benjamin mit seiner Bemerkung, alles hänge davon ab, wie man an seinen Glauben glaubt, sehr vorausschauend.
Dieses ideologische Dilemma bildet den Ausgangspunkt für das vorliegende Buch. Es liefert keine nüchterne Analyse, sondern eine äußerst »parteiische«, engagierte Beurteilung – die Wahrheit ist parteiisch und nur zugänglich, wenn man einen Standpunkt einnimmt, doch wird sie dadurch nicht weniger universell. Der hier vertretene Standpunkt ist natürlich der des Kommunismus. Adorno beginnt seine Drei Studien zu Hegel mit einer Zurückweisung der traditionellen Frage nach der aktuellen Bedeutung von Hegels Werk, wie sie exemplarisch im Titel von Benedetto Croces Buch Lebendiges und Totes in Hegels Philosophie zum Ausdruck kommt. Wer so fragt, maßt sich die arrogante Position eines Richters über die Vergangenheit an. Wenn wir uns mit einem wahrhaft großen Philosophen beschäftigen, muss die Frage nicht lauten, was dieser Philosoph uns heute noch zu sagen hat, was er für uns bedeutet, sondern umgekehrt was wir und unsere gegenwärtige Situation für ihn bedeuten, wie unser Zeitalter seinem Denken erschienen wäre. Und ebenso sollten wir auch mit dem Kommunismus verfahren: Anstatt die offensichtliche Frage zu stellen: »Ist die Idee des Kommunismus noch relevant, taugt er heute noch als Analyseinstrument und als politische Praxis?«, sollten wir umgekehrt fragen: »Wie stellt sich unser aktuelles Dilemma aus der Perspektive der kommunistischen Idee dar?« Dahinter steckt die Dialektik von Alt und Neu: Wer ständig neue Begriffe einführt, um zu erfassen, was heute vor sich geht (»postmoderne Gesellschaft«, »Risikogesellschaft«, »Informationsgesellschaft«, »postindustrielle Gesellschaft« usw.), der übersieht die Umrisse des eigentlich Neuen. Die Neuartigkeit des Neuen lässt sich nur begreifen, wenn man das, was vor sich geht, durch die Linse dessen analysiert, was am Alten »ewig« war. Wenn der Kommunismus wirklich eine »ewige« Idee ist, dann wirkt er im Sinne der Hegel’schen »konkreten Allgemeinheit«: Er ist ewig nicht im Sinne einer Reihe abstrakt-allgemeiner Eigenschaften, die auf jede Situation angewendet werden können, sondern in dem Sinne, dass er in jeder neuen historischen Situation jeweils neu erfunden werden muss.
In der guten alten Zeit des real existierenden Sozialismus kursierte in Dissidentenkreisen ein Witz, der die Nutzlosigkeit ihres Protests verdeutlichen sollte: Im von den Mongolen besetzten Russland des 15. Jahrhunderts geht ein Bauer mit seiner Frau eine staubige Landstraße entlang; plötzlich kommt ein mongolischer Krieger angeritten, hält neben ihnen und teilt dem Bauern mit, er werde jetzt seine Frau vergewaltigen; außerdem verlangt er: »Weil der Boden so staubig ist, sollst du meine Hoden hochhalten, während ich deine Frau vergewaltige, damit sie nicht schmutzig werden!« Als der Mongole fertig ist und wieder wegreitet, fängt der Bauer auf einmal an zu lachen und Freudensprünge zu machen; die überraschte Ehefrau fragt ihn: »Wie kannst du Freudensprünge machen, wo ich gerade in deiner Gegenwart brutal vergewaltigt worden bin?« Der Bauer antwortet: »Ich hab ihn drangekriegt! Seine Eier sind voller Staub!« Dieser traurige Witz spiegelt das Dilemma der Dissidenten wider: Sie dachten, sie würden der Parteinomenklatura schwere Schläge versetzen, dabei streuten sie ihr in Wirklichkeit nur ein bisschen Staub auf die Weichteile, während die Nomenklatura weiter das Volk vergewaltigte … Befindet sich die kritische Linke heute nicht in einer ähnlichen Lage? (Zu den aktuellen Bezeichnungen für das vorsichtige Beschmieren der Eier der Machthabenden mit Staub gehören definitiv »Dekonstruktion« und »Schutz individueller Freiheiten«.) In einem berühmten Wortwechsel an der Universität von Salamanca 1936 entgegnet Miguel de Unamuno den Frankisten: »Venceréis, pero no convenceréis« (Ihr werdet siegen, aber nicht überzeugen) – ist das alles, was die heutige Linke dem triumphierenden globalen Kapitalismus entgegenzusetzen hat? Ist es das Schicksal der Linken, weiterhin die Rolle derer zu spielen, die – umgekehrt – überzeugen, aber nicht siegen (und dann ganz besonders überzeugend darin sind, nachträglich die Gründe für ihr Scheitern zu erklären)? Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, wie wir einen Schritt weiter gehen können – unsere elfte These sollte lauten: Die kritische Linke hat die Eier der Mächtigen in unseren Gesellschaften nur mit Staub beschmutzt, es kommt aber darauf an, sie abzuschneiden.
Aber wie? Hier gilt es, aus den Fehlern der linken Politik des 20. Jahrhunderts zu lernen. Die Aufgabe ist nicht, den Mächtigen in einer direkten sich zuspitzenden Konfrontation die Eier abzuschneiden, sondern ihre Position durch geduldige Ideologiekritik zu unterminieren, so dass wir, noch während sie an der Macht sind, plötzlich merken, dass sie, auch wenn sie uns wild attackieren, schon mit einer höheren Stimme sprechen … In den 1960er Jahren gründete Lacan eine Zeitschrift seiner Schule, die unregelmäßig und nur für kurze Zeit erschien, und gab ihr den Namen Scilicet – die Botschaft dahinter lag nicht in der heute vorherrschenden Bedeutung des Wortes (»nämlich«, »das heißt«, »und zwar«), sondern in dem eigentlichen Wortsinn »man darf wissen« (Was darf man wissen? Was die École Freudienne de Paris über das Unbewusste denkt …). Unsere Botschaft heute sollte dieselbe sein: Man darf wissen, was Kommunismus ist und sich ganz dafür einsetzen, man darf wieder ganz getreu der kommunistischen Idee handeln. Die liberale Permissivität gehört in den Bereich des videlicet – man darf sehen – und unsere Faszination für die Obszönität, die wir sehen dürfen, verhindert, dass wir wissen, was wir sehen.
Das vorliegende Buch ist daher ein Buch des Kampfes in Anlehnung an Paulus’ überraschend aktuelle Definition des emanzipatorischen Kampfes: »Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs.« (Eph 6,12) Oder in die heutige Sprache übersetzt: »Wir kämpfen nicht gegen konkrete korrupte Individuen, sondern gegen die Mächtigen im Allgemeinen, gegen ihre Autorität, gegen die globale Ordnung und die ideologische Mystifikation, auf welcher sie beruht.« Sich auf diesen Kampf einzulassen bedeutet, Badious Motto »mieux vaut un désastre qu’un désêtre« anzuerkennen: Es ist besser, das Risiko der Treue zum Wahrheitsereignis einzugehen, auch wenn diese Treue in die Katastrophe führt, als in dem utilitaristisch-hedonistischen, ereignislosen Zustand der Nietzscheanischen letzten Menschen dahinzuvegetieren. Was Badiou ablehnt, ist jene liberal-viktimistische Ideologie, für die Politik nur noch bedeutet, das Schlimmste zu verhindern, alle positiven Projekte aufzugeben und die am wenigsten schlechte Option zu verfolgen – oder, wie der jüdische Wiener Schriftsteller Arthur Feldmann bitter bemerkte: Wir überleben größtenteils auf Kosten des Lebens.
Fußnoten
[1]
Karl Marx, »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung«, in: Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 1 , Berlin: Dietz 1976, S.381f.
1 Radikale Intellektuelle oder: Warum Heidegger 1933 den richtigen Schritt machte[2]
Den Baum im Wald verbergen
Als Father Brown in G. K. Chestertons Erzählung »Das Zeichen des zerbrochenen Säbels« (aus dem Band Father Browns Einfalt)[3] seinem Freund Flambeau das Geheimnis der Geschichte enthüllt, beginnt er mit dem, »was alle Welt weiß«, nämlich dass
»Arthur St. Clare ein großer und erfolgreicher englischer General war. Man weiß, daß er nach glänzenden, aber sorgfältig geführten Feldzügen in Indien und Afrika das Kommando gegen Brasilien hatte, als der große brasilianische Patriot Olivier sein Ultimatum stellte. Man weiß, daß bei jener Gelegenheit St. Clare mit sehr schwachen Kräften Olivier mit sehr starken Kräften angriff und nach heldenhaftem Widerstand gefangengenommen wurde. Und man weiß, daß nach seiner Gefangennahme St. Clare zum Entsetzen der gesamten zivilisierten Welt am nächsten Baum aufgehängt worden ist. Man fand ihn dort baumelnd, nachdem die Brasilianer sich zurückgezogen hatten, mit dem zerbrochenen Säbel um den Hals.«[4]
Father Brown bemerkt allerdings, dass etwas an dieser allbekannten Geschichte nicht stimmen kann: St. Clare, als stets bedächtiger Befehlshaber bekannt, der »immer mehr für die Pflicht als für das Wagnis« war, unternimmt einen törichten Vorstoß, der in einem Desaster endet; und Olivier, der als »großmütig wie ein fahrender Ritter« gilt und Gefangene fast immer wieder laufen lässt, ermordet St. Clare auf grausame Weise. Um dieses Rätsel zu erklären, bedient sich Father Brown einer Metapher:
»›Wo verbirgt der Weise ein Blatt? Im Wald. Aber was tut er, wenn da kein Wald ist?‹ […] ›Er läßt einen Wald wachsen, um es darin zu verbergen‹, sagte der Priester mit undeutlicher Stimme. ›Eine furchtbare Sünde.‹ […] ›Und wenn ein Mann eine Leiche zu verbergen hat, dann schafft er ein Feld von Leichen, sie darin zu verbergen.‹«[5]
Die Auflösung beruht auf der Annahme einer dunklen, verdorbenen Seite des englischen Helden. Sir Arthur St. Clare war
»ein Mann, der seine Bibel las. Das war es, was mit ihm los war. Wann werden die Menschen begreifen, daß es für einen Mann nutzlos ist, seine Bibel zu lesen, wenn er nicht auch aller anderen Bibel liest? Ein Drucker liest eine Bibel auf Setzfehler hin. Ein Mormone liest seine Bibel und findet darin Vielweiberei; ein Christian Scientist liest die seine und findet darin, daß wir keine Arme und Beine haben. St. Clare war ein alter protestantischer Angloindien-Soldat. […] Und natürlich findet er im Alten Testament alles, was er sich wünscht – Wollust, Tyrannei, Verrat. O ja, natürlich war er ein Ehrenmann, wie Sie das nennen. Aber welchen Wert hat es, wenn ein Mann in seiner Verehrung der Ehrlosigkeit Ehrenmann ist?«[6]
Unmittelbar vor der verhängnisvollen Schlacht im brasilianischen Urwald hatte der General plötzlich vor einem unerwarteten Problem gestanden: Sein begleitender, jüngerer Offizier, Major Murray, war irgendwie hinter die grässliche Wahrheit gekommen; und als sie langsam durch den Urwald gingen, hatte er Murray mit seinem Säbel getötet. Was sollte er nun mit dem unerklärlichen Leichnam tun? »›Er konnte den Leichnam weniger unerklärlich machen. Er konnte einen Hügel Leichname schaffen, um diesen einen zu bedecken. 20 Minuten danach marschierten 800 englische Soldaten in ihren Tod.‹«[7] Hier lief die Sache für den General allerdings schief: Die überlebenden englischen Soldaten hatten irgendwie erraten, was er getan hatte – sie waren es, die den General töteten, nicht Olivier. Nachdem sie sich diesem ergeben hatten, ließ der sie großmütig frei und zog sich mit seinen Truppen zurück. Daraufhin verurteilten und henkten die überlebenden Soldaten St. Clare, um anschließend zur Bewahrung des Ruhms der englischen Armee ihre Tat durch die Geschichte, Olivier habe ihn umgebracht, zu vertuschen.
Die Erzählung endet im Stile eines John-Ford-Westerns (denken wir etwa an Bis zum letzten Mann, als John Wayne am Ende den Journalisten seine Version des von Henry Fonda gespielten rücksichtslosen Generals schildert), wo die Heldenlegende mehr zählt als die Wahrheit: »Millionen, die ihn nie gekannt haben, werden ihn wie einen Vater lieben – diesen Mann, den die wenigen letzten, die ihn kannten, wie Mist behandelten. Er wird ein Heiliger sein; und die Wahrheit über ihn wird nie erzählt werden, denn ich habe mich endlich entschlossen.«[8] Worin liegt nun die hegelianische Lehre dieser Geschichte? Liegt sie darin, dass man die schlichte, zynisch-denunzierende Interpretation ablehnen sollte? Oder darin, dass der Blick, welcher die Verderbtheit des Generals auf die Wahrheit seiner Persönlichkeit reduziert, selbst gemein und niederträchtig ist? Hegel hat dies vor langer Zeit als die Falle der schönen Seele beschrieben, deren Blick alle großen Heldentaten auf die privaten, gemeinen Motive derer reduziert, die sie begehen:
»Es gibt keinen Helden für den Kammerdiener; nicht aber weil jener nicht ein Held, sondern weil dieser – der Kammerdiener ist, mit welchem jener nicht als Held, sondern als Essender, Trinkender, sich Kleidender, überhaupt in der Einzelheit des Bedürfnisses und der Vorstellung zu tun hat. So gibt es für das Beurteilen keine Handlung, in welcher es nicht die Seite der Einzelheit der Individualität der allgemeinen Seite der Handlung entgegensetzen und gegen den Handelnden den Kammerdiener der Moralität machen könnte.«[9]
Haben wir es somit bei Father Brown, wenn er auch kein solcher Kammerdiener der Moralität für seinen General ist, nicht doch zumindest mit einem Zyniker zu tun, der weiß, dass die unangenehme Wahrheit zugunsten des allgemeinen Wohls vertuscht werden muss? In der Beantwortung der Frage nach der Verantwortlichkeit für den allmählichen Sturz des Generals beweist Chesterton seine theologische Finesse: Es ist nicht etwa so, dass der General mit seiner moralischen Verdorbenheit aufgrund des Vorherrschens niederträchtiger, materialistischer Motive den christlichen Glauben verraten hat. Chesterton ist klug genug, die Ursache für den moralischen Niedergang des Generals als etwas zu erkennen, das dem Christentum inhärent ist: Der General war »ein Mann, der seine Bibel las. Das war es, was mit ihm los war.« Schuld war also die besondere – in diesem Fall protestantische – Interpretation. Und gilt nicht in etwa dasselbe für den Versuch Heideggers (aber auch Adornos und Horkheimers und sogar Agambens), die Schuld an den ethisch-politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts in der gesamten Tradition der »abendländischen Metaphysik« zu suchen, die mit ihrer instrumentellen Vernunft etc. in direkter Linie »von Plato zur NATO« (oder vielmehr zum Gulag) geführt habe? Sloterdijk schreibt über die globale Problematisierung der »westlichen Zivilisation« seitens der Linken:
»Dank maßloser Formen von Kulturkritik – etwa der Rückführung von Auschwitz bis zu Luther und Platon oder der Kriminalisierung der okzidentalen Zivilisation im ganzen – versuchte man, die Spuren zu verwischen, die verrieten, wie nahe man selbst einem klassengenozidalen System gestanden hatte.«[10]
Dem wäre lediglich hinzuzufügen, dass dasselbe auch auf Heidegger und andere Exfaschisten zutrifft: Auch sie verbargen ihre Nazi-Leichen in dem Hügel von Leichnamen namens abendländische Metaphysik … Müssen wir nicht in gleicher Weise die liberale Alltagsweisheit, Philosophen in der Politik stellten ein schreckliches Unglück dar, als eine vorschnelle Verallgemeinerung zurückweisen? Von Platon angefangen seien die Philosophen entweder kläglich gescheitert oder erfolgreich … im Unterstützen von Tyrannen. Der Grund dafür sei, so heißt es, dass sie versuchten, der Wirklichkeit ihre Idee überzustülpen und ihr somit Gewalt antäten – kein Wunder also, dass es sich bei ihnen von Platon bis Heidegger um entschiedene Antidemokraten handele (mit Ausnahme einiger Empiriker und Pragmatiker), welche die Masse des »Volkes« als Opfer von Sophisten abtue, das einer kontingenten Pluralität ausgeliefert sei. Wenn nun also der Alltagsverstand von Marxisten hört, die Marx verteidigen, indem sie argumentieren, seine Ideen seien im Stalinismus nicht originalgetreu umgesetzt worden, so erwidert er: Gott sei Dank! Sie vollständig zu verwirklichen wäre ja noch schlimmer gewesen! Heidegger war immerhin gewillt, aus seiner katastrophalen Erfahrung Konsequenzen zu ziehen, und räumte ein, wer ontologisch denke, der müsse ontisch irren, die Kluft sei irreduzibel und es gebe keine echte »philosophische Politik«. Es scheint demnach, dass G. K. Chestertons ironischer Vorschlag vollkommen berechtigt war,
»ein Spezialkorps von Polizeileuten [zu bilden] – von Polizeileuten, die Philosophen sind. Deren Geschäft ist es nun, die Anfänge der Verschwörung zu überwachen, und das nicht nur in einem kriminellen, sondern in einem kontroversen Sinn. […] Die Leistung des philosophischen Schutzmanns […] ist eine verwegenere und erfinderischere zugleich als die eines gewöhnlichen Detektivs. Der gewöhnliche Detektiv geht in die Kaschemmen, um Diebe zu arretieren. Wir gehen zu artistischen Teegesellschaften, um Pessimisten zu überwachen. Der gewöhnliche Detektiv ersieht aus dem Hauptbuch oder Journal, daß ein Verbrechen begangen worden ist. Wir indes lesen aus einem Sonettbande, daß ein Verbrechen begangen werden wird. Wir haben die Quellen aufzuspüren jener furchtbaren Gedanken, die die Mühlsteine des geistigen Fanatismus und des geistigen Verbrechens treiben.«[11]
Hätten nicht auch so unterschiedliche Denker wie Popper, Adorno oder Levinas einer leicht abgeänderten Version dieser Idee zugestimmt, nach der tatsächliche politische Verbrechen als »Totalitarismus« bezeichnet werden und das philosophische Verbrechen im Begriff der »Totalität« verdichtet wird? Es führt ein direkter Weg vom philosophischen Begriff der Totalität zum politischen Totalitarismus, und die Aufgabe der »philosophischen Polizei« besteht darin, aus einem Buch der platonischen Dialoge oder einer Abhandlung Rousseaus über den Gesellschaftsvertrag zu lesen, dass ein politisches Verbrechen begangen werden wird. Der gewöhnliche politische Polizist geht zu geheimen Organisationen, um Revolutionäre zu arretieren; der philosophische Polizist besucht philosophische Symposien, um Verfechter der Totalität zu überwachen. Der gewöhnliche antiterroristische Polizist sucht nach Tätern, die Anschläge auf Gebäude oder Brücken planen; der philosophische Polizist verfolgt diejenigen, die im Begriff sind, das religiöse und moralische Fundament unserer Gesellschaft zu zerstören …[12]
Die Haltung, die dahinter steckt, ist die der »Weisheit«: Der Weise weiß, dass man die Realität nicht »zwingen« sollte, dass ein wenig Korruption der beste Schutz gegen die große Korruption ist … Das Christentum ist in diesem Sinne Anti-Weisheit par excellence: eine verrückte Wette auf die Wahrheit, wohingegen das Heidentum letzten Endes auf die Weisheit setzt (»Alles kehrt zum Staub zurück, das Lebensrad dreht sich ewig weiter …«). Die verhängnisvolle Beschränkung dieser Haltung der Weisheit liegt in dem Formalismus, welcher der Idee des Gleichgewichts und des Vermeidens von Extremen anhaftet. Das Problem, das sich bei Formulierungen wie »wir brauchen weder eine totale staatliche Kontrolle noch einen vollkommen unregulierten Liberalismus/Individualismus, sondern das rechte Maß zwischen diesen beiden Extremen« sofort auftut, ist das Maß dieses Maßes – der Punkt des Gleichgewichts wird immer stillschweigend vorausgesetzt. Was wäre beispielsweise, wenn jemand sagen würde: »Wir brauchen weder zu viel Respekt vor Juden noch den nationalsozialistischen Holocaust, sondern das rechte Maß dazwischen, eine gewisse Quotenregelung an den Universitäten und ein Verbot öffentlicher Ämter für Juden, um ihren übermäßigen Einfluss zu verhindern.« So jemandem könnte man nicht auf rein formaler Ebene antworten. Dies ist der Formalismus der Weisheit: Die eigentliche Aufgabe ist, das Maß selbst zu verändern, nicht nur zwischen dessen Extremen zu pendeln.
In seinem ansonsten bewundernswerten Buch Holy Terror[13] scheint Terry Eagleton in dieselbe Falle zu tappen, wenn er die Dialektik des Exzesses des Heiligen, des heiligen Terrors, als Exzess des Realen darstellt, welcher respektiert und befriedigt, aber auf Distanz gehalten werden sollte. Das Reale ist gleichzeitig generativ und destruktiv: destruktiv, wenn es freie Hand bekommt, aber auch wenn es verneint wird, da seine Verneinung eine Wut freisetzt, welche es imitiert – ein Zusammenfallen der Gegensätze. Eagleton betrachtet auch die Freiheit als einen solchen pharmakós, der zerstörerisch wirkt, sobald er freigesetzt wird. Aber kommt dies der konservativen Weisheit nicht allzu nahe? Ist es nicht höchst ironisch, dass Eagleton, der wohl schärfste und deutlichste Kritiker der Postmoderne, hier seine eigenen versteckten postmodernen Vorurteile offenbart, indem er eines der großen postmodernen Motive vertritt, nämlich das des realen Dings, zu dem man die richtige Distanz wahren sollte? Kein Wunder, dass er seine Sympathie für einen Konservativen wie Edmund Burke und dessen Kritik der Französischen Revolution bekundet: Nicht dass diese ungerecht gewesen wäre etc., sondern dass sie die begründende exzessive Gewalt der Rechtsordnung enthüllte und so ans Licht brachte und wiederholte, was um jeden Preis verborgen bleiben sollte – das ist die Funktion traditioneller Mythen. Die Ablehnung dieser Mythen, das Vertrauen in die der Tradition kritisch gegenüberstehende reine Vernunft führt dabei zwangsläufig in den Wahnsinn und die zerstörerische Orgie der Unvernunft.[14]
Wo steht Lacan in Bezug auf dieses komplexe Thema, das unter der langweiligen und dummen Bezeichnung der »gesellschaftlichen Rolle der Intellektuellen« abgehandelt wird? Natürlich kann Lacans Theorie helfen, ein neues Licht auf zahlreiche politisch-ideologische Phänomene zu werfen, indem sie die verborgene libidinöse Ökonomie zum Vorschein bringt, die ihnen zugrunde liegt; hier geht es jedoch um eine grundlegendere und naivere Frage: Impliziert Lacans Theorie eine bestimmte politische Haltung? Manche Lacanianer (und nicht nur diese) versuchen zu zeigen, dass seine Theorie unmittelbar eine demokratische Politik begründet (so etwa Yannis Stavrakakis). Die Begriffe sind wohlbekannt: »Es gibt keinen großen Anderen« bedeutet, dass die symbolische Ordnung inkonsistent ist, dass sie keine endgültige Garantie darstellt, und Demokratie ist die Möglichkeit, dieses Fehlen einer Letztbegründung in das Machtgefüge zu integrieren. Insofern alle organischen Visionen eines harmonischen Ganzen der Gesellschaft auf einem Phantasma beruhen, scheint die Demokratie somit eine politische Haltung zu ermöglichen, die »das Phantasma durchquert«, das heißt das unmögliche Ideal einer nichtantagonistischen Gesellschaft aufgibt.
Ein politischer Theoretiker, der uns hier als zentraler Bezugspunkt dienen kann, ist Claude Lefort. Er wurde selbst von Lacan beeinflusst und verwendet dessen Terminologie für seine Definition der Demokratie. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Kluft zwischen dem Symbolischen (der leeren Stelle der Macht) und dem Realen (dem Akteur, der diese Stelle besetzt) anerkennt und postuliert, dass es keinen empirischen Akteur gibt, der die leere Stelle der Macht »natürlich« ausfüllt. Andere Systeme sind unvollständig, sie müssen Kompromisse eingehen und sich gelegentlich umstrukturieren, um zu funktionieren; die Demokratie erhebt Unvollständigkeit zum Prinzip, sie institutionalisiert die regelmäßigen Umstrukturierungen in Gestalt von Wahlen. Kurz, S(A) ist der Signifikant der Demokratie. Hier geht die Demokratie weiter als die gewöhnliche »realistische« Weisheit, der zufolge man, um eine bestimmte politische Vision in die Tat umzusetzen, konkrete unvorhersehbare Umstände einkalkulieren und sich auf Kompromisse einstellen sollte, um Raum für menschliche Schwächen und Fehler zu lassen – die Demokratie macht die Unvollkommenheit selbst zum Begriff. Man sollte allerdings bedenken, dass das demokratische Subjekt durch eine gewaltsame Abstraktion von all seinen besonderen Wurzeln und Bestimmungen entsteht; es entspricht dem Lacan’schen durchgestrichenen Subjekt und ist als solches unvereinbar mit dem Genießen, das ihm fremd ist:
»Demokratie als leere Stelle bedeutet für uns: Das Subjekt der Demokratie ist ein durchgestrichenes Subjekt. Unsere kleine Algebra lässt uns sofort erfassen, dass hier das kleine (a) fehlt; will sagen: alles, was sich um die Partikularität des Genießens dreht. Das leere durchgestrichene Subjekt der Demokratie hat Schwierigkeiten damit, sich mit all dem in Beziehung zu setzen, was wir mit dem bequemen kleinen Buchstaben, dem kleinen (a) bezeichnen und was darum herum geschieht, sich formt, zittert. Uns wird gesagt: Sobald es die leere Stelle gibt, kann jeder, der die Gesetze achtet, seine Traditionen und seine Werte einbringen. […] Wir wissen jedoch, je leerer die Demokratie ist, desto mehr ist sie eine Wüste des Genießens und desto mehr verdichtet sich das Genießen entsprechend in bestimmten Elementen. […] Je mehr der Signifikant ›unaffiziert‹ ist, wie andere es nennen, je mehr er gereinigt wird, je mehr er sich in der reinen Form des Gesetzes, der egalitären Demokratie, der Globalisierung des Marktes geltend macht, […] desto mehr wächst die Leidenschaft, verstärkt sich der Hass, vermehren sich Integrismen, breitet sich Zerstörung aus, werden beispiellose Massaker verübt und ereignen sich nie da gewesene Katastrophen.«[15]
Dies bedeutet, dass die demokratische Leerstelle strikt korrelativ zum Diskurs der totalitären Fülle ist, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Es wäre daher sinnlos, die eine gegen die andere auszuspielen und für eine »radikale« Demokratie einzutreten, die jene unschönen Zusätze vermeiden würde. Wenn also die Linke heute darüber klagt, nur die Rechte besitze noch die Leidenschaft und die Fähigkeit, ein neues, mobilisierendes Imaginäres anzuregen, während sie selbst nur verwalte, dann übersieht sie die strukturelle Notwendigkeit dessen, was sie für eine bloße taktische Schwäche ihrerseits hält. Kein Wunder, dass das heute vieldiskutierte europäische Projekt es nicht schafft, zu fesseln und Leidenschaften zu wecken. Es ist letztlich ein Projekt der Verwaltung, nicht der ideologischen Passion. Die einzige Passion ist die der Verteidigung Europas von Seiten der Rechten – sämtliche linken Versuche, der Idee des vereinten Europas politische Leidenschaft einzuhauchen (wie die Initiative von Habermas und Derrida im Sommer 2003), kommen nicht in Schwung. Der Grund für das Scheitern ist, dass die »fundamentalistische« Bindung an die jouissance die Kehrseite, das phantasmatische Supplement der Demokratie selbst ist.
Was ist nun also zu tun, wenn man die Konsequenzen aus diesem Unbehagen in der Demokratie zieht? Einige Lacanianer (und nicht nur Lacanianer) bemühen sich, Lacan die Rolle eines internen Kritikers der Demokratie zuzuschreiben, eines Provokateurs, der unbequeme Fragen stellt, ohne selbst ein politisches Projekt zu verfolgen. Die Politik als solche wird hierbei als ein Reich imaginärer und symbolischer Identifikationen abgewertet, da dem Selbst per definitionem eine Verkennung, eine Selbstverblendung innewohne. Lacan als Provokateur steht demnach in einer Linie mit Sokrates und Kierkegaard und erkennt die Illusionen und verborgenen metaphysischen Voraussetzungen der Demokratie. Das herausragende Beispiel für diese zweite Position ist Wendy Brown, die, obwohl sie keine Lacanianerin ist, eine äußerst wichtige und deutliche Nietzscheanische Kritik der politisch korrekten Politik der Viktimisierung, also der Fundierung der eigenen Identität in der Verletzung, entwickelt.
Fußnoten
[2]
… wenn auch in die falsche Richtung.
[3]
G. K. Chesterton, Father Browns Einfalt. Zwölf Geschichten, Zürich: Haffmans 1991.
[4]
Ebd., S.234.
[5]
Ebd., S.239–246.
[6]
Ebd., S.246f.
[7]
Ebd., S.249.
[8]
Ebd., S.252.
[9]
G. W. F. Hegel, Werke in 20 Bänden. Band 3 , Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1970, S.489.
[10]
Peter Sloterdijk, Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2006, S.260.
[11]
G. K. Chesterton, Der Mann, der Donnerstag war. Eine Nachtmahr, Stuttgart: Klett-Cotta 1982, S.56.
[12]
Denselben Gedanken formulierte schon Heinrich Heine in seiner Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland von 1834, wenn auch als positiven, bewunderungswürdigen Umstand: »Dieses merkt euch, ihr stolzen Männer der Tat. Ihr seid nichts als unbewußte Handlanger der Gedankenmänner, die oft in demütigster Stille euch all eu’r Tun aufs bestimmteste vorgezeichnet haben.« (Heinrich Heine, Werke und Briefe in 10 Bänden, hg. v. Hans Kaufmann, Band 5 , Berlin: Aufbau 1961, S.258)
[13]
Terry Eagleton, Holy Terror, Oxford: Oxford University Press 2005.
[14]
Ebd., S.50f.
[15]
Jacques-Alain Miller, Le Neveu de Lacan, Lagrasse: Verdier 2003, S.146f.
Eine Domestizierung Nietzsches
Brown interpretiert die postmoderne Identitätspolitik, deren Ausgangspunkt das bestimmten Gruppen jeweils zugefügte Unrecht ist (Sex – Gender – Rasse), als Ausdruck unseres zwiespältigen Verhältnisses zum guten alten liberaldemokratischen egalitären Grundsatz der Menschenrechte: Wir fühlen uns betrogen (in Bezug auf Frauen, Schwarze, Schwule etc. hat die universalistische liberale Rhetorik die Erwartungen nicht erfüllt, sie maskiert die fortwährende Exklusion und Ausbeutung), und bleiben diesen liberalen Idealen dennoch stark verhaftet. In ihrer genauen Analyse zeigt Brown, wie das Gefühl moralischer Empörung aus dem Versuch entsteht, einen gefährlichen Kompromiss zwischen einer Unmenge inkonsistenter und widersprüchlicher Einstellungen zu finden (Sadismus und Masochismus, Bindung und Zurückweisung, Schuldzuweisung an andere und das Gefühl der eigenen Schuld). Sie versteht die Moralisierung der Politik »nicht nur als Zeichen des hartnäckigen Festhaltens an einer gewissen Gleichsetzung von Wahrheit mit Machtlosigkeit oder als Ausleben eines gekränkten Willens, sondern als Symptom eines zerstörten Geschichtsnarrativs, zu dem uns noch keine Alternativen eingefallen sind«. (22f.)[16] »Wenn der Telos des Guten verschwindet, die Sehnsucht danach aber bleibt, scheint Moralität in der Politik in Moralismus überzugehen.« (28) Als sich nach dem Ende der großen, allumfassenden linken Fortschrittsnarrative die politische Aktivität in eine Vielzahl von Identitätsfragen auflöste, konnte sich der Exzess über diese partikularen Kämpfe um Identitäten nur in machtloser moralistischer Empörung entladen.
Brown geht hier allerdings einen entscheidenden Schritt weiter und verfolgt sämtliche Paradoxien der Demokratie konsequent bis zum Ende, radikaler als Chantal Mouffe mit ihrem »demokratischen Paradox«. Schon mit Spinoza und Tocqueville wird deutlich, dass die Demokratie in sich unvollständig leer ist und ihr ein festes Prinzip fehlt – sie braucht einen antidemokratischen Inhalt, der ihre Form ausfüllt; in dieser Hinsicht ist sie tatsächlich konstitutiv »formal«. Den antidemokratischen Inhalt liefern Philosophie, Ideologie und Theorie – kein Wunder, dass die meisten großen Philosophen, von Platon bis Heidegger, misstrauisch gegenüber der Demokratie oder sogar direkt antidemokratisch waren:
»Was ist, wenn die demokratische Politik, die untheoretischste aller politischen Formen, paradoxerweise der Theorie bedarf, also eine Antithese zu sich selbst sowohl in der Form wie in der Substanz der Theorie braucht, um ihre Ambitionen auf die Schaffung einer freien und egalitären Ordnung zu befriedigen?« (122)
Brown entfaltet alle Paradoxien aus der Tatsache, dass »die Demokratie für ihre Gesundheit ein nichtdemokratisches Element braucht«. Eine Demokratie benötigt einen ständigen Zufluss antidemokratischer Selbstbefragung, damit sie eine lebendige Demokratie bleiben kann – das Heilmittel gegen ihre Krankheiten ist homöopathisch:
»Wenn die Demokratie, wie die Überlegungen Spinozas und Tocquevilles nahelegen, zur Kathexis auf Prinzipien neigt, die ihr antithetisch gegenüberstehen, dann ist eine kritische Prüfung dieser Prinzipien und der von ihnen angeregten politischen Formationen für das Projekt einer Neugründung oder Wiederherstellung der Demokratie von entscheidender Bedeutung.« (128)
Brown definiert die Spannung zwischen Politik und Theorie als eine zwischen der politischen Notwendigkeit, Bedeutung zu fixieren, die textliche Abweichung in einem Formprinzip zu »vernähen«, welches allein unser Handeln leiten kann, und der permanenten »Dekonstruktion« der Theorie, die in keinem neuen positiven Programm aufgehen kann:
»Unter den menschlichen Praktiken ist die Politik besonders untheoretisch, weil das Greifen nach der Macht, welches sie konstituiert, notwendigerweise im Widerspruch zur Absicht der Theorie steht, Bedeutungen zu eröffnen und ›zum Gleiten zu bringen‹, um es mit Stuart Hall zu sagen. Diskursive Macht funktioniert durch das Verbergen ihrer Herstellungsbedingungen, daher rührt ihre Formbarkeit und Kontingenz; der Diskurs fixiert Bedeutung, indem er sie naturalisiert, andernfalls verliert er seinen Einfluss als Diskurs. Diese Fixierung oder Naturalisierung von Bedeutung ist das notwendige Idiom, in dem sich Politik vollzieht. Selbst die Politik der dekonstruktiven Verschiebung impliziert, zumindest provisorisch, eine solche Normativität.« (122f.)
Theoretische Analysen, welche das Fehlen einer Letztbegründung, die prinzipielle Kontingenz und Unbeständigkeit aller normativen Konstrukte und politischen Projekte ans Licht bringen, »sind antipolitische Bestrebungen, insofern sie Bedeutung destabilisieren, ohne selbst alternative Codes oder Institutionen vorzuschlagen. Andererseits können sie auch wesentlich für den Erhalt eines bestehenden demokratischen Regimes sein, indem sie es neu beleben.« (128) Brown scheint folglich eine Art Kantischer »Kritik der dekonstruktiven (antidemokratischen) Vernunft« vorzubringen, indem sie zwischen deren legitimem und illegitimem Gebrauch unterscheidet. Es ist legitim, sie als negativ-regulatives Korrektiv, als Provokation usw. einzusetzen, aber illegitim, sie als konstitutives Prinzip zu benutzen, das als politisches Programm oder Projekt direkt auf die Realität angewendet wird. Dieselbe zwiespältige Verbindung entdeckt Brown auch im Verhältnis von Staat und Volk. So wie die Demokratie die Antidemokratie braucht, um sich neu zu beleben, braucht der Staat den Widerstand des Volkes:
»Nur durch den Staat konstituiert sich das Volk als Volk; nur im Widerstand gegen den Staat bleibt das Volk ein Volk. So wie die Demokratie der antidemokratischen Kritik bedarf, um demokratisch zu bleiben, braucht also auch der demokratische Staat eher demokratischen Widerstand als Treue, um nicht den Tod der Demokratie herbeizuführen. Entsprechend ist die Demokratie möglicherweise darauf angewiesen, dass ihr die Theorie unrealisierbare Kritiken und unerreichbare Ideale liefert.« (137)
Bei dieser Parallele der beiden Paare Demokratie/Antidemokratie und Staat/Volk verfängt sich Browns Argumentation gewissermaßen in einer merkwürdigen symptomalen Dynamik der Umkehrungen. Während die Demokratie die antidemokratische Kritik braucht, um lebendig zu bleiben und ihre falschen Gewissheiten zu erschüttern, braucht der demokratische Staat den demokratischen Widerstand des Volkes, nicht den antidemokratischen. Verwechselt Brown hier nicht zwei (oder vielmehr eine ganze Reihe von) Arten des Widerstands gegen den demokratischen Staat: den antidemokratischen »elitären« Widerstand des Theoretikers (Platon – Nietzsche – Heidegger), den demokratischen Volkswiderstand gegen das nicht hinreichend demokratische Gepräge des Staates usw.? Und gehört nicht zu jedem dieser beiden Widerstandsarten darüber hinaus noch jeweils ein dunkles, schattenhaftes Double: der brutale zynische Elitarismus, der die Machthabenden rechtfertigt; die Gewaltausbrüche eines Mobs? Was ist, wenn die beiden sich zusammentun und es zum antidemokratischen Widerstand des Volkes selbst (»autoritärer Populismus«) kommt?
Tut Brown nicht auch antidemokratische Denker wie Nietzsche allzu leichtfertig ab, wenn sie sagt, sie lieferten »unrealisierbare« Kritiken der Demokratie? Was ist, wenn doch ein Regime kommt und versucht, sie zu realisieren, wie der Nationalsozialismus? Ist es nicht zu einfach, Nietzsche aus der Verantwortung zu entlassen, indem man sagt, die Nazis hätten sein Denken verzerrt? Natürlich taten sie das, aber ebenso hat der Stalinismus Marx verzerrt und ebenso hat sich jede Theorie verändert (wurde »verraten«), wenn sie in die politische Praxis umgesetzt wurde; mit Hegel können wir hier anmerken, dass die »Wahrheit« in solchen Fällen nicht einfach auf Seiten der Theorie liegt – was ist, wenn der Versuch, eine Theorie zu realisieren, den objektiven Inhalt dieser Theorie sichtbar macht, der selbst dem Blick des Theoretikers verborgen war?
Die Schwäche von Browns Beschreibung liegt vielleicht darin, dass sie das undemokratische Element, das die Demokratie am Leben hält, nur in »verrückten« Theorien verortet, welche die Grundlagen der Demokratie von »unrealisierbaren« Prämissen aus in Frage stellen – was aber ist mit den sehr realen undemokratischen Elementen, welche die Demokratie stützen? Ist nicht die Hauptprämisse von Foucaults (Browns wichtigster Referenz) Analysen moderner Macht, dass demokratische Macht von einem komplexen Netzwerk kontrollierender und regulierender Mechanismen gestützt werden muss? In seinen Notes Towards a Definition of Culture hat T. S. Eliot, jener Archetyp des »edlen Konservativen«, überzeugend argumentiert, eine starke Adelsklasse sei ein notwendiger Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Die höchsten kulturellen Werte könnten nur gedeihen, wenn sie durch ein komplexes und beständiges Familien- und Gruppengeflecht übermittelt würden. Wenn Brown also sagt, dass »die Demokratie der antidemokratischen Kritik bedarf, um demokratisch zu bleiben«, können sich Liberalkonservative, die vor »deMOREcracy« warnen, vollauf einverstanden erklären: Zwischen Staat und Demokratie sollte eine Spannung bestehen, ein Staat sollte nicht einfach in der Demokratie aufgehen, er sollte den Exzess bedingungsloser Macht über das Volk, eine starke Herrschaft des Rechts bewahren, um seine eigene Auflösung zu verhindern. Wenn der demokratische Staat nicht von diesem Gespenst der bedingungslosen Machtausübung gestützt wird, fehlt ihm die Autorität, um zu funktionieren. Macht ist per definitionem exzessiv, andernfalls ist es keine Macht.
Die Frage ist: Wer oder was ergänzt hier wen oder was? Ist die Demokratie eine Ergänzung der grundsätzlich nichtdemokratischen Staatsmacht oder ist die undemokratische Theorie eine Ergänzung der Demokratie? An welchem Punkt wird aus dem Prädikat ein Subjekt? Und was das »Anhalten des Gleitens der Bedeutung« angeht: Lehnt die nichtdemokratische Theorie die Demokratie in der Regel nicht genau deshalb ab, weil sie sie als zu »sophistisch« (für Platon …), als zu sehr in das Gleiten von Bedeutung verwickelt empfindet, und ist sie nicht weit davon entfernt, der Demokratie die Festigkeit der Bedeutung zum Vorwurf zu machen, sondern vielmehr verzweifelt bemüht, dem Gesellschaftsleben eine stabile Ordnung zu geben? Ist jenes »unaufhörliche Gleiten der Bedeutung« nicht schließlich bereits ein Merkmal der kapitalistischen Wirtschaft selbst, die in ihrer gegenwärtigen Dynamik Marx’ altes Motto von der Auflösung aller festen Identitäten auf eine neue Stufe hebt?
Die von Brown dargestellte »homöopathische« Logik ist daher zwiespältig. Einerseits ist die theoretische antidemokratische Kritik von außen das Heilmittel gegen verknöcherte staatliche Demokratie, indem sie deren Gewissheiten erschüttert und sie wiederbelebt; andererseits gibt es aber auch die umgekehrte Homöopathie: Danach ist das einzig wahre Mittel gegen die offensichtlichen Krankheiten der Demokratie – noch mehr Demokratie. Wir haben es hier mit einer Abwandlung von Churchills berühmtem Ausspruch zu tun, die Demokratie sei die schlechteste aller Regierungsformen, das Problem sei nur, dass es keine bessere gebe. Das demokratische Projekt ist inkonsistent und schon von seiner Idee her ein »unvollendetes Projekt«, aber genau diese »Paradoxie« ist seine Stärke und ein Garant gegen die totalitäre Versuchung. Die eigene Unvollkommenheit ist schon in der Idee der Demokratie enthalten, und deshalb ist das einzige Mittel gegen ihre Mängel: mehr Demokratie.
Sämtliche in der Demokratie schlummernden Gefahren haben ihren Ursprung in diesen konstitutiven Widersprüchlichkeiten des demokratischen Projekts und in den verschiedenen Versuchen, mit ihnen fertig zu werden – auf die Gefahr, dass man beim Versuch, die Unvollkommenheiten der Demokratie, das heißt ihre nichtdemokratischen Bestandteile loszuwerden, unabsichtlich die Demokratie selbst einbüßt; man denke etwa daran, wie der populistische Aufruf zur direkten Äußerung des allgemeinen Volkswillens unter Umgehung aller Partikularinteressen und Streitereien letztlich das demokratische Leben selbst erstickt. In Anlehnung an Hegel ist man somit versucht, Browns Version als extreme Verschärfung des »demokratischen Paradoxons« bis zu dessen direkter Selbstwidersprüchlichkeit einzustufen. Worin könnte nun die Lösung dieses Gegensatzes zwischen »These« (Lacan als Theoretiker der Demokratie) und »Antithese« (Lacan als interner Kritiker) bestehen? In der gewagten, aber notwendigen Geste, die Idee der »Demokratie« selbst in Frage zu stellen, sich woandershin zu bewegen – das Risiko einzugehen, ein positives, realisierbares Projekt »jenseits der Demokratie« zu entwickeln.
Ist Brown nicht allzu un-Nietzscheanisch, wenn sie »Nietzsche« auf eine provozierende Korrektur der Demokratie reduziert, ja domestiziert, welche durch ihre Übertreibung die Widersprüche und Schwächen des demokratischen Projekts sichtbar mache? Geht sie, wenn sie Nietzsches implizites (und auch explizites) antidemokratisches Projekt für »unrealisierbar« erklärt, nicht allzu schnell darüber hinweg, dass es ganz reale politische Projekte mit direktem Bezug auf Nietzsche gab, bis hin zum Nationalsozialismus, und dass Nietzsche selbst sich ständig auf aktuelle politische Geschehnisse in seiner Umgebung bezog (so war etwa der »Sklavenaufstand«, der ihn erschütterte, die Pariser Kommune)?[17] Brown unternimmt also eine Domestizierung Nietzsches, sie verwandelt seine Theorie in ein Exerzitium der »inhärenten Transgression«: Provokationen, die nicht wirklich »ernst gemeint« sind, sondern uns mit ihrem »provokativen« Charakter aus unserem demokratisch-dogmatischen Schlummer aufwecken und so zur Wiederbelebung der Demokratie selbst beitragen sollen … So mag das Establishment »subversive« Denker: als lästige, aber harmlose Fliegen, die uns ab und zu stechen und so die Widersprüche und Unvollkommenheiten des demokratischen Unterfangens bewusst machen – aber es würde natürlich niemand auf die Idee kommen, ihr Projekt ernst zu nehmen, geschweige denn zu realisieren …
Fußnoten
[16]
Die Seitenzahlen in Klammern in diesem Abschnitt beziehen sich auf Wendy Brown, Politics Out of History, Princeton: Princeton University Press 2001.
[17]
Nietzsche wird seltsamerweise regelmäßig von den gleichen Autoren dekontextualisiert/enthistorisiert, die ansonsten so eifrig bemüht sind, Lacan und andere zu kontextualisieren/historisieren, um deren metaphysische und repressive Voreingenommenheit aufzuzeigen. In Deleuzes paradigmatischer Nietzsche-Interpretation verschwindet diese Dimension völlig. (Während sich dieselben Autoren typischerweise ausführlich mit dem Antisemitismus von Nietzsches großem Widersacher Wagner befassen und ihn in seinen historischen Kontext einordnen …).
Michel Foucault und das iranische Ereignis
Eines der größten antitotalitaristischen Klischees ist das des »Intellektuellen« (in der berüchtigten Definition von Paul Johnson), der vom »authentischen« Touch gewaltsamer Spektakel und Ausbrüche verführt wird und die rücksichtslose Machtausübung liebt, um seine jämmerliche Existenz aufzubessern – er steht in einer langen Tradition von Platon über Rousseau zu Heidegger, ganz zu schweigen von der Liste der üblichen Verdächtigen, die auf den Stalinismus hereinfielen (Brecht, Sartre …). Als Lacanianer kann man auf einen solchen Vorwurf einfach erwidern: Das Mindeste, was sich über die Lacan’sche Psychoanalyse sagen lässt, ist, dass sie uns immun gegen solche »totalitaristischen Versuchungen« macht. Kein Lacanianer hat wohl jemals einen politischen Fehler der Art begangen, sich vom Trugbild der totalitären Revolution verführen zu lassen …
Aber so leicht wollen wir es uns gar nicht machen, sondern uns dieser »Bürde des weißen Intellektuellen« vielmehr mutig stellen. Beginnen wir gleich an der problematischsten Stelle: Die Konturen der Debatte über Heideggers NS-Engagement (War es nur ein Flüchtigkeitsfehler ohne theoretische Bedeutung oder ist es in seinem Denken begründet? Hatte es etwas mit der späteren Wende im Heidegger’schen Denken zu tun?) erinnern auf seltsame Weise an Michel Foucaults kurzes Engagement für die iranische Revolution.[18] In den folgenden Zeilen –
»Viele Foucault-Kenner betrachten diese Schriften [über den Iran] als Abweichung oder als Ergebnis eines politischen Fehlers. Wir meinen dagegen, dass Foucaults Schriften über den Iran ganz eng mit seinen allgemeinen theoretischen Schriften über den Diskurs der Macht und die Gefahren der Moderne verbunden sind. Wir sind auch der Ansicht, dass Foucaults Erfahrungen im Iran eine bleibende Wirkung auf sein folgendes Werk hinterlassen haben und dass man die plötzliche Wende in seinen Schriften in den 1980er Jahren nicht verstehen kann, ohne die Bedeutung der iranischen Episode und seiner generellen Beschäftigung mit dem Orient anzuerkennen.«[19]
– ist die frappierende Parallele zu Heidegger kaum zu übersehen. In beiden Fällen sollte man die Standarderzählung umkehren, der zufolge das falsche Engagement dem Denker die Grenzen seiner vorherigen theoretischen Position zu Bewusstsein geführt und ihn gezwungen habe, sein Denken zu radikalisieren, eine »Kehre« zu vollziehen, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden (Heideggers Schritt zur Gelassenheit, Foucaults Verlagerung auf die Ästhetik des Selbst). Wie Heideggers NS-Engagement war Foucaults Iran-Engagement an sich (in seiner Form) eine richtige Geste, seine beste Tat, das Problem war nur, dass es (was den Inhalt betrifft) in die falsche Richtung ging.
Anstatt Foucault seinen »Fauxpas« vorzuwerfen, sollte man seine einige Jahre später erfolgte Hinwendung zu Kant als Reaktion auf jenes gescheiterte Engagement sehen. Foucault interessiert sich für den Begriff des Enthusiasmus, den Kant (in Der Streit der Fakultäten) in Bezug auf die Französische Revolution entfaltet. Deren wahre Bedeutung liege nicht in den tatsächlichen Geschehnissen in Paris – vieles dort war entsetzlich, es gab Ausbrüche mörderischer Leidenschaft –, sondern in der enthusiastischen Reaktion, die jene Ereignisse in den Augen der geneigten Zuschauer in ganz Europa hervorgerufen hätten … Lieferte Foucault damit nicht eine Art Metatheorie seines eigenen Enthusiasmus für die iranische Revolution 1978/79? Was zählte, war demnach nicht die traurige Wirklichkeit, aus der die Umwälzungen hervorgingen, die blutigen Konfrontationen, die neuen Unterdrückungsmaßnahmen usw., sondern der Enthusiasmus, den die Ereignisse im Iran im externen (westlichen) Beobachter auslösten und ihn in der Hoffnung bestärkten, dass eine neue Form eines spirituellen politischen Kollektivs möglich sein könnte.
War also der Iran für Foucault das Objekt der »interpassiven Authentizität«, jener mythische andere Ort, an dem Authentisches geschieht – Kuba, Nicaragua, Bolivien in der heutigen Zeit … – und nach dem westliche Intellektuelle ein unstillbares Bedürfnis haben? Im Übrigen ließe sich in der gleichen Weise nicht nur der Enthusiasmus rehabilitieren, den das stalinistische Russland bei vielen westlichen Intellektuellen und Künstlern in den 1930er und 40er Jahren ausgelöst hat, sondern auch die Begeisterung für die maoistische Kulturrevolution, die sogar erbitterte Kritiker des Stalinismus erfasste. Was zählt, sind nicht brutale Gewalt und Schrecken in China, sondern der Enthusiasmus, der durch dieses Spektakel im westlichen Beobachter ausgelöst wurde … (Und warum sollte man dann nicht auch die Faszination einiger westlicher Beobachter für Nazi-Deutschland in den ersten vier Jahren von Hitlers Herrschaft rehabilitieren, als die Arbeitslosigkeit rapide abnahm etc.?)
Das Problem bei dieser Lesart ist allerdings, dass Foucault bei seiner Interpretation der Ereignisse im Iran die Perspektive umkehrt und dem Enthusiasmus der an dem Ereignis Beteiligten den kühlen Blick des externen Beobachters gegenüberstellt, der den größeren Kausalzusammenhang, das Wechselspiel der Klassen und ihrer Interessen etc. erkennt. Diese Verlagerung des Enthusiasmus eines externen Beobachters auf den Enthusiasmus der an dem Ereignis aktiv Beteiligten ist entscheidend – wie soll man sich die Verbindung zwischen diesen beiden Orten des Enthusiasmus, dem Enthusiasmus der direkt Beteiligten und dem der externen und unbeteiligten (neutralen) Beobachter vorstellen? Die einzige Lösung besteht darin, die Unmittelbarkeit des Erlebens der direkt Beteiligten zu »dekonstruieren«. Was ist, wenn die Unmittelbarkeit schon von vornherein für einen Beobachter, für den Blick eines imaginierten Anderen inszeniert ist? Was, wenn die Vorstellung, beobachtet zu werden, schon zu ihrem innersten Erleben dazugehört? So stellt Foucault in seinem letzten Text über den Iran (»Nutzlos, sich zu erheben« vom Mai 1979) die historische Wirklichkeit eines komplexen Prozesses sozialer, kultureller, ökonomischer, politischer etc. Umwandlungen dem magischen Ereignis der Revolte gegenüber, welches das Spinnengewebe der historischen Kausalität irgendwie aufhebt und sich nicht darauf reduzieren lässt:
»Für den Menschen, der sich erhebt, gibt es letztlich keine Erklärung. Ein Mensch muss sich losreißen und den Faden der Geschichte samt ihren langen Kausalketten durchtrennen, um die Todesgefahr ›wirklich‹ der sicheren Pflicht zum Gehorsam vorziehen zu können.«[20]
Man muss sich die Kantische Konnotation dieser Aussagen vor Augen führen: Die Revolte ist ein Akt der Freiheit, welcher den Nexus historischer Kausalität vorübergehend aufhebt, das heißt in der Revolte zeigt sich die noumenale Dimension. Das Paradoxe daran ist natürlich, dass diese mit ihrem Gegenteil zusammenfällt: der reinen Oberfläche eines Phänomenons. Das Noumenon erscheint nicht nur, sondern das Noumenale ist dasjenige, was in einem Phänomenon nicht auf das Kausalnetzwerk der Realität, welches es erzeugt hat, reduziert werden kann, kurz: das Noumenon ist das Phänomenon qua Phänomenon. Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dieser Irreduzibilität des Phänomenons und Deleuzes Begriff des Ereignisses als Fluss des Werdens, als Oberflächenerscheinung, die sich nicht auf ihre »körperlichen« Ursachen reduzieren lässt. Konservativen Kritikern, welche die kläglichen oder sogar schrecklichen tatsächlichen Folgen revolutionärer Umwälzungen verurteilen, hält Deleuze entgegen, dass sie die Augen vor der Dimension des Werdens verschlössen:
»Heute ist es in Mode, die Schrecken der Revolution anzuprangern. Das ist nicht einmal neu, die ganze englische Romantik ist voll von einem Nachdenken über Cromwell, das ganz analog zu dem über Stalin heute ist. Angeblich haben Revolutionen eine schlechte Zukunft. Aber dabei bringt man zwei Dinge durcheinander: die Zukunft der Revolutionen in der Geschichte und das Revolutionär-Werden der Menschen. Es sind nicht einmal dieselben Leute in beiden Fällen. Die einzige Chance der Menschen liegt in einem Revolutionär-Werden, nur dadurch kann die Schande abgewendet oder auf das Unerträgliche geantwortet werden.«[21]
Die Art, wie Deleuze hier über revolutionäre Entladungen schreibt, weist deutliche Parallelen zu Foucault auf:
»Die iranische Bewegung ist nicht jener ›Gesetzmäßigkeit‹ der Revolutionen erlegen, wonach, wie es scheint, aus der blinden Begeisterung stets die Tyrannei hervorgeht, die insgeheim bereits darin angelegt ist. Der innerste und am intensivsten erlebte Teil der Erhebung grenzte an einen überlaufenen politischen Kampfplatz. Doch dieser Kontakt bedeutet keine Identität. Die Spiritualität, auf die sich die zum Tode Bereiten beriefen, ist ohne gemeinsames Maß mit der blutigen Herrschaft eines integralistischen Klerus. Die iranischen Geistlichen wollen ihrem Regime durch die Bedeutungen, die der Erhebung zukamen, Authentizität verleihen. Man tut nichts anderes als sie, wenn man die Erhebung durch den Hinweis disqualifiziert, dass es heute eine Regierung von Mullahs gibt. In beiden Fällen haben wir es mit ›Angst‹ zu tun. Mit der Angst vor dem, was vergangenen Herbst im Iran geschehen ist und das die Welt seit langem nicht mehr gesehen hatte.«[22]
Foucault erweist sich hier als Deleuzianer. Was ihn an den Ereignissen im Iran interessiert, ist nicht die Ebene der sozialen Wirklichkeit oder deren Kausalbeziehungen, sondern die Ereignisoberfläche, die reine Virtualität des »Lebensfunkens«, der nur die Einzigartigkeit des Ereignisses erklärt. Was im Zwischenraum zweier Zeitabschnitte der sozialen Wirklichkeit im Iran stattgefunden hat, war nicht die explosive Entladung des Volkes als substantieller, mit einer Reihe von Eigenschaften ausgestatteter Entität, sondern das Ereignis des Volk-Werdens. Es geht folglich nicht um einen Wechsel der Macht- und Herrschaftsbeziehungen wirklicher soziopolitischer Akteure, um die Neuregelung der sozialen Kontrolle oder Ähnliches, sondern um die Transzendierung – oder, besser gesagt, vorübergehende Aufhebung – eben genau dieses Bereichs, um die Entstehung einer völlig neuen Sphäre des »gemeinschaftlichen Willens« als reines Sinn-Ereignis, in der alle Differenzen ausgelöscht und irrelevant geworden sind. Ein solches Ereignis ist nicht nur neu im Hinblick auf das, was vorher war, es ist neu »an sich« und bleibt daher für immer neu.[23] Hier wird die Sache – auf ganz sublime Weise – kompliziert. Foucault muss einräumen, dass die beteiligten Individuen innerlich gespalten sind:
»Nehmen wir den Anhänger einer beliebigen politischen Gruppe. Als er sich an einer der ersten Demonstrationen beteiligte, war er gleichsam doppelt präsent: als jemand, der seine eigenen politischen Ziele verfolgte, und als ein Mitglied der revolutionären Bewegung oder eher noch als Iraner, der sich gegen seinen König erhob. Aber zwischen beidem bestand keine Deckungsgleichheit. Er erhob sich nicht gegen seinen König, weil seine Partei bestimmte politische Ziele verfolgte.«[24]
Diese Spaltung zieht sich durch den gesamten Sozialkörper: Auf der Ebene der Realität gab es natürlich zahlreiche Akteure, ein komplexes Wechselspiel der Klassen, und eine Überdeterminierung unvereinbarer Kämpfe; auf der Ebene des eigentlichen revolutionären Ereignisses jedoch wurde all dies »aufgehoben« zu einem »absolut gemeinschaftlichen Willen«, der den gesamten Sozialkörper gegen den König und seine Clique vereinte. Es gab keine Spaltung des Sozialkörpers, keinen »Klassenkampf«; alle – vom armen Bauern bis zum Studenten, vom Geistlichen bis zum enttäuschten Kapitalisten – wollten dasselbe:
»Der gemeinschaftliche Wille ist ein politischer Mythos, mit dessen Hilfe Rechtswissenschaftler oder Philosophen Institutionen und dergleichen zu analysieren oder zu rechtfertigen versuchen. Er ist ein theoretisches Instrument. Den ›gemeinschaftlichen Willen‹ hat noch niemand gesehen, und ich selbst sah im gemeinschaftlichen Willen so etwas wie Gott oder die Seele, denen man niemals begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber in Teheran und im ganzen Iran sind wir dem gemeinschaftlichen Willen eines Volkes begegnet.«[25]
Foucault unterscheidet zwischen Revolte und Revolution: Die »Revolution« (im modernen europäischen Sinn) bezeichnet die Wiedereinschreibung einer Revolte in den Prozess des strategisch-politischen Kalküls. Sie ist ein Prozess, durch den die Revolte »kolonisiert und in den Rahmen der Realpolitik eingepasst« wird:
»Sie [die Revolution] gab der Erhebung eine Legitimation, unterschied zwischen guten und schlechten Formen, bestimmte die Gesetze ihres Ablaufs und definierte ihre Voraussetzungen, Ziele und Erfolgskriterien. Man definierte sogar den Beruf des Revolutionärs. Durch diese Repatriierung glaubte man, die Erhebung in ihrer Wahrheit erscheinen zu lassen und auf ihren realen Begriff zu bringen.«[26]
Kein Wunder, dass Foucault das Erscheinen eines gemeinschaftlichen Willens mit zwei von Kants noumenalen Dingen (Gott, Seele) vergleicht. Wenn das Noumenale erscheint, dann in Gestalt des äußersten Schreckens – Foucault ist sich dessen bewusst:
»Auf dieser Bühne mischt sich Bedeutendes mit Abscheulichem: die großartige Hoffnung, den Islam wieder zu einer lebendigen Zivilisation zu machen, mit virulenten Formen der Fremdenfeindlichkeit; geopolitische Ziele mit regionalen Rivalitäten. Mit dem Problem des Imperialismus. Mit der Unterdrückung der Frau usw.«[27]
»Zwei Dinge haben der Bewegung im Iran ihre besondere Intensität verliehen: ein politisch sehr ausgeprägter gemeinschaftlicher Wille und der Wunsch nach einer radikalen Veränderung des Daseins. Doch beides erfordert den Rückgriff auf Traditionen und Institutionen, die einen Gutteil Chauvinismus, Nationalismus und Ausschluss bergen und den Einzelnen wirklich mitzureißen vermögen. Wer einer derart schrecklich gerüsteten Macht die Stirn bieten will, darf sich weder allein fühlen noch bei null anfangen.«[28]
Das Bild verkompliziert sich. Zuerst nimmt Foucault Abstand von einer pauschalen Unterstützung der iranischen Erhebung (die von der Hoffnung getragen war, es werde eine völlig andere Gesellschaft daraus hervorgehen, die aus dem Raum der europäischen Moderne und deren Verklemmungen ausbrechen könnte) und lässt nur noch den enthusiastischen Augenblick der Revolte gelten. Die europäischen Liberalen, welche die iranische Revolte in Misskredit bringen wollen, weil sie zu einem repressiven Regime des Klerus geführt habe, bewegen sich demnach auf der gleichen Ebene wie dieser Klerus, der die Revolte für sich reklamiert, um seine Herrschaft zu rechtfertigen – beide versuchen, das Ereignis auf einen Faktor innerhalb eines politisch strategischen Interessenkampfes zu reduzieren. – Dann, subtiler und überraschender, macht Foucault eine weitere Ambiguität aus, die sich nicht auf den Unterschied zwischen den Ebenen der reinen Revolte und des vielfältigen gesellschaftspolitischen Wechselspiels reduzieren lässt: »Chauvinismus«, »virulente Fremdenfeindlichkeit«, die »Unterdrückung der Frau« usw. sind keine Zeichen der Verunreinigung des Ereignisses durch die gesellschaftspolitische Wirklichkeit, sondern eine inhärente Stütze des Ereignisses selbst, das heißt, ihre Mobilisierung gab dem Ereignis erst die Kraft, sich dem repressiven politischen Regime entgegenzustellen und nicht in die Fänge des politischen Kalküls zu geraten. Ebendieses Vertrauen in die »niedrigsten« rassistischen, antifeministischen usw. Motive gab der iranischen Revolution die Kraft, über einen bloßen pragmatischen Machtkampf hinauszugehen. Das authentische Ereignis wird somit ununterscheidbar vom Pseudo-Ereignis, um es mit Badiou zu sagen.