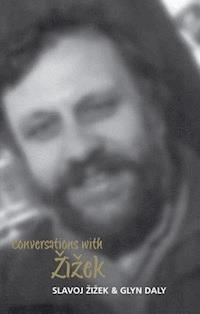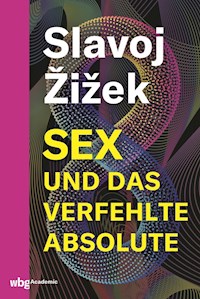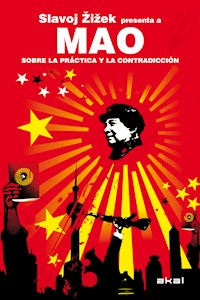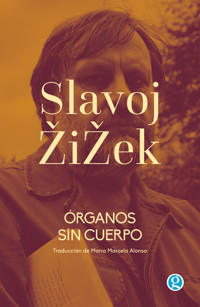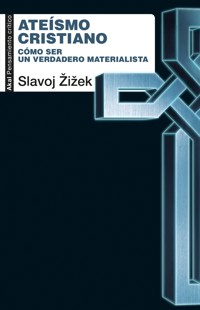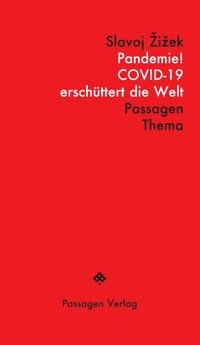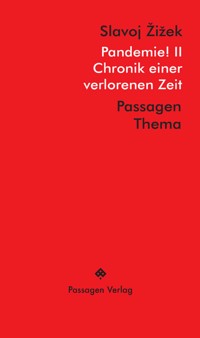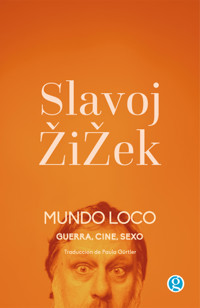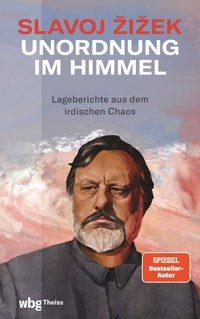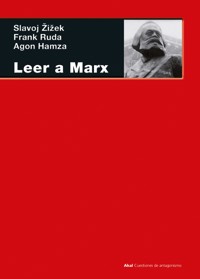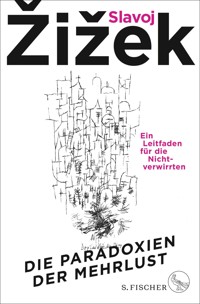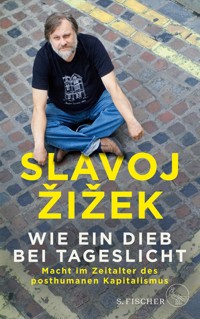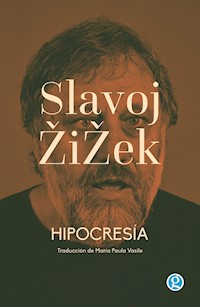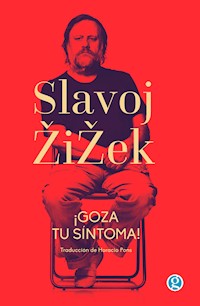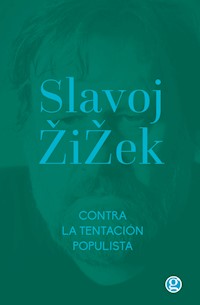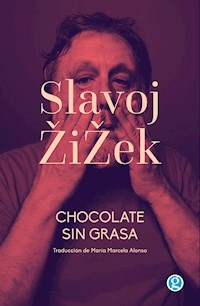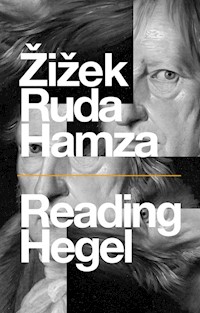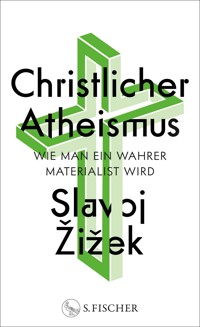
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Für alle, die das Christentum noch nicht abgeschrieben haben Häufig schon hat der Philosoph Slavoj Žižek die christliche Theologie kommentiert und kritisiert, aber bislang eher verstreut über sein ganzes Werk. Jetzt legt er die erste buchfüllende Darstellung seines theologischen Projekts vor. Unter Rückgriff auf so unterschiedliche Traditionen und Themen wie buddhistisches Denken, dialektischer Materialismus, politische Subjektivität, Quantenphysik, künstliche Intelligenz artikuliert dieses Buch Žižeks Vorstellung von einem religiösen Leben. Er fragt u.a., ob Gott an sich selbst glaubt, ob man Gott täuschen kann, er versteht den Heiligen Geist als Modell einer emanzipatorischen Gemeinschaft und untersucht den Buddhismus im Unterschied zum Christentum. Doch Žižek wäre nicht Žižek, wenn er dabei nicht auf seine Lieblingsthemen zu sprechen käme: Cancel Culture, Geschlechtsidentitäten, Chatbots, Perversionen, Klassenkampf, Law and Order. Oder in seinen eigenen Worten: »Um ein wahrer dialektischer Materialist zu werden, muss man durch die christliche Erfahrung hindurchgehen.« »Ein klassischer Žižek«, wie die Zeitschrift Jacobin geschrieben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Slavoj Žižek
Christlicher Atheismus
Wie man ein wahrer Materialist wird
Über dieses Buch
Häufig schon hat Slavoj Žižek die christliche Theologie kommentiert. In »Christlicher Atheismus« trägt er nun ein neues Verständnis des Christentums als eine progressive, säkularisierende Kraft vor. Unter Rückgriff auf so unterschiedliche Traditionen und Themen wie buddhistisches Denken, dialektischer Materialismus, politische Subjektivität, Quantenphysik, künstliche Intelligenz und Chatbots artikuliert dieses Buch zum ersten Mal Žižeks Vorstellung von einem religiösen Leben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Slavoj Žižek, geboren 1949, ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er lehrt Philosophie an der Universität von Ljubljana in Slowenien und an der European Graduate School in Saas-Fee und ist derzeit International Director am Birkbeck Institute for the Humanities in London. Seine zahlreichen Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Bei S. Fischer sind zuletzt u.a. erschienen »Die Paradoxien der Mehrlust. Ein Leitfaden für die Nichtverwirrten« (2023), »Hegel im verdrahteten Gehirn« (2020) sowie »Wie ein Dieb im Tageslicht. Macht im Zeitalter des posthumanen Kapitalismus« (2019).
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe ist unter dem Titel »Christian Atheism. How to Be a Real Materialist« im Verlag Bloomsbury, London, erschienen.
© Slavoj Žižek 2024
This translation of Christian Atheism is published by S.Fischer Verlag by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.
Für die deutsche Ausgabe © S. Fischer GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main, 2025
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt nach einer Idee von Ben Anslow
ISBN 978-3-10-492145-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Einleitung: Warum der wahre Atheismus indirekt sein muss
Die Selbstzerstörung des Westens
Antisemitismus und Intersektionalität
Über die Wichtigkeit, alle sechs Füße zu sehen
1 Eine Religion soll sich selbst auszehren
Wer kann die Wahrheit nicht vertragen?
Subjektivität im Afropessimismus
Glaubt Gott an sich selbst?
Der Heilige Geist als Vorbild der emanzipatorischen Gemeinschaft
Was ist wahrer Materialismus?
Vom Agnostizismus zur reinen Differenz
2 Warum Lacan kein Buddhist ist
Hinayana, Mahayana, Theravada
Buddhistische Wirtschaftslehre
Warum Bodhisattva ein Schwindel ist
Gegen Opfer
Die ultimative Entscheidung
3 Über Superpositionen und Undinge
Wie kann die Realität selbst falsch sein?
Die Bell’sche Ungleichung
Ein betrogener Gott
Raum oder Zeit
Materialismus der Undinge
4 Das Heilige, das Obszöne und das Untote
Den letzten Kannibalen essen
Inzestuöser Kurzschluss
Ein wahres Happy End
Die Suche nach sich selbst
Gott süßsauer
Alles unter dem Himmel oder ein geteilter Himmel?
5 Neque homo neque deus neque natura
Der Kosmismus als ein Fall von heidnischem Christentum
Die ultraintelligente Idiotie von Chatbots
Perversionsmaschinen
Willkommen in der Wüste der Posthumanität
6 Warum Politik immanent theologisch ist
Die göttlichen Clouds
Der Antagonismus ohne Feind
Politische Korrektheit versus Ethik
Von Gegensätzen zum Klassenkampf
Schluss: Die Notwendigkeit der Psychoanalyse
Weder biologisches noch kulturelles Geschlecht
Hodenquetscher, einst und jetzt
Manipur ist nicht nur in Indien
Ein linkes Plädoyer für Recht und Ordnung
Namens- und Sachregister
Es mag langweilig klingen, aber dies ist wieder für Jela.
Einleitung: Warum der wahre Atheismus indirekt sein muss
Ich bin nicht nur politisch aktiv, sondern werde auch manchmal als politisch radioaktiv wahrgenommen. Der Gedanke, dass die politische Theologie eine notwendige Grundlage radikalemanzipatorischer Politik ist, wird diese Wahrnehmung gewiss noch verstärken.
Heutige Atheisten gehen von der Prämisse aus, dass der Materialismus eine Sichtweise ist, die aus sich selbst heraus schlüssig erklärt und verteidigt werden kann, in einer Argumentationslinie, die ohne Bezüge auf ihr Gegenteil (religiöse Überzeugungen) auskommt. Aber was, wenn es genau umgekehrt wäre? Was, wenn wir, um wahre Atheisten zu sein, mit einem Glaubensgebäude beginnen und dieses von innen untergraben müssen? Zu sagen, dass Gott betrügerisch, böse, dumm, untot ist …, ist viel radikaler als die direkte Behauptung, dass es keinen Gott gibt. Wenn wir einfach postulieren, dass Gott nicht existiert, öffnen wir damit den Weg für sein faktisches Überleben als Idee bzw. Ideal, das unser Leben leiten sollte. Kurzum, wir machen den Weg für die moralische Aufhebung des Religiösen frei. Hier gilt es, sehr präzise zu sein: Die kantische Auffassung der Religion als bloße Narrativierung (als Darstellung gemäß unserer gewöhnlichen sinnlichen Realität) der Reinheit des moralischen Gesetzes ist uneingeschränkt abzulehnen. Nach dieser Ansicht ist die Religion für die gewöhnliche Mehrheit da, die nicht imstande ist, das übersinnliche moralische Gesetz aus sich selbst heraus zu begreifen. Diese Auffassung ist unbedingt abzulehnen, denn die Religion kann keinesfalls auf diese Dimension reduziert werden, nicht nur in dem Sinne, dass sie eine ontologische Sicht der Wirklichkeit enthält (als von Gott bzw. Göttern geschaffen, der göttlichen Vorsehung folgend usw.), oder im Sinne intensiver religiöser und/oder mystischer Erfahrungen, die weit über die Moral hinausgehen, sondern auch im immanenten Sinne. Man denke nur daran, wie oft Gott im Alten Testament als ungerecht, grausam und sogar frivol erscheint (vom Buch Hiob bis hin zur Anordnung der Beschneidung).[1] Ist das Christentum selbst nicht gerade deshalb einzigartig unter den Glaubenslehren, weil es nicht direkt, sondern nur über den Umweg einer anderen Religion (der jüdischen) zugänglich ist? Seine heilige Schrift – die Bibel – besteht aus zwei Teilen, dem Alten und dem Neuen Testament; man muss also erst durch den ersten hindurch, um zum zweiten zu gelangen.
1965 führten Theodor Adorno und Arnold Gehlen für den damaligen Südwestfunk ein großes Streitgespräch, in dem es um das Spannungsverhältnis zwischen Institutionen und Freiheit ging, dessen eigentlicher Fokus jedoch auf der Frage lag: Ist die Wahrheit prinzipiell allen zugänglich oder nur den Auserwählten?[2] Die interessante Paradoxie lag darin, dass Adorno, dessen Schriften ohne eine genaue Kenntnis der Hegel’schen Dialektik kaum lesbar sind, sich für die allgemeine Zugänglichkeit der Wahrheit aussprach, während Gehlen (dessen Schriften viel leichter zu lesen sind) erklärt, die Wahrheit sei nur den wenigen Privilegierten zugänglich, da sie für die Masse der normalen Menschen zu gefährlich und zerstörerisch sei. Wenn man das Problem so allgemein formuliert, bin ich auf der Seite von Adorno: Die Wahrheit ist prinzipiell allen zugänglich, verlangt aber große Anstrengung, zu der viele nicht imstande sind. Ich möchte allerdings eine differenziertere These vorschlagen. Im abstrakten Sinne des wissenschaftlichen »objektiven Wissens« ist unser Wissen natürlich begrenzt – für die meisten von uns ist es unmöglich, die Quantenphysik oder höhere Mathematik zu verstehen. Was uns aber allen zugänglich ist, ist der grundlegende Schritt von unserer Erfahrung des Mangels (des unvollkommenen Universums, der Begrenztheit unseres Wissens) zur Verdopplung dieses Mangels, das heißt, der Verortung im Anderen, der dadurch zu einem »ausgestrichenen«, inkonsistenten Anderen wird. Hegels Gottesbegriff ist ein Musterbeispiel für eine solche Verdopplung: Die Kluft, die uns endliche, schwache und sündige Menschen von Gott trennt, ist Gott selbst immanent, sie trennt Gott von sich selbst, macht ihn inkonsistent und unvollkommen und schreibt einen Antagonismus in sein Innerstes ein. Diese Verdopplung des Mangels, diese »Ontologisierung« unserer epistemologischen Beschränktheit bildet den Kern von Hegels absolutem Wissen, sie zeigt den Moment an, an dem die Aufklärung an ihr Ende gelangt.
Alle Kapitel des vorliegenden Buchs sind Einwürfe zu einer laufenden Debatte. Im ersten Kapitel schlage ich eine eigene Lösung für den Dialog zwischen Lorenzo Chiesa und Adrian Johnston über Psychoanalyse und Atheismus vor. In Kapitel zwei antworte ich auf die Kritik von buddhistischer Seite, ich würde die Nähe zwischen Lacan und dem Buddhismus übersehen. Im dritten Kapitel beschäftige ich mich mit widerstreitenden philosophischen Interpretationen der Quantenmechanik. In Kapitel vier trete ich in einen Dialog mit Alenka Zupančič über Antigone als die Heilige und Obszöne im Gegensatz zur humanistischen Lesart von Antigones Tat als Forderung nach einer Inklusion aller marginalisierten Minderheiten in die menschliche Allgemeinheit. In Kapitel fünf versuche ich einige Missverständnisse auszuräumen, die den Blick auf die tatsächlichen sozialen und subjektiven Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz verstellen. Im sechsten Kapitel verteidige ich dann schließlich meine These von der Notwendigkeit der Theologie für eine radikale Politik gegen die übliche Befürwortung einer materialistischen Emanzipationspolitik. Trotz seines dialogischen Charakters folgt das Buch einer ganz klaren Linie: von der grundlegenden Bestimmung meines christlichen Atheismus über die Skizzierung des Unterschieds zwischen meinem Atheismus und dem buddhistischen Agnostizismus, der Feststellung des tiefen Atheismus der Quantenphysik, einer Untersuchung des Dreiecks aus Göttlichem, Heiligem und Obszönem und einer materialistischen Kritik der antichristlichen, spirituellen Deutung der Künstlichen Intelligenz bis hin zu einer Erklärung, warum emanzipatorische Politik nicht ohne eine theologische (oder, genauer, theosophische) Dimension auskommen kann.[3]
Lassen Sie mich also eine klare und prägnante Beschreibung der Grundprämissen dieses Buches geben. Ich versuche, drei in meinen Werken wiederkehrende Themen zusammenzubringen, die, so lautet meine Hypothese, drei Aspekte desselben Kerns darstellen: den atheistischen Kern des Christentums, die ontologischen Implikationen der Quantenmechanik und die transzendentale/ontologische Parallaxe.
Was das Christentum einzigartig macht, ist die Überwindung der Kluft, die den Menschen von Gott trennt; diese geschieht nicht dadurch, dass der Mensch sich durch fromme Taten und Meditation zu Gott erhebt und so sein sündiges Leben hinter sich lässt, sondern indem er jene Kluft, die ihn von Gott trennt, in Gott selbst überträgt. Am Kreuz stirbt nicht ein irdischer Repräsentant oder Bote Gottes, sondern, wie Hegel sagt, der Gott des Jenseits selbst, so dass der tote Christus als Heiliger Geist wiederkehrt, was nichts anderes ist als die egalitäre Gemeinschaft der Gläubigen (für einen Christen gibt es, wie Paulus es ausdrückt, keine Männer und Frauen, keine Griechen und Juden, weil alle in Christus vereint sind). Diese Gemeinschaft ist in dem radikalen Sinne frei, dass sie sich selbst überlassen ist, ohne eine transzendente höhere Macht, die ihr Schicksal lenkt. In diesem Sinne schenkt Gott uns Freiheit – indem er selbst von der Bildfläche verschwindet.
Die ontologischen Implikationen der Quantenmechanik weisen nicht auf einen Gott hin, der ein Betrüger ist, wie Einstein glaubte, sondern der selbst betrogen wird. »Gott« steht hier (für Einstein) für den großen Anderen, die harmonische Ordnung der Naturgesetze, welche ewig und unabänderlich sind, keine Ausnahmen zulassen und Teil der objektiven Wirklichkeit sind, die unabhängig von uns (menschlichen Beobachtern) existiert. Die Grundeinsicht der Quantenmechanik ist dagegen, dass es einen Bereich von Quantenwellen gibt (dessen Status umstritten ist), in dem der Zufall irreduzibel ist, in dem Dinge geschehen, die rückwirkend aufgehoben werden können, und so weiter – kurzum, einen Bereich, der sich der Kontrolle durch den (göttlichen) großen Anderen entzieht (Informationen bewegen sich schneller als das Licht usw.). In Kombination mit dem Gedanken, dass Quantenfluktuationen nur dann in unsere Alltagswirklichkeit kollabieren, wenn sie von einem Beobachter wahrgenommen bzw. gemessen werden, wird diese Einsicht üblicherweise als Argument gegen den Materialismus gewertet, also gegen die Ansicht, dass die Realität außerhalb und unabhängig von uns existiert – einige sehen in Gott gar den ultimativen Beobachter, der die Realität konstituiert. Meine These lautet dagegen, dass Einstein recht damit hatte, den großen Anderen der Naturgesetze als »göttlich« zu bezeichnen – ein wahrhaft radikaler Materialismus reduziert die Realität nicht auf das, was wir als unsere alltägliche äußere Welt wahrnehmen, sondern lässt einen Bereich zu, der die Naturgesetze verletzt.
Der größte Einschnitt in der Geschichte der Philosophie findet mit Kants transzendentaler Revolution statt. Vor Kant beschäftigte sich die Philosophie (wie skeptisch sie auch sein mochte) mit der ontologischen Dimension im schlichten Sinne des Wesens der Realität: Was gilt als Realität, können wir sie erkennen, wie ist diese Realität strukturiert, ist sie rein materiell oder auch, vielleicht sogar vorwiegend geistig? Bei Kant ist die Realität nicht mehr einfach gegeben und wartet darauf, von uns entdeckt zu werden, sie ist vielmehr von der Struktur der Kategorien, durch die wir sie wahrnehmen, »transzendental konstituiert«. Nach Kant wird diese transzendentale Dimension historisiert: Jede Epoche hat ihre eigene Art, die Realität wahrzunehmen und in ihr zu handeln. So entwickelte sich etwa die moderne Naturwissenschaft, als die Realität als äußerer materieller Existenzraum wahrgenommen wurde, der von seinen eigenen Gesetzen bestimmt wird und damit von unserem subjektiven Empfinden und unseren Sinnprojektionen strikt getrennt ist. Parallaxe bedeutet hier, dass die zwei Ansätze nicht aufeinander reduziert werden können und einander gleichzeitig bedingen. Wir können die Realität als ein Objekt erforschen und ihre Entwicklung bis zur Entstehung menschlichen Lebens auf der Erde erklären, doch indem wir das tun, nähern wir uns der Realität schon auf eine bestimmte Weise (mittels der Evolutionstheorie und ihrer Begriffe), und dies lässt sich nicht aus dem Gegenstand ableiten, sondern wird immer schon vorausgesetzt (wir setzen voraus, dass die Natur durch komplexe Kausalketten gesteuert wird und so weiter).
Das vorliegende Buch führt diese drei Themen in einem Projekt des »christlichen Atheismus« zusammen. Der Raum für die Erfahrung des »Göttlichen« ist die Kluft, die den transzendentalen Ansatz für immer vom objektiv-realistischen trennt, aber diese »göttliche« Dimension bezieht sich auf die Erfahrung der radikalen Negativität (was Mystiker und Hegel die »Nacht der Welt« genannt haben), die jede Theologie ausschließt, die auf eine positive Gottesgestalt abhebt, auch wenn diese Gottesgestalt im modernen wissenschaftlichen Naturalismus radikal säkularisiert ist. Im Christentum zeigt diese Kluft die Abwesenheit Gottes (seinen »Tod«), die den Heiligen Geist begründet. Und nicht zuletzt hält die Dimension der radikalen Negativität auch den Raum für jede emanzipatorische Politik offen, die es ernst meint, also über die Kontinuität des historischen Fortschritts hinausreicht und einen radikalen Schnitt macht, der die Maßstäbe des Fortschritts selbst verändert.
Die Selbstzerstörung des Westens
Die Momente eines dialektischen Prozesses lassen sich, wie wir von Hegel wissen, als drei oder als vier zählen – und das fehlende vierte Moment ist hier natürlich die Politik. (Die politische Dimension ist nicht auf das Schlusskapitel beschränkt, sie zieht sich vielmehr als Unterströmung durch das gesamte Buch und taucht sogar in den philosophischsten Abschnitten auf.) Damit sind wir wieder bei meiner politischen Radioaktivität. Um daran anzuknüpfen, möchte ich mit Jean-Claude Milners Behauptung beginnen, dass das, was wir »den Westen« nennen, heute eine Konföderation unter der Hegemonie der USA ist; die USA herrschen auch intellektuell über uns, doch hier »muss man ein Paradoxon akzeptieren: Die US-amerikanische Dominanz im intellektuellen Bereich drückt sich in den Diskursen des Dissenses und des Protests, nicht in denen der Ordnung aus«.[4]
Die globale Universität lehrt uns,
die wirtschaftliche, politische und ideologische Funktionsweise der westlichen Ordnung ganz oder teilweise abzulehnen. Ungleichheit hat die Rolle eines Axioms, von dem sich jegliche Kritik letztlich ableitet. Je nach Situation bevorzugt man diese oder jene spezifische Form der allgemeinen Ungleichheit: die koloniale Unterdrückung, die kulturelle Aneignung, das Primat der weißen Kultur, das Patriarchat, die Geschlechterkonflikte und so weiter.[5]
Remi Adekoya weist auf einen merkwürdigen Umstand hin, den die Forschung zu Tage gefördert hat: Fragte man Wähler, welchen Wert sie am wichtigsten fänden, nannte die große Mehrheit im entwickelten Westen die Gleichheit, während die große Mehrheit in Afrika südlich der Sahara die Gleichheit weitgehend außer Acht ließ und Reichtum an die erste Stelle setzte (unabhängig davon, wie er zustande kam, und sei es durch Korruption). Das Ergebnis ist nachvollziehbar: Der entwickelte Westen kann es sich leisten, die Gleichheit zu priorisieren (auf der Ebene des ideologischen Selbstbildes), während die Hauptsorge der armen Mehrheit in Subsahara-Afrika darin besteht, wie man überleben und die schreckliche Armut überwinden kann.[6] Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Paradoxon: Der Kampf gegen die Ungleichheit ist insofern selbstzerstörerisch, als er sein eigenes Fundament untergräbt, und kann sich daher nicht als Projekt für einen positiven globalen Wandel präsentieren:
Gerade weil das kulturelle Erbe des Westens sich nicht von den Ungleichheiten befreien kann, die seine Existenz ermöglicht haben, werden frühere Ankläger der Ungleichheit nun ihrerseits bezichtigt, von der einen oder anderen bisher unentdeckt gebliebenen Ungleichheit profitiert zu haben. […] [A]lle revolutionären Bewegungen und auch die Ideen der Revolution selbst stehen heute unter Verdacht, nur weil sie zur langen Reihe toter weißer Männer gehören.[7]
Es ist wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass der Neuen Rechten und der woken Linken diese selbstzerstörerische Haltung gemeinsam ist. Ende Mai 2023 entfernte der Schulbezirk Davis County nördlich von Salt Lake City die Bibel aus den Bibliotheken der Grund- und Mittelschulen (in den Highschools durfte sie bleiben), nachdem ein Komitee die Schrift überprüft hatte. Auslöser war eine Beschwerde der Utah Parents United vom 11. Dezember 2022, in der es hieß: »Sie werden zweifellos feststellen, dass die Bibel (nach staatlichem Recht) ›keinen ernsthaften Wert für Minderjährige‹ hat, ›weil sie nach unserer neuen Definition pornografisch ist.‹«[8] Ist das einfach nur ein Streit von Mormonen gegen Christen? Nein. Am 2. Juni 2023 wurde eine Beschwerde gegen die wichtigste Schrift der vorherrschenden Glaubensrichtung in Utah, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage eingereicht. Der Sprecher des Distrikts, Chris Williams, bestätigte, dass jemand einen Antrag auf Überprüfung des Buchs Mormon gestellt hatte. Welche politisch-ideologische Richtung steckt hinter dieser Forderung? Ist es die woke Linke (in Ausübung einer ironischen Racheaktion gegen das Verbot von Vorlesungen und Büchern über die US-amerikanische Geschichte, die Black-Lives-Matter-Bewegung, LGBT+ usw. seitens der Rechten)? Oder ist es die radikale Rechte selbst, die ihre Kriterien für Familienwerte (konsequenterweise) auf die eigenen Gründungstexte angewendet hat? Letztlich ist es egal – was wir zur Kenntnis nehmen sollten, ist vielmehr die Tatsache, dass dieselbe Logik des Verbietens (oder zumindest des Umschreibens) klassischer Texte die Neue Rechte und die woke Linke gleichermaßen erfasst hat, was den Verdacht bestätigt, dass sie trotz ihrer starken ideologischen Animosität formal oft auf die gleiche Weise vorgehen. Während die woke Linke systematisch ihr eigenes Fundament zerstört (die europäische emanzipatorische Tradition), bringt die Rechte endlich den Mut auf, die Obszönität ihrer eigenen Tradition in Frage zu stellen. Es ist eine grausame Ironie, dass die westliche demokratische Tradition, die sich üblicherweise ihrer Fähigkeit zur Selbstkritik rühmt (»die Demokratie hat Fehler, aber sie beinhaltet auch das Streben, ihre Fehler zu überwinden …«), diese selbstkritische Haltung nun auf die Spitze getrieben hat – »Gleichheit« ist eine Maske für ihr Gegenteil und so weiter, und so bleibt nur noch der Hang zur Selbstzerstörung.
Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen dem antiwestlichen Diskurs im Westen und dem, der außerhalb geführt wird: »Während im Westen ein antiwestlicher Diskurs geführt wird (und der Westen ist stolz darauf), gibt es noch einen anderen antiwestlichen Diskurs außerhalb des Westens. Nur dass Ersterer Ungleichheit für einen Fehler hält, den auszunutzen niemand das moralische Recht hat; im Gegensatz dazu sieht der Zweite in der Ungleichheit eine Tugend, vorausgesetzt sie verläuft zu seinen Gunsten. Folglich sehen die Vertreter des zweiten Diskurses im ersten ein Zeichen für die Dekadenz des Gegners. Sie verhehlen ihre Verachtung nicht.«[9]
Und ihre Verachtung ist vollkommen gerechtfertigt. Das Resultat des antiwestlichen Diskurses im Westen ist vorhersehbar: Je mehr westliche Linksliberale ihre eigene Schuld ergründen, desto mehr wird ihnen von muslimischen Fundamentalisten vorgeworfen, sie seien Heuchler, die ihren Islamhass verbergen wollten. Dieses Paradigma gibt perfekt das Paradox des Über-Ichs wieder: Je mehr man befolgt, was die pseudomoralische Instanz von einem verlangt, desto schuldiger ist man – so wie der Druck des Islam immer größer zu werden scheint, je mehr man ihn toleriert. Man kann sicher sein, dass dasselbe auch für den Zustrom von Flüchtlingen gilt: Je offener Westeuropa für sie wird, desto schuldiger wird es sich fühlen, nicht noch mehr aufgenommen zu haben – es kann per definitionem nie genug aufnehmen. Je mehr Toleranz man gegenüber nicht westlichen Lebensweisen zeigt, desto mehr Schuldgefühle bekommt man aufgeladen, weil man nicht genug Toleranz übt.
Die woke Antwort darauf lautet: Die nicht westlichen Kritiker haben recht, die Selbsterniedrigung des Westens ist ein Fake, jene Kritiker bestehen zu Recht darauf, bei allem, was der Westen ihnen zugesteht, zu sagen: »Das ist nicht das«; wir behalten unseren überlegenen Rahmen und erwarten, dass sie sich integrieren – doch warum sollten sie? Das Problem besteht natürlich darin, dass die nicht westlichen Kritiker erwarten, dass der Westen, um es schonungslos und direkt zu sagen, seine Lebensweise aufgibt. Die Alternative lautet hier: Wird der Westen sich als Endresultat der eigenen antiwestlichen Haltung erfolgreich selbst (sozial, ökonomisch) als Zivilisation zerstören oder wird es ihm gelingen, die selbstzerstörerische Ideologie mit wirtschaftlicher Überlegenheit zu kombinieren?
Milner hat recht: Dass die kritische Selbstverunglimpfung die beste ideologische Haltung ist, um sicherzustellen, dass es keine revolutionäre Bedrohung der bestehenden Ordnung gibt, ist kein großes Paradox. Man sollte seine Aussage aber ergänzen und an die (vorgetäuschte, aber dennoch reale) revolutionäre Haltung der neuen populistischen Rechten erinnern. Deren gesamte Rhetorik basiert auf der »revolutionären« Forderung, dass die neuen Eliten (Großkonzerne, akademische und kulturelle Eliten, staatliche Dienste) zerstört werden müssen, notfalls mit Gewalt. Sie wollen, um es mit Yanis Varoufakis zu sagen, einen Klassenkrieg gegen unsere neuen Feudalherren – der schlimmste Albtraum ist hier die Möglichkeit eines Pakts zwischen den westlichen Rechtspopulisten und den nicht westlichen Autoritären.
In meinen kritischen Bemerkungen zur Me-too-Bewegung als Ideologie beziehe ich mich auf Tarana Burke, eine Schwarze, die vor mehr als einem Jahrzehnt die Kampagne ins Leben rief. Sie machte kürzlich die kritische Beobachtung, dass sich in der Bewegung über die Jahre eine immer stärkere Obsession mit den Tätern entwickelt habe – ein zyklischer Zirkus aus Anklagen, Schuld und Indiskretionen: »Wir arbeiten fleißig daran, dass sich das populäre Narrativ über #MeToo immer mehr von dem wegbewegt, was es ist. Wir müssen das Narrativ ändern, es handele sich um einen Geschlechterkrieg, es sei männerfeindlich, es gehe um Männer gegen Frauen, es betreffe nur eine bestimmte Art von Menschen – es sei für weiße, cisgeschlechtliche, heterosexuelle, berühmte Frauen.«[10] Kurzum, man sollte sich darum bemühen, den Fokus der Me-too-Bewegung wieder auf das alltägliche Leid von Millionen ganz normaler berufstätiger Frauen und Hausfrauen zu legen.
Einige Kritiker haben mir vorgeworfen, dass ich für einen einfachen Schritt von verhaltensmäßigen und sprachlichen Belästigungen zu »realen« sozioökonomischen Problemen eintrete, und weisen (korrekterweise) darauf hin, dass die dichte Textur des Verhaltens und der Sprechweisen das eigentliche Medium der Reproduktion der Ideologie sei; zudem sei das, was als »reale Probleme« gelte, nie direkt erkennbar, sondern immer durch das symbolische Netzwerk definiert und somit das Ergebnis eines Kampfes um Hegemonie. Ich halte daher den oben erwähnten Vorwurf gegen mich für einen schlechten Witz, betone ich doch ständig, dass die Textur ungeschriebener Regeln das Medium ist, in dem Rassismus und Sexismus reproduziert werden. Um es theoretisch zu formulieren: Die große Implikation der »strukturalistischen« Theorien (von Levi-Strauss und Althusser bis zu Lacan) ist, dass der ideologische Überbau eine eigene Infrastruktur hat, ein eigenes (unbewusstes) Netzwerk aus Regeln und Praktiken, die für sein Funktionieren sorgen. Aber sind solche (für einige) »problematischen« Positionen, die ich vertrete, Indizien dafür, dass ich in den letzten Jahrzehnten meinen Standpunkt verändert habe? Einer meiner Kritiker wies neulich auf den »Gegensatz zwischen [meinen] Schriften zu jener Zeit (1997, als er Ende vierzig war) und [meiner] aktuellen Verwandlung zu einer postlinken Figur« hin – er beginnt mit einem anerkennenden Zitat aus meinem Buch The Plague of Fantasies und fügt dann seinen Kommentar hinzu:
»Würden rassistische Einstellungen für den vorherrschenden ideologisch-politischen Diskurs akzeptabel, so würde dies das Gleichgewicht der gesamten ideologischen Hegemonie radikal verschieben. […] Angesichts des Aufkommens eines neuen Rassismus und Sexismus sollte die Strategie heute darin bestehen, solche Äußerungen unaussprechlich zu machen, so dass jeder, der sich auf sie beruft, sich dadurch automatisch disqualifiziert (so wie es in unseren Sphären mit denjenigen geschieht, die sich zustimmend auf den Faschismus beziehen). Man sollte ausdrücklich nicht diskutieren, ›wie viele Menschen in Auschwitz wirklich starben‹, welche ›die guten Seiten der Sklaverei‹ sind, warum es ›notwendig ist, die Tarifrechte von Arbeitern zu beschneiden‹ und so weiter; unser Standpunkt sollte hier ganz unverhohlen ›dogmatisch‹ und ›terroristisch‹ sein; dies ist keine Angelegenheit für eine ›offene, vernünftige, demokratische Diskussion.‹« […]
Gut gesagt. Genauso wie man sich zum Beispiel nicht über Gespräche darüber einlassen sollte, ob Transfrauen ›wirklich‹ Frauen sind. Tatsächlich schreibt der Endvierziger Žižek, »der Grad der ideologisch-politischen ›Regression‹ ist das Ausmaß, in dem solche Aussagen im öffentlichen Diskurs akzeptabel werden.« Würde er sein älteres Ich demnach als Symptom einer solchen Regression betrachten?[11]
Mein Gegenargument ist hier offensichtlich: Können wir Wokeness- und Trans-Forderungen wirklich in die Reihe progressiver Errungenschaften einordnen, sind also die Veränderungen unserer Alltagssprache (die Verwendung von »they« usw.) nur der nächste Schritt im langen Kampf gegen den Sexismus? Meine Antwort darauf ist ein entschiedenes Nein. Die Veränderungen, die die Trans- und Woke-Ideologie befürwortet und durchsetzen will, sind selbst größtenteils »regressiv«; es sind Versuche der herrschenden Ideologie, neue Protestbewegungen zu vereinnahmen (und ihnen die kritische Schärfe zu nehmen).
Es steckt somit ein Körnchen Wahrheit in der bekannten rechten Diagnose, dass Europa heute einen einzigartigen Fall von vorsätzlicher Selbstzerstörung darstelle – es ist besessen von der Angst, die eigene Identität zu behaupten, geplagt von der unendlichen Verantwortung für die meisten Gräuel auf der Welt, es genießt seine Selbstbeschuldigung in vollen Zügen, tut so, als wäre es seine oberste Pflicht, jeden aufzunehmen, der nach Europa immigrieren will, reagiert auf den Europa-Hass vieler Einwanderer mit der Behauptung, an diesem Hass sei Europa selbst schuld, weil es nicht bereit sei, sie vollständig zu integrieren … Das ist natürlich nicht alles falsch, aber der Hang zur Selbstzerstörung ist offensichtlich die Kehrseite der Tatsache, dass Europa nicht mehr in der Lage ist, seiner größten Errungenschaft treu zu bleiben, dem linken Projekt der globalen Emanzipation – es scheint nur noch Selbstkritik übrig zu bleiben, ohne ein positives Projekt, das sie begründen würde. So ist unschwer zu erkennen, was uns am Ende dieser Argumentationslinie erwartet: eine selbstreflexive Wende, auf deren Grundlage die Emanzipation selbst als ein eurozentrisches Projekt denunziert werden wird.[12]
Was die Sklaverei angeht, ist zu bedenken, dass es sie in der gesamten »zivilisierten« Geschichte der Menschheit in Europa, Asien, Afrika und den Amerikas gab und sie bis heute in neuen Formen fortbesteht – die Versklavung der Schwarzen durch die weißen Nationen des Westens war nicht ihre schlimmste Ausprägung. Man sollte allerdings hinzufügen, dass die Staaten Westeuropas (die heute als die Hauptverantwortlichen für die Versklavung gelten – wenn wir das Wort »Sklaverei« hören, ist unsere erste Assoziation »Weiße, die schwarze Sklaven besitzen«) die Einzigen waren, die nach und nach ein Verbot der Sklaverei durchgesetzt haben. Um es kurz zu machen: Sklaverei ist universell und der Westen zeichnet sich dadurch aus, dass er die Bewegung zu seiner Abschaffung in Gang gesetzt hat – das genaue Gegenteil der allgemeinen Wahrnehmung.
Der Titel eines Essays über mein Werk – »Pazifistischer Pluralismus gegen militante Wahrheit: Christentum im Dienste der Revolution«[13] – gibt den Kern meiner anti-woken, christlichen Haltung perfekt wieder: Anders als das Wissen, welches auf der unparteiischen, »objektiven« Haltung seines Träger beruht, ist die Wahrheit nie neutral, sie ist per definitionem militant, subjektiv beteiligt. Dies impliziert keinesfalls irgendeine Art von Dogmatismus – der wahre Dogmatismus ist in einer »objektiven«, ausgewogenen Sichtweise verkörpert, egal wie relativiert und historisch bedingt diese zu sein behauptet. Wenn ich für Emanzipation kämpfe, dann ist die Wahrheit, für die ich kämpfe, absolut, obwohl sie augenscheinlich die Wahrheit einer spezifischen historischen Situation ist. Hier müssen wir den wahren Geist des Christentums der Wokeness entgegenhalten: Trotz ihres Anscheins, tolerante Diversität zu fördern, ist diese in ihrer Funktionsweise extrem ausgrenzend, wohingegen das christliche Engagement seine subjektive Voreingenommenheit nicht nur offen zugibt, sondern sogar zu einer Bedingung seiner Wahrheit macht. Und meine Wette ist hier ganz klar: Nur die Haltung, die ich als christlichen Atheismus bezeichne, kann das westliche Erbe vor seiner Selbstzerstörung bewahren, ohne seine selbstkritische Schärfe aufzugeben.
Antisemitismus und Intersektionalität
Dies führt uns zu einer weiteren radioaktiven Eigenschaft von mir: meiner Kritik an gewissen Kritiken des Antisemitismus, die ebenfalls die kritische Schärfe des emanzipatorischen Universalismus abmildern. Indem sie uns auffordern, die Einzigartigkeit des Antisemitismus anzuerkennen, werten sie die universelle Dimension des Judentums ab. Am 14. Mai 2023 fand in Porto die Jahrestagung der European Jewish Association (EJA) statt. Sie verabschiedete dort einen Antrag,
in dem gefordert wird, Antisemitismus von anderen Formen des Hasses gesondert zu behandeln, und in dem andere jüdische Gruppen angehalten werden, den theoretischen Rahmen der »Intersektionalität« abzulehnen, der Gruppen in »Unterdrückte« und »Privilegierte« einteilt. »Antisemitismus ist etwas Einzigartiges und muss als solches behandelt werden«, so der Antrag, der weiter feststellt, dass der Antisemitismus im Unterschied zu anderen Formen des Hasses »in vielen Ländern staatlich sanktioniert«, »von den Vereinten Nationen gedeckt« und von anderen Gruppen, die Hass ausgesetzt sind, nicht als Rassismus anerkannt werde.[14]
Der Schlüssel zu diesen Behauptungen liegt in der vermeintlichen Verbindung zwischen drei Vorstellungen: der Einzigartigkeit des Antisemitismus, der Intersektionalität und dem Gegensatz zwischen Unterdrückten und Privilegierten. Warum wird Intersektionalität als »theoretischer Rahmen, der Gruppen in ›Unterdrückte‹ und ›Privilegierte‹ einteilt«, abgelehnt und warum ist das Konzept vom jüdischen Standpunkt aus problematisch? Intersektionalität ist in der Sozialtheorie und in der praktischen Analyse ein sehr nützlicher Begriff. Wenn wir eine unterdrückte Gruppe betrachten, stellen wir fest, dass sie auf verschiedenen, sich überschneidenden Ebenen unterdrückt (oder privilegiert) wird. Lassen Sie mich schamlos eine Wikipedia-Definition zitieren (denn, machen wir uns nichts vor, das ist die Definition, die die meisten Menschen benutzen werden):
Intersektionalität ist ein soziologischer Analyserahmen, um zu verstehen, wie die sozialen und politischen Identitäten von Gruppen und Individuen zu einzigartigen Kombinationen aus Diskriminierungen und Privilegien führen. Beispiele dieser Faktoren sind Gender, Kaste, Geschlecht, Rasse, Ethnizität, Klasse, Sexualität, Religion, Behinderung, Größe, Alter, Gewicht und körperliche Erscheinung. Diese sich überschneidenden und überlagernden Identitäten können sowohl ermächtigend als auch unterdrückend sein.[15]
Betrachten wir zum Beispiel den Fall einer einkommensschwachen schwarzen lesbischen Frau: Sie ist fast überall auf der Welt vierfach benachteiligt. Außerdem haben wir es nie nur mit einer mechanischen Kombination dieser nachteiligen (oder vorteilhaften) Faktoren zu tun. Die antisemitische Figur des »Juden« vereint Merkmale aus Religion, Ethnizität, Sexualität, Bildung, Wohlstand und Aussehen. Wer als »Jude« stigmatisiert wird, wird auch mit einer Reihe anderer Zuschreibungen belegt (sie wissen, wie man mit Geld spekuliert, sie halten sich dogmatisch an ihre religiösen Gesetze, sie sind faul und beuten gern andere aus, sie waschen sich nicht genug …).
Das Fazit der intersektionalen Analyse ist, dass alle Menschen aufgrund der Zusammensetzung ihrer Identität einzigartige Formen von Unterdrückung oder Privilegierung erleben. Warum lehnen dann jene, die auf der Einzigartigkeit des Antisemitismus bestehen, die Intersektionalität ab?
Die Unterdrückung, der Juden heute in westlichen Industriestaaten ausgesetzt sind, ist etwas unklarer, weil die Wahrnehmung in die Richtung geht, dass Juden privilegierte Positionen einnehmen (ökonomisch, kulturell, politisch), und die Assoziation von Juden mit Reichtum und Kultur in der öffentlichen Vorstellung (»Hollywood ist jüdisch«) ist selbst eine Quelle klassischer antisemitischer Tropen. Die EJA ist besorgt, dass diese Kombination aus Unterdrückung und Privilegierung den Antisemitismus zu einer beliebigen Form des Rassenhasses macht, die nicht nur mit anderen vergleichbar ist, sondern neben anderen Formen der Unterdrückung sogar weniger schwer wiegt. Durch den Blick durch die intersektionale Linse könnte aus dem Hass auf »den Juden« nur ein minderschwerer Fall innerhalb der umfassenderen Taxonomie der Hassformen werden. Ist diese Befürchtung gerechtfertigt?
Die EJA besteht zu Recht darauf, dass der Antisemitismus ein Ausnahmefall ist. Er unterscheidet sich von anderen Arten von Rassismus. Sein Ziel ist nicht die Unterordnung der Juden, sondern deren Ausrottung, weil sie nicht als minderwertige Fremde, sondern als heimliche Herren gesehen werden. Der Holocaust ist nicht dasselbe wie die Zerstörung von Zivilisationen in der Geschichte des Kolonialismus. Er ist ein einzigartiges Phänomen der industriell organisierten Vernichtung. Den Schlüssel zum Verständnis des Antisemitismus, jedenfalls in seiner modernen Form, liefert jedoch jene Verbindung aus »Unterdrückung« und »Privilegiertheit«. Im Faschismus diente »der Jude« als äußerer Eindringling, dem man die Schuld für Korruption, Unordnung und Ausbeutung zuschieben konnte. Die Projektion des Gegensatzes von »Unterdrückten« und »Privilegierten« auf einen Sündenbock kann die Menschen davon ablenken, dass solche Auseinandersetzungen in Wirklichkeit ihrer eigenen wirtschaftlichen und politischen Ordnung immanent sind. Die Tatsache, dass viele Juden (in Bezug auf Reichtum, Bildung und politischen Einfluss) »privilegiert« sind, ist mithin gerade die Quelle des Antisemitismus: Dass sie als privilegiert angesehen werden, macht sie zur Zielscheibe gesellschaftlichen Hasses.
Problematisch wird es, wenn versucht wird, die Ausnahmestellung des Antisemitismus zu nutzen, um eine Doppelmoral zu unterstützen oder um jede kritische Analyse der Privilegien, die Juden durchschnittlich genießen, zu unterbinden. Ein Streitgespräch über Antisemitismus und die Israel-Boykott-Bewegung BDS, das 2020 im Spiegel erschien, trägt die Überschrift »Wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der potenzielle Antisemit«.[16] Doch wenn dem so ist, sollte dann nicht auch dasselbe für die Palästinenser im Westjordanland gelten, die selbst bestimmen können, wer sie ihres Landes und ihrer Grundrechte beraubt? Wird Apartheid nicht auch in Israel sanktioniert? Das wird in dem Antrag der EJA völlig außer Acht gelassen.
Darüber hinaus stützt sich die Haltung der EJA auf ihren eigenen intersektionalen Rahmen. Jede Analyse der von einigen Juden eingenommenen privilegierten Positionen wird sofort als antisemitisch verurteilt, und selbst Kapitalismuskritik wird infolge der Verknüpfung zwischen »Judentum« und »reichen Kapitalisten« ebenfalls abgelehnt. Die gute alte marxistische These, dass der Antisemitismus eine primitive und verzerrte Version des Antikapitalismus sei, wird damit in ihr Gegenteil verkehrt: Der Antikapitalismus wird zur Maske des Antisemitismus. Aber wenn die Implikation lautet, dass das Judentum sowohl außergewöhnlich als auch untrennbar mit dem Kapitalismus verknüpft ist, landen wir dann nicht nur wieder bei einer uralten antisemitischen Trope? Provozieren wir die Armen und Unterdrückten damit nicht geradezu, den Juden die Schuld für ihr Unglück zu geben? Die Haltung der EJA ist daher abzulehnen – nicht wegen irgendeines obszönen Bedürfnisses nach einem »Gleichgewicht« zwischen verschiedenen Formen des Rassismus, sondern im Namen des Kampfes gegen den Antisemitismus selbst.
Die schreckliche Situation in Israel kann uns aber auch Grund zur Hoffnung geben. Denn etwas hat sich innerhalb und außerhalb Israels drastisch verändert, sogar in den USA, dem israelfreundlichsten Land. Selbst die Menschen, die bis dato bereit waren, alles zu dulden, was Israel tat, greifen es jetzt offen an und es wächst das Bewusstsein, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Israel hat sich als einzige freiheitliche Demokratie inmitten von autoritären und fundamentalistischen arabischen Regimes präsentiert, aber was es jetzt unternimmt, ähnelt mehr und mehr den schlimmsten arabischen Hardlinern. Der nächste Schritt zeichnet sich schon am Horizont ab: Die israelischen Hardliner wollen die reformwilligen säkularisierten Juden im eigenen Land zu Bürgern zweiter Klasse machen …
Auf diese Weise ist das Motto zu verstehen, dass nur eine Katastrophe uns retten kann: Vielleicht wird die autoritäre Wende in Israel eine starke Gegenbewegung auslösen und wird von dieser besiegt. Für Israel bedeutet das, dass nur eine öffentliche Solidaritätsbekundung der drei Buchreligionen (Judentum, Christentum, Islam) den emanzipatorischen Kern des Judentums bewahren kann – auf der geistlichen Ebene werden Juden selbst die größten Opfer des aggressiven Zionismus sein. Der christliche Atheismus ermöglicht hier nicht etwa die Überwindung der bestehenden Religionen – er schafft vielmehr den Raum für eine spirituelle Verbindung, die jede von ihnen sich frei entfalten lässt.
Hier spielt Atheismus eine entscheidende Rolle: Der gemeinsame Raum, in dem die verschiedenen Religionen gedeihen können, ist keine vage, allgemeine Spiritualität, sondern ein Atheismus, der den Streit der einzelnen Religionen sinnlos macht.
Über die Wichtigkeit, alle sechs Füße zu sehen
Dies führt uns zurück zur Intersektionalität, dieses Mal der Intersektionalität von Religionen selbst – es gibt einen (nicht allzu) vulgären Witz, der perfekt beschreibt, worum es geht. Der Witz beginnt mit einer Ehefrau und ihrem Liebhaber im Bett. Plötzlich hören sie, wie der Ehemann überraschend nach Hause kommt und schwer betrunken die Treppe hinaufgeht. Der Liebhaber gerät in Panik, aber die Frau beruhigt ihn: »Mein Mann ist so besoffen, dass er nicht einmal merken wird, dass ein anderer Mann im Bett ist, also bleib einfach, wo du bist!« Und tatsächlich fällt ihr Mann, der sich kaum auf den Beinen halten kann, wie sie es vorausgesagt hat, einfach aufs Bett. Etwa eine Stunde später öffnet er die Augen und sagt zu seiner Frau: »Schatz, ich bin so betrunken, dass ich nicht mehr zählen kann. Für mich sieht es aus, als wären da sechs Beine am Fußende.« Die Frau beruhigt ihn: »Mach dir keine Sorgen! Steh einfach auf, geh zur Tür vor dem Bett und sieh genau hin.« Der Gatte folgt ihrem Rat und ruft: »Du hast recht, es sind nur vier Beine! Dann kann ich mich ja wieder beruhigt schlafen legen …«
Der Witz mag zwar vulgär sein, aber er enthält eine interessante formelle Struktur, die der eines Witzes von Jacques Lacan gleicht: »Ich habe drei Brüder, Paul, Ernst und mich.« Volltrunken wie er war, schloss der Ehemann sich selbst in die Reihe mit ein und zählte sich selbst als einen der Brüder; als er wieder zu einem einigermaßen nüchternen Blick von außen imstande war, sah er, dass er nur zwei Brüder hat (er schloss sich also aus der Reihe aus). Man würde ja erwarten, dass man die ganze Situation deutlich erkennt, wenn man sie von außen, aus sicherer Distanz betrachtet; wenn man dagegen noch in der Situation steckt, ist man blind für deren entscheidende Dimension, für ihren Horizont, der sie abgrenzt; in unserem Witz ist es freilich die Position von außen, die blind macht, während der Mann die Wahrheit sieht, wenn er in ihr gefangen ist (das Gleiche gilt übrigens für die Psychoanalyse und den Marxismus).
Genau genommen schließt der Ehemann sich nicht einfach aus. Seine Exklusion (wenn er an der Tür vor dem Bett steht) führt zu einer falschen Inklusion und er verwechselt die Füße des Liebhabers mit seinen eigenen. Weil er die Füße des Liebhabers als seine zählt, kehrt er zufrieden ins Bett zurück und erhält eine sehr grausame Lektion: Er duldet, dass seine Frau mit einem anderen Mann schläft, als seinen eigenen Akt … Die Ironie liegt natürlich darin, dass der Mann, als er etwas nüchterner ist, wie ein Idiot handelt, indem er sich aus der Reihe ausschließt – eine überraschende Version von in vino veritas. Die libidinöse Wahrheit solcher Situationen liegt darin, dass selbst, wenn das Paar allein im Bett liegt, immer sechs Beine da sind (die beiden zusätzlichen Beine stehen für die Anwesenheit einer dritten Instanz) – die Lacan’sche Funktion des »plus-eins« ist immer wirksam. Hier kann man an den unmöglichen Dreizack denken (auch bekannt als unmögliche Gabel oder Stimmgabel des Teufels), die Zeichnung einer unmöglichen Figur, eine Art optische Täuschung: Sie scheint auf der einen Seite drei zylindrische Zacken zu haben, die sich auf geheimnisvolle Weise in zwei rechteckige Zacken am anderen Ende verwandeln (siehe Abb. 1).[17]
Abb. 1.1
Wenn in unserem Fall der betrunkene Ehemann im Bett liegt (hellgrauer Bereich), sieht er drei Beinpaare, wenn er aber aufsteht und das Bett betrachtet, sieht er zwei Paare … Wir sollten uns nicht scheuen, in dieser Richtung bis zum (obszönen) Ende weiterzugehen und uns dieselbe Szene mit der »Jungfrau« Maria und ihrem Mann Joseph vorstellen. Während Joseph auf Sauftour ist, vergnügt sich Maria im Bett mit dem Heiligen Geist (oder der Person, die sich als dieser ausgibt); Joseph kommt früh nach Hause und krabbelt zu ihr ins Bett; als er wenig später aufwacht, sieht er sechs Füße am Bettende und es passiert dasselbe wie in unserem Witz – von der Tür aus sieht er nur zwei Paar Füße im Bett und hält die Füße des Heiligen Geistes für seine eigenen …
Geschieht nicht etwas ganz Ähnliches, wenn wir die Ukraine unterstützen, aber den Kampf für Gerechtigkeit in der Ukraine selbst außer Acht lassen? Wir verschließen die Augen davor, wie der ukrainische Kampf von der vorherrschenden Oligarchen-Clique monopolisiert wird, und sollten uns daher nicht wundern, wenn die Nachkriegs-Ukraine der korrupten Oligarchie von vor dem Krieg gleicht, kolonisiert von westlichen Großunternehmen, die die besten Grundstücke und Bodenschätze kontrollieren – wir leiden, kurz gesagt, in einem schrecklichen Krieg, sind aber blind für die Tatsache, dass unsere Gewinne von unseren Feinden in Beschlag genommen werden, genau wie der betrunkene Ehemann, der die Tatsache, dass seine Frau mit einem anderen Mann schläft, als seinen eigenen Akt duldet. Wie lässt sich vermeiden, in diese Falle zu tappen? Vom 20. bis 22. Juni 2023 fand in London eine Reihe von Treffen statt, die von der Organisation Europe, a Patient koordiniert wurden, einer paneuropäischen, parteiübergreifenden Initiative mit dem Ziel, »die ukrainischen Gemeinden nach all dem, was sie in diesem Krieg schon durchgemacht haben, vor Ausbeutung zu schützen.« Der ehemalige Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, Rabbi Wittenberg und ukrainische NGOs sprachen sich für einen grünen, gerechten und bürgergeführten Wiederaufbau aus:
Die Herausforderung für die Ukraine und alle unsere internationalen Partner besteht darin, zu verhindern, dass im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Krieg eine neue Generation von Oligarchen entsteht. […] Das ukrainische Volk hat zu lange unter der fossilen Brennstoffindustrie gelitten, die immer noch die russische Kriegsmaschinerie finanziert.[18]
Initiativen wie diese sind heute notwendiger denn je, denn sie verbinden die Unterstützung der ukrainischen Verteidigung mit ökologischen Belangen und dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Eine solche Kombination von Zielen ist keineswegs größenwahnsinnig, sondern vielmehr die einzige realistische Option. Wir können die Ukraine nur unterstützen, wenn wir gegen die von russischem Öl abhängige fossile Brennstoffindustrie vorgehen und gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Die Kombination verschiedener Kämpfe wird durch die Umstände selbst erzwungen. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms bei Cherson Anfang Juni 2023 (mit überschwemmten Dörfern und im Wasser treibenden Minen) brachte Krieg und Umweltzerstörung zusammen, denn die Zerstörung der Umwelt wurde bewusst als militärische Strategie eingesetzt. An sich war das nichts Neues: Schon im Vietnamkrieg hatte die US-Armee große Waldgebiete mit Giftgas zur Entlaubung der Bäume besprüht (damit sich die Vietkong-Einheiten nicht unter den Blättern verstecken konnten). Die Zerstörung des Staudamms bei Cherson ist schlimmer, weil sie in einer Zeit geschah, in der von allen Seiten Lippenbekenntnisse zum Umweltschutz abgegeben werden – wir sind dazu gezwungen, weil die Bedrohung unserer Umwelt in unserem Alltag immer spürbarer wird. In der ersten Juniwoche 2023 lag New York unter einer braunen Rauchwolke (aufgrund von Waldbränden in Kanada), und die Einwohner wurden aufgefordert, im Haus zu bleiben oder, wenn sie nach draußen mussten, eine Maske zu tragen – was für große Teile der sogenannten Dritten Welt nichts Neues ist:
Indien, Nigeria, Indonesien, die Philippinen, Pakistan, Afghanistan, Papua-Neuguinea, Sudan, Niger, Burkina Faso, Mali und Zentralamerika sind extrem gefährdet. Wetterereignisse wie massive Überschwemmungen, zunehmende Zyklone und Hurrikane werden Ländern wie Mosambik, Zimbabwe, Haiti und Myanmar weiter Schaden zufügen. Viele Menschen werden umziehen oder sterben müssen. Während die Auswirkungen unseres Konsums Tausende von Kilometern entfernt sichtbar werden und Menschen an unseren Grenzen verzweifelt Zuflucht vor einer Krise suchen, bei deren Entstehung sie so gut wie keine Rolle gespielt haben – einer Krise, die reale Überschwemmungen und reale Dürren mit sich bringen könnte –, verkünden dieselben politischen Kräfte ohne jede Spur von Ironie, wir würden von Flüchtlingen »überschwemmt« oder »ausgesaugt«, und Millionen folgen ihrem Aufruf, unsere Grenzen dicht zu machen.[19]
Warum also geben westliche Länder zwar Lippenbekenntnisse zu diesen Problemen ab, streichen aber weiterhin Maßnahmen zur Begrenzung des Klimakollaps? (Lassen Sie mich nur zwei Beispiele aus den USA nennen: »Gesetzgeber in Texas führen einen Krieg gegen erneuerbare Energien, während ein Gesetzesvorschlag in Ohio die Klimapolitik als ›kontroverse Überzeugung oder Verfahrensweise‹ aufführt, die Universitäten ihren Studierenden nicht ›eintrichtern‹ dürfen.«[20]) Wer sagt, »rechtsradikale und rechtsextreme Politik sind ein von Oligarchen zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Interessen errichteter Schutzwall«,[21] macht es sich zu einfach, denn das Missachten des vollen Ausmaßes der Bedrohung für die Umwelt ist nicht auf die extreme Rechte bzw. die Großunternehmen beschränkt, sondern findet sich auch in linken Verschwörungserzählungen. Verschwörungstheoretiker malen sich gern alternative historische Szenarien aus: Was wäre, wenn (… die USA sich im Zweiten Weltkrieg nicht England im Kampf gegen Deutschland angeschlossen hätten? … die USA nicht den Irak angegriffen und besetzt hätten? … der Westen die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression nicht unterstützen würde?) Diese Szenarien sind keine emanzipatorischen Träume von gescheiterten Revolutionen, sondern ganz im Gegenteil zutiefst reaktionäre Träume davon, sich auf Kompromisse mit brutalen autoritären Regimes einzulassen, um so den Frieden zu erhalten.
Um die »pazifistische« Opposition gegen die Militärmaschinerie der NATO zu verstehen, sollten wir uns die Lage zu Anfang des Zweiten Weltkriegs vor Augen führen, als sich eine ähnliche Haltung von rechts und links gegen einen Kriegseintritt der USA richtete. Die genannten Gründe ähnelten auf unheimliche Weise denen der heutigen »Pazifisten«: Warum sollten sich die USA in einen weit entfernten Krieg einmischen, der sie nichts anging? Dann gab es eine diskrete Sympathie der Rechten für Deutschland (die von Deutschland nicht minder diskret unterstützt wurde); wegen des Molotow-Ribbentrop-Pakts war die Linke bis zum Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion gegen den Krieg; das deutsche Friedensangebot an Großbritannien im Sommer 1940 wurde von vielen als sehr großzügig betrachtet; und es gab die Sorge, dass ein Kriegseintritt der USA dem riesigen Rüstungsindustriekomplex dienen würde. Diese Argumentation enthält wie alle guten Lügen ein Körnchen Wahrheit. Es stimmt, dass die USA die Great Depression im Zuge der Weltwirtschaftskrise erst im Verlauf des Zweiten Weltkriegs überwand; und es gibt Hinweise darauf, dass Deutschland 1940 ernsthaft an einem Frieden mit Großbritannien interessiert war (man denke an die überraschende Flucht von Rudolf Heß nach Schottland, um Friedensverhandlungen mit der britischen Regierung zu führen).
Die ausführlichste Version dieser Argumentationslinie vertrat 2009 der amerikanische Politiker und Journalist Patrick J. (»Pat«) Buchanan. Hätte Churchill Hitlers Friedensangebot von 1940 akzeptiert, so meint er, wäre der Holocaust weniger schlimm verlaufen. (Die – häufig vollkommen berechtigte – Kritik an Churchill wird auch von der Linken geäußert. Die jüngsten radikalen Kritiken stammen zum einen von dem Rechtsaußen David Irving, der mit Nazideutschland sympathisiert, und zum anderen von Tariq Ali, einem radikalen Linken …) Buchanan bekräftigt die Idee vom westlichen Verrat und beschuldigt Churchill und Roosevelt, Osteuropa auf den Konferenzen von Teheran und Jalta an die Sowjetunion ausgeliefert zu haben. Churchill habe das British Empire in den Ruin getrieben, indem er zwei unnötige Kriege mit Deutschland verursacht habe, und Bush sei seinem Beispiel gefolgt und habe mit seinem unnötigen Krieg im Irak die USA in den Ruin getrieben; außerdem habe er Garantien an zahlreiche Länder verteilt, in denen die USA keine vitalen Interessen hätten, wodurch sein Land keine Ressourcen mehr gehabt hätte, um seine Versprechen einzuhalten.[22] Was wir heute häufig hören, ist eine neue Variante dieses Buchanan-Motivs: Der Zerfall der Sowjetunion und der anschließende wirtschaftliche Niedergang der postsowjetischen Staaten wurde erlebt wie eine Neuauflage des Versailler Vertrags und erzeugte das leicht vorhersehbare Verlangen nach Rache. Genau wie Hitler 1940 machte Putin der Ukraine wiederholt Friedensangebote; in seinen ersten Amtsjahren schlug er sogar vor, Russland solle der NATO beitreten … So verführerisch diese Argumentationslinie auch klingen mag (zumindest für manche), so ist sie doch genauso abzulehnen, wie der Faschismus bekämpft werden muss.
Das Problem besteht darin, dass die herrschende Ideologie heute die dringend benötigte Kombination von Kämpfen (das Sehen aller sechs Füße, um es mit unserem Witz zu sagen) nicht nur verhindert, sondern, wie wir soeben gesehen haben, sogar ihre eigene falsche Kombination in Gestalt von neuen Verschwörungstheorien vorantreibt, die von Rechtspopulisten und Teilen der Linken geteilt werden. Dieses neue Rechts-Links-Bündnis diskreditiert die Öko-Panik und die »grüne Politik« als eine List der Großkonzerne, um den einfachen, arbeitenden Menschen neue Beschränkungen aufzuerlegen; es lehnt Hilfen für die Ukraine ab, weil die Militärhilfe dem militärisch-industriellen Komplex der NATO diene; es verunglimpfte die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie als Instrument zur Disziplinierung der Bevölkerung … In einem Musterbeispiel der Verneinung werden die größten Bedrohungen, vor denen wir heute stehen (einschließlich der Berichte über Spuren außerirdischer Landungen), als Strategie des Großkapitals in Verbindung mit Staatsapparaten abgetan. Die Botschaft solch einer Verneinung ist natürlich unverhohlen optimistisch, sie macht uns Hoffnung: Die Rückkehr zur alten Normalität ist einfach, wir müssen die neuen Gefahren nicht bekämpfen, wir müssen lediglich über die Bedrohungen hinwegsehen, das heißt, so tun, als gäbe es sie nicht. Die starke Zunahme solcher Verneinungen ist der Hauptgrund für die traurige Tatsache, dass wir in einem Zeitalter der »demokratischen Rezession« leben:
Der Autoritarismus ist auf dem Vormarsch, trotz der liberalen Prophezeiung, die Ausbreitung freier Märkte werde zu mehr Demokratie führen – das liegt daran, dass der Kapitalismus gesellschaftliche Hierarchien immer gegen die Bedrohung wirtschaftlicher Gleichheit verteidigen wird.[23]
Man muss diese Behauptung etwas genauer ausführen. Die Bedrohung für die Demokratie erwächst auch aus dem falschen populistischen Widerstand gegen den Konzernkapitalismus. Der Ausweg aus diesem Dilemma liegt daher nicht nur im verzweifelten Festhalten an der liberalen Mehrparteiendemokratie – wir brauchen neue Formen zur Schaffung eines breiten gesellschaftlichen Konsenses und zur Herstellung einer aktiveren Verbindung zwischen politischen Parteien und der Zivilgesellschaft. Der Gegensatz von freiheitlicher Demokratie und neuen Populisten ist nicht der wahre; das bedeutet freilich nicht, dass das Trump-Putin-Lager besser ist als die liberale Demokratie (ebenso wie es falsch wäre, Sympathien für Hitler zu haben, weil freiheitliche Demokratie und Faschismus nicht der wahre Gegensatz sind). Wir sollten uns hier auf die Distanz zwischen Taktik und Strategie berufen: Strategisch ist die freiheitliche Demokratie unser größter Feind, auf der taktischen Ebene sollten wir jedoch mit der freiheitlichen Demokratie gegen die neuen Populisten kämpfen – so wie die Kommunisten im Zweiten Weltkrieg mit den »imperialistischen« Demokratien des Westens gegen den Faschismus kämpften, wohl wissend, dass der Imperialismus ihr größter Feind war.
Sind wir damit nicht weit von unserem eigentlichen Thema, der Idee des christlichen Atheismus, abgekommen und haben uns in einem bunten Gemisch aus politischen Kommentaren verloren? Nein, denn diese Kommentare zeigen gerade, wie der christliche Atheismus als politische Praxis funktioniert. Raffaele Nogaro (ein 1933 geborener italienischer Geistlicher und emeritierter Bischof) sagte, dass Jesus der »Neue Mensch« sei, der jeden ohne Ansehen der Person liebe, unabhängig von seiner Kultur, seiner Hautfarbe, seiner Religion oder der Tiefe seines Atheismus – jeder bekomme von Jesus dieselbe Frage gestellt: »Wer sagst du, dass ich bin?«[24] Für Nogaro ist Christus also keine Autoritätsfigur, die den Menschen sagt, wer sie sind; vielmehr will er von den Menschen wissen, wer er ihrer Meinung nach ist. Und man sollte dies nicht als billigen rhetorischen Trick missverstehen, nach dem Motto: »Ich weiß, wer ich bin, der Sohn Gottes, ich will nur nachprüfen, ob ihr das wisst.« Christus ist sich bewusst, dass in gewisser Weise seine ganze Existenz nicht nur davon abhängt, wie und was die Menschen über ihn reden, sondern vor allem davon, wie sie in der Gesellschaft handeln (oder nicht handeln). Jeder von uns muss aus seiner existenziellen Tiefe heraus eine Antwort auf Jesu Frage geben und diese Antwort dann in die Tat umsetzen.
1Eine Religion soll sich selbst auszehren
Wer kann die Wahrheit nicht vertragen?
Manchmal enthält selbst der flachste Blockbuster-Trash eine nützliche Lektion. Kevin Costners Film Postman (ansonsten ein großer Reinfall) beschäftigt sich mit der strukturellen Notwendigkeit einer ideologischen Lüge als Voraussetzung für die Wiederherstellung sozialer Verbundenheit – die Prämisse des Films ist, dass die einzige Möglichkeit zum Aufbau der »Wiederhergestellten Vereinigten Staaten« nach einer globalen Katastrophe darin besteht, so zu tun, als ob die US-Regierung noch existiert, so dass die Menschen anfangen, daran zu glauben, entsprechend handeln und die Lüge zur Wahrheit wird (der Held setzt die Wiederherstellung der USA dadurch in Gang, dass er Briefe zustellt, als wäre er ein offizieller Mitarbeiter des Postdienstes). Dies führt uns zur paradoxen Zeitlichkeit der Wahrheit.
Die meisten kennen wahrscheinlich den Höhepunkt der Gerichtsszene aus dem Film Eine Frage der Ehre (A Few Good Men, Rob Reiner 1992), als Tom Cruise zu Jack Nicholson sagt: »Ich will die Wahrheit!«, und Nicholson zurückruft: »Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen!« Die Antwort ist mehrdeutiger, als es den Anschein hat. Sie sollte nicht einfach so verstanden werden, dass die meisten von uns zu schwach sind, um die brutale Wirklichkeit der Dinge zu vertragen. Wir müssen also die Metapher aufgeben, nach der das Reale der harte Kern der Realität ist (das, wie die Dinge »an sich wirklich sind«), das uns nur durch eine Vielzahl von Linsen zugänglich ist, mit denen wir die Realität symbolisieren, mit denen wir sie durch unsere Phantasien und kognitiven Verzerrungen konstruieren. Im Gegensatzpaar von Realität (»nackten Tatsachen«) und Phantasien (Illusionen, symbolischen Konstrukten) steht das Reale auf der Seite der Illusionen und Phantasien. Natürlich widersetzt sich das Reale definitionsgemäß einer vollständigen Symbolisierung, ist aber zugleich ein durch den Symbolisierungsprozess selbst erzeugter Exzess. Ohne Symbolisierung gibt es kein Reales, nur eine flache Stupidität dessen, was da ist. Ein weiteres (vielleicht das beste) Beispiel: Wenn jemand einen Zeitzeugen nach der Wahrheit des Holocaust fragen würde und der Zeuge antwortet: »Sie können die Wahrheit nicht vertragen!«, dann sollte man darin nicht nur die schlichte Behauptung sehen, dass die meisten von uns nicht imstande wären, das Grauen des Holocaust zu verarbeiten. Auf einer tieferen Ebene waren es die nationalsozialistischen Täter selbst, die die Wahrheit nicht vertragen konnten – die Wahrheit, dass ihre Gesellschaft von einem allumfassenden Antagonismus durchzogen war, und um dieser Einsicht zu entgehen, betrieben sie ihre mörderische Jagd auf die Juden, als ob deren Ermordung wieder zu einem harmonischen Sozialgefüge führen könnte. Was die Sache allerdings zusätzlich verkompliziert, ist der Umstand, dass die »Wahrheit«, die Nicholson meint, nicht einfach die Wirklichkeit der Lage der Dinge ist, sondern die heikle Tatsache, dass die Macht (nicht nur die militärische) illegale ungeschriebene Gesetze und Praktiken anwenden muss (der »Code Red« im Film), um das Rechtssystem aufrechtzuerhalten – das ist die Wahrheit, die weiche Liberale nicht vertragen können. Ein solcher Wahrheitsbegriff verlangt eine paradoxe zeitliche Struktur:
Traditionell scheint sich die Wahrheit als regulative Idee eines Zustands der direkten Zustimmung ausgegeben zu haben. Diese angestrebte Direktheit wurde dann allerdings mit dem unendlichen Aufschub ihrer Erreichung ausgeglichen. Es ist vielleicht an der Zeit, diese Formel umzukehren, also die Wahrheit im Rahmen der Indirektheit zu begreifen und sie dann vollkommen im Hier und Jetzt geschehen zu lassen. Ein einfacher Perspektivwechsel lässt uns ein völlig anderes »Leben der Wahrheit« entdecken. Anstatt »Wahrheit« als ständige Annäherung an einen idealisierten Zustand der vollständigen Befriedigung zu begreifen, verschieben wir unsere Aufmerksamkeit auf die in einer bestimmten historischen Wirklichkeit tatsächlich auftretenden Wahrheitsfälle, die Ereignisse von großem Ausmaß und unumkehrbarer Zeitlichkeit anheizen oder unwiderlegbare und unentwirrbare Knoten und Exzesse im Alltagsleben hervorrufen oder aber unerwartete Mehrwerte in den Zufällen und Fehlern der Sprache produzieren. Die Wahrheit scheint unmöglich und ist doch zugleich unvermeidlich; sie gibt sich den Anschein, sich unserem Zugriff zu entziehen, um dann doch plötzlich und sogar zufällig aufzutauchen und uns in ihre diskursive Verbindlichkeit, ihre obligatorischen und unausweichlichen Wirkungen, ihre politische Kraft und historische Dringlichkeit und vielleicht auch ihre logische Notwendigkeit hineinzuziehen.[25]
Die Wahrheit gleicht folglich der jouissance (Jacques-Alain Miller nannte die Wahrheit einmal die jüngere Schwester der jouissance): unmöglich und unvermeidlich zugleich. Das Schlimmste, was man in Bezug auf die Wahrheit tun kann, ist, sie sich als eine Unbekannte X vorzustellen, auf die wir uns in einem endlosen Annäherungsprozess langsam zubewegen, ohne sie je ganz zu erreichen. Es gibt hier keinen Platz für irgendeine Art von Poesie des Mangels und davon, wie wir die letzte Wahrheit letztlich immer verpassen – das meint Lacan nicht, wenn er am Anfang von »Television« sagt, die Wahrheit könne nur halbgesagt werden: »Ich sage immer die Wahrheit: nicht die ganze, denn die ganze zu sagen, erreicht man nicht. Sie ganz zu sagen, das ist unmöglich, materiell: da fehlen die Worte. Gerade durch dieses Unmöglich hängt die Wahrheit am Realen.«[26] Wir verdrängen die Wahrheit, sie entzieht sich uns, aber in ihren Wirkungen ist sie immer schon da, als halbgesagte – etwa als Symptom, das die hegemoniale Struktur unseres symbolischen Raums unterminiert. Es ist nicht nur unmöglich, die ganze Wahrheit zu sagen, es ist sogar noch weniger möglich, ganz zu lügen, denn die Wahrheit holt uns in den Rissen und Verschiebungen unserer Lügen immer ein.[27]
Laut Bertolt Brecht entgeht uns das Glück, wenn wir direkt danach streben, während es uns sofort einholt, sobald wir aufhören, danach zu streben (»Ja, renn nur nach dem Glück / doch renne nicht zu sehr! / Denn alle rennen nach dem Glück / Das Glück rennt hinterher.«[28]) Gilt dasselbe nicht auch für die Wahrheit? Wenn wir zu sehr nach der Wahrheit rennen, wird sie zurückbleiben, unerkannt. Lässt sich dasselbe auch über Gott sagen? Ist Gott eine Lüge, ein Produkt unserer kollektiven Phantasie, die nicht seine tatsächliche Existenz hervorbringt, sondern eine tatsächliche Gesellschaftsordnung, die auf seinen Lehren und Geboten fußt, eine tatsächliche Ordnung, in der Institutionen und Gewohnheiten eine religiöse Grundlage haben? So einfach ist es nicht. In den modernen säkularen Gesellschaften, in denen Gott für tot erklärt wird, kehrt er als verleugneter Geist zurück, der seinen Tod überlebt – aber wie?
God Is Undead [Gott ist untot], das maßgebliche Buch über das zwiespältige Verhältnis zwischen Lacan’scher Psychoanalyse und Atheismus, ist eine fundierte Debatte zwischen Adrian Johnston (der den dialektischen Materialismus vertritt) und Lorenzo Chiesa (der behauptet, der agnostische Skeptizismus sei die einzig konsequente Haltung des wahren Atheismus).[29] Ich stimme mit Chiesa darin überein, dass die direkte Behauptung einer indifferenten ontologischen Vielheit, eines Nicht-Eins, das jeder Identität vorausgeht, unzureichend ist – Johnston scheint in diese Richtung zu gehen, weshalb sein »transzendentaler Materialismus« allzu leicht die transzendentale Dimension umgeht und einer einfachen materialistischen Ontologie gefährlich nahe kommt.
Anders als Chiesa denke ich jedoch, dass die Oszillationen, die das Verhältnis von Eins und Nicht-Eins kennzeichnen, keinen Raum für ein mögliches religiöses Ergebnis offenlassen. Oszillationen zeigen eine irreduzible Lücke oder Spalte im ontologischen Gefüge oder in der Realität selbst an. Dieser Spalt ist nicht der zwischen unseren vielfältigen Symbolisierungen der Realität und dieser Realität »an sich«, vielmehr hat er seinen Ort im Innersten der Realität selbst. Und der Raum der Theosophie befindet sich in der Lücke, derentwegen die transzendentale Dimension nicht auf die Ontologie reduzierbar ist – wir können, vulgari eloquentia, unseren transzendentalen Horizont niemals vollständig in den Begriffen der universellen Ontologie erklären, weil jede ontologische Vorstellung des Ganzen der Realität in den Bereich des Transzendentalen fällt, und das macht alle allgemeinen Ontologien von Spinoza bis Deleuze letztlich unhaltbar.
Die Oszillation, die Chiesa im Blick hat, lässt sich auf die Spannung zwischen der Aussage und dem Prozess des Aussagens reduzieren. Wenn wir das irreduzible Nicht-Eine zur ultimativen Wahrheit des Seins erklären, wirkt unsere Position des Aussagens als die eines Einen, das imstande ist, die gesamte Realität in seiner Wahrheit zu erfassen, und wenn wir umgekehrt versuchen, über das Eine als höchste göttliche Realität zu sprechen, wird unsere Position des Aussagens zwangsläufig inkonsistent und gerät in Widersprüche. In der Philosophie tritt diese Spannung als die zwischen der Realität, der wir gegenüberstehen, und dem transzendentalen Horizont, durch den wir die Realität wahrnehmen, in Erscheinung – das beste Beispiel dafür: Wir können überzeugend darlegen und nachweisen, dass es keinen freien Willen gibt und dass Freiheit eine »Benutzerillusion« ist, aber die Tatsache, dass wir argumentieren, impliziert, dass wir frei handeln und andere zu überzeugen versuchen, unsere Argumente freiwillig zu akzeptieren. Selbst wenn wir also wissen, dass wir nicht frei sind, handeln wir doch so, als ob wir frei wären. Die reflexive Verschiebung vom geäußerten Inhalt zum Prozess des Aussagens darf freilich nicht als Schritt von der Illusion zur Wahrheit verstanden werden. Wir handeln und argumentieren zwar, als ob wir frei wären, aber die Kognitionswissenschaft kann erklären, wie diese Illusion der Freiheit entstanden ist. Es ist eine der größten Errungenschaften der modernen Wissenschaft, unsere subjektive Beteiligung auszublenden und uns auf die »objektive Realität« zu konzentrieren. Wissenschaftliche Ergebnisse sollten weder danach beurteilt werden, »wem sie dienen«, noch sollte die subjektive Ökonomie der Beteiligten eine Rolle spielen. Wenn Lacan sagt, dass die Wissenschaft das Subjekt ausschließt, so ist dies kein Negativurteil in dem Sinne, dass der Wissenschaft etwas fehle, sondern eine Geste, die den Raum der modernen Wissenschaft überhaupt aufrechterhält. Kurzum, wissenschaftliche Inhalte lassen sich nicht aus subjektiven Tätigkeiten »transzendental ableiten« (was Fichte versucht hat), die Schwankung zwischen den beiden ist irreduzibel. Aus diesem Grund nenne ich das, was Chiesa als irreduzible Oszillation bezeichnet, die irreduzible ontologische Parallaxe.[30]