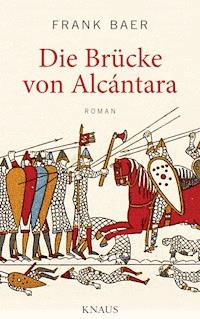
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman über ein entscheidendes Kapitel der religiösen Geschichte Europas: als die Illusion vom friedlichen Miteinander der Religionen zerbrach
Im 11. Jahrhundert beginnt das christliche Spanien sich der 300-jährigen muslimischen Fremdherrschaft zu widersetzen. Die berühmte Reconquista, die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel, nimmt ihren Anfang. Frank Baers Epos vom Beginn dieses für Europa so bedeutenden Abschnitts erzählt die Geschichte dreier ungleicher Männer – eines gefeierten arabischen Poeten, eines hochgeachteten jüdischen Arztes und eines spanischen Edelmanns -, die trotz ihrer verschiedenen Lebenswelten zu Freunden werden. Jahre später müssen sie jedoch in einer schicksalshaften Nacht erkennen, dass in Andalusien die Tage des friedlichen Zusammenlebens von Christen, Juden und Muslimen gezählt sind.
Geschrieben in der Tradition der großen historischen Romane von Lion Feuchtwanger und Stefan Zweig gelang Frank Baer mit „Die Brücke von Alcántara“ ein Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1582
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Man schreibt das Jahr 1064. Auf dem ersten blutigen Kreuzzug christlicher Ritterheere gegen das maurische Spanien begegnen sich drei sehr ungleiche Männer. Ibn Ammar, der gefeierte und verbannte arabische Poet, Yunus Ibn al-A’war, ein hochgeachteter jüdischer Arzt, in Kenntnissen und Praxis seiner Umwelt weit überlegen, und Lope, der Bursche eines spanischen Edelmannes, der im Verlauf seiner oft lebensgefährlichen Abenteuer selbst zum Adeligen wird. Dann trennen sich ihre Wege, doch Jahre später treffen die drei in Sevilla wieder zusammen. Inzwischen ist der Maure zum Großvezir aufgestiegen, der spanische Christ Lope hat sich in die Tochter des Juden verliebt. Aber alle müsen sie in dieser unheilvollen Nacht auf der Brücke von Alcántara erkennen, dass die Tage der kulturellen Hochblüte und des friedlichen Zusammenlebens endgültig gezählt sind.
In diesen drei wechselvollen Schicksalen spiegelt sich auf vielfältige Weise jene grandiose Epoche, in der Andalusien zum aufstrebenden Zentrum für Kunst und Kultur wurde, um schließlich zwischen unersättlicher Gier und Fanatismus unterzugehen. In prunkvollen Palästen, düsteren Burgen und blühenden Handelszentren erwacht in einer Fülle von Gestalten das Leben und Denken der Zeit in all ihren Farben und Facetten. Die Brücke von Alcántara ist ein hinreißendes Stück historischer Realität und die ebenso spannende wie bewegte Geschichte dreier sich kreuzender Lebenswege.
Autor
Frank Baer wurde 1938 in Dresden geboren, wuchs an der Saale und in Würzburg auf. Nach einem Philologiestudium und unterschiedlichsten Anstellungen kam er 1965 zum Bayerischen Rundfunk. Sein erstes Buch, »Die Magermilchbande«, war auf Anhieb ein großer Erfolg und wurde später verfilmt. Danach veröffentlichte er nach fünf Jahren Recherche seinen historischen Roman »Die Brücke von Alcántara«.
Frank Baer arbeitet als freier Journalist und als Filmemacher für das Fernsehen.
FÜR ANNETTE
»Von den schönen Dingen dieser Welt lieben die Franken ammeisten das Geld, die Juden das gute Essen, die Andalusieraber lieben am meisten die Liebe.«
Andalusische Spruchweisheit, 11. Jh.
»Das Grün der Pflanzen nach einem Frühlingsregen, die Blumenim Morgentau, wenn sich die schwarzen Schatten derNacht verzogen haben, das Gemurmel eines klaren Baches, derdurch blühende Wiesen fließt, der Anblick eines weißen Schlossesinmitten grüner Gärten, all das mag wunderschön sein,aber es ist nichts gegen die Vereinigung mit einem geliebtenMenschen. Dies gilt um so mehr, je länger einer sich dem anderenverwehrt oder von ihm getrennt ist, so daß die Leidenschaftzu brennen beginnt und die Flamme der Sehnsucht auflodertund die Glut der Hoffnung angefacht wird ... Wahrlich, dieZunge des Beredtesten kann das Glück der Vereinigung nichtbeschreiben und die Schilderung des Wortgewaltigsten bleibtweit hinter der Wirklichkeit zurück.«
Ibn Hazm, andalusischer Poet aus Cordoba, 994–1064
Inhaltsverzeichnis
TAQĀSĪM
Vorspiel
Im Jahre 711, nicht einmal acht Jahrzehnte nach dem Tod des Propheten Muhammad, drang der Islam, der sich bis dahin schon in ganz Vorderasien und Nordafrika ausgebreitet hatte, zum ersten Mal nach Europa vor. In diesem Jahr nämlich überquerte ein kleines muslimisches Expeditions-Heer die Meerenge bei jenem Felsenkliff, das seitdem den Namen Gibraltar trägt, und landete in Spanien.
Die iberische Halbinsel wurde von den Westgoten beherrscht, die knapp dreihundert Jahre zuvor, während der Völkerwanderungszeit, die Römer als Oberschicht abgelöst hatten. Der westgotische König Roderich stellte sich den Eindringlingen mit seinem Heer entgegen, aber er wurde besiegt, und im Verlauf von nur fünf Jahren eroberten daraufhin die Muslims, durch nachfolgende Truppen verstärkt, sein ganzes Reich, bis auf ein paar unwegsame Gebirgsregionen im äußersten Norden.
Die Anführer der Eroberungsheere, teils Araber und Syrer, teils Berber aus Nordafrika, holten sich die Töchter des westgotischen Adels als Frauen und bildeten eine neue Oberschicht, die das Land beherrschte. Die Spanier selbst leisteten kaum Widerstand. Die spanischen Juden, die unter der Intoleranz der von westgotischen Bischöfen regierten Kirche sehr zu leiden gehabt hatten, empfanden die Eroberung eher als Befreiung. Auch die Christen paßten sich den neuen Machtverhältnissen schnell an. Die meisten übernahmen im Verlauf der folgenden zweieinhalb Jahrhunderte freiwillig den Glauben der neuen Herren, gleichzeitig die arabische Sprache (ohne allerdings ihr eigenes romanisches Idiom aufzugeben), und mit der Sprache auch die Kultur. Spanien wurde der westlichste Pfeiler des riesigen muslimisch-arabischen Reiches.
Zunächst war es nur eine ganz am Rande gelegene, unbedeutende Provinz. Dann machten sich die Statthalter in Cordoba von den Kalifen unabhängig und bauten ihre Hauptstadt prächtig aus, und als sie reich genug waren, holten sie sich für ein unerhört hohes Honorar den berühmten und hochgebildeten Komponisten und Vortragskünstler Ziryäb aus Bhagdad, dem Zentrum der damaligen Welt, und ließen sich von ihm Kultur und feine Lebensart beibringen. Zuletzt legten sie sich selbst den Kalifentitel zu.
Im Jahre 974 schickte der deutsche Kaiser Otto II. eine Gesandtschaft nach Cordoba. Sie wurde in der damals gerade erst neu erbauten Palaststadt Madīnat az-Zahrā, deren eindrucksvolle Reste noch heute zu besichtigen sind, mit solchem Pomp empfangen, daß die Herren aus dem fränkischen Norden schon vor dem ersten Palastbeamten, der sie hinter dem Tor willkommen hieß, in die Knie gingen. Bis man ihnen erklärte, daß es erst der Diener des Kämmerers des Fürsten sei, vor dem sie knieten.
Wenig später kam in Cordoba ein Mann an die Macht, der es vom Kātib, vom kleinen Sekretär, bis zum Hādjib brachte, zum Ministerpräsidenten. Er hieß Ibn Abī Āmir und legte sich später den Ehrennamen al-Mansūr zu: der Siegreiche. Sobald er fest im Sattel saß, schloß er den legitimen Herrscher in einen Palast ein. Dann holte er Berbertruppen aus Nordafrika und baute mit ihnen ein stehendes Heer auf, das ihm bedingungslos ergeben war. Mit diesem Heer schlug er gegen die christlichen Spanier im Norden los.
Die hatten sich in den Jahrhunderten zuvor nach und nach aus ihren Bergen hervorgewagt und mehrere Fürstentümer gegründet, von Galicien im Westen über Leon, Kastilien, Navarra und Aragon bis zur Grafschaft von Barcelona im Osten. Jetzt wurden sie wieder aufs äußerste zurückgedrängt.
Im Jahr 985 legte al-Mansūr Barcelona in Schutt und Asche, 988 zerstörte er die Hauptstadt des Königreichs Leon, und 997 eroberte er schließlich sogar das größte Heiligtum der spanischen Christen im äußersten Nordwesten der Halbinsel: das Grab des Apostels Jakob in Compostela. Das Reich von Cordoba erreichte den Gipfel seiner Macht.
Fünf Jahre später starb al-Mansūr, und sein Reich zerfiel wieder. Machtkämpfe und Bürgerkriege verwüsteten das Land, die Berbertruppen plünderten die Hauptstadt, brannten die Paläste nieder, die Gouverneure in den Provinzhauptstädten machten sich selbständig.
Als schließlich im Jahre 1031 die verschiedenen Parteien den Kampf um das Kalifat in Cordoba aufgaben, war Andalusien in viele Klein-Fürstentümer aufgesplittert: In Zaragoza, Valencia, Almeria, Granada, Sevilla, Badajoz, Toledo, überall saßen eigenständige Herren inmitten kleiner unabhängiger Herrschaften. Das Fehlen einer starken Zentralregierung hatte eine ungeahnte Freiheit im Gefolge. Andalusien erlebte noch einmal eine goldene Zeit, die von einer im Mittelalter sonst nie erlebten Toleranz geprägt war.
Die kleinen Fürsten wetteiferten miteinander in der Ausstattung ihrer Residenzen, der Pracht der Ehrengewänder, der Qualität der Hoforchester. Dichter, Philosophen, Wissenschaftler, Architekten und Kunsthandwerker fanden großzügige Mäzene. Es war eine kulturelle Blütezeit, die von den Historikern mit der Frührenaissance in Italien verglichen wird.
Auch die christlichen Reiche im spanischen Norden erlebten während dieser Zeit einen Aufschwung. Sie erholten sich rasch von den Schlägen al-Mansūrs. Aber kaum war die Bedrohung aus dem Süden gewichen, da stürzten sich die Grafen und Kleinkönige, die alle miteinander verschwistert und verschwägert waren, sofort in mörderische Familienfehden. Aus denen ging zuletzt der Graf von Kastilien als Sieger hervor, Don Fernando der Große, dem es gelang, zu seinem Stammland Kastilien auch noch Galicien und das Königreich Leon hinzuzugewinnen. Um das Jahr 1060 hatte er seine Herrschaft so weit ausgebaut, daß er unbestritten der mächtigste Fürst der ganzen Halbinsel war.
Wenig später setzt die Geschichte ein, die dieses Buch erzählt.
ERSTES BUCH
MUSADDAR
Große Ouvertüre
1063 bis 1064
1 Sevilla
MITTWOCH 1. ELUL 4823 1. SHABĀN 455/30. JULI 1063
Er saß auf dem blanken Boden, die Beine untergeschlagen, die Hände vor dem Gesicht. Er bewegte den Oberkörper vor und zurück im Takt seiner Atemzüge, er bewegte die Lippen, betete mit tonloser Stimme: »Der Herr ist der Herr. Er ist der Ewige. Er hat gegeben. Er hat genommen. Sein Name sei gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit.«
Er hatte sein Gewand in der Mitte durchgerissen, er hatte seine Schuhe abgestreift und seinen Scheitel bedeckt mit Asche aus allen Herden seines Hauses, wie es der Brauch vorschrieb. Er hatte in der Thora gelesen. Die Rolle lag vor ihm auf dem Lesepult. Jetzt hielt er die Augen geschlossen. Er hatte keinen Trost gefunden. »Warum hast Du genommen, Herr, warum hast Du genommen?« Der Schmerz stak in ihm, wie ein schwarzer Dorn. »Warum hast Du genommen, Herr?«
Er hatte sich in der Khizāna eingeschlossen, die ihm als Arbeitszimmer diente, einem kleinen Nebenraum, der von der Haupthalle des Hauses abging und seine Bibliothek beherbergte. Er hatte den Riegel vor die Tür gelegt und das Fenster zum Innenhof mit dem hölzernen Laden abgedeckt, der für die kalten Tage bereitlag. Er saß seit dem frühen Nachmittag in dem kleinen Raum. Als es dunkel geworden war, hatte er eine Öllampe angezündet. Die Lampe blakte, weil er es unterlassen hatte, den Docht zu kürzen. Es war heiß, und die Luft war stickig vom Ruß der Lampe. Er merkte es nicht. Er bewegte den Oberkörper vor und zurück und murmelte Gebete, formte die Worte mit den Lippen, ohne auf ihren Sinn zu achten. »Herr der Wahrheit, Herr des Lebens, warum hast Du genommen?«
Vielleicht hätte er den Schmerz leichter ertragen, wenn sein Glaube fest gewesen wäre. Vielleicht hätte es ihm geholfen, wenn er Gott hätte verfluchen können, mit ihm hadern wie Hiob, seinen Schmerz zu ihm hinaufschreien. Aber er hatte nicht den Glauben Hiobs. Er konnte keinen Trost finden in der Gewißheit, daß dieser Tod einen Sinn haben mußte nach dem ewigen Ratschluß Gottes, nach den unerforschlichen Maßstäben seiner Gerechtigkeit. Er hatte nicht diese Gewißheit. Er war allein mit seinem Schmerz und seiner Trauer. Allein in der kleinen, düsteren Khizāna zwischen seinen Büchern, neben der blakenden, rußenden Lampe, die zu flackern anfing und mit einem schmurgelnden Zischen verlosch. Er sprach die Worte der Totenklage, wie sie vorgeschrieben waren, sprach sie leer vor sich hin. Sie kamen zwischen seinen Lippen heraus wie trockene Spelzen.
Spät in der Nacht gab ihm die Erschöpfung ein paar Stunden Schlaf.
Er hieß Yūnus Ibn al-A’war und war Mitglied der palästinensischen Kongregation in der Judengemeinde von Sevilla. Ein Mann von zweiundfünfzig Jahren, groß, hager, mit weichen Zügen trotz einer scharf gebogenen Nase, die ein Kennzeichen der Familie seines Vaters war. Der Bart schon grau, die Augen nicht mehr so scharf wie früher, ein wenig zusammengekniffen von der ständigen Anstrengung des Lesens. Ein Arzt mit einer bescheidenen Praxis in der Straße der Lederschlauchmacher, ein angesehener Mann, von dem seine Freunde behaupteten, daß er keine Feinde habe.
Am Vormittag hatte er seine Frau begraben. Sie waren achtundzwanzig Jahre lang verheiratet gewesen, und sie waren glücklich gewesen, obwohl sie nicht das Glück gehabt hatten, Kinder zu bekommen. Seine Frau war an einer Krankheit gestorben, die er nicht hatte diagnostizieren können, einer Geschwulst im Bereich des Unterleibs, einer Funktionsstörung der Leber oder der Gallenblase, er hatte es nicht herausfinden können. Es war eine Krankheit gewesen, die mit unerträglichen Schmerzen verbunden war, stechenden, reißenden, zermürbenden Schmerzen, die sich zuletzt auch mit starken Opiumgaben nicht mehr hatten lindern lassen.
Sie war in der letzten Nachtstunde gestorben, kurz vor Sonnenaufgang. Er hatte an ihrem Bett gesessen und hilflos mit angesehen, wie der Schmerz ihr Leben aufgezehrt hatte. Er war ihr gefolgt, als man sie aus dem Haus getragen hatte zum Hof der Synagoge und von dort auf den Friedhof vor die Stadt. Er wäre ihr noch weiter gefolgt, wenn das Gesetz es nicht verboten hätte.
Als er wach wurde, war es schon hell. Er lag auf der Seite, auf dem rechten Arm. Der Arm war eingeschlafen und schmerzte, als wäre er mit heißem Wasser gefüllt. Auch sein Rücken schmerzte, und er hatte Mühe, hochzukommen, und als er endlich aufrecht stand, wurde ihm schwindlig. Er tappte zum Fenster, hob den Laden herunter, brachte seine Augen nahe an das Holzgitter und schaute auf den Innenhof hinaus. Die Sonne stand so niedrig, daß der Hof noch ganz im Schatten lag. Das Licht war mild, und das Weiß der Wände blendete noch nicht, und das Grün der Pflanzen war noch satt vom Tau. Es war ein schöner Morgen, ein Morgen, der wieder einen brüllend heißen Tag versprach. Aber jetzt, so kurz nach dem Sonnenaufgang, war alles noch lind und gedämpft, die Farben, die Schatten, die Geräusche der erwachenden Stadt.
Die alte Dādā war an der Zisterne, um Wasser für die Küche zu holen, und Nabīla und Sarwa kamen in ihren Nachthemden über den Hof und begrüßten sie und verschwanden im Waschraum neben der Küche. Er sah ihnen zu. Er sah, wie sie sich bemühten, leise zu sein, kein Geräusch zu machen, um ihn nicht zu stören, und im selben Augenblick überfiel ihn wieder die Trauer und machte ihn gefühllos und starr.
Er begann auf und ab zu gehen in dem kleinen Zimmer zwischen Fenster und Türe, vier Schritte hin, vier Schritte zurück, vier Schritte hin, vier Schritte zurück.
Gegen das Ende der dritten Stunde kam Dādā an die Tür und klopfte leise. »Du mußt essen, Herr, bitte, du mußt essen!«
Er gab keine Antwort, wartete, bis sie gegangen war, nahm seine Wanderung wieder auf.
Es wurde warm im Zimmer, obwohl die gemauerten Wände noch die Kühle der Nacht gespeichert hielten. Der Durst begann ihn zu quälen. Er hatte seit dem Tod seiner Frau nichts mehr getrunken. Seine Kehle war trocken wie Papier.
Nach dem Gebetsruf am Mittag nahm er in plötzlichem Entschluß ein Oktavheft vom Regal, eines jener kleinen Hefte, wie sie die Kaufleute auf Reisen benutzten, um ihre Einnahmen und Ausgaben zu notieren, und setzte sich in die Fensternische, schnitt eine neue Spitze in die Rohrfeder, rührte die Tusche an, glättete das Papier und fing an zu schreiben. Er schrieb in arabischer Sprache, aber in hebräischer Kursivschrift, sehr rasch und mit kleinen Buchstaben und genau auf der Zeile. Er schrieb an seine Frau.
Er hatte ihr immer geschrieben, wenn er fern von ihr gewesen war, auf Reisen, in anderen Städten. Er hatte ihr am Abend geschrieben, was er tagsüber erlebt hatte, genauso wie er ihr zuhause immer alles beim Abendessen berichtet hatte, was am Tag vorgefallen war. Auf diese Weise war sie ihm immer nah gewesen. Er hatte auch jetzt das Gefühl, daß sie ihm nah sei, als er ihr schrieb.
Die beiden Mädchen kamen an die Tür und klopften zaghaft. »Wir bringen etwas zu essen, Vater«, hörte er sie rufen. »Dādā sagt, Ihr müßt essen.« Er hörte sie flüstern und unschlüssig hin und her laufen, und wenig später sah er durch das Fenstergitter, wie sie durch den Innenhof zurückgingen und in der Küche verschwanden.
Sie waren die Töchter seines Bruders. Sarwa war elf Jahre alt, Nabīla vierzehn, zwei zarte, stille Mädchen, nach Meinung der besorgten Dādā zu still und zu zart, weshalb sie ständig hinter ihnen her war, um sie mit allen möglichen Leckerbissen aufzupäppeln, und sich bemühte, mit den gleichen Leckerbissen Mädchen aus der Nachbarschaft ins Haus zu locken, damit sie ihnen Gesellschaft leisteten.
Vor knapp zweieinhalb Jahren waren sie von Ceuta mit dem Schiff nach Sevilla gekommen, zusammen mit anderen Flüchtlingen aus dem Maghreb, nichts als ein Kleiderbündel in der Hand und einen in höchster Eile hingekritzelten Brief seines Bruders in einem Lederbeutel um den Hals.
Sein Bruder war Handelsagent in Sijilmāsa gewesen, einer Wüstenstadt im Nordwesten Afrikas, zehn Tagesreisen südlich von Fez, heiß wie ein Schmelztiegel, aber auch erfüllt vom Glanz des Goldes und so bedeutend als Knotenpunkt des westafrikanischen Handels, daß viele der großen Fernhändler aus Alexandria und al-Mahdiyya, aus Sevilla und Almeria dort eigene Niederlassungen unterhielten. Sie schafften Zucker, Öl und Baumwollstoffe hin, Schmuck, Waffen, Lederwaren, und handelten dafür Gold und schwarze Sklaven ein, die in riesigen Karawanen aus den Ländern des Niger heraufgebracht wurden. Die unendlich langen Wüstenstraßen zwischen dem Niger und Sijilmāsa wurden von Nomaden beherrscht, die zum Stamm der Sinhādja-Berber gehörten. Sie kassierten hohe Schutzgebühren von den Gold- und Sklavenkarawanen und kauften dafür jene Waren, die von den Fernhändlern nach Sijilmāsa geschafft wurden. Ein Austausch, der alle Beteiligten zufriedenstellte.
Irgendwann aber hatten die einzelnen Stammesgruppen der Sinhādja angefangen, sich die Herrschaft über das Gold und die Goldstraße untereinander streitig zu machen. Die Almoraviden, die im Westen der großen Wüste beheimatet waren, hatten ihre Stammesbrüder, die die Herrschaft über Sijilmāsa ausübten, in wilden Kämpfen besiegt und unterworfen. Sie waren Wüsten-Nomaden, Halbwilde, Barbaren, von einem muslimischen Eiferer zu fanatischer Glaubensstrenge erzogen.
Vor zweieinhalb Jahren hatten sie Sijilmāsa eingeschlossen und waren über die Stadt hergefallen. Sie hatten nicht nur viele der Einwohner niedergemacht, sondern mit dem eingefleischten Haß der Nomaden auf alle seßhaft Lebenden auch die Palmen umgehackt, die Gärten verwüstet, die Bewässerungsanlagen zerschlagen. Vor allem die jüdische Kolonie hatte unter ihrer Grausamkeit zu leiden gehabt. Manchen ihrer Opfer hätten sie bei lebendigem Leib die Bäuche aufgeschlitzt, um die Eingeweide nach verschluckten Goldmünzen zu durchsuchen. So hatten es die Flüchtlinge berichtet.
Yūnus’ Bruder und seine Frau waren in ihrem Haus verbrannt. Gott allein wußte, was die beiden Mädchen an diesem schrecklichen Tag alles hatten mit ansehen müssen. Sie hatten nie darüber gesprochen. Aber Yūnus hatte oft nachts an ihren Betten gewacht und miterlebt, wie sie, von Alpträumen geschüttelt, im Schlaf gewimmert hatten. Und die ängstlich-klammernde Zärtlichkeit, mit der sie aneinander hingen, war sicher auch ein Erbe aus Sijilmāsa.
Yūnus sah, wie sie wieder aus der Küche kamen, Sarwa mit einem Korb, Nabīla mit dem Einkaufszettel in der Hand. Sie verschwanden hinter der Tür zur Vorhalle, die das Haustor vom Innenhof trennte. Die alte Dādā hatte sie wohl auf den Markt geschickt.
Gute, alte Dādā. Sie kam später am Nachmittag noch einmal selbst an die Tür.
»Herr, nimm das Wasser, nimm wenigstens das Wasser!« bettelte sie. »Ich lasse den Krug vor der Tür stehen. Nur das Wasser. Nur für die Waschung zum Gebet!«
Was hätte er ohne sie gemacht, wie hätte er diesen Tag überstanden? Die Beileidsbesuche, die schreckliche Geschäftigkeit der Leichenwäscherin, die gaffenden Gesichter der Muslims vor dem Friedhof, die nur gekommen waren, um die Frauen zu betrachten, die im Trauerzug ihre Kopftücher abgenommen hatten. Und dann der Hazzān, der neue Kantor mit seinen Klageliedern auf dem ganzen langen Weg vom Hof der Synagoge bis zum Friedhof vor der Stadt. Seine Stimme hatte ihm fast das Herz abgedrückt. Dieser Hazzān, der hinter dem Sarg hergegangen war, hatte mit der gleichen Stimme gesungen, wie der Kantor in der Synagoge von Almeria, damals, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren.
Oh, Karīma, Karīma al-Wuhsha, weißt du noch? Unser Kantor in Almeria?
Es war am letzten Tag des Pessachfestes gewesen. Nie im Leben würde er diesen Tag vergessen. Einen Monat zuvor war er zwanzig Jahre alt geworden, ein angehender Arzt und Hakīm mit guten Aussichten und großen Hoffnungen. Zum ersten Mal sollte er die Parascha lesen, die die Gemeinde seinem Vater für diesen Festtag zugestanden hatte. Eine große Ehre für den Sohn, wahrhaftig eine große Ehre. Aber es gab auch einen guten Anlaß dafür. Sein Vater hatte sich während der Festtage heimlich mit Amram Lebdī getroffen, dem ehrenwerten Ältesten, dem Juwelier, dem reichen Amram, und die beiden Männer hatten eine gewisse Übereinstimmung erzielt über eine Verbindung zwischen ihren Familien. Ihre beiderseitigen Wünsche hatten sich harmonisch ergänzt, denn der reiche Amram wünschte für seine Tochter sehnlichst einen Hakīm zum Mann, den Sohn eines Hakīm. Und sein eigener Vater erwartete eine Schwiegertochter, die so viel Vermögen mit in die Ehe brachte, daß der Sohn unbeschwert von Geldsorgen seine Studien fortsetzen konnte. Beides ließ sich glücklich verbinden. Die Mitgift sollte achthundert Dinar betragen, eine Summe, die von den Frauen auf der Galerie der Synagoge nur mit ehrfürchtigem Flüstern weitergegeben wurde.
Yūnus wußte offiziell von nichts. Der Vater hatte ihn noch nicht um seine Zustimmung gebeten. Aber die Mutter hatte ihm heimlich Bescheid gesagt. Er kannte auch das Mädchen, das ihm zugedacht war, die Tochter des reichen Amram. Jeder heiratsfähige junge Mann der Judengemeinde von Almeria kannte sie. Sie war ein hübsches, unbekümmertes Kind mit fröhlichen Augen, gerade vierzehn Jahre alt. Ja, er hatte sie gekannt, und er war nicht unzufrieden gewesen mit der Wahl seines Vaters.
Doch dann war eben jener letzte Tag des Pessachfestes gekommen. Noch heute war ihm jede Einzelheit gegenwärtig. Er sah sich hinter dem Thorapult stehen. Der Kantor breitete die Rolle vor ihm aus, und er begann zu rezitieren mit lauter, sicherer Stimme. Er kannte den Text der väterlichen Parascha so gut wie die Worte des Morgengebets. Er brauchte nicht auf die Schrift zu achten. Er schaute auf seinen Vater, der stolzgeschwellt vor ihm auf seinem Polster saß und mit dem reichen Amram wohlgefällige Blicke tauschte. Er schaute hoch zur Frauengalerie, wo seine Mutter stand, und suchte sie mit den Augen. Und dann sah er sie.
Sie stand auf der Seite der Mädchen, und sie war ein gutes Stück größer als alle anderen (sie war damals schon siebzehn Jahre alt gewesen). Und er fragte sich: Was macht sie bei den Mädchen, warum steht sie nicht bei den Frauen? Er dachte: Ist sie neu in der Gemeinde, ist sie eine Christin, warum habe ich sie noch nie gesehen? Und plötzlich verlor er seinen Text und suchte verzweifelt nach dem Anschluß in der Rolle und fand die Zeile nicht und wäre fast hängengeblieben, wenn ihm der Kantor nicht im letzten Augenblick die Worte zugeflüstert hätte. Der Kantor war der einzige gewesen, der bemerkt hatte, was geschehen war.
Ein paar Tage später hatten es alle gewußt. In der Gemeinde hatte es gesummt wie in einem Bienenstock. Niemand, der nicht heftig Anteil genommen hätte. Der Vater voll Zorn über den Ungehorsam des Sohnes. Der reiche Amram tödlich gekränkt und wütend, weil er fürchtete, sein Gesicht zu verlieren. Die Mutter hilflos in dem Versuch, zu vermitteln. Und er selbst immer halsstarriger, je mehr er bedrängt wurde.
Er hatte schließlich die Stadt verlassen müssen. Die Mutter hatte ihm Geld gegeben und ihn zu ihrem Bruder geschickt, nach Ägypten, nach Fustat. Erst als er schon auf dem Schiff gewesen war, im letzten Augenblick vor dem Ablegen, hatte ihm der Vater doch noch seinen Segen gegeben.
Er war vier Jahre im Orient geblieben, hatte in Kairo und Baghdad studiert. Als er zurückgekommen war, hatten seine Eltern nicht mehr gelebt. Aber sie war dagewesen. Briefe waren hin und her gegangen während seiner Abwesenheit. Der junge Kantor war ihr Mittelsmann gewesen. Und sie hatte auf ihn gewartet, auch sie gegen den Widerstand ihrer Familie.
Sie hatten geheiratet. Sie hatten die Feindseligkeit der Strenggläubigen ertragen und den offenen Haß des reichen Amram und seiner großen Gefolgschaft. Und als ihre Ehe ohne Kinder geblieben war und die Übelwollenden angefangen hatten, von der gerechten Strafe Gottes zu sprechen, waren sie auch damit fertiggeworden. Aber dann war Ibn Abbās, der großmächtige Vezir des Fürsten von Almeria, mit Samuel Nagdela, dem Vezir des Fürsten von Granada, in Streit geraten und hatte angefangen, seine Wut über den jüdischen Gegenspieler an den Judengemeinden seines Machtbereichs auszulassen mit Sondersteuern und Handelsbeschränkungen und anderen Schikanen, worauf viele Juden ausgewandert waren. Da hatten auch sie die Gelegenheit genutzt und waren nach Sevilla gezogen. Das war vor fünfundzwanzig Jahren gewesen.
Von draußen drang jetzt das dumpfe Gedröhn der Pauken und Trommeln herein, mit denen die Torwachen des al-Qasr die Zeit des ersten Nachtgebets ankündigten. Kurz darauf war der Gebetsruf vom Turm der Hauptmoschee zu hören und das dünne Vespergeläut der christlichen Kirchen in den Vorstädten. Yūnus verschloß sorgfältig das Tuscheglas, verstaute es zusammen mit den anderen Schreibutensilien in einem der verschließbaren Wandschränkchen und setzte sich wieder in die Fensternische.
Es wurde rasch dunkel. Er saß ruhig, ohne sich zu rühren, beobachtete, wie die Dunkelheit von seinem Zimmer Besitz ergriff und ihn einhüllte, spürte nach, wie die Hitze des Tages sich allmählich verflüchtigte. Erinnerungen und Gedankenfetzen von schmerzender Klarheit gingen ihm durch den Kopf. Er konnte sie nicht festhalten. Unversehens schlief er ein.
Der Durst weckte ihn. Seine Kehle brannte, und seine Zunge klebte am Gaumen, und seine Gedanken kreisten um den Wasserkrug, der draußen vor der Tür stand. Aber er war noch nicht bereit, sein Fasten zu brechen.
Er begann, sich mit dem Problem des Durstes zu beschäftigen. Warum war Durst schwerer zu ertragen als Hunger? Warum starb der Mensch bei Mangel an Flüssigkeit schon nach wenigen Tagen, während er einen völligen Nahrungsentzug notfalls über sechs, acht Wochen hinweg durchhalten konnte, ohne Schaden zu nehmen?
Er arbeitete sich verbissen durch die Standardwerke seiner medizinischen Bibliothek, nahm sich Galen vor und ar-Razi, den Qanun des Ibn Sina und das Kitāb al-Maliki des Ibn al-Abbās, ohne bei den Autoritäten einen brauchbaren Hinweis zu finden. Dann trug er die Fakten zusammen, die ihm aus eigener Praxis geläufig waren, und begann selbst über eine Lösung nachzudenken.
Man mußte ausgehen von den vier Elementen, aus denen sich alles zusammensetzte: Feuer, Luft, Wasser, Erde. Weiter von den vier Körpersäften, deren richtige oder falsche Mischung im menschlichen Körper über Gesundheit und Krankheit entschied: gelbe Galle, Blut, Schleim, schwarze Galle. Wasser und Schleim wurden von den gleichen Eigenschaften bestimmt: kalt und feucht. Wenn dem Körper kein Wasser zugeführt wurde, konnte sich kein Schleim bilden. Im Mischungsverhältnis der Körpersäfte fehlte die feuchtkalte Komponente, die Konstitution verschob sich zum Warm-Trockenen hin. Die Folge: Fieber sowie mangelnde Ausscheidung von Speichel, Nasenschleim und Schweiß und eine allgemeine Austrocknung des Körpers. Das waren die Grundtatsachen. Aber es blieb die Frage, warum der Mangel an Wasser, der einen Mangel an Schleim zur Folge hatte, so rasch zum Tod führte.
Er wählte einen anderen Ausgangspunkt für seine Überlegungen, folgte einer Kette von Schlußfolgerungen, die ihn annehmen ließen, daß von den Substanzen, die bei der Verbrennung der Nahrung und der Atemluft im Körper zurückblieben, jene, die normalerweise mit dem Schleim ausgeschieden wurden, womöglich giftiger waren als jene, die mit den anderen Körpersäften über Stuhl, Urin und Blut ausgeschieden wurden. Gab es aufgrund von Wassermangel keine Schleimabsonderungen durch Schweiß und Speichel, blieben die Giftstoffe im Körper. War das die Ursache für den raschen Tod?
Er erinnerte sich an drei Mekka-Pilger, die er damals, als er in Baghdad studiert hatte, im Sinan-Hospital am syrischen Tor behandelt hatte. Die drei waren in der Wüste nur dadurch am Leben geblieben, daß sie ihren eigenen Urin getrunken hatten. Das stützte seine Annahme, war aber noch kein Beweis.
Er schloß in seine Überlegungen ein, daß Fieberkranke mehr Flüssigkeit verlangten als Gesunde, daß der Durst bei großer Hitze wuchs, daß also der Bedarf an Flüssigkeit um so mehr zunahm, je mehr sich das Mischungsverhältnis der Körpersäfte zum Warm-Trockenen hin verschob, was seltsamerweise dazu führte, daß der Körper durch Schweißabsonderung noch mehr Schleim ausschied, wodurch sich das Mischungsverhältnis weiter verschlechterte. Was aber bewirkte die Flüssigkeit dann im Inneren des Körpers? Welchen Unterschied machte es, ob man kalte oder heiße Flüssigkeit zu sich nahm? Brauchten Frauen, deren Konstitution von Natur aus mehr zum Kalt-Feuchten neigte, auch mehr Flüssigkeit als Männer? Starben sie auch entsprechend eher bei Flüssigkeitsentzug? Er verirrte sich in einem Labyrinth von Fragen und sah plötzlich den Wasserkrug, den die alte Dādā draußen abgestellt hatte, innen am Türpfosten stehen, starrte auf den Riegel, der die Tür versperrt hielt, suchte verzweifelt nach einer Erklärung, wie der Krug ins Zimmer gekommen war, stand gegen seinen Willen auf, machte zwei Schritte auf den Krug zu, blieb stehen, kniff die Augen zusammen, schlug sich mit den Handballen gegen die Stirn. Kein Krug mehr an der Tür. Eine Wahnvorstellung, nichts als eine Wahnvorstellung, der er zum Opfer gefallen war.
Er erinnerte sich, daß ihm die drei Pilger im Sinan-Hospital von ähnlichen Erfahrungen berichtet hatten. Von leibhaftigen Wasserträgern, von winkenden Beduinen, von ganzen Karawanen, die vor ihren Augen vorübergezogen waren und sich schließlich beim Nähergehen als ganz gewöhnliche, nicht einmal besonders auffallend geformte Felsbrocken entpuppt hätten. Wirkte demnach der Entzug von Flüssigkeit und der Mangel an Schleim auf das Gehirn? Oder war es weniger das Fehlen des Feucht-Kalten im Mischungsverhältnis der Körpersäfte als vielmehr eine daraus resultierende Überfülle des Warm-Trockenen, das heißt der gelben Galle, die diese Wirkungen im Gehirn hervorrief? Schrieb nicht Galen, daß ein Überfluß an gelber Galle Ursache für den Wahnsinn ist? Deuteten die Wahnvorstellungen nicht auf beginnenden Wahnsinn hin?
Andererseits hatten die drei Pilger in der Endphase des Verdurstens keineswegs die Symptome gezeigt, die normalerweise mit einem Überfluß an gelber Galle einhergingen. Keine cholerischen Zustände, keine Aufgeregtheit, sondern eher Depression, völlige Apathie, also Symptome, die auf einen Überfluß an schwarzer Galle, an Melan Chole, hatten schließen lassen. War Galens Aussage also falsch? Waren seine eigenen Schlußfolgerungen falsch? War die ganze Richtung falsch, in die er dachte, das ganze System?
Noch mehr Fragen. Viel zu viele Fragen. Und welchen Sinn hatten alle diese Fragen? Was war gewonnen, wenn er eine Antwort fand? Was half es dem Pilger, der am Verdursten war, wenn er wußte, warum er verdurstete? Brauchte er nicht vielmehr ein ganz anderes Wissen, ein Wissen, das ihm einen Weg aus der Wüste wies, Kenntnisse, die ihn zu einem Wasserloch führen konnten?
Er dachte an die Tage und Nächte, die er am Krankenbett seiner Frau verbracht hatte. Was hatten ihm da all seine Kenntnisse genützt über die Anatomie des Körpers, über die Natur der Krankheiten, über die Wirkungsweise der verschiedenen Pharmaka. Was hatten ihm seine Studien geholfen, seine Bücher, seine Wissenschaft?
Er schloß die Augen und überließ sich einer Verzweiflung, die ihn noch mehr ausdörrte als der Mangel an Wasser.
Am späten Nachmittag kam Zecharia in den Innenhof des Hauses. Zecharia war sein Assistent in der Praxis, sein einziger Schüler. Yünus hatte sich immer geweigert, Schüler anzunehmen. Der Hang zum Zweifel, der ihm eigen war, machte ihn nach seiner Meinung zum Lehrer ungeeignet. Zecharia war die einzige Ausnahme, zu der er sich einmal durchgerungen hatte. Zecharias Vater war Glasbläser gewesen, im selben Schiff wie Yūnus aus Almeria gekommen. Nach dem Tod des Mannes hatte Yūnus den Sohn in seine Praxis geholt. Seit drei Jahren war der Junge jetzt schon bei ihm, zuerst als Handlanger, dann als Lehrling, seit kurzem als Student. Er war eifrig, lernbegierig, ehrgeizig und von rascher Auffassungsgabe. Und er war verläßlich.
Yūnus sah, wie er im Innenhof mit der alten Dādā sprach und wie sie beide ins Haus gingen. Dann hörte er sie in die Madjlis kommen bis vor die Tür seines Zimmers. Dādā klopfte, zuerst mit dem Finger, dann mit der Faust.
»Herr!« rief sie. »Zecharia hat einen Mann mit einer kranken Frau gebracht. Bauern aus der al-Jarāfe. Sie wollen zu dir, Herr, sie wollen zum Sohn des Einäugigen.«
Er schwieg. Aber diesmal gab sie nicht nach.
»Herr, sie sind in der Vorhalle. Sie warten schon seit gestern auf dich. Die Frau ist sehr krank. Zecharia sagt, sie ist sehr krank.«
Er gab immer noch keine Antwort. Er würde sowieso kein Wort herausbringen mit seinen trockenen, verklebten Lippen und seiner aufgeschwollenen Zunge.
Dādā rüttelte an der Tür. »Herr, wenn du nicht aufmachst, hole ich Ammi Hassān! Hast du gehört, Yūnus! Ich hole Ammi Hassān, damit er die Tür aufmacht. Komm heraus, Yūnus, komm heraus! Es ist nicht gut, was du machst.« Ihre Stimme klang jetzt sehr streng. Sie war ernsthaft böse. Sie nannte ihn nur dann bei seinem Eigennamen, wenn sie sehr ärgerlich auf ihn war.
Er stand auf und ging zur Tür und räusperte sich den Hals frei. »Was sind das für Leute?« fragte er. »Sind es Muslims?«
»Ja, Hakīm«, antwortete Zecharia.
»Dann schickt sie zu Yūsuf Ibn Harūn, dem Shaikh. Er kennt sich besser aus mit Leuten vom Land«, sagte er durch die geschlossene Tür. Er hörte, wie Zecharia zu einer Antwort ansetzte, aber Dādā kam ihm zuvor.
»Herr, sie wollen zu dir. Zecharia hat sie zum Shaikh geschickt, ich habe sie zum Shaikh geschickt, sie lassen sich nicht wegschicken. Sie wollen zum Sohn des Einäugigen. Sie hocken in der Vorhalle, und die Ziege, die sie mitgebracht haben, scheißt den Boden voll. So ist es!«
»Ich habe wirklich alles versucht, Hakīm«, setzte Zecharia vermittelnd hinzu. »Sie haben die Nacht in der Abu-Hassān-Moschee verbracht. Die Frau ist sehr geschwächt.«
Yūnus hatte den Riegel schon in der Hand. Er drehte sich noch einmal um. Die Sonne stand so tief, daß ihr Licht unter dem Bogen des Laubengangs hindurch die untersten Öffnungen des Fenstergitters erreicht hatte. Fünf Strahlen fielen herein, griffen quer durch den Raum nach seinen Füßen wie fünf Finger einer gläsernen Hand, malten fünf hell leuchtende Flecke auf den Boden. Er sah in Gedanken den Bauern vor sich, wie er mit seiner kranken Frau auf dem Esel und mit der Ziege am Strick sich auf den langen, heißen Weg in die Stadt machte und sich von Tor zu Tor durchfragte bis zum Sohn des Einäugigen, dem Hakīm. Er kannte diese Bauern aus seinen ersten Praxisjahren. Wahrscheinlich hatte er vor wer weiß wie vielen Jahren einen Nachbarn der beiden in Behandlung gehabt und mit Gottes Hilfe kuriert, und jetzt war ihm ein gewaltiger Ruf zugewachsen in einem Dorf der al-Jarāfe, das er nicht einmal kannte.
»Der Sohn des Einäugigen«, das war ein Name, den sich die Bauern merkten.
Er schob den Riegel hoch und öffnete die Tür, durchquerte die Madjlis, ohne sich aufzuhalten, lief über den Innenhof zum Waschraum. Die alte Dādā watschelte hinter ihm her wie eine Ente, die ihr Junges wiedergefunden hat. Er wusch sich die Asche aus dem Gesicht und aus den Haaren, trank ein wenig frisches Wasser in kleinen, vorsichtigen Schlucken, legte ein neues Gewand an. Nur die Schuhe, die Dādā ihm hinstellte, ließ er noch stehen.
Als er in die Vorhalle kam, saß die Frau auf dem Boden, in ihre Tücher eingehüllt, den Kopf auf den Knien. Der Mann, der dabeistand, war noch ziemlich jung, vielleicht Mitte zwanzig, sehr groß, sehr kräftig. Er blickte Yünus mißtrauisch entgegen, stellte sich ihm in den Weg.
»Ich will zu Ibn al-A’war«, sagte er mit einem drohenden Unterton. »Keiner geht an meine Frau außer Ibn al-A’war!« Anscheinend hatte er sich den Sohn des Einäugigen älter vorgestellt.
Yūnus holte tief Luft, aber die alte Dādā schob ihn mit einer energischen Armbewegung zur Seite und baute sich vor dem Bauern auf und verkündete mit einer großartigen Geste und der Stimme eines Ausrufers: »Dies ist Yūnus Ibn Ismail Ibn Yūnus al-A’war, der Ehrenwerte, der hochgelehrte Tabīb, der Hakīm, dem Gott die Geheimnisse der Wissenschaft enthüllt hat und dessen Hände er mit heilender Kraft erfüllt hat!« Sie war drauf und dran, auch noch die Namen seiner übrigen Vorfahren anzuhängen mit allen Ehrentiteln bis ins siebte Glied, aber der Bauer war schon vom Anfang so beeindruckt, daß er zur Seite trat.
Yūnus schickte Zecharia hinaus und machte sich daran, die Frau mit Dādās Hilfe zu untersuchen.
2 Sabugal
DONNERSTAG 7. AUGUST 1063 9. ELUL 4823/9. SHABĀN 455
Die Küche befand sich im inneren Teil der Burg in einem Anbau, der sich an den massigen Wohnturm klammerte wie ein Kind an die Beine der Mutter. Der Eingang lag drei Mannshöhen über dem Boden, ein aufgesperrtes Maul, so groß wie ein Stalltor, das jetzt im Sommer offenstand, damit die Hitze besser abziehen konnte. Eine steile Rampe aus zwei Stämmen, die durch eingelassene Querhölzer miteinander verbunden waren, führte hinauf.
Für jeden Dienstmann auf der Burg, gleichviel ob er Knecht war oder Waffen trug, galt die Regel, daß er am Morgen, wenn er aus dem Mannschaftsbau kam und in die Küche ging, um die Morgensuppe zu fassen und die Tagesration an Brot und Speck oder was es sonst gab, für jeden galt die Regel, daß er ein paar Äste Brennholz mit hochtrug von dem Haufen, der unten aufgeschichtet lag.
An diesem Morgen kam der starke Pere mit leeren Händen oben an. Er hatte es nicht mit Absicht getan, man konnte es ihm ansehen. Der Bauer, der jede Woche eine neue Ladung Holz brachte, war gerade gekommen, und Pere hatte ein paar Worte mit ihm gewechselt und darüber vergessen, sein Stück Holz mitzunehmen. Er wäre wohl auch zurückgegangen und hätte es in Gottes Namen geholt, aber der Koch war schlechter Laune, und Pere kam ihm gerade recht, und er fauchte ihn an, was er sich einbilde, nur fressen und nichts dafür tun wollen, gerade er, der beim Fressen immer der Größte wäre und das Maul nicht voll genug kriegte, und weiter in diesem Ton.
Daraufhin konnte Pere nicht mehr so ohne weiteres zurück, denn es waren schon zu viele Männer in der Küche, die alles mitangehört hatten. Er stand im Eingang mit eingezogenem Kopf, die runden Schultern vorgeschoben, die dicken Arme seitlich abgestreckt, noch gedrungener wirkend gegen den hellen Himmel draußen, als er es ohnehin schon war. Er dachte nach. Man konnte förmlich zusehen, wie es in ihm nachdachte, wie sich die Gedanken hinter der breiten Stirn in Bewegung setzten. Er dachte lange nach.
Dann fing unten der Esel des Brennholzbauern an zu schreien, und Pere, als hätte ihm der Esel das Kommando gegeben, drehte sich um und stapfte die Rampe hinunter. Am Fuß der Rampe stand der Esel. Er hatte das Holz noch auf dem Rücken, einen riesigen Haufen langer Äste, unter denen er fast verschwand. Pere ging neben ihm in die Hocke und nahm ihn mitsamt der Ladung auf den Buckel, stemmte ihn hoch, trug ihn die Rampe hinauf und in die Küche hinein und stellte ihn mitten in den Aschengraben vor das Herdfeuer.
Der Koch ging auf wie ein Brot im Ofen und fing zu kreischen an und schoß aus der Küche, um sich zu beschweren. Aber keiner nahm ihn ernst, denn der Castellan war in Guarda, und die Dueña würde ihn gar nicht erst vorlassen so früh am Morgen, das war gewiß. Sie sahen zu, wie er auf der Außentreppe zum Wohnturm fuchtelnd auf den Kammerknecht einredete, der ihm den Eintritt verwehrte, und lachten dröhnend und klopften dem starken Pere auf die Schultern und fielen fast von der Bank, als der Esel, der immer noch blöde glotzend in der Brandreite stand, vor Angst plötzlich losbrunzte, daß es in den Suppenkessel spritzte. Nur Pere saß ganz ruhig da mit seinem Brot und seiner Schüssel und tat so, als wäre nichts gewesen.
So hatte der Tag begonnen. Es war kein gewöhnlicher Tag gewesen von Anfang an. Kein guter Tag. Eine von den Mägden sagte später, im Vorhof habe eine tote Krähe gelegen, als sie am Morgen in die Burg gekommen sei. Sie habe ein Kreuz geschlagen und nicht weiter darauf geachtet. Wer achtet schon auf alle Zeichen.
Der Junge wäre gern bei den Männern in der Küche geblieben, aber er mußte zurück in den Wohnturm, das Wasser für den jungen Herrn hochtragen. Die Amme würde ihm sowieso die Ohren langziehen, wie es aussah, weil er sich schon wieder verspätet hatte. Er mußte sich an viele Regeln halten, seit er zum Haus gehörte, seit ihn der Conde, der hohe Herr, vor einem Monat zum Leibburschen seines kleinen Sohnes gemacht hatte. Er wußte noch immer nicht genau, wie es dazu gekommen war, und ob er Gott dafür danken sollte oder nicht.
Er hatte am Fuß des Wohnturms gesessen, an der Ostmauer, mit den Sätteln und Packtaschen der ganzen Mannschaft des Conde, um das Lederzeug für den Rückritt nach Guarda zu putzen und zu fetten. Er war darüber eingeschlafen. Ein Schrei hatte ihn geweckt, und er hatte noch halb im Schlaf ein Bündel auf sich zufliegen sehen und war hochgefahren und hatte die Arme ausgestreckt, mehr um sich selbst zu schützen, als um das Bündel aufzufangen. Und dann hatte er sich am Boden wiedergefunden mit dem kleinen Sohn des Conde in den Armen. So war es gewesen, nicht anders. Und seitdem stand er in diesem strengen Dienst.
Er durfte den Kleinen nie aus den Augen lassen, von morgens bis abends nicht. Nachts mußte er vor seiner Tür schlafen, tags mußte er ständig in seiner Nähe sein, mußte alles tun, was ihm die Amme, die Kindermagd, die Stubenmagd auftrugen, mußte sogar den faden Brei vorkosten, den die Amme dem Kleinen alle zwei Tage gab, um ihn zu entwöhnen. So hatte es der Conde selbst befohlen. Und der Conde war der Herr, der mächtige Graf von Guarda, dem alles untertan war. Auch der Castellan und die Burg von Sabugal. Auch sein Vater und seine Mutter und das Dorf, aus dem er stammte.
Nur am Nachmittag, wenn der Kleine schlief, hatte er drei Stunden frei, damit der Capitan ihn im Gebrauch der Waffen unterrichten konnte. Auch das hatte der Conde so befohlen, und es war das einzige, was ihn mit seinem neuen Dienst versöhnen konnte, die einzigen Stunden des Tages, auf die er sich freute.
Heute sollten diese drei Übungsstunden ausfallen. Heute war Ruhetag für alle Männer auf der Burg, freier Tag, Dienst nur für die Wachen. Der Koch hatte schon seine Messer geschärft, um eine Sau zu schlachten, und am Abend, wenn der Castellan mit seinen Leuten aus Guarda zurückkam, sollte es ein Festessen geben in der großen Halle des Wohnturms. Wein für die ganze Besatzung.
Die Männer hatten den freien Tag hart verdient. Sie hatten eine arbeitsreiche Erntewoche hinter sich. Südwind mit glühender Hitze, und der Castellan hatte auch von den Reitern der Burgbesatzung verlangt, daß sie mit zupackten, wenn Not am Mann war. Dazu noch verstärkter Wachdienst, weil der Castellan kein Risiko eingehen wollte, solange der Sohn des Conde auf der Burg war. Ständig zwei Mann auf dem Turm und zwei Mann am Tor, und das äußere Tor auch tagsüber geschlossen, und nachts Doppelposten und Rundgänge mit den Hunden. Und das alles, obwohl zum Schutz des kleinen Herrn eigens zwei Infanzones aus der Mesnada des Grafen mit ihren Burschen aus Guarda herübergekommen waren, die nur Hofdienst auf der Burg verrichteten und sonst nichts zu tun hatten und nur großspurig herumtaten.
Vor vier Tagen war man mit der Ernte fertig geworden, und die Männer hatten schon aufgeatmet, da war der Castellan mit dem nächsten Auftrag gekommen. Zwanzig Pferde hatten sie von den Sommerweiden holen müssen, von vier verschiedenen Weideplätzen, einer weiter entfernt als der andere, und alles in großer Besetzung und in voller Montur, weil die Schafhirten von den Weiden im Nordosten etwas von einem fremden Reitertrupp gemeldet hatten.
Am Abend zuvor waren die letzten Pferde angekommen. Sie standen in den frisch abgeernteten Weizenfeldern zwischen dem Herrenhof und dem Fluß und hatten die Köpfe tief im Stroh, um nach den saftigen Gräsern zu suchen, die zwischen dem Getreide gewachsen waren. Die Männer waren alle auf der Burg, nur zwei Peones noch draußen, um die Weidezäune weiter flußaufwärts auszubessern. Bis zum Abend sollten noch vierzig Rinder vor die Burg getrieben werden.
Ungefähr zwei Stunden nach Sonnenaufgang erschienen oben am Hang über dem Fluß drei Männer und bogen auf die Straße ein, die zur Brücke führte. Die Brücke war im Juni eingebrochen. Der Castellan hatte schon den Auftrag gegeben, sie wieder herzurichten, aber seit Beginn der Ernte ruhte die Arbeit. Kein Mensch war unten an der Baustelle, als die drei Fremden durch den Fluß wateten. Voraus ging einer zu Fuß in einem Bauernkittel mit einem Tuch um den Kopf, das er auf maurische Art geschlungen hatte. Er trug auch einen maurischen Bogen im Köcher über der Schulter. Hinter ihm kamen zwei Pardos, Bauernreiter auf großen knochigen Pferden, in Lederzeug mit kurzen Lanzen, die Helme am Sattelknopf.
Der Junge sah sie als erster. Er entdeckte sie, noch bevor die Turmwache das übliche Hornsignal hören ließ. Er stand auf dem Wehrgang der Palisade, die den Vorhof vom inneren Burghof trennte, und langweilte sich. Hinter ihm, in dem kleinen Garten, den die Dueña neben dem Wohnturm hatte anlegen lassen, spielte der Sohn des Conde in seinem Laufstall. Der Junge hätte unten bei ihm sein sollen, aber es war noch die Kindermagd da, die aufpaßte, und der Kleine hatte etwas, das ihn beschäftigt hielt. Er spielte mit einem Vogel, den der Brennholzbauer mitgebracht hatte. Der Vogel hing mit einem Fuß an einem langen dünnen Faden, dessen anderes Ende an einem der Gitterstäbe des Laufstalls festgebunden war. Er kämpfte flügelschlagend und angstvoll piepsend um seine Freiheit, hüpfte auf das Gitter, flog hoch, stürzte ab, sobald der Faden sich spannte, flog wieder hoch, stürzte wieder ab, wieder und wieder. Und der Kleine lachte und freute sich über das piepsende, flatternde Federknäuel und versuchte, mit seinen tapsigen Händen den Faden einzuholen. Aber noch war der Vogel kräftig genug, um sich immer wieder loszureißen.
Die drei Fremden hatten den Fluß durchquert und schlugen den Weg ein, der südlich um die Burg und das dahinterliegende Dorf herumführte. Die Männer der Burgbesatzung, die noch in der Küche waren, hatten sich in den Eingang gestellt und hielten Ausschau. Es war ungewöhnlich, daß so früh am Tage Fremde kamen.
Als die drei an der Abzweigung anlangten, die zum äußeren Tor heraufführte, machten sie Halt, und der zu Fuß, der wie ein Moro aussah, kam allein auf das Tor zu, so daß ihn der Junge aus den Augen verlor.
Das Tor war verschlossen, wie es angeordnet war. Den Dienst als erste Torwache unten hatte der alte Aznar. Als zweiter Mann war einer von den Bauernburschen aus dem Dorf eingeteilt. Der stand oben auf der Torbefestigung und hing mit beiden Armen über der Brüstung.
Der Junge sah, wie der alte Aznar den Schieber am Guckloch zurückschob und mit dem Mann draußen sprach und sich dann abwandte und ausspuckte und auf den Mannschaftsbau zulief, als wollte er jemanden holen. Dann hörte er auf einmal ein herzzerweichend klägliches Piepsen hinter sich und blickte über die Schulter nach unten und sah, daß der Junge im Laufstall es endlich geschafft hatte, sich den Vogel zu greifen. Er hielt ihn fest zwischen seinen dicken Händen und gluckste vor Vergnügen, als das Federbündel noch einmal matt mit den Flügeln schlug, bis er plötzlich merkte, daß das Ding nicht mehr mitspielte, daß es sich nicht mehr rührte, auch wenn er es schüttelte und daran zupfte. Und er verzog das Gesicht zu einer weinerlichen Grimasse, wie er es immer tat, wenn ihm etwas nicht paßte, und war kurz davor loszubrüllen, als plötzlich ein Schrei ertönte, ein so furchtbarer Schrei, daß der Junge meinte, ein kaltes Messer würde ihm über den Rücken gezogen, ein Schrei an der Grenze äußersten Schmerzes. Für einen Augenblick war er heillos verwirrt, er hatte auf das übliche Gebrüll des Kleinen gewartet und starrte ihn völlig entsetzt an, bis ihm klar wurde, daß es gar nicht der Kleine war, der da schrie, sondern daß der Schrei aus dem äußeren Burghof kam.
Der alte Aznar lag auf dem Boden, keine zwanzig Schritte vom Tor entfernt. Er lag auf dem Bauch und ruderte mit Armen und Beinen, um vom Boden hochzukommen und kam nicht hoch und schrie und schrie, hörte nicht mehr auf zu schreien. In seinem Rücken steckte ein Pfeil. Der Kerl mit dem maurischen Bogen mußte ihm durch das kleine Guckloch hindurch einen Pfeil in den Rücken gejagt haben.
Und die drei waren schon auf der Flucht, den Weg hinunter zum Fluß in mäßig scharfem Galopp, als hätten sie es gar nicht eilig. Der mit der Moro-Kopfbinde saß bei einem der beiden Reiter hintenauf.
Der Junge dachte: Heiliger Jakob, sie haben die Burg angegriffen! Drei Mann nur! Drei verdammte Pardos, und sie greifen eine ganze Burg an! Er hörte sich plötzlich schreien: »Sie haben auf den alten Aznar geschossen!« Er stand auf dem Wehrgang und schrie aus Leibeskräften: »Sie haben den alten Aznar umgelegt! Der alte Aznar! Sie haben ihn umgelegt!« Da war schon alles auf den Beinen. Vom Turm tönte die Alarmglocke, und die Männer aus der Küche polterten die Rampe hinunter, und andere kamen aus dem Mannschaftsbau gerannt. Aus dem oberen Fenster des Wohnturms hing die Dueña und schrie. Irgend jemand schrie zurück, überall schrien sie jetzt durcheinander. Die ersten waren schon am Stall im äußeren Burghof, wo immer zwei gesattelte Pferde bereitstanden. Rufe: »Tor auf!« Und Rufe nach dem Capitan, damit er die Waffenkammer aufsperrte. Wo war der Capitan? Die beiden Infanzones kamen mit ihren Burschen aus dem Wohnturm, die Holztreppe herunter: »Was ist los? Was ist los?« Da waren die anderen schon am äußeren Tor und griffen sich irgendwelche Waffen, was gerade herumstand in der Wachstube, der junge Tomás allen voraus, schon auf dem Pferd, ohne Rüstung, ohne Lanze, nur einen kurzen Spieß in der Hand und hinaus durchs Tor und im Losreiten noch den Helm aufgebunden. Der Capitan noch immer nicht da. Die Infanzones noch immer ohne Antwort. »Was ist los, verdammt noch mal, was ist hier los?« Und der auf dem Turm hing nach wie vor an der Glocke, und das himmelhelle Gebimmel mischte sich mit den wahnsinnigen Schmerzensschreien des alten Aznar, der immer noch am Boden lag und nicht hochkam.
Der Junge war mit ein paar Sprüngen an der Leiter und hinunter wie eine Katze und in den äußeren Burghof hinaus. Er achtete nicht auf die Kindermagd, die ihm irgend etwas nachschrie, er hatte nur noch Augen für die Männer draußen, die sich an die Verfolgung der drei Pardos machten. Der starke Pere im offenen Kettenhemd mit einer Axt in der Rechten als einziger Waffe. Enneg, der Stallbursche, auf einem ungesattelten Maultier und Bermudo, der mit seinem Sattel erst jetzt aus dem Mannschaftsbau gerannt kam und nach einem Pferd schrie und zur äußeren Kuppel weiterrannte. Die anderen an ihm vorbei mit den kurzen Spießen aus der Wachstube. Die Waffenkammer noch immer versperrt. Noch immer keine Spur vom Capitan. Und der starke Pere sprengte zum Tor hinaus und die anderen hinterher, zuletzt nur noch der Galicier am Tor, der die Spieße verteilt hatte, und der lange Rechín mit seinem Riesengaul. Der zog noch umständlich seinen Sattelgurt fest und stolperte über seine Lanze und kam endlich doch noch hoch und brachte beide Füße in den Bügeln unter, stellte sich auf, um sich im Sattel zurechtzusetzen, da war der Gaul schon am Tor, und Rechín knallte mit dem Kopf gegen den Torbalken, knallte mit solcher Wucht dagegen, daß es ihn gestreckt aus dem Sattel fegte. Der Junge stand dicht daneben und sah, wie der Lange auf den Boden aufschlug und wie sich sein linker Fuß im Steigbügel verhängte und das Pferd ihn vors Tor schleifte und vorne hochging und wild mit den Vorderfüßen schlug, weil der Lange immer noch festhing.
In diesem Augenblick rannte der Junge los, rannte leichtfüßig mit vorgestreckten Armen auf das Pferd zu, faßte nach dem Zügel, zog Rechíns Fuß aus dem Bügel, griff sich die Lanze, zog sich aufs Pferd, indem er die Lanze wie eine Kletterstange benutzte, und brachte das Pferd dazu, daß es sich in Bewegung setzte. Es war ein riesiges Tier, noch größer, als es aussah. Der Junge hielt sich am Sattelknopf fest. Seine Beine standen seitlich weit ab, und die Steigbügel hingen leer und schlenkerten dem Tier um die Flanken, während es jetzt immer schneller wurde und den Weg zum Fluß hinunterjagte und aufspritzend durch den Fluß, geradewegs den anderen hinterher, die schon weit voraus waren.
Die Lanze schleifte nach. Lope bemühte sich mit aller Kraft, sie in den Griff zu bekommen. Sie war schwer, viel schwerer als die, mit der der Capitan ihn hatte üben lassen, und er hatte sie viel zu weit hinten gefaßt. Er faßte nach, bis er den aufgerauhten Griff in der Hand spürte, brachte die Spitze nach vorn und in die richtige Höhe. Zwei rote Bänder flatterten am Schaft entlang von der Spitze bis zum Griff, er durfte nicht hinschauen, es sah aus, als flatterte die ganze Lanze in seiner Hand.
Auf der jenseitigen Uferwiese fiel das Pferd in einen schwerfälligen Galopp, der das Äußerste zu sein schien, was es zu leisten imstande war. Der Junge trieb es den Hang hinauf, auf die Straße zu, die nach Guarda führte. Die anderen, die vor ihm ritten, waren schon über dem Hügelkamm verschwunden und nicht mehr zu sehen.
Er merkte plötzlich, daß er die Lanze viel zu tief hielt. Die Spitze neigte sich immer mehr, wurde immer schwerer. Seine Hand zitterte, sein ganzer Arm verkrampfte sich vor Anstrengung, während er sich abmühte, sie waagrecht zu halten. Der Wind verfing sich in den Bändern, drückte die Spitze noch weiter nach unten. Er spürte, wie seine Kraft nachließ, und sah einen Reisighaufen voraus, der rasend schnell näher kam, und hielt die Lanze krampfhaft fest und merkte noch, wie die Spitze in den Haufen einstach, und wie es ihn aus dem Sattel stieß und hochhob. Und er sah, wie das Pferd unter ihm hindurchschoß, und meinte zu schweben, schwerelos für einen kurzen Augenblick hoch über dem Boden, bis er abstürzte, so wie der kleine Vogel am Ende des Fadens.
3 Murcia
DONNERSTAG 9. SHABĀN 455 7. AUGUST 1063/9. ELUL 4823
Das Haus lag in der nördlichen Vorstadt an der Straße, die nach Toledo führte. Ein heruntergekommenes Mietshaus, um einen weiten Innenhof angelegt, zweistöckig, das Obergeschoß erst nachträglich aufgesetzt mit Wänden aus lehmverputztem Flechtwerk, so dünn, daß jeder im Zimmer des Nachbarn mitwohnte. Tür neben Tür, eine Wohnung an der anderen, von kleinen Leuten besetzt, die vom Land zugezogen waren, Latrinenreiniger, Lastträger, Holzsammler. Im Erdgeschoß kleine Handwerker: Flickschuster, Mattenflechter, Kistenmacher, Sackweber. Der Innenhof war erfüllt vom Lärm ihrer Arbeit und vom Geschrei ihrer Kinder.
Ibn Ammar wohnte oben in einer schmalen Kammer, die vorher als Lagerraum gedient hatte, und die so heiß war, daß man es nur nachts darin aushalten konnte. Jetzt, kurz vor Mittag, war die Hitze unerträglich. Brütende, drückende, schweißtreibende Hitze, kein Lufthauch, obwohl Tür und Fensterluke offenstanden.
Er hatte seine Habseligkeiten zu einem Bündel zusammengerollt und in der Ecke unter dem Fenster abgestellt. Das Bündel enthielt alles, was er besaß, ein Baumwolltuch für die Nacht, einen Mantel für die kalte Jahreszeit mit einem Besatz aus Kaninchenfell, ein Untergewand, ein paar Holzschuhe, sein Schreibzeug und einen schmalen Band mit Gedichten von al-Ma’arri, das einzige Buch, das er noch nicht verkauft hatte. Er stand in der Tür und blickte auf das kleine, mit einem Lederriemen verschnürte Bündel. Er würde es irgendwann abholen lassen. Er würde diesen Raum nie wieder betreten. Drei lange Monate hatte er hier gehaust wie eine Ratte im Loch. Drei Monate waren genug.
Er schloß die Tür und machte sich auf den Weg zum Treppenhaus. Die Frauen auf der Galerie zogen sich ehrerbietig zurück und scheuchten die Kinder beiseite und grüßten ihn mit unterwürfiger Freundlichkeit: »Gott schütze dich, Kātib! Gottes Segen sei mit dir!«
Es war noch nicht lange her, da hatte ihn kein Mensch im ganzen Haus beachtet. Da hatte die Frau des Bauarbeiters, bei dem er zur Untermiete wohnte, sich jedesmal, wenn er aus dem Haus gegangen war, mit scharfem Blick vergewissert, daß er seine Habe zurückließ als Pfand für das Essensgeld, das er ihr noch schuldete. Jetzt kam sie ihm eilig mit dem Wasserkrug hinterher. »Wollt Ihr nicht einen Schluck Wasser, Herr, Ihr müßt Durst haben, Herr, der Samum trocknet die Kehle aus.« Seit einer Woche hatte sich alles verändert.
Das Mietshaus gehörte Ahmad Ibn Mundhir, einem der reichsten Männer von Murcia, der Tuchhändler und Reeder war und mehrere Häuser in der Stadt besaß, dazu drei Dörfer in den Huertas im Süden und zwei hochseetüchtige Handelsschiffe im Hafen von Cartagena. Vor zwanzig Tagen hatte einer seiner Verwalter die Mietsparteien im Haus durchgezählt und dabei festgestellt, daß viel mehr Menschen in den Wohnungen hausten, als in den Mietverträgen festgelegt war. Viele Familien hatten Verwandte aufgenommen, viele hatten untervermietet, die Zimmer quollen über von Menschen.
Der Verwalter hatte schweigend seine Zahlen notiert. Am nächsten Tag war er wiedergekommen und hatte angekündigt, daß der Hausherr die Mieten erhöhen würde im gleichen Maßstab, wie sich die Zahl der Bewohner vermehrt habe. Das ganze Haus war in höchste Aufregung geraten, eine Abordnung der ältesten Mieter war in die Stadt gelaufen, um die drohende Mietsteigerung abzuwenden, aber Ibn Mundhir hatte sie nicht einmal vorgelassen. Völlig verzweifelt waren sie zurückgekehrt, hatten beratschlagt, wie sie es anstellen könnten, doch noch an den Hausherrn heranzukommen, und in dieser Lage waren sie auf den Gedanken verfallen, Ibn Ammar einen Brief schreiben zu lassen.
Jeder im Haus wußte, daß er als Schreiber arbeitete. Er hatte seinen Standplatz an der Außenmauer der Freitagsmoschee, abseits vom Haupttor, wo die zweitrangigen Schreiber saßen, ein Platz, den er mit Bedacht gewählt hatte. Er schrieb Gesuche an Beamte und Richter, Heiratskontrakte, Kaufverträge, verfaßte kleine Gedichte für verliebte junge Männer, beschriftete Amulettzettelchen für Kinder, kopierte Traktate und Bücher. Er hatte vorgehabt, die Rolle des kleinen Schreibers mindestens ein halbes Jahr lang beizubehalten, um seine Verfolger ganz sicher abzuschütteln, aber nach zweieinhalb Monaten Dahinvegetierens in äußerster Armut war seine Ausdauer erschöpft gewesen und der Widerwille gegen den Schmutz und das Elend und den Hundefraß, von dem er sich ernährte, größer als seine Angst vor den Agenten al-Mutādids. Der Auftrag der Hausbewohner war ihm wie ein Fingerzeig des Schicksals erschienen. Er hatte sich entschlossen, das Versteckspiel aufzugeben. Ibn Mundhir war nur ein Kaufmann, aber er hatte schon einmal vor Kaufleuten angefangen, und sein erstes Honorar als junger Poet war ein Sack Roggen gewesen. Warum sollte er diesen Weg nicht noch einmal gehen. Wenn ihm der Bittbrief Zugang zur Madjlis Ibn Mundhirs verschaffte, würde er irgendwann auch einen Weg an den Hof Ibn Tāhirs finden, des Qa’id von Murcia.
Er hatte ein Kunstwerk verfaßt, einen Brief in gereimter Prosa, in klassischem Arabisch geschrieben, mit einer Einleitung voll versteckter Zitate aus den großen Meistern, einer knappen persönlichen Vorstellung, die in tiefster Demut abgefaßt war, einer Lobeshymne auf den Empfänger, die in den höchsten Tönen schwelgte, und einem in aller Bescheidenheit formulierten Schluß, der mit der Hoffnung auf die Großmut des Adressaten die untertänige Bitte um Milde verband und in kunstvollen Gleichnissen den Standpunkt der Mieter darlegte.
Der Shaikh, als der Sprecher der Hausbewohner, hatte den Brief überbracht, und das ganze Haus hatte in wachsender Spannung auf eine Antwort gewartet. Auch Ibn Ammar.
Tagelang war nichts geschehen. Dann, vor einer Woche, war endlich der Verwalter erschienen. Ein Auflauf im Innenhof, ein plötzliches Abebben des Lärms und in die Stille hinein nur die Frage nach dem Schreiber des Briefes. »Wer ist dieser Abu Bakr Ibn Ammar?« Kein Wort an die Hausbewohner, nur die Frage nach Ibn Ammar.
Der Kaufmann hatte ihn in den Makhāzin seines Stadtpalais empfangen zwischen Tuchstapeln und riesigen, fast mannshohen, in Leinen eingenähten Übersee-Ballen, in denen noch der Salzgeruch des Meeres hing. Ein Mann von sechzig Jahren, klein und knochig, mit grauen Augen, ausdruckslosem Gesicht.
»Und du behauptest, diesen Brief selbst verfaßt zu haben. Ein kleiner Kātib aus der Vorstadt!« Abschätziger Blick voll Mißtrauen. Der Blick eines Händlers, der eine Ware begutachtet, die von guter Qualität zu sein scheint, aber so billig angeboten wird, daß es Verdacht erregt. Ein paar knappe Fragen und ein paar höfliche Antworten, mit denen es Ibn Ammar gleichwohl nicht gelungen war, das Mißtrauen des Kaufmanns zu zerstreuen. Dann der schlaue Einfall, den unbekannten kleinen Schreiber auf die Probe zu stellen.
Man hatte ihn in eine abgeschlossene Kammer geführt und mit Schreibzeug und Papier versorgt und ihm den Auftrag gegeben, ein Einladungsschreiben zu verfassen. Eine geschliffene und polierte Einladung für ein Fest, das Ibn Mundhir zu geben beabsichtigte, in Versform gehalten nach klassischem Vorbild mit ein paar literarischen Finessen: Der Name des Ehrengastes sollte sich aus den Anfangsbuchstaben der Verszeilen ablesen lassen.
Ibn Ammar hatte keine zwei Stunden gebraucht, um das Gewünschte anzufertigen, er war geübt darin, er hatte jahrelang von solchen Gelegenheitsarbeiten gelebt, er kannte den Geschmack dieser reichgewordenen Händler, die sich den Anstrich literarischer Bildung geben wollten. Ein Diener hatte ihm das Manuskript abgenommen, und einige Zeit später hatte er zum zweiten Mal vor Ibn Mundhir gestanden, diesmal in der Madjlis des Hauses. Und diesmal war der Kaufmann ein gutes Stück entgegenkommender gewesen.





























