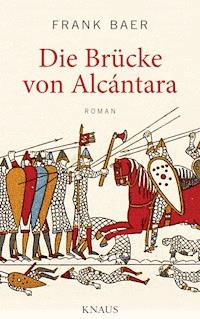2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
April 1945: Angeführt von Maxe Milch, Spitzname »Magermilch«, irren nach Pilsen verschickte Berliner Schüler in den Wirren des Krieges heimwärts – zwischen geschlagenen Soldaten, Gefangenenkolonnen und Flüchtlingstrecks, querfeldein, durch Wälder und Felder, zu Fuß, in Güterwaggons, auf Lastern, mit Pferdefuhrwerken. Sie sehen die Toten am Wegesrand, begegnen amerikanischen Soldaten und Menschen, die sich in ihren Häusern und Höfen verschanzt haben. Als sie endlich zu Hause sind im zerstörten Berlin, findet dort keiner, was er sich während des langen Weges erträumt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Frank Baer
Die Magermilchbande
Roman
Knaus
Über den Roman
April 1945: Angeführt von Maxe Milch, Spitzname „Magermilch“, irren nach Pilsen verschickte Berliner Schüler in den Wirren des Krieges heimwärts – zwischen geschlagenen Soldaten, Gefangenenkolonnen und Flüchtlingstrecks, querfeldein, durch Wälder und Felder, zu Fuß, in Güterwaggons, auf Lastern, mit Pferdefuhrwerken. Sie sehen die Toten am Wegesrand, begegnen amerikanischen Soldaten und Menschen, die sich in ihren Häusern und Höfen verschanzt haben. Als sie endlich zu Hause sind im zerstörten Berlin, findet dort keiner, was er sich während des langen Weges erträumt hat.
Über den Autor
Frank Baer, Jahrgang 1938, wuchs in Würzburg auf, studierte in München Geschichte und Philosophie, absolvierte ein Volontariat bei einer Tageszeitung und arbeitete danach als fester freier Mitarbeiter für verschiedene Redaktionen des Bayrischen Fernsehens. Bereits sein erster Roman „Die Magermilchbande“ wurde ein großer Erfolg und im Auftrag des Bayerischen Fernsehens verfilmt. Beim renommierten amerikanischen Verlag Little, Brown erschien 1983 die englische Übersetzung. Nach umfangreichen Recherchen veröffentlichte Frank Baer Ende der 80er Jahren den historischen Roman "Die Brücke von Alcántara", der zu einem Bestseller wurde und vor allem in Spanien bis heute eine große Leserschaft findet.
Der Autor lebt mit seiner Familie in München.
Der Roman erschien 1979 unter dem Titel «Die Magermilchband. Mai 1945: Fünf Kinder auf der Flucht nach Hause» im Albrecht Knaus Verlag, Hamburg Korrigierte, durchgesehene Neuausgabe 2015
Copyright © 1979, 2015 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in derVerlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: Sabine KwaukaUmschlagbild: Süddeutsche Zeitung Photo
ISBN 9783641182786V001
www.knaus-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
BILLES TAGEBUCH
24. Oktober 1941 bis 20. April 1945
24. Oktober 1941
Heute mein 10. Geburtstag. Von Inge bekam ich 1 Tagebuch. Von Hänschen 1 Laubsägeherz mit Kerze. Von Helga und Günter 1 Schmuckkästchen. Von Dietrich 1 Feldpost-Päckchen mit Ring aus Afrika. Wunderschön. Von Mutti und Vati 1 Dackelhund. Er heißt Emil. Er folgt mir schon. Er ist süß. Ganz strubbelich.
25. Oktober 1941
Heute nacht war Fliegeralarm. Emil sprang auf mein Bett und bellte. Wir waren 3 Stunden im Keller. Emil bellte immerzu. Er ist aus Thüringen. Er hat noch nie Fliegeralarm gehört. Er wird sich schon gewöhnen.
15. September 1942
Dietrich ist gefallen. Im Juli war er noch hier zu Inges Geburtstag auf Urlaub. Inge und Mutti weinen. Vati weiß es noch nicht. Helga und Günter sind seit 3 Wochen in KLV. Helga ist in Kattowitz, Günter ist im Warthegau. Nur wir vier sind augenblicklich da, Inge und Mutti, Hänschen und ich. Und Emil.
Kinder-Land-Verschickung nach Palovice (Protektorat). Ich bin schon zwei Tage hier, aber ich schreibe jetzt nach, was passiert ist.
Dienstag, den 31. August 1943
Heute fuhren wir um 5 Uhr nachmittags vom Görlitzer Bahnhof ab. Ich wäre natürlich beinahe wieder zu spät gekommen. Armer kleiner Emil, ich mußte dich verlassen. Inge und Mutti kamen mit zum Bahnhof. Ob wir lange wegbleiben? Mutti gab mir viel Lebensmittel mit. In 3 Stunden sollten wir in Dresden sein, aber es wurden ungeahnt 25 Stunden.
Mittwoch, den 1. September 1943
Als wir in Dresden einfuhren, kam Alarm. Alles stürmte in den Luftschutzkeller. Hier bekamen wir Tee und Stullen, von denen Spinne die Wurst verlor. Durch Prag fuhren wir auch.
Donnerstag, den 2. September 1943
Am Abend kamen wir in Palovice an. Das Lager ist in einem neugebauten Schulhaus. Wir 140 Mädel von der Bettina-von-Arnim-Schule sind in einem Flügel. Im anderen sind welche aus Spandau. Die sind schon länger hier. Unser Lagerleiter heißt Otto Weberecht, genannt Weberknecht. Er ist so 50 oder 60. Ich bin mit Spinne und Schwettchen und drei anderen in einem Zimmer. Zur Nacht mußten wir erst noch beziehen und die Strohsäcke aufschütten.
Montag, den 6. September
Heute erster Schultag. Diese Woche ist unsere Stube für das Wecklied dran. Wir müssen schon um halb 7 aufstehen. Heute sangen wir »Steht auf, steht auf, der Tag erwacht!«. Normal ist um 7 aufstehen. Dann Morgenappell. Um halb 8 Frühstück im großen Speisesaal alle zusammen (Butter- und Marmeladenstulle, jeden Morgen dasselbe, brauch ich nicht mehr zu erwähnen). Dann Unterricht bis 13 Uhr. Danach Mittagessen (heute gab’s Buchteln mit Vanillesoße). Danach 1 Stunde Mittagsruhe, dann 1½ Stunden Schularbeiten, dann Kaffee, dann frei oder Gartenarbeit oder Jungmädeldienst usw. 19 Uhr Abendbrot (heute gab’s Kartoffelsalat und zwei Kekse). Danach wieder frei für Schreiben, Putzen und Flicken usw. 21 Uhr Lagerruhe. Jetzt ist es kurz vor 21 Uhr. Wir liegen schon alle in der Heia. Spinne macht gleich das Licht aus.
Donnerstag, den 9. September 1943
Jetzt ist der eine Tag fast so wie der andere. Das 1. Mal nach Hause geschrieben. Strümpfe gestopft. Ob das Essen weiterhin so gut bleibt?? Denn zum Abendbrot gibt’s Apfelstrudel und Salat für die Vitamine.
Sonntag, den 10. September 1943
Maja Sperl und Sonja Gerber kamen noch in unsere Stube. Die Sperling geht ja noch, aber die doofe Gerbern, o Gott o Gott! Sie tut schrecklich »erwachsen«, weil sie schon einen »Büstenhalter« um hat, dabei hat sie höchstens einen Speckwulst oben rum, die fette Ziege.
7. 2. 44
Heute erhielt ich die Nachricht, daß wir total ausgebomt sind. Schneekuh tröstete vor der ganzen Klasse. Ich mußte grinsen. Schade um die schöne Wohnung.
9. und 10. IV. 44
Ostern. Heute erfahren wir vom Lagerwechsel nach Kusice, schade, ich hab mich hier so schön eingewöhnt. Von zu Hause viel Geschenke und 50 RM.
20. IV. 44
Mit dem Zug 12 Stationen bis Kusice. Als wir im Schloß ankamen, sangen wir erst mal: »Wir gehen singen« und »Wir sind da«. Das einzige, was am Schloß Barock ist, ist Schneekuhs Hut. Aber sonst ist es sehr hübsch hier. Große Zimmer, lange Gänge. Großer Park mit dicken Bäumen. Das ganze Städtchen ist voll KLV. Hinter unserem Schlößchen ist eine Jungenschule aus Wedding. Ist aber ein Zaun dazwischen.
6. VI. 44
Ja, dieser Tag ist historisch wertvoll. Unsere Stube sollte vom Bahnhof die neue Lagermädelschaftsführerin abholen. Wer war es? Janne Keck, die schon mal vor zwei Jahren auf dem Ferienlager meine Führerin war. So eine Überraschung. Wir haben uns andauernd abgeknutscht vor Freude.
22. VI. 44
Weberknecht ist furchtbar wütend auf uns. Janne auch. Weil wir beim Chorsingen letzte geworden sind. Und ausgerechnet die aus Wedding, die neben uns im Neubau sind, haben den ersten Preis gemacht. Alle schieben es auf uns, dabei war’s die 3. Stimme, weil sie den Einsatz verpatzt haben. Auf der Heimfahrt im Zug dicke Luft. Die Idioten vom Neubau haben auch noch gestänkert, blöde Bande.
2. VIII. 44
Maja Sperl ist schwerkrank. Schneekuh und Schwester Gisela telefonieren den ganzen Tag. Endlich kommt Jeschke, der tschechische Arzt, aber Sperling will nicht von einem tschechischen Arzt behandelt werden. Dabei kann sie kaum noch atmen, hat Schaum vor dem Mund und ist blau. Sie kommt gleich ins Krankenhaus. Alles ist aufgeregt.
4. VIII. 44
Sperling ist gestorben, gestorben, wir fassen es noch kaum. Die schönsten Blumen werden gepflückt. Nachmittags fährt die ganze Klasse ins Leichenschauhaus, sie noch mal zu besuchen. Im Leben vorher war sie ja eigentlich ziemlich doof, aber jetzt sah sie wie ein Engelchen aus. Der erste Tote, den ich sah. Nebenan lag noch ein toter alter Mann, huch, war das gruselig. Ganz durchweicht zu Hause angekommen, hörten wir, daß nur 8 Mädel aus unserem Lager auf Urlaub fahren dürfen. Ich zog ein Ja-Los. Schneekuh meinte so fordernd, na, den anderen tut’s nötiger, ich trat zurück, denn nachsagen lass ich mir nichts.
5. VIII. 44
Ob es richtig war zurückzutreten? Was werden wohl Mutti und Vati sagen? Stube 3 hat Weckdienst, sie singen so schauerlich, daß wir jeden Morgen vor Schreck schon vorher aufwachen. – Ich hab’s mir überlegt, ich werde abends doch zu Janne gehen und fragen, ob ich nicht doch in Urlaub kann.
Das ist die Höhe, so was von empörend! Wie ich’s geahnt habe. Spinne hat Janne doch getratscht und dazu noch alles auf mich geschoben, daß ich die anderen angestiftet hätte und so. Ich kann’s noch gar nicht fassen. Und das Schlimmste ist, daß Marianne ihr auch noch glaubt. Zuerst tut sie so freundlich, und dann diese Ungerechtigkeit. Hüte dich vor falschen Freunden! Ich glaube, daß ich abhaue und nach Berlin gehe. Soviel Ungerechtigkeit halte ich nicht aus. Einer vom Neubau ist neulich auch abgehauen und ist bis Potsdam gekommen, obwohl er noch jünger ist als ich.
(Brief an die Eltern 5. 8. 44)
Liebe Mutti, lieber Vati!
Wie geht es Euch? Wenn Ihr wüßtet, wie schlecht es mir geht. Ich bin von allen verlassen. Eva Spindler, mit der ich befreundet war, hat mich bei Marianne (Lamafü) schlecht gemacht, und Janne hat die Lügen dem Lagerleiter weitererzählt. Jetzt soll ich auf einmal ganz allein an allem schuld sein, dabei haben alle, die 2. Stimme gesungen haben, mitgemacht. Und die Idee, daß wir beim Singen ein Bonbon im Mund haben, haben wir auch alle zusammengehabt, und wäre auch nichts bei gewesen, wenn die 3. Stimme nicht gepatzt hätte. Es war auch nur, weil die Schneekuh uns in Geschichte von Demostenes erzählt hat, wie er Kieselsteine in den Mund getan hat, damit er besser reden kann. Und jetzt heißt es auf einmal, ich hätte die anderen überredet, und nur weil ich für den Urlaub ein Ja-Los gezogen habe, aber weil sie mich so gedrängt haben, daß ich’s der Urbanek geben soll, hab ich’s ihr gegeben, und wie ich dann doch selber fahren wollte, kommen sie jetzt damit an, dabei ist es schon fast 2 Monate her, wie wir in Prag waren mit dem Chorwettsingen. Dann bin ich mit Janne zum Lagerleiter, sagt er: »Halt den Mund, du freches Balch!« Jetzt will ich nicht mehr hierbleiben, ich hab niemand mehr hier. Bitte, bitte könnt Ihr mich nicht nach Hause holen. Viele Grüße und Küsse Eure unglückliche Sybille.
PS. Wenn Ihr mich nicht holt, komme ich alleine. Glaubt es ja nicht, wenn sie Euch was anderes schreiben!!
(Brief von den Eltern 10. 8. 44)
Meine liebe Bille!
Mach bitte keine Dummheiten, wir haben hier ohnehin schon genug Sorgen. Ich werde mich mit dem Lagerleiter in Verbindung setzen. Langer Brief folgt. Und »Balch« schreibt man nicht mit ch sondern mit g!
Sei tapfer. Es küßt Dich Deine Mutti.
20. II. 45
Mein liebes Tagebuch. So lange habe ich dich vernachlässigt. Und dabei ist so viel passiert. Vom 20. 12. 44 bis 8. 1. 45 war ich auf Urlaub zu Hause. Zu viert fuhren wir nach Berlin. Ich stellte mir die Trümmer eigentlich viel schlimmer vor. In der alten ausgebombten Wohnung war es aber tausendmal schöner. Jetzt wohnen wir bei Tante Ursel, sie hat ja jetzt Platz, trotzdem ist es schrecklich eng. Emil hat mich zuerst gar nicht erkannt, hat mich richtig angebellt. Silvester kam Inge aus Leipzig, wo sie jetzt arbeitet. Wir haben gefeiert, aber fröhlich waren wir nicht gerade. Hänschen hatte die Masern, von Helga und Günter keine Nachricht und bei Tante Ursel ist ja sowieso das Unglück zu Hause. Werner gefallen, Leo im Lazarett in Oberbayern und Onkel Herbert im ... na, du weißt es schon, ich will es lieber nicht sagen. Abends im Bett oft geweint, damit es Mutti nicht sehen sollte. Viel zu rasch waren die schönen Tage vorüber. Im Zug einen schönen Fensterplatz erwischt, aber wir fuhren fast nur nachts. Ein schicker Panzersoldat saß mir gegenüber, hat mich dauernd beobachtet, schrecklich! In Prag mußten wir zwei Tage bleiben, dann nach 5 Tagen kamen wir endlich im Lager an. Es gab Zeugnisse. Ich hab fünf Vieren drauf: in Beteiligung am Unterricht, Deutsch, Geschichte, Raumlehre und Rechnen. Die olle Schneekuh und der blöde Weberknecht!
Ende Januar kamen Helga und Günter aus Ostpreußen geflüchtet. Alles Gepäck haben sie in ihren Lagern verloren. Ob wir auch bald wegmüssen?
Jetzt haben wir »Adam« als Lamafü. Wir nennen ihn so, er hat ein ganz zerquetschtes Gesicht und Spitzkühler, tut immer ganz stramm, immer mit Uniform. Er ist unser Hauptgefolgschaftsführer, fast 50 Jahre alt und dann per »Du«, aber langsam gewöhnt man sich ja dran.
Das war jetzt vor einer Woche.
Freitag, den 2. 3. 45
Gestern nacht, wir waren grade im Bett, hörten wir plötzlich zwei Detonationen. Wie auf Befehl hüpften wir sofort aus den Betten, da rief Adam auch schon von draußen: »Fliegeralarm! Licht aus!« Dann ging die ganze Korona in den Wald. Die Jungen vom Neubau waren auch da. Schneekuh war ganz aufgeregt, daß sie all ihre Küken zusammenhielt im Dunkel. Wir müssen jetzt ziemlich oft in den Wald, weil hier ewig Flieger brummen und auch mit Bordwaffen schießen.
11. 3. 45
Heut ist schon wieder Sonntag, die Zeit fliegt ja nur so dahin. Zu Mittag gabs Wiener Schnitzel und Salat. Bin mal wieder richtig satt geworden. Karola Urbanek hat Post aus Berlin bekommen. Die haben jetzt jede Nacht Terrorangriffe. Schrecklich. Die Feinde sind in Küstrin und haben im Westen jetzt auch Bonn eingenommen. Wie soll das nur weitergehen? Werden wir siegen? Na, wir malen uns schon immer aus, daß wir nach Sibirien Steineklopfen gehen. Ob ich da auch Tagebuch schreiben kann?
Sonntag, den 18. März 1945
Heute waren wir im Flüchtlingslager. Am Vormittag wurden Sachen gesammelt, Puppen, Mäntel, Kleider, alles mögliche. Auf Stroh schlafen sie, und so viel Kinder. Dann so wenig zu essen, Frauen, die Kinder kriegen, schrecklich. Wir haben gestern alle auf unsern Käsekuchen verzichtet für sie.
Wir sind jetzt 25 Mädel in der 4b, letzte Woche kamen noch 6 dazu, die waren vorher in einem Lager in Schlesien, sie haben schon die Front gehört, als sie weg sind. Am Abend haben wir dem guten alten Weberknecht ein Ständchen gebracht: »Der Mond ist aufgegangen«. Er war ganz gerührt und meinte: »Ja das Herz wird einem immer schwerer.« Wer weiß, wie lange er noch bei uns bleibt. Bei dem Adam ist ja nichts sicher. Nach den Nachrichten hält er immer noch eine Ansprache, daß wir den Endsieg haben werden.
Mittwoch, den 21. März 1945
Kein besonderer Tag. In der 2. Stunde, grade als Adam reinkam, Fliegeralarm und wir mit Hallo in den Wald. Ich mit Spinne immer tiefer rein. Plötzlich waren zwei Jungs aus dem Neubau da, mitten in einem Gebüsch. Sie meinten, sie sagen immer bei Fliegeralarm, daß sie die Entwarnung nicht gehört hätten, und kommen zu spät. Wir machten es auch so. Als wir zurückkamen hatten die anderen schon eifrig Schule, wir hatten die ganze Stunde Physik versäumt. Weberknecht war tief empört, aber wir grinsten nur. Mittags gabs nur Suppe und zwei Liwanzen. Wir werden jetzt überhaupt nicht mehr satt. Zucker spare ich für zu Hause.
Freitag, den 30. März 1945
Endlich nach fast zwei Monaten wieder Post von zu Hause. Alle sind noch wohlauf. Das ist ja das Wichtigste. Eben kommt Spinne von den Nachrichten runter und erzählt, daß sie in Berlin schon wieder einen Terrorangriff am Tag hatten. Und die Feinde sind in Würzburg und an der Oder! Was soll das nur noch werden. Gestern sprach ein HJ-Führer zu uns, er kam aus Berlin. Die Zustände dort müssen ja furchtbar sein. Keine Nahrungsmittel, dauernd Stromsperre, nur wenig Gas. Was werden wohl die Meinen machen? Mutti hat mir Lebensmittelmarken mitgeschickt. Ich kaufte mir unten im Städtchen gleich Brot und Wurst, da war ich endlich mal wieder satt. Im Moment sitzt unser ganzes Zimmer am Tisch, und wir quatschen über unsere Zukunft in Sibirien. Ob wir dies Jahr Ostereier erwarten können?
Ostermontag, 2. IV. 45
Ja, wir konnten Ostereier erwarten. Morgens um ¾ 5 Uhr wurden wir leise geweckt, gingen zum Bach und wuschen uns mit Osterwasser, damit wir das ganze Jahr über hübsch und gesund bleiben. Die doofe Gerbern hat sich am längsten gewaschen, aber das wird ihr auch nichts nützen. Doof bleibt doof und fett bleibt fett, da helfen keine Pillen. Dann Frühlingsmorgenfeier im Park. Sonst war nichts Besonderes. Zweiter Ostertag war wie ein gewöhnlicher Feiertag.
Mittwoch, 11. April 1945
Strahlend blauer Himmel und richtig heiß und den ganzen Tag Tiefflieger. Schon in der ersten Stunde kam zum ersten Mal Alarm und wir alle mit Gejohle in den Wald. Wenn so schönes Wetter ist, können sie ruhig kommen. Wieder mit Spinne ganz weit reingerannt. Die zwei Jungen vom Neubau waren auch wieder da. Der eine meinte, daß wir bald von hier weg müssen ins Reich. Er ist der, der mal getürmt ist bis nach Potsdam. Hätte ich ihm aber nicht zugetraut. Erst zu Mittag zurück, aber der Unterricht fällt jetzt sowieso dauernd aus.
Freitag, 13. April 1945
Der vom Neubau hat vielleicht doch recht. Adam machte heute auch so eine Andeutung. Auch hören wir jetzt nicht mehr die Nachrichten, sondern nur den »Werwolf«, sehr interessant. Ich bin ja so gespannt, wie das alles werden soll.
Freitag, 20. April 45
Jetzt ist es also soweit. Unser ganzes Gepäck ist schon vor der Eingangshalle gestapelt. Wir müssen also doch unser liebes Schlößchen verlassen. Gestern mittag war plötzlich Appell, und Adam sagte, daß wir nun weg müßten. Jeder nur das Nötigste an Gepäck, die schweren Sachen alle in die Bettsäcke, die kämen mit Lkw nach. Den ganzen Tag haben wir aus Decken Rucksäcke genäht. Erst sollten wir schon gestern abend los, dann war es doch nichts, aber das ganze Bettzeug war schon verpackt. Wir haben entsetzlich gefroren in der Nacht. Fräulein Redwitz sagt, wir müßten nach Tirol, alles zu Fuß, 25 Kilometer am Tag. Wenn ich an meinen Rucksack denke, wird mir jetzt schon schlecht. Für drei Tage Marschverpflegung mußte ich auch noch drin unterbringen. Jetzt heißt es, daß wir die Bettsäcke mit den ganzen Sachen doch gleich mitnehmen. Adam will einen Wagen organisieren. Hätte ich bloß nicht so viel in meinen Rucksack gestopft, aber wer weiß, sicher ist sicher. Eben kommt die Schneekuh mit ihrer Sturmhaube auf dem Kopf.
1. Kapitel
Der Kaiser
»Frauen und Kinder zuerst«, sagte der fette Heini. Es sollte forsch klingen, aber es hörte sich ein bißchen dünn an.
Sie hingen zu dritt aus dem Fenster ihrer Stube im ersten Stock, Heini, Peter und Christo. Wenn sie sich weit genug hinauslehnten, konnten sie um das Hauseck herum gerade noch den Eingang des Schlosses sehen. Und dort, zwischen den Säulen des Vorbaus, der den Eingang überdachte, die Mädchen, die davor warteten. Eng zusammengedrängt, wie Bienen vor dem Flugloch, inmitten hoher Stapel von Gepäck, Rucksäcken, verschnürten Kartons, Spankoffern, Schließkörben, Bettsäcken, alles wirr aufeinandergeschichtet. Die warteten auf den Abmarsch, das war klar. Die warteten schon eine Ewigkeit auf den Abmarsch. Wie lange wollten die eigentlich noch warten?
Peter hatte sie als erster entdeckt. Früh um sieben durch das Fenster des Waschraums. Da hatten sie schon genauso marschbereit herumgestanden wie jetzt.
Später beim Morgenappell hatte es dann das ganze Lager mitbekommen. Wie eine Parole war es durch die Reihen gegangen, und einer nach dem anderen hatte hinübergeschielt, und sogar beim Fahnengruß war die Flüsterei weitergegangen, obwohl der Deutsche Wald wie ein Jochgeier gebrüllt hatte.
Jetzt war es halb zwei, und noch immer tat sich drüben nichts.
»Die wollten mit dem Zug weg, und dann ist keiner gekommen«, sagte Heini. Es war schon das fünfte Mal, daß er das sagte.
Aus einem der zweistöckigen Betten hinter ihnen in der Stube maulte einer, sie sollten endlich das Fenster zumachen. Sie kümmerten sich nicht darum. Es war einer, der nichts zu sagen hatte. Heini schob sich vorsichtig auf der Fensterbank zurück, bis seine Füße den Boden berührten. Ihm wurde leicht schwindlig, wenn er aus dieser Höhe hinunterschaute. »Mit was wollen die sonst fahren?« fragte er patzig. »Mit Lkw vielleicht? Das glaubste ja selber nicht. Die bräuchten ja fünf Lkw, so viel wie das sind.«
Christo drehte den Kopf Peter zu, der bäuchlings neben ihm lag, und fragte leise: »Wie weit ist das eigentlich bis zur Grenze?« Er hatte eine hohe, näselnde Stimme, die so klang, als verstellte er sie absichtlich.
»Hundert Kilometer«, sagte Peter, »und wenn wir um Pilsen außen herum müssen, noch’n bißchen mehr.« Sie wechselten einen bedeutungsvollen Blick und starrten wieder zum Schloß hinüber.
Heini hatte den Blick bemerkt. Für einen kurzen, unbehaglichen Augenblick hatte er das Gefühl, daß ihm die beiden etwas verheimlichten. Er wollte fragen und hatte gleichzeitig Angst, daß er sich eine flapsige Antwort einhandeln könnte, die ihn vor den anderen bloßstellen würde, und wie immer war seine Angst größer als seine Neugier. Was sollten sie auch schon wissen, das er nicht wußte. Gar nichts konnten sie wissen. Er quetschte sich wieder neben sie auf das Fensterbrett, zog sich an der Kante vor. Seine kurzen, fleischigen Beine, die waagrecht ins Zimmer ragten, waren bläulich marmoriert in der Kälte. Er war stolz darauf, daß er nach dem Winter immer als erster in der Stube kurze Hosen trug.
Das Schloß lag gut zweihundert Meter hinter dem Neubau auf der Kuppe des sanft ansteigenden Hügels, der sich vom Ort heraufzog. Es war kein echtes Schloß, es hieß nur so. Als sie vor zwei Jahren nach Kusice verlegt worden waren, hatten sie selbst darin gewohnt. Im Elternbrief, den man ihnen damals diktiert hatte, war vom ›Kurhotel Kusice‹ die Rede gewesen: ›Das herrlich gelegene ehemalige Kurhotel der kleinen Bäderstadt, in dem wir jetzt untergebracht sind, übertrifft unsere kühnsten Erwartungen. ‹ Das war nicht einmal übertrieben gewesen. Riesige Zimmer mit Balkon, ein Eßsaal so groß wie eine Bahnhofshalle und ein Park, in dem man sich verlaufen konnte.
Nach einem Jahr waren zwei Mädchenschulen einquartiert worden, und sie hatten in den Neubau daneben umziehen müssen. Der hieß auch nur so. In Wirklichkeit war er ein uralter Kasten. Sie hatten damals eine ganz schöne Wut gehabt auf die Weiber, die sie vertrieben hatten.
Ein gummibereifter Stellwagen kam die Schloßauffahrt heraufgefahren, mit einem knochigen Gaul davor, der den Kopf tief hängen ließ. Auf dem Bock saß ein alter Mann mit blauer Kittelschürze, und neben dem Pferd her ging ein kleiner Dicker in einem grauen Reitanzug, der ein Fahrrad schob.
»Ein Pferdewagen! Da! Hab ich ja gleich gesagt«, schrie Heini. Er schnaufte vor Aufregung.
»Halt doch mal die Klappe«, sagte Peter grob. Heini verstummte augenblicklich. Und als in diesem Augenblick auch noch die Stubentüre aufgerissen wurde, wäre er vor Schreck fast aus dem Fenster gefallen. Aber es war keiner von den Lehrern, der hereinkam, sondern nur der kleine Achimsen aus der 5b in schwarzer Winterkluft, vorschriftsmäßig von der Skimütze bis zu den grauen, umgeschlagenen Wollsocken über den Stiefeln.
»Wo ist’n der Milch?« fragte er knapp, ohne den Türgriff loszulassen.
Peter kam als erster von der Fensterbank herunter. Achimsen war einen halben Kopf kleiner als er, der sollte erst einmal sagen, was er überhaupt wolle. »Wieso? Was ist’n los?« fragte er. Ging langsam auf ihn zu. Wenn Maxe Milch nicht da war, hatte er das Sagen in der Stube.
Auch Heini und Christo kamen vom Fenster herunter, und die in den Betten setzten sich auf. Sie waren alle begierig auf Neuigkeiten. Könnte ja sein, daß es auch bei ihnen jetzt losging, wie bei den Mädchen drüben im Schloß, das mußte ja was bedeuten, daß nach Maxe gefragt wurde, schließlich war er der Stubenälteste. Vielleicht gab’s Appell für die Stubenältesten?
Der Junge in der Tür zog sich zurück, bevor sie zu nahe kamen. »Arschlöcher!« sagte er noch, bevor er die Tür zuwarf. Dann rannte er den Gang hinunter. Wenn Maxe Milch nicht in der Stube war, konnte er nur noch auf dem Klo sein, schließlich war Mittagsruhe, und da durfte keiner das Haus verlassen. Die Klotüre war versperrt.
»Milch! Magermilch!« rief er drängend, den Mund nah am Türspalt. Er hatte es eilig. Es war der erste Befehl, den er ausführte als frisch verpflichteter HJ-Junge, und er wollte ihn gut ausführen. Er rüttelte vorsichtig an der Türklinke. »Mach schnell, du sollst zum Lagerleiter!«
Maxe ließ sich Zeit. Er zeigte auch keine Eile, als er endlich herauskam. Er hatte die Hände in den Hosentaschen, die Schultern hochgezogen, ein schmaler, drahtiger Junge, der beim Gehen leicht auf den Ballen wippte, wie ein Hochspringer beim Anlauf. Als er an der Stube vorbeikam, drängten sich die anderen in der Tür, und Peter fragte aufgeregt: »Was ist’n los? Sag doch, was los ist?« Aber Maxe zog nur die Schultern noch ein bißchen höher. Es war ihm nicht anzumerken, ob er wirklich nichts wußte oder ob er sie nur abwimmeln wollte. Es war ihm überhaupt nur selten etwas anzumerken, und sie wußten, daß es keinen Sinn hatte, weiter in ihn zu dringen. Wenn er nicht von selbst kam, war nichts aus ihm herauszuholen.
Achimsen wieselte vor ihm her, den Gang hinunter zur Treppe. Er hatte Eisen unter den Stiefeln, die laut auf den Treppenstufen knallten und auf den Steinplatten, mit denen die Eingangshalle im Erdgeschoß ausgelegt war. Maxe hätte ihm mit geschlossenen Augen folgen können. Sie durchquerten die Eingangshalle und hielten vor einer weiß lackierten Kassettentüre. Die Kassette in Augenhöhe war mit einer bunten Schülerzeichnung ausgefüllt. Sie zeigte einen Jungenchor im Halbrund auf einem tannengeschmückten Podium. Zwei Reihen weißer Gesichter, wie Perlen auf einer Schnur, runde Münder, die gerade den Mond aufgehen ließen. Davor die Rückenansicht eines schwarz gekleideten Mannes, riesengroß mit ausgebreiteten Armen, die wie schwarze Flügel über dem Chor hingen. In der rechten Hand hielt der Mann einen mächtig aufragenden Taktstock. Darunter stand in Schönschrift: DR. KARL KAYSER – LAGERLEITER!
Achimsen öffnete die Tür, und Maxe trat ins Zimmer, streckte den Arm, meldete sich zur Stelle. Er hörte, wie die Tür hinter ihm ins Schloß fiel.
Das Büro des Lagerleiters sah aus wie eine Mönchszelle, lang und schmal mit einem kleinen, hochliegenden Fenster, das nur wenig Licht einließ. Ein karger, ungemütlicher Raum, der früher womöglich einmal als Wäschekammer gedient hatte, zu einer Zeit, als der Neubau noch eine Dependance des Kurhotels gewesen war. Aktenschränke rechts und links an den Wänden machten ihn jetzt noch enger und ungemütlicher. In der Mitte stand längs ein einfacher Tisch mit klobigen Beinen, der als Schreibtisch herhalten mußte. Auf dem Fußboden vor den Schränken und um den Tisch lagen Stapel von Aktenordnern, einige zu Paketen verschnürt, Schnellhefter kreuz und quer aufgeschichtet, einzelne Blätter, Briefe, Formulare in unordentlichen Haufen.
Maxe nahm alles nur aus den Augenwinkeln wahr. Er hielt den Blick starr geradeaus gerichtet. Zwei Männer standen vor dem Schreibtisch. Er hatte sie schon beim Eintreten erkannt. Der eine war ein Bauer, den hatte er erwartet. Der andere war der einzige Polizist von Kusice, ein dürres, verschrumpeltes Männchen in grünverwaschener Uniformjacke und mit steifen Ledergamaschen um die Waden. Warum der da war, konnte er sich nicht erklären, aber es war ihm auch egal. Er hatte keine Angst. Er wartete, daß der Mann, der hinter dem Schreibtisch saß, endlich anfing zu sprechen, damit er es bald hinter sich hätte.
Lagerleiter Kayser war ein großer Mann mit kantigem Schädel, straff zurückgebürsteten, kurzgeschnittenen, lohgelben Haaren und einem Gesicht, das so glatt und ebenmäßig war wie die Marmorgesichter jener römischen Charakterköpfe, die er im Geschichtsunterricht vorstellte und deren Bildnisse er manchmal durch die Bankreihen wandern ließ. Er unterrichtete in Deutsch, Geschichte und Musik. Sie nannten ihn ›Kaiser Karl‹ oder ›Karl der Große‹, aber meistens sagten sie nur ›der Kaiser‹. Er war kein Lehrer, dem man einen Spitznamen geben konnte. Bei ihm herrschten Zucht und Ordnung, er war immer korrekt, hart, aber gerecht.
Er saß vornübergebeugt am Tisch, die Arme gestreckt, die Hände flach auf der Tischplatte. Heftete den Blick auf Maxe, deutete mit einer knappen Kopfbewegung auf den tschechischen Bauern. »Bei diesem Mann wurde Bettwäsche aus unserem Lager gefunden. Zwei Überzüge und zwei Laken.« Er ließ eine Hand auf den Wäschestoß fallen, der vor ihm auf dem Tisch lag. »Lagermannschaftsführer Wald und der Heimleiter haben mir berichtet, daß sie dich gestern vormittag während des Alarms mit einem entsprechend großen Paket zu diesem Mann haben gehen sehen. Sie sind überzeugt, daß du ihm die Wäsche verkauft hast.« Wieder deutete er mit einer Kopfbewegung auf den Bauern. »Bevor ich ihn frage, möchte ich von dir wissen, ob sie recht haben oder nicht.«
Maxe senkte den Kopf. Er wußte, daß es keinen Sinn hatte, die Sache abzustreiten. Schon als er gestern aus dem Hof des Bauern herausgekommen war, hatte er bemerkt, daß er beobachtet worden war. Das wäre noch nicht weiter schlimm gewesen, niemand hätte ihm etwas nachweisen können. Aber dann am Nachmittag nach dem Geländespiel waren sie mit dem Deutschen Wald noch einmal an dem Hof vorbeigekommen, und da hatte die Bettwäsche mit dem unverkennbaren KLV-Einheitsmuster aus blauen Karostreifen im Garten auf der Leine gehangen. Sogar dem fetten Heini war es aufgefallen. Der Vollidiot von einem tschechischen Bauern hatte sie gewaschen, obwohl sie ganz frisch gewesen war. Und jetzt hatte er garantiert schon längst alles zugegeben.
»Wird’s bald!« sagte der Kaiser.
Maxe hob den Kopf. »Jawoll, Herr Oberstudiendirektor«, sagte er, »die Wäsche habe ich verkauft!« Es kam leichter heraus, als er gedacht hatte. Der Kaiser ließ sich nicht anmerken, ob ihn das Geständnis überraschte. Mit gleichmütiger Stimme wandte er sich an den Polizisten. »Sagen Sie dem Kerl, daß der Junge den Verkauf eingestanden hat.«
Der Polizist sprach leise in Tschechisch auf den Bauern ein, aber der hörte ihm nicht zu. Er hatte sich halb zu Maxe umgedreht, die Hände tief in den Taschen seines Arbeitskittels, und betrachtete ihn von oben herab mit einem schiefen Lächeln, in dem sich Verwunderung und Mitleid mischten. Er war groß, mindestens ebenso groß wie der Kaiser, und im Gegensatz zu dem Polizisten, der in seiner weiten Uniformjacke immer mehr zusammenschrumpfte, schien er vor dem Kaiser keine Angst zu haben. Maxe brauchte einige Zeit, bis er begriff. Er war nicht der Schnellste im Denken. Er hatte sich schon gewundert, warum der Bauer so tat, als verstünde er kein Deutsch, obwohl er doch selbst mit ihm in Deutsch verhandelt hatte. Jetzt wurde ihm klar, daß der Mann versucht hatte, ihn aus der Sache herauszuhalten. Er wich dem verwundert-mitleidigen Blick aus. Er kam sich auf einmal wie ein Verräter vor und wie ein erbärmlicher Dummkopf.
Als der Kaiser ihn barsch fragte, was er für die Bettwäsche bekommen habe, hatte er Mühe zu antworten.
»Eine Hartwurst und einen Dreipfünder Brot«, sagte er stockend.
»Fragen Sie ihn, ob das wahr ist!« sagte der Kaiser zu dem Polizisten, der eilfertig übersetzte. Der Bauer brummte in Tschechisch eine kurze Antwort.
»Er sagt, es ist richtig«, sagte der Polizist, »aber er sagt, der Junge hat die Sachen noch nicht erhalten.«
Der Kaiser stand auf, und es sah fast so aus, als stieße er mit dem Kopf an die Decke. Er war doch größer als der Bauer. »Gut, ich brauche Sie nicht mehr«, sagte er. »Sie werden von mir hören!« Der Polizist salutierte lahm und linkisch. Der Bauer drehte sich wortlos um. Im Vorübergehen griff er nach Maxes Schulter. Maxe spürte den Druck seiner großen, schweren Hand. Er wagte nicht aufzusehen.
Als sie allein waren, kam der Kaiser hinter seinem Schreibtisch hervor. Maxe hob den Blick. Genau in Augenhöhe und in Reichweite vor sich sah er den V-förmigen Ausschnitt einer Strickweste, die von zwei lederbezogenen Knöpfen zugehalten wurde. Er starrte auf die Spitze des V, die genau auf den Solarplexus zeigte, und unwillkürlich spannten sich seine Muskeln. So hatte er schon einmal vor dem Kaiser gestanden.
Das war vor einem Jahr gewesen. Damals, als der Chor des Lagers in Prag beim großen KLV-Wettsingen den ersten Preis gewonnen hatte.
Der Knabenchor war das Lieblingskind des Kaisers. Sein Steckenpferd. Die Chorsänger waren seine Jungs. Nicht daß er sie bevorzugt hätte. Er war ein strenger Vater. Aber die Mitgliedschaft im Chor bedeutete eine Auszeichnung, obwohl sie mit vielen Verpflichtungen verbunden war. Jeden Werktag eine Stunde Chorprobe und an den meisten Feiertagen Auftritte vor Publikum bei Schulfeiern, auf Heimatabenden mit Sudetendeutschen, bei Fahnenweihen und Parteiveranstaltungen und vor allem dann, wenn hoher Besuch kam: Ritterkreuzträger von der Front, HJ-Führer oder andere große Tiere aus Prag.
Trotzdem setzten die meisten Schüler alles daran, in den Chor aufgenommen zu werden. Der Kaiser verstand es, ihre Begeisterung zu wecken, weil er selbst begeistert war. Beim Singen verlor er seine Strenge, seine Unnahbarkeit. Da zeigte sich ein warmes Lächeln auf seinem Gesicht, das man sonst nie an ihm sah. Am Ende einer Aufführung, in der atemlosen Stille, wenn der letzte Ton verklungen war, stand er oft in starrer Verzückung vor dem Chor, als wollte er alle umarmen. »Unsre jungen Herzen sich vereinen …«, da sang er beim Dirigieren mit, ohne Stimme, aber die Worte so deutlich mit dem Mund formend, daß man sie ablesen konnte.
Damals nach dem Gewinn des Pokals in Prag hatte auch in der Klasse Hochstimmung geherrscht, denn die 4b war mit acht Mann im Chor vertreten gewesen. In der ersten Musikstunde hatte der Kaiser diese acht vortreten lassen und jedem mit Handschlag eine Urkunde überreicht. Maxe erinnerte sich an jede Einzelheit. Er sah den Kaiser wieder vor sich, wie er mit weit ausholenden Schritten durch die Bankreihen gelaufen war, die Arme auf dem Rücken verschränkt. Wie er sich dann vor der Tafel aufgebaut hatte, eine Hand auf den Lehrertisch gestützt, »miiimimimimi ... müüümümümümü …« in Sängerpose mit hoher Stimme tremolierend. Brustkasten aufgeblasen, Bauchmuskeln gespannt. »Ja, die richtige Atmung, darauf kommt es an! Nicht so wie einer, der gerade aus dem Wasser auftaucht, chchchch-häääh, chchchch-häääh ..., sondern Bauchatmung, huuuh-haaah, huuuh-haah ..., das ist das Geheimnis!«
Und dann wieder ein Gang durch die Bankreihen mit gewölbter Brust, so daß die Arme seitlich abstanden und beim Gehen schlenkerten. »Müümümümümü ... miiimimimimi ... man singt nicht bloß mit dem Mund und mit dem Kehlkopf! Der ganze Körper muß mitsingen, Jungs. Da braucht man Muskeln! Muskulatur! Hier! Bauchmuskulatur!« Und nach jedem Wort ein Schlag auf den Bauch, daß die Faust zurückschnellte wie ein Paukenschlegel vom gespannten Fell. »Ja, das geht nur, wenn man richtig atmen kann. Richtig atmen, das ist die Kunst!« Und wieder zwei Schläge auf den Bauch. »Na, ihr glaubt wohl nicht, daß ich fest genug zuschlage, wie! Kommt mal einer her und haut mir in den Bauch, aber feste!«
Sie hatten alle die Luft angehalten. Keiner war auf den Gedanken gekommen vorzutreten, aber der Kaiser hatte darauf bestanden. »Na, was ist? Hat keiner die Traute?«
Und dann, nach einem prüfenden Blick über die Bankreihen, hatte er Maxe ins Auge gefaßt. »Was ist mit dir, Milch! Das wäre doch mal eine Gelegenheit für dich, auch in der Musikstunde etwas zu zeigen. Du sollst doch den härtesten Schlag haben in deiner Boxstaffel, wie ich höre. Jetzt zeig mal, was du kannst!«
Automatisch war Maxe aus der Bank getreten, als der Kaiser ihn angesprochen hatte. War mit steifen Beinen zur Tafel vorgegangen, hatte vor dem Kaiser Aufstellung genommen. In seinem Rücken das Getuschel und das verschluckte Kichern der anderen.
»Na, dann mal zu!« hatte der Kaiser gesagt. »Aber feste druff! Wenn’s mich von den Beinen reißt, hast du gewonnen, werde ich nie mehr etwas über deine Sangeskünste verlauten lassen.«
Maxe hatte ihn nicht angesehen, hatte nur auf den V-förmigen Ausschnitt der Strickweste gestarrt, gerade so wie jetzt.
Und dann hatte er blindlings zugeschlagen. Ohne Ansatz, Schulter vor und die Faust gerade heraus mit einer Wucht, daß es seinen ganzen Körper auf die Zehen gehoben hatte. Der Schlag war genau in dem Augenblick angekommen, als der Kaiser die Spannung seiner Bauchmuskeln für eine Sekunde gelockert hatte. Vielleicht weil er durch Maxes langes Zögern unaufmerksam geworden war, vielleicht weil er ihn noch einmal hatte aufmuntern wollen. Maxe war sofort klar gewesen, wie gut er getroffen hatte. Er hatte lange genug geboxt, um das einschätzen zu können. In hilfloser Bestürzung hatte er zugesehen, wie dem großen, schweren Mann die Beine weggeknickt waren, wie er in zitternder Anstrengung die Knie durchgedrückt und mit steifen Armen auf dem Tisch Halt gesucht hatte, das Gesicht verspannt zu einem starren Grinsen. Er hatte eine furchtbare Ohrfeige erwartet, einen Fußtritt, der ihn durch das Klassenzimmer geschleudert hätte. Aber nichts war geschehen. »Setzen, Milch!« hatte der Kaiser mit ruhiger Stimme gesagt. Hart auch gegen sich selbst. Und gerecht.
Aber Maxe hatte diese kalte Gerechtigkeit angst gemacht. Wenn der Kaiser nur einmal zurückgeschlagen hätte, wenn er nur für einen Augenblick seine Selbstbeherrschung verloren hätte, dann wäre alles gut gewesen. So aber hatte Maxe ein Gefühl der Schuld behalten, hatte in wachsender Unruhe auf die fällige Bestrafung gewartet.
Zwei Monate später war er abgehauen. Nach Hause. Nach Berlin. Vier Tage Bahnfahrt ohne Essen und dann in Potsdam die Bahnpolizei und die ewigkeitslange Rückfahrt voller Angst. Und dann wieder kein Donnerwetter, nur ein paar spöttische Bemerkungen und eine peinigende Bloßstellung vor der ganzen Klasse, als der Kaiser einen Brief seines Vaters vorgelesen hatte mit der Bitte, ihm wegen des Ausreißversuchs ›eine Abreibung zu verpassen, aber eine orntliche!‹. Den Rechtschreibfehler hatte Maxe auch noch vorne an der Tafel verbessern müssen.
Vier Jahre lang, die ganze KLV-Zeit hindurch, war der Kaiser sein Lagerleiter gewesen. Er hatte in schüchterner Verehrung zu ihm aufgeblickt, hatte ihn aus der Ferne mit einer scheuen Zuneigung verfolgt, die nichts erwartete als ein wenig Aufmerksamkeit, eine kleine Geste freundlicher Anerkennung.
Nach seinem Ausreißversuch war diese Zuneigung in einen wilden, selbstquälerischen Trotz umgeschlagen, in eine verzweifelte Auflehnung. Monatelang war er im Unterricht stumm geblieben, hatte keine einzige Frage mehr beantwortet, hatte bei Deutschaufsätzen leere Blätter abgegeben, hatte sich bei den KLV-Boxmeisterschaften im Endkampf absichtlich schlagen lassen, hatte eine lange Nacht frierend auf einem Baum verbracht und zugesehen, wie das ganze Lager ausgerückt war, um ihn zu suchen. Das alles hatte ihm vom Kaiser nichts anderes eingetragen als lässigen Spott und gleichmütig erteilte Verweise, Strafarbeiten, Bunker, Ausgehverbote, die üblichen Strafen nach der Lagerordnung. Hart, aber gerecht.
Er wußte auch jetzt, welche Strafe ihn erwartete. Es war ihm gleichgültig. Er hatte nie Angst vor Strafen gehabt. Er starrte immer noch auf den Ausschnitt der Strickweste und bemerkte plötzlich, daß der Kaiser seine Bauchmuskeln straff gespannt hielt. Daß er schon die ganze Zeit, seit Maxe sich vor ihm aufgestellt hatte, nur ganz flach atmete als erwarte er jeden Augenblick einen Schlag.
Maxe dachte darüber nach, und als er aufblickte, lag auf seinem Gesicht ein kaum wahrnehmbares spöttisches Lächeln.
»Gut, Milch«, sagte der Kaiser, »das einzige, was für dich spricht, ist die Tatsache, daß du nicht versucht hast zu leugnen.«
Maxe hörte nicht, was er sagte. Er lächelte. Es war ihm egal, was er sagte. Es würde ihn nie mehr berühren, was der Kaiser sagte. Er beobachtete ihn, wie er sich umdrehte und mit gestelzten Schritten zum Fenster ging und dort verharrte. Es war ihm noch nie aufgefallen, daß der Kaiser einen so komisch gestelzten Gang hatte. Wie ein Storch im Salat.
»Der Tatbestand ist klar«, fuhr der Kaiser fort, »du hast Eigentum des Lagers gestohlen. Du hast damit auch deine Kameraden bestohlen. Du hast also einen Kameradendiebstahl begangen.« Er wandte sich wieder um und ging zum Schreibtisch. »Du weißt, welche Strafe darauf steht. Ich erwarte also, daß deine Haare bis heute abend um 18 Uhr abgeschnitten sind. Sauber und glatt. Welche Strafe der Lagermannschaftsführer noch zusätzlich für angemessen hält, wirst du von ihm erfahren.«
Maxe stand stramm und sagte: »Jawoll, Herr Oberstudiendirektor!« Er lächelte noch immer. Und weil er nicht wußte, ob er schon entlassen war oder ob der Kaiser noch etwas sagen wollte, blieb er ruhig stehen und wartete.
Der Kaiser stand am Schreibtisch, stützte sich mit den Händen auf, starrte auf das Wäschebündel, das vor ihm lag.
»Herrgott noch mal, Milch, nun erzähl mir schon endlich, warum du diesen Unsinn gemacht hast!« sagte er. Seine Stimme klang so gepreßt, daß Maxe überrascht aufblickte. So hatte er ihn noch nie sprechen hören. Und für einen Augenblick überlegte er ernsthaft, ob er ihm etwas sagen sollte. Aber dann ließ er es doch. Was hätte er ihm schon erzählen können? Vom Heimleiter vielleicht, den er vor drei Tagen nachts im Suff hatte herumgrölen hören, daß das Lager aufgegeben werde und der ganze Kram sowieso den Tschechen in die Hände falle? Das mußte der Kaiser doch selbst wissen. Oder sollte er ihm erzählen, daß der Verkauf der Bettwäsche nur der erste Teil seines Plans gewesen war? Da hätte der Kaiser nur neue Fragen gestellt und wieder neue Fragen, und er wäre aus dem Erklären gar nicht mehr herausgekommen. Er schwieg und wartete.
Der Kaiser ließ ihm viel Zeit. Dann richtete er sich langsam auf und reckte das Kinn, wie er es immer machte, wenn er eine spöttische Bemerkung auf der Zunge hatte. »Na gut, ich will dich nicht länger schweigen lassen«, sagte er. »Du könntest dir allerdings ab und zu etwas Originelleres einfallen lassen. Du kannst gehen.«
Maxe baute sich vorschriftsmäßig auf, und während er den Arm streckte, kam etwas angeflogen und traf ihn vor der Brust mit solcher Wucht, daß es ihn rückwärts gegen die Wand schleuderte. Seine Füße glitten weg, und er rutschte mit dem Rücken an der Wand herunter, bis er auf den Boden aufknallte. Er hatte instinktiv mit beiden Armen zugegriffen, als es ihn getroffen hatte, und jetzt stellte er fest, daß er das Wäschebündel umklammert hielt. Er rappelte sich wieder hoch.
»Bring die Wäsche dorthin zurück, wo du sie weggenommen hast!« hörte er den Kaiser sagen.
Er ging rückwärts zur Türe hinaus, ließ den Kaiser nicht aus den Augen, bis die Türe dazwischenklappte.
Er brachte die Wäsche in den Keller hinunter. Als er zurückkam, war wieder das spöttisch-erstaunte Lächeln auf seinem Gesicht. Und als er die Treppe hinauflief, pfiff er eine Melodie, die kam mißtönend falsch heraus, aber sie hörte sich fröhlich an.
Die anderen in der Stube hatten mit angesehen, wie die Mädchen drüben vom Schloß losgelaufen waren. Das schwere Gepäck auf dem Stellwagen voraus und dahinter die Lehrerinnen und klassenweise die Mädchen, behängt mit Rucksäcken und Taschen und Beuteln und Mappen, wie Flüchtlinge auf dem Treck. Sie waren durch das rückwärtige Parktor verschwunden, auf den Wald zu, der die Hügel hinter dem Schloß bedeckte, Richtung Südwesten.
Und dann war es erst richtig spannend geworden. Vom Ort waren Leute heraufgekommen in kleinen Trupps, immer mehr, Männer und Frauen mit Leiterwagen und Fahrrädern. Die waren alle im Schloß verschwunden und hatten zu plündern angefangen mit Geschrei und Schlägereien und Fenstereinwerfen und Möbelherausschmeißen.
Sie lagen jetzt alle im Fenster und schauten hinüber, und als Maxe hereinkam, räumten sie ihm einen Platz auf der Fensterbank ein und berichteten ihm, was vorgefallen war, und stritten sich, ob die Plünderer Tschechen wären, die man alle umlegen müßte, oder Deutsche aus dem Flüchtlingslager. Sie stritten sich ziemlich lange, und als sie endlich das Fenster schlossen, war es so kalt in der Stube, daß sie sich alle in den Betten verkrochen, nur Peter und Christo blieben auf und spielten Seeschlacht mit Wilhelmshavener Schiffsmodellen auf dem Schachbrett-Fußboden.
Der kleine Hellwig fragte Maxe, was es beim Lagerleiter gegeben hätte, aber Maxe sagte nur, daß es nichts Besonderes gegeben hätte, und weil sie alle noch mit den Plünderern beschäftigt waren, gaben sie sich damit zufrieden. Ab und zu schaute einer durchs Fenster zum Schloß hinüber und gab Bericht.
»Was meint ihr, wann’s bei uns losgeht?« fragte der fette Heini besorgt. Er hatte ein Akkordeon mit 64 Bässen in einem nagelneuen schwarzen Kunstlederkoffer, und er überlegte gerade, wie er den Koffer am besten verpacken könnte, damit er auf der Fahrt nicht beschädigt würde.
Maxe erinnerte sich an die herausgeräumten Akten im Büro des Kaisers. Er war überzeugt, daß sie höchstens noch ein, zwei Tage hierbleiben würden. Aber er sagte nichts.
»Was heißt hier fahren?« fragte Peter höhnisch zurück. Heini war ein dankbares Opfer. Man konnte ihn leicht in Angst versetzen. Er rutschte auch sofort aus seinem Bett heraus und hockte sich neben Peter auf den Boden. »Wieso sollen wir nicht fahren?« fragte er.
Peter tat so, als ob er geheime Informationen hätte, die er nicht so ohne weiteres preisgeben dürfte. »Brauchst ja nur mal nachzudenken«, sagte er, »denk mal an die aus dem Schloß, sind die vielleicht gefahren!«
Heini dachte nach. »Vielleicht sind sie bloß zum Bahnhof gelaufen und dann mit dem Zug weiter.«
»Zu welchem Bahnhof?«
»Nach Pilsen vielleicht«, sagte Heini hoffnungsvoll. Peter bedachte ihn mit einem mitleidigen Blick. »Wenn hier keine Züge mehr durchkommen, glaubste vielleicht, daß es in Pilsen welche gibt?«
Heini suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Es waren hundert Kilometer bis zur Grenze, das hatte er sich genau gemerkt. Hundert Kilometer zu Fuß! Und das Akkordeon und der Rucksack und die ganzen Sachen, die er unbedingt mitnehmen mußte. Das würde er ja nie schaffen. »Der Kaiser findet garantiert was, damit wir nicht laufen müssen«, sagte er kleinlaut.
»Was denn?« fragte Peter ungerührt.
»Vielleicht Busse oder Lkw«, sagte Heini.
»Wer’s glaubt, wird selig«, sagte Peter.
Die anderen hatten jedes Wort mitbekommen. Sie hatten alle genausoviel Angst wie der fette Heini, Maxe und Christo ausgenommen, nur waren sie so schlau, ihre Angst nicht offen zu zeigen. Jetzt gaben sie sich betont gleichmütig, taten so, als ginge sie das alles gar nichts an. Der dünne Tjaden, der das Bett über Heini hatte, ließ einen seiner berühmten Fürze fahren. Er hielt den Schulrekord mit einem elf Sekunden langen Furz, den er am Ostersonntag nach dem Morgenappell vor drei Zeugen gelassen hatte. Christo sprang hoch und riß das Fenster auf und schimpfte über Gasvergiftung. Und Heini wickelte sein Akkordeon in eine Decke und schob es wieder unters Bett.
Maxe lag flach auf dem Rücken und starrte gegen die Decke. Er dachte darüber nach, wie er den Friseur bezahlen solle. Er hatte nur noch 20 Pfennig. Die Mittagsruhe war gleich zu Ende, es war kurz vor drei. Er beschloß, Adolf anzupumpen. Irgendwie mußte er versuchen, zu Geld zu kommen, er mußte sich etwas einfallen lassen. Er schaute über den Bettrand nach unten. Adolf hatte ein Buch vor der Nase, wie üblich. Er überlegte, was er Adolf sagen solle, und gab auf, weil ihm nichts einfiel. Er mußte nach einer anderen Lösung suchen. Von Adolf hätte er alles haben können, aber das machte es gerade so schwer.
Er kroch vorsichtig ans Fußende des Bettes, ließ sich am Eckpfosten hinuntergleiten. Peter und Christo waren mit ihrer Seeschlacht fast fertig. Peter hatte nur noch ein U-Boot und einen Kreuzer, der nur noch einen Treffer brauchte. Er war wieder einmal am Verlieren.
Maxe schloß das Fenster. Die Stube mit den fünf doppelstöckigen Betten, den Sperrholzspinden und den Flugzeugmodellen, die von der Decke hingen, kam ihm auf einmal wie eine Gefängniszelle vor. Er stieg über die Seeschlacht und ging zur Tür. Er hatte noch immer keine Idee, wie er das Geld für den Friseur auftreiben sollte.
An der Tür war ein Spiegel befestigt, und rechts und links daneben hingen zwei Wachstuchbeutel mit je fünf Fächern, in denen ihre Kämme und Bürsten steckten. Er blieb vor dem Spiegel stehen und betrachtete sein Spiegelbild. Die Haare standen schon an den Ohren auf, und vorne hingen sie fast bis vor die Augen. Er hatte einen Haarwispel, der wie ein Hahnenschwanz über der Stirn stand und der sich auch mit Wasser nicht zurückbürsten ließ. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, strich den Wispel glatt nach hinten und sah zu, wie er wieder nach vorn fiel. Er dachte angestrengt nach und fuhr sich wieder mit gespreizten Fingern durch die Haare. Es fiel ihm nichts ein. Er nahm seine Bürste und bürstete den Wispel zurück, immer wieder. Es fiel ihm einfach nichts ein.
Christo war der erste, der auf ihn aufmerksam wurde. Er hatte Peters letztes U-Boot versenkt, das Spiel war gelaufen. Eine Zeitlang beobachtete er Maxe schweigend, dann stand er auf und lehnte sich lässig gegen den Türpfosten. »Hast du Läuse, oder was ist?« fragte er beiläufig. Maxe zuckte zusammen. Es war nicht seine Art, daß er sich so ausführlich mit seinen Haaren beschäftigte. Und es war ihm peinlich, daß man ihn dabei beobachtet hatte. Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, aber als er sich umdrehte, sah er, daß auch die anderen aufmerksam geworden waren. Er mußte irgend etwas sagen.
»Ich denke, ich laß mir ’ne Glatze schneiden«, sagte er. Er sagte es ohne Hintergedanken. Es war ihm nur gerade nichts Besseres eingefallen.
Im ersten Augenblick herrschte beinahe andächtige Stille. Dann ging das Gejohle los. »Du spinnst! Glaubste ja selber nicht! Sagste ja bloß so! Alles Angabe, trauste dich ja doch nicht! Wenn du dir die Haare schneiden läßt, laß ich mir …« Der fette Heini drängte sich vor und überschrie die anderen: »Ich wette zehn Mark!« Und als Maxe nicht gleich darauf einging, erhöhte er auf zwanzig. Es wurde still. Das war ein Haufen Geld.
Der fette Heini konnte leicht mit Geld um sich schmeißen. Er hatte es. Außer dem Taschengeld, das offiziell vom Lagerleiter ausgegeben wurde, und außer dem, was er aus den Ferien mitbrachte, kriegte er noch jeden Monat fünfzig Märker, die wurden in einem verschlossenen Umschlag mit Brief an eine deutsche Familie in Kusice geschickt, und Heini holte sie sich dort an jedem Ersten ab. So etwas war zwar vom Lager aus verboten, aber Heinis Mutter hatte eben Angst, daß ihr Goldstück nicht genug zu essen bekäme, und die in der Stube, die davon wußten, hielten dicht, weil sie auch einiges davon abbekamen. Heini wurde überhaupt nur deshalb geduldet, weil er so viel von zu Hause bekam. Am besten waren seine Freßpakete. Seit seine Mutter erfahren hatte, daß alle Pakete in der Stube gleichmäßig aufgeteilt werden mußten, hatte sie immer die dreifache Ladung geschickt. Riesenpakete, um die sie vom ganzen Lager beneidet wurden.
Maxe nahm die Wette an. Es war ein verdammt gutes Angebot. Der kleine Hellwig legte noch fünf Mark dazu, Peter sieben und die beiden Hermänner je drei, machte zusammen achtunddreißig Mark. Dazu kamen noch ein echter Ledergürtel mit schwarzer Eisenschnalle von Christo, ein Taschenmesser von Tjaden und ein langes Stück Feuerstein von Rottmännchen. Adolf war der einzige, der sich nicht an der Wette beteiligte, aber von ihm hätte Maxe sowieso nichts genommen.
Der kleine Hellwig notierte die Einsätze sorgfältig auf einem Zettel, und gerade als er damit fertig war, läutete die Glocke zum Ende der Mittagsruhe.
Sie waren als erste aus dem Haus, alle zehn auf einem Haufen, auch Adolf zockelte mit. Maxe ging an der Spitze, Peter und Christo neben ihm, und Heini versuchte sich dazwischenzudrängen, er war ungeheuer stolz, weil er sich einbildete, alles wäre seine Idee gewesen.
Sie bogen in die Lindenallee, die vom Schloß in den Ort hinunterführte. Ein paar Männer auf Fahrrädern fuhren vorbei, die vom Plündern kamen. Auf den Gepäckträgern hatten sie hastig zusammengeschnürte Ballen mit Röcken und Blusen, Mänteln, Schuhen, lauter Kleiderkram. Sie machten mißmutige Gesichter. Es waren lauter Deutsche aus dem Flüchtlingslager.
Das Friseurgeschäft lag in einer schmalen Gasse, die vom Marktplatz wegführte. Wie ein Stoßtrupp brachen sie in die Gasse hinein, daß die Eisen auf dem Pflaster knallten. Vor dem Geschäft wurden sie dann auf einmal ganz leise. Starrten Maxe an, grinsten verlegen und waren beinahe schon bereit, die Wette wieder zurückzunehmen, wenn es sich Maxe doch noch überlegen sollte.
Maxe lächelte, als er die drei Stufen hochging und die Tür öffnete. Es machte ›ping‹, und beim Schließen der Tür machte es wieder ›ping‹. Links hinter dem Eingang standen zwei Sessel, der vordere am Fenster war nicht besetzt, und der Friseur bedeutete Maxe mit einer Kopfbewegung, daß er sich darauf setzen solle. Maxe kannte den Friseur nicht, es war nicht der, der alle vier, fünf Wochen in den Neubau kam und ihnen den Einheitsschnitt verpaßte.
Der Kunde im Nachbarsessel beobachtete Maxe im Spiegel. Dann fragte er den Friseur etwas auf tschechisch, und sie unterhielten sich laut und beobachteten ihn beide im Spiegel. Es sah nicht unfreundlich aus, wie sie ihn beobachteten.
»No sag, was hast du angestellt?« fragte der Kunde schließlich. Maxe zog den Kopf ein. Was wußten die beiden Tschechen? Woher konnten die wissen, warum er hier war? Er war voller Mißtrauen, bei den Tschechen konnte man nie wissen. Vor fünf Tagen erst hatte es geheißen, daß sie nur noch in größeren Gruppen in die Stadt gehen durften. Warum taten die so freundlich?
Dann überlegte er, daß es ja nur dieses eine Friseurgeschäft in Kusice gab und daß er wohl nicht der erste war, der sich eine Glatze scheren lassen mußte. Er zuckte die Achseln und setzte ein überlegenes Lächeln auf.
Die beiden Tschechen unterhielten sich wieder und lachten. Maxe drehte den Kopf weg. Schaute zum Fenster hinaus. Die anderen standen aufgereiht an der Hauswand gegenüber. Sie machten ihm Zeichen und kicherten. Nur Adolf war nicht zu sehen.
Bald würden sie nicht mehr kichern. Der Deutsche Wald würde es ihnen beim Morgenappell schon ausführlich genug erzählen, warum er sich eine Glatze scheren ließ. Das fiese Schwein, von dem hatte er auch noch einiges zu erwarten. Bei Kameradendiebstahl gab es normalerweise Glatze und vom Lagermannschaftsführer Klassenkeile. Aber der Deutsche Wald würde sich bei ihm sicher etwas Besonderes ausdenken, das war ja seine Spezialität.
Peter und Christo hatte er einmal beim Kleiderappell erwischt. Bei Christo hatte ein Knopf an der Winterbluse gefehlt, und bei Peter war es ein daumenlanger Riß in der Hosennaht gewesen. Er hatte sie ihre ganzen Klamotten anziehen lassen, zwei kurze Hosen, zwei lange Hosen, Hemden, Jacken, Windbluse, alles übereinander und alles zugeknöpft und Reißverschlüsse zugezogen. Und dann auf Kommando: »Arme streckt! Knie beugt!« Es hatte richtig gekracht, und die Knöpfe waren mit so viel Druck abgeplatzt, daß sie über den ganzen Schulhof geflogen waren. Zwei Tage lang hatten sie genäht, bis alles wieder in Ordnung gewesen war.
Oder die Eimerkette. Die hatte er einmal für den dünnen Tjaden erfunden, der das Wasser scheute und ein paarmal die Morgenwäsche ausgelassen hatte. Er hatte ihn mit drei Scheuereimern zum Bach gehetzt, und dann Kleider runter, zwei Mann zum Festhalten und von jedem in der Klasse einen Kübel eiskaltes Wasser über den Kopf.
Der Deutsche Wald würde sich auch für ihn etwas Spezielles einfallen lassen.
Maxe sah im Spiegel, wie der Friseur hinter seinen Sessel trat. »Alles weg? Alles herunter?« fragte der Friseur, während er ihm den Umhang um die Schultern legte und am Kragen zuschnürte. Maxe nickte.
»Nur scheren oder auch rasieren?«
»Auch rasieren«, sagte Maxe. Sein Atem ging flach, und sein Magen zog sich zusammen wie beim Zahnarzt, wenn der Bohrer lossurrte. Er beobachtete im Spiegel, wie der Friseur nach dem Schermesser griff und damit ein paarmal spielerisch in der Luft schnappte. Seit er auf dem Sessel Platz genommen hatte, war er seinem Spiegelbild ausgewichen. Jetzt blickte er auf, sah sein finster verkniffenes Gesicht und den braunen Haarwispel, der in die Stirn hing. Tjaden hatte noch ein Foto machen wollen ›vorher – nachher‹, warum hatten sie das bloß vergessen? Und dann fiel ihm ein, daß er seine Mütze nicht dabei hatte, aber da faßte die Hand des Friseurs schon nach seiner Stirn, und in seinem Nacken war das Schermesser. Es fühlte sich kalt an, und er spürte, wie es sich langsam am Hinterkopf hochfräste und über den Scheitel nach vorn bis auf die Stirn. Er kniff die Augen zu.
Als er sie wieder öffnete, hing ein dicker Ballen brauner Haare auf dem Umhangtuch zwischen seinen Knien. Noch ein Büschel fiel herunter, stieß weich auf den Ballen auf, und der ganze Knäuel rollte über den Rand des Tuches und fiel zwischen seine Beine. Er überlegte, ob die abgeschnittenen Haare wohl etwas Kriegswichtiges wären und ob die Friseure sie vielleicht sammelten und verkauften. Er erinnerte sich undeutlich, daß sie bei der U-Boot-Waffe Menschenhaare brauchten für irgendwas, es fiel ihm nicht ein, wofür. Oder brauchten sie sie für die V2? Vielleicht für den Antrieb? Er versuchte angestrengt herauszufinden, wer ihm das einmal erzählt hatte.
Er hielt den Blick gesenkt. Auf seinem Scheitel spürte er etwas Weiches, Warmes, und sein Kopf wurde auf einmal ganz schwer und pendelte hin und her. Und er überlegte immer noch, wer ihm das mit den Haaren erzählt hatte.
Er kam erst wieder zu sich, als ihm der verhaßte Duft von Kölnisch Wasser in die Nase stieg, aber da war es schon zu spät. Da schüttelte der Friseur schon die Flasche über seinem Kopf, und die Tropfen klatschten auf die nackte Kopfhaut. Starr vor Schreck, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, blieb er auf dem Sessel hocken. Er blickte auch nicht hoch, als ihm der Friseur den Handspiegel in den Nacken hielt. Er wollte sich nicht sehen, wollte nur schnell weg hier, heraus aus der stinkenden Parfümwolke, die seinen Kopf einhüllte.
»Eine Mark fünfzig, mit Rasieren«, sagte der Friseur. Er hatte sich neben der Tür aufgestellt und wischte sich die Hände an einem Zipfel seines Mantels trocken. Sein Blick ruhte wohlgefällig auf Maxes Kopf.
Maxe gab ihm zwei Mark, wartete nicht auf das Wechselgeld, drängte sich hastig an ihm vorbei durch die Tür. Die anderen standen unter ihm im Halbrund, die Gesichter andächtig erhoben. Er blickte über ihre Köpfe hinweg. Und dann entdeckte er in plötzlichem Erschrecken sein Spiegelbild in einer Fensterscheibe gegenüber, schemenhaft nur, aber doch deutlich zu erkennen. Ein blanker, weißer Kugelkopf, der ihm entgegenleuchtete. Er ging die drei Stufen hinunter und stellte sich vor den anderen auf. »Also, was ist!« sagte er.
Sie drängten sich um ihn, beeilten sich, ihm das Geld in die Hand zu drücken, das sie schon abgezählt bereithielten. Nahmen mit bewundernder Scheu seine Glatze in Augenschein, streckten sich auf die Zehenspitzen, um besser draufblicken zu können, wollten sie mit dem Finger berühren, über die glatte, polierte Oberfläche streichen, und trauten sich nicht.
Maxe steckte das Geld in die Tasche und ging los. Wenn er an einem Schaufenster vorbeikam, schaute er aus den Augenwinkeln nach seinem Spiegelbild. Als er auf den Marktplatz einbog, stand Adolf da, wagte nicht, ihn anzusehen. Er legte ihm den Arm um die Schulter, zog ihn mit sich. Und dann, mit einer raschen beiläufigen Bewegung, faßte er mit der anderen Hand nach seiner Stirn, fuhr langsam tastend mit der flachen Hand über die glatte Rundung bis in seinen Nacken. Es fühlte sich angenehm an, nach Gänsehaut prickelnd, ziemlich hart und gar nicht so glatt und rund, wie er gedacht hatte, sondern eher höckerig und gebuckelt. Er begann, sich an seine Glatze zu gewöhnen.
Sie überquerten im Pulk den Marktplatz, und als sie halbwegs drüber waren, war aus der Straße, die von Prag kam, anschwellendes Motorengebrumm zu hören, das sich schnell näherte. Sie rannten los und hatten kaum den Gehsteig erreicht, als eine Wagenkolonne in einem Höllentempo aus der Straßenmündung herausdonnerte und in den Platz einkurvte. Voraus ein Kübelwagen, dahinter zwei schwarze Limousinen und zwei Kurzschnauzer-Lkw und ein klappriger Bus mit Rot-Kreuz-Bemalung; die rasten geradewegs auf sie zu und kamen rutschend und schleudernd vor ihnen an der Bordsteinkante zum Stehen. Und im selben Augenblick fegte mit fauchendem Pfeifen ein Tiefflieger über den Platz, so dicht über den Dächern, daß ein paar Ziegel herunterschepperten. Sie konnten nicht einmal erkennen, was für eine Maschine es war, hörten nur, wie sie hinter dem Ort aufheulend hochzog und zu einer Schleife ansetzte. Und die Wagenkolonne fuhr schon wieder los, bog wild hupend und reifenquietschend neben der Kirche in die Straße nach Pilsen ein. An allen Häusern gingen die Fenster auf, und Leute schauten heraus, und aus den Läden kamen sie und suchten den Himmel ab, der ganze Platz stand auf einmal voller Leute. Sie machten, daß sie weiterkamen.
Maxe steuerte auf einen kleinen Laden zu, der im Winkel des Marktplatzes neben der Kirche lag, ein Kolonialwarenladen mit einem winzigen Schaufenster. Es war der schäbigste Laden auf dem ganzen Platz, aber der einzige, in dem man auch ohne Marken einkaufen konnte, sogar Lebensmittel und Süßigkeiten, die man sonst nirgends bekam.
Der Laden gehörte einem alten Ehepaar. Meistens war nur der Mann da. Mit dem konnte man sich gut verständigen und von dem kriegte man auch alles. Wenn die Frau bediente, hatte es wenig Sinn hineinzugehen. Sie sprach kein Wort Deutsch, und selbst wenn man mit dem Finger auf die Sachen deutete, die man haben wollte, tat sie manchmal so, als verstünde sie nicht. Und bei ihr bekam man auch nichts ohne Marken.