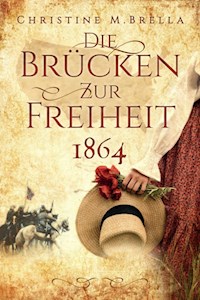
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Getrennt durch den Krieg – Verbunden in der Sehnsucht nach Freiheit Amerikanischer Bürgerkrieg, 1864. Annie hat einen Traum: Sie möchte Pferde züchten wie ihr Vater. Auf eine standesgemäße Ehe und Konventionen pfeift sie. So zögert sie nicht lange, als sie von der geheimen Underground Railroad angeworben wird, entflohene Sklaven auf dem Weg in die Freiheit zu verstecken. Hunderte Meilen entfernt im verfeindeten Süden träumt Nick ebenfalls von Unabhängigkeit. Die Verantwortung für die Familie wiegt schwer und seit die beiden älteren Brüder im Krieg kämpfen, gelingt es kaum noch, das Nötigste aufzutreiben. Als das Unglück über die Ranch hereinbricht, schließt sich Nick dem Südstaatengeneral Morgan an und wird damit zur Gefahr für Annie und deren Familie … Wer wird seine Liebsten schützen können? Wie werden sie sich entscheiden: Für ihr Herz oder ihre Freiheit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Brücken zur Freiheit - 1864
1Inhaltsverzeichnis
Teil IWinter
2Nick – 13. Dezember 1863
Schneidend blies der Wind über die texanische Grassteppe. Gerade erst hatte sich die Sonne fahl erhoben. Die frostüberzogenen Halme funkelten friedlich – trügerisch friedlich. Ich ballte meine eiskalten Finger zur Faust, kauerte mich tiefer in meinen Mantel und verschmolz wie ein echter Indianer mit dem Gestrüpp neben mir. Ich war Uncas, der letzte Mohikaner. Kein Hirsch, kein Eichhörnchen, nicht einmal eine Fliege würden meinem scharfen Auge entgehen. Nach einer halben Stunde in dieser Position spürte ich meine Beine kaum mehr. Meine Ohren brannten und mein Magen grummelte. Seit Monaten waren unsere Vorräte knapp. Vorsichtig lockerte ich meine Schultern, ließ aber die Senke vor mir keine Sekunde aus den Augen. Falls nötig, würde ich hier noch bis zum Mittag ausharren, auch wenn ich damit eine Backpfeife von meiner Ma riskierte. Sie mochte es nicht, wenn ich mich draußen herumtrieb. War ich allerdings erfolgreich, würde ich mit einem vorwurfsvollen Blick davonkommen. Tat sich da unten was? Meine Finger tasteten nach den bereitgelegten Kieseln. Mit einem Handgriff, den ich so lange geübt hatte, bis er mir in Fleisch und Blut übergegangen war, lud ich meine Steinschleuder. Vor Jahren hatte ich mir zusammen mit meinen Geschwistern Pfeil und Bogen gebaut. Im Gegensatz zu diesem Kinderspielzeug war die Schleuder eine tödliche Waffe. Zwei fellige, rötlich braune Ohren tauchten hinter einem Felsbrocken auf und verschwanden sofort wieder. Die Jagd hatte begonnen. Tatsächlich wurde es unten plötzlich lebendig. Ruhig bleiben! Das Wild durfte nicht misstrauisch werden. Ich zählte fünf Kaninchen, die sich aus ihrem Bau gewagt hatten. In aller Ruhe nagten sie an gefrorenen Grashalmen; hoppelten dann und wann hin und her; immer auf der Suche nach einem Stück Grün. Ein Langohr hüpfte auf mich zu. Jetzt war es etwa zehn Fuß entfernt. Langsam bog ich den Arm mit der Schleuder nach hinten und visierte es an. Alarmiert richtete es sich auf. Sein Kopf schoss in alle Richtungen. Das Näschen zuckte. Ich hielt den Atem an; wagte nicht, mich zu bewegen. Nach einigen langen Sekunden senkte das Tier die Vorderläufe auf den Boden und wandte sich wieder seiner Morgenmahlzeit zu. In dem Moment ließ ich den Riemen der Schleuder nach vorne peitschen. Das Kaninchen purzelte getroffen zur Seite und blieb mit einer blutigen Wunde liegen. Ich stieß ein wildes Kriegsgeheul aus, sprang auf und eilte zu meiner Beute. Deren überlebende Geschwister huschten verschreckt in alle Winde davon. Ich bückte mich und hob das magere Fellbündel auf. Nicht gerade viel Fleisch, um sechs hungrige Mäuler zu stopfen. Hoffentlich gewannen meine Brüder bald den Bürgerkrieg gegen die arroganten Nordstaatler! Lange würden wir hier draußen nicht mehr durchhalten. Die altbekannte Angst zog mir den Magen zusammen. Es wurde immer schwerer, der Verantwortung gerecht zu werden, die mir James vor drei Jahren übertragen hatte. Dabei war das doch meine Chance, ihm endlich zu beweisen, dass er auf mich zählen konnte! »Nicky«, hatte er mich beschworen, »wenn wir weg sind, musst du für die Familie sorgen. Du kannst leidlich mit den Rindern umgehen, und wie man jagt, habe ich dir ja auch gezeigt. Ich will einfach nur, dass die Ranch so bleibt wie sie ist, bis wir wiederkommen.« Wenn es doch nur bald soweit wäre! Mir wurde zwar schlecht, wenn ich mir vorstellte, wie er auf den Hof ritt und entdeckte, wie es um uns stand. Aber das war besser, viel besser, als wenn er nicht kam. Bis er und Andrew zurückkehrten, mussten wir uns irgendwie durchkämpfen. Später würde ich noch mal losziehen und meine Schlingen kontrollieren. Hoffentlich hatte ich damit mehr Erfolg. Ich wandte mich zum Gehen. Da fiel mein Blick auf eine dunkle Vertiefung in einem Flecken makellos weißen Schnees. Eine Fährte, die ich nicht sofort zuordnen konnte, obwohl ich so was bei jeder Gelegenheit übte. Neugierig bückte ich mich. Eindeutig ein Abdruck von einem kleinen, nackten Menschenfuß. Rot gefärbt von Blut. Mein Herz zog sich zusammen. Unsere nächsten Nachbarn lebten einen halben Tagesritt entfernt. Kannte ich das Kind? Ich sah mich rasch um, konnte aber keine Gefahr ausmachen. Keine Verfolger, keine wilden Tiere. Außer dem Wind war kein Laut zu hören. Mit angespannten Sinnen setzte ich mich in Bewegung und, folgte den blutigen Abdrücken. Den Blick auf den Boden gerichtet, kämpfte ich mich durch das brusthohe, mit Reif überzogene Dornengestrüpp. Sprang über einen gefrorenen Bachlauf. Erklomm einen steilen Hügel. Rutschte aus und riss mir die Finger auf. Egal! Weiter! Kam ich noch rechtzeitig? Schlussendlich wäre ich um ein Haar über sie gestolpert. Sie lag reglos auf dem hartgefrorenen Boden, zusammengerollt wie das Eichhörnchenbaby, das ich im letzten Frühjahr gefunden und aufgepäppelt hatte. Beinahe wäre es ein friedliches Bild gewesen, hätte nicht überall Blut an ihr geklebt, getrocknetes an ihrem viel zu dünnen Hemd, frisches an ihren aufgerissenen Fußsohlen. Ich kniete mich zu dem Mädchen hinunter und berührte sacht ihre kohlschwarze Stirn. Es war das erste Mal, dass ich einem Sklaven so nahe war. Ihre Haut fühlte sich seltsamerweise nicht anders an als meine, abgesehen davon, dass sie unter meinen kühlen Fingern glühte. Erleichterung durchströmte mich. Es war noch nicht zu spät. »Heiliges Kanonenrohr«, murmelte ich. »Wem gehörst du denn?« Was sollte ich mit ihr anfangen? Meine Gedanken überschlugen sich. Sollten wir einer entlaufenen Sklavin Unterschlupf bieten? Damit machten wir uns zur Zielscheibe für ihren Besitzer. Konnte ich sie hier liegen lassen? Nein! Das war weder mutig noch ehrenhaft. Es bedeutete ihren sicheren Tod. Hier würde heute keine zweite Menschenseele mehr vorbeistolpern. Schon eher eine Wolfsmeute. »Mist!« Ich atmete tief ein und aus. Sie musste so schnell wie möglich an einen wärmeren Ort. Eigentlich kam nur unsere Ranch infrage, aber meine Eltern würden ihre Anwesenheit unter keinen Umständen dulden. Somit blieb vorerst unser Stall. Dort konnte ich sie verstecken, bis mir eine bessere Lösung einfiel. Ein letztes Mal zögerte ich. Durfte ich meine Familie einer so großen Gefahr aussetzen? Wieder sah ich mich nach allen Seiten um. Doch da war nichts als frostige Wildnis. Das Mädchen stöhnte und nahm mir die Entscheidung ab. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, sie hier zum Sterben zurückzulassen. Ich band mein Kaninchen am Gürtel fest und packte die Kleine behutsam unter den Armen. Obwohl sie bereits acht oder neun Jahre alt sein musste, wog sie nicht mehr als ein neugeborenes Kälbchen. Sie wachte nicht auf, als ich sie hochwuchtete und an mich presste. Keuchend schob ich sie ein Stück höher, sodass ihr Kopf und ihre Arme über meine rechte Schulter baumelten. Nur einmal stieß sie einen maunzenden Klagelaut aus, dann verstummte sie wieder. Zum Glück hatte ich meinen Hengst nicht weit entfernt angebunden. Ich musste nur einige hundert Meter überwinden, aber mir brach der Schweiß aus und meine Muskeln zitterten vor Anstrengung. Daisy wartete geduldig. Jetzt hatte ich es fast geschafft. Schon wollte ich das Kind über seinen Rücken legen, da schnaubte mein Grauschimmel und tänzelte mit verdrehten Augen ein paar Schritte zur Seite. »Ist schon gut. Ist schon gut«, beruhigte ich Daisy und fluchte innerlich. Normalerweise erfüllte es mich mit Stolz, dass er außer mir keinen Menschen in seiner Gegenwart duldete. Jetzt aber hatte ich für seine Sperenzchen keine Kraft. Doch ich hatte keine Wahl. Diesmal näherte ich mich in Zeitlupe, den linken Arm besänftigend ausgestreckt, während ich mit dem rechten das Mädchen an meine Schulter drückte. Tatsächlich wich der Hengst jetzt nicht mehr zurück und hörte auf zu beben, als wollte ich ihn an die Wölfe verfüttern. Es gab noch einen kurzen Moment der Unsicherheit, als ich beide Hände benötigte, um die Kleine vor den Sattel auf den Pferderücken zu hieven. Dann hatte ich es geschafft. Mit einem Schwung war ich ebenfalls oben. Unser gemeinsames Gewicht war keine wirkliche Herausforderung für Daisy. Mit meinen fünfzehn Jahren war ich schmal gebaut und zusammen wogen das Mädchen und ich kaum so viel wie ein erwachsener Mann. Im Schritt lenkte ich den Grauschimmel in Richtung unserer Ranch. Ich wollte der Kleinen auf keinen Fall weiteren Schaden zufügen. Sie wirkte so zerbrechlich. Kraftlos baumelten ihre Füße auf der einen Pferdeflanke herab und die Arme auf der anderen. Der Kopf wiegte bei jeder Bewegung hin und her und ihre sorgfältig geflochtenen Zöpfe hingen in ihr Gesichtchen, während die roten Schleifen im Wind flatterten. Wer zum Teufel hatte ihr das angetan? Vor wem hatte sie sich so gefürchtet, dass sie barfuß querfeldein durch die Dornen geflüchtet war? Bevor die Gebäude unserer Ranch in Sicht kamen, passte ich Daisys Laufrichtung an, sodass der Blick vom Wohnhaus durch eine Bodenwelle versperrt wurde. Ich hatte mir diesen Weg vor langer Zeit angewöhnt. Auf diese Weise nutzte ich jede Minute, die ich für mich allein hatte. Dass ein dichtes Gestrüpp am Kamm das Durchkommen erschwerte, war dabei von Vorteil. Zum ersten Mal heute war ich froh über das ungemütliche Wetter. So hielt sich wahrscheinlich niemand im Freien auf. Trotzdem saß ich ab und führte Daisy mit pochendem Herzen bis kurz vor den Hügelrücken. Tatsächlich fand ich den Hof verlassen vor. Nur eine erloschene Laterne neben der Haustür schwankte knarzend im Wind und kratzte an meinen Nerven. Jetzt galt es, schnell zu sein! Natürlich würden die anderen im Haus das Hufgeklapper hören, aber daran konnten sie ja nicht ablesen, dass heute etwas anders war als sonst. Ich schob das Stalltor so weit auf, dass ich den Grauschimmel hindurchführen konnte. Dann zog ich es sofort wieder hinter uns zu. Im Stall empfing uns der vertraute deftig-warme Geruch nach Gaul und Kuh. Hier waren im Winter neben unseren Pferden auch die beiden Milchkühe untergebracht, die uns noch geblieben waren. Die Bretterwand hatte zwar fingerbreite Schlitze, durch die der Wind pfiff, dafür war es hier drinnen aber auch nicht völlig dunkel und dank der Tiere immer noch deutlich wärmer als draußen. Suchend blickte ich mich um. Die vorderen Boxen zur Linken waren mit Werkzeug und Futter für die Tiere gefüllt, in den folgenden standen die Kühe. Die Pferdeboxen rechts waren mit Gegenständen vollgestopft, die auf eine Reparatur warteten. Am anderen Ende war unsere Kutsche geparkt. Ich entschied mich, für unseren Gast ein Lager im Heuvorrat in einer der Boxen weiter vorne einzurichten. Auf dem Kutschbock fand ich eine alte, schmierige Baumwolldecke. Die roch zwar penetrant nach Pferdeschweiß, würde die Verletzte aber warmhalten. Die Kleine vom Pferd herunterzuziehen, war bedeutend leichter, als sie hinaufzuschaffen. In einem letzten Kraftakt manövrierte ich sie auf ihr improvisiertes Krankenlager und legte sie auf den Bauch. Unschlüssig blieb ich in der Stallgasse stehen. Was jetzt? Bis hierhin hatte ich mich darauf konzentriert, das Mädchen aus der mörderischen Kälte in Sicherheit zu bringen. Weiter hatte ich noch nicht geplant. Ich schielte auf die blutigen Flecken, die sich auf dem Rücken ihres Hemds abzeichneten. Meine älteste Schwester Charlotte war diejenige, die sich mit Verbänden auskannte und sich stets geduldig um die kleineren und größeren Blessuren ihrer fünf Geschwister kümmerte. Wie würde sie jetzt vorgehen? Vermutlich erst mal das Problem eingrenzen und herausfinden, wie schwer die Verletzung tatsächlich war. Ich überwand meine Scheu; trat zu dem Mädchen; strich ihr sanft über die Wange. Was ich jetzt tun musste, war bestimmt schmerzhaft für sie. Ich zog mein Jagdmesser und schlitzte ihr Hemd von der Hüfte bis zum Kragen auf. Der verkrustete Stoff klebte an ihrer Wunde. Während ich ihn behutsam wegzupfte, wimmerte das Mädchen, noch immer ohne Bewusstsein. Endlich war es geschafft. Als ich die Fetzen zur Seite schlug, enthüllten sich fünf braunrote Krater, die von ihrer rechten Schulter quer über den Rücken liefen. Darunter leuchteten helle Geschwülste von älteren, längst verheilten Verletzungen. Entsetzt sog ich die Luft ein und unterdrückte die Tränen, die mir in die Augen traten. Ein Indianer weinte nicht. Dass mancher Sklavenbesitzer die Peitsche gebrauchte, war mir klar. Aber was musste ein Kind verbrechen, um so eine Behandlung zu rechtfertigen? Hastig schlug ich den Stoff über den grausamen Anblick und zog die Decke über die mageren Schultern. Wenn ich die Wunden verband, würde ich bestimmt alles verschlimmern. Ich brauchte Hilfe. So schlüpfte ich aus dem Stall und überquerte mit langen Schritten den eisigen Vorplatz bis zum Ranchhaus. Vor der Tür zögerte ich und sah hinunter auf das magere Kaninchen, das mich so viele Stunden gekostet hatte. Würde das bisschen Fleisch ausreichen, um Ma zu besänftigen? Wie würde sie reagieren, wenn sie von dem Mädchen erfuhr? Allein der Gedanke daran drehte mir den Magen um. Ich war vielleicht sechs Jahre alt gewesen, als ich mit schlammiger Kriegsbemalung und einer Feder im Haar ins Haus gekommen war und Ma stolz meinen ersten Eselhasen hingehalten hatte. Er lebte noch, zappelte in meinen Händen und kitzelte mich mit seinem weichen Fell. Eine Ewigkeit hatte ich vor dem Gebüsch auf der Lauer gelegen. Als er aufgetaucht war, hatte ich mich auf ihn gestürzt, noch bevor er den ersten Haken hatte schlagen können. Aber danach hatte ich es nicht übers Herz gebracht, ihm den Hals umzudrehen. »Was soll das?«, hatte Ma mich angefahren. »Ich bin ein Mohikaner!«, verkündete ich, immer noch strahlend. »Heute können wir Fleisch in den Eintopf tun!« »Hab ich dich nicht zum Wasserholen geschickt? Wo ist der Eimer? Hast du wenigstens die Hühner gefüttert?« Schuldbewusst sanken meine Schultern herab. Die Hühner hatte ich völlig vergessen, nachdem ich mir die Feder ins Haar gesteckt hatte und der Hase vorbeigehoppelt war. Ma lief rot an vor Wut. Mit einem langen Schritt trat sie auf mich zu und verpasste mir eine Ohrfeige. Vor Schreck ließ ich den Hasen los, der sofort die Flucht ins Freie ergriff. Mit Tränen in den Augen sah ich ihm hinterher. »Nie kann man sich auf dich verlassen«, raunzte Ma und wandte mir den Rücken zu. Ihre Worte stachen zu wie ein Skorpion – ohne Vorwarnung und giftig. Sie brannten schlimmer als meine Wange. Unsicher berührte ich die Stelle, an der sie mich getroffen hatte, und starrte Ma an. In diesem Moment hörte ich Pa in meinem Rücken: »Was hat das Kind denn jetzt wieder angestellt?« »Es ist zu nichts zu gebrauchen. Wasser holen und Hühner füttern. Was ist daran so schwer? Das kommt nur daher, weil du den Kindern mit deinen Indianergeschichten Flausen in den Kopf setzt.« Ein kleiner Funke der Rebellion entzündete sich in mir. Dass ich meine Aufgaben vergessen hatte, war allein meine Schuld! »Pa kann nichts dafür! Ich …« Bevor ich fortfahren konnte, schob mich Pa nach draußen. »Komm, ich helfe dir mit den Wassereimern. Besser wir ärgern deine Mutter heute nicht mehr.« Verschwörerisch zwinkerte er mir zu. So leise, dass Ma uns nicht hören konnte, flüsterte er: »Wenn du brav bist, erzähle ich dir als Belohnung die Geschichte, wie wir zwei Schwestern auf einem Hausboot gegen einen ganzen Stamm Mingos verteidigt haben!« Am Abend hatten wir Kinder noch lange wachgelegen und gelauscht, wie unsere Eltern sich unten in der Stube anschrien. Seit wir nach Texas gezogen waren, kam das immer häufiger vor. Ma nannte Pa einen Träumer und er warf ihr vor, dass sie nicht an ihn glauben würde. »Erzähl den Kindern wenigstens keinen solchen Blödsinn mehr!«, keifte Ma. »Du hast Nicky heute gesehen! Läuft herum wie ein dreckiger Indianer!« Meine Geschwister starrten mich vorwurfsvoll an und ich kroch tiefer unter meine Decke. Es polterte fürchterlich, dann wurde die Tür zugeschlagen und es war ruhig. »Du bist schuld«, zischte mir meine Zwillingsschwester Mary ins Ohr und drehte sich weg. Als die Atemzüge meiner Geschwister ruhig wurden, lag ich immer noch hellwach auf meiner Pritsche. Ab jetzt würde ich alles tun, was Ma mir auftrug, schwor ich mir. Nie wieder wollte ich der Grund für einen Streit zwischen meinen Eltern sein. Ich würde Ma gegenüber genauso gehorsam sein wie Uncas gegenüber seinem Vater Chingachgook. Doch egal, was ich seitdem versucht hatte, für Ma war ich eine Enttäuschung geblieben. Seit ich ihr über den Kopf gewachsen war, schlug sie mich nicht mehr oft, aber ihre kalten Blicke trafen mich ebenso hart. Und heute hatte ich ein neues Ärgernis angeschleppt. Aber besser, ich erzählte ihr jetzt von dem Mädchen, bevor meine Familie es zufällig herausfand. Beherzt stieß ich die schwere Holztür auf und trat ein.
Mit einem Blick hatte ich den Wohnraum überblickt. Fünf Blondschöpfe, die sich so sehr von meinen eigenen rabenschwarzen Haaren unterschieden, waren über ihre jeweilige Tätigkeit gebeugt. Früher hatte ich mir oft erträumt, dass ich gar nicht wirklich das Kind meiner Eltern war. Vielleicht war ich in einem Binsenkörbchen am Ufer des Mississippis angespült worden? Hatte ich in Wirklichkeit indianische Ahnen? Aber welcher Indianer hatte Locken, blaue Augen und Sommersprossen? Letztlich hatte ich mich damit abgefunden. Ich gehörte in diese Familie. Mein Vater saß in seinem Schaukelstuhl am offenen Kamin und schnitzte unbeholfen am neuen Stiel für unsere Axt. Wahrscheinlich hatte er wieder zu viel getrunken. Früher hatte er wunderschöne Spielzeuge aus Holz für uns Kinder gemacht. Dabei hatte er uns Geschichten aus seiner Jugend erzählt. Er war von zu Hause weggelaufen und Fallensteller bei den großen Seen geworden. Eine Zeit lang hatte er sogar unter den Indianern gelebt und mit dem Trapper Lederstrumpf und seinen indianischen Freunden Uncas und Chingachgook aufregende Abenteuer erlebt. James, Andrew, Mary und ich hatten das Gehörte immer nachgespielt und weitergesponnen. Meistens hatte Andrew Mary entführt und James und ich hatten sie dann vor grausamen Qualen am Marterpfahl gerettet. Charlotte waren unsere Spiele immer zu wild gewesen und Ben war damals noch zu klein. Später, als Ma ihn mit uns hatte ziehen lassen, durfte er manchmal als Jagdhund mitlaufen. Seit seinem Unfall vor sechs Jahren hatte Vater selten ein freundliches Wort – oder überhaupt ein Wort – für uns übrig. Dass er mit seinem verkrüppelten Bein auf kein Pferd mehr steigen konnte, hatte aus ihm einen verbitterten Säufer werden lassen. Den stolzen Pionier, der uns 1855 aus den Wäldern um Memphis in Tennessee nach Texas in ein besseres Leben geführt hatte, gab es nicht mehr. Zu seinen Füßen ließ mein zwölfjähriger Bruder Ben seine Holzsoldaten erbarmungslos gegeneinander anstürmen. Ob ihm bewusst war, dass das Spiel für unsere beiden älteren Brüder blutiger Ernst war? Ma und meine Schwestern bestickten am halbdunklen Küchentisch Charlottes Aussteuer. Charlotte hob den Kopf und warf mir ein zerstreutes Lächeln zu. Mary ignorierte mich wie meistens. »Es zieht!«, polterte Pa, rutschte mit dem Messer ab, steckte sich den Finger in den Mund und fluchte gotteslästerlich. Schuldbewusst zog ich die Tür lauter zu als notwendig und erntete prompt einen strafenden Blick meiner Ma. Mein Herz verkrampfte sich. Wie würde sie die Nachricht aufnehmen, dass ich ein entlaufenes Sklavenkind im Stall versteckt hatte? »Ich hab da draußen Spuren entdeckt«, murmelte ich, ohne einen von ihnen direkt anzusehen. Charlotte hob alarmiert den Blick. »Von Wölfen?« »Wenn die von Menschen waren, geht uns das nichts an!« Alle Köpfe fuhren zu Ma herum, die mich anfunkelte. Demonstrativ wandte sie sich der langen Unterhose auf ihrem Schoß zu. »Wir haben dir was vom Maisbrot übriggelassen. Melkst du bitte die Kühe gleich?« Für sie war die Angelegenheit erledigt. Auch die anderen drehten sich von mir weg und ich stand vergessen im Raum. Ich legte das Kaninchen neben den Küchenherd. Den Mut für einen weiteren Versuch, mit der Wahrheit herauszurücken, brachte ich nicht auf. Das konnte genauso gut bis später warten. »Waren nur Spuren von Karnickeln und Eichhörnchen«, durchbrach ich die Stille. Dankbar für die Gelegenheit, der Enge im Haus zu entgehen, schnappte ich mir mein Brot. »Nach dem Melken seh’ ich noch nach meinen Fallen.« Bevor mir jemand widersprechen konnte, fiel die Haustür hinter mir zu.
Bebend lief ich über den Hof zurück. Wann kamen James und Andrew endlich heim, damit sie wieder ihren Teil der Arbeit übernehmen konnten? Gleich darauf schämte ich mich für den Gedanken. Meine Brüder riskierten im Krieg ihr Leben für uns. Irgendjemand musste den Nordstaaten die Stirn bieten, die sich zu einer Union zusammengeschlossen hatten, um uns ihre Gesetze aufzuzwingen! Ich dagegen hatte nur zwei Aufgaben: Ma gehorchen und Essen auf den Tisch schaffen. In beiden Fällen scheiterte ich kläglich. Manchmal wollte ich alles einfach nur hinter mir lassen und für immer fortgehen. Sofort fegte ich die verräterischen Gedanken aus meinem Kopf. Unsere Familie hielt zusammen! Zuneigung offen zu zeigen, entsprach einfach nicht unserer Art. Trotzdem würde ich sie nie im Stich lassen!
Zurück im Stall vergewisserte ich mich, dass der Zustand meiner Patientin sich nicht verändert hatte. Sie war noch immer ohne Bewusstsein und ihre Stirn glühte. War ihre Temperatur noch gestiegen? Ich kaute nervös auf der Unterlippe. Wenn sie nicht wach geworden war, bis ich mit dem Melken fertig war, musste ich mir etwas einfallen lassen. Hatte ich sie am Ende zu spät gefunden? Ich durfte die Kleine nicht sterben lassen! Sie hatte bestimmt nichts anderes gewollt als die Freiheit! Wenn das der Preis war, war er zu hoch. Ich suchte mir zwei Eimer. Der eine war für die Milch gedacht, der zweite als Melkschemel. Honey und Sugar traten unruhig auf der Stelle und begrüßten mich mit lautem Muhen. Schnelle Bewegungen vermeidend, richtete ich mich an Honeys Flanke ein, ließ aus jeder Zitze die ersten Tropfen auf den gestampften Erdboden spritzen und säuberte danach das Euter mit einem nassen Lappen. Dann ließ ich abwechselnd mit jeder Hand einen dünnen weißen Strahl in den leeren Kübel schießen. Ein hohler Klang ertönte in immer gleichem Rhythmus. Bis alle Zitzen abgemolken waren, dauerte es eine halbe Ewigkeit. Ich blendete jeden Gedanken an das Mädchen aus und versank in meiner Arbeit. Es schepperte; ich fuhr auf. Mit dem Eimer noch in der Hand stürmte ich in die Box des Mädchens. Sie blickte mir mit großen, ängstlichen Augen entgegen. Beim Versuch sich aufzurichten, hatte sie die Heugabel zu Boden gerissen. Minutenlang starrten wir uns an. Schließlich räusperte ich mich. Meine Kehle fühlte sich an wie mit einem Lasso zugeschnürt. »Ich bin Nick. Du hast nichts zu befürchten. Ich hab dich draußen in der Wildnis gefunden.« Ungläubigkeit und Angst wechselten sich auf ihrem hübschen Gesicht ab, bis schließlich ein scheues Lächeln über ihre Lippen huschte. »Du hast mich beschützt?« Ihre treuherzige, klare Kinderstimme rührte mich. Ich konnte nur nicken. »Du wirst Master Johnson sagen, wo ich bin?« Überrascht zuckte ich zusammen. Ausgerechnet Freddy Johnson! Der Vorarbeiter unseres Nachbarn Mr. Goodman war schon vor Ausbruch des Bürgerkriegs kein angenehmer Zeitgenosse gewesen. Er hasste alle Siedler, die wie wir nach dem Krieg gegen Mexiko nach Texas gekommen waren. In den letzten Jahren hatten er und seine Männer fast alle unsere Bekannten zum Aufgeben gezwungen. Am Ende mussten sie dankbar sein, wenn sie von Goodman ein paar Dollar für ihr gesamtes Hab und Gut bekamen. Eine Woche nachdem sich meine Brüder den Rebellen der Südstaaten angeschlossen hatten, war Freddy Johnson auch bei uns aufgetaucht. Vater hatte ihn mit der Flinte vom Hof gejagt. Beeindruckt hatte Johnson das nicht im mindesten. Wenn wir ihn in der Stadt trafen, beobachtete er uns mit dem lauernden Ausdruck einer Katze auf Mäusefang. Ohne James und Andrew war es schwer, allen Aufgaben auf der Ranch gerecht zu werden. Dazu kamen die kleinen Unglücksfälle. Ein Kalb, das in der Nacht spurlos verschwunden war. Ein Hirschkadaver, den ich erst im Bachlauf gefunden hatte, als mehrere Rinder wegen des verseuchten Wassers verendet waren. Unsere Cowboys hatten sich entweder ebenfalls eingeschrieben oder arbeiteten jetzt für Arnold Goodman. Nach und nach hatten wir unsere gesamte Herde Longhorns verkaufen müssen, und die meisten Reitpferde noch dazu. Wie sollte ich James all das bloß beibringen, wenn er heimkam? Je länger sie auf meine Antwort warten musste, desto hoffnungsloser wurde der Gesichtsausdruck der Kleinen. Langsam schüttelte ich den Kopf. »Nein«, schwor ich. »Das werde ich nicht tun.« Erleichtert sank sie zurück auf die Decke. Es war, als ob ihr diese Frage die letzte Kraft geraubt hätte. »Ich bin Delilah«, murmelte sie noch, dann klappten ihre Augen zu. Kurze Zeit später zeugte ihr schwerer Atem davon, dass sie eingeschlafen war. Ich brachte es nicht übers Herz, sie jetzt zu verbinden und damit zu wecken. Stattdessen ließ ich mich neben das Mädchen ins Heu plumpsen und tauchte ein Stück Maisbrot in die frische Milch. Während ich mir meine erste Mahlzeit des Tages schmecken ließ, beobachtete ich meinen Schützling beim Schlafen. Ich würde nicht zulassen, dass sie wieder in die Hände dieses Kerls fiel. Doch ich musste bald eine neue Unterbringung für sie finden! Solange schwebten wir alle in Gefahr. Nachdem ich meinen Teil aufgegessen hatte, legte ich die andere Hälfte des Brots neben Delilah auf mein Halstuch und rückte den Milcheimer heran. Wenn sie das nächste Mal aufwachte, würde sie sicher hungrig sein.
Mit den Schlingen war ich erfolgreicher als mit der Schleuder. Zufrieden hängte ich das Kaninchen neben die drei Eichhörnchen an meinen Gürtel, machte mich auf den Rückmarsch und führte den Schecken dabei locker am Zügel. Daisy hatte ich im Stall gelassen, damit auch unser zweites Pferd Auslauf bekam. Tief sog ich die kalte Luft ein und genoss jeden Moment in Freiheit, in dem mir niemand vorschrieb, wie ich zu sein hatte. Ich hatte es nicht eilig zurückzukommen. Heute Nachmittag würde ich ans Haus gefesselt sein und folgsam alle Aufgaben erledigen, die mir Ma auftrug. Dabei wusste ich jetzt schon, dass ich sie wieder enttäuschen würde, egal, wie sehr ich mich anstrengte. Je näher ich unserem Heim kam, desto langsamer wurden meine Schritte. Ich wollte noch für ein paar Minuten so tun, als wäre ich ein einsamer Fallensteller. Ich hatte gerade eine Jungfrau in Nöten aus den Händen feindlicher Indianer befreit und wir wurden jetzt über die offene Prärie verfolgt. Wenn mir die Feinde vor die Büchse liefen und dann schworen, von uns abzulassen, würde ich Gnade vor Recht ergehen lassen.
3 Annie – 13. Dezember 1863
Ein Knall durchbrach die eisige Ruhe des Dezembernachmittags. Die Gestalt, die eben auf Zehenspitzen durch den Dienstboteneingang der Schule für höhere Töchter ins Freie geschlüpft war, zuckte zusammen, blickte sich hastig um und zog die Kapuze ihres Mantels tiefer ins Gesicht. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. So erreichte die Vermummte unbehelligt das schwere Eisentor zur Straße, glitt durch den Spalt und verschwand aus der Sichtweite des Herrenhauses. Nur die Spuren im frisch gefallenen Schnee zeugten davon, dass sie da gewesen war.
Annika Bailey atmete erleichtert aus, als sie zwischen den Häusern in die Gassen Cincinnatis eintauchte, und schob eine kohlschwarze Locke, die sich frech aus ihrem Knoten gelöst hatte, zurück unter die Kapuze. Wieder einmal war sie den strengen Augen von Mrs. Hodgers entkommen, die über die vierzig Schülerinnen wachte, wenn kein Unterricht stattfand. Jetzt musste sie nur noch vor dem Abendessen zurück sein und in der Stadt niemandem begegnen, der sie kannte. Es waren deutlich weniger Menschen als normalerweise auf der Straße, die ohne Ausnahme dick eingehüllt ihrem Ziel entgegenhasteten. Keiner achtete auf die junge Frau, die mit einem Korb bewaffnet das Militärlager der Unionisten am Stadtrand ansteuerte. Viel hatte sie in dieser Woche nicht vom Tisch abzweigen können. Unter ihrem Tuch befanden sich zwei Äpfel, frisch gebackenes Weißbrot, ein Stück Hartkäse und ein Wurstzipfel, den sie der Köchin hatte abschwatzen können. Annie hoffte, mit den Köstlichkeiten die Zungen der Soldaten etwas zu lockern. Vielleicht erhielt sie so endlich Neuigkeiten von der Front! Belustigt beobachtete die Fünfzehnjährige einen Mann mit schwarzem Spitzbart, dessen Besorgungen so hoch auf seinen Armen gestapelt waren, dass sie seine fliehende Stirn gut zwei Fuß überragten. Entfernt kam ihr sein Gesicht bekannt vor, doch sie konnte sich nicht entsinnen, woher. Der Mann schaffte es kaum, um seine Ladung herumzuspähen. So kollidierte er mehrmals mit anderen Passanten und entschuldigte sich jedes Mal wortreich. Gerade steuerte er auf eine junge Mutter zu, die auf dem einen Arm einen Säugling balancierte und mit dem anderen einen heulenden Buben hinter sich herzog. Im letzten Moment verhinderte sie den Zusammenstoß mit einem Sprung zur Seite und schimpfte dem Mann hinterher. Vor Schreck hatte ihr Sohn aufgehört zu weinen. Doch kaum war die Gefahr vorüber, fing er mit doppelter Lautstärke erneut an. Anders als alle anderen hatte es Annie nicht eilig. Die strenge Temperatur störte sie nicht, hatte sie doch, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war, gerne Zeit im Freien verbracht. Sie hob den Kopf und inhalierte den Nachmittag in Freiheit. Obwohl sie die ständige Bevormundung schwer zu ertragen fand, liebte Annie die Schule in der Stadt. Sie genoss ein seltenes Privileg, indem sie eine umfangreiche Ausbildung in Geschichte, Latein, Rhetorik, Algebra, Logik und Naturphilosophie erhielt. Eines Tages würde sie eine der wenigen Frauen sein, die über ihr eigenes Leben bestimmen konnten. Sie grinste. Ihre feine Stiefmutter ging wie selbstverständlich davon aus, dass Annie eine normale Mädchenschule besuchte und ausschließlich in Etikette, Literatur und Französisch unterrichtet wurde. Geschah ihr ganz recht! Immerhin hatte Theresa sie vor drei Jahren eigenhändig in das Internat im hundert Meilen entfernten Cincinnati abgeschoben. Natürlich war es ihr primär darum gegangen, Annie aus dem Weg zu schaffen. Sie hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, dem Institut selbst einen Besuch abzustatten. Warum nur hatte Annies Vater ein zweites Mal heiraten müssen? Und dann auch noch eine so überzüchtete Schönheit aus den Südstaaten? Eine, die lediglich neun Jahre älter war als seine Tochter! Wenn Annie auch nur an die wippenden blonden Korkenzieherlocken ihrer Stiefmutter dachte, überkam sie das Bedürfnis, Kletten zu sammeln und jemandem in die Haare zu hängen. So, wie sie das früher bei Theresa immer gemacht hatte. Vielleicht hoffte ihre Stiefmutter auch, dass man Annie an der Schule Manieren beibrachte und man sie zu einer ebenso stocksteifen Lady erzog, wie sie selbst eine war. Wer wusste das schon so genau? Seit drei Jahren hatte Annie ihre Heimat nicht mehr gesehen, da kurz nach ihrer Ankunft in Cincinnati der Krieg zwischen den Staaten ausgebrochen war. Kentucky lag im Grenzgebiet zwischen den Kontrahenten und Annies Vater hatte bestimmt, dass es für sie sicherer war, weiter nördlich zu bleiben. Annie war froh darüber! Viel lieber war sie an ihrer geliebten Schule, statt täglich Gefechte mit Theresa auszutragen. Welch glückliche Fügung, dass sie in Cincinnati ausgerechnet an das Institut gekommen war, das die Revolutionärin Miss Catherine Beecher gegründet hatte! Diese beschritt neue Wege in der Erziehung junger Frauen und kämpfte für eine angemessene Bildung für die künftigen Mütter der Nation. Nur Politik wurde als männliche Domäne betrachtet und stand nicht auf dem Stundenplan. Annie zog ärgerlich die Augenbrauen zusammen. Politik ging jeden an. Natürlich fochten nur Männer im Krieg – aber auch Frauen waren unmittelbar davon betroffen. Warum sollten sie nicht die Hintergründe der Gewalt kennen, die ihr Leben zerstören konnte? Jeden Tag hoffte Annie, dass die bornierten Südstaatler einsahen, dass eine Demokratie aus Kompromissen bestand – und sorgte sich um ihren Vater. Seit Kriegsbeginn hatte sie ihn nur einmal gesehen, nämlich als sein Regiment bei Cincinnati gelagert hatte. Aber jetzt musste er lediglich noch ein paar Monate durchhalten! Wie die meisten hatte er sich für drei Jahre verpflichtet und diese liefen im April aus. Dann würde er endlich nicht mehr in Lebensgefahr schweben und sie wieder ruhig schlafen können. Colonel Bartholomew Bailey war in die Heimat Kentucky abkommandiert. Seit Wochen hatte Annie keine Nachricht über ihn oder seine Einheit bekommen können. Sie beruhigte sich damit, dass Kentucky zurzeit nicht im Fokus der Kämpfe stand. Aber das konnte sich im Nu ändern. Selbst Cincinnati war nicht sicher. Vor fünf Monaten war der gegnerische General Morgan mit zweitausendfünfhundert Mann in den Norden bis hier vorgestoßen und hatte die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Die Zeitung nannte ihn zu Recht ›den Donnerkeil‹. Annies Vater und seine Einheit hatten die Gefahr gebannt und Morgan mit einem Teil seiner Männer gefangen genommen! An einer Straßenecke kramte das Mädchen ein paar Münzen aus ihrem Beutel und kaufte einem Zeitungsjungen mit übergroßer Schiebermütze die Sonntagsausgabe ab. Sie warf einen Blick darauf und schob sie dann in den Korb. Daheim würde sie ihren Schatz in ihrem Versteck herausholen und genüsslich die Nachrichten aus der echten Welt verschlingen, die sonst nur tröpfchenweise und gefiltert zu den behüteten Schülerinnen durchdrangen.
Annie näherte sich dem Stadtrand. Die Häuser wurden niedriger und waren häufiger aus Holz statt aus Stein gebaut. Aus allen Schornsteinen stieg dichter Rauch. Dessen würziger Geruch legte sich auf die Stadt und die bleiche Wintersonne drang wie durch einen Schleier in die düstere Gasse. Plötzlich registrierte Annie Tumult am Ende der Straße. Beim Näherkommen richteten sich ihre feinen Härchen im Nacken auf. Eine Gruppe aus fünf oder sechs Burschen hatte einen Kreis gebildet. Sie malträtierten johlend irgendeine Kreatur in ihrer Mitte. Immer wieder löste sich einer aus der Runde und vollführte im Zentrum einen schwankenden Tanz, während die anderen die Lücke sofort schlossen. Sie boten ihrem Opfer keine Möglichkeit zur Flucht. Hatte eine bedauernswerte Ratte das Pech gehabt, der Bande in die Hände zu fallen? Die Halbstarken mochten knapp jünger sein als Annie, und der guten Kleidung nach zu urteilen waren es allesamt Sprösslinge von bessergestellten Handwerkern. Sie hatten bestimmt nur Flausen im Kopf und fühlten sich in der Gruppe unbesiegbar. Während die spärlichen anderen Passanten in großem Abstand die Straßenseite wechselten und demonstrativ auf den Boden oder in die Luft starrten anstatt auf die Jugendlichen, näherte sich Annie rebellisch dem Geschehen. Sie sah gar nicht ein, einen Umweg in Kauf zu nehmen und im Straßenmatsch aus Staub, Schnee und Pferdeäpfeln ihre Schuhe zu beschmutzen. Da setzte ein unheimliches Heulen ein und ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Hatten diese Wüstlinge einen streunenden Hund in der Mangel? Annie beschleunigte ihre Schritte, und obwohl die langen Röcke sie ausbremsten, erreichte sie die Gruppe in wenigen Augenblicken. Über die Schultern der lachenden und grölenden Jungen warf sie einen Blick auf deren Opfer. »Ach, du meine Güte«, entfuhr es ihr. Nicht eine Ratte oder ein Streuner war in die Fänge dieser Tunichtgute geraten! Im Matsch der Straße lag ein etwa zehnjähriger Schwarzer. Seine Oberlippe war aufgesprungen, ein Auge schwoll bereits zu, und auf seinem hellen Hemd hatten Stiefel schwarze Abdrücke hinterlassen. Das Kind hielt die Lider geschlossen. Wenn der Kleine nicht den grauenerregenden Heulton ausgestoßen hätte, hätte Annie angenommen, dass die Burschen ihr grausames Werk schon zu weit getrieben hatten. Hitze rauschte durch Annies Adern. Wie konnte jemand so unmenschlich handeln? Wie ein Racheengel fuhr sie zwischen die überraschten Peiniger. »Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut?«, kreischte sie. »Haut bloß ab, bevor ein Unglück geschieht!« Sie stürmte ins Zentrum der Gruppe und schubste den Jungen weg, der noch über dem Kleinen stand und gerade zu einem Tritt ausholte. Immerhin hatte er den Anstand, eine ertappte Grimasse zu schneiden. Dann drehte er sich um und verschwand zwischen den Häusern. Die anderen ließen sich nicht so leicht einschüchtern. Jetzt war es Annie, die in die Mitte genommen wurde. Feixend und Schmählieder singend, tanzten die Teufel um sie herum. Immer enger wurde der Kreis. Schon zogen ihr die ersten die Kapuze vom Kopf und rissen an ihren Haaren. Wie weit würden sie gehen? Annie verwünschte sich für ihr kopfloses Eingreifen. Ausgeliefert stand sie da und hielt mühsam die Tränen zurück. Diese Genugtuung wollte sie den Unholden nicht gönnen. Da zwickte sie einer der Lümmel in den Hintern und sie schoss herum. Genug war genug! Mit brennenden Augen sprang sie auf ihn zu, holte aus und traf ihn mit ihrem Korb voll an der Schläfe. Ein weiterer Schritt und sie war an ihm vorbei und dem Kreis entkommen. Ihr war klar, dass sie sich lediglich einen Aufschub erkämpft hatte. Die Burschen waren schneller und in der Überzahl. Annie drehte sich um und wappnete sich gegen den nächsten Angriff – doch die Meute rannte, immer noch spottend, die Gasse hinunter und davon. In einem letzten wütenden Aufbäumen griff sie in ihren Korb und schleuderte ihren Peinigern die beiden Äpfel hinterher, erntete aber nur schallendes Gelächter, das zwischen den Häusern verklang. Zitternd hielt Annie mitten auf der Straße an. Jetzt, da die Bedrohung verschwunden war, wich alle Kraft aus ihr. Es blieb nur Platz für eine niederschmetternde Frage: Wie konnten Menschen so grausam sein? Der Junge hatte mit seinem erschütternden Geheul aufgehört und das unverletzte Auge aufgeschlagen. Als Annie ihm aufmunternd zulächelte, drehte er sich auf die Seite und kämpfte sich auf die Knie, dann auf die Füße. Dabei guckte er sie durchdringend mit seinem dunklen, gehetzten Rehauge an. Erst jetzt sah sie, dass er barfuß im Schneematsch stand. Seine fadenscheinige Kleidung war vollgesogen mit kalter Nässe und er bibberte am ganzen Leib. Was sollte sie mit ihm anstellen? Unmöglich konnte sie ihn zu seinen Eltern ins Schwarzenviertel begleiten. Das war kein Ort für Weiße und erst recht nicht für weiße Frauen, die alleine unterwegs waren. Unsicher griff Annie erneut in den Korb und hielt dem Kind den Kanten Brot und das Stück Käse hin. Erst zögerte der Kleine, dann schnappte er blitzschnell danach, und humpelte mit einem kurzen Blick über die Schulter davon. Wohin jetzt? Ohne Tauschware brauchte Annie bei den Soldaten nicht aufzukreuzen. Möglicherweise würde sie zwar Neuigkeiten erfahren, aber sicher nicht, ohne sich Anzüglichkeiten anhören zu müssen. Dafür war sie nach dem gerade Erlebten nicht in Stimmung. Noch hatte sie sich nicht entschieden, da vernahm sie hinter sich ein Hüsteln. Sie zuckte zusammen. In einem Hauseingang lehnte ein buckliger Greis, der sich mit der einen Hand auf einen kunstvoll geschnitzten Stock stützte und in der anderen eine Pfeife hielt. Wie lang stand er schon da? Hatte er die Burschen in die Flucht geschlagen? Mit listigen Augen blinzelte der Mann zu ihr herauf. »Warum hast du ihm geholfen?«, wollte er mit knarziger Stimme wissen. »Er ist doch nur ein Schwarzer.« Empört richtete sich Annie zu voller Größe auf, überragte ihn jetzt um zwei Hauptlängen. »Er. Ist. Ein. Mensch.« Sie betonte jedes Wort. Leiser fügte sie hinzu: »Nur ein Kind.« Bedächtig nickte der Alte. »Wohl. Wohl. Das war die richtige Antwort.« Er musterte sie von oben bis unten, bis Annie sich unbehaglich in ihrer Haut fühlte. Endlich unterbrach er die Stille: »Dass du dich für ihn eingesetzt hast, war tapfer. Und nicht ungefährlich. Meine Frau hat alles vom Fenster aus beobachtet, sich aber nicht selbst auf die Straße getraut. Eine Schande ist das, wie wir unsere schwarzen Mitbürger behandeln. Jedoch ist es allemal besser als ihr Sklavendasein in den barbarischen Südstaaten.« Im ersten Moment wollte Annie voller Überzeugung zustimmen. Dann wurde ihr mulmig. Ihre Heimat Kentucky hatte sich zwar den Nordstaaten angeschlossen, aber Sklaverei war dort immer noch nicht verboten. Selbst ihr Vater hatte früher einige Sklaven besessen. Ihre leibliche Mutter hatte vor der Hochzeit dafür gesorgt, dass er ihnen die Freiheit schenkte. Zumindest hatte das ihre Haushälterin Mrs. Foster einmal erzählt, als Klein-Annie sie wieder einmal um Geschichten von früher angefleht hatte. Die Zeiten änderten sich. Nur waren die Menschen im Süden zu eigensinnig, um das zu akzeptieren. Waren die Rebellen nur rückständig oder von Natur aus blutdürstig? Immerhin führten sie einen Krieg für das Recht, eine andere Rasse zu unterdrücken. Annie hatte davon gehört, dass auf so manchen Plantagen im Süden Sklaven grausam misshandelt wurden. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Wenn die Südstaatler ihre Macht nicht derart missbraucht hätten, wäre es nie zu diesem blutigen Bürgerkrieg gekommen! Zögerlich fasste sie ihre Gedanken in Worte: »Ich kann es nicht leiden, wenn jemand gequält wird.« Der Alte sah sie seltsam an und fragte dann: »Hast du je von der Untergrundbahn gehört?« Verwirrt schüttelte Annie den Kopf. Er kicherte. »Da könnten wir mutige Frauen wie dich gut gebrauchen. Dank des vermaledeiten Krieges ist der Großteil unseres Schienennetzes zusammengebrochen.« Annie verstand nur Bahnhof. Der Kauz wurde plötzlich todernst. »Kurz zusammengefasst: Wir sorgen dafür, dass befreite Sklaven sicher bis nach Kanada gelangen. Das ist natürlich illegal. Aber ist das die Rettung eines Menschenlebens nicht wert?« Er starrte das Mädchen so lange durchdringend an, bis Annie nicht anders konnte, als zustimmend zu nicken. Erst dann fuhr er fort. »Wir stecken in einer schwierigen Situation. Unser regulärer Schaffner ist noch unterwegs und demnächst erwarten wir eine Lieferung. Hier kommst du ins Spiel. Deine Gesinnung und deinen Mut hast du gerade bewiesen. Falls der Herr nicht rechtzeitig zurück ist – kannst du dich mit einer gewissen Vorankündigung freimachen?« Annie schwieg überrumpelt. Was wollte der Alte von ihr? »Du bist doch auch für die Abschaffung der Sklaverei, oder etwa nicht?«, hakte er mit einem schmalen Lächeln nach. Diese Frage hatte ihr bis heute noch niemand gestellt. War sie für die Haltung von Sklaven? Ihr Magen zog sich bei dieser Vorstellung zusammen. Mit dem unguten Gefühl, in eine Sache verwickelt zu werden, die sie nichts anging, brachte sie hervor: »Ich glaube schon.« »Gut, dann ist alles gesagt.« Mit einem listigen Blick auf die Schuluniform, die unter ihrem verrutschten Mantel hervorlugte, fügte er hinzu: »Wenn es notwendig werden sollte, finden wir dich im Institut für Schülerinnen des Westens.«
4 Nick – 13. Dezember 1863
Sobald ich den Kamm erreicht hatte, überblickte ich die ganze Szene vor mir. Fremde Reiter waren über den Hof hereingefallen; trampelten den Gemüsegarten meiner Ma nieder; johlten siegessicher; gaben Schüsse aus ihren Revolvern ab. Einer von ihnen sah in meine Richtung und ich konnte mich gerade noch flach auf den Bauch werfen. Mit klopfendem Herzen lugte ich am Gebüsch vorbei. Was ging dort vor sich? Einer der Burschen hielt Daisy am Zügel. Mein Pferd gebärdete sich wie wild; stieg; verdrehte die Augen. Der Kerl musste die Fersen in die Erde stemmen, damit es nicht ausbrach. Da entdeckte ich meinen Vater. Trotz seines lahmen Beins stand er aufrecht inmitten der Eindringlinge, an seinem bloßen Hals eine Messerklinge. Der Besitzer des Messers überragte meinen Vater um mehr als eine Hauptlänge. Im Gegensatz zu seinen Kumpanen trug er keinen Hut. Immer wieder hob er seine Hand und strich sich die langen, weißblonden Haare aus dem bartlosen Gesicht, die der Wind sofort erneut nach vorne wehte. Den Blick hielt er starr auf den Stall gerichtet. Kalte hellblaue Augen, wie ich von unseren früheren Begegnungen wusste. Freddy Johnson. Fast überhörte ich seine sanfte Stimme. Bei seinen Worten wurde mir eiskalt: »Ich frage jetzt ein letztes Mal: Wo. Hast. Du. Die. Sklavin. Versteckt?« Die Männer waren auf der Suche nach Delilah. Ich musste aufstehen und meinem Pa helfen! Die Schuld auf mich nehmen! Aber würden sie mir überhaupt zuhören? Was konnte ich gegen so eine Übermacht ausrichten? Verspielte ich meinen Vorteil, wenn ich mich jetzt zeigte? Zitternd drückte ich mich auf den Boden. Unfähig, die Augen von der Szene abzuwenden. Vater wirkte keineswegs verängstigt oder betrunken. »Und ich bleib dabei: Es gibt auf dieser Ranch keine Sklaven.« Seine Antwort war fest. Er hatte keinen Zweifel daran, dass er im Recht war. Der Blonde verzog sein Gesicht zu einem freudlosen Lachen. »Wir wissen, dass sie hier ist. Wir haben ihre Spur bis hierher verfolgt. Ich möchte nur hören, wo ihr sie versteckt habt.« Vater würdigte ihn keiner Antwort mehr. Sekunden verstrichen in angespanntem Schweigen. Als klar war, dass keiner von beiden nachgeben würde, wandte sich Freddy Johnson mit kalter Stimme an seine Männer: »Durchsucht alles und bringt mir dieses elende Miststück!« Darauf hatten die anderen nur gewartet. Hilflos sah ich mit an, wie zwei, in denen ich mittlerweile Cowboys von Mr. Goodman erkannt hatte, das Ranchhaus stürmten. Drei andere schoben das Stalltor auf. Sie mussten Mitglieder des Heimatschutzes sein, schloss ich anhand ihrer fleckigen grauen Hosen und militärisch geschnittenen Mäntel. Einer von ihnen trug seinen rechten Ärmel verknotet. Vermutlich war er wegen seiner Verstümmlung aus der Armee ausgeschieden. Aus dem Haus schrillten Schreie. Charlotte, Ben, Ma und Mary waren da drin! Was taten diese Schufte ihnen an? Ich spannte alle Glieder an, aber in diesem Moment tauchten auch die anderen drei aus dem Stall wieder auf und zerrten Delilah hinter sich her. Das Mädchen sandte hilfesuchende Blicke in alle Richtungen und stemmte sich mit ihrem ganzen Körper gegen die Hände, die sie gepackt hielten, wurde aber Fuß um Fuß weitergeschleift. Warum war ich so nachlässig gewesen? Noch vor wenigen Stunden hatte ich Delilah versprochen, sie zu beschützen. Ich hätte sie besser verstecken müssen! Zumindest hätte ich darauf achten müssen, unsere Spuren zu verwischen! Was konnte ich jetzt noch für sie tun? Ich biss mir in den Handrücken, damit ich nicht in Tränen ausbrach. Mit verschleierten Augen sah ich, wie ein Lächeln Freddys Lippen kräuselte. »Du hättest mich nicht anlügen sollen«, sagte er sanft. Ohne meinen Vater noch eines Blickes zu würdigen, zog er ihm das Messer die Kehle entlang. Pa brach gurgelnd zusammen. Nein! Nicht Pa! Eiswasser pumpte durch meine Adern. Meine Gedanken wurden zäh. Nie würde ich Vaters ungläubigen Gesichtsausdruck vergessen! War ihm in seinem letzten Moment klar geworden, dass einer von uns die Familie verraten hatte? Die Tür zum Haupthaus flog auf und Ma und Charlotte traten aneinander gedrückt ins Freie. Ihnen folgten die beiden Cowboys mit den Revolvern im Anschlag und stießen sie vorwärts. Der größere hielt Ben mit der linken Hand am Hemdkragen gepackt und riss ihn hinter sich her. Mein kleiner Bruder zappelte stumm wie ein Fisch an der Angel konnte aber nichts ausrichten. Von Mary fehlte jede Spur. Verzweifelt blinzelte ich. Grub meine Fingernägel in die Erde; spürte kaum, wie sich Steinsplitter in meine Fingerspitzen bohrten. Ich wollte aufspringen! Meiner Familie helfen! Was hatten die Männer mit ihnen vor? Allein hatte ich gegen so viele Gegner keine Chance. Erstarrt blieb ich liegen. Meine Mutter und Charlotte stützten sich gegenseitig, als sie grob zum Stall geschoben wurden. Ma drückte ihren Rücken durch. Mit blitzenden Augen drehte sie sich zur Meute um – und sah Vater mit dem Gesicht nach unten im Dreck liegen. Abrupt blieb sie stehen und starrte auf ihren Ehemann. Ihr Bewacher lief auf sie auf, fluchte und folgte ihrem Blick. Kurz zögerte er, dann gab er Ma einen Schubs nach vorne. Ein Schrei verließ ihre Kehle, der mir mitten ins Herz fuhr. Tränen schossen mir in die Augen. Der Schrei hallte in meinem Körper wider; vervielfachte sich. Ich wollte in das Wehklagen einfallen. Heulen wie ein Wolf. Mich auf die Angreifer stürzen. Daisy riss sich mit einem letzten Aufbäumen los und verschwand in donnerndem Galopp über die Prärie. Leben kam in die Männer. Sie brüllten Verwünschungen, schrien ihre Geiseln an und stießen sie durch das Stalltor aus meiner Sicht. Das Geheul meiner Ma brach plötzlich ab und eine unheimliche Ruhe legte sich über den Hof. Der blonde Teufel pfiff und schwang sich auf sein Pferd. Die anderen Heimatschützer folgten seinem Beispiel. Einer von ihnen hielt Delilah vor sich im Sattel, die sich stumm in ihr Schicksal ergeben hatte. Jetzt rannten die letzten beiden aus dem Stall; nahmen sich die Zeit, von außen den Riegel vorzuschieben. Dann galoppierte die Truppe davon und ließ nur eine Staubwolke zurück.
5 Annie – 13. Dezember 1863
Annika Bailey, bist du hier irgendwo?« Die schneidende Stimme von Mrs. Hodgers drang in jeden Winkel des kleinen Stalls. Annie zuckte zusammen, versteckte eilig die Zeitung, über der sie die Zeit vergessen hatte, und duckte sich im Verschlag des alten Kutschgauls noch tiefer in das Stroh. Sie hielt den Atem an. Sekunden verstrichen, in denen sie nur das Schnauben des Pferdes und das gelegentliche Stampfen und Rascheln von Hufen vernahm. »Suchen Sie irgendwas?«, dröhnte der Bass des Kutschers durch die Stille. »Haben Sie Miss Bailey gesehen?« »Was sollte sie denn im Stall verloren haben? Kommen Sie mit nach draußen, dann helfe ich Ihnen, sie zu finden.« Für einen Moment erschien das Gesicht ihres Freundes Mr. Curtis über der Wand der Box. Verschwörerisch blinzelte der alte Mann Annie zu. Dann fiel die Tür hinter den beiden ins Schloss. Sofort entspannte sich Annie. Sie musste noch besser aufpassen, wenn sie hierherkam! Keine andere Schülerin hätte Mrs. Hodgers ausgerechnet im Stall gesucht. Für Annie jedoch waren Pferde gleichbedeutend mit Freiheit. Der Stall bot ihr ein Versteck vor dem Trubel im Internat, wo sie nie allein war. Nicht im Schlafsaal, nicht im Unterricht, nicht im Speisesaal. Annie schloss die Augen und sog den würzigen Duft nach Pferd ein. In der Zeit vor dem Krieg hatte sie auf dem Rücken ihrer Stute für ein paar Stunden dem Tadel ihrer Stiefmutter und den standesgemäßen Konventionen entfliehen können. All ihre glücklichen Kindheitserinnerungen waren mit Pferden verknüpft. Sie konnte immer noch die starken Arme ihres Vaters um sich spüren, wie er sie als kleines Mädchen vor sich im Sattel gehalten hatte. Das glockenhelle Lachen ihrer echten Mutter war ein fester Bestandteil dieser Erinnerung. Wenn Annie sich konzentrierte, konnte sie deren Silhouette im Gegenlicht ausmachen. So vertraut. Doch nie gelang es ihr, dem Umriss ein Gesicht zu geben. Traurig streichelte das Mädchen dem Falben über die Nüstern und genoss das Gefühl von weichem, beweglichem Fell unter ihren Fingern. Sanft stupste der Hengst gegen ihre geöffnete Handfläche und sein warmer Atem strich darüber. Seit einem gefühlten Jahrhundert war sie auf keinem Pferd mehr gesessen. Sie vermisste den Wind in ihren offenen Haaren, die gleitende Bewegung unter sich, wenn sie mit ihrem Pferd zu einer Einheit verschmolz und über die Weide am Waldrand stob. Sehnte sich nach der Aufregung, wenn sie einen riskanten Sprung über einen gestürzten Baum wagte, und die Unabhängigkeit, wenn sie allein schnelle Entscheidungen treffen musste. Nur sie gab dann die Richtung vor! Annies geheimes Ziel war es, nach ihrem Schulabschluss die heimatliche Pferdezucht mit ihrem Vater zusammen zu leiten. Natürlich war das für eine Frau unerhört. Aber die Welt der Züchter musste sie einfach anerkennen, wenn sie die Beste in ihrem Fach war und Zuchterfolge aufweisen konnte! Ihre Bildung würde der Grundstein werden für die Brücke in ein freies Leben. Das nächste Mal, wenn sie ihren Vater sah, würde sie ihm ihren Traum anvertrauen. Er würde stolz sein. Bestimmt. Gedankenverloren zog Annie die Zeitung unter dem Stroh hervor und strich liebevoll mit dem Finger über die gedruckten Zeilen, ohne sie zu lesen. Bücher und Zeitungen waren ihr geheimes Fenster auf die aufregenden Geschehnisse außerhalb der Schulmauern seit ihrer Kindheit. Annies Mutter Sue hatte in ihr schon als kleines Mädchen die Neugierde auf die Geheimnisse der Welt geweckt. Sie war es gewesen, die Annie enthüllt hatte, dass man mithilfe von Büchern alle Grenzen überwinden konnte. Seit Annika gelernt hatte, Buchstaben zu entziffern, sog sie jeden geschriebenen Text in sich auf, der ihr in die Hände fiel. Dass sie einen großen Teil der Lexika, Pferdezuchtbücher, Romane, Manöverstrategien, Geographiewerke und Ausführungen zum christlichen Glauben, die sie in der Bibliothek entdeckte, anfangs nur ansatzweise begriff, störte sie nicht im mindesten. Sue hatte es sich nicht nehmen lassen, Annika zusammen mit den Kindern der Haushälterin George und Maggie persönlich zu unterrichten. Niemand hatte ein gütigeres Herz als ihre Mutter. Annie musste bei der Erinnerung schmunzeln. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie noch die rauen Bretter der Tische im alten Schulhaus unter den Fingerspitzen fühlen. Zum ersten Mal kam ihr die Frage in den Sinn, warum ihre Mutter darauf bestanden hatte, das kleine Blockhaus im Wald als Schule zu nutzen. Vor dem Wiederaufbau war es halb verfallen gewesen – vermutlich stammte es noch von den ersten Siedlern. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass Sue immer von einer eigenen Schule geträumt hatte und kurze Zeit als Lehrerin tätig gewesen war, bevor sie Annies Vater getroffen hatte. Zumindest hatte dieser ihr das einmal erzählt. Oder vielleicht hatte Sue es einfach genossen, dort im Wald ihr eigenes Reich zu erschaffen. Annies Erinnerung duftete nach poliertem Holz und Tinte. Neben ihr saß George. Sein Kopf lag schief und dunkle Strähnen fielen ihm ins Gesicht. Vor Konzentration hatte er die Zunge aus einem Mundwinkel gestreckt. Trotzdem gerieten ihm die Buchstaben windschief und konnten kaum entziffert werden. Sobald sich Sue zur großen Tafel umdrehte und mit schönen Bögen ein kompliziertes Wort anschrieb, ließ George die Schreibfeder fallen, und sein spitzbübisch funkelnder Blick traf den Annies. Wie sehr sie ihn um seine langen, dunklen Wimpern und die blitzenden Augen beneidete. Sie waren schwarz wie ein Moorsee! Nie konnte sie sicher sein, was dahinter vorging und was er diesmal wieder ausgeheckt hatte. Genervt drehte sie sich weg, konnte es aber nicht lassen, zwischen den Haaren hindurch zu ihm hinüber zu schielen. Hatte er in seiner Hosentasche ein paar Regenwürmer in die Schule geschmuggelt? Oder hatte er ihr eine seltene Blüte mitgebracht, die er bei seiner Arbeit auf der Ranch entdeckt hatte? Oder würde er sie gleich mit feuchten Papierkügelchen beschießen?
Nach dem Tod von Annies Mutter hatte ihr Vater es in seiner Trauer versäumt, einen Hauslehrer oder eine Gouvernante einzustellen. Die achtjährige Annika hatte es ungerecht gefunden, dass ihrer aller Ausbildung auf einen Schlag beendet war. So setzte sie durch, dass der Unterricht beibehalten wurde und übernahm kurzerhand selbst das Zepter. Im Hier und Jetzt musste sie über ihr jüngeres Ich lächeln. Kaum nachdem sie den Entschluss gefasst hatte und die erste Stunde näher rückte, war sie immer nervöser geworden. Sie hatte sich nichts sehnsüchtiger gewünscht, als dass ihre Schüler nicht nur aus Pflichtgefühl teilnahmen. Sie wollte ihre Neugierde wecken und vielleicht auch George ein klein wenig beeindrucken. Tagsüber ritt sie über die Wiesen und durchforstete in Gedanken alle Geschichten, die sie selbst besonders faszinierten. Schließlich verfiel sie auf Christopher Columbus, der für sie der Inbegriff von Forscherdrang war. Als Entdecker Amerikas war er prominent genug, um für die Foster-Kinder – insbesondere für den hibbeligen George – interessant zu sein. Wieder zu Hause hatte sich die achtjährige Annie auf das Geschichtslexikon ihres Vaters gestürzt und sich in das Spanien des fünfzehnten Jahrhunderts entführen lassen. Sie kniete sich an Christophers Seite vor die Königin Isabella und erbat Geld für eine Expedition nach Indien; bangte, ob ihr Lebenstraum endlich in Erfüllung ginge; erlebte zusammen mit den Matrosen die endlose Seereise mit Krankheiten, Entbehrungen, Hoffnung im Herzen und dem berauschenden Gefühl der Freiheit; jubelte erleichtert »Land in Sicht!«, als die ersten Inseln auftauchten. Annies erste Unterrichtsstunde war jedoch um Haaresbreite ins Wasser gefallen, weil George nicht auftauchte. Unruhig lief Annie auf und ab, kaute auf ihrer Unterlippe und zerbrach fast den Zeigestab, der länger war als sie selbst. Maggie saß stumm in ihrer Schulbank und verfolgte verängstigt, wie Annie immer nervöser wurde. Erst mit einer ganzen halben Stunde Verspätung lud Mr. Foster seinen Sohn eigenhändig vom Pferd und schleifte ihn am Ohr herein. Mit verschränkten Armen, Schmutzstreifen im Gesicht und völlig verstrubbelt schmollte George in seiner Bank. Wenn Annie ihn aufrief, verweigerte er jede Antwort. »Maggie, könntest du bitte für uns das Wort ›Pferd‹ buchstabieren, wenn das für deinen Bruder zu schwierig ist?«, versuchte sie es bei seiner Schwester. Vielleicht konnte sie George bei seinem Stolz packen. Bestimmt ließ er nicht zu, dass die Kleine ihn überflügelte. Mit aufgerissenen Augen starrte Maggie ihre neue Lehrerin an. Als Annie schon die Hoffnung aufgegeben hatte, klappte die Kleine den Mund auf. »Pferd buchstabieren«, wiederholte sie wenig hilfreich. »Sei still«, blaffte George seine Schwester an. »Annie ist nicht unsere Lehrerin! Sie will sich nur aufspielen.« Annie biss sich auf die Innenseite ihrer Lippe. Sie wollte George nicht die Genugtuung geben und ihn anschreien oder anfangen zu heulen. Er hatte ja recht – ihre Mutter sollte hier vorne stehen. Doch Sue war nicht mehr da. Annie wollte nicht daran denken, dass ihre Mutter tot war. Wollte vergessen, dass ihr Vater zu irgendeiner Geschäftsreise aufgebrochen war und sie verlassen hatte. Wollte, dass alles wieder so wurde wie früher! Also setzte sie sich an das Lehrerpult und begann zu erzählen: »Vor langer Zeit lebte ein Mann, der hieß Christopher Columbus. Wenn er 1492 Amerika nicht entdeckt hätte, säßen wir alle heute nicht hier.« Während sie die Geschichte Stück für Stück vor ihren Zuhörern ausbreitete, bemerkte Annie zufrieden, dass Maggies Augen anfingen zu leuchten und Georges Arme sich lockerten. Gebannt hingen die Geschwister an ihren Lippen und saugten jedes Wort auf. Angespornt von diesem Erfolg hatte Annie sich von da an mit Leib und Seele in die Vorbereitung des Unterrichts geworfen. Wenn sie nicht gerade ausritt, traf man sie mit großer Wahrscheinlichkeit in der Bibliothek ihres Vaters an. Natürlich hatte es George auch weiterhin nicht gefallen, dass Annie sich als Lehrerin gebärdete. Wenn es ihr jedoch gelungen war, ihn für ein Thema zu begeistern, hatte der Triumph jedes Mal umso süßer geschmeckt. Annie konzentrierte sich wieder auf die Zeitung in ihren Händen und überflog die Überschriften nach Neuigkeiten aus dem Krieg. Hatte es der Norden endlich geschafft, weiter in den Süden vorzudringen? Gab es einen Hinweis, wo die Einheit ihres Vaters derzeit eingesetzt war? Annie stutzte, als ihr die Wörter »geflohene Sklaven« und »Torturen« ins Auge fielen. Irritiert sprang sie zum Anfang des Artikels und las: »Eine neue Enthüllung des Grauens! Um den Grad der Brutalität zu veranschaulichen, den die Sklaverei unter den Weißen im Süden erreicht hat, fügen wir den folgenden Auszug aus einem Brief der New York Times hinzu, in dem wir wiedergeben, was Flüchtlinge von Mrs. Gillespies Anwesen am Black River erzählt haben.« War es Schicksal, dass dieser Artikel ausgerechnet heute in der Zeitung stand? Oder hatte sie derartige Berichte bis jetzt unbewusst übersprungen? Mit einem mulmigen Gefühl studierte Annie die Stelle noch einmal langsam: »Die Behandlung der Sklaven ist in den letzten sechs oder sieben Jahren immer schlechter geworden. Das Auspeitschen des nackten Körpers mit einem Lederband ist häufig.« Und weiter unten: »Eine andere Methode der Bestrafung, die für schwerere Verbrechen verhängt wird, wie z. B. Flucht oder anderes widerspenstiges Verhalten, besteht darin, ein Loch in den Boden zu graben, das groß genug ist, damit der Sklave darin hocken oder sich hinlegen kann. Das Opfer wird dann nackt ausgezogen, in das Loch gesteckt und eine Abdeckung oder ein Gitter aus grünen Stöcken über die Öffnung gelegt. Über diesen wird ein Feuer aufgebaut. Die brennende Glut fällt auf das nackte Fleisch des Sklaven, bis sein Körper Blasen bildet und bis zum Platzen anschwillt. Gerade noch lebendig genug, um kriechen zu können, darf sich der Sklave von seinen Wunden erholen, wenn er kann, oder seine Leiden durch den Tod beenden. Charley Sloo und Overton, zwei Hilfsarbeiter, wurden beide durch diese grausame Folter ermordet. Sloo wurde zu Tode gepeitscht und starb an den Folgen kurz nach der Bestrafung. Overton wurde nackt auf sein Gesicht gelegt …« Tränen bannten in Annies Augen und sie konnte nicht weiterlesen. Ungläubig starrte sie auf die Zeilen. Warum wurde etwas so Grausames gedruckt? Menschen wurden hier schlechter behandelt als jedes Tier! Wie konnte es sein, dass ein Sklavenbesitzer derartige Willkür walten lassen durfte und dabei durch das Gesetz geschützt war? Immerhin befand sie sich in Amerika, in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts! Wie konnten die Südstaatler stolz auf ihre Freiheit sein und gleichzeitig ihre Wirtschaft auf einem System der Sklaverei begründen? Zu Hause in Kentucky waren Sklaven ein fester Bestandteil der Gesellschaft, den sie nie hinterfragt hatte. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass hier im Staat Ohio das Alltagsleben auch ohne Sklaven wunderbar funktionierte. Natürlich gab es auch hier Schwarze, doch die lebten in ihren Vierteln mit eigenen Kirchen, Schulen und Läden, die kaum je ein Weißer betrat. Heute hatte sie das erste Mal mit einem von ihnen gesprochen. Wie es dem Kleinen wohl ging? Bis jetzt hatte Annie diese Abolitionisten, wie sich die Leute nannten, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten, belächelt. Sollten sie doch singend und Banner schwingend durch die Straßen ziehen. Meinten sie wirklich, sie konnten damit auch nur einen Sklavenhalter zum Umdenken bewegen? Doch nach dem Vorfall heute verlieh es ihr ein beruhigendes Gefühl, dass Menschen wie der kauzige Alte existierten, die sich um entlaufene Sklaven kümmerten. Im Grund konnte sie sich vorstellen, sich irgendwann für Flüchtlinge zu engagieren. Aber gerade jetzt hatte sie keine Zeit. Sie musste sich dringend auf ihre Prüfungen konzentrieren und Geschenke für Weihnachten besorgen.
6 Nick – 13. Dezember 1863
Endlich erwachte ich aus meiner Erstarrung; sprang auf; rannte den Hügel hinunter. Meine Tränen ließen den Hang vor mir verschwimmen. Ich strauchelte; fing mich im letzten Moment; rieb mir unwirsch über die Augen; hastete weiter. Als ich den Stall erreicht hatte, leckten Flammen aus dem Dach; der schwarze Rauch türmte sich darüber. Die erstickten Hilfeschreie meiner Schwester waren in Husten und Keuchen übergegangen. Aber sie lebte! Wie stand es um Ma und Ben? Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich mit zitternden Fingern den Riegel zurückgeschoben hatte. Gerade noch konnte ich zur Seite springen, als eine Kuh nach draußen stürmte, die Augen in Panik verdreht. Das Feuer war im vorderen Teil gelegt worden, in den Boxen mit Heu und Werkzeugen. Die Luft war zum Schneiden dick. Ich zog mein Hemd nach oben über Mund und Nase und trat in das Flammenmeer. Sofort spürte ich die sengende Hitze auf der Haut. Meine Augen brannten und tränten. Ich musste den Drang, sie fest zuzukneifen, mit Gewalt unterdrücken und stolperte halb blind vorwärts. Meine Lippen wurden trocken und rissig und ich hustete unkontrolliert. Trotzdem drang ich weiter vor. »Wo seid ihr?«, rief ich erstickt und musste erneut husten. Zum Glück waren die Pferde nicht im Stall! Ich schüttelte mechanisch die Funken von meinem Hemdsärmel; ignorierte den brennenden Schmerz. Einer Eingebung folgend, stieß ich die Tür zu Delilahs Krankenlager auf. Tatsächlich stand der Eimer mit Milch noch fast voll mitten im Raum. Ich packte ihn und kehrte auf dem Absatz um. In einem Funkenregen krachte ein Balken vom Dachstuhl neben mir zu Boden, verfehlte mich nur knapp. Nur weiter. Weiter. Ein beißender Geruch nach verbrannten Haaren und angesengter Haut ließ mich keuchen. Langsam sickerte ein Gedanke in mein Bewusstsein: An einem einzigen Tag hatte ich meine halbe Familie getötet. Hoffnungslos schluchzte ich auf. Aber es kamen keine Tränen mehr. Meine Augen waren ausgetrocknet. Nach endlosen Minuten hörte ich wieder Husten. Mindestens einer von ihnen lebte noch! Was war mit den anderen? Ein neuer Schluchzer entrang sich meiner schmerzenden Kehle. Mit wackligen Beinen hastete ich weiter. Es kam von der Kutsche, die in der letzten Ecke des Stalls noch nicht von den Flammen erfasst worden war. Sie wurde fast verhüllt von schwarzem Qualm. Nur noch wenige Minuten, dann würde auch sie ein Opfer des Feuers werden. Meine Haut brannte und spannte unerträglich. Ich taumelte auf die Kutsche zu; erklomm über ein Wagenrad die Ladefläche; zerrte den Eimer hinter mir her. »Nicky?« Ma starrte mir mit rußgeschwärztem Gesicht entgegen. Sie waren alle drei da. Die beiden Frauen hatten Ben in ihre Mitte genommen. Mit einer Decke schützten sie sich vor herabregnenden Funken, wagten es aber nicht, ihre Zuflucht zu verlassen. Warum auch? Sie wussten, dass das Tor von außen verrammelt war. Es gab keinen Weg nach draußen.





























