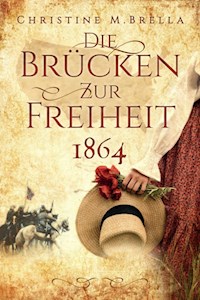4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
9 Reisen durch Himmel, Welt und Hölle Die "Schreiber und Sammler" präsentieren ihr erstes gemeinsames Buch. 9 Autoren, 9 Geschichten - Fantasy, Krimi, SciFi, Historisches, Satire und Traumhaftes. 9 Geschichten über das, was passiert, wenn Welten aufeinanderprallen - im Weltraum, im Wilden Westen, im Hier und Jetzt und überall dazwischen. Schneewittchen klappert New York nach einem Kupferkessel ab, und eine Frau, die auch ein Jaguar ist, flieht vor ihrer eigenen Familie. Echte Raben suchen nach echtem Futter und nach Antworten. Eine Mutter ist spurlos verschwunden, und eine andere reist auf der Suche nach ihrem Sohn zu den Sternen. In Niemandsstadt begegnen sich ein Junge und ein Mädchen. Er weiß zu wenig, sie zu viel. Im frühen Rom und im Wilden Westen stehen Väter und Töchter vor ihrer schwersten Entscheidung. Was bedeutet Liebe? Was ist sie wert? Was tust du für deine Familie? Und sie für dich? In der Hölle herrscht tote Hose, und wer an das Paradies glaubt, kann tun, was er möchte. Lass dich nicht hängen! Die Menschheit feiert die Utopie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Die Schreiber und Sammler – Wir über uns
9 Autoren aus Augsburg
Christine M. Brella – Lass Dich nicht hängen wortwörtlich
Julia E. Dietz – Als die Wassergeister ihre Seele verloren Der erste Fall für Eddie, Kim und Friedel
Rebecca Ahlen – Teufel sei Dank Eine Satire über Himmel und Hölle
Luna Day – Solta, Ruf der Freiheit Eine Jaguar-Gestaltwandlerin findet mehr als ihre Freiheit
Valentina Baumgartner – Heute, gestern, morgen Ein Abenteuer in einer verlassenen Welt
Daniel Bühler – Der Ring des Römers Opferst du das Wertvollste für Rom?
Katharina Maier – Der
Sohn
Suche zwischen den Sternen
Sinakaii Cheops – TikTok Frankenstein Glauben Sie immer noch, dass Frankenstein, Schneewittchen, Romeo und der Affe nichts gemeinsam haben?
Nessa Hellen – Paradies.Economy.con Bei dieser dystopischen Geschichte wurden keine echten Tiere verwendet!
Die Schreiber und Sammler
– Die Autoren
DIE SCHREIBER UND SAMMLER
Wir über uns: 9 Autoren aus Augsburg
Dass wir uns getroffen haben, ist Zufall. Jedenfalls mehr oder weniger. Gemeinsam hatten wir nur, dass wir zu diesem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben in Augsburg und Umgebung wohnten – und das Schreiben.
Das Schreiben hat uns zusammenführt. So entstand die Gruppe der »Schreiber und Sammler«, ein Kaleidoskop gefüllt mit Ideen, Welten und Figuren, ein Murmelglas mit neun komplett unterschiedlichen, vielfarbigen Murmeln. Aber unsere Autorengruppe ist auch wie ein Lagerfeuer. Am Lagerfeuer der Schreiber und Sammler muss man nicht nur schriftstellernder Einzelkämpfer sein. Man findet offene Ohren, Unterstützung und Zusammenhalt. Dort, am Lagerfeuer, lachen wir gemeinsam, lernen gemeinsam und lassen uns inspirieren. Denn das ist das Ziel der Schreiber und Sammler: sich gegenseitig zu helfen, immer bessere Geschichten zu schreiben und sie mit unseren Lesern zu teilen.
Wer wir sind? Am besten lernt Ihr uns kennen, wenn Ihr unsere Geschichten lest!
Für diese Anthologie haben wir uns jeder die Frage gestellt, was passiert, wenn Welten aufeinanderprallen – und neun sehr unterschiedliche Antworten gefunden. Doch so verschieden wir Schreiber und Sammler und unsere Geschichten auch sind, unterm Strich vereint uns alle Neune eins: der Wunsch, unseren Lesern eine richtig gute Geschichte zu erzählen!
Viel Freude beim Lesen!
Christine M. Brella – die Hüterin der staubigen Straßen
Julia E. Dietz – die Coming-of-Age-Autorin, authentisch und manchmal fantastisch
Rebecca Ahlen – die Weltenbummlerin
Luna Day – die, in deren Geschichten Liebe immer geht, egal ob fantastisch oder real
Valentina Baumgartner – Fänger dieser kleinen Momente, in denen man die Zeit anhalten wollen würde
Daniel Bühler – der mit den Römern
Katharina Maier – das Schreibweib, die Weltenbauerin
Sinakaii Cheops – der Exot, der einfach viertausend Jahre mehr Erfahrung hat
Nessa Hellen – die mit dem Wolf tanzt
9 REISEN DURCH HIMMEL, WELT UND HÖLLE
Christine M. Brella
LASS DICH NICHT HÄNGEN
17.10.1860, Oregon Trail (Nebraska)
Lieber Daddy,
es wird Dich freuen zu hören, dass Du wahrscheinlich nicht hängen musst. Ich war mit Deinen Medaillen, die Du Dir beim Kampf gegen die Wilden verdient hast, in Washington. Die feinen Herren waren mordsbeeindruckt und sehr freundlich. Anbei liegt das Begnadigungsschreiben. Ich hoffe bloß, dass es Dich noch rechtzeitig erreicht. Ein Monat ist halt echt nicht viel, besonders weil heuer keine Postkutsche mehr geht. Aber mach Dir keine Sorgen, ich gebe den Brief morgen beim Pony-Express-Quartier in Fort Kearny ab. Es heißt, dass die Reiter so schnell sind, dass sie zweitausend Meilen in zehn Tagen zurücklegen. Nein, ich übertreibe nicht! Das schaffen die wirklich! Natürlich macht aber nicht ein Reiter die Strecke allein – die Post wird von einem zum anderen weitergereicht. Vierzig Mal! Das passiert in so einem Quartier, in dem ein Reiter dann Kost und Logis bekommt. Aber nicht nur die Post, sondern auch ein Reiter wird wie ein Staffelholz weitergegeben. Alle paar Meilen gibt es nämlich zusätzlich Wechselstationen, bei denen das müde Pferd seinen Reiter an ein frisches übergibt.
Ein wenig mulmig ist mir schon bei dem Gedanken, dass der Brief auf dem Weg verloren geht. Immerhin muss er durch das Gebiet von kriegerischen Indianern – und sogar über die Rocky Mountains! Mir fällt aber tatsächlich nicht ein, wie ich es sonst machen soll. Warum hast Du Dich auch unbedingt in Kalifornien festsetzen lassen? Das war nicht besonders schlau.
Lass Dich nicht hängen!
In Liebe,
Mathilda
1. KAPITEL
Gleißend hell fuhr ein Blitz vom bleigrauen Himmel herab und schlug breit gefächert in die Grasebene ein. Gleich darauf folgte ein ohrenbetäubender Donnerschlag. Seit Stunden zerrte der Sturm an der kleinen Blockhütte und ließ die Fensterläden gegen die Rahmen krachen. Die Männer des Pony-Express hatten sich um den Tisch geschart, auf dem eine einzelne Petroleumlampe flackerte. Nach dem Frühstück waren sie direkt zu Whiskey und Poker übergegangen. Niemand hatte das Bedürfnis, auch nur eine Nasenspitze vor die Tür zu strecken.
»Diese verfluchten Wilden!«, schimpfte Quartierleiter Williams und rupfte an seinen wenigen verbliebenen grauen Strähnen. »Solange die auf alles schießen, was durch das Platte-Tal reitet, meldet sich keiner freiwillig für die Strecke.«
Jacques zuckte zusammen. Schnell nahm er einen Schluck Whiskey, um seine Reaktion zu verbergen. So oft schon hatte er gehört, wie das Volk seines Großvaters beleidigt wurde. Dreckiger Indianer, Heide, Flapjack waren Namen, die ihm auch die Männer am Tisch gelegentlich gaben. Die meiste Zeit meinten sie es nicht einmal böse. Vielleicht hätte er seine Gefühle besser verbergen können, wenn er ein ganzer Lakota gewesen wäre, aber er war eben nur ein halber.
»Wenn wir die Post nicht bald Richtung Kalifornien bringen, können wir zusperren.« Der korpulente Hüttenwirt Sam knallte eine Dollarnote auf den Tisch, um seinen Einsatz zu erhöhen.
Jacques lehnte im Halbschatten an der Wand und nahm am Spiel nicht teil. Die Männer tranken und arbeiteten zwar mit ihm, doch an den Pokertisch ließen sie ihn nicht. So viel zu seiner Hoffnung, dass ihm die Uniform eines Scouts bei der Armee Respekt einbringen würde. Genauso würden sie nie auf die Idee kommen, ihn mit den Briefen loszuschicken. Dabei war er aktuell der Einzige in Fort Kearny, der dieser Aufgabe gewachsen war. Schon als Junge war er die Strecke regelmäßig geritten. Kannte den Weg auch im Dunkeln. Sturm und Regen waren ihm gleichgültig. Doch stattdessen würde er bis Mittag so viel trinken, bis ihm angenehm warm wurde. Bis er vergessen konnte, dass er unter diesen Männern immer als Mensch zweiter Klasse gelten würde, egal, wie sehr er sich anstrengte. Dann würde er sich auf sein Pferd schwingen, hinaus in den Regen reiten und dieselben Männer warnen, falls er indianische Krieger auf Beutezug entdeckte. Ein Nachmittag noch in dieser Routine, dann brach endlich sein freies Wochenende an. Er lebte für diesen einen Tag im Monat, den er bei seiner Familie verbringen konnte. Dort wurde er geachtet, vermisst, geliebt.
»Erst seit einem halben Jahr ist die Strecke in Betrieb. Wir müssen reiten, damit das Ganze nicht zur totalen Katastrophe wird!« Williams nahm einen tiefen Zug.
Mit einem Knall flog die Tür auf. Williams verschluckte sich und hustete nass. Regen wehte durch die Öffnung, die von einer Person verdeckt wurde, die sogar noch kleiner war als Jacques selbst. Unter ihrem durchweichten Umhang sprangen rote Locken hervor. Die Hände hatte sie in die Hüften gestemmt; das Kinn erhoben.
»Ich will einen Brief aufgeben!«, forderte das Mädchen mit rauer Stimme und trat ein.
Die Männer sahen sich verblüfft an. Sams Sohn sprang zur Tür und schlug sie zu. Sein Vater wischte sich den Mund ab.
»Erstens nehmen wir keine Briefe auf halber Strecke an. Das geht nur in Saint Joseph. Und zweitens endet die Verbindung aktuell hier. Unser Reiter hat es mit dem Magen und uns fehlt ein Ersatz.«
Mit dem Daumen wies er in die Ecke, in dem sich eben jener Junge auf der Pritsche wand und leise stöhnte. Vielleicht hätte er nicht unbedingt am Bohnenwettessen teilnehmen sollen, dachte Jacques spöttisch, verzog aber keine Miene. Das Mädchen mit dem Flammenhaar ließ die Schultern sinken, blickte kurz ratlos, straffte sich dann wieder.
»Gut – ich mach‘s.«
Es wurde still im Raum. Dann brachen die Männer zusammen. Lachen polterte von einem zum anderen. Sam hielt sich den Bauch und kippte vornüber. Williams schlug sich auf die Schenkel. Selbst Jacques musste schmunzeln. Doch das Mädchen verschränkte nur die Arme vor der Brust und zuckte mit keiner Wimper. Als sich die Männer nicht beruhigten, fragte sie über den Lärm: »War‘s das jetzt? Dann brauch ich die Post, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren.«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir einem Mädchen unsere Pferde anvertrauen?«, presste Sam hervor und schob mit dem Fuß die Posttasche unter den Tisch.
»Ich wette, ich kann besser reiten als jeder andre hier im Raum«, gab sie zurück. Was bildete sich dieses Weib eigentlich ein?
»Da halte ich dagegen!« Das war klar gewesen, dachte Jacques. Williams ließ nie eine Wette aus.
»Wenn du schneller um das Fort reitest als unser Bester, bist du eingestellt.«
Alle Blicke richteten sich auf Jacques. Das Weib sah ebenfalls in seine Richtung - und erstarrte. Ihre Augen wurden groß und sie krallte ihre Finger in die verschränkten Arme, bis die Knöchel weiß wurden. Jacques biss die Zähne zusammen. Merde. Hatte sie noch nie einen Indianer gesehen?
»Ich setz keinen Fuß vor die Tür«, stöhnte der Reiter von der Pritsche. Auch die anderen sahen sich unentschlossen an. Nass werden wollte eigentlich keiner freiwillig. Nicht einmal für eine Wette.
»Kannst du schießen?«, fragte Williams.
Das Weib zögerte nur einen Wimpernschlag und nickte dann langsam.
Sam strahlte. »Wenn du uns alle beim Schießen besiegst, hast du den Job.«
Bevor sie antworten konnte, sauste Sams Sohn in eine dunkle Ecke und tauchte mit fünf leeren Bohnendosen wieder auf, die bereits ein paar Löcher aufwiesen. Sorgfältig platzierte er sie auf einem einfachen Hängeregal über dem Tisch, wo sie von der Lampe angestrahlt wurden. Währenddessen schenkte Sam sechs Gläser voll.
Die Frau hob abwehrend eine Hand. »Ich trinke nicht.«
Ein Runzeln zerfurchte Sams Stirn. »Ein Reiter für den Pony-Express muss reiten, schießen und saufen können! Oder hast du es dir schon anders überlegt, Missy?«
Wortlos stolzierte das störrische Weib an den Tisch und stürzte den brennenden Fusel hinunter, ohne abzusetzen. Wehmütig dachte Jacques an die stille Eleganz seiner Mutter und Schwester. Immer tauchten sie geräuschlos auf und erfüllten, ohne zu fragen, seine Wünsche oder die seines Vaters. Die Fremde erinnerte ihn viel eher an seine achtjährige Nichte. Marie kletterte ständig auf Bäume, plapperte ununterbrochen und wollte immer mit dem Kopf durch die Wand. Für ein kleines Mädchen war das ja ganz niedlich, aber gewiss nicht für eine erwachsene Frau. Was wollte dieses Weib beweisen? Die Stärken eines Reiters waren, leicht und mutig zu sein und sich möglichst nicht abwerfen zu lassen. Vielleicht schadete auch das Trinken nicht, wenn die meisten Reiter auch nicht älter als achtzehn waren – manche gerade mal vierzehn – und damit erst blutige Anfänger auf diesem Gebiet. Schießen gehörte aber ganz klar nicht zu den Aufgaben der Reiter – schließlich konnten sie einen ganzen Stoß Briefe mehr transportieren, wenn sie den Revolver zu Hause ließen. Ein Reiter wurde darauf gedrillt, sich niemals einer Gefahr zu stellen, sondern ihr mit seinem schnellen, ausgeruhten Pferd unter allen Umständen aus dem Weg zu gehen. Wusste die Fremde das nicht oder ignorierte sie diese einfache Logik bewusst? Die offene Prärie war kein Ort für eine einzelne Frau ohne Beschützer.
Nacheinander traten die Männer an den Tisch und leerten ihren Whiskey. Natürlich ließ sich Jacques die Runde nicht entgehen. Danach gesellte er sich zu den anderen neben die Pritsche an der hinteren Wand. Sam war bereits dabei, den Revolver das erste Mal zu laden.
»Wer einmal daneben schießt, ist raus«, bestimmte Williams. »Der Letzte im Rennen hat gewonnen.«
»Aber der Abstand ist nur knapp zwanzig Fuß«, protestierte das störrische Weib. »Eher geht uns die Munition aus, als dass einer nicht trifft.«
Sam blinzelte ihr verschwörerisch zu. »Du wirst ja sehen, Missy.«
Dann drückte er in einer fließenden Bewegung fünfmal ab. Obwohl er einen deutlichen Vorsprung hatte, was den Whiskeykonsum anbelangte, sprangen alle Dosen hübsch nacheinander vom Brett. Sofort eilte sein Sohn hinüber, um sie neu zu platzieren. Der Reiter traf ebenfalls sauber, wenn er auch in seiner liegenden Position einen klaren Nachteil hatte. Die Schüsse hallten ohrenbetäubend von den Wänden wider, als Jacques, Williams und Sams Sohn die Dosen vom Brett holten. Als Letztes war das Weib an der Reihe. Sie presste die Lippen aufeinander. Es klang wie ein einzelner, langgezogener Schuss, als sie das Magazin und das Regal innerhalb eines Wimpernschlags leerte. Verblüfft starrten die Männer sie an.
»Wo hast du gelernt, so zu schießen?«, fragte Sam, erhielt aber nur ein Schulterzucken zur Antwort. Kurz zögerte er, dann füllte er die Gläser ein weiteres Mal. Die Augen des störrischen Weibs weiteten sich, doch diesmal protestierte sie nicht. Gemeinsam mit den anderen kippte sie den Fusel hinunter. Jacques beobachtete genau, ob sie schummelte, doch kein einziger Tropfen lief an ihrem Kinn entlang. Immer noch sah sie sehr nüchtern aus, während der Boden unter seinen Füßen bereits angenehm schaukelte.
Weitere drei Runden mit Schießen und Whiskey folgten schnell aufeinander, dann schoss Sams Sohn daneben. Kurz danach hielt sich der Reiter die Hand vor den Mund, wankte vor die Tür und kam nicht zurück.
»Du schiess verdamm gut fürn Mädchen«, nuschelte Sam und prostete dem störrischen Weib zu. Immerhin waren mittlerweile ihre Wangen gerötet. Auch wurden ihre Bewegungen unpräzise und sie lachte laut über die unanständigen Witze der Männer, traf jedoch weiterhin jede Büchse voll in der Mitte.
»Mein Daddy sagt immer: Entweder du bist dir sicher, dass du triffst, oder du lässt den Revolver stecken.«
»Wenn du genauso reites wie du schiess und säufs, gib ich dir die Post villeich doch.« Williams fand seinen eigenen Witz zum Brüllen. Die anderen, selbst das störrische Weib, stimmten ein
In der kleinen Hütte wurde die Stimmung immer ausgelassener. Sam schüttete erneut Whiskey in Richtung der Gläser, traf allerdings nicht mehr so zielsicher wie am Anfang.
»Sum Wohl, Freunde«, grölte er und hob sein Glas. »Lass uns susammen trinkn – oder untergehn!«
»Un untergehn tun wir sicher!« Williams stützte sich auf einer Stuhllehne ab. Prompt krachte der Stuhl unter seinem Gewicht zu Boden.
Wie kleine Mädchen kicherten die Männer los, während Williams auf allen Vieren zum Tisch krabbelte und sich hochzog. Er griff sich ein Glas und reckte es in die Höhe.
»Die Indianer sin Halsabschneider. Aber die sin nix gegen die reichn Bosse. Schickn unss ini Wildnis un sahnen selber die fette Kohle ab.«
»Ihr braucht denen ja nicht sagen, dass ich die Post übernommen hab«, mischte sich das störrische Weib ein. »Ich bring die Briefe bis zur nächsten Station und ihr seid wieder im Rennen.«
»Wenn aber was schiefgehn tut, sin wir geliefert.« Sam zog mit zwei Fingern den Revolver zu sich heran. Damit wankte er zur hinteren Wand. Blitzschnell drehte er sich um und drückte mehrmals ab. Jacques ließ sich zu Boden fallen. Das Weib kreischte auf – oder war das Williams? Von der Decke rieselte Staub auf die Dosen, die alle noch fein säuberlich auf dem Brett standen.
»Dad!« Vorwurfsvoll starrte Sams Sohn seinen Vater an.
»Verdammmich!«, fluchte Sam. »Diese dummn Bohnn sin schnnneller wie man denkt.«
»Lasss mich ma rannn.« Ungeduldig zog ihm Williams den Revolver aus der Hand, hielt ihn dicht vor das rechte Auge, zwickte das linke zu und zielte angestrengt. Das nahm mehrere Minuten in Anspruch. Dann drückte er ab. Die erste Dose wackelte und fiel um.
»Ha! Isch binder Beschte!« Williams riss die Arme nach oben.
Ein weiterer Schuss krachte, Staub rieselte und er ließ sie etwas bedröppelt wieder sinken. Das störrische Weib grinste.
»Mach‘s ers ma besser«, grummelte Williams und drückte ihr den Revolver in die Hand.
Dieses Mal ließ sie sich Zeit. In ihre Augen trat eine tödliche Entschlossenheit, bevor sie ohne weiteres Zögern fünf Mal abdrückte. Das Brett war leergefegt. Jetzt konnte nur noch Jacques die komplette Blamage des Pony-Express verhindern. Williams Augen flackerten zu ihm, trafen seine für den Bruchteil einer Sekunde, sahen auf seine Füße. Dann packte Williams die Hand des Mädchens und riss sie in die Höhe.
»Wir ham ne Meisterschützin su Gast. Sam, schenk deinn bestn Whiskey ausss! Das müssn wir feiern.«
Jacques ließ die Schultern sinken. Ihm war klar, was hier gespielt wurde. Lieber ließ sich Williams von einem Weib schlagen als von einem Indianer.
Während die Männer einen Drink nach dem anderen kippten und dabei immer kindischer wurden, zog sich Jacques mit einer halbvollen Flasche auf die Pritsche zurück und beobachtete das störrische Weib. Immer noch lachte sie mit den Männern und nippte hin und wieder an ihrem Glas. Als Williams unter den Tisch sank und Sam schnarchend sein Glas umklammerte, unternahm Jacques nichts, als das Weib mit den Flammenlocken lautlos ihren Stuhl zurückschob, nach der Posttasche griff und draußen vom Sturm verschluckt wurde.
2. KAPITEL
Die Türe fiel hinter Mathilda ins Schloss. Ihre Knie zitterten trunken vor Erleichterung, Whiskey und Schock. Wo war der Stall? Ihr Kopf drehte sich. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Für einen endlosen Moment hatte es so ausgesehen, als wäre der Brief hier in der Mitte vom Nirgendwo gestrandet. Und dann der Indianer. Niemals hätte sie gedacht, dass sie nach all der Zeit noch so heftig reagieren würde. Doch sein Anblick hatte gereicht, um sie zurückzuversetzen – in den Kamin – in der Blockhütte – mitten im Wald. Sie war acht Jahre alt: stemmte sich mit Knien und Händen in die spitzen Steine des Rauchabzugs; konnte sich die bemalten Gesichter der Wilden nur noch vorstellen; hörte die Schreie ihrer Mutter und des Babys – und dann plötzlich Stille. Diese grausame Stille.
Langsam tröpfelte in ihr Bewusstsein, dass ihr die Haare am Kopf klebten. Kalte Bäche rannen über ihr erhitztes Gesicht und in den Kragen. Mit einer unbeholfenen Geste zog sie sich die Kapuze wieder in die Stirn. Sie stutzte. Vor ihr lag, gehüllt in einen dunkelgrauen Schleier, der rechteckige Exerzierplatz. Am Rand wiegten mächtige Pappeln ihre blattlosen Äste im Wind. Hier war definitiv kein Stall. Mathilda drehte schwungvoll auf dem Absatz um; verlor kurz das Gleichgewicht; fing sich wieder.
»Hups.«
Da lag ja die Blockhütte und daneben – nicht zu verfehlen – der kleine Unterstand für die Pferde. Sie umrundete ein paar Pfützen und schlüpfte ins Innere. Drei Pferde warteten angebunden auf ihren Einsatz, daneben hingen Sättel und Zaumzeug. Mathilda beeilte sich, einen schwarzen Hengst zu satteln. Er stampfte auf der Stelle und wich mit dem Hinterlauf aus, als sie sich näherte. Damit er nicht stieg und die Posttasche abwarf, musste sie sich mit ihrem ganzen Gewicht an den Strick hängen, bis er sich beruhigt hatte. Endlich hatte sie den Hengst durch das Tor bugsiert und schwang sich auf seinen Rücken. Noch immer färbte der Regen die ohnehin nicht besonders abwechslungsreiche Landschaft grau. Immerhin hatte er im Laufe des Morgens ein wenig nachgelassen. Mathilda war froh, dass der Pfad dem Platte-Fluss folgte, denn hier in der weiten Ebene war es ohne Sonne schwer, die richtige Richtung zu bestimmen. Außerdem schwankte die Welt immer noch in sanften Wellen unter ihr. Fünfundsiebzig Meilen und Pferdewechsel an drei Stationen lagen vor ihr, bis sie irgendwann in der Nacht das nächste Quartier erreichte. Dort wartete hoffentlich wieder ein Reiter darauf, die Post zu übernehmen. Und sie bekam endlich eine Mütze Schlaf und etwas Anständiges zu essen.
Obwohl der Weg schlammig war und der Rappe immer wieder wegrutschte, kam Mathilda gut voran. Anfangs hielt sie noch Ausschau nach indianischen Kriegern, gab es jedoch bald auf. Im Platzregen sah und hörte sie nur die Hufe ihres eigenen Pferdes. Gegen Mittag ließ der Regen nach. Hemd und Mantel klebten an ihrer Haut. Im Reiten zog sie sich den rechten Stiefel aus und kippte das trübe Wasser weg, das sich darin gesammelt hatte. Genauso beim linken. Danach band sie sich den Rock nach oben, sodass unter ihrem Mantel nur die Hose hervorlugte, die sie für solche Gelegenheiten immer darunter trug. Die Locken schob sie unter die Kapuze. Zwar hatte sie kein Problem damit, als Frau aufzutreten, doch wenn möglich ging sie Konflikten lieber aus dem Weg. Eigentlich hätte sie hungrig sein müssen, stattdessen setzte sich ein flaues Gefühl in ihrem Magen und ein Geschmack nach rostigem Eisen im Mund fest. Es war das erste Mal, dass ihr vom Schaukeln im Sattel so schlecht wurde, dass sie sich am liebsten in die erstbeste Pfütze gelegt hätte, um sich darin zu ertränken. Doch das war keine Option.
Nach drei Stunden wurde der Hengst müde und versuchte ein ums andere Mal, eigenmächtig das Tempo zu drosseln. Mathilda musste immer listiger werden, damit er nicht langsamer wurde. Endlich erblickte sie eine schiefe Hütte neben dem Pfad. Davor stand ein kleiner Mann mit einem gesattelten Pferd am Zügel. Kurz darauf drang schon sein Gezeter zu ihr durch: »… bodenlose Dreistigkeit! Seit vier Stunden stehe ich im Regen! Bei dem Tempo kommt die Post erst im Frühjahr nach Kalifornien. Vorher sind wir bankrott! Was trödelst du rum, Bengel?«
Sie hatte den durchweichten Mann erreicht. Während er weiterschimpfte, glitt sie aus dem Sattel und schwang sich mit der Posttasche über der Schulter auf den stämmigen Fuchs.
»Wenn das noch mal passiert, bin ich weg! Moment – wo ist denn der Kleine, der sonst kommt? Dich kenne ich nicht!«
Im letzten Moment klammerte er sich an den Zügel und ließ auch nicht los, als Mathilda das Pferd antrieb, das prompt buckelte und mit den Hinterläufen ausschlug. Sie rutschte rechts vom Pferderücken. Schock durchzuckte sie. Reflexartig klammerte sie sich mit Schenkeln und Fingern fest. Dank ihres Zustands wäre sie tatsächlich um ein Haar abgeworfen worden.
»Ich bin der Ersatz«, knurrte sie ungeduldig.
»Verflucht – du bist ja ein Mädchen!«
Das Herz sank ihr in den Magen. Unmöglich konnte sie die Situation jetzt mit dem Kerl diskutieren. Sie verlor nur weiter wertvolle Zeit.
Entschlossen griff sie mit beiden Händen nach seinen; versuchte die Finger aufzubiegen. Doch er gab sich nicht geschlagen. Minutenlang kämpften sie um die Vorherrschaft über die Zügel, dann senkte Mathilda den Kopf und biss zu. Mit einem Schrei riss der kleine Mann die Hände zurück. Mehr brauchte sie nicht. Bevor er sich gefasst hatte, galoppierte sie bereits den Hügel hinter der Hütte hinauf. Ein Knall in ihrem Rücken ließ sie zusammenzucken. Sofort schmiegte sie sich an den Pferdehals und feuerte den Fuchs weiter an. Der Verrückte schoss tatsächlich auf sie! Noch ein Satz, dann war sie über der Kuppe und aus der Schussbahn. Angespannt wartete sie auf den nächsten Knall. Dann hatte sie den höchsten Punkt überwunden und atmete aus. Erst jetzt schmeckte sie die Mischung aus Blut, Rauch, Schweiß und Pferdeäpfeln auf der Zunge und spuckte angeekelt aus. Doch der Geschmack und die Erinnerung an die dreckige Hand blieben. Ein Würgekrampf drückte ihren Mageninhalt den Hals hinauf. Gerade noch rechtzeitig konnte sie aus dem Sattel gleiten, bevor sich ihr Magen schmerzhaft in einer sauren Suppe entleerte. Vornüber gebeugt wartete sie, bis das Würgen nachließ.
Danach ging es ihr besser. Irgendwann hörte sogar der Regen auf. Ihr Mantel flatterte im Gegenwind und begann zu trocknen. Allmählich tat sich in der Gegend ihres Bauchs ein Loch auf, das mit jeder Stunde tiefer wurde. Ihren letzten Proviant hatte sie am Planwagen noch weit vor Fort Kearny verzehrt. Doch statt noch in ihrem Magen war dieser jetzt auf der Prärie verteilt. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als ein Stück Leder vom Zügel abzuschneiden und darauf herumzukauen. Nicht gerade besonders lecker, aber ausreichend, um ihren Magen vorläufig zu überlisten.
Vor dem nächsten Pferdewechsel ging Mathilda noch sorgfältiger vor. Sie kontrollierte, ob ihr Rock verrutscht war und zog sich die Kapuze wieder über die Haare. Der Mann an der nächsten Station wartete ebenfalls mit einem frischen Pferd am Zügel, war aber weit weniger gesprächig als der letzte, obwohl auch er bereits seit Stunden hier stehen musste. Genau genommen sprach er überhaupt nicht. Entweder bemerkte er nicht, dass er einen neuen Reiter vor sich hatte, oder es war ihm egal. Sein Gesicht war so vernarbt, dass es unmöglich war, irgendwelche Emotionen darin zu lesen.
Schon wollte Mathilda das neue Pferd antraben lassen, da hielt sie ein sanfter Druck am Schienbein zurück. Hatte er ihre Maskerade doch noch durchschaut? Aber er streckte ihr nur einen kleinen Beutel hin. Dann drehte er sich um, um in seiner Behausung zu verschwinden. Diese bestand im Wesentlichen aus einer Aushöhlung im Hügel, die lediglich mit ein paar bemoosten Brettern abgedeckt war.
Der braune Wallach hatte einen sanften Trab, trotzdem traf sie nach endlosen Stunden im Sattel jeder Tritt schmerzhaft im Hinterteil. Auch ihre Schenkel und Schultern waren so verspannt, dass sich Mathilda nicht sicher war, wie sie heute Nacht gerade im Bett liegen sollte. Um sich abzulenken, öffnete sie den Beutel. Eine Träne stahl sich in ihren Augenwinkel, als sie den Duft wahrnahm und ein Stück geräuchertes Fleisch und zwei Fladen Maisbrot entdeckte. Vorsichtig, um sich im Trab nicht auf die Zunge zu beißen, riss sie mit den Zähnen ein Stück Brot ab. Dann ließ sie es langsam im Mund aufweichen, bis es ganz süß wurde. Erst danach schluckte sie den Brei hinunter. Und das Fleisch! Es verhielt sich zum Zügel wie Whiskey zu Pferdepisse.
Mit jedem Biss ritt Mathilda weiter in die Wildnis, weg von der Zivilisation. Bis jetzt hatte sie angenommen, nicht besonders an Menschen im Allgemeinen zu hängen. Letztlich hatte jeder nur seine eigenen Interessen im Kopf. Doch je weiter sie in die Prärie vordrang, desto unsicherer fühlte sie sich. Hier draußen war sie völlig auf sich allein gestellt. Jeder Hagelsturm, jede Büffelherde, jedes Loch im Boden konnte ihr zum Verhängnis werden. Es gab kein festes Haus, in dem sie einen Unterstand finden konnte, kein Geschäft mit Lebensmitteln. Nie hatte sie sich so intensiv nach dem Anblick eines menschlichen Gesichts gesehnt – wenn auch im besten Fall kein indianisches. Wussten die Wilden, dass sie hier war? Wurde sie von ihren Spähern beobachtet? Gänsehaut spross in ihrem Nacken. Ihre Schultern verkrampften sich noch mehr. Warteten sie nur auf einen günstigen Moment, sie aus dem Hinterhalt zu erschießen? Oder darauf, sie lebendig zu fangen, um sie dann über einem Feuer zu Tode zu foltern?
Mathilda trieb den Braunen an. Weit konnte es nicht mehr sein bis zur nächsten Wechselstation. Mittlerweile fürchtete sie sich nicht mehr vor einer Auseinandersetzung mit einem Stationsleiter. Hauptsache, sie war nicht mehr das einzige zivilisierte Wesen in dieser unendlichen, kargen Einöde.
Allmählich setzte die Dämmerung ein. Mathilda befürchtete schon, die letzte Station verpasst zu haben, als sie den Umriss einer Hütte am Wegrand ausmachte. Diesmal wartete niemand auf sie und durch das Fenster drang auch kein Licht nach außen. Ohne ein Geräusch glitt sie von ihrem Pferd. Jeder einzelne Muskel in ihrem Körper schmerzte. Die ersten Schritte waren grausam. Sie lief gebeugt, mit nach außen gedrehten Knien. Nur ganz langsam wurde es besser. Um die Hütte war nichts als vertrocknetes Gebüsch und knöcheltiefer Schlamm. Vor der Tür entdeckte sie Hufspuren, die vom Haus wegführten. Wasser hatte sich in den Vertiefungen gesammelt. Ob sie von heute stammten oder schon älter waren, konnte Mathilda nicht unterscheiden; jedenfalls war das Haus leer und die Asche im Ofen kalt. Wo war der Stationsleiter? Hatte er seinen Posten für immer verlassen oder war er nur auf der Jagd? Hatte er die Einsamkeit hier draußen nicht ertragen oder war er vertrieben worden? Hatten die Indianer ihn geholt? Mathilda schauderte.
Hier zu warten, war nur Zeitverschwendung. Sie musste weiter, ungeachtet der Müdigkeit ihres Pferdes. Mathilda führte den Braunen hinunter zum Fluss. Beide beugten sich zum Wasser und tranken durstig. Danach füllte Mathilda ihre Feldflasche. Viele Meilen lagen noch vor ihr bis zum Quartier. Sie machte nicht den Fehler, im selben Tempo weiterzureiten, auch wenn der Vollmond immerhin ein wenig Licht spendete. Wenn der Braune sich am holprigen Pfad ein Bein brach, war sie verloren.
Es war noch nicht spät am Abend – im Sommer wäre es noch lange hell gewesen – trotzdem spürte Mathilda, wie Müdigkeit durch ihre kalten Stiefel in ihre Beine kroch, sich in der Hüfte einnistete, die Wangen betäubte und ihr die Augen zuklappte. Sie zuckte zusammen. Ja, der Tag war lang gewesen. Die Auseinandersetzungen und der Ritt hatten Kraft gekostet. Trotzdem musste sie noch ein wenig länger durchhalten – und beten, dass das Quartier nicht auch verlassen war. Dass dort freundliche Menschen mit warmem Essen auf sie warteten. Dass der nächste Reiter bereitstand, ihren Brief weiterzutragen. Dass sie dort ankam, bevor die Indianer sie fanden.
Die Stunden zogen sich endlos in die Länge. Jetzt rächte sich, dass Mathildas Kleider nicht vollständig getrocknet waren. Kälte setzte sich in ihnen fest, und obwohl sie mit ihren Fingern und Zehen wackelte, klapperten ihre Zähne mit den Hufen um die Wette.
Endlich nahm sie vor sich einen Lichtschein in der Dunkelheit wahr. Für lange Minuten traute sie der Erscheinung nicht, war sicher, dass sie lediglich ihrem Wunschtraum entsprang. Erst als tatsächlich eine Blockhütte aus dem Dunkeln trat, gestattete sie sich aufzuatmen. Sie hatte es geschafft!
Wie schon einmal an diesem Tag drückte Mathilda eine schwere Holztüre auf. Die Einrichtung war dem Quartier im Fort ganz ähnlich, bis auf die Fässer und Felle in eine Ecke, die darauf hinwiesen, dass dieses Quartier zusätzlich als Handelsposten fungierte. Auch hier saßen Männer beim Poker und starrten sie an wie einen Geist. Für einen Moment fühlte sie sich in einem endlosen Albtraum gefangen, dann trat eine Frau aus dem Schatten und kam mit ausgestreckten Händen auf sie zu.
»Wo kommst du her, Kleine? Komm rein. Hier es gibt was zu essen.«
Mathilda starrte sie an. Was hatte eine Indianerin hier verloren?
»Ich hab die Post dabei«, stotterte sie und hielt die Tasche wie einen Schutzschild vor sich.
»Mon Dieu.«
Ein kleiner Mann mit abstehenden grauen Haaren sprang auf und eilte auf sie zu. Kurz fühlte sich Mathilda an den Indianer von heute Morgen erinnert, was angesichts seiner blassen Haut völlig absurd war.
»Isch bin Bertrand. Das ‘ier ist mein ‘aus. Willkommen!«
18.10.1860, Platte-Quartier (Nebraska)
Lieber Daddy,
ich hab eine gute und zwei schlechte Nachrichten für Dich. Die erste schlechte Nachricht ist, dass der Reiter im Fort Kearny zu krank war, um die Post zu transportieren. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn – und das ist die gute Nachricht – die Herren vom Pony-Express waren sehr nett. Sie haben mir freundlicherweise die ganze Post und ein Pferd überlassen. Ich hab die Etappe also einfach selber gemacht und Dein Brief ist jetzt schon ein gutes Stück weiter im Westen.
Eigentlich ist es ganz schön hier in Nebraska. Es gibt keine lästigen Berge, Bäume oder Menschen. Stundenlang kann man ohne Unterbrechungen einfach geradeaus reiten. Auch gibt es hier quasi kein Wetter. Den ganzen Nachmittag war der Himmel grau. Es hat nicht geregnet, die Sonne hat nicht gescheint und Wind war auch keiner. Sogar wilde Tiere oder Indianer habe ich keine gesehen. Du musst Dir also keine Sorgen machen.
Hier im Quartier bin ich recht gastfreundlich empfangen worden. Ich kann hier übernachten und werde auch sonst gut versorgt. Zumindest, wenn man Bisamratte an Bohnen mag. Naja, die Frau vom Wirt ist halt eine Wilde.
Nachher setz ich mich vielleicht noch zu den anderen Gästen. Da läuft eine Runde Poker, und Whiskey gibt es auch. Nur wie es morgen weitergeht, ist mir noch nicht ganz klar. Das ist nämlich die zweite schlechte Nachricht. Der Reiter für den nächsten Abschnitt hätte schon längst da sein sollen. Ist er aber nicht. Du musst Dir aber keinen Kopf machen, lieber Daddy – irgendwie finde ich schon einen Weg. Zur Not mache ich einfach nochmal eine Etappe.
Lass Dich nicht hängen!
In Liebe,
Mathilda
3. KAPITEL
Müde ließ Mathilda die Feder sinken und schob sich einen Löffel warmen Eintopf in den Mund. Wie nett die ältere Indianerin zu ihr gewesen war, würde sie ihrem Vater nicht schreiben – das würde ihn nur aufregen. Auch nicht von deren erwachsener Tochter, die sofort angeboten hatte, sich draußen um den Braunen zu kümmern. Und ganz sicher nicht von den drei Kerlen, die an der anderen Seite des Tisches saßen und soffen. Gegen diese drei Gestalten waren die Männer von heute Morgen Waisenknaben.
»Die Flasche ist leer, verflucht!«, rief einer von ihnen. »Bring Nachschub, Berty!«
Sofort löste sich der Wirt aus der Ecke, in die er sich mit der älteren Indianerin zurückgezogen hatte, und brachte noch mehr Whiskey an den Tisch. Seine Hand zitterte leicht, als er die Gläser ein weiteres Mal füllte.
»Hast du Angst?«, fragte ein Blonder mit breitem Gesicht. »Wir sind doch bei dir und beschützen dich vor den verfluchten Rothäuten.«
»Ich hab sogar meine Station verlassen, um dir beizustehen«, ereiferte sich ein hagerer Mann.
Als ob, dachte Mathilda. Viel eher hatte der Kerl selbst Schiss bekommen, ganz auf sich allein gestellt da draußen. Immerhin war ihr jetzt klar, was mit dem fehlenden Stationsleiter passiert war.
Der Dritte im Bunde, ein dunkler Typ in schlecht verarbeiteter Pelzkleidung, hieb mit der Faust auf den Tisch. »Letztes Jahr um die Zeit hab ich den alten McAllister gefunden. Am lebendigen Leib skalpiert und von Ameisen abgenagt. Erkannt hab ich ihn nur an seinem Goldzahn.«
»Wenn sie kommen, sind wir vorbereitet.« Grinsend deutete der Blonde auf die Flinten, die schussbereit an der Wand lehnten. Zusätzlich trug jeder von ihnen zwei moderne Colt-Revolver am Gürtel.
»Stundenlang hab ich auf den Reiter vom Fort gewartet«, ließ sich wieder der Hagere verlauten. »Als er nicht gekommen ist, war ich sicher, dass er entweder schlau genug war, daheim zu bleiben, oder dass die Wilden ihn geholt haben.«
»So wie die Millers«, grummelte der Pelzträger dunkel. »Sie haben nichts Schlimmeres getan, als ihre Felder zu pflügen. Die Scheusale sind in einer Nacht gekommen wie heute. Haben die Männer aufgeschlitzt wie Mehlsäcke. Die Frauen und Mädchen hatten nicht so viel Glück. Die haben sie davor der Reihe nach rangenommen.«
Die Männer starrten alle zu Mathilda herüber. In ihren glitzernden Blicken lag kein bisschen Mitleid mit den Millers. Mathilda spürte, wie sich die Haare auf ihren Armen aufstellten. Wie sollte sie in diesem Haus schlafen, solange die Kerle hier herumlungerten? Trotzdem hatte sie Mühe, die Augen offen zu halten.
In diesem Moment ging die Tür auf und die jüngere Indianerin schlüpfte herein, die Augen angstvoll aufgerissen.
»Willys Pferd ist vor dem Stall aufgetaucht«, flüsterte sie. »Die Posttasche hängt noch am Sattel – aber Willy ist nicht da.«
Mit einem spitzen Schrei presste sich die ältere Indianerin die Hand auf den Mund.
»Diese verfluchten Wilden«, brüllte der Pelzträger und sprang auf.
Alle drei zogen ihre Revolver und stürmten nach draußen. Mathilda stand vom Tisch auf, zog sich in den Schatten zurück und lehnte sich, die Arme schützend vor der Brust verschränkt, gegen die Wand. Eigentlich ging sie das alles nichts an. Doch wenn der Reiter verschwunden war, war der Brief ein weiteres Mal in einer Sackgasse. Wenn der Junge bis morgen früh nicht auftauchte, würde ihr nichts anderes übrigbleiben, als auch die nächste Etappe zu übernehmen. Vorher musste sie wenigstens ein paar Stunden schlafen. Aber hatte sie überhaupt eine Chance, wenn da draußen Indianer lauerten, die jeden Reiter aus dem Hinterhalt mit Pfeilen durchbohrten?
Nicht lange, da stampften die Männer wieder herein. Wut strömte mit ihnen in den Raum.
»Die Indianer haben ihn ermordet!« Der Blonde packte sich ein Regal und riss es um. Töpfe, Pfannen und Schüsseln polterten zu Boden.
Mathilda zog sich noch ein wenig weiter in den unbeleuchteten Teil der Hütte zurück. Das roch nach Ärger!
»Bitte nicht.« Die ältere Indianerin hob ihre gefalteten Hände flehend und tat einen Schritt nach vorne.
»Wahrscheinlich steckst du dreckiges Indianerweib mit diesen Bastarden unter einer Decke.« Der Hagere trat ihr entgegen und verpasste ihr eine derartige Ohrfeige, dass sie an die Wand geschleudert wurde.
Mathilda schloss kurz die Augen. Das alles ging sie nichts an. Ganz sicher würde sie sich nicht für eine Indianerin zur Zielscheibe mache – auch wenn die Wirtin ihr zu essen gegeben hatte und nichts anderes als freundlich zu ihr gewesen war.
Der Hagere folgte seinem Opfer. Gerade als er zu einem Tritt ausholte, trat der Hüttenwirt mit seiner Flinte im Anschlag aus dem Schatten.
»Monsieur, lassen Sie sie in Ruh«, zischte er.
Der Blonde grinste gemein, stellte sich neben seinen Kameraden und richtete die Revolver in beiden Händen auf den älteren Mann. »Sonst was? Nimmst du es mit uns allen auf? Lässt du dich für deine Squaw abknallen?«
Der Flintenlauf des Wirts tanzte nervös zum Blonden und zurück zum Hageren. Plötzlich kreischte die jüngere Indianerin auf und schlug nach dem Pelzträger, der sich ihr von der Seite genähert hatte.
»Ruhig, mein Täubchen. Wir wollen doch nur ein bisschen Spaß haben miteinander.«
»Lassen Sie meine Tochter in Frieden!« Jetzt zeigte die Flinte des Wirts auf den neuen Angreifer. Unruhig zuckten seine Augen zwischen den dreien hin und her.
»Was ist los, Maman?«, drang eine feine Stimme aus der Richtung der Pritsche im hintersten Eck. Kurz drauf tapste ein etwa achtjähriges Mädchen im Nachtgewand aus dem Schatten auf die junge Indianerin zu.
Mathildas Herz verpasste einen Schlag. Wo kam das Kind her?
»Die ist mir auch recht.« Der Pelzträger grinste wölfisch, packte sich das Kind und klemmte es zwischen sich und der Wand ein.
Das Mädchen zappelte, doch seine wütenden Schreie beeindruckten den groben Kerl nicht im Mindestens. Er drückte ihr seine feuchten Lippen auf den bloßen Hals. Mit einem Schrei sprang ihre Mutter auf seinen bepelzten Rücken. Dass sie ein Messer in der Hand hielt, sah Mathilda erst, als der Mann sich nach hinten fallen ließ und die junge Frau unter sich begrub. Währenddessen rappelte sich die ältere Indianerin auf die Füße. Wieder holte der Hagere mit dem Stiefel aus.
»Bleib im Dreck, wo du hingehörst, du Schlampe!«
Diesmal traf er sie direkt zwischen die Rippen. Stöhnend brach sie zusammen. Ein hellrotes Rinnsal lief aus ihrem Mund. Mathilda schnappte nach Luft und tastete nach der Waffe in ihrem Stiefel. Doch der Wirt war schneller. Fast so schnell wie der Blonde. Zwei Schüsse krachten. Der Wirt sank leblos zu Boden, während der Hagere nach seiner eigenen Brust tastete. Als er seine Hand zurückzog, klebte Blut daran. Er schrie auf, stürzte sich auf den Wirt am Boden und umklammerte dessen Kehle.
Der Blonde überließ die beiden ihrem Schicksal und richtete seinen Revolver jetzt auf den Kampf zwischen dem Pelzträger und der jungen Indianerin. Wollte er seinen Freund nicht verletzen, konnte er jedoch noch nicht abdrücken.
Mathildas Blick suchte wieder nach dem Kind. Das Kind, das zwar braun war und die Haare in schwarzen Zöpfen trug, aber genauso unschuldig war wie sie damals, als sie ihre Mutter verloren hatte. Die Kleine wich nicht etwa zurück und versteckte sich, sondern sprang auf den Pelzträger zu, der mit ihrer Mutter um das Messer rang, und schlug mit winzigen Fäusten auf seinen Rücken ein. Tatsächlich gelang es der Kleinen, den Koloss solange abzulenken, bis ihre Mutter den Arm frei bekam. Diese zögerte nicht. Mit einer einzigen Bewegung schnitt sie dem Angreifer die Kehle durch. Damit hatte der Blonde freie Schussbahn.
»Nein!«, schrie Mathilda und erschrak selbst über die Panik in ihrer Stimme. Die Hand mit dem Revolver zitterte so sehr wie noch nie in ihrem Leben.
Doch der Blonde drehte sich nicht einmal zu ihr um, sondern visierte mit unbarmherzigem Auge sein Ziel und drückte ab. Der Schuss donnerte. Auf der Stirn der jungen Frau erschien ein blutiges Loch. Sie kippte zur Seite. Danach schwenkte der Schütze den Lauf in Richtung des Kindes. Mathilda zögerte keine Sekunde länger; atmete aus; drückte ebenfalls ab. Doch der Winkel war schlecht. Und ihre Schusshand zitterte immer noch, sodass sie den Kerl nur an der rechten Schulter erwischte. Er brüllte auf; drehte sich jetzt doch zu ihr um. Die linke Hand mit dem zweiten Colt hielt er ausgestreckt in ihre Richtung, die rechte hing nutzlos herab. Endlich hatte sie seine Brust voll im Schussfeld. Mathilda griff mit der zweiten Hand an den Revolver, stabilisierte ihn, visierte, zog ab. Der Schuss krachte und die Welt um sie explodierte. Vom eigenen Rückstoß und der Kugel des Blonden gleichzeitig getroffen, wurde Mathilda nach hinten gegen die Wand geschleudert. Als sie hilflos an den rauen Brettern hinunterrutschte, das Leben aus ihr hinauslief und es immer dunkler wurde um sie, sah sie, wie sich das kleine Gesicht des Mädchens über sie beugte, und sie bereute nichts.
Tut mir leid, Daddy, war ihr letzter Gedanke, bevor alles um sie schwarz wurde.
4. KAPITEL
Obwohl Jacques bereits um Mitternacht aufgebrochen war, kam der Handelsposten seiner Eltern erst kurz vor der Abenddämmerung in Sicht. Im Gegensatz zu den Postreitern hatte er nicht das Privileg, sein müdes Pferd gegen ein frischeres zu tauschen, konnte deshalb nur kurze Strecken galoppieren und war gezwungen, immer wieder Pausen einzulegen. Entsprechend spürte er jetzt die Müdigkeit in allen Knochen und freute sich darauf, von seiner Mutter verwöhnt zu werden.
Jacques stutzte. Irgendetwas störte das idyllische Bild. Kein Lichtschein erhellte die Fenster. Kein Rauch quoll aus dem Kamin. Sein Herz krampfte sich zusammen und er drückte seinem Pferd die Fersen in die Seite. Noch im Galopp sprang er vor dem Haus ab. Den Revolver im Anschlag trat er die Tür auf. Ein Schwall aus kaltem Rauch, Whiskey und Bohneneintopf traf ihn. Drinnen war es finster und totenstill. In diesem Haus war es nie still. Immer waren irgendwelche Reiter, Fallensteller oder Farmer da, die sich bekochen ließen, ihren Whiskey schlürften und Waren tauschten.
Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Finsternis und er registrierte die Zerstörung. Ein umgekipptes Regal versperrte den Weg. Töpfe und Pfannen lagen zu seinen Füßen. Und leblose Körper. Überall lagen leblose Körper. Ein Paar blicklose Augen starrten ihn an. Jacques zuckte zurück. Jetzt roch er auch den Pulverdampf und das Blut. Würgend stolperte er ins Freie und übergab sich.
Es kostete ihn einige Anstrengung, das Haus ein zweites Mal zu betreten, doch die Sorge um seine Familie trieb ihn vorwärts. War noch jemand am Leben? Er ließ die Türe weit geöffnet und suchte sich im Halbdunkeln einen Weg zum Kamin, immer darauf bedacht, nicht auf einen Arm oder ein Bein zu treten. Jacques zwang sich dazu, sich auf die nächsten Schritte zu konzentrieren. Zuerst das Feuer entfachen. Das Feuerzeug lag wie immer fein säuberlich aufgeräumt neben den Spänen. Dann die Laterne anzünden. Dann die Toten zählen. Es waren sieben. Sieben Erwachsene. Wo war Marie? Dann die Leichen der Reihe nach untersuchen. Ein Unbekannter lag mit aufgeschlitzter Kehle da. Darunter begraben, das Messer noch umklammert, Jacques’ große Schwester. Er erkannte sie an ihrem Kleid mit den roten Mohnblumen, das er ihr von seinem ersten Gehalt gekauft hatte.
Entsetzen klammerte seine Kehle zu und trocknete seine Augen aus. Der Leiter einer der Stationen zwischen hier und dem Fort hatte eine Kugel in der Brust. Genauso wie ein Fallensteller, der seit Jahren bei ihnen seine Felle verkaufte. Und wie Jacques Vater. Auch seine Mutter fand er. Sie hatte keine äußeren Verletzungen, doch getrocknetes Blut klebte an ihren Lippen und die Augen waren gebrochen. Der letzte Körper hing halb zusammengesunken an der Wand. Jacques stieß ihn mit dem Fuß an und er rutschte noch ein Stück weiter hinunter. Ein leises Stöhnen ließ seine Eingeweide einfrieren. Zögernd hielt er die Laterne über das Gesicht, erkannte die roten Locken und sein Herz stockte für einen kurzen Moment. Was tat sie hier? Steckte sie mit der Bande unter einer Decke? Was tat ein Mädchen überhaupt ganz allein hier an der wilden Grenze? Noch dazu eines, das so schießen konnte wie sie?
Hatten sie es auf die Post abgesehen? Wenn er das Weib gestern nicht hätte laufen lassen, wären seine Eltern und seine Schwester dann heute vielleicht noch am Leben? Jacques biss sich auf die Unterlippe, um nicht hier und jetzt anzufangen zu schreien und nie mehr damit aufzuhören. Sein Innerstes war leer. Seine Familie gewaltsam daraus herausgerissen. Ohne sie war er nichts. Hatte keinen Platz im Leben. Kein Ziel. Mit bebender Hand hob er den Revolver und visierte den Kopf des Weibes an.
»Nicht«, erklang eine dünne Stimme hinter ihm. Jacques zuckte herum. Sein Revolver fiel polternd zu Boden.
»Marie!« Er ging in die Hocke und breitete die Arme aus.
Das kleine Mädchen flog in seine Umarmung; vergrub ihr Gesicht an seiner Schulter; zitterte am ganzen Körper.
»Du bist hier«, flüsterte sie. Dann fing sie erst leise an zu weinen, dann immer lauter. Schluchzer, die aus tiefster Seele kamen, schüttelten ihren schmächtigen Körper. Was hatte das kleine Mädchen mitansehen müssen? Eine Träne lief über seine Wange. Er würde diese rothaarige Hexe zerquetschen.
»Die Frau hat uns geholfen«, sagte Marie schließlich leise und brachte seine Wut zum Einsturz. Was war hier passiert?
»Waren da noch mehr Männer?«, fragte er vorsichtig.
Die Kleine schüttelte den Kopf und vergrub sich wieder an seinem Hals. Endlos lang knieten sie ineinander verschlungen am Boden, bis sich Marie ein Stück löste.
»Kannst du mal nach der Frau sehen? Ich hab sie zwar verbunden, aber da war so viel Blut.«
Das störrische Weib war immer noch bewusstlos. Während Marie ihm über die Schulter blickte, untersuchte Jacques sie. Wie es aussah, hatte sie sich über dem linken Beckenknochen eine Kugel eingefangen. Das Schultertuch, das ihr Marie um die Hüfte geknotet hatte, war blutdurchtränkt, doch mittlerweile hatte die Blutung aufgehört.
»Das hast du gut gemacht, Chérie.« Er tastete am Rücken nach der Austrittswunde. »Merde! Die Kugel steckt noch in ihr. Holst du mir bitte die Kohlenzange, Nähzeug und Whiskey?«
Ohne zu fragen, sauste das Mädchen los, während Jacques möglichst behutsam den provisorischen Verband abwickelte. Doch der Stoff war so verkrustet, dass er nicht umhin konnte, fest daran zu ziehen, auch wenn damit die Wunde wieder aufbrach und erneut anfing zu bluten. Die Verletzte stöhnte auf. Ihre Lider flatterten. Zuerst schwirrte ihr Blick haltlos umher, dann heftete er sich auf Jacques und ihre Augen weiteten sich. Darin stand nicht Verwunderung oder Angst, sondern blanker Horror.
»Nein«, murmelte sie. »Nein. Nein. Nein.«
Trotz ihres zerstörten Zustands kroch sie von ihm weg.
»Es ist gut«, versuchte er, sie zu beruhigen. »Keiner tut Ihnen was.«
Wobei alles in seinem Inneren schrie: Nichts ist gut. Meine Eltern sind ermordet worden. Nichts wird jemals wieder gut werden!
»Bleiben Sie, wo Sie sind.« Abwehrend hob das Weib mit den Flammenlocken das Kinn.
»Sie sind der Indianer aus dem Fort«, stellte sie schwach fest. »Gehören Sie zu den Wilden, die Willy erschossen haben?«
Jacques zuckte zusammen. »Willy ist auch tot?«
Er kannte den Jungen gut. Dessen Eltern waren vor drei Jahren bei dem Versuch gestorben, über den Oregon-Trail nach Westen zu gelangen. Irgendeine Seuche hatte fast den gesamten Wagenzug ausgelöscht. Damals war Willy erst zwölf Jahre alt gewesen und Jacques Mutter hatte ihn bei sich aufgenommen, bis er angefangen hatte, für den Pony-Express zu reiten.
»Zumindest ist sein Pferd ohne Reiter zurückgekommen. Die Männer haben behauptet, die Indianer sind auf Kriegszug. Sie waren so wütend. Sind auf die Indianerin und ihre Tochter los. Haben gesagt, sie stecken da mit drin.«
»Merde. Alle Stämme der Prärie sind gerade damit beschäftigt Büffel zu jagen. Kriegszüge sind ein Geschäft für den Sommer. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, reite ich los und suche den Jungen.«
Jacques biss wütend die Zähne zusammen. Wieder einmal hatten die Weißen aus Angst und Unverständnis die falschen Schlussfolgerungen gezogen.
»Heißt das, Sie bringen mich jetzt nicht um?«, fragte sie.
Er schmunzelte ungewollt. »Wenn Sie mich lassen, rette ich sogar Ihr Leben.«
Skeptisch nickte sie und schloss erschöpft die Augen. Inzwischen kam Marie mit allem zurück, worum er sie gebeten hatte.
»Ich weiß, dass du tapfer bist, Chérie, aber das wird jetzt ziemlich hässlich. Wenn du nicht dabei sein willst, ist das in Ordnung. Allerdings könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen.«
»Ich helfe dir.« Marie sah nicht auf, sondern begann, die Gegenstände am Boden anzuordnen.
»Dann brauche ich als Erstes den Whiskey.«
Das Kind gab ihm die Flasche und er reichte sie an die Verletzte weiter.
»Trinken Sie.«
Erst dachte er, sie wäre stur genug, den Betäubungstrank abzulehnen, doch dann sah er, dass ihre Hand zuckte und ihr schlichtweg die Kraft fehlte, sie zu heben. Also kniete er sich neben sie und flößte ihr Schluck um Schluck der braunen Flüssigkeit ein.
»Marie, kannst du bitte die Kohlenzange in die Laterne halten, bis sie glüht?«
Wieder gehorchte das Kind, ohne Fragen zu stellen. Einen weiteren Schluck Whiskey schüttete Jacques über das Einschussloch und seine eigene Hand. Das störrische Weib krampfte zusammen. Ihre Zähne waren fest aufeinander gepresst. Als Jacques zwei Finger in die Wunde steckte, um nach der Kugel zu fischen, sog sie scharf die Luft ein. Doch er hatte keine Wahl. Solange das Blei in ihr steckte, würde die Wunde immer wieder eitern und ihr Blut vergiften. Weiter und weiter tastete er sich vor, bis er endlich einen harten Gegenstand fühlte. Die Kugel war glitschig, rutschte ihm jedes Mal wieder aus den Fingern, bis er sie endlich zu packen bekam und herauszog.
»Ich hab sie.« Jacques hielt die Kugel hoch, erhielt jedoch keine Antwort. Als er in das zarte Gesicht sah, bemerkte er, dass die Frau ohnmächtig geworden war.
Erleichtert atmete er aus. Es war besser, dass sie nicht spürte, wie er mit dem glühenden Eisen die Wunde ausbrannte, diese mit noch mehr Whiskey desinfizierte und anschließend die zerfetzte Haut in groben Stichen zusammennähte. Marie hätte Letzteres bestimmt besser hinbekommen als er, aber das kleine Mädchen hatte an diesem Tag genug durchgemacht.
»Marie, ich reite jetzt los und suche nach Willy«, sagte Jacques, nachdem die Wunde endlich mit einem frischen Leintuch verbunden war. »Kannst du solange für mich auf die Frau aufpassen?«
Kurz sah es so aus, als würde das Mädchen protestieren, und er hasste sich dafür, sie noch einmal in einem Haus voller Leichen zurückzulassen, schließlich nickte sie aber tapfer.
»Bist du zurück bis zur Nacht?«
»Natürlich, Chérie, wenn es zu dunkel ist, muss ich die Suche so oder so abbrechen.«
Ein letztes Mal umarmte er die Kleine, dann schwang er sich wieder auf sein Pferd und trabte den Pfad entlang Richtung Westen. Das Weib mit den Flammenlocken und dem Herz eines Pumas verbannte er aus seinen Gedanken.
5. KAPITEL
Schleifende Geräusche drangen in Mathildas wirre Träume. Etwas zupfte an ihrem Ärmel. War sie tot und wurde jetzt in ihr Grab gezerrt? Schwer atmend schlug sie die Augen auf. Ein unbekannter Junge starrte sie an.
»Sie müssen etwas essen, Miss. Marie sagt, Sie haben schon zwölf Stunden geschlafen.«
Also war sie doch noch nicht gestorben. »Wer bist du denn?«
»Willy.«
»Dann haben dich die Indianer gar nicht erschossen?«
Verlegen scharrte er mit dem Fuß. »Ich war so müde. Nur einmal kurz hab ich die Augen zugemacht, da hat mein Pferd gescheut und mich abgeworfen. Ich bin den ganzen Tag gelaufen, aber zu Fuß ist man so langsam. Hätte Jacques mich nicht gefunden, hätte ich noch eine Nacht draußen verbringen müssen.
Mathilda griff nach der Schüssel, die er ihr hinhielt. Offensichtlich war der Bohneneintopf noch immer nicht leer. Ihre Hände zitterten von der Anstrengung, den Napf zu halten, und das Loch in ihrer Hüfte brannte wie Feuer, doch wie es aussah, hatte sie das Schlimmste überstanden. Was auch immer dieser Indianer getan hatte – er hatte ihr damit das Leben gerettet.
»Was hab ich verpasst?«
»Wir haben ein Loch ausgehoben und legen die Leichen hinein.«
»Alle kommen in dasselbe Grab?«, fragte sie entsetzt.
»Nur die Männer. Jacques will seine Mutter und Schwester nach indianischer Art zur Ruhe betten.«
»Das waren seine Mutter und seine Schwester?«
Immerhin erklärte das, warum er überhaupt hier war.
»Und sein Vater. Sie waren wirklich nett«, sagte Willy traurig. Mathilda schwieg betroffen. Dieser Mann hatte an einem Tag fast seine gesamte Familie verloren. Wie konnte er damit weiterleben?
»Willy, hilfst du mir hier?«, fragte der schmächtige Indianer von der Tür her und der Junge sprang auf.
Mit neuen Augen beobachtete Mathilda, wie die beiden den Pelzträger hochhoben und nach draußen beförderten. Danach folgten die anderen Leichen der Reihe nach. Der Indianer erteilte ruhig Anweisungen, legte dem kleinen Mädchen die Hand auf die Schulter und schonte sich keine Minute, obwohl Trauer tiefe Falten um seine Mundwinkel gegraben hatte.
Für die Begräbniszeremonie kämpfte sich Mathilda auf die Füße. Es fiel ihr noch immer schwer zu begreifen, wie schnell die Situation gestern eskaliert war. Hätte etwas Ähnliches auch schon im Fort passieren können?
»Was machen Sie denn hier draußen?«, wurde sie nicht gerade freundlich empfangen.
»Es geht mir schon besser.« Mathilda hob stolz das Kinn und der Indianer drehte sich mit hochgezogener Augenbraue weg.
Jetzt, da sie wusste, dass der Wirt sein Vater gewesen war, sah sie die Ähnlichkeit deutlich. Eigentlich kennzeichneten ihn nur seine bronzefarbene Haut und seine schulterlangen Haare als Indianer, ansonsten hätte er ebenso gut ein Weißer sein können.
Das Grab war bereits zugeschaufelt und die Zeremonie nur kurz. Der Indianer überraschte Mathilda ein weiteres Mal, indem er die Bibel aufschlug und einen Psalm vorlas. Dann stellte das kleine Mädchen ein Kreuz auf. Darauf war ein Schild befestigt, auf dem nur ein einziger Name eingeritzt war: Bertrand Roux.
Das Mädchen fing an zu weinen. Ohne zu zögern, nahm der Indianer sie in den Arm. Lautlos liefen auch ihm Tränen über das Gesicht. Mathilda musste sich auf die Lippen beißen, um nicht ebenfalls loszuheulen. Sie hatte diese Menschen kaum gekannt. Doch sie hatten sie aufgenommen, ohne Fragen zu stellen. Dass ihre Leben so grausam beendet worden waren, war nicht gerecht. Was sollte denn aus dem kleinen Mädchen werden ohne seine Mutter?
Nach der Zeremonie wandte sich Mathilda dem Pferdestall zu.
»Was haben Sie vor?« Der Indianer klang nicht gerade begeistert.
»Ich muss die Post zum nächsten Quartier bringen. Wir haben schon zu viel Zeit verloren.«
»Kommt nicht in Frage! Gestern habe ich Sie zusammengeflickt. Wenn Sie sich heute umbringen, war das reine Zeitverschwendung. Halten Sie das!«
Er reichte ihr ein aufgewickeltes Seil und einen gut gefüllten Beutel. Dann drehte er sich um und hob die Leiche seiner Mutter auf, die in eine Decke gehüllt war, während das kleine Mädchen Willy half, ihre eigene Mutter zu tragen. Schweigend zog die kleine Prozession am Haus vorbei in Richtung der Uferböschung. Mathilda blieb nichts anderes übrig, als zu folgen. Bestimmt brauchte er die Gegenstände, die er ihr in die Hand gedrückt hatte.
Die Büsche standen an diesem Flussabschnitt dicht. Wo Mathilda ein Durchkommen niemals für möglich gehalten hätte, fand der Indianer spielend einen Weg. Jetzt im Herbst leuchteten die Blätter in kräftigen Farben. Um sie flötete und zirpte es lautstark mit dem Rauschen des Flusses um die Wette. Es roch feucht nach modrigen Blättern, was in dieser trockenen Gegend ein kleines Wunder war. Mathilda hatte das Gefühl, alle Farben, Geräusche und Gerüche an diesem kühlen, klaren Tag viel intensiver wahrzunehmen als gestern noch. Lag das daran, dass sie dem Tod persönlich ins Auge geblickt hatte? Oder einfach am Gegensatz dieser kleinen Oase zur kargen Prärie?
Plötzlich wichen die Zweige zur Seite und sie standen direkt am Ufer des Platte-Flusses. Der Indianer führte sie am Flusslauf entlang bis zu einer mächtigen Weide im silbergrauen Herbstkleid. Er sah Mathilda in die Augen.
»Können Sie das Seil hierher bringen?«
Zögernd folgte Mathilda seiner Bitte.
»Jetzt binden Sie zwei Schlingen und knoten sie im Abstand von drei Fuß hier am unteren dicken Ast fest.«
Wieder tat sie, was er verlangte, und half ihm dann, in eine Schlinge die Füße der Toten zu platzieren und die andere um ihre Schultern zu legen. Danach zog er seine schweren Lederstiefel aus und kletterte barfuß, geschickt wie ein Eichhörnchen, den Stamm hinauf. Die Seilenden hielt er dabei fest in der Hand. Den Beutel, den Mathilda getragen hatte, hatte er sich über die Schultern gelegt.
Als der Indianer in doppelter Mannshöhe auf einen stabilen Ast gelangte, gab er den Befehl, das Seil vom unteren Ast zu lösen. Schwankend zog er die Tote nach oben. Er nahm sich die Zeit, sie sicher zu befestigen, bevor er auch seine Schwester nach oben hievte und auf einem benachbarten Ast zur Ruhe bettete. Staunend beobachtete Mathilda, wie er aus dem Beutel Pfannen, bunte Haarschleifen, Perlenketten und Pelze zog, die er dann in die Zweige hängte.
»Was tut er da?«, fragte sie das kleine Mädchen.
»Er gibt ihnen ihre Lieblingssachen mit, damit sie es im Jenseits schön haben.«
Sie sah dabei so verloren aus, dass Mathilda nicht anders konnte, als sie in den Arm zu nehmen. Zuerst stand Marie steif da, dann ergab sie sich in die Umarmung und schmiegte sich an Mathildas Seite. Wärme, die von dem kleinen, verletzlichen Körper ausging, breitete sich an ihrer Hüfte und rund um ihr Herz aus.
Gemeinsam beobachteten sie, wie der Indianer sein Gesicht mit Asche schwarz malte, ein Rauchopfer aus Tabak darbot und sich dann auf einem Ast niederließ. Mathildas Beine fingen an zu zittern, und sie setzte sich auf einen großen Stein.
Das kleine Mädchen kuschelte sich in ihren Schoß. Während sie beobachteten, wie der Indianer auf dem Baum saß und Willy flache Steine über den Fluss hüpfen ließ, fielen ihnen beiden bald die Augen zu.
Sonnenstrahlen kitzelten Mathilda in der Nase und sie schlug die Augen auf. Das Kind ruhte noch immer in ihrem Schoß, von Willy war keine Spur zu sehen und auf einem Stein ganz in der Nähe saß der Indianer und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen.
»An was glauben Sie?«, fragte sie verschlafen und biss sich gleich darauf auf die Zunge. Manchmal wäre es wirklich besser, die Worte zu sieben, bevor sie auf ihrer Zunge landeten.
Fragend sah er sie an.
»Sie haben Ihren Vater in der Erde bestattet und Ihre Mutter und Schwester auf einem Baum.«
»Ich glaube an die Harmonie. An die Harmonie zwischen den Menschen, wie sie Christus gelehrt hat, und an die Harmonie zwischen allen Lebewesen, nach der das Volk meines Großvaters lebt. Danach versuche ich zu streben, wenn es auch manchmal schwer ist. An was glauben Sie, Miss?«
Mathilda schwieg lange und dachte nach.
»Was Sie gesagt haben, klingt schön. Mein Vater war nicht sehr oft mit mir in der Kirche und meine Mutter ist früh gestorben. Aber nennen Sie mich bitte Mathilda.«
»Dann bin ich Jacques.«
Mit einem Schmunzeln reichte er ihr die Hand, die sie nach kurzem Zögern ergriff. Sie war kühl und stark. Es war seltsam, einem Indianer die Hand zu geben. Eigentlich fühlte es sich ganz normal an. Aber auch schön. All ihre Sinne kribbelten plötzlich. Jacques.
»Warum ist dir dieser Brief so wichtig, Mathilda?«