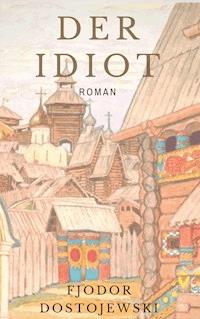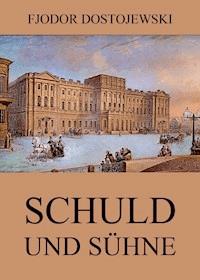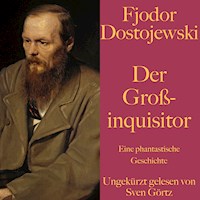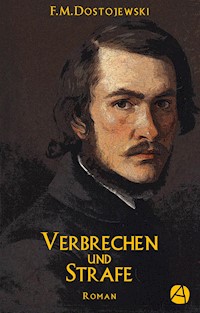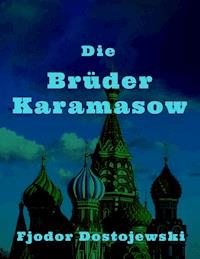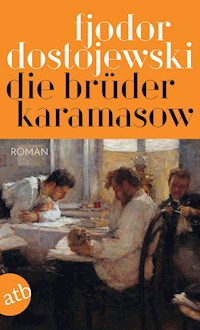
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Brüder und ein Mord.
Die drei Brüder Karamasow könnten unterschiedlicher nicht sein, einzig der tiefe Konflikt mit ihrem moralisch verkommenen Vater, Fjodor Karamasow, eint sie. Dmitri, der Älteste, macht kein Geheimnis daraus, dass er den Vater abgrundtief hasst, weil dieser ihm sein Erbteil vorenthält und zudem um dieselbe Frau buhlt wie er. Doch als der Vater brutal ermordet wird, hat jeder der Brüder ein Motiv. Das Gerichtsurteil trifft zwar den Falschen, vor dem inneren Richter jedoch begegnet jeder der Brüder den Verstrickungen seiner ganz persönlichen Schuld.
Dostojewskis letzter großer Roman – ein Meisterwerk der russischen Literatur.
„Der großartigste Roman, der je geschrieben wurde.“ Sigmund Freud.
„Dostojewskis Romankunst ist nicht katalogisierbar, sondern wild wie keine andere des 19. Jahrhunderts.“ FAZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1920
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Drei Brüder und ein Mord.
Die drei Brüder Karamasow könnten unterschiedlicher nicht sein, einzig der tiefe Konflikt mit ihrem moralisch verkommenen Vater, Fjodor Karamasow, eint sie. Dmitri, der Älteste, macht kein Geheimnis daraus, dass er den Vater abgrundtief hasst, weil dieser ihm sein Erbteil vorenthält und zudem um dieselbe Frau buhlt wie er. Doch als der Vater brutal ermordet wird, hat jeder der Brüder ein Motiv. Das Gerichtsurteil trifft zwar den Falschen, vor dem inneren Richter jedoch begegnet jeder der Brüder den Verstrickungen seiner ganz persönlichen Schuld.
Dostojewskis letzter großer Roman – ein Meisterwerk der russischen Literatur.
»Der großartigste Roman, der je geschrieben wurde.« Sigmund Freud.
»Dostojewskis Romankunst ist nicht katalogisierbar, sondern wild wie keine andere des 19. Jahrhunderts.« FAZ
Über Fjodor Dostojewski
Fjodor Dostojewski (1821–1881) wurde in Moskau als Sohn eines Militärarztes und einer Kaufmannstochter geboren. Er studierte an der Petersburger Ingenieurschule und widmete sich seit 1845 ganz dem Schreiben. 1849 wurde er als Mitglied eines frühsozialistischen Zirkels verhaftet und zum Tode verurteilt. Unmittelbar vor der Erschießung wandelte man das Urteil in vier Jahre Zwangsarbeit mit anschließendem Militärdienst als Gemeiner in Sibirien um. 1859 kehrte Dostojewski nach Petersburg zurück, wo er sich als Schriftsteller und verstärkt auch als Publizist neu positionierte.
Wichtigste Werke: »Arme Leute« (1845), »Der Doppelgänger« (1846), »Erniedrigte und Beleidigte« (1861), »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1862), »Schuld und Sühne« (1866), »Der Spieler« (1866), »Der Idiot« (1868), »Die Dämonen« (1872), »Der Jüngling« (1875), »Die Brüder Karamasow« (1880).
Michael Wegner (geboren 1930 in Kaunas, Litauen), war bis 1991 Professor für russische Literaturgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er ist der Herausgeber der Gogol-Ausgabe und der renommierten Dostojewski-Ausgabe des Aufbau-Verlags und Autor von Veröffentlichungen zur Geschichte und Theorie des Romans und zu deutsch-russischen Kulturbeziehungen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Fjodor Dostojewski
Die Brüder Karamasow
Roman in vier Teilen mit einem Epilog
Aus dem Russischen von Werner Creutziger
Anna Grigorjewna Dostojewskaja gewidmet
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es für sich allein; wenn es aber erstirbt, bringt es reiche Frucht.
Johannes 12, 24
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Bemerkung des Autors
Erster Teil
Erstes Buch Die Geschichte einer Familie
1 Fjodor Pawlowitsch Karamasow
2 Den ersten Sohn abgeschoben
3 Die zweite Ehe und die Kinder aus ihr
4 Der dritte Sohn, Aljoscha
5 Die Starzen
Zweites Buch Eine ungehörige Zusammenkunft
1 Die Ankunft im Kloster
2 Der alte Possenreißer
3 Gläubige Frauen
4 Die Dame, der es an Glauben fehlt
5 Dies erfülle sich!
6 Warum lebt so ein Mensch!
7 Ein allzu zielstrebiger Seminarist
8 Der Skandal
Drittes Buch Die Wollüstlinge
1 Im Gesindehaus
2 Lisaweta Smerdjastschaja, die »Stinkende«
3 Beichte eines heißen Herzens • In Versen
4 Beichte eines heißen Herzens • In Begebenheiten
5 Beichte eines heißen Herzens • »Kopfüber«
6 Smerdjakow
7 Die Kontroverse
8 Beim Kognak
9 Die Wollüstlinge
10 Beide zusammen
11 Noch ein verlorener Ruf
Zweiter Teil
Viertes Buch Übersteigerungen
1 Vater Ferapont
2 Beim Vater
3 Folgenreiche Begegnung mit Schuljungen
4 Bei den Chochlakows
5 Übersteigerung – im Salon
6 Übersteigerung in der Stube des Armen
7 Und im Freien
Fünftes Buch Pro und kontra
1 Die Verlobung
2 Smerdjakow mit der Gitarre
3 Die Brüder lernen einander kennen
4 Empörung
5 Der Großinquisitor
6 Ein vorerst noch sehr unklares Kapitel
7 »Mit einem gescheiten Menseben zu sprechen lohnt sich«
Sechstes Buch Ein russischer Mönch
1 Starez Sossima und seine Gäste
2 Aus dem Leben des in Gott entschlafenen Priestermönchs Starez Sossima, nach seinen eigenen Worten aufgezeichnet und zusammengefügt von Alexej Fjodorowitsch Karamasow • Nachrichten über den Lebenslauf
a) Von dem Jüngling, der des Starez Sossima Bruder war
b) Von der Heiligen Schrift im Leben des Vaters Sossima
c) Erinnerungen an die jungen Jahre des Starez Sossima, als er noch in der Welt lebte • Das Duell
d) Der geheimnisvolle Besucher
3 Aus den Betrachtungen und Lehrgesprächen des Starez Sossima
e) Über den russischen Mönch und seine mögliche Bedeutung
f) Von Herren und Dienern und ob Herren und Diener einander im Geiste Brüder werden können
g) Vom Gebet, von der Liebe und vom Teilhaben an anderen Welten
h) Kann man Richter über seinesgleichen sein? Vom Glauben bis ans Ende
i) Von der Hölle und vom höllischen Feuer – eine mystische Betrachtung
Dritter Teil
Siebentes Buch Aljoscha
1 Verwesungsgeruch
2 Welch ein Augenblick
3 Die Zwiebel
4 Kana in Galiläa
Achtes Buch Mitja
1 Kusma Samsonow
2 Ljagawy
3 Goldgruben
4 Im Dunkeln
5 Plötzlicher Entschluß
6 Ich komme!
7 Der Frühere, der Unbestrittene
8 Fieberwahn
Neuntes Buch Voruntersuchung
1 Beginn der Karriere des Beamten Perchotin
2 Alarm
3 Der Martergang der Seele • Erste Marter
4 Zweite Marter
5 Dritte Marter
6 Der Staatsanwalt fängt Mitja
7 Mitjas großes Geheimnis • Vorbeigeredet
8 Zeugenaussagen • »’s Kleine«
9 Mitja wird weggebracht
Vierter Teil
Zehntes Buch Die Jungen
1 Kolja Krassotkin
2 Probleme mit Kindern
3 Der Schüler
4 Shutschka
5 An Iljuschas Bett
6 Frühreif
7 Iljuscha
Elftes Buch Bruder Iwan Fjodorowitsch
1 Bei Gruschenka
2 Das kranke Füßchen
3 Das Teufelchen
4 Hymne und Geheimnis
5 Nicht du, nicht du!
6 Die erste Begegnung mit Smerdjakow
7 Der zweite Besuch bei Smerdjakow
8 Die dritte, die letzte Begegnung mit Smerdjakow
9 Der Teufel • Iwan Fjodorowitschs Alptraum
10 »Er, er hat es gesagt!«
Zwölftes Buch Ein Justizirrtum
1 Der verhängnisvolle Tag
2 Gefährliche Zeugen
3 Medizinische Gutachten und ein Pfund Nüsse
4 Das Glück lächelt Mitja
5 Die plötzliche Katastrophe
6 Die Rede des Staatsanwalts • Charakteristik
7 Historischer Überblick
8 Traktat über Smerdjakow
9 Psychologie auf höchsten Touren • Die dahinpreschende Troika • Finale der Rede des Staatsanwalts
10 Die Rede des Verteidigers • Der Stock mit zwei Enden
11 Kein Geld • Kein Raub
12 Auch kein Mord
13 Gesetzt den Fall, er hätte es getan
14 Die Bäuerlein behaupten sich
Epilog
1 Pläne zu Mitjas Rettung
2 Für einen Augenblick wird Lüge Wahrheit
3 Iljuschetschkas Begräbnis • Die Rede am Stein
Anhang
Zu diesem Band
Anmerkungen
Impressum
Bemerkung des Autors
Da ich beginne, das Leben meines Helden, Alexej Fjodorowitsch Karamasows, zu beschreiben, spüre ich eine gewisse Verlegenheit. Denn ich nenne zwar Alexej Fjodorowitsch meinen Helden, weiß aber selbst, daß er keineswegs ein bedeutender Mensch ist, und darum sehe ich unausweichliche Fragen voraus, die etwa lauten: Was macht denn Ihren Alexej Fjodorowitsch so beachtenswert, daß Sie ihn zum Helden gewählt haben? Was hat er Besonderes vollbracht? Wem und wodurch ist er bekannt? Warum soll ich, der Leser, Zeit aufwenden, um mich mit Fakten seines Lebens zu befassen?
Die letzte Frage ist die heikelste; denn auf sie kann ich nur erwidern: »Vielleicht gibt Ihnen der Roman die Antwort.« Was aber, wenn man den Roman liest und keine Antwort aus ihm vernimmt, wenn man nicht bestätigt findet, daß mein Alexej Fjodorowitsch bemerkenswert sei? Ich spreche so, weil ich das schmerzlich voraussehe. Für mich ist er bemerkenswert, aber ich zweifle entschieden daran, daß ich es dem Leser werde beweisen können. Es geht doch darum, daß er wohl ein tätiger, wirkender Mensch ist, sich aber als ein solcher nicht mit Bestimmtheit und Klarheit zu erkennen gegeben hat. Übrigens wäre es eine wunderliche Sache, in einer Zeit wie der unseren von den Menschen Klarheit zu verlangen. Eines ist gewiß recht sicher: Wir haben es mit einem wunderlichen Menschen zu tun, mit einem Sonderling sogar. Doch Wunderlichkeit und Sonderbarkeit schaden eher, als daß sie ein Recht auf Beachtung gäben, besonders wenn alle danach streben, die Einzelerscheinungen zusammenzufassen und einen gemeinsamen Sinn, sei er, wie er sei, in der allgemeinen Sinnlosigkeit zu finden. Ein Sonderling wiederum stellt fast immer einen Einzelfall dar, eine Erscheinung ganz für sich. Ist es nicht so?
Ja, wenn Sie dieser letzten These nicht zustimmen, wenn Sie antworten: »Es ist nicht so« oder »es ist nicht immer so«, dann werde ich wohl doch, was die Bedeutung meines Helden, also Alexej Fjodorowitsch, betrifft, Mut fassen. Denn nicht nur, daß ein Sonderling keineswegs immer einen Einzelfall darstellt, eine Erscheinung ganz für sich, nein, dann und wann macht wohl er, der Sonderling, sogar Hirn und Herz des Ganzen aus, während die übrigen Menschen seiner Epoche allesamt für eine Weile sozusagen von ihm losgerissen worden sind, wie von einem kräftigen Windstoß.
Ich würde mich übrigens nicht in diese höchst uninteressanten und wirren Erklärungen einlassen und lieber kurzerhand, ohne Vorwort, beginnen; denn gefällt das Buch, wird man es ohnehin lesen; aber das Schlimme ist, daß ich nur die eine Lebensbeschreibung vorzulegen habe, sie jedoch in zwei Romanen geben will. Der Hauptroman ist der zweite; er behandelt das Wirken meines Helden schon in unserer Zeit, jawohl, in unseren Tagen, im gegenwärtigen Augenblick. Hingegen liegt die Handlung des ersten Romans dreizehn Jahre zurück, und es ist beinahe gar kein Roman, sondern bloß ein Augenblick aus der frühen Jugend meines Helden. Ohne diesen ersten Roman auszukommen ist mir unmöglich, weil manches im zweiten Roman unverständlich bliebe. So aber wird die Schwierigkeit, von der am Anfang die Rede gewesen ist, noch größer; denn wenn schon ich, das heißt der Lebensbeschreiber selbst, finde, daß vielleicht ein einziger Roman für solch einen bescheidenen und wenig ausgeprägten Helden zuviel sei, wie kann ich da mit zweien aufwarten, und womit sollte ich dann solche Anmaßung, die es auf meiner Seite doch wäre, rechtfertigen?
Da ich bei aller Mühe keine Lösung dieses Problems finde, will ich es nun ohne jede Lösung beiseite lassen. Natürlich hat der scharfsichtige Leser längst erraten, daß ich von Anfang an eben hierzu neigte, und verärgert über mich, fragt er sich nur, warum ich fruchtlose Worte häufe und kostbare Zeit verschwende. Darauf werde ich jetzt genaue Antwort geben: Fruchtlose Worte und kostbare Zeit habe ich aufgewendet erstens aus Höflichkeit, zweitens aus Berechnung – immerhin kann ich später sagen, daß ich rechtzeitig gewarnt habe. Übrigens finde ich es sogar gut, daß mein Roman ganz von selbst in zwei Geschichten zerfällt, »bei wesentlicher Einheit des Ganzen«; denn nachdem der Leser die erste Geschichte kennengelernt hat, mag er selbst bestimmen, ob es sich für ihn lohnt, die zweite in die Hand zu nehmen. Natürlich ist keiner gebunden; man kann das Buch nach den ersten beiden Seiten der ersten Geschichte weglegen und nie mehr aufschlagen. Es gibt aber Leser mit so ausgesprochenem Feingefühl, daß sie das Buch auf jeden Fall bis zum Schluß lesen, um beim vorurteilsfreien Urteilen nur ja nicht fehlzugehen: zu ihnen gehören beispielsweise alle russischen Kritiker. Gegenüber solchen Lesern also ist mir jetzt immerhin leichter ums Herz – bei all ihrer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit gebe ich ihnen doch einen höchst legitimen Anlaß, die Geschichte schon mit der ersten Episode des Romans abzutun. Damit bin ich am Ende des Vorworts. Ich gebe bereitwillig zu, daß es überflüssig ist; aber einmal geschrieben, möge es denn bleiben.
Und jetzt zur Sache.
Erster Teil
Erstes Buch Die Geschichte einer Familie
1 Fjodor Pawlowitsch Karamasow
Alexej Fjodorowitsch Karamasow war der dritte Sohn des in unserem Kreis ansässigen Gutsbesitzers Fjodor Pawlowitsch Karamasow, dessen Name damals in aller Munde war (und noch heute bei uns zuweilen genannt wird), weil sein Leben auf so tragische und geheimnisvolle Weise endete, was vor genau dreizehn Jahren geschah und worüber ich, wenn es an der Reihe ist, berichten werde. Einstweilen will ich über diesen »Gutsbesitzer« (wie man ihn bei uns nannte, obwohl er in seinem ganzen Leben fast nie auf seinem Gut gelebt hatte) nur soviel sagen: Er verkörperte einen merkwürdigen, dabei ziemlich häufig vorkommenden Typ, den Typ des nicht einfach nur lottrigen und ausschweifenden, sondern stumpfsinnig lottrigen und ausschweifenden Menschen, und zählte wiederum zu jenen Stumpfsinnigen, die es verstehen, ihre Besitzangelegenheiten – und offenbar nur sie – aufs beste wahrzunehmen. Fjodor Pawlowitsch zum Beispiel hatte fast mit nichts angefangen, unter den Gutsbesitzern war er ein ganz kleiner gewesen, er hatte, hierhin und dahin laufend, von fremden Tischen sich genährt, um ein rechtes Krippenreiterdasein sich bemüht; dagegen besaß er, als der Tod ihn ereilte, allein an Geld, wie sich zeigte, beinahe hunderttausend Rubel. Dennoch hatte er sein Leben lang nicht aufgehört, einer der stumpfsinnigsten Querköpfe in unserem ganzen Kreis zu sein. Ich wiederhole: Nicht von Dummheit ist die Rede; die meisten dieser Querköpfe sind ziemlich schlau und verschlagen; nein, es ist wirklich Stumpfheit, und zwar eine von besonderer Art, von nationaler Eigentümlichkeit.
Zweimal war er verheiratet gewesen, und er hatte drei Söhne: den ältesten, Dmitri Fjodorowitsch, von der ersten Frau, die anderen beiden, Iwan und Alexej, von der zweiten. Die erste Frau Fjodor Pawlowitschs stammte aus dem ziemlich reichen und angesehenen Adelsgeschlecht der Miussows, die gleichfalls Gutsbesitzer in unserem Kreis waren. Wie es geschehen konnte, daß ein Mädchen mit beträchtlicher Mitgift, zudem eine Schönheit und, mehr noch, eines jener selbstbewußten, gescheiten Wesen, die wir bei der heutigen jungen Generation keineswegs selten finden, die es aber hier und da auch früher schon gegeben hat – daß also dieses Mädchen solch einen schäbigen »Kümmerling«, wie alle ihn damals nannten, heiratete, werde ich nicht weiter zu erklären versuchen. Kannte ich doch eine – noch zur »romantischen« Generation von dazumal zählende – unverheiratete Dame, die nach etlichen Jahren geheimnisvoller Liebe zu einem Herrn, den sie übrigens jederzeit in aller Ruhe hätte heiraten können, am Ende sich selber unüberwindliche Hindernisse ausdachte und sich in einer stürmischen Nacht von einem felsigen Hochufer in einen ziemlich tiefen und rasch strömenden Fluß stürzte, wo sie den Tod fand, dessen Ursache buchstäblich ihre eigenen Launen waren; sie starb so, einzig um der Shakespeareschen Ophelia zu gleichen; ja, wäre dieser Felsen, auf den sie seit langem ihre Aufmerksamkeit gerichtet und den sie liebgewonnen hatte, nicht so malerisch gewesen, hätte vielmehr statt seiner der Fluß an dieser Stelle ein prosaisches flaches Ufer gehabt, so wäre der Selbstmord womöglich ganz unterblieben. Dies ist wirklich geschehen, eine Tatsache, und es gilt zu bedenken, daß unser russisches Leben in den letzten zwei, drei Generationen von solchen oder ganz gleichartigen Tatsachen nicht wenige aufzuweisen hat. Ähnlich verhielt es sich mit dem Schritt, zu dem Adelaida Iwanowna Miussowa sich entschloß; zweifellos war es Widerhall fremden Sinnens, war eben auch »gefangnen Geistes Wallung«. Vielleicht trieb es sie, weibliche Selbständigkeit zu beweisen, etwas zu unternehmen gegen die Verhältnisse der Gesellschaft, gegen den Despotismus von Sippe und Familie, und die gefügige Phantasie mochte sie, sei es auch nur für einen Augenblick, davon überzeugt haben, daß Fjodor Pawlowitsch ungeachtet seiner Krippenreiterrolle immerhin einer der durch große Kühnheit und ätzenden Spott sich auszeichnenden Männer jener Epoche des Übergangs sei – des Übergangs zu jeglichem Besseren; dabei war er ein boshafter Possenreißer, nichts weiter. Das Pikante an der Sache bestand zudem darin, daß sie mittels Entführung vor sich ging – ein Umstand, der für Adelaida Iwanowna hohen Reiz besaß. Fjodor Pawlowitsch wiederum zeigte zu allen Streichen solcher Art schon angesichts seiner sozialen Stellung damals geradezu die größte Bereitschaft, wünschte er doch sehnlich, sich eine Karriere zu sichern, ganz gleich wodurch; und sich in eine gute Familie einzuschleichen und Mitgift zu vereinnahmen lockte ihn sehr. Was nun beiderseitige Liebe betraf, so war sie offenbar überhaupt nicht vorhanden, weder bei der Braut noch bei ihm, ungeachtet sogar der Schönheit Adelaida Iwanownas. So daß dieser Fall vielleicht den einzigen seiner Art im Leben Fjodor Pawlowitschs ausmachte, der bis zu seinem Ende ein Lüstling gewesen ist: Wenn nur ein Weiberrock – irgendeiner – ihn reizte, so besann er sich keinen Augenblick und heftete sich zudringlich an ihn. Indessen also machte allein diese Frau, was die sinnliche Seite betraf, auf ihn gar keinen besonderen Eindruck.
Adelaida Iwanowna gelangte sofort nach der Entführung, beinahe augenblicks, zu der Einsicht, daß sie ihren Mann nur verachtete, weiter nichts. Was aus der Eheschließung folgte, zeichnete sich darum außerordentlich rasch ab. Obgleich sich die Familie erstaunlich schnell mit dem Geschehenen abfand und der Entflohenen die Mitgift zukommen ließ, begann zwischen den Eheleuten ein denkbar unordentliches Leben, und es gab ständig Szenen. Wie erzählt wurde, bewies die junge Frau dabei unvergleichlich mehr Edelmut und Würde als Fjodor Pawlowitsch, der, wie man heute weiß, ihr sämtliches bares Geld, nicht weniger als fünfundzwanzigtausend, gleich mit einem Male, kaum daß es in ihren Händen war, an sich riß, so daß die schönen Tausender von dieser Zeit an für sie gänzlich verloren, wie vom Wasser verschluckt waren. Was das Dörfchen und das recht ansehnliche Haus in der Stadt betraf, die gleichfalls zur Mitgift gehörten, so verwendete er viel Zeit und die größte Mühe darauf, sie durch ein geeignetes Rechtsgeschäft auf seinen Namen überschreiben zu lassen, und wahrscheinlich hätte er das allein schon sozusagen dank der Verachtung und der Abscheu erreicht, die seine Gattin für ihn hegte und die er jede Minute mit seinen schamlosen Erpressungen und Betteleien aufs neue hervorrief, auch allein schon dank ihrer seelischen Ermattung: nur daß er Ruhe gäbe. Doch zum Glück mischte sich Adelaida Iwanownas Familie ein und setzte der Räuberei Grenzen. Zuverlässig weiß man, daß es zwischen den Eheleuten häufig zu Schlägereien kam, aber es wird überliefert, daß nicht Fjodor Pawlowitsch schlug, sondern daß dies Adelaida Iwanowna tat, eine hitzige, mutige, ungeduldige brünette Dame von erstaunlicher Körperkraft. Am Ende lief sie fort aus dem Haus, fort von Fjodor Pawlowitsch, ging davon mit einem Lehrer, einem, der bloß Seminarbildung hatte und der in Bettelarmut sein Dasein fristete; in Fjodor Pawlowitschs Händen ließ sie den dreijährigen Mitja zurück. Schleunigst richtete Fjodor Pawlowitsch im Hause einen ganzen Harem ein und veranstaltete wüsteste Trinkgelage; in den Pausen aber bereiste er beinahe das ganze Gouvernement und beklagte sich tränenreich bei allen und jedem darüber, daß ihn Adelaida Iwanowna verlassen habe, wobei er so im einzelnen über sein Eheleben berichtete, wie es ihm, dem Gatten, die Scham hätte verbieten sollen. Und die Hauptsache: Offensichtlich machte es ihm Freude, es schmeichelte ihm sogar, vor allen Leuten seine lächerliche Rolle des gekränkten Gatten zu spielen, ja noch ausschmückend und ins einzelne gehend die Art seiner Kränkung zu beschreiben.
»Man könnte meinen, Fjodor Pawlowitsch, Sie hätten einen hohen Rang erhalten, so zufrieden sehen Sie aus, bei all Ihrem Kummer«, bemerkten ihm gegenüber die Spötter. Manch einer fügte gar hinzu, Fjodor Pawlowitsch genieße es, in aufgefrischter Possenreißerrolle erscheinen zu können, und um größerer Erheiterung willen tue er so, als bemerkte er nicht die Lächerlichkeit seiner Lage. Übrigens, wer weiß, vielleicht handelte er da auch naiv. Schließlich entdeckte er Spuren seiner Entflohenen. Es zeigte sich, daß die Ärmste in Petersburg war; dorthin war sie mit ihrem Lehrerchen gezogen, und dort stürzte sie sich in unbegrenzte Emanzipation. Fjodor Pawlowitsch wurde ohne Verzug sehr geschäftig und rüstete sich zur Reise nach Petersburg; wozu, das wußte er natürlich selbst nicht. Mag sein, er wäre wirklich gefahren; doch da er diesen Entschluß gefaßt hatte, fühlte er sich in besonderem Maße berechtigt, zur Aufmunterung, vor dem weiten Weg, sich wieder einmal der uferlosesten Zecherei hinzugeben. In diesen Tagen nun erhielt die Familie seiner Frau die Nachricht, daß sie in Petersburg gestorben sei. Ganz plötzlich sei sie gestorben, in einer Mansarde – an Typhus, wollten die einen wissen, während andere Gerüchte besagten, sie sei einfach verhungert. Fjodor Pawlowitsch war betrunken, als er die Nachricht vom Tod seiner Frau erhielt; es heißt, er sei dann auf die Straße gerannt und habe, vor Freude die Hände zum Himmel streckend, geschrien: »Herr, nun lassest du deinen Diener …«; andere behaupteten, er habe geschluchzt wie ein kleines Kind, habe so geweint, daß es den Augenzeugen zu Herzen gegangen sei, bei aller Abscheu, die sie sonst für ihn empfanden. Sehr leicht kann sowohl das eine als auch das andere geschehen sein, das heißt, er kann sich über seine Befreiung gefreut und seiner Befreierin nachgeweint haben – alles zugleich. Meistens sind die Menschen, selbst die Schufte, viel naiver und einfältiger, als wir von ihnen annehmen. Wir selber sind’s ja auch.
2 Den ersten Sohn abgeschoben
Es ist natürlich leicht vorstellbar, was für ein Erzieher und Vater so ein Mensch sein konnte. Was ihn als Vater betraf, so geschah genau das, was geschehen mußte, das heißt, er kümmerte sich nicht im mindesten um sein Kind, das er mit Adelaida Iwanowna gezeugt hatte, und nicht aus bösem Willen ihm gegenüber handelte er so, auch nicht, weil ihn da etwa Gefühle des gekränkten Ehemanns beherrscht hätten, nein, er hatte das Kind einfach vergessen, völlig vergessen. Während er allen mit seinen Tränen und Klagen lästig fiel und sein Haus in eine Lasterhöhle verwandelte, nahm der treue Diener dieses Hauses, Grigori, den dreijährigen Knaben Mitja in seine Obhut; ohne seine Sorge wäre wohl zu dieser Zeit niemand dagewesen, der dem Kind das Hemd gewechselt hätte. Es kam hinzu, daß die Verwandten, die der Knabe mütterlicherseits hatte, ihn anfangs auch vergessen zu haben schienen. Sein Großvater, also Herr Miussow selbst, Adelaida Iwanownas Vater, lebte nicht mehr; zu kränklich geworden war Miussows Frau, Mitjas Großmutter, die als Witwe nach Moskau gezogen war; Adelaida Iwanownas Schwestern wiederum hatten allesamt geheiratet, und so mußte Mitja fast ein ganzes Jahr beim Diener Grigori bleiben und bei ihm im Gesindehaus wohnen. Übrigens, wenn sein lieber Papa sich seiner auch erinnert hätte (in der Tat konnte ihm die Existenz des Kindes nicht völlig entfallen sein), so hätte er selbst ihn wieder ins Gesindehaus geschickt, denn der Knabe hätte bei den Orgien im Hause gestört. Nun geschah es aber, daß aus Paris der Vetter der verstorbenen Adelaida Iwanowna zurückkehrte, Pjotr Alexandrowitsch Miussow, ein Mann, der später wieder über viele Jahre hin im Ausland lebte, doch zu der Zeit, von der hier die Rede ist, noch sehr jung war – eine ungewöhnliche Erscheinung unter den Miussows: gebildet, aufgeklärt, viele Städte und Länder kennend, zudem sein Leben lang ein Europäer, dann im höheren Alter ein Liberaler der vierziger und fünfziger Jahre. Sein Werdegang brachte ihn mit etlichen der am entschiedensten liberalen Männer seiner Epoche in Berührung, in Rußland und anderswo; er kannte Proudhon und Bakunin persönlich, und besonders gern dachte er, schon am Ende seiner Wanderjahre, an die drei Tage der Pariser Februarrevolution von achtundvierzig zurück; wenn er von ihnen erzählte, klang es, als habe er selbst auf den Barrikaden gestanden und an ihr teilgenommen. Es war eine der leuchtendsten Erinnerungen aus seiner Jugend. Er hatte ein Vermögen, das ihn unabhängig machte: nach dem Maß von damals ungefähr tausend Seelen. Sein vortreffliches Gut befand sich gleich am Rande unseres Städtchens und grenzte an die Ländereien unseres berühmten Klosters, gegen das Pjotr Alexandrowitsch, nachdem er das Gut geerbt hatte, noch als ganz junger Mann, sofort einen endlosen Prozeß zu führen begann; in ihm ging es um das Recht auf Fischfang im Fluß oder auf Holzeinschlag im Wald, genau weiß ich es nicht; einen Prozeß gegen die »Kleriker« anzustrengen, hielt er jedenfalls geradezu für seine Pflicht als Bürger und als aufgeklärter Mensch. Nachdem er über Adelaida Iwanowna, an die er sich natürlich erinnerte und die ihm irgendwann sogar aufgefallen war, alles gehört, nachdem er von der Existenz ihres Sohnes Mitja erfahren hatte, nahm er sich, trotz seiner jugendlichen Entrüstung und der Verachtung für Fjodor Pawlowitsch, der Sache sofort an. Bei dieser Gelegenheit wurde er mit Fjodor Pawlowitsch überhaupt erst persönlich bekannt. Er erklärte ihm rundheraus, daß er die Erziehung des Knaben in seine Hände zu nehmen wünsche. Später erzählte er, um einen charakteristischen Zug zu bezeichnen, ausführlich, wie Fjodor Pawlowitsch, als er den Gast von Mitja sprechen hörte, eine Zeitlang so ausgesehen habe, als begreife er überhaupt nicht, um welches Kind es sich da handle, und wie es für Fjodor Pawlowitsch anscheinend sogar verwunderlich gewesen sei, daß er irgendwo im Hause einen kleinen Sohn hatte. Mochte Pjotr Alexandrowitsch da auch übertreiben, so mußte in seinem Bericht doch ein Körnchen Wahrheit stecken. Aber tatsächlich schauspielerte Fjodor Pawlowitsch gern, sein Leben lang liebte er es, seinem Gesprächspartner plötzlich eine Rolle vorzuspielen, mit der dieser nicht gerechnet hatte, und, was die Hauptsache ist, er tat es zuweilen ohne jede Notwendigkeit, sogar zum eigenen Schaden, wie zum Beispiel im vorliegenden Falle. Dieser Zug ist übrigens außerordentlich vielen Menschen eigen, auch sehr klugen, keineswegs nur dem Typ Fjodor Pawlowitschs. Pjotr Alexandrowitsch besorgte seine Sache mit großem Eifer und wurde sogar (gemeinsam mit Fjodor Pawlowitsch) zum Vormund des Kindes bestellt, weil die Mutter immerhin noch einen kleinen Besitz hinterlassen hatte: das Haus und das Gut. Mitja zog nun wirklich zu diesem Vetter seiner Mutter, aber da der nicht selbst Familie hatte und nach dem Ordnen und Sichern seiner Einkünfte von den ihm gehörenden Gütern unverzüglich zurück nach Paris eilte, um lange dort zu bleiben, gab er den Knaben in die Obhut einer Moskauer Dame, einer Kusine seiner Mutter. So fügte es sich, daß auch er, von neuem in Paris heimisch, an das Kind nicht mehr dachte, vor allem dann nicht mehr, als eben jene Februarrevolution ausbrach, die seine Phantasie so sehr entzünden und ihm sein Leben lang gegenwärtig bleiben sollte. Die Moskauer Dame starb, und Mitja geriet zu einer ihrer verheirateten Töchter. Vermutlich hat er später noch zum vierten Male das Nest gewechselt. Darüber will ich mich jetzt nicht weiter verbreiten, zumal da es noch viel anderes über diesen Erstling Fjodor Pawlowitschs zu berichten geben wird; fürs erste beschränke ich mich darauf, über ihn die allernötigsten Mitteilungen zu geben, ohne die ich den Roman gar nicht beginnen kann.
Vor allem ist zu bemerken, daß dieser Dmitri Fjodorowitsch von den drei Söhnen Fjodor Pawlowitschs der einzige war, der in der Überzeugung aufwuchs, er besitze immerhin einiges Vermögen und werde nach Erreichen der Volljährigkeit unabhängig sein. In seiner Kindheit und Jugendzeit lief vieles ohne Sinn und Ordnung – das Gymnasium schloß er nicht ab, er geriet auf eine Militärschule, es verschlug ihn in den Kaukasus, er diente sich hinauf, duellierte sich, wurde degradiert, diente sich wieder hinauf, lebte flott und trank und brachte ziemlich viel Geld durch. Von Fjodor Pawlowitsch freilich bekam er vor Erreichen der Volljährigkeit nichts, darum machte er einstweilen Schulden. Ihn, Fjodor Pawlowitsch, seinen Vater, lernte er überhaupt erst kennen, als er, volljährig geworden, in unsere Gegend eigens zu dem Zwecke kam, mit ihm seine Vermögensangelegenheiten zu klären. Offenbar fand er auch bei dieser Gelegenheit an seinem Vater kein Gefallen; er blieb nicht lange bei ihm, reiste rasch wieder ab, nachdem er nur eine gewisse Summe von ihm herausholen und einen gewissen Kompromiß hatte erreichen können, bei dem es um die weitere Zusendung von Einkünften aus seinem Gute ging; wieviel das Gut einbrachte und welchen Wert es hatte, das freilich (ein beachtenswertes Faktum) konnte er dabei von Fjodor Pawlowitsch eben doch nicht erfahren. Fjodor Pawlowitsch hatte in diesen Gesprächen gleich am Anfang (das gilt es festzuhalten) begriffen, daß Mitja von seinem Vermögen eine übertriebene und unrichtige Vorstellung hatte. Das befriedigte Fjodor Pawlowitsch sehr, denn er knüpfte daran seine besonderen Pläne. Es genügte ihm, zu wissen, daß der junge Mann leichtsinnig, ungestüm, seinen Leidenschaften ausgeliefert, ungeduldig, dem Weine zugetan war und daß man ihm nur immer mal einen Happen zuzuwerfen brauchte, damit er sich sogleich, wenn auch natürlich nur für kurze Zeit, zufriedengäbe. Das eben begann Fjodor Pawlowitsch auszunutzen, das heißt, er speiste Mitja mit Almosen, mit gelegentlichen kleinen Geldsendungen ab, und letztlich ergab sich daraus dies: Als Mitja, nachdem wieder vier Jahre vergangen waren, die Geduld verlor und zum zweiten Male in unserer Stadt auftauchte, nunmehr, um endgültig mit seinem Vater ins reine zu kommen, da stellte sich zu seiner größten Bestürzung plötzlich heraus, daß er buchstäblich nichts mehr besaß, daß da kaum noch etwas aufzurechnen war und daß er nach und nach bereits den ganzen Wert seines Besitzes von Fjodor Pawlowitsch sich hatte auszahlen lassen, ja, daß er selbst ihm womöglich etwas schuldete; es zeigte sich, daß er zufolge Punkt soundso und Punkt soundso jener Kompromißvereinbarung, die an dem und dem Tag eben auf seinen Wunsch getroffen worden war, gar kein Recht mehr hatte, etwas zu verlangen … und so weiter. Der junge Mann war wie vor den Kopf gestoßen, er witterte Unrecht, Betrug, geriet ganz außer sich, wurde schier verrückt. Dieser Umstand führte dann eben zu der Katastrophe, mit der sich der erste meiner beiden Romane, der einführende, befaßt oder die, besser gesagt, seine äußere Handlung ausmacht. Doch bevor ich mich diesem Roman zuwende, muß ich noch über die anderen beiden Söhne Fjodor Pawlowitschs, über Mitjas Brüder, berichten, muß erklären, warum sie hier erscheinen, woher sie gekommen sind.
3 Die zweite Ehe und die Kinder aus ihr
Sehr bald nachdem Fjodor Pawlowitsch den vierjährigen Mitja abgeschoben hatte, heiratete er zum zweitenmal. Diese zweite Ehe dauerte acht Jahre. Geholt hatte er die zweite Frau, wieder eine blutjunge Person, Sofja Iwanowna, aus einem anderen Gouvernement. Dorthin war er wegen der Vergabe irgendwelcher kleiner Aufträge gereist, zusammen mit einem Schacherer. Bei all seiner Trunksucht und seinem ungezügelten Hang zur Ausschweifung unterließ es Fjodor Pawlowitsch doch niemals, auf gute Anlage seines Kapitals zu achten, und seine Geschäfte machte er immer erfolgreich, wenn auch natürlich immer auf etwas schmutzige Art. Sofja Iwanowna war, was man eine »arme Waise« nennt – ohne Eltern, ohne Familie von Kindheit an, Tochter eines Hilfsgeistlichen, aufgewachsen in dem reichen Hause ihrer Wohltäterin, Erzieherin und Peinigerin, einer hochherrschaftlichen alten Generalin, Witwe des Generals Worochow. Einzelheiten kenne ich nicht, doch immerhin ist mir zu Ohren gekommen, man habe das junge Mädchen, ein sanftes, argloses und fügsames Geschöpf, einmal von dem Strick abgenommen, den sie in ihrer Mansarde an einem Nagel befestigt hatte – so schwer fiel es ihr, die Launen und die ewigen Vorwürfe dieses alten Weibes zu ertragen, das nicht einmal boshaft zu sein schien, sondern nur vom Müßiggang zu ganz und gar unerträglichen starrköpfigen Verdrehtheiten getrieben wurde. Fjodor Pawlowitsch machte einen Heiratsantrag, man zog Erkundigungen über ihn ein und wies ihn ab, und da schlug er, wie schon im Falle der ersten Ehe, dem Waisenmädchen die Entführung vor. Es ist sehr leicht möglich, daß nicht einmal sie ihm gefolgt wäre, um keinen Preis, wenn sie rechtzeitig mehr Einzelheiten über ihn erfahren hätte. Aber es handelte sich um ein anderes Gouvernement, und was konnte ein sechzehnjähriges Mädchen schon begreifen außer: daß es besser wäre, in den Fluß zu springen, als bei der Wohltäterin zu bleiben. So tauschte die Ärmste die Wohltäterin gegen einen Wohltäter ein. Diesmal kassierte Fjodor Pawlowitsch keinen Groschen, denn die Generalin tobte vor Zorn, gab nicht nur nichts, sondern verfluchte obendrein die beiden; er aber war diesmal gar nicht auf eine Mitgift ausgewesen, sondern hatte sich gefangennehmen lassen von der ungewöhnlichen Schönheit des unschuldigen Kindes, ja, eben davon: vom Bild der Unschuld, das sie bot und das ihn, den Lüstling, der bis dahin nur lasterhaft Freude an handfester weiblicher Schönheit verspürt hatte, ins Innerste traf. »Wie Rasiermesser schnitten damals diese unschuldigen Äuglein in meine Seele«, pflegte er später zu sagen, auf seine widerliche Art kichernd. Übrigens braucht es dem ausschweifenden Menschen auch hier nur um einen neuen wollüstigen Reiz gegangen zu sein. Da Fjodor Pawlowitsch also keinerlei Entgelt vereinnahmt hatte, machte er mit seiner Gattin nicht viele Umstände; davon ausgehend, daß sie ihm sozusagen etwas »schuldig« war und daß er sie beinahe »vom Strick genommen« hatte, ferner ihre einzigartige Demut und Fügsamkeit nutzend, trat er selbst die elementarsten ehelichen Anstandsregeln mit Füßen. Vor den Augen seiner Frau wurden im Hause mit zusammengeholten üblen Weibern Orgien gefeiert. Einen bezeichnenden Zug will ich anführen: Der Diener Grigori, ein finsterer, dummer und störrischer Murrkopf, der seine frühere Herrin Adelaida Iwanowna gehaßt hatte, ergriff nun Partei für seine neue Herrin; er stellte sich schützend vor sie und stritt sich ihretwegen mit Fjodor Pawlowitsch so herum, wie es einem Diener kaum noch zukommt; es geschah sogar, daß er eine solche Orgie gewaltsam beendete, indem er das ganze versammelte liederliche Weibsvolk davonjagte. Später wurde die unglückliche, von frühester Kindheit an eingeschüchterte junge Frau von einem Nervenleiden befallen, einer Frauenkrankheit, die man am häufigsten auf dem Lande, bei den Bäuerinnen antrifft; dort sagt man dann, sie hätten die Schreisucht. Bei Sofja Iwanowna bewirkte die mit schrecklichen hysterischen Anfällen verbundene Krankheit, daß sich zeitweise sogar ihr Geist verwirrte. Dennoch gebar sie Fjodor Pawlowitsch zwei Söhne, Iwan und Alexej, den ersten im ersten Ehejahr, den zweiten drei Jahre später. Als sie starb, war der Knabe Alexej noch nicht vier, und wenn es auch seltsam klingt, so weiß ich doch, daß er fürs ganze Leben die Erinnerung an seine Mutter bewahrte, ihre Züge freilich wie im Traume sehend. Nach ihrem Tode geschah mit den beiden Knaben beinahe haargenau dasselbe, was mit dem ersten, Mitja, geschehen war: Sie wurden vom Vater völlig vernachlässigt und vergessen, fielen wiederum Grigori zu und gerieten zu ihm ins Gesindehaus. Und eben dort wurden sie von der Generalin vorgefunden, der starrköpfigen Wohltäterin und Erzieherin ihrer Mutter. Die alte Dame lebte noch und hatte in der ganzen Zeit, all die acht Jahre, die ihr zugefügte Kränkung nicht vergessen können. Wie ihr Zögling Sofja in den acht Jahren lebte, darüber hatte sich die Generalin unterderhand die genauesten Auskünfte verschafft, und da sie unterrichtet worden war, wie krank die junge Frau sei und was für abscheuliche Dinge um sie herum geschähen, hatte sie vor den bei ihr schmarotzenden Damen zwei- oder dreimal laut geäußert: »Geschieht ihr recht; das ist Gottes Strafe für ihre Undankbarkeit.«
Genau drei Monate nach Sofja Iwanownas Tod erschien unerwartet die Generalin persönlich in unserer Stadt und begab sich geradenwegs zur Wohnung Fjodor Pawlowitschs; nicht mehr als eine halbe Stunde verbrachte sie am hiesigen Orte, aber sie besorgte vieles. Die Sache ging gegen Abend vor sich. Fjodor Pawlowitsch, den sie in den acht Jahren kein einziges Mal gesehen hatte, trat betrunken zu ihr heraus. Es wird berichtet, sie habe ihm, da sie seiner nur ansichtig wurde, ohne jede Erklärung augenblicks zwei kräftige und schallende Ohrfeigen verabreicht und seinen Kopf am Haarschopf dreimal nach unten gerissen; darauf sei sie, ohne noch ein Wort zu sprechen, geradenwegs ins Gesindehaus zu den Knaben gegangen. Da sie dort auf den ersten Blick bemerkte, daß die beiden nicht gewaschen waren und in schmutziger Wäsche steckten, bedachte sie sofort auch Grigori mit einer Ohrfeige und eröffnete ihm, daß sie die beiden Kinder mitnehme; sie holte die Knaben heraus, so wie sie waren, hüllte sie in Plaids und setzte sie in den Wagen, um sie in ihre Stadt zu bringen. Grigori nahm die Ohrfeige als ergebener Sklave hin, wurde mit keinem Worte grob, und als er die alte Dame zum Wagen begleitete, da verbeugte er sich ganz tief vor ihr und äußerte vernehmlich die Hoffnung, daß Gott ihr die »Wohltat an den Waisen« lohne. »Und trotzdem bist du ein Hammel!« rief ihm die Generalin im Wegfahren zu. Fjodor Pawlowitsch kam, nachdem er sich alles recht überlegt hatte, zu dem Schluß, dies sei doch eine gute Lösung, und als es später darum ging, daß er sich in aller Form mit der Erziehung der Kinder durch die Generalin einverstanden erklären sollte, verweigerte er seine Zustimmung in keinem einzigen Punkte. Die Geschichte von den empfangenen Ohrfeigen erzählte er dann selbst, eigens deshalb Besuche machend, in der ganzen Stadt.
Es fügte sich, daß auch die Generalin bald darauf starb; sie hatte jedoch in ihrem Testament den Knaben je tausend Rubel vermacht – »damit sie Unterricht kriegen, und das ganze Geld soll auch unbedingt für sie aufgewandt werden, aber so, daß es bis zur Volljährigkeit reicht, denn so eine Zuwendung ist schon mehr als genug für solche Kinder, und wenn einer durchaus mehr tun will, soll der selber in die Tasche greifen« und dergleichen mehr. Ich habe das Testament nicht selbst gelesen, mir aber sagen lassen, gerade Verdrehtheiten dieser Art hätten, überaus eigensinnig ausgedrückt, dringestanden. Als Haupterbe der Alten erwies sich jedoch ein redlicher Mann, der Adelsmarschall jenes Gouvernements, Jefim Petrowitsch Polenow. Ihm brachte ein Briefwechsel mit Fjodor Pawlowitsch sofort die Erkenntnis, daß von diesem kein Geld für die Erziehung der Kinder, die doch die seinen waren, herauszuholen sei (obgleich Fjodor Pawlowitsch sich niemals rundweg weigerte, sondern in solchen Fällen immer nur auswich, sich manchmal sogar in Rührseligkeit erging); so nahm sich Jefim Petrowitsch auch menschlich der Waisen an und gewann zumal den Jüngeren lieb, Alexej; er behielt ihn sogar für lange Zeit bei sich in der Familie. Dies bitte ich den Leser von Anfang an im Auge zu behalten. Und wenn die beiden Heranwachsenden ihre Erziehung und Bildung fürs ganze Leben jemandem verdankten, so war dies Jefim Petrowitsch, ein in höchstem Maße edelmütiger und humaner Mensch, einer, wie man ihn selten findet. Er ließ das Geld, das die Generalin den Kindern vermacht hatte, unangetastet, so daß die Summe für jeden von ihnen, als sie volljährig wurden, durch die Zinsen von tausend auf zweitausend gewachsen war; die Kosten für die Erziehung bestritt Jefim Petrowitsch aus der eigenen Tasche, wobei er natürlich für jeden weit mehr als tausend ausgab. Mir geht es nicht darum, an dieser Stelle einen ausführlichen Bericht über ihre Kindheit und Jugend zu geben; ich will nur die wichtigsten Umstände nennen. Über den Älteren, Iwan, soll vorerst die Mitteilung genügen, daß er zu einem verschlossenen und recht finster blickenden Jüngling heranwuchs; er war keineswegs verschüchtert, aber schon etwa vom zehnten Lebensjahr an schien er stark zu empfinden, daß sie immerhin in einer fremden Familie aufwuchsen, abhängig von den Wohltaten anderer, daß sie einen Vater von besonderer Art hatten, einen, von dem man nicht einmal sprechen mochte, und dergleichen mehr. Dieser Knabe bekundete sehr früh, schon als kleines Kind (so wenigstens wird berichtet), eine ungewöhnliche und glänzende Fähigkeit zu lernen. Wie es kam, weiß ich nicht genau, jedenfalls nahm er, kaum dreizehnjährig, Abschied von der Familie Jefim Petrowitschs und wechselte in ein Moskauer Internatsgymnasium über, in die Obhut eines erfahrenen und zu jener Zeit berühmten Pädagogen, mit dem Jefim Petrowitsch seit der Kindheit befreundet war. Iwan pflegte später selbst zu erzählen, alles habe sich sozusagen daraus ergeben, daß Jefim Petrowitsch in seinem »Feuereifer für gute Taten« sich an der Idee begeistert habe, ein genial begabtes Kind müsse von einem genialen Erzieher gebildet werden. Übrigens waren sowohl Jefim Petrowitsch als auch der geniale Erzieher schon gestorben, als der junge Mann das Gymnasium absolvierte und die Universität bezog. Da nun Jefim Petrowitsch es versäumt hatte, die richtigen Verfügungen zu treffen, und darum die Auszahlung des von der verdrehten Generalin den Kindern hinterlassenen, ihnen also gehörenden Geldes, das wegen der Zinsen nicht mehr tausend, sondern zweitausend bei jedem ausmachte, sich wegen verschiedener bei uns ganz und gar unvermeidbarer Formalitäten und Hindernisse verzögerte, hatte der junge Mann in seinen ersten beiden Universitätsjahren viel Schweres durchzustehen; denn er war diese ganze Zeit gezwungen, sich selbst die Existenzmittel zu beschaffen und dabei zu studieren. Hier muß bemerkt werden, daß er damals nicht einmal den Versuch unternehmen mochte, sich brieflich mit seinem Vater zu verständigen – vielleicht aus Stolz, vielleicht, weil er ihn verachtete, vielleicht auch, weil die nüchterne Überlegung ihm sagte, er würde von seinem Väterchen schwerlich irgendeine ernsthafte Unterstützung erhalten. Wie dem auch sei, der junge Mann ließ keineswegs den Mut sinken, er erreichte es, Arbeit zu finden, zuerst gab er für wenige Kopeken Nachhilfestunden, später lief er in die Zeitungsredaktionen und versorgte sie mit Zehnzeilenartikelchen über kleine Geschehnisse in der Stadt – Artikelchen mit der Unterschrift »Augenzeuge«. Sie seien, heißt es, immer so fesselnd und witzig verfaßt gewesen, daß sie rasch beliebt wurden, und allein schon darin bewies der junge Mann seine ganze praktische und geistige Überlegenheit über jenen großen, ewig Not leidenden und unglücklichen Teil unserer studierenden Jugend beiderlei Geschlechts, der in den Hauptstädten üblicherweise vom Morgen bis in die Nacht den Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen die Türen einrennt und sich nichts Besseres auszudenken weiß, als immer und ewig dieselbe Bitte zu äußern: man möge sie Übersetzungen aus dem Französischen oder Abschriften machen lassen. Da Iwan Fjodorowitsch mit den Redaktionen einmal bekannt war, ließ er auch später die Verbindung zu ihnen niemals abreißen und fing in seinen letzten Universitätsjahren an, höchst talentvolle Besprechungen von Büchern über mancherlei Fachthemen zu veröffentlichen, so daß er sogar in literarischen Kreisen bekannt wurde. Übrigens lag es zu der Zeit, von der hier erzählt wird, noch gar nicht lange zurück, daß es ihm zufällig gelang, die besondere Aufmerksamkeit eines noch bedeutend größeren Leserkreises mit einem Male auf sich zu lenken und zu bewirken, daß plötzlich sehr viele seinen Namen kennenlernten und im Gedächtnis behielten. Das war eine recht interessante Sache. Unmittelbar nach dem Studium, beschäftigt mit den Vorbereitungen einer Auslandsreise, die er mit Hilfe seiner zweitausend Rubel unternehmen wollte, veröffentlichte Iwan Fjodorowitsch in einer der größeren Zeitungen einen merkwürdigen Artikel, der sogleich auch die Beachtung der Nichtfachleute fand, und das Auffallendste war, daß er von Dingen handelte, die ihm eigentlich ganz fremd sein mußten, denn sein Studium hatte der Naturkunde gegolten. Der Artikel war der damals allerorts die Geister bewegenden Frage der kirchlichen Gerichtsbarkeit gewidmet. Iwan Fjodorowitsch betrachtete kritisch einige zu dieser Frage schon geäußerte Meinungen und legte dann seine eigene Ansicht dar. Die Hauptsache aber waren der Ton und das großartig Überraschende der Schlußfolgerung. Bei alledem hielten etliche Kirchenleute den Autor entschieden für einen der Ihren. Und plötzlich fingen neben ihnen nicht nur die Verfechter des säkularen Standpunkts, sondern selbst die Atheisten an, ihm Beifall zu spenden. Zu guter Letzt kamen ein paar findige Leute darauf, der ganze Artikel sei nichts als dreiste Farce und Parodie. Ich erwähne die Angelegenheit besonders deshalb, weil der Artikel seinerzeit auch in unser berühmtes, am Stadtrand gelegenes Kloster gelangt war, wo man sich überhaupt für die aufgekommene Frage der kirchlichen Gerichtsbarkeit interessierte – man las ihn dort und war höchst befremdet. Da man den Namen des Autors erfahren hatte, fand man es zudem bemerkenswert, daß er aus unserer Stadt stammte und der Sohn »jenes Fjodor Pawlowitsch« war. Und eben zu dieser Zeit tauchte der Autor selbst bei uns auf.
Warum damals Iwan Fjodorowitsch zu uns kam – ich weiß noch, gleich nach seiner Ankunft stellte ich mir selbst, geradezu besorgt, diese Frage. Der schicksalsschwere, so ungewöhnliche Folgen zeitigende Umstand, daß er in unsere Stadt reiste, blieb mir noch lange danach, beinahe immer, unerklärlich. Es war doch, im ganzen betrachtet, merkwürdig, daß ein so gebildeter, so stolzer und offenbar besonnener junger Mann plötzlich in so ein widerliches Haus einkehrte, einen Vater aufsuchte, der nie etwas von ihm hatte wissen wollen, auch nichts gewußt, nicht an ihn gedacht hatte und der zwar, versteht sich, um keinen Preis und auf keinen Fall Geld gegeben hätte, wenn er vom Sohn darum gebeten worden wäre, der aber doch sein Leben lang davor bangte, daß auch Iwan und Alexej eines Tages kämen und Geld von ihm verlangten. Und nun richtet sich der junge Mann im Haus eines solchen Vaters ein, lebt mit ihm einen Monat und noch einen, und sie kommen aufs beste miteinander aus. Letzteres verblüffte in besonderem Maße nicht nur mich, sondern auch viele andere. Der schon erwähnte Pjotr Alexandrowitsch Miussow, mit dem Fjodor Pawlowitsch entfernt, über seine erste Frau, verwandt war, hielt sich damals gerade in der Nähe auf, verbrachte, zu Besuch aus Paris, wo er sich endgültig niedergelassen hatte, einige Zeit auf seinem Gut nahe der Stadt. Ich besinne mich, er war’s, der sich am meisten wunderte; er hatte sich mit dem jungen Mann bekannt gemacht, der ihn außerordentlich interessierte und an dessen Wissen er zuweilen nicht ohne inneren Schmerz das seine maß. »Er ist stolz«, so äußerte er sich damals im Gespräch mit uns über ihn, »er wird sich immer seinen Lebensunterhalt beschaffen, auch jetzt hat er Geld fürs Ausland – was sucht er also hier? Allen leuchtet ein, daß er nicht um Geldes willen zu seinem Vater gekommen ist, denn der Vater würde ohnehin bestimmt keines geben. Trinkgelage und Ausschweifungen liebt er nicht; der Alte aber kommt ohne ihn nicht aus, so gut leben sie miteinander!« Das stimmte; der junge Mann hatte sogar spürbaren Einfluß auf den Alten; man konnte beinahe schon sagen, er füge sich dann und wann dem Sohn, wenn er auch über die Maßen und manchmal sogar verbissen eigenwillig blieb; von Zeit zu Zeit immerhin benahm er sich ein wenig anständiger.
Erst später stellte sich heraus, daß Iwan Fjodorowitsch nicht zuletzt auf Bitten und in Angelegenheiten Dmitri Fjodorowitschs, seines älteren Bruders, gekommen war, den er bei dieser Gelegenheit, das heißt nach seiner Ankunft, überhaupt erst von Angesicht kennenlernte, mit dem er aber aus einem wichtigen Anlaß, der freilich mehr Dmitri Fjodorowitsch betraf, schon vor seiner Reise von Moskau hierher in Briefwechsel getreten war. Um welchen Anlaß es sich handelte, wird der Leser zu gegebener Zeit im einzelnen erfahren. Dennoch sah ich auch dann, als ich über diesen besonderen Umstand schon Bescheid wußte, in Iwan Fjodorowitsch eine rätselhafte Persönlichkeit, und sein Aufenthalt bei uns schien mir trotz allem unerklärlich.
Ich füge hinzu, daß es damals so aussah, als sei Iwan Fjodorowitsch der Vermittler und Versöhner zwischen dem Vater und dem älteren Sohn, Dmitri Fjodorowitsch, der im Begriffe war, einen großen Streit zu entfachen und gegen den Vater sogar in aller Form einen Prozeß zu führen.
Die kleine Familie, ich wiederhole es, hatte sich in jenen Wochen zum erstenmal überhaupt in voller Zahl versammelt, und einige, die zu ihr gehörten, hatten einander zum erstenmal im Leben gesehen. Einzig der jüngste Sohn, Alexej Fjodorowitsch, lebte damals schon ein ganzes Jahr in unserer Stadt, war also früher als seine Brüder zu uns gekommen. Über ihn, Alexej, in dieser meiner Vorgeschichte zu berichten, ehe ich ihn im Roman auftreten lasse, fällt mir am schwersten. Aber auch ihn werde ich vorstellen müssen, wenigstens um von vornherein in einem sehr merkwürdigen Punkte Klarheit zu schaffen, nämlich: Ich bin gezwungen, meinen künftigen Helden gleich in der ersten Szene seines Romans in der Kutte des Klosternovizen, des Dienenden Bruders, vorzustellen. Ja, ein Jahr schon hatte er damals in unserem Kloster verbracht, und es schien, als sei er entschlossen, sich fürs ganze Leben dort einzuschließen.
4 Der dritte Sohn, Aljoscha
Er zählte damals nicht mehr als zwanzig Jahre (sein Bruder Iwan stand im vierundzwanzigsten und der Älteste, Dmitri, im achtundzwanzigsten Jahr). Zuallererst will ich den Leser darüber unterrichten, daß dieser junge Mann, Aljoscha, keineswegs ein Fanatiker und, zumindest nach meiner Auffassung, auch ganz und gar kein Mystiker war. Von vornherein sage ich klar meine Meinung: Er hatte sich einfach früh der Menschenliebe verschrieben, und wenn er den Weg zum Mönchsleben eingeschlagen hatte, so deshalb, weil dieses ihn damals ganz und als einziges in seinen Bann zog und er in ihm sozusagen das Ideal eines Ziels für seine Seele sah, die mit Macht aus der finsteren Falschheit dieser Welt zum Licht der Liebe drängte. Und in seinen Bann gezogen hatte ihn das Mönchsleben wiederum nur, weil er dort, so meinte er, einem ungewöhnlichen Manne begegnet war: unserem berühmten Kloster-Starez Sossima; ihm schloß er sich mit der ganzen glühenden ersten Liebe seines dürstenden Herzens an. Ich bestreite dabei keineswegs, daß er immer, eigentlich von der Wiege an, sehr sonderbar gewesen war. Übrigens habe ich schon erwähnt, daß er das Bild seiner Mutter, die er doch verloren hatte, als er noch nicht vier Jahre zählte, fürs ganze Leben in sich bewahrte; er sah ihr Gesicht, spürte ihre Liebkosungen, »genau als stünde sie lebendig vor mir«. Solche Erinnerungen können (das wissen alle) selbst in noch frühere Kindheit zurückreichen, sogar ins zweite Lebensjahr; aber sie bleiben dann fürs ganze Leben nur wie Lichttupfen, die aus dem Finsteren hervortreten, bleiben gleichsam eine Ecke, die von einem riesigen Gemälde abgerissen ist, einem sonst ganz erloschenen und verschwundenen, nur in diesem winzigen Rest noch vorhandenen Gemälde. Geradeso war es bei ihm: Er erinnerte sich an einen Abend, einen stillen Sommerabend, an ein offenes Fenster, an die flach einfallenden Strahlen der untergehenden Sonne (die flachen Sonnenstrahlen hatten sich ihm am tiefsten eingeprägt), an das Heiligenbild in der Zimmerecke, vor ihm das brennende Lämpchen und vor dem Heiligenbild mit dem Lämpchen seine Mutter; sie kniet, sie schluchzt wie außer sich, wie im Krampf, weint laut, schreit auf, hält mit beiden Armen ihn umschlungen, drückt ihn an sich, daß es ihm weh tut, und betet für ihn zur Muttergottes; dann löst sie den Ring ihrer Arme, faßt ihn mit beiden Händen und hebt ihn dem Heiligenbild entgegen, als wolle sie ihn unter den Schutz der Muttergottes stellen … und plötzlich stürzt die Kinderfrau herein und reißt ihn erschrocken von ihr los. Was für ein Bild! Aljoscha konnte auch noch das Gesicht seiner Mutter beschreiben, wie es in diesem Augenblick war: Es sei von Raserei gezeichnet gewesen, sagte er, aber wunderschön – so wenigstens habe er es im Gedächtnis. Freilich vertraute er diese Erinnerung nicht gern jemand an. In der Kindheit und der Jugend war er wenig mitteilsam, geradezu wortkarg, aber nicht aus Mißtrauen, nicht aus Schüchternheit oder finsterer Menschenscheu; es war eher etwas ganz Entgegengesetztes: eine gewisse Sorge, die er in sich trug, die nur ihn anging, andere nicht betraf, ihm aber so wichtig war, daß er ihretwegen gleichsam die anderen vergaß. Die Menschen aber liebte er; es war, als lebe er sein ganzes Leben in vollkommenem Glauben an die Menschen; dabei wurde er niemals und von keinem als Einfaltspinsel, als Naivling angesehen. Er hatte etwas an sich, was erkennen ließ (und so blieb es dann sein Leben lang), daß er nicht Richter über die Menschen sein wolle, daß er nicht willens sei zu verurteilen, daß er um keinen Preis den Stab über jemand brechen werde. Es schien sogar, als lasse er, ohne im mindesten zu verurteilen, wenn auch oft mit bittrem Schmerz, alles gelten. Mehr noch: In dieser Haltung ging er so weit, daß keiner ihn verblüffen, keiner ihn erschrecken konnte; und so war es schon in seiner frühesten Kindheit. Als er im zwanzigsten Lebensjahr zu seinem Vater kam, buchstäblich in eine Höhle schmutzigen Lasters, er, der Keusche und Reine, da entschied er sich, wenn ihm das Zusehen unerträglich wurde, einfach stumm fortzugehen; aber keinen einzigen ließ er spüren, daß er ihn verachte oder verurteile. Der Vater wiederum, der als einstiger Krippenreiter ein feines Organ für Kränkungen hatte, begegnete ihm anfangs mißtrauisch und mürrisch (»der schweigt mir zuviel; wer weiß, was der für Gedanken wälzt«); bald jedoch, nach kaum zwei Wochen, hatte er seine Haltung ganz geändert; schrecklich oft umarmte und küßte er von nun an den Sohn – er tat es mit der Rührseligkeit des Säufers und den Tränen des Rauschs, doch man spürte, er hatte ihn liebgewonnen, aufrichtig und herzlich und so, wie es einem Menschen seines Schlages natürlich im Grunde gar nicht gegeben war, jemand jemals zu lieben. Überhaupt liebten alle diesen jungen Mann, wo immer er erschien; ja, schon das Kind hatten sie geliebt. Als er ins Haus seines Wohltäters und Erziehers, Jefim Petrowitsch Polenows, gebracht worden war, nahm er in dieser Familie alle so für sich ein, daß er seinen Pflegeeltern ganz wie zum leiblichen Sohne wurde. Und unsinnig wäre es gewesen, bei einem so kleinen Kinde, wie er es war, als er ins Haus kam, etwa Berechnung, Schlauheit, Intrigantentum zu vermuten oder zu glauben, er lege es listig darauf an, sich beliebt zu machen. Die Gabe, zu bewirken, daß die anderen ihm eine besondere Zuneigung schenkten, lag sozusagen in seiner Natur, er tat nichts hinzu, erkünstelte nichts. Dasselbe zeigte sich bei ihm in der Schule; man hätte doch glauben sollen, er gehöre gerade zu den Kindern, die das Mißtrauen ihrer Kameraden auf sich ziehen, manchmal auch Spott, sogar Haß. Zum Beispiel hing er oft seinen Gedanken nach und hielt sich dann abseits. Von früher Kindheit an zog er sich gern zurück, um Bücher zu lesen. Trotzdem waren ihm bald auch seine Kameraden so zugetan, daß man ihn während seiner ganzen Schulzeit ohne Übertreibung den allgemeinen Liebling nennen konnte. Selten war er ausgelassen, selten auch nur lustig, aber alle merkten, wenn sie ihn nur ansahen, daß er darum keineswegs von mürrischem Wesen war, sondern im Gegenteil: ausgeglichen und heiter. Er hatte keine Lust, sich unter den Altersgefährten hervorzutun. Vielleicht fürchtete er gerade deshalb keinen, und bei alledem begriffen die Jungen sofort, daß er sich mit seiner Furchtlosigkeit keineswegs brüstete; er schien gar nicht zu bemerken, daß er kühn und furchtlos war. Kränkungen trug er niemals nach. Es kam vor, daß er dem, der ihn gekränkt hatte, schon eine Stunde später wieder antwortete oder daß er von sich aus mit ihm zu sprechen begann, und zwar mit so argloser und heiterer Miene, als wäre zwischen ihnen gar nichts gewesen. Es sah dann auch nicht so aus, als wäre ihm die Kränkung im Augenblick entfallen oder als raffte er sich auf, sie zu verzeihen; nein, er nahm die Sache einfach nicht als Kränkung, und davor streckten die Kameraden bedingungslos die Waffen. Eine einzige Eigenart hatte er, die in allen Klassen des Gymnasiums, schon in der untersten und selbst noch in den oberen, seine Gefährten ständig reizte, über ihn zu spötteln – aber nicht boshaft, sondern gutmütig, nur weil es sie fröhlich machte. Diese Eigenart bestand in seiner ganz naturhaften und unbezähmbaren Schamhaftigkeit und Keuschheit. Er konnte gewisse Wörter und gewisse Reden über die Frauen einfach nicht mit anhören. Diese »gewissen« Wörter und Reden lassen sich unglücklicherweise in den Schulen nicht ausrotten. Jungen, geradezu noch Kinder, rein in der Seele und im Herzen, finden sehr oft Gefallen daran, heimlich unter sich oder sogar laut über Dinge und Vorstellungen zu sprechen, über die sich mitunter selbst Soldaten nicht äußern mögen, ja, es gibt wohl manches, was auf diesem Gebiete die Soldaten gar nicht wissen und begreifen, was jedoch den noch so jungen Söhnen unserer gebildeten und feinen Gesellschaft durchaus schon bekannt ist. Um moralische Verderbnis wird es sich hier kaum handeln, auch nicht um echten, lasterhaften, aus dem Inneren kommenden Zynismus, wohl aber um äußeren, und dieser eben gilt bei ihnen nicht selten sogar als etwas Schickes, Frisches, Forsches, Nachahmenswertes. Sahen die Kameraden, daß ihr lieber Aljoschka Karamasow, sobald sie nur »davon« zu reden begannen, sich schnell die Ohren zuhielt, so umringten sie ihn manchmal in großer Zahl, rissen ihm die Hände vom Kopf und schrien ihm die schmutzigen Wörter in beide Ohren; Aljoscha aber suchte freizukommen, warf sich auf den Boden, verhüllte den Kopf, und bei alledem sprach er kein Wort, schalt keinen, ertrug stumm die Kränkung. Am Ende ließen sie ihn dann doch in Ruhe, hießen ihn auch nicht mehr »die Jungfer«, bedachten ihn eher, was dies betraf, mit einigem Mitleid. Im Unterricht war er immer einer der Besten, aber niemals kam er auf den besonderen Platz des Ersten.
Als Jefim Petrowitsch gestorben war, blieb Aljoscha noch zwei Jahre auf dem Gouvernementsgymnasium. Die untröstliche Witwe Jefim Petrowitschs reiste bald nach seinem Tode mit ihrer ganzen einzig aus weiblichen Personen bestehenden Familie für lange Zeit nach Italien, und Aljoscha geriet in das Haus zweier Damen, entfernter Verwandter Jefim Petrowitschs, die er vorher nie gesehen hatte; welche Absprachen da über ihn getroffen worden waren, wußte er selbst nicht. Auch dies kennzeichnete ihn – und zwar in hohem Maße –, daß es ihn niemals kümmerte, wer eigentlich für seinen Unterhalt aufkam. Darin war er das genaue Gegenteil seines älteren Bruders, Iwan Fjodorowitschs, der sich in seinen ersten beiden Universitätsjahren mühselig durchschlug, indem er sich von eigener Arbeit ernährte, und der es von Kindheit an als bitter empfand, bei einem Wohltäter zu leben und fremdes Brot zu essen. Doch offenbar sah niemand Anlaß, über diesen Charakterzug Alexejs sehr streng zu urteilen, denn jeder kam, wenn er ihn auch gerade erst oberflächlich kennengelernt hatte, im Blick auf diese Dinge sogleich zu dem sicheren Schluß, daß Alexej jedenfalls zu den Jünglingen gehörte, die etwas vom russischen Gottesnarren an sich haben – mag so einem auf einmal ein ganzes Vermögen zufallen, es macht ihm nichts aus, es sofort, bei der ersten Gelegenheit, wegzugeben, ganz gleich, ob es da um ein gutes Werk geht oder ein geschickter Gauner ihn anbettelt. Überhaupt schien er den Wert des Geldes nicht zu kennen, was natürlich nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen ist. Er bat nie um Taschengeld, aber wenn er welches bekam, wußte er entweder wochenlang nichts damit anzufangen, oder er ging schrecklich achtlos damit um, hatte es im Nu ausgegeben. Pjotr Alexandrowitsch Miussow, ein Mensch, der in Geldangelegenheiten und in allem, was bürgerliche Ehrenhaftigkeit betraf, höchst empfindlich reagierte, tat einmal – später – über Alexej, den er genau beobachtet hatte, den bedeutsamen Ausspruch: »Er ist vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, den ihr plötzlich in den Straßen einer ihm fremden Millionenstadt allein lassen könnt, ohne Geld, und der ganz bestimmt nicht untergehen, nicht verhungern, nicht erfrieren wird, weil man ihm sogleich Speise und Trank geben, ihm sogleich Unterkunft bieten wird, und tut man’s nicht, so wird er sich selbst sogleich Unterkunft verschaffen, und das wird ihn keinerlei Mühe und keinerlei Erniedrigung kosten, und dem, der ihn aufnimmt, wird das keinerlei Last bedeuten, sondern im Gegenteil: eine Freude.«
Sein Gymnasium besuchte er nicht bis zum Schluß; es fehlte ihm noch ein ganzes Jahr, da erklärte er überraschend seinen Damen, er werde in einer Angelegenheit, die ihm in den Sinn gekommen sei, zu seinem Vater fahren. Den Damen tat es sehr leid um ihn, sie wollten ihn nicht fortlassen. Die Fahrt kostete nicht viel, und die Damen duldeten nicht, daß er seine Uhr versetzte – die Angehörigen seines Wohltäters hatten sie ihm vor ihrer Abreise ins Ausland geschenkt –; vielmehr statteten sie ihn reich mit Mitteln aus, sogar mit neuen Kleidern und neuer Wäsche. Er jedoch gab ihnen die Hälfte des Geldes zurück und bemerkte dazu, er wolle auf jeden Fall die dritte Klasse benutzen. Dann, in unserer Stadt angelangt und vom leiblichen Vater sogleich darüber befragt, wieso er ihn mit seinem Besuch beehre, da er doch mit dem Gymnasium noch nicht fertig sei, gab Alexej keine rechte Antwort; es heißt nur, er sei ungewöhnlich in sich gekehrt gewesen. Bald stellte sich heraus, daß er das Grab seiner Mutter sehen wollte. Er versuchte damals sogar selbst, sein Kommen einzig damit zu erklären. Und doch wird dies kaum der ganze Grund gewesen sein. Am ehesten ist anzunehmen, daß er zu jener Zeit selbst nicht wußte und beim besten Willen nicht hätte erklären können, was da eigentlich mit einem Mal in seiner Seele aufgebrochen war und ihn unabweisbar auf einen neuen, unbekannten, aber ihm schon zwingend vorgezeichneten Weg drängte. Fjodor Pawlowitsch konnte ihm nicht sagen, wo er seine zweite Frau begraben hatte; denn seitdem der Sarg unter der Erde war, hatte er diesen Ort nie wieder aufgesucht, und mit den Jahren war er ihm ganz aus dem Gedächtnis geschwunden.
Da gerade von Fjodor Pawlowitsch die Rede ist: Er hatte inzwischen längere Zeit nicht in unserer Stadt gewohnt. Drei oder vier Jahre nach dem Tode seiner zweiten Frau war er nach Südrußland gefahren und hatte bald hier, bald dort, schließlich aber mehrere Jahre in Odessa gelebt. Nach seinen eigenen Worten hatte er sich »erst mal mit etlichen Jidden, Jiddchen, Jid