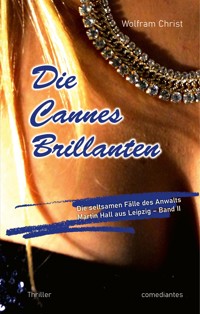
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: comediantes - Verlag für Lyrik und Belletristik des 21. Jahrhunderts
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die seltsamen Fälle des Anwalts Martin Hall aus Leipzig
- Sprache: Deutsch
1999. Filmfestspiele in Cannes. Südfrankreich. Eine internationale Gang plant den größten und spektakulärsten Brillanten-Raub aller Zeiten. Es geht um jenen Schmuck, den Hollywood-Schönheiten wie Catherine Zeta-Jones und Julia Roberts hier auf dem roten Teppich tragen. Schmuck, für diesen Zweck aus Werbegründen vom Sponsor des Festivals leihweise zur Verfügung gestellt. Der Coup gelingt. Die Bande erbeutet Ketten, Ringe und Ohrgehänge im Wert von weit über hundert Millionen Schweizer Franken. Ein fast perfektes Verbrechen. Sieben Jahre später taucht das sogenannte "Roberts-Collier", eine der wertvollsten Preziosen aus dem Raub, bei Sotheby's in London auf. Anwalt Martin Hall erhält den Auftrag, den Überbringer zu verteidigen. Keine große Sache, wie es scheint. Halls Recherche allerdings wirbelt Staub auf. Er löst mit seiner Suche nach der Wahrheit eine ungeheuerliche Mordserie aus. Verkompliziert wird die Recherche durch seine neue Angebetete. Die attraktive aber ziemlich überdrehte Malerin Corinne Blair besteht darauf, ihn zu begleiten und ihm zu assistieren. Eine blutige Spur führt Hall und Blair in der Folge über Amsterdam, Gibraltar, Córdoba und New York bis nach New Orleans. Je tiefer sie in den Sumpf des Verbrechens eintauchen, desto mehr verwischen die Konturen von Gut und Böse, Opfer und Täter. Ein äußerst brutaler Wettlauf auf Leben und Tod beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfram Christ
Die Cannes Brillanten
Thriller
1. Auflage der überarbeiteten Neuausgabe
comediantes
Verlag für Lyrik und Belletristik des 21. Jahrhunderts
Lektorat: Uta Christ
e-book / EPUB
ISBN 978-3-946691-15-0
© 2020 www.comediantes.de
Erstveröffentlichung 2012 im AAVAA-Verlag Berlin
Um ein Buch, ein Gemälde, ein Musikstück zu schaffen, bedarf es Menschen,die der Phantasie der Künstlerin beziehungsweise des Künstlersauf die Sprünge helfen;es bedarf Freunden, Partnern,die ihr oder ihm Vertrauen schenken undMut machen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen,die mit Rat und Tat helfen, das begonnene Werk zu vollenden.
Danke Susann!
Inhalt
Lasst die Spiele beginnen – Cannes (Frankreich) im Mai 1999
Ein kleiner Gefallen – Biala (Bulgarien) im August 2006
Von Staatsanwälten und Oligarchen
Spurensuche in Amsterdam
The Rock
Die Augen des Todes
Eine Falle für Calderón
Auf dem Mississippi
Wer das Lied vom Tod spielt
Vom freien Willen und anderen Unwägbarkeiten
Lasst die Spiele beginnen – Cannes (Frankreich) im Mai 1999
Auf geradezu unverschämt laszive Weise schwenkte die Kamera langsam über die atemberaubenden Beine von Catherine Zeta-Jones. Ihr hochgeschlitztes rosafarbenes Kleid ließ der Phantasie kaum Spielraum. Umschnitt. Am Hals über ihrem tiefen Dekolletee glitzerten dezent in Weißgold gefasste Diamanten und Saphire. Ebenso in den filigranen Ohrgehängen, die ihr strahlendes Lächeln auf das Vorteilhafteste unterstrichen. Sie funkelten im Blitzlichtgewitter mit den Augen der Diva um die Wette. Ihr Begleiter auf dem roten Teppich, der von Natur aus ziemlich glamouröse Sean Connery, wirkte neben dieser grandiosen Selbstinszenierung fast wie ein Kleindarsteller. Die Fotografen und Kameraleute nahmen seine Anwesenheit an der Seite der bezaubernden Schönheit zur Kenntnis. Mehr nicht. Er trug es mit der ihm eigenen Gelassenheit.
„Wieso ist die Zeta-Jones eigentlich dabei?“ fragte Paul und drehte den Ton des Fernsehers leiser. „Die hat hier gar keinen Film im Wettbewerb oder hab ich was verpasst?“
„Dabei sein ist alles. Sich zeigen. Davon verstehst du nichts“, antwortete Chiara. Sie dehnte sich und schob ihre Füße vorsichtig zwischen die Gläser, die auf dem niedrigen Glastischchen standen. „Ihr aktueller Thriller hat gerade den Europäischen Filmpreis abgeräumt. Er heißt ‚Verlockende Falle‘. Der Streifen läuft in den meisten Ländern demnächst an. Da kann bisschen Publicity in Cannes vorab nicht schaden. Auch mit Blick auf den Oskar im kommenden Jahr. Deswegen ist heute am Eröffnungsabend Filmpartner Connery bei ihr und nicht Ehemann Michael Douglas.“
„Verlockende Falle? Worum geht’s?“
„Die Beiden nutzen die Uhrenumstellung Silvester 2000, um einen Haufen Geld auf ihr Konto zu leiten. Ziemlich raffiniert.“
„Hab ich gesehn“, schniefte Simon und schob sich die nächste Portion Chips in den Mund. „Im Internet. Hab ich mir von ‘nem russischen Portal gezogen. Coole Nummer. Die Mutter gibt dabei ‘ne wirklich heiße Superdiebin.“
„Genau so heiß wie Chiara?“ witzelte Paul. Simon blickte kauend über seinen Brillenrand zum Sofa und musterte die Frau. Sie erwiderte seinen Blick. Simon verschluckte sich und erlitt einen Hustenanfall. „Aha.“ Paul Vandenberg grinste. „Verstehe, Chiara ist heißer!“ Er versuchte, ihr den Arm um die Schulter zu legen. Sie schüttelte ihn ab. Dabei spürte sie, dass sie inzwischen von allen drei Männern angestarrt wurde. Selbst der Blick des Bosses ruhte auf ihr. Chiara verzog das Gesicht. Eine unangenehme Stille entstand.
„Lasst den Quatsch!“ knurrte Terri Matisse schließlich und wandte sich wieder dem Fernseher zu. „Ich habe euch engagiert, weil ihr die Besten in eurem Job seid und nicht, weil wir hier ein Flirtfestival veranstalten. Schreib lieber mit, Paul, wer was trägt. Wir brauchen eine genaue Liste.“
„Ist ja gut.“ Der Holländer griff zu Zettel und Stift. „Ich finde trotzdem, dass Chiara eine gewisse Ähnlichkeit mit der Zeta-Jones hat. Und dass die jetzt so was spielt? Ist doch witzig, oder?“
Auf dem roten Teppich vor dem Festivalkino gab gerade der unvermeidliche Gerard Depardieu ein Interview. Als nächste waren Sophie Marceau, Catherine Deneuve, Altmeister Alain Delon und das neu ins Metier strebende Model Laetitia Casta angekündigt. Die gesamte französische Filmelite. So wie jedes Jahr im Mai an der Côte d’Azur. Dazu etliche Hollywood-Stars. George Clooney zum Beispiel werde in Kürze erwartet, hieß es. Dogma-Papst Lars von Trier aus Dänemark nebst Gespielinnen. Selbst ein paar Deutsche und Italiener durften nicht fehlen. Dazu die Exoten aus Fernost. Ein wirklich bunter Haufen exzellenter Künstler.
Den Schmuck, den sie zur Schau trugen, stellte die Edelmanufaktur Chopard zur Verfügung. Ausnahmslos. Die Schweizer hatten seit ein paar Jahren einen Exklusivvertrag mit dem Filmfestival. Sie sponserten das Branchentreffen und den Preis, die Goldene Palme.
Im Gegenzug hatten die angereisten Damen die angenehme Pflicht, sich für die wichtigsten Abendveranstaltungen leihweise mit den aktuellen Schmuckkollektionen von Chopard behängen zu lassen. Gewissermaßen als lebende Anziehpuppen für ein Schaufenster, das von der ganzen Welt begutachtet wurde. Viele der Stücke würden bereits in den kommenden Tagen ersteigert werden. Teils von jenen Superreichen, die zum Festival mit ihren Jachten in Cannes persönlich vor Anker gingen und Partys veranstalteten, teils von Kunden, die sich nach den Fernsehbildern umgehend telefonisch bei Chopard meldeten, um gesehene Stücke reservieren zu lassen. Wobei etliche dieser Kunden mindestens ebenso sehr Filmfans waren wie Schmuckliebhaber. Die Frage, welcher Star welches Geschmeide am Eröffnungsabend angelegt hatte, konnte im Wettbewerb mehrerer Bieter den Preis erheblich in die Höhe treiben.
Für den Sponsor des Festivals ein lohnendes Geschäft. Die ersten Nachfragen wurden für den Morgen nach der Eröffnung erwartet. Dann würde im Hotel Martinez, in dem die Schweizer Juweliere fünf Suiten für Stilberatung und Verkauf gemietet hatten, Hochbetrieb herrschen. Die ausgeliehenen Diademe, Colliers, Ketten, Ringe, Armreifen, Ohrringe, Clips, Broschen und so weiter würden von Bodyguards zurück gebracht, von Angestellten der Firma Chopard entgegengenommen, registriert und sorgfältig verpackt werden. Experten würden jedes Stück gründlichst auf Echtheit oder Beschädigung überprüfen. Wachleute patrouillierten lange vorher in und vor den Suiten. Unzählige zusätzliche Kameras waren im betreffenden Flur und den Zimmern installiert worden. Im Keller hatten sie eigens eine zentrale Überwachungseinheit mit hochauflösenden Monitoren für das komplette Hotel eingerichtet. Spätestens 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit sollte der Verkauf offiziell beginnen.
„Eh, guckt mal!“ tönte Simon, der Techniker des Teams, mit vollen Backen. „Ist das nicht die ‚Pretty Woman‘?“ Chiara Visconti sprang vom Sofa.
„Bow, ist das geil! Was hat die denn am Hals? Paul, weißt du, was das für ein blauer Klunker ist, den die Roberts umhängen hat?“
„Logisch. Der war schon länger avisiert. Das ist der ‚Blue Sea Star‘. Ein blauer Diamant. Chopard hat ihn letztes Jahr in Amsterdam ersteigert. Stammt von De Beers. Exquisiter Schliff. Das genaue Gewicht in Karat hab ich zwar gerade nicht im Kopf, aber wenn ich mich nicht täusche, hat der damals über 13 Millionen Schweizer Franken gekostet. Moment, ich seh nach. Hier hab ich’s: 13,65 Millionen. Natürlich nicht in einem Collier verarbeitet. Zusammen mit der Goldschmiedearbeit dürfte er den nächsten Käufer mindesten 15 oder 16 Millionen kosten.“ Terri runzelte die Stirn.
„Unter Liebhabern, nachdem er bei Julia Roberts auf dem Busen gelegen hat?“
„Ach so, stimmt. Na ja. Wenn da so ein paar Spezis aus Arabien oder China mitmischen, fast das Doppelte, könnte ich mir denken. Kommt auf die Nachfrage an.“
„Echt?“ prustete Simon. Er rollte mit den Augen. Der Teppich vor seinem Sessel war mit Chipkrümeln übersät. Terri dachte nach.
„Und alles zusammen? Was schätzt du? Was wir bis jetzt hier gesehen haben und das, was vermutlich noch in den Tresoren im Hotel für die kommenden Tage liegt?“
„Tja, wenn ich die Wertsteigerung durch Roberts, Casta und Co. einbeziehe und davon ausgehe, dass ein paar potente Kunden und Fans der Damen kurz vor der Jahrtausendwende auf Nummer sicher gehen wollen … 100 bis 150 Milliönchen dürften’s werden.“ Terri nickte.
„Mehr als ich erwartet hatte. Liegt vielleicht wirklich an der Jahrtausendwende.“ Simon gab auf. Er konnte nicht mehr an sich halten, knüllte die leere Chipstüte zusammen, kickte sie Richtung Küche und jubelte:
„Scheiß die Wand an! Wenn das mein Alter noch erleben könnte! Sein missratener Sohn ist reich. Der kleine schwarze Scheißer aus der Bronx, den alle immer nur in den Arsch getreten haben, weil er chemische Formeln geiler fand als Gangsta Rap. Fuck! Ich werd die ganzen Idioten mit meinem Geld zuscheißen!“
„Nichts wirst du!“ Terri fluchte. „Darüber hatten wir geredet. Wir müssen erst Käufer finden und dann wirst du einen Teufel tun, mit Geld um dich zu schmeißen.“
„Vor allem in der Bronx!“ ereiferte sich Paul. „Du hast sie wohl nicht mehr alle? Willst du uns der Polizei auf dem Silbertablett servieren?“
„Es reicht, Paul.“ Terri hatte sich wieder im Griff. „Simon?“
„Okay Boss.“
„Gut. Versucht heut Abend, beizeiten zu schlafen. Wir müssen früh raus. Jeder von uns weiß, was zu tun ist. Und jetzt kein Gezänk mehr! Gute Nacht!“ Er stand auf und trat hinaus auf die Terrasse. Die milde Abendluft streichelte sanft durch die Büsche vorm Haus. Von Ferne hörte er die Wellen des Mittelmeeres auf den Strand laufen. Der Maihimmel über Cannes war sternenklar. Chiara trat zu ihm.
„Was denkst du?“ fragte sie.
„Nichts.“
„Haben wir etwas übersehn?“
„Ich hoffe nicht.“
„Sollte was schief gehen: Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten, Terri.“ Terri lächelte.
„Danke gleichfalls.“ Netter Kerl, dachte Chiara. Wie alt mag er sein? Anfang 50? Sein Haar wird langsam dünn. Könnte mein Vater sein. Ich glaube, so einen Vater hätte ich gern gehabt.
„Und woran denkst du gerade, schöne Frau?“ Sie sah ihm in die Augen.
„Ist Terri Matisse dein richtiger Name?“
„Ja. Ich hasse es, wenn jemand mit gezinkten Karten spielt.“
„Bist du mit dem Maler verwandt?“ Der Boss lachte.
„Das fragen mich alle. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Weitläufig. Keine Ahnung. Meine Eltern liebten auf alle Fälle seine Bilder. Ich bin mit ihnen aufgewachsen.“ Chiara nickte.
„Dann bist du ein Mann, der nie Geldschwierigkeiten kannte, oder?“
„Nein.“
„Warum machst du dann so etwas?“
„Weil es Spaß macht.“
„Nur deshalb?“ Er zuckte mit den Schultern.
„Und warum machst du mit?“
„Weil es Spaß macht.“ Terri betrachtete die Frau, die neben ihm stand und den Wellen lauschte. Sie musste nicht alles über ihn wissen. Was wusste er schon von ihr? Vater Italiener, Mutter Französin. Offiziell: Innenarchitektin. Inoffiziell: Eine brillante Diebin. Beide Jobs ergänzten sich ideal. Wer eine Wohnung einzuräumen versteht, weiß auch, wie er sie am leichtesten ausräumt. Ein einziges Mal hatte sie gepatzt. Das war, als sie bei ihm einzubrechen versuchte. Er hatte sie auf frischer Tat ertappt, verzichtete jedoch auf eine Anzeige. Ihm kam der Gedanke, dass ihm die neue Bekanntschaft mehr nutzen konnte, wenn sie sich auf freiem Fuß befand. Er täuschte sich nicht. Nur dank ihrer einschlägigen Erfahrungen hatte er diesen präzisen Plan ausarbeiten können. Von ihm kam die Idee. Das nötige Kleingeld für die Vorbereitungen sowieso. Chiara brachte das Knowhow mit. Zum Beispiel einen wunderbar gefälschten französischen Personalausweis, mit dem „Madame Marianne Lacroix“ dieses Ferienhaus anmieten konnte. Er freute sich auf die langen Gesichter der Cops. Denn, dass sie ihnen bis hierher auf die Spur kommen würden, stand zu erwarten. Weiter nicht. Davon war er überzeugt.
Unabhängig voneinander erkundeten sie das Hotel Martinez. Jeder mit seinen Mitteln und Möglichkeiten. Terri hatte ein paar Tage Urlaub dort verbracht. Chiara arbeitete beim Zimmerservice. Attraktive junge Damen waren in Hotels an der französischen Mittelmeerküste immer gefragt. Erst recht solche, die neben dem üblichen Französisch fließend Englisch und Italienisch sprachen.
Den Holländer, einen Fachmann für edle Steine und Schmuck mit einschlägigen Beziehungen zu Händlern und Hehlern, kannte Terri länger. Seit drei oder vier Jahren, wenn er sich recht erinnerte. Paul Vandenberg galt in seinen Kreisen nicht gerade als Koryphäe. Dafür war er zu oberflächlich. Wohl aber hatte er sich als seriöser Makler einen Namen gemacht. Gerade in grenzwertigen Fällen. Man munkelte, er arbeite mit einem Gewährsmann zusammen, der über die nötigen Kontakte in die Unterwelt verfüge. Einem gewissen Calderón. Ein Phantom. Keiner konnte behaupten, Calderón jemals gesehen zu haben. Vielleicht existierte er auch nur in Pauls Kopf. Als Legende, um von realen Geschäftspartnern abzulenken.
Paul ging entsprechenden Nachfragen konsequent aus dem Weg. „Mund halten!“ lautete sein oberstes Geschäftsprinzip. Auch darum hatte Terri gerade ihn für den Job ausgewählt. Man konnte sich auf ihn verlassen. Dass er Simon und Chiara gegenüber den großen Zampano spielte, hing mit dem Projekt zusammen. Weil sie Paul für den Verkauf der Beute brauchten, fühlte der sich am längeren Hebel. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben.
Simon Brown hatte Chiara empfohlen. Der junge Schwarze mit der Sportbrille war ein Bastler und Tüftler vor dem Herrn. Er hackte die Computer der Polizei, lud für seine Kunden deren Einsatzpläne herunter. Auf Wunsch montierte er aus Spielzeugteilen Miniroboter oder Drohnen. Nützliche ferngesteuerte Dinge, mit denen sich andere nützliche Dinge ausbaldowern ließen. Damit verdiente er sein Geld. Sein Hobby hingegen lag mehr im Bereich der Chemie. Er hatte sich im Keller ein kleines Labor eingerichtet, in dem er gern mit verschiedenen Gasen und Sprengstoffen experimentierte. Chiara meinte, dass sie so einen Spezialisten in mehrerlei Hinsicht brauchen könnten. Als er zustimmte, dachte Terri zunächst vor allem an das Sicherheitssystem. Aber schon da zeigte es sich, dass Simon tatsächlich ein Gewinn für die kleine Truppe darstellte. Er hörte sich sämtliche Statusberichte an, ließ sich die Skizzen zeigen und meinte dann:
„Völlig unmöglich! Die Überwachung ist perfekt.“ Sein Fazit: So etwas zu knacken, funktioniere nur im Kino. Mission impossible. Definitiv. Keine Chance, an die Hotelsafes ranzukommen, geschweige denn, sie zu öffnen. Ein Einbruch in der Nacht käme so wenig infrage wie ein bewaffneter Überfall bei Tage. Punkt.
Was ihn nicht daran hinderte, eine Alternative vorzuschlagen. Eine Alternative, die realistisch schien und erheblich einfacher klang als der ursprüngliche Plan. Vorausgesetzt, Simons Equipment hielt, was es versprach.
„Ich geh dann mal, Boss.“
„Schlaf gut, Chiara!“
„Du auch.“ Sie drückte ihn kurz und verschwand im Haus. Terri sah ihr nach. Die samtene Mailuft tat ihm gut.
Der Vormittag nach dem Eröffnungsabend brachte dem Grandhotel Martinez das erwartete Chaos. Ein kontrolliertes Chaos. Der Manager hatte für die Dauer des Filmfestivals sämtlichen Mitarbeitern Urlaubsstopp verordnet. Nahezu jede Position im Haus wurde doppelt besetzt.
Draußen, dezent etwas seitlich der Einfahrt an der Straße, parkte ein Wagen der örtlichen Polizei. Im Eingangsbereich überprüften Security-Männer einer namhaften Sicherheitsagentur jeden, der das Haus betreten oder verlassen wollte. Leibesvisitationen. Metalldetektoren. Das Versicherungsbüro Lloyds hatte eigens für die Festivaltage im Haus ein Büro gemietet. Rund um die Uhr in wechselnden Schichten besetzt. Nichts hatten die Organisatoren dem Zufall überlassen.
Das Martinez war solche Tage gewohnt. Der prächtige weiße Art-Deco-Palast strahlte Stein gewordene Tradition in den blauen Himmel über der französischen Riviera. Es ging auf halb zwölf zu. Im Restaurant „La Palme d’Or“, vom Strand lediglich durch die Straße getrennt, saßen elegant gekleidete Müßiggänger unter Palmen und Sonnenschirmen. Bei exquisiten Cocktails beobachteten sie belustigt das Treiben. Die wenigen ernster dreinblickenden Gäste tranken Wasser oder Kaffee. Polizisten in Zivil.
Ganz oben, im siebenten Stockwerk, wenn man das Erdgeschoss wie hier üblich mitrechnete, dort, wo große Balkone und Dachgärten einen phantastischen Blick übers Meer erlaubten, lagen die fünf Suiten von Chopard. Riesige Räume mit mondänen Sitzlandschaften, Spiegeln und speziell für die Filmfestspiele aufgestellten Schmuckablagen. Sie nahmen fast das gesamte Stockwerk ein. Hier oben war man vor unliebsamen Besuchern, Gaffern und ähnlichem sicher. Die Fahrstühle und die weitläufige, muschelförmig empor schwingende Haupttreppe ließen sich durch wenige Sicherheitsleute problemlos kontrollieren. Außerdem hatte der Hotelmanager an diesem Morgen offenbar eine zusätzliche Hostess abkommandiert, ein Auge auf das Treppenhaus und die Flure zu werfen. Eine äußerst attraktive Frau in goldbetresster Hotel-Livree.
Auf unkomplizierte Art und Weise half sie den aus- und eingehenden Damen und Herren, die richtige Tür zu finden. Beziehungsweise verwies sie sie freundlich aber bestimmt der Etage, wenn sie nichts mit den Juwelieren zu tun hatten. Ihre dunklen Augen strahlten professionelle Souveränität aus.
Den Sicherheitsmännern war die Anwesenheit der charmanten Hoteldame eine angenehme Ergänzung ihres wenig freudvollen Dienstes. Zumal die Lady nicht abgeneigt schien, auf gelegentliche Flirtversuche einzugehen. Überwiegend unterhielten sie sich allerdings über fachliche Fragen. Zum Beispiel darüber, dass im Fall eines Alarmes, wenn irgendwo im Haus eine Bombe detonieren würde, die Fahrstühle nicht zu benutzen seien oder wie der Evakuierungsplan mit der Hotelleitung abgestimmt sei.
Lediglich der Zimmerkellner, der sich um den Getränkenachschub in den Suiten kümmerte, wunderte sich ein wenig. Er kannte die Frau. Sie arbeitete seit ein paar Wochen im Hotel. Und zwar wie er im Room-Service. Dass man sie hier oben als Hostess einsetzte, erschien ihm seltsam. Allerdings gehörte er nicht zu jenen Leuten, die Entscheidungen der Geschäftsführung hinterfragten. Wer zu viel dachte, riskierte seinen Job. Vermutlich hatte der Manager angesichts der Gäste im Obergeschoss nach optischen Kriterien entschieden. Das war im Hotelgewerbe nicht ungewöhnlich.
Muriel Rüttli und Shannon Manson hatten alle Hände voll zu tun. Die beiden Chopard-Managerinnen leiteten das operative Geschäft in den fünf Suiten. Einerseits gab es für sie Grund zur Freude. Denn tatsächlich wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt fast alle Schmuckstücke, die gestern Abend auf dem roten Teppich unterwegs gewesen waren, pünktlich abgeliefert. Insofern stand dem Verkaufsbeginn in gut zwei Stunden nichts im Weg. Probleme ergaben sich, weil die meisten Preziosen fast gleichzeitig eintrafen und die Experten mit dem Prüfen nicht nachkamen. Es bildete sich ein Rückstau. Was bedeutete, dass es schwieriger wurde, den Überblick zu behalten. Immerhin handelte es sich in diesem Jahr bei den verschiedenen Kollektionen um nahezu 1000 Einzelexemplare.
Aufbewahrt wurden sie nachts im großen Hotelsafe im Keller. Jetzt am Tage jedoch, wenn damit gearbeitet werden musste, wurden sie sorgsam in ihren nummerierten navy-blauen Schmuckschatullen in zehn schweren, ebenfalls navy-blauen Panzerkoffern deponiert. Zwei Koffer pro Suite, lautete die Weisung, um eine zu große Anhäufung an einer Stelle zu vermeiden. Die breiten Koffer waren Spezialanfertigungen, die ausschließlich diesem Zweck dienten. Ihre Deckel wurden stehend seitlich aufgeklappt. Dabei kamen je zehn Fächer zum Vorschein. Immer eines für genau eine Schatulle. Jede Schatulle enthielt durchschnittlich zehn Schmuckteile.
„Die Zwei ist komplett!“ verkündete Muriel Rüttli.
„Beide Koffer?“ fragte ihre Kollegin. Rüttli nickte.
„In der Eins und der Fünf sind sie auch fast durch. Nur hier und in der Drei klemmt es.“ Shannon Manson hob die Schultern.
„Jeff beeilt sich, aber es sind einfach zu viele kleine Teile, und wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten leisten.“
„Hm, gut, dann geh ich mal rüber in die Drei und schaue, was ich tun kann. Ich denke, in einer halben Stunde haben wir es geschafft. Dann können wir Mittagessen gehen.“
„Geh allein. Ich hab mir Joghurt mitgebracht.“ Manson fühlte den missbilligenden Blick der Kollegin im Rücken. „Tut mir leid, ich muss abnehmen.“ Rüttli verzog das Gesicht.
„Abnehmen? Du?“ Draußen im Flur jaulte die Sirene los. „Was soll das denn?“ murrte sie und steckte den Kopf durch die Tür.
„Feueralarm!“ tönte es von den Sicherheitsleuten an der Treppe. „Das ganze Treppenhaus ist voller Rauch. Es brennt. Irgendwo unten. Keine Übung.“
„Das heißt?“
„Notfallszenario X1. Sofort evakuieren. Alle!“
„Scheiße!“
„Das ist jetzt ein Scherz, oder?“ keuchte Manson.
„Sieht nicht so aus. Sofort die Prüfungen einstellen. Alles einpacken. Zwei Koffer pro Wachmann, damit die übrigen Kollegen beide Hände frei haben. Safety first. Sie müssen uns notfalls verteidigen können. Privatkram bleibt hier. Wir treffen uns in 30 Sekunden auf dem Flur!“
Sie stürmte aus der Suite, um ihre Mitarbeiter in den Nachbarräumen anzutreiben. In Momenten wie diesen zeigte sich, wie effizient ein eingespieltes Team funktionieren konnte. In Sekundenschnelle verschwanden die Preziosen in ihren feuer- und bruchsicheren Transportbehältern. Die halbe Minute war noch nicht vorüber, da standen tatsächlich alle abmarschbereit im Flur. Fünf starke Männer mit je zwei schweren Panzerkoffern, fünf mit gezückter Waffe und alle vierzehn Mitarbeiter von Chopard.
„Und jetzt?“ fragte Manson. „Wohin?“ Die Security-Leute vom Treppenhaus dirigierten den Tross durch den Flur.
„Folgen Sie bitte den Ausschilderungen zu den Fluchtwegen. Die Fluchttreppe befindet sich am Ende des Ganges.“
„Können wir nicht die Fahrstühle …?“
„Nein. Bei Brand ausgeschlossen. Los, los lauft! Keine Diskussion. Außerdem wollt ihr sicher nicht mitten durch das Tohuwabohu im Foyer oder? Also. Beeilung Leute. An den Türen keine Batzen bilden. Die Treppe im linken Seitenflügel ist ausschließlich für euch. Sie führt zu einem separaten Ausgang.“
So altehrwürdig das Martinez auch sein mochte, seine Sicherheitstechnik befand sich auf dem neuesten Stand. Sofort mit Auslösung des Feueralarms schlossen sich im Fluchttreppenhaus automatisch alle Fenster, um den berüchtigten Kamin-Effekt zu verhindern. Die Brandschutztür vom Flur fiel hinter den Evakuierten mit lautem Knall ins Schloss. Auch sie galt als hundertprozentig luftdicht. Die Hostess kontrollierte diese Dinge persönlich, nachdem der letzte Bodyguard im Treppenhaus verschwunden war.
Offenbar funktionierte der direkte Alarmkontakt zur örtlichen Feuerwehr ebenfalls tadellos, denn kaum 60 Sekunden nach dem ersten Sirenenton raste ein Löschzug an den verdutzten Polizisten beim Haupteingang vorbei und bog in die nächste Quergasse. Wie es aussah, wussten die Feuerwehrleute sehr genau, wo es brannte und was zu tun sei.
Die Polizisten hatten strikte Anweisung, ihre Posten unter keinen Umständen zu verlassen. Wären sie der Feuerwehr gefolgt, hätten sie folgendes sehen können:
Der Löschzug hielt präzise am linken Seiteneingang. Drei Männer sprangen vom Wagen und zogen sich Gasmasken übers Gesicht. Einer von ihnen schloss die nur von innen mit einer Klinke versehene Brandschutztür auf. Die beiden anderen rannten mit einem Feuerlöscher ins Gebäude, verriegelten hinter sich wieder und öffneten das Ventil.
Der Chopard-Tross hatte zu diesem Zeitpunkt den zweiten Stock erreicht. Erfreut stellten die Frauen und Männer fest, dass unten im Erdgeschoss Helfer auf sie warteten. Dann schwanden ihnen die Sinne. Zehn blaue Panzerkoffer rutschten scheppernd die letzten Stufen hinunter. Gefolgt von der Hostess, die nun ebenfalls eine Gasmaske trug und sorgsam achtgab, auf keinen der bewusstlosen Menschen zu treten. Mit wenigen Handgriffen beförderten die Feuerwehrmänner die zehn Koffer in ihr Fahrzeug, packten den vermeintlichen Feuerlöscher ein und brausten zusammen mit der Hostess davon. Blaulicht und Martinshorn halfen ihnen, jede Kreuzung frei zu räumen, bis sie die Stadt verlassen hatten.
All das sahen die Polizisten nicht. Befehlsgemäß hielten sie tapfer vorm Haupteingang die Stellung. Ungefähr zur gleichen Zeit fanden die Security-Leute im Hauptfoyer des Grandhotel Martinez endlich den letzten der drei ferngezündeten Rauchtöpfe, die den ganzen Alarm verursacht hatten. Über Sprechfunk gaben sie ihren Kollegen bei Chopard Entwarnung. Seltsamerweise erhielten sie keine Antwort.
Ein kleiner Gefallen – Biala (Bulgarien) im August 2006
So ging Sommer. Ich rekelte mich. Von oben Sonne, unterm Badetuch feiner heißer Sand. Das Leben konnte schön sein! Einfach nur schön! Über den Rand meiner Sonnenbrille beobachtete ich die braungebrannten Mädels, die gleich nebenan Beachvolleyball spielten. Schlanke Grazien mit langem schwarzem Haar und tiefdunklen Augen. Bulgarinnen eben. Das Feuer des Südens. War es ein Fehler gewesen, Corinne in mein Ferienparadies am Schwarzen Meer einzuladen? Wobei, was hieß „einladen“? Das hatte sie genau genommen selbst gemacht. Keine Chance, ihr zu widersprechen.
„Natürlich komme ich mit! Martin Hall und Corinne Blair am Schwarzen Meer! Ein Traumpaar in Traumkulisse!“ Immer musste sie übertreiben. Sie konnte nicht anders. „Das wird phänomenal!“ Phänomenal war ihr Lieblingswort.
Ich drehte mich auf den Rücken und schloss die Augen. Die Wellen plätscherten leise. Lachende Stimmen, Kindergeplärr, irgendwo von ferne eintönige Beats. Die kamen von der Bar. Dort mixten Sommeraushilfskräfte mit Hilfe von Bedienungsanleitungen aus dem Internet, die sie von ihren Smartphones ablasen, erstaunlich genießbare Cocktails. Zu erstaunlich günstigen Preisen. Wenn es bei der Hitze nicht so gefährlich gewesen wäre, ich hätte mich von nichts anderem ernährt. Etwas ploppte heftig auf meinen Bauch.
„Au!“ Eigentlich wollte ich „Passt doch auf, ihr Idioten!“ brüllen, behielt den Satz aber für mich. Stattdessen zog ich den Bauch ein, setzte mich auf und reichte mit charmanter Geste, beziehungsweise mit einer Geste, von der ich glaubte, dass sie charmant aussehen könnte, den Wasserball zurück.
„So sorry! Thank you, Mister!” Das Mädchen strahlte mich mit großen Augen an. Wow.
„Your welcome“, brabbelte ich verlegen. „Nichts zu danken.“ Ihre Freundinnen am Volleyballnetz lachten sich halb tot. Hühner! Ich rieb mir den Bauch. Vermutlich war es okay, den Urlaub mit Corinne zu verbringen. Für diese Teenager war ich mit meinen Mitte vierzig und deutlichen Anzeichen geschäftlichen Erfolgs im Bauch- und Hüftbereich sicher kein Objekt der Begierde. Also lieber den Spatz in der Hand …
„Juhuu!“ klang es vom Wasser herauf. „Juhuu, Martin, guck mal was ich habe! Ist das nicht phänomenal?“ Ich verdrehte die Augen. Bestimmt brachte sie wieder irgendwelchen Seetang angeschleppt. Ich täuschte mich nur geringfügig. Diesmal waren es einige ziemlich verkeimte und halb zerbrochene Schneckenhäuser oder etwas in der Art. Allein, wie Corinne diese rötlich und braun schimmernden Dinger präsentierte, musste es sich dabei wohl eher um den verlorenen Schatz irgendeines untergegangenen Heidenvolkes handeln. Mindestens. Ich bemühte mich, ein anerkennend klingendes „Ah! Zeig doch mal!“ herauszubringen. Wobei ich das eklige Zeug mit spitzen Fingern anfasste und eingehend begutachtete. Solange ich mit der Materialanalyse beschäftigt war, musste ich wenigstens keine weiteren Kommentare abgeben. Nachher würde sich sicher eine Gelegenheit finden, es „ausversehen“ im Sand verschwinden zu lassen.
„Ach, ist das schön im Wasser.“ Sie schüttelte ihre wasserstoffblonde Mähne. Ich bekam eine kalte Dusche ab. „Kommst du noch mal mit rein, Mäuschen?“
Mäuschen! Aaaaah! Ich biss die Zähne zusammen und konzentrierte mich auf die ineinander verschlungenen Röhren der Schneckenhäuser.
„Kommst du oder kommst du?“
„Später vielleicht. Ist gerade so gemütlich auf der Decke.“
„Später? Wir wollen nachher in die Stadt, Mäuschen. Bummeln gehen. Bisschen hübsche Kleider für deine Cori shoppen und anschließend mondän zu Abend essen.“
Das, was Cori euphemistisch als „Stadt“ bezeichnete, waren zwei im rechten Winkel aufeinander zulaufende Hauptstraßen mit einer Handvoll Läden für Strandbedarf und Lebensmittel. Etwa doppelt so viele Grillrestaurants drum herum. Ein paar Obst- und Eisstände. Alles in allem ungefähr zwanzig Minuten Fußweg. Zehn in jede Richtung. Wenn man langsam ging. Deshalb hatte ich dieses abgelegene Kaff gewählt. Hier gab es weder besoffene Party-Löwen noch meckernde All-inklusive-Zombies. Weit und breit kein Eimersaufen, kein Diskolärm. Keine Deutschen, Engländer und keine Russen. Niemand, der im Urlaub das Verlangen verspürte, sich um Strandliegen zu prügeln. Die meisten Touristen in Biala waren Einheimische. Bulgaren aus Sofia, Plovdiv und so weiter. Dazu ein paar polnische Motorrad-Freaks. Die Leute wohnten überwiegend in kleineren Pensionen und Ferienwohnungen.
Genau so eine Ferienwohnung mit Terrasse und Vorgärtchen, nicht mehr ganz neu, dafür wunderbar mit Efeu und blühenden Pflanzen aller Art fast komplett zugewuchert, hatte ich für diesen Sommer gemietet. Ein Zimmer, Bad mit Dusche und Toilette, Miniküche. Perfekt! Jedenfalls für meinen Geschmack.
Corinne hatte ein wenig mit den Augen gerollt, als der ihrer Meinung nach recht gut verdienende Herr Anwalt ihr dies bescheidene Domizil präsentierte. Sie fügte sich in ihr Schicksal. Der brummige alte Mann, der mit seiner Frau die überschaubare Anlage betreute, reichte ihnen wortlos die Schlüssel und verschwand so einsilbig, wie er ihre Personalien aufgenommen hatte. Gut, wenn der Herr es so wünscht, hatte sie gedacht, und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile beschlossen, statt einen Aufstand gleich am ersten Tag vom Zaun zu brechen, lieber die Idylle zu nutzen, um zielstrebig an ihrem Plan zu arbeiten. Besagter Plan enthielt im Grunde nur einen Programmpunkt: Herrn Martin Hall so gründlich um den Finger wickeln, dass er ihr nicht mehr entkommen konnte. So ein amüsanter und gutsituierter Fisch war ihr lange nicht mehr ins Netz gegangen. Da hieß es: dran bleiben.
Weswegen sie sich jetzt entschlossen zu dem intensiv die Schneckenhäuser inspizierenden Anwalt niederbeugte, ihm einen Kuss gab und zuckersüß schnurrte:
„Du wolltest dein Frauchen heut Abend ausführen! Also musst du jetzt mit ins Wasser oder es wird heute nichts mehr mit Schwimmen.“
„Äh, ja, richtig. Dann morgen vielleicht wieder. Geh nur allein deine Abschiedsrunde drehn, Cori. Ich schau dir zu und warte hier auf dich.“
„Spielverderber!“ schmollte die Abgewiesene und trabte davon. Sie hatte durchaus registriert, dass sie nicht die einzige Frau war, der ihr „Mäuschen“ hier am Strand zusah. Ich blickte ihr nach. Dafür, dass sie nur wenige Jahre jünger war als ich, hatte die Frau ein ziemlich windschnittiges Chassis mit rasant geschwungenen Kotflügeln, ging es mir durch den Kopf. Ganz zu schweigen vom Fahrgestell, um mal für Männer nachvollziehbare Vergleiche zu bemühen. Über das Thema „Bikini-Figur“ brauchte sie sich definitiv keine Sorgen zu machen. In dem Punkt konnte sie locker mit den Volleyball-Girls von nebenan mithalten. Im Bett war sie ein Vulkan. Eigentlich ein ganz passabler Fang, wäre da nicht ihre ständige, überdrehte Fröhlichkeit. Das begann zu nerven. Obwohl wir erst vor zwei Tagen in Biala angekommen waren!
Irgendwie ging mit dieser Frau alles ziemlich schnell. Ich hatte sie vor ein paar Wochen bei einer Vernissage in Halle kennengelernt. Ein Anwaltskollege hatte mich gebeten, ihn zu begleiten. Der Leiter der Galerie sei ein Mandant von ihm und da auch die lokale Presse zugegen sei, brauche der dringend ein volles Haus. Nun, von meinem Leipziger Büro hinüber an die Saale war es quasi nur ein Katzensprung. Warum nicht einmal einen Abend den schönen Künsten widmen?
Ich betrat den Raum. Da stand sie. Direkt vor ihren Gemälden. Zeichnungen, Aquarelle und sogar einige gewaltige Ölschinken unbestimmten futuristischen Inhalts bildeten einen beeindruckenden Rahmen für das zierliche Persönchen. Die Bilder? Uninteressant. Ganz im Gegensatz zur Malerin. Eine faszinierende Erscheinung in ziemlich hohen Highheels. Auf der Nase eine merkwürdig altertümlich wirkende Brille. Vermutlich der letzte Retro-Schrei.
Die Frau hatte Mut. Und Humor. Ich bin kein Kunstkenner, bewahre. Aber ich kenne die Menschen in der deutschen Provinz. Wozu die „Großstadt“ Halle allen anderslautenden Selbstbekundungen zum Trotz zweifellos nach wie vor gehört. Wenigstens mental. Um sich denen mit solchen Arbeiten öffentlich auszuliefern, bedarf es jeder Menge Mut. Und Humor. Gepaart mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. All das strahlte sie aus. Ich fühlte mich sofort zu ihr hingezogen.
Corinne Blair gehöre zu einer Gruppe kreativer und aufstrebender junger Künstler. So in etwa lautete die Formulierung des Laudators. Diese Künstler erhielten hier regelmäßig die Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Ihre Bilder seien Ausdruck purer Lebensfreude und sprühender Zuversicht. Der Mann war ein drittklassiger Mitarbeiter des zuständigen Ministeriums, das die kleine Galerie mit Hilfe von Fördermitteln am Leben hielt. Leute wie Frau Blair seien das kulturelle Kapital, erklärte der Redner, in das zu investieren für Sachsen-Anhalt bedeute, in seine Zukunft als Kulturstandort zu investieren.
Ins Deutsche übersetzt: Die Malerin und ihre Freunde hatten es mit ihrer brotlosen Kunst bislang zu nichts gebracht. Kein Schwein interessierte sich für ihre Gemälde. Da umgekehrt dem Land die Mittel fehlten, sich „richtige“ Künstler zu leisten und die Galerie mangels idealistischen Interesses solcher Leute sonst kaum zu halten gewesen wäre, hatten sich Not und Elend zusammengefunden. In der Hoffnung, dass es irgendwann in einer leuchtenden Zukunft besser würde.
Die Lokalpresse schrieb fleißig mit. So eine Vernissage war mal etwas anderes als die sonst ihre Zeitungsseiten bevölkernden Prügeleien der Polizei mit Rechten, Linken oder Hooligans. Weil es außerdem auf Kosten des Ministeriums lecker Häppchen und Sekt gab …
Ich spürte sofort, dass die Künstlerin einen Mäzen suchte. Warum nicht, sagte ich mir. Ich hatte in den letzten Jahren mehrere spektakuläre Fälle gewonnen. Die Einkünfte der Kanzlei waren kontinuierlich gewachsen. Ich hatte in der Folge sogar mein Äußeres ein wenig aufpoliert und mir, halb aus Einsicht in die Notwendigkeit, halb des Spottes meiner Kollegen wegen, einen ziemlich kostspieligen Anzug für Anlässe wie diesen schneidern lassen. Ich hasste das Ding, glaubte aber, damit einen kleinen Schritt auf jenen Punkt hin getan zu haben, der sich grob mit dem Begriff „endlich erwachsen werden“ umschreiben ließ.
Andererseits, seit meiner Scheidung und der wenig später folgenden romantischen Affäre mit dem vermeintlichen „tödlichen Engel von Leipzig“, einer jungen Frau, deren Unschuld ich beweisen konnte, war bei mir auf der erotischen Schiene wenig gelaufen. Entweder hatte ich gerade keine Zeit, mich mit anderen Dingen als meinen Verhandlungen zu beschäftigen, oder mir begegnete absolut keine geeignete Aspirantin für mein Bett. Um ins Bordell zu gehen, war ich zu stolz. Und zu jung! Jedenfalls meiner persönlichen Überzeugung nach. Außerdem war mir dafür mein sauer verdientes Geld zu schade. Musste anders gehen. Der Abend bei der Vernissage schien meine Theorie zu bestätigen.
Zugegeben, bei Lichte besehen war Corinne erheblich kostspieliger als jedes Bordell. Bereits zum Auftakt unserer Beziehung griff ich tief in die Tasche. Ich wollte mich weltmännisch zeigen. Also erwarb ich den größten ihrer Ölschinken.
Frau Ehle, meine Bürochefin, schlug die Hände überm Kopf zusammen, als das Teil in die Kanzlei geliefert wurde. Sie bestimmte ihm umgehend einen Ehrenplatz an der Kellertreppe. Also dort, wo einmal pro Jahr jemand vorbei kommt, um die angesammelten Ordner der vergangenen zwölf Monate ins Archiv zu verbannen. An dieser Stelle hinge es ausgezeichnet, meinte Frau Ehle. Die grauenvolle Kakophonie sich gegenseitig erschlagender Farben hätte mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit abschreckende Wirkung auf jede Ratte, die den verhängnisvollen Entschluss zu fassen gedächte, sich an unseren Archivbeständen zu vergreifen. Die Tiere seien zwar ziemlich lästig, besäßen aber von Natur aus Intelligenz und einen guten Geschmack. Den Zusatz „Im Gegensatz zu dir, Martin Hall!“ verkniff sie sich aus Loyalität.
In der Folge trafen wir uns fast täglich. Dabei erfuhr ich nach und nach, womit meine Angebetete ihren Lebensunterhalt verdiente. Es muss nämlich erwähnt werden, dass das für die Anwaltskanzlei erworbene Gemälde tatsächlich Corinnes allererstes verkauftes Werk war. „Corinne Blair“ erwies sich im Übrigen lediglich als Künstlername. Sie liebte ihn. Im richtigen Leben hieß sie Karin Blumbinder, geschiedene Kraus, verwitwete Carlson. Sie arbeitete als freiberufliche Haarstylistin abwechselnd in verschiedenen Friseursalons und auf Hochzeiten.
Die Herren Kraus und Carlson hatten in ihrem Leben nur kurze Gastspiele gegeben. Kraus war ein Jugendschwarm gewesen. Er hatte die Scheidung bereits eingereicht, da war die Tinte auf ihrer Heiratsurkunde noch nicht trocken. Carlson kannte man in Fachkreisen als sehr erfolgreichen Motorradrennsportler. Corinne hatte ihn bei einem Rennen kennengelernt, bei dem sie sich als „Grit-Girl“ – andere nannten den Job „Boxenluder“ – ein paar Mark dazu verdiente. Bei seinem ersten Grand Prix nach der Hochzeit hatte sie ihn überzeugt, ihren Schleier als Glücksbringer in den Stiefel zu stecken. Wie frühere Ritter ein Tüchlein ihrer Holden in den Handschuh steckten, bevor sie zum Turnier oder aufs Schlachtfeld ritten. Sehr romantisch! Carlson liebte seine junge Frau und fand die Idee gut. Der Schleier weniger. In einer engen Kurve, Carlson schleifte mit dem Knie fast auf der Fahrbahn, unternahm der Glücksbringer einen Fluchtversuch. Er verhedderte sich im Hinterrad. Lange her.
Danach hatte die Witwe Carlson die Nase voll von Männern. Jedenfalls eine Weile. Sie legte sich offiziell wieder ihren Mädchennamen zu, inoffiziell den neuen Künstlernamen und tobte fortan in der Freizeit ihren Frust über die Männer im Allgemeinen und im Besonderen mit Farbe, Pinsel und Kreide aus. Bis, ja, bis ich zu ihrer Ausstellungseröffnung erschien.
Corinnes erster Gedanke an jenem Abend: Ein Mann mit Stil! Kein Adonis, gewiss. Die Haare an seinen Schläfen begannen grau zu werden, der Bauchansatz ließ sich nicht wegdiskutieren. Aber Stil hatte er. Allein der Anzug! Maßarbeit. Das sah sie sofort. Und dann kam dieser Mensch direkt auf sie zu. Nicht aufdringlich aber auch nicht direkt schüchtern. Ein Typ, der es gewohnt war, mit Fremden umzugehen. In seinen Augen blitzte der Schalk. Etwas Abenteuerlust meinte sie ebenfalls zu entdecken. Er sprach sie an und kaufte eines ihrer Bilder! Das teuerste! Corinne war überwältigt. Der oder keiner, hatte sie sich geschworen. Fortan setzte sie ihr ganzes Geschick daran, Herrn HallHallHH in einen Kokon von Liebesbeweisen einzuspinnen, aus dem es ihrer Überzeugung nach kein Entrinnen gab. Sie musste an die Zukunft denken. Sie wurde nicht jünger.
Die Shoppingtour am Abend durch Biala blieb erwartungsgemäß von geringem Erfolg gekrönt. Am Ende brachte sie uns eine quietschgelbe Sonnenschirmhalterung ein, die sich bequem mit der Hand in den weichen Sand drehen ließ. Eine deutliche Verbesserung zum bisherigen mühevollen Buddeln! Außerdem erwarben wir eine Flasche Wein.
Das „mondäne Abendessen“ in einem der Grillrestaurants dagegen konnte sich wirklich sehen lassen. Der knackige Schöpskasalat erfrischte nach so einem heißen Tag wunderbar. Die würzigen Kebabtscheta-Hackfleischröllchen schmeckten ebenso „phänomenal“ wie der knusprig gebratene Schwarzmeerfisch. Corinne war zufrieden und wenn es ihr gut ging, hatte auch ich keinen Grund, zu klagen. Vergnügt sah ich einer fröhlichen Nacht entgegen.
Dummerweise machte ich die Rechnung ohne den Wirt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Besagter Wirt nämlich, der Inhaber unserer kleinen Ferienwohnung, fing uns am Tor der Anlage ab.





























