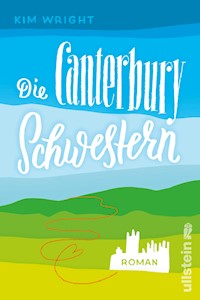
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Che kann es nicht fassen: Sie ist mit acht anderen Frauen auf dem Weg von London nach Canterbury. In einem Brief hat ihre exzentrische, willensstarke Mutter ihrer Tochter aufgetragen, dorthin zu pilgern und ihre Asche zu verstreuen. Außerdem hat sich gerade auch noch ihr Freund von ihr getrennt. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann, ist ein als Pilgerreise getarnter Selbstfindungstrip. In alter Pilgertradition soll jede der Frauen auf dem Weg eine Geschichte über die Liebe erzählen. Che ist skeptisch, als die Wanderinnen damit beginnen. Doch die unterschiedlichen Geschichten der Frauen berühren sie tief. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Che das Gefühl, ihren Weg zu kennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Che kann es nicht fassen: Sie ist auf dem Weg von London nach Canterbury. Zu Fuß. Mit acht anderen Frauen. Denn in einem Brief hat ihre exzentrische, willensstarke Mutter ihrer Tochter aufgetragen, dorthin zu pilgern und ihre Asche zu verstreuen. Außerdem hat Che gerade eine schmerzhafte Trennung hinter sich. Ein als Pilgerreise getarnter Selbstfindungstrip fehlte ihr da gerade noch. Aber den Letzten Willen der Mutter kann man schlecht ignorieren. In alter Pilgertradition soll dann jede der Frauen auf dem Weg nach Canterbury eine Geschichte über die Liebe erzählen. Che ist zunächst skeptisch. Doch die unterschiedlichen Geschichten der Frauen berühren sie tief. Sie merkt bald, dass aus Mitreisenden Freundinnen werden können. Und obwohl Che unterwegs ist, hat sie das Gefühl, angekommen zu sein.
Die Autorin
Kim Wright schreibt für mehrere Lifestylemagazine über Wein, Restaurants und Reisen. Sie veröffentlichte bereits zwei Romane und schrieb sich in die Herzen der Leserinnen, bevor sie ihre eigene Pilgerreise nach Canterbury zur Inspiration für einen dritten nahm. Sie ist leidenschaftliche Tänzerin und lebt in Charlotte, North Carolina.
Aus dem Amerikanischen von Elfriede Peschel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1283-5
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juni 2016
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
© 2015 by Kim Wright
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Canterbury Sisters
(Gallery Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York)
Umschlaggestaltung und Illustration: All Things Letters/Chris Campe, Hamburg
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für meine Mutter, Doris Mitchell, die so viele Reisen möglich gemacht hat
Es ist besser, gut zu reisen, als anzukommen.
Buddha
ennen Sie das alte chinesische Sprichwort »Mögest du in interessanten Zeiten leben«? Für mich lautete die logische Entsprechung von heute schon immer »Mögest du eine interessante Mutter haben«. Denn von der Minute meiner Geburt an lag der Fluch der impulsiven, talentierten, politisch radikalen und sexuell experimentierfreudigen Diana de Milan auf mir.
Das »de« war ihre Idee gewesen. »Diana Milan« klang nicht groß genug für sie. Sie musste ihren Namen mit dieser kleinen, aber exotischen Silbe ausweiten – die Chance ergreifen, ihr Leben geräumiger und freier zu machen, damit sie in etwas hineinwachsen konnte.
Und was mich betrifft, ich heiße Che.
Ich weiß. Das ist absolut lächerlich, und dabei ist es nicht mal ein Spitzname. Ich bekam ihn zu Ehren des kubanischen Revolutionärs Che Guevara am Tag nach seiner Hinrichtung durch ein bolivianisches Erschießungskommando. Meine Mutter behauptete immer, der Schock über seine Ermordung habe bei ihr die Wehen ausgelöst, aber das ist auch nur wieder ein Teil ihrer komplizierten persönlichen Mythologie. Nach Aussage meines Vaters war ich zwei Wochen über der Zeit, und die Wehen wurden eingeleitet.
Meine Geburt war das erste und das letzte Mal in meinem Leben, dass ich zu irgendwas zu spät kam. Hätte ich, wie geplant, am 24. September das Licht der Welt erblickt, wäre mir der zwar etwas süßliche, aber letztendlich doch tolerable Name »Leticia« sicher gewesen: zu Ehren der jüngferlichen Tante, die meinen Eltern den Apfelgarten hinterlassen hatte, in dem sie ihre erste Kommune auf die Beine stellten. Aber dank meines zu langen Verweilens im Mutterleib bekam ich den Namen Che de Milan aufgedrückt, der wesentlich besser zu einer Revolutionärin als zu einer Weinkritikerin passen würde, und seitdem achtete ich immer darauf, überall zwanzig Minuten vor der Zeit zu erscheinen.
Später im Leben, als meine Mutter bereits einen Lungenflügel und meinen Vater an einen Schlaganfall verloren hatte, wurde sie religiös. Und ich meine damit nicht die mit Trommeln und Brustentblößen einhergehende Suche nach der inneren Göttin, die sie in ihrer Jugend angerufen hatte. O nein. Halbe Sachen machte Diana de Milan niemals. Als meine Mutter sich Gott zuwandte, wirbelte sie mehrmals en pointe um ihre eigene Achse und sprang dann wie eine Ballerina in die Luft. Sie kehrte ganz zurück zu ihren spirituellen Wurzeln – was an sich schon eine Ironie ist, da sie immer behauptet hatte, der Katholizismus liege wie ein Fluch auf ihr, dem sie ihr ganzes Leben lang zu entkommen versucht habe. Aber jetzt zeigten sich Flecken auf ihrer noch verbliebenen Lunge, und sie begann, sich nach einer ganz speziellen Gottheit zu sehnen, den sie den »Gott meiner Kindheit« nannte. Die letzten sieben Monate ihres Lebens verbrachte Diana in einem Pflegeheim, einem düsteren neogotischen Gebäude, das von der Kirchengemeinde ihres Wohnorts getragen wurde und Assoziationen an die Szenerie für einen Horrorfilm wachrief. Ich kann mich nicht erinnern, jemals dort gewesen zu sein, ohne dass es geregnet hätte.
Für die Nonnen und Priester, die das Heim führten, war sie eine wahrhaft verlorene, aber heimgekehrte Tochter. Es schien ihnen nichts auszumachen, dass sie für jedes liberale Anliegen, das die Welt kannte, auf die Straße gegangen war und in ihrer Jugend eine Streitschrift über die Freuden der Bisexualität verfasst hatte, die kurzzeitig für Aufruhr sorgte. Ich glaube sogar, dass man sie deshalb nur umso lieber mochte. Die netten alten Damen im Pflegeheim, Frauen, die ihr ganzes Leben für Kuchenverkäufe und Bingonachmittage in den Dienst der guten Sache gestellt hatten, wurden weitgehend ignoriert, während die sündigsten Patienten wie Berühmtheiten behandelt wurden. Jeden Morgen kam der Pfarrer und holte meine Mutter zur Messe ab, als wäre es eine Verabredung. Eigenhändig schob er sie in ihrem Rollstuhl durch den Mittelgang der Kapelle.
Als der Krebs seinen langsamen, aber unablässigen Vormarsch durch ihren Körper fortsetzte, begann Diana, von einer Wunderheilung zu fantasieren. Und war besessen von der Idee, nach Canterbury zu reisen. Sie wünschte sich, vor dem Schrein von Thomas Becket zu knien, einem Ort, dem der Ruf vorauseilte, alle möglichen Spontanheilungen zu bewirken, und der den Blinden, Lahmen und Unfruchtbaren Hoffnung machte. Selbst den Aussätzigen. Ob ich dorthin mitkommen wolle, hat sie mich nie gefragt, genauso wenig wie ich früher jemals gefragt wurde, ob ich sie auf ihren halbgaren Abenteuern begleiten wollte, aber offenbar habe ich während dieser quälenden letzten paar Monate irgendwann zugestimmt, sie dorthin zu bringen. Alles, um ihre Lebensgeister zu beflügeln, doch ich glaube, uns beiden war schon bald klar, dass sie diese Reise niemals schaffen würde. Sie verfügte kaum mehr über die Kraft, mich nach meinen Besuchen zum Aufzug zu begleiten, wie hätte sie also den holprigen Pilgerweg bewältigen können, der von London zur Kathedrale von Canterbury führte?
»Das sind etwa hundert Kilometer«, erklärte ich ihr einmal. »Daran ist im Moment nicht zu denken. Vielleicht später mal, wenn du wieder bei Kräften bist. Irgendwann klappt es schon noch.«
Ja. Das war natürlich eine krasse Lüge, aber einer Sterbenden die Wahrheit zu sagen, ist schwer, und der eigenen Mutter gegenüber ehrlich zu sein, ist unter allen Umständen so gut wie unmöglich. Liegt die Mutter im Sterben, potenziert sich das noch, und man betritt die überaus bizarre Welt dümmlicher Schönfärberei. Da rutschen einem, nur weil man unbedingt etwas sagen möchte, schon mal Worte heraus, von denen man glaubt, dass sie einem aus der Patsche helfen. Einmal ertappte ich mich dabei, dass ich vor ihr die Hauptstädte unserer fünfzig Bundesstaaten aufsagte – in alphabetischer Reihenfolge.
Und als ich das tat und irgendwo zwischen Denver und Dover angekommen war, drehte sie sich in ihrem Krankenhausbett um und sah mich an. Sah mich mit ihrem mir wohlvertrauten Blick an. Als wäre es eine Überraschung, eine Art ewiges Geheimnis, dass ich einfach so hier mitten in ihrem Leben aufgetaucht war.
Man hätte meinen können, dass Dianas Tod auch das Aus für die Büßerreise nach Canterbury bedeutete. Aber drei Wochen nach der Trauerfeier, als ich die Urne mit ihrer Asche erhielt, lag dieser eine Notiz bei.
Wenn Du dies liest, hatte sie geschrieben, bin ich endlich und wahrhaftig tot. Aufgrund unserer Übereinkunft musst Du mich nun nach Canterbury bringen. Mach das, Che. Bring mich dorthin. Auch wenn Du viel zu tun hast. Vor allem, wenn Du viel zu tun hast. Für eine Heilung ist es nie zu spät.
Das war nun wirklich seltsam, selbst für jemanden wie Diana. Nicht nur wegen der albernen Anwaltsformulierung »aufgrund unserer Übereinkunft«, sondern auch wegen des letzten Satzes: »Für eine Heilung ist es nie zu spät.« Denn war dein Körper erst einmal eingeäschert und in einer Urne verwahrt – die übrigens überraschend schwer war –, würde man doch davon ausgehen, dass jede Chance zur Genesung vertan war. Meine Mutter hatte die meiste Zeit ihres Lebens leicht benebelt verbracht – zuerst vom Cannabis, das sie zwischen den Apfelbäumen anbaute, später dann vom Morphium, das ihr die Nonnen zusammen mit einer Dauerinfusion Jesus verabreichten. Aber meiner Meinung nach dürfte nicht mal Diana geglaubt haben, dass es möglich sei, aus dem Grab wiedererweckt zu werden.
Die Urne hatte man mir an mein Büro geschickt. Ausgeliefert von UPS zusammen mit einer Kiste zwölf neuer Syrah-Weine, die ein aufstrebendes Weingut mir zur Verkostung und möglichen Besprechung geschickt hatte. Mein Newsletter Frauenweine geht monatlich an Tausende von Restaurants und Weinläden, und eine Erwähnung von mir kann für ein neues Label gute Absatzzahlen bedeuten, vor allem, wenn meine Bewertung positiv ausfällt. Was nur selten der Fall ist. Ich bin in der Branche für meinen anspruchsvollen Geschmack bekannt. Nur wenig findet Gnade bei mir, also zählt es tatsächlich etwas, wenn ein Wein meine Zustimmung findet.
Ich nahm die zwölf Flaschen aus ihrer Versandkiste und packte dann die Urne aus, wobei ich erstaunlicherweise Mühe hatte, sie aus der gutgepolsterten Schachtel zu holen, in der das Krematorium sie verpackt hatte. Ganz unten fand ich den Bildband über Canterbury, den ich Diana zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Es war eins dieser großen quadratischen Exemplare für den Couchtisch, und sie hatte es kaum halten können. Ich saß neben ihr auf dem Krankenhausbett, das Buch quer über unsere Schenkel aufgeschlagen, und las ihr laut daraus vor wie einem Kind. Von den Wegen, die man dort gehen kann, und dass man von einem Priester – anglikanisch diesmal – gesegnet wird, wenn man die Kathedrale betritt, und er sich sogar niederkniet, um einem den Staub von den Schuhen zu wischen, der sich auf dem Pilgerweg angesammelt hat. Dieser Punkt hatte ihr gefallen. Das Buch listet eine ganze Reihe amtskirchlich bestätigter medizinischer Wunder auf und berichtet, dass die gewieften mittelalterlichen Mönche sofort, nachdem Becket ermordet worden war, sein Blut in der Gewissheit aufwischten, dass jeder Tropfen potentielle Zauberkraft besaß. Oder wenigstens potentiellen Profit versprach.
Zauberkraft, aus einem Mord gewonnen. Geld gewonnen aus beidem. Ich fand das seltsam, sogar abgründig, aber Diana hatte befriedigt genickt, als hätte sich endlich das letzte Puzzleteil zum Ganzen zusammengefügt.
Und jetzt sitze ich da. Blinzelnd, als wäre ich gerade erst aus einer Art Trance erwacht. Ich lehne mich in meinen Bürostuhl zurück und betrachte die auf meinem Tisch aufgereihten Gegenstände. Den Wein, die Urne, das Buch, die Notiz. Die Handschrift ist schwach und zittrig und kaum als die meiner Mutter zu erkennen, und ob es mir nun gefällt oder nicht, weiß ich doch, dass ich an mein Versprechen gebunden bin. Ich war immer ein Einzelkind, und jetzt bin ich außerdem eine Waise, und für eigene Kinder ist es auch schon reichlich spät. Nicht, dass ich mir wirklich eins gewünscht hätte. An der Stoßstange meines Fiats steht auf einem Aufkleber: ICH BIN NICHT KINDERLOS, ICH BIN KINDERFREI, aber dennoch traf es mich härter als erwartet, mich plötzlich ganz allein auf der Welt wiederzufinden, jedenfalls was die Blutsverwandtschaft betraf.
Dianas Sterben hatte so lange gedauert, dass ich sicher war, mir den Trauerprozess danach erspart zu haben, weil ich all meine Trauer schon verausgabt hatte. Dabei hatte ich allerdings nicht berücksichtigt, dass es zwischen Gehen und Gegangensein einen Unterschied gibt. Gehen bedeutet Aktivität. Mit dem Gehen sind Aufgaben verbunden – Ärzte und Sozialarbeiter müssen aufgesucht werden, darauf folgt die langwierige Suche nach einem freien Bett in einer anständigen Einrichtung, Anlagefonds müssen flüssiggemacht und Möbel eingelagert werden. Das Gehen erfordert viele Besuche, und manchmal überkommen einen dabei verräterische Gedanken. Wie etwa, dass es für alle besser wäre, wenn sie nicht mehr hier wäre, gefangen in ihrem Leid. Und du stellst dir vor, wie erleichtert du sein wirst, wenn dieser letzte Anruf kommt.
Das ist dann auch so, jedenfalls am Anfang. Aber nach etwa einer Woche kehrt das Leben zu dem zurück, was man allgemein Normalität nennt, und erst da wird dir klar, dass das Gehen leichter war als das Gegangen sein. Und da erst stellst du dich dieser endgültigen schweigenden Leere, die den Kern jedes menschlichen Todes ausmacht, und es geht dabei nicht nur um die zusätzliche Zeit, die einem plötzlich am Tag bleibt und sich seltsamerweise nur schwer füllen lässt, sondern auch darum, dass man nicht weiß, wohin mit der seelischen Energie, die um den Raum kreist, den deine Mutter einst gefüllt hatte.
Und Diana füllte eine Menge Raum.
Ich starre auf die Urne. Wir möchten, dass unsere Mütter uns als das sehen, was wir wirklich sind – jedenfalls behaupten erwachsene Töchter das immer. Uns quälen die Fragen: Warum versteht sie mich nicht? Warum will sie gar nicht wissen, was ich denke? Aber wenn unsere Mütter es versuchen … wenn sie dir gelegentlich diese vorsichtige Frage stellen, dieses unerwartete »Und wie geht es dir?«, immer am Ende eines Gesprächs eingefügt, das sich hauptsächlich um sie drehte, und nachdem man schon mit dem Ritual des Auflegens beschäftigt war, wirfst du ein rasches »Bestens, Mama« ein. Und du sagst ihr, dass du wie immer am Sonntag bei ihr sein wirst. Aber dann kommt der Tag, an dem deine Mutter endgültig tot ist, nicht sterbend, sondern tot, nicht dahinschwindend, sondern unsichtbar, und du weißt, dass sie wirklich nicht mehr, nie mehr …
Und jetzt das. Zwölf Flaschen Syrah, von denen ich wohl kaum eine genießen werde, ein Buch über eine Kathedrale, die ich nicht aufsuchen möchte, eine zittrige Aufforderung und eine Urne mit der Asche meiner Mutter. Ich greife zum Handy und drücke die Taste ganz unten.
»Siri«, sage ich. »Was ist der Sinn des Lebens?« Die Linie des kleinen Mikrophon-Symbols flattert, während ich spreche.
Und dann antwortet Siri: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt eine App dafür.
Toll. Ich habe in meinem Leben einen Punkt erreicht, wo mein Handy mich mit Sarkasmus begrüßt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Entscheidung, nach Canterbury zu pilgern, tatsächlich getroffen hätte – auch nicht, nachdem ich die Asche und die merkwürdige Notiz meiner Mutter erhalten hatte. Nicht, wenn sich am selben Tag nicht noch etwas anderes ereignet hätte.
Es traf in Form eines anderen Briefs ein, diesmal nicht von UPS, sondern von der allgemeinen Post ausgeliefert, und nicht an meine Büroadresse, sondern an meine Wohnung geschickt. Ich war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte sechs der noch nicht gekosteten Flaschen Wein und meine Mutter in der Diele abgestellt und hatte dann Freddy, meinen Yorkshireterrier, an die Leine genommen, um sofort mit ihm zu einem Spaziergang aufzubrechen. Da ich meine Schlüssel noch in der Hand hielt, ging ich an den Briefkästen vorbei, um nachzusehen, ob etwas in meinem Fach lag.
Ich sehe meine Post nicht jeden Tag durch. Meine Bankgeschäfte erledige ich online, und heutzutage schreibt keiner mehr Briefe, weshalb ich höchstens einmal pro Woche meinen Briefkasten öffne. Und auch dann finde ich darin für gewöhnlich nur Werbezettel und Spendenaufrufe. Ich spreche mit Freddy, der gern hochspringt und bellt, während ich den Schlüssel in den Kasten stecke und die kleine silberne Tür aufziehe und …
Plötzlich bin ich von einem Bienenschwarm umgeben.
Es dauert etwas, bis mir klarwird, was da geschieht. Eine sticht mich in die Hand, direkt in die fleischige Fläche zwischen Daumen und Zeigefinger, und vier oder fünf schwärmen hinterher und umkreisen meinen Kopf. Freddy dreht völlig durch. Die Post ist zu Boden gefallen, darunter ein dicker Packen Werbezeitungen und ein Flyer, der mich darüber informiert, dass ich einem Obdachlosen für gerade mal zweiundneunzig Cent ein Abendessen zu Thanksgiving spendieren kann. Und dann flattert mir auch noch das denkbar Merkwürdigste vor die Füße – ein persönlicher Brief. Ich betrachte in Schockstarre den Umschlag und erkenne die Handschrift meines Lebensgefährten Ned. Warum schreibt er mir? Wir skypen jeden Abend um acht Uhr miteinander, immer pünktlich, und natürlich schicken wir uns tagsüber Nachrichten. Manchmal schickt er mir auch eine Postkarte, aber das hier ist eindeutig ein Brief. Der Umschlag ist lang und wirkt geschäftsmäßig mit der Adresse seiner Anwaltskanzlei in der Ecke.
Ich schlage um mich, um die Bienen zu vertreiben, dabei erwischt mich eine weitere an der Schulter, sticht mich durch meine Bluse hindurch, während eine dritte sich in meinen Stirnfransen verfängt. Mir kommt nicht in den Sinn, das Weite zu suchen, Freddy hingegen schon, und seine Leine rutscht mir aus der Hand. Ich schreie und schlage auf die Biene in meinen Haaren ein. Normalerweise gehöre ich nicht zu den Frauen, die kreischen – es dürfte seit meiner Kindheit das erste Mal gewesen sein, dass ich hysterisch losgeschrien habe –, und dann höre ich eine Autohupe und gleich darauf quietschende Reifen.
Manchmal nimmt unser Leben ganz unvermutet eine plötzliche Wendung. Ein Stich in die Hand, eine entglittene Hundeleine, ein Brief, der einem vor die Füße fällt.
Keine Sorge. Freddy wurde nicht vom Auto überfahren. Die Geschichte ist düster, aber nicht deshalb. Am Steuer des Wagens saß eine meiner Nachbarinnen, eine Frau, die selbst Hunde hat, und es gelang ihr, rechtzeitig anzuhalten. Sie springt erschüttert und weinend, weil es so knapp war, aus dem Wagen und packt die Leine. Freddy springt vor Freude hoch, und die Frau und ich reden aufeinander ein. Die Bienen, sage ich, seien aus dem Nichts aufgetaucht. Sie waren in meinem verdammten Briefkasten. Der Hund, sagt sie. Ich hätte ihn fast nicht gesehen. Er kam aus dem Nichts, wie die Bienen.
Meine Hand pocht, als ich ihr die Leine abnehme. Es tut mir schrecklich leid, sage ich, als ich mich bücke, um die Post aufzuheben. Auch dem Hund sage ich, dass es mir leidtut. Unverdrossen zerrt er an der Leine, will nur seinen Spaziergang beenden.
Packen Sie Eis drauf, rät mir die Frau. Schaben Sie mit einer Kreditkarte darüber, um sicherzugehen, dass der Stachel draußen ist. Und nehmen Sie für alle Fälle ein Antiallergikum. Gott sei Dank, sagt sie. Es hätte so viel schlimmer ausgehen können. Das wiederholt sie mehrmals.
Zweifellos sind Sie mir inzwischen um einiges voraus. Zweifellos haben Sie, sobald Sie erfuhren, dass der Brief aus einer Kanzlei stammte, vorhergesehen, was kommen würde. Vielleicht war es sein Name, Ned, so minimal und ordentlich, oder die Tatsache, dass er Anwalt ist, oder Sie haben die Erwähnung von Skype als Beweis dafür genommen, dass wir in verschiedenen Städten leben, was, wie man weiß, der Todesstoß für jede Beziehung ist. Aber ich war noch immer mit den Stichen und dem Hund und der Tatsache beschäftigt, dass ich vor meiner Nachbarin wie eine verantwortungslose Närrin dastand. Ich stopfte mir den Brief in die Jackentasche, warf den Rest der Post in den Müll und nahm Freddy mit zur langen Runde, die einmal rund um den künstlich angelegten See und durch den Wald führte.
Erst Stunden später, als ich bereits im Bett lag, das Licht gelöscht hatte und fast schon schlief, fiel mir Neds Brief wieder ein.
Sehr zum Verdruss des dösenden Freddy schaltete ich die Nachttischlampe an, holte den Brief aus meiner Jacke, setzte die Brille auf, ging zurück ins Bett und riss den Umschlag auf. Drei getippte Seiten mit einfachem Zeilenabstand, gefolgt von einer vierten mit Zahlen darauf. Ein Schätzwert für die Höhe der Summe, die derjenige von uns aufbringen müsste, wenn er den anderen für unser Häuschen auf Cape May auszahlen würde.
Und auf diese Weise erfuhr ich, was Sie sich zweifellos bereits gedacht haben.
Dass man mir den Laufpass gegeben hat.
Die Frau, deretwegen Ned mich verlässt, heißt Renee Randolph. Ihm ist es wichtig, sicherzustellen, dass mir die Fakten vorliegen. Er möchte keine Ausreden erfinden oder so tun, als gäbe es sie nicht. Er respektiert mich zu sehr und möchte sich deshalb all das übliche Gerede von wegen, man habe sich auseinandergelebt oder es liege nicht an mir, sondern an ihm, ersparen. Er möchte, schreibt er, »jede Art von Versteckspielchen zwischen uns vermeiden«. Dafür seien wir viel zu gute Freunde.
Die beiden haben sich im Fitnessstudio kennengelernt, erklärt er und schreibt dann, dass dieser Umstand mich vermutlich amüsieren werde. Erst kann ich mir gar nicht erklären, warum er auf diese Idee kommt, bis mir einfällt, dass er und ich uns ebenfalls im Fitnessstudio kennengelernt haben, oder besser gesagt im Sportraum eines Hotels, wo wir beide nebeneinander auf dem Laufband schwitzten. Und an dieser Stelle verschwimmt mir alles vor den Augen. Es gelingt mir offenbar nicht mehr, den Buchstaben auf vernünftige Weise von links nach rechts zu folgen – ich halte das Blatt vor mich, und die Wörter und Sätze lösen sich von der Seite und schwärmen wie tausend kleine stechende Insekten auf mich zu.
Diese Frau, Renee, hat scheinbar einen Ehemann. Schlimmer noch, sie hat einen ausländischen Ehemann. Er kommt aus einem dieser Länder, wo eine Ehe geschieden wird, wenn die Frau nur Töchter zur Welt bringt, und dann versuchen die Väter auch noch, ihre Töchter zu entführen. Renee lebt in ständiger Angst, schreibt er, sie weiß nie, wann dieser Mann auftauchen oder an seiner statt irgendeinen schwer bewaffneten Emissär schicken wird. Die Lehrer an der Schule ihrer Töchter haben Anweisung, dass die Mädchen den Campus nur mit Renee verlassen dürfen.
Ja, sie hat also einen schlimmen Ehemann und setzt dann noch eins drauf, indem sie krank ist. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie hat eine unaussprechliche Krankheit – eigentlich eher ein Syndrom, also etwas, das sich nur schwer diagnostizieren lässt, etwas, das sie einem zuschreiben, wenn einem sonst eigentlich nichts fehlt. Aber dieses Syndrom, diese Krankheit, macht es womöglich erforderlich, dass er ihr … ich weiß nicht, irgendwas gibt. Etwas Lebenswichtiges. Seine Hornhaut, sein Knochenmark, Zugang zur bestmöglichen Krankenversicherung. Mein Herz.
Sie braucht mich. Die Worte steigen von der Seite auf, begleitet von ihrem schweigenden Echo: Und du nicht.
In gewisser Weise hat er recht. Seit wir uns vor sechs Jahren kennenlernten – wir waren beide unterwegs auf einer Geschäftsreise und bewegten uns nebeneinander auf dem Laufband mit Blick nach oben zu den CNN-Nachrichten –, verband Ned und mich eine Partnerschaft, eine Freundschaft, die von einer fast unglaublichen sexuellen Kompatibilität getragen wurde. Mir gefiel das, und ich dachte, ihm auch. Dass wir einander während der Woche in Ruhe ließen und unserer Arbeit nachgingen, um uns dann aber in der Freizeit an vielen interessanten Plätzen zu treffen – in Napa, Austin, Miami, Montreal, Reykyavík, London, Key West, Telluride und Rom.
Als wir das Häuschen in Cape May kauften, stellten wir Sonnenblumen auf den Tisch und legten einen handgeknüpften Teppich auf den Fußboden. Unsere Einrichtung war alt, gutes Holz, aber alt, und wir strichen alles in Burgunder oder Moosgrün oder Holländisch-Blau. Van-Gogh-Farben nannte Ned sie. Es war eine perfekte kleine Welt, vervollständigt durch ein paar sorgfältig gestylte Nachlässigkeiten, die man sich erlaubt, um zu verdeutlichen, dass man nicht »zu dieser Art von Leuten gehört« – Sie wissen, was ich meine. Jeden Sonntagmorgen liefen wir hinunter zum Café an der Ecke, wo wir uns zwei Ausgaben der New YorkTimes kauften, damit wir gemeinsam an unserem Tisch sitzen und den anderen zum Kreuzworträtselwettkampf herausfordern konnten. Wir passten gut zusammen. Manchmal gewann ich, manchmal er.
Liebte ich ihn? Ich denke schon. Ich muss ihn geliebt haben. Es war eine sehr moderne Form der Liebesbeziehung, jedenfalls redete ich mir das ein, wenn ich hin und her pendelte, immer in einem Auto oder einem Zug oder zu einem Flughafen. Und wir lachten … du liebe Güte, Ned und ich hatten ständig was zu lachen.
Und wenn man so viel lacht, wenn man jedes Rätsel fast gleichzeitig löst, wenn man sich über den farbig angestrichenen Tisch hinweg ansieht und die Blicke sich befriedigt treffen … dann muss das doch was zu bedeuten haben, oder?
Ich bin mir sicher, dass ich ihn an dem Wochenende geliebt habe, als wir Lorenzo kauften. Lorenzo war ein Hummer. Wir erwarben ihn an einem dieser Stände neben der Straße, wo »FRISCH« auf den Schildern steht und jede Menge Bilder von lächelnden Meeresfrüchten dazugemalt sind. Er war in Eis und Styropor verpackt, die Scheren wurden von dicken Gummibändern zusammengehalten, und ich begann, diese ganze Idee bereits zu bedauern, bevor wir mit Neds Lexus wieder auf der Straße waren.
»Was meinst du, ob er da drin atmen kann?«, fragte ich, und Ned erwiderte: »Hummer atmen nicht.«
Nun, das ist lächerlich. Jedes Wesen atmet auf die eine oder andere Weise. Aber ich sagte nichts, und nach ein paar Kilometern meinte Ned: »Wenn er was braucht, dann vermutlich Wasser.«
Natürlich war es albern von uns, um das Wohlergehen eines Geschöpfs besorgt zu sein, dem nur noch Stunden bis zu seiner Hinrichtung blieben, aber schon da wusste ich, dass wir es nie übers Herz bringen würden, Lorenzo zu kochen. Man kann etwas, dem man einen Namen gegeben hat, nicht kochen. Wir fuhren weiter, hielten aber mehrmals an, um Salat, Tomaten, Zitronen, Kräuter und das Sauerteigbrot einzukaufen. Als wir schließlich in die Einfahrt zu unserem Häuschen einbogen, war Ned bereits dazu übergegangen, mit dem Hummer zu sprechen und auf die Sehenswürdigkeiten zu zeigen, an denen wir unterwegs vorbeikamen, als wäre Lorenzo unser Wochenendgast. Wir bereiteten den Salat zu, öffneten den Wein und stellten sogar einen riesigen Wassertopf zum Kochen auf den Herd, aber es war vergeblich. Am Ende befreiten wir Lorenzo von seinen Gummibändern und warfen ihn zurück in die Bucht.
»Weißt du«, sagte Ned und hob das Weinglas zu einem Toast, während Lorenzo zurück ins Meer trieb, »wir müssen aufhören, diesen Ort hier als Geldanlage zu sehen, und ihn stattdessen als ein Zuhause betrachten.« Und am nächsten Wochenende zogen wir los und kauften Freddy.
Und jetzt teilt mir Ned mit, er wünsche mir das Beste. Und ich war mir immer sicher gewesen, was wir hatten, sei das Beste. Nein, »das Allerbeste« schreibt er sogar. Dass er mir das »Allerbeste wünsche«. Weniger habe ich seiner Ansicht nach nicht verdient.
Will er mir damit sagen, dass das Lachen nicht gezählt hat? Auch nicht die Freundschaft und nicht der Sex? Schließlich haben wir sogar gemeinsam Kreuzworträtsel gelöst. Wir hatten einen Hummer und einen Hund. Er ist der einzige Mann, mit dem ich zusammen war, den auch meine Mutter mochte.
Aber offensichtlich ist das jetzt alles Schnee von gestern, seit er seinen verwundeten Vogel gefunden hat. Seit er sich niedergebückt hat, um die Patientin zu retten, flattert sie in seiner Hand. Und er hat mir geschrieben, um mich darüber zu informieren, dass er nie glücklicher war.
Ich denke, schreibt er mit tödlicher Simplizität, dass sie Die Eine sein kann.
Ja, in Großbuchstaben, falls es mir sonst entginge. Die. Eine.
Stundenlang liege ich mit Herzklopfen und tauben Beinen im Dunkeln. Am Montag wolle er mich anrufen, kündigt er in seinem Brief an. Wir hätten viele Dinge zu besprechen, mit denen er mich aber nicht überrumpeln wolle. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Indem er mir einen Brief schrieb, vermied er es, mich jammern oder weinen zu hören, und er musste sich auch nicht dem Ansturm meiner Fragen stellen. Wann ist das passiert? Wie lange kennt er sie schon? Gab es Zeiten, in denen er von ihrem Bett in meins kam, und hat sie ihn auf diese Weise langsam und schrittweise auf ihre Seite gezogen, oder war ihr Sieg über mich ein Überraschungscoup? Und welche Antwort darauf wäre schwerer zu akzeptieren?
Als ich mich aus dem Bett quäle, ist es fast schon hell. Ich öffne eine weitere Flasche Syrah, schütte mir etwas davon in ein Wasserglas und gehe zu meinem Schreibtisch, um den Computer anzuschalten. Einen Moment lang kämpfe ich gegen das Verlangen an, diese Frau zu googeln, um alles über Renee Randolph in Erfahrung zu bringen, aber ich versage es mir. Zweifellos wird sie hübsch sein. Schönheit und Tragik, das ist eine höchst anziehende Kombination. Romanstoff pur, während durchschnittliches Aussehen und Tragik nur … durchschnittliches Aussehen und Tragik sind. Auf jeden Fall nicht bezwingend genug, um einem so angenehmen und komfortablen Leben wie dem, das Ned und mich verband, ein Ende zu bereiten. Sie muss hübsch sein. Alles andere ergäbe keinen Sinn.
Ich nehme einen großen Schluck Wein und betrachte die Suchzeile, in die ich bereits REN eingetippt habe. Was könnte Google mir Tröstliches über diese Frau sagen? Sollte sie versierter sein als ich, würde es schmerzen … aber wenn sie nun weniger perfekt wäre? Das wäre irgendwie noch schlimmer. Schließlich lösche ich REN und gebe stattdessen PILGERREISENNACHCANTERBURY ein.
Natürlich lande ich auf Seiten, die der Literatur und Geschichte gewidmet sind. Artikel über Chaucer und Becket und den Ruf, den Canterbury für Wunder genießt. Verärgert lehne ich mich zurück, während die wissenschaftlichen Artikel vorbeiscrollen, und dabei fällt mein Blick auf die Ehemaligenzeitschrift meiner Hochschule, die schon weiß Gott wie lang auf meinem Schreibtisch liegt. Auf den hinteren Seiten sind dort immer Reisen aufgelistet, wie mir beim flüchtigen Durchblättern aufgefallen ist. Die Idee, von einem Professor in einer Gruppe durch Museen und Paläste sowie über Schlachtfelder geführt zu werden, hat mir schon immer gefallen. Jemanden zu haben, der den Blick auf die wichtigen Dinge lenkt. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Reisen einsame Singlefrauen ansprechen, jene traurigen Seelen, die in der Mitte ihres Lebens angekommen sind und sich solche Reisen leisten können, aber niemanden haben, mit dem sie diese unternehmen können.
Im blauen Lichtschein des Computerbildschirms gehe ich den Katalog durch und werde rasch fündig: Da steht der Name einer Kunstprofessorin, die sowohl Gruppen als auch Einzelreisende durchs südliche England begleitet. Ihr Aussehen entspricht genau meinen Vorstellungen: blass, ernsthaft, akademisch, ohne den Hang, persönliche Fragen zu stellen. Ich schicke ihr rasch eine E-Mail mit der Information, dass ich so schnell wie möglich nach Canterbury wandern muss, von Anfang bis Ende, von London bis zu den Stufen der Kathedrale. Und dann google ich, was man beim Transport von Asche auf einem Auslandsflug beachten muss.
Offensichtlich nehmen die Toten in der Reisebranche ein nicht unerhebliches Segment ein, weil die Antwort sofort erscheint. Die Urne muss im Flugzeug mitgeführt werden und darf nicht in den Koffer gepackt werden. Sie muss gescannt werden und die Sicherheitskontrolle passieren und benötigt die Bestätigung des Krematoriums, dass der Inhalt aus menschlichen Überresten und nicht beispielsweise aus Plutonium besteht. Ich muss damit rechnen, dass die Sicherheitsbeamten die Urne nach Gutdünken jederzeit öffnen und kleine Teile meiner Mutter womöglich auf dem Bodenbelag des Flughafens landen oder die Hände eines Beamten der Transportsicherheitsbehörde beschmutzen können. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, ganz auf die Urne zu verzichten, wie die Seite dezent, aber nachdrücklich empfiehlt. Befördern Sie die Asche in einem weniger schweren Behältnis, das vom Scanner weniger leicht erfasst werden kann. Wie etwa einem Frischhaltebeutel.
Ich hatte oft vorgehabt, meine Mutter mit nach Europa zu nehmen, aber ich war bei diesen Reisen meist geschäftlich unterwegs oder traf mich mit Ned an einem romantischen Ort. Und natürlich war auch sie stets sehr beschäftigt gewesen, weil sie sich um unverstandene Pitbulls kümmerte, für Amnesty International auf die Straße ging oder Häuser mit Hilfe von Habitat auf Vordermann brachte … Und dann wurde sie krank. Diana und ich haben alle Chancen verpasst, aber jetzt endlich begleitet sie mich, wenn auch in meinem Handgepäck. Ich setze das Glas Wein ab, den ich bitter finde, aber ich weiß, dass das ungerecht ist. Ich habe ihn getrunken, während ich in Gedanken ganz woanders war, was eine Kardinalsünde bei der Weinverkostung ist. Schließlich weiß jeder, wie leicht Gefühle sich von der Seele auf die Zunge schleichen. Ist der Wein bitter geworden oder ich?
Die Sonne ist aufgegangen. Ich verlasse meinen Schreibtisch, das Weinglas noch immer in der Hand. Die Reste des Syrahs kippe ich in den Abfluss meiner Küchenspüle und vertiefe mich in den dunkelroten Fleck. Ich habe der Professorin mitgeteilt, dass ich frühestens am Sonntag in London sein könne und gerne eine Privatführung hätte. Die kostet vermutlich ein Vermögen, aber mich treibt nur ein Gedanke an, nämlich dass ich weg sein muss, längst weg sein muss, bevor Ned mich anrufen und sich entschuldigen und mir erneut erklären kann, dass er einfach nicht anders handeln könne, weil ein Mann einer Frau in Not nicht widerstehen kann. Der Wunsch zu flüchten ist in mir sehr groß. Tatsächlich weiß ich nicht, was geschehen wird, wenn ich nicht sofort von hier wegkomme.
Ich greife nach dem Handy und versuche es erneut. »Siri«, sage ich. »Was ist der Sinn des Lebens?«
Eine Pause und dann die Antwort: Frag Kant. Haha.
Haha. Ein echter Brüller, diese Siri.
s gab mal eine Studie darüber, warum so viele Menschen in Flugzeugen weinen – ob es an der Stille liegt oder der Isolation oder an der Urangst, die terra firma zu verlassen.
Ich denke, es rührt daher, dass die meisten von uns im Flugzeug fast so etwas erleben wie eine erzwungene Meditation. Auf der Startbahn, in jener kleinen, zitternden Welt zwischen Hier und Dort, können wir nichts weiter tun, als dasitzen und unseren Gedanken nachhängen. Ist das Flugzeug erst mal in der Luft, gibt es natürlich tausend Dinge, die uns ablenken: Filme, Kindles, Spiele, Rätsel, Drinks und jene schmale, aber verführerische Möglichkeit, unser Sitznachbar könnte sich als Seelenverwandter erweisen. Aber während des Startens und Landens sind wir auf uns allein gestellt. Da können wir den gewaltigen einsamen Prärien, die in unseren Köpfen existieren, nicht aus dem Weg gehen.
Anfangs sieht es so aus, als wäre bei diesem Flug das Glück auf meiner Seite. Keiner belegt den Gangplatz, und ich kann mich ausstrecken und schlafen. Wir landen vorzeitig, sogar so verfrüht, dass Heathrow für uns noch nicht mal ein Gate bereit hat. Während wir auf eine Freigabe warten, hole ich mein Handy heraus und gehe meine Nachrichten durch. Es ist nicht viel Überraschendes dabei – Arbeit und Werbung und Benachrichtigungen von Facebook, Instagram und Twitter. Aber eine davon kommt von der Uniprofessorin, die ich als meine Reiseführerin angeheuert habe, und im Betreff steht: Kleine Planänderung.
Kleine Planänderung? Das ist nicht gut. Meiner Erfahrung nach ist das nie gut.
Ich schaue aus dem Fenster des Flugzeugs auf den regennassen Asphalt, und ein leiser Schauder läuft mir über den Rücken. Allein die kurze Zeit, die ich darauf verwendet habe, diese Reise auf meinem Computer zu studieren, hat mich gelehrt, dass die Fußwanderung nach Canterbury gar nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Vielmehr geht es darum, auf den noch verbliebenen Resten des alten Pilgerwegs zu wandern. Dieser folgte nämlich ursprünglich einem noch älteren römischen Pfad, doch dieser alte, heilige Weg wurde von den Erfordernissen des modernen Lebens zerstückelt. An mehreren Stellen wird er von einer wichtigen Autobahn durchschnitten, und die noch intakten Teile des Weges schlängeln sich vorwiegend durch Privatbesitz, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Obstgärten und selbst durch die Hinterhöfe ländlicher Anwesen.
Da der Weg der Aufsicht des National Trust unterliegt, wussten die Landbesitzer natürlich beim Kauf bereits, dass sie das Wegerecht zulassen müssen. Und sind vermutlich auch daran gewöhnt, dass Amerikaner mit Rucksäcken und mit Blasen an den Füßen und gebrochenen Herzen im Nebel an ihnen vorbeiziehen. Aber Google warnt davor, dass es knifflig ist, dem Weg zu folgen. Es gibt nur wenige Markierungen, und diese lassen oft zu wünschen übrig, weil sie so angebracht sind, dass man unmöglich erkennen kann, wo der Weg abbricht und wo er wieder einsetzt.
Heißt im Klartext, man braucht einen Führer.
Aber wie es aussieht, habe ich es bereits geschafft, meine Führerin zu verlieren. Sie schickt mir ihre E-Mail von der Krankenbahre in einem Krankenhaus aus, wo sie als Notfall auf ihre Blinddarm-OP wartet.
»Ist das zu fassen?«, schreibt sie.
Nein, fassen kann ich das nicht. Wer muss sich denn heute noch einer Blinddarmoperation unterziehen? Genauso gut könnte sie mir mitteilen, sie würde von der Beulenpest heimgesucht. Aber dann bietet sie mir in verdächtig vollständigen und grammatikalisch korrekten Sätzen für eine Frau, die höchstwahrscheinlich Qualen leidet, eine Lösung an. Zufälligerweise leitet eine ihrer Universitätskolleginnen eine organisierte Tour nach Canterbury, die an diesem Nachmittag von London aufbrechen wird. Eine auf ihrem Gebiet hochgeschätzte Altphilologin, noch ziemlich jung, fast ein Ausnahmetalent. Und sie versichert mir, dass ich keine Sorge haben müsse, nicht willkommen zu sein. Die Frauen in dieser Gruppe seien allesamt Amerikanerinnen und hätten ihre Reise über ein Unternehmen gebucht, das sich Reiseweiber nennt und an allein reisende Frauen wendet.
Die allein reisende Frau. Vermutlich gehöre ich da jetzt dazu.
»Eine Lösung, wie sie besser nicht sein könnte«, schreibt die Professorin, aber überzeugt bin ich nicht. Ich möchte mich beim Wandern nicht unterhalten müssen. Ich möchte mich nicht mit anderen Frauen verbünden und ihnen von meinen Problemen erzählen, denn so schmerzlich sie auch sind, entsprechen sie doch sehr dem Klischee, wenn man ehrlich ist. Und bin ich erst einmal gezwungen, ihnen meine Geschichten zu erzählen, erfordert es die Höflichkeit, mir auch ihre anhören zu müssen. Und ich wette, auch sie haben alle tote Mütter und gemeine Liebhaber. Mein Handy hat sich auf die Ortszeit umgestellt und zeigt mir, dass es noch nicht ganz sieben Uhr morgens ist. Ich starre hinaus auf einen wenig anheimelnden Morgen in der Fremde und wäge meine Möglichkeiten ab.
Vielleicht sollte ich einfach den Zug nach Canterbury nehmen. Meine Mom loswerden und schnell wieder zurück nach Heathrow fahren, dann säße ich mit ein bisschen Glück abends vielleicht schon wieder im Flieger nach Philadelphia. Das wäre dann zwar keine echte Pilgerreise, nicht im Sinne einer schrittweisen Annäherung, aber mein Versprechen hätte ich gehalten. Und darum geht es doch schließlich, oder? Um den Schlusspunkt am Ende eines Satzes. Darum, auf die Return-Taste zu drücken und einen neuen Paragraphen in meinem Leben zu beginnen. Abschied zu nehmen. Mich von Geistern zu befreien. Es gibt absolut keinen Grund dafür, mir die Sache schwerer als nötig zu machen.
Endlich bewegt sich das Flugzeug auf ein offenes Gate zu. Ich blicke auf die Textnachricht in meiner Hand.
Reiseweiber. Meine Güte. Vielversprechend klingt dieser Name nicht.
Als ich im Heathrow Express auf dem Weg in die Stadt sitze, hat der Regen aufgehört, und der Morgen ist rosig und golden. Auf den Gehwegen schillern die Pfützen wie bei einem Gemälde von Monet, und die Luft fühlt sich frisch an. An der Paddington Station steige ich aus und schlage die Richtung ein, die, wie mir mein Handy versichert, schnurgerade nach Osten führt. Unter meinen Stiefeln rascheln die Herbstblätter, und als ich an einer Straßenecke stehenbleibe, um meinen Koffer in die andere Hand zu nehmen, denke ich mir, dass London sich in einem anderen Tempo bewegt als amerikanische Städte. Die Betriebsamkeit ist gedämpfter. Das Tempo zivilisierter und humaner. Das gefällt mir nicht.
Wann habe ich zum letzten Mal etwas gegessen? Vor so langer Zeit, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, was nicht gut ist, und deshalb steuere ich das nächste Café an. Bestelle, ohne zu überlegen, das »Standardfrühstück« und bin völlig irritiert, als ich ein britisches Frühstück bestehend aus Baked Beans, Pilzen und Tomaten vorgesetzt bekomme. Doch als mir sein Duft in die Nase steigt, merke ich, dass ich hungrig bin, seit Tagen vielleicht zum ersten Mal. Während ich mich durch den Teller arbeite, lese ich noch mal die E-Mail der Professorin, diesmal in ruhigerer Seelenverfassung.
Die Reiseweiber treffen sich zum Mittagessen im George Inn, schreibt sie. Es liege neben dem ehemaligen Tabard Inn, wo Chaucer und seine Pilger vor fünfhundert Jahren ihre Reise begannen. Das Tabard sei allerdings irgendwann bei einem Feuerausbruch im darin untergebrachten Bordell ein Raub der Flammen geworden. Das George sei ein Wirtshaus derselben Provenienz und aus derselben Ära und somit ein würdiger Ausgangsort für eine Wallfahrt. Das sind die Worte, die sie verwendet – »Provenienz«, »Ära«, »würdiger Ausgangsort« und »Wallfahrt« –, und ich staune wieder, dass eine Frau, die kurz vor einer Operation steht, sich die Zeit nimmt, eine so wortreiche und überzeugungskräftige Nachricht zu verfassen. Offenbar ist diese Fröhlichkeit im Angesicht des Ungemachs, dieser Zwang, sich über mittelalterliche Geschichte auszulassen, während man sich vor Schmerzen krümmt, ein britischer Wesenszug.
Nehmen Sie die U-Bahn zur London Bridge Station, rät sie mir, dann stoßen Sie nach weniger als zehn Minuten Fußweg auf das George Inn. Ich esse meine Bohnen und werfe einen Blick auf den Plan, den ich mir aus dem Zug mitgenommen habe. Die Entfernung von Paddington zur London Bridge ist beträchtlich, aber schließlich habe ich viel Zeit totzuschlagen. Ein ausgiebiger Spaziergang wird mir guttun, nachdem ich so lange eingepfercht im Flugzeug gesessen habe. Natürlich habe ich nicht wirklich vor, mich der Gruppe anzuschließen. Jedenfalls nicht, ohne sie vorher auszukundschaften. Sie schreibt, es seien mit der Führerin acht Frauen auf dieser Tour, und eine Gruppe dieser Größe sollte nicht allzu schwer auszumachen sein. Ich beschließe, sie aus angemessener Distanz zu beobachten und herauszufinden, wie langweilig sie sind, bevor ich eine Entscheidung treffe. Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass sie in Ordnung sind, werde ich auf sie zugehen. Wenn nicht, kann ich von London Bridge aus noch immer den Zug nach Canterbury nehmen und allein meine Mutter verstreuen.
Wikipedia schreibt, dass Chaucers Pilger ihre Reise in Southwark begannen – auf heutige Verhältnisse übertragen ein zwielichtiger Vorort, der außerhalb der Stadtmauern Londons lag und somit auch nicht dem Gesetz unterworfen war. Prostituierte, Diebe und Trunkenbolde waren dort zu Hause.
Jetzt wimmelt es hier von Touristen. Tatsächlich ist die ganze Gegend um die London Bridge ein Vergnügungszentrum wie geschaffen für Ausländer auf Urlaub. Es erstreckt sich von der Brücke selbst über den Kerker und den Turm auch auf mehrere Segelschiffe, die als Nachbildungen in Originalgröße auf der Themse schaukeln. Sogar Kostümierte laufen durch die Straßen, um Handzettel für Museen und Stadtrundfahrten zu verteilen, und kaum habe ich Southwark betreten, gesellt sich bereits ein Mann zu mir, der wie Sir Walter Raleigh gekleidet ist. Ich weiß, dass es sich nur um Raleigh handeln kann, weil er mit großer Geste einen Schritt zurücktritt, sich verbeugt und dabei seinen schäbigen roten Samtumhang ablegt, als wollte er ihn über eine der ziemlich großen Pfützen breiten, die der Regen auf der Straße hinterlassen hat. Die Idee dahinter ist vermutlich die, dass ich wie damals Queen Elizabeth über den Umhang laufen soll, aber ich schüttle abwehrend den Kopf, um ihm zu vermitteln, dass dies nicht nötig sei. Um ihm zu zeigen, dass ich ungeachtet meines Rucksacks und des hinter mir hergezogenen Koffers nicht die typische amerikanische Touristin bin. Egal, wie galant er sich auch geben mag, ich werde ihm nicht zum Kai folgen und zehn Pfund für eine Fahrt auf seinem Boot zahlen. Da hat er sich wirklich die Falsche ausgesucht. Und um ihm zu beweisen, wie unabhängig ich bin und wie eilig ich es habe, laufe ich direkt in die Pfütze hinein.
Er lächelt.
»Gehabt Euch wohl, Mylady«, sagt er, und seine Stimme hebt sich auf der letzten Silbe ein wenig, als wäre es eine Frage.
Macht er sich über mich lustig? Ist »Gehabt Euch wohl« elisabethanisch für »Verpiss dich«? Ich hatte schon immer den Verdacht, dass britische Männer glauben, eine unwiderstehliche Wirkung auf amerikanische Frauen zu haben, und mal ehrlich, ganz unrecht haben sie damit nicht. Sie wissen, dass wir sie wegen ihres Akzents lieben … dass ein britischer Mann picklig, pleite und primitiv sein kann und eine amerikanische Frau ihn dennoch umschmeicheln und fraglos einem ihrer eigenen Landsleute vorziehen wird. Aber wie soll eine Frau auf »Gehabt Euch wohl« reagieren? Etwa mit »Gehabt auch Ihr Euch wohl« oder sagt man besser einfach »Danke«?
Im Weitergehen werfe ich einen Blick über die Schulter. Sir Walter Raleigh löst die Spange seines Umhangs bereits für die nächste Touristin. Eine, die ihm mehr Wertschätzung entgegenbringt, femininer, hilfloser und liebenswerter ist. Sie kichert, und ihre Freunde machen ein Foto, als sie vorsichtig ihren Fuß anhebt, um auf den von Motten zerfressenen roten Samt zu treten. Er verneigt sich vor ihr, zieht den federngeschmückten Hut mit der einen und berührt ihre Fingerspitzen mit der anderen Hand. Ihr Lächeln verrät, dass sie ihm zehn Pfund geben wird. Ein Lächeln, als würde sie ihm gern alles geben, worum er sie bittet.
Trotz des langen Fußwegs treffe ich zeitig im Lokal ein, fast eine Stunde vor dem vereinbarten Treffen der Frauen. Das George Inn entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Dunkel ist es, ja, mit roten Zierleisten um die Fenster und vielen Kupferkesseln und jeder Menge anderem blödsinnigen Zierrat, der »historisches Gasthaus« schreit. Aber es ist größer und vornehmer, als ich vermutet hatte, und sehr gut besucht, offenbar von Einheimischen wie von Touristen gleichermaßen. Ich setze mich an die lange Eichentheke und bestelle mir meinen ersten Drink. Meine Seelenverfassung lässt sich wohl am besten damit wiedergeben, dass mir genau das durch den Kopf geht: »Mein erster Drink.«
Restaurants sind die Kirchen meiner Generation. Hier versammeln wir uns, um unsere Sünden zu beichten, Wein zu trinken, nach Hoffnungsschimmern Ausschau zu halten und – als Wichtigstes – um Gemeinschaft … oder wenigstens einen vorübergehenden Zufluchtsort vor unserer Einsamkeit zu finden.
Und wäre das George Inn tatsächlich eine Kirche, wäre diese Bar ihr Reliquienschrein. Ich starre auf die zahllosen Reihen vielfarbig gefüllter Flaschen, die alle sorgfältig von hinten beleuchtet werden, als wären sie in einem Museum zur Schau gestellte Juwelen. Oder vielleicht auch Bücher in einem Bibliotheksregal. Nein, nicht ganz. Keine Bücher. Denn Bücher beinhalten Geschichten von Dingen, die bereits passiert sind, aber die Spirituosen auf diesen hohen Regalen vor mir enthalten Geschichten, die sich erst noch ereignen. Von Liebenden, die sich noch nicht begegnet sind, von Schwertern, die noch nicht gezückt wurden, von Reisen, die vielleicht unternommen werden, vielleicht aber auch nicht. Und in diesem Glas, überlege ich und vertiefe mich dabei in jenes, das ich in meiner Hand halte … wartet unten am Grunde etwas Überraschendes auf mich. Wenn ich meinen letzten Schluck genommen habe, wird eine Geschichte ihren Anfang nehmen.
Fast zwei Stunden sind vergangen, und allem Anschein nach bin ich betrunken.
Die Frauengruppe, die ich erwartet habe, ist vor einiger Zeit eingetroffen und hat sich am hinteren Ende eines langen Tischs im Picknickstil niedergelassen. Aus dieser Entfernung ist es mir nicht möglich, ihr Gespräch zu verfolgen, aber ich kann ihre Gesichter im Spiegel hinter der Theke sehen. Die Verlegenheit, die man bei einer Gruppe von Fremden erwarten würde, die sechs Tage zusammen verbringen wird, scheinen sie nicht zu kennen. Sie reden und lachen, rücken ihre Stühle zurecht. Sie haben sich ihrer Mäntel und Schals entledigt und sich in die großen, bierfleckigen Speisekarten vertieft.
Viel Glück damit, möchte ich ihnen zurufen. Ich habe schon was gegessen, wenn auch nicht viel.
Die nachlässige Servicequalität in Europa ist mir schon seit jeher ein Ärgernis. Überall um mich herum stehen nicht abgeräumtes Geschirr und nicht nachgeschenkte Gläser. Kreditkarten warten in ihren schwarzen Kladden darauf, entgegengenommen zu werden, aber der junge Mann, der vor mir an der Theke bedient, lehnt mit vor der Brust verschränkten Armen an der Wand und starrt gedankenverloren ins Leere. Mich drängt es, ihn zur Eile zu ermahnen, ihm zu erklären, dass ich noch woanders hinmuss, aber das ist natürlich gelogen. Es gibt absolut nichts und niemanden, der mich erwartet. Keiner auf Erden – abgesehen vom Besitzer der Hundepension, wo ich Freddy zurückgelassen habe, und von der Uniprofessorin, die in diesem Moment in die Dunkelheit der Anästhesie abtaucht – hat die leiseste Ahnung, wo ich mich gerade befinde. Niemand weiß, in welchem Land ich mich aufhalte. Ich werde nirgendwo erwartet, von keinem, und die freie Zeit gähnt mich an wie ein Rachen. Wenn ich nicht aufpasse, falle ich noch hinein und werde auf der Stelle verschluckt.
Die acht Frauen haben sich, vier auf der einen, drei auf der anderen Seite, um den Tisch gruppiert, dessen Kopfende eine Frau in Beschlag genommen hat, die eindeutig die Jüngste in dieser Gruppe ist. Ich würde sie sogar noch ein Mädchen nennen, höchstens Mitte zwanzig. Sie ist schmal und dunkel, trägt das Haar im Nacken zum Pferdeschwanz gebunden und strahlt eine natürliche Würde aus. Offensichtlich ist sie die Professorin für Altphilologie, das akademische Wunderkind und somit die Leiterin unserer Tour. Koffer und Rucksäcke stapeln sich um die Stühle herum, und die Gruppe trinkt unentwegt und hält alle paar Minuten inne, um sich zuzuprosten, sehr wahrscheinlich auf den Anfang ihrer Reise. Von Anfang an scheint an diesem Tisch etwas außer Kontrolle geraten zu sein, denn es ist der lebhafteste im ganzen Pub. Mir fällt dabei eine gewisse Absurdität unseres Lebens auf – die eifrige Suche von uns Frauen nach Männern, die wir dann umschmeicheln, verführen, uns um sie kümmern, obwohl wir irgendwie wissen, dass es in mancher Hinsicht so viel einfacher, so viel erfüllender wäre, uns einfach zu erlauben …
Schnell, sage ich mir. Denk an was anderes. Überschreib den letzten Gedanken und drücke wieder auf ENTER, denn ich stehe kurz davor, zu dieser Art Frau zu werden. Sie wissen, wovon ich spreche. Der Frau, die vor kurzem fallengelassen wurde und jetzt allen Männern abgeschworen hat. Der Frau, die jeden, der ihr auf der Straße begegnet, heranwinkt, um ihm zu erzählen, was der Mistkerl gesagt hat, als er sie verließ, und dazu gleich noch alles, was sie falsch gemacht hat. Der Frau, der ihre Verbitterung ins Gesicht geschrieben steht und die mit geballten Fäusten durch die Welt läuft. Der Sorte Frau, die ungeduldig vor Sir Walter Raleigh den Kopf schüttelt. Ich muss meine Denkweise ändern, meinen Blick von diesem langen, fröhlichen Tisch lachender Frauen abwenden und mich auf die anderen Leute im Pub konzentrieren.
Wenn ich in so einer Verfassung bin, greife ich zu einem Spiel. Ich blicke mich in dem Raum um, in dem ich mich gerade befinde, und versuche zu entscheiden, welche drei Männer ich am attraktivsten finde. Dabei ist es unbedeutend, ob ein Mann verheiratet, viel zu jung oder offensichtlich schwul oder in anderer Hinsicht unerreichbar ist, weil es in diesem Spiel nicht darum geht, mich ihm zu nähern oder ihn auch nur anzulächeln oder mit ihm zu flirten. Es geht einfach nur darum festzustellen, dass er da ist. Um mich daran zu erinnern, dass es überall attraktive Männer gibt.
Die offensichtlichste Wahl hier im George fällt auf einen der Kellner, eine weitere Person, die ich im Spiegel beobachte. Er ist nicht gelangweilt wie die anderen, sondern kraftvoll und voller Energie. Seine Blicke schießen durch den Raum, wandern von Tisch zu Tisch, während er etwas abstellt oder etwas mitnimmt. Die Bartstoppeln an seinem Kinn sind Absicht, und er trägt zu einem weißen Hemd und Jeans eine steinfarbene Schürze wie einen Kummerbund um seine Taille.
Der zweitattraktivste Mann fällt nicht sofort ins Auge. Ich muss mich herumdrehen und den ganzen Raum absuchen, bevor ich ihn an einem Tisch voller Geschäftsleute entdecke. Er kommt meinem Alter näher und wirkt eigentlich sogar ein wenig dümmlich mit seinen viel zu großen Augen hinter den Brillengläsern. Er hat eine tiefe Spalte im Kinn und Grübchen und das, was mein Vater eine kumpelhafte Ausstrahlung genannt hätte. Als würde er darauf bestehen, für alle die Rechnung zu bezahlen, auch für Leute, die er gar nicht kennt. Nicht wirklich gut aussehend, aber sein Gesicht hat was Vertrauenswürdiges.
Gut. Jetzt der Dritte. Das ist noch schwerer, aber schließlich lege ich mich auf den Mann fest, der direkt neben mir sitzt. Er neigt zur Glatze oder trägt vielleicht auch nur sein graues Haar so kurz geschnitten, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als wäre gar nichts da. Das verleiht ihm die Aura eines römischen Senators in einer dieser üppig ausgestatteten BBC-Produktionen, die Aura eines Mannes, der über Macht verfügt. Er ist dünn – nicht dünn wie ein Mann, der von Natur aus schlank ist und sein ganzes Leben lang war, sondern eher dünn wie jemand, der krank gewesen ist und nun langsam den Weg zurück ans Licht wiederfindet. Denselben Ausdruck habe ich auch an Leuten in Dianas Pflegeheim gesehen – denjenigen aus dem Rehabereich, den Genesenden, den Glücklichen, die an der dunklen Mauer des Todes vorbeigeschrammt sind, aber irgendwie überlebt haben. Die hatten auch diesen skeptischen Blick. Er trägt einen marineblauen Pullover mit V-Ausschnitt, was mir gefällt, und ihm fällt auf, dass er mir auffällt. Natürlich tut er das. Die Tatsache, dass ich dieses Spiel oft spiele, bedeutet nicht, dass ich besonders gut darin bin.
»Sie sind Amerikanerin«, sagt er.
Ein interessanter Kommentar, da ich meines Wissens noch kein Wort gesprochen habe, seit er gekommen ist. »Woher wissen Sie das?«
»Sie haben den Kellner angelächelt. Amerikanerinnen machen so etwas. Ihr lächelt jeden an.«
Das sagt er, als wäre Lächeln eine Art Charakterfehler. Ungeachtet der Tatsche, dass dies eine grobe Verallgemeinerung ist, ertappe ich mich zu meinem Verdruss dabei, dass ich ihn, während er spricht, die ganze Zeit anlächle. Unsere Blicke richten sich auf die Hände des jeweils anderen, bemerken das Fehlen von Ringen. Er schielt auf das iPhone, das neben mir auf der Theke liegt. Freddy ist mein Displayhintergrund, und das erzählt diesem Mann vermutlich meine ganze Geschichte oder jedenfalls so viel, wie er unter den momentanen Umständen wissen muss. Eine Frau, die einen Hund auf ihrem Display hat, ist eine Frau ohne Kinder, ohne Ehemann. Ich kratze mich an der Hand. Die Bienenstiche jucken noch immer, vor allem der eine, der so unangenehm meine Handinnenfläche erwischt hat.
»Und wie heißt Ihr kleiner Hund?«, erkundigt er sich.
»Freddy«, sage ich, und unerklärlicherweise hätte ich beim bloßen Aussprechen des Namens am liebsten losgeheult. Ich bin erschöpft, sage ich mir. Ausgebrannt von diesem halbherzigen Schlaf im Flugzeug und jetzt auch noch betrunken und irgendwie verloren – auf den Flügeln des Schicksals in diesen merkwürdigen Pub getragen. Als er mich dann als Nächstes fragt, was mich nach London führt, rechnet er vermutlich mit einer einfachen Antwort, vielleicht einem einzigen Wort wie »Beruf« oder »Urlaub«, aber stattdessen sprudelt die ganze Geschichte aus mir heraus. Die Urne, die Bienen, der Krebs, die Blinddarm-OP, die Reiseweiber. Während ich spreche, streichen meine Finger um die Kanten meines iPhones, und ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich ihm nicht die ganze Geschichte erzähle. Den Teil, der Ned betrifft, lasse ich aus. Das wäre zu peinlich, und wenn ich zu Hause in den Staaten in einem Restaurant säße, würde ich mit diesem Mann gar nicht reden. Dann wäre ich in Twitter vertieft oder würde meine E-Mails checken, allein mit mir in meinem virtuellen Büro, weshalb es wohl schon an ein Wunder grenzt, dass ich seine Anwesenheit überhaupt bemerkt habe. Und doch halte ich mein iPhone in der Hand, während wir plaudern, wie ich das immer tue, selbst wenn es ausgeschaltet ist, selbst wenn ich keinen oder nur schwachen Empfang habe. Es ist mein Talisman, und ich klammere mich daran, wie ein Christ seinen Rosenkranz umklammert, und rastlos huschen meine Finger über die Kanten.
»Dann haben Sie also die Urne Ihrer Mama mitgebracht«, sagt er. Er hat die Angewohnheit, seine Unterlippe zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenzudrücken, wenn er einen Satz beendet, außerdem spricht auch er in dem merkwürdigen Tonfall wie Sir Walter Raleigh, so dass jede Feststellung wie eine Frage klingt und jede Frage fast wie eine Feststellung. Vermutlich eine britische Eigenart. Der ansteigende Ton am Ende des Satzes legt eine Unsicherheit nahe, zugleich aber ein »oder nicht?«, was bestätigt, dass er die Antwort auf die von ihm gerade gestellte Frage bereits kennt. Das ist unglaublich irritierend, doch vielleicht sind es auch seine Augen, die sehr klar und graugrün sind, eingebettet in kleine Lachfältchen, die mich irritieren, aber vielleicht bin ich einfach nur betrunkener, als ich dachte.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.





























