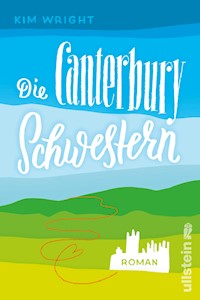8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, ein Weg, eine Antwort Cory Ainsworth schlägt sich nach dem Tod ihrer Mutter als Blues-Sängerin durch. Bis sie im alten Schuppen ihres Elternhauses ein Erinnerungsstück der Rock 'n' Roll-Geschichte entdeckt: den Blackhawk, das legendäre Auto von Elvis Presley. Für Cory ist das der langgesuchte Beweis: Elvis muss ihr biologischer Vater sein! Vor 37 Jahren war ihre Mutter Honey Backgroundsängerin beim King persönlich. Alles, was sie weiß, ist, dass Honey nach einem Jahr reumütig nach Hause zurückkehrte, um ihre Jugendliebe zu heiraten. Kurzerhand startet Cory das Auto und fährt dieselbe Route ab, die Honey damals genommen hat. Dabei erfährt sie nicht nur viel über ihre Mutter, sondern auch über Elvis, die 70er und ihren eigenen Platz in dieser Geschichte. Eine faszinierende Mutter-Tochter-Geschichte – bewegend und mitreißend wie ein Elvis-Song
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Cory Ainsworth kann sich als Bluessängerin gerade so über Wasser halten. Sie hat es seit dem Tod ihrer Mutter nicht immer leicht, aber sie kommt zurecht. Was ihr Kraft gibt, ist der Gedanke, etwas ganz Besonderes zu sein: Elvis ist ihr biologischer Vater, davon ist sie überzeugt. Denn ihre Mutter Laura, die brave Pastorentochter, hat Beaufort nach der Highschool verlassen, um als Backgroundsängerin mit dem King auf Tour zu gehen. Nach einem Jahr kehrte sie geläutert nach Hause zurück und heiratete ihre Jugendliebe Bradley. Sieben Monate und vier Tage später wurde Cory geboren. Völlig klar, dass die Rechnung nicht aufgeht und Bradley gar nicht ihr Vater sein kann. Der Verdacht erhärtet sich, als Cory im Schuppen ihres Elternhauses ein Auto entdeckt. Nicht irgendein Auto, sondern den Lieblingswagen von Elvis, seinen Stutz Blackhawk. Das Auto ist wie eine Zeitkapsel – im Rekorder steckt sogar noch eine alte Kassette mit einem Song von Elvis und ihrer Mutter. Cory zögert keine Sekunde: Sie wird das Geheimnis ihrer Mutter lüften und den Wagen die 672 Meilen von Beaufort zurück nach Memphis bringen, nach Graceland, und zwar auf derselben Route, die Laura vor 37 Jahren genommen hat.
Die Autorin
Kim Wright schreibt für mehrere Lifestylemagazine über Wein, Restaurants und Reisen. Sie ist leidenschaftliche Tänzerin und lebt in Charlotte, North Carolina.
Von Kim Wright ist in unserem Hause bereits erschienen:
Die Canterbury Schwestern
Roman
Aus dem Amerikanischen von Elfriede Peschel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1606-2
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage März 2018
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018 © 2016 by Kim Wright
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Last Ride to Graceland (Gallery Books, New York 2016)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für meinen Vater Harry Wright, der mich lehrte, an das zu glauben, was vor einem liegt.
Es war, als wäre er vorbeigekommen und hätte jedem einen Traum ins Ohr geflüstert, den wir dann irgendwie alle träumten.
BRUCE SPRINGSTEEN
TEIL EINS
Beaufort, South Carolina
CORY
30. Mai 2015
Ich war ein Frühchen und wog 4490 Gramm. Ja, ich weiß. Unmöglich. Aber medizinische Wunder speziell dieser Art sind im ländlichen Süden sehr verbreitet, verstehen Sie. Hier blickt Jesus noch immer von Reklametafeln herab, und den Leuten ist es nach wie vor wichtig, was ihre Nachbarn denken. Wir beten, und wir grüßen einander … und vor allem lügen wir. Deshalb haben wir auch so viele gute Schriftsteller hervorgebracht und ebenso viele schlechte. Wir alle haben gelernt, die Wahrheit zu verbiegen, kaum dass wir zu sprechen gelernt haben.
Das mag sich schlimm anhören, aber man sollte bedenken, dass die meisten Menschen nur lügen, um etwas zu schützen, was sie lieben, wie ihre Familie oder ihre Würde oder ihren Ruf. Ein Gefühl für Anstand kann durchaus etwas Gutes sein. Bei genauer Betrachtung verfügt die Welt nicht über genug Anstand. Ich erinnere mich, wie meine Großmutter bei einer Gastspielaufführung von Anatevka in Savannah, zu der sie mich mitgenommen hatte, zu weinen anfing und sich die Augen rieb, als sie »Tradition« sangen. Sie sagte zu mir: »Das ist mein Leben, Cory Beth, das bin ich durch und durch. Mit der einen Ausnahme, dass sie Juden sind.«
Versetzen Sie sich also in eine Version von Anatevka, wo es zur Tradition gehört, dass man Reis in kleine rosa Netzsäckchen verpackt, bevor man die Braut damit bewirft, dass man das dunkle Fleisch ganz unten im Hähnchensalat vergräbt, damit die Damen vom Gebetskreis nicht denken, man gehöre zum Gesindel, und dass man Leuten, die man eigentlich gar nicht ausstehen kann, Geburtstagsgeschenke schickt, nur weil sie einem 1997 mal eins geschickt haben und nun keiner mehr weiß, wie man aus diesem Teufelskreis rauskommt. Ganz genau. Versetzen Sie sich in ein Irrenhaus, wo man sehr höflich miteinander umgeht, und Sie bekommen ein Gefühl dafür, wie ich groß geworden bin.
Beaufort, South Carolina, das ist der Alte Süden. Nicht vergleichbar mit Atlanta und seinem Hip-Hop oder Charlotte mit seinen Banken oder Florida mit Walt Disney und all den Serienmördern. Das ist eine völlig andere Welt. Das ist der Teil des Südens, der mehr oder weniger den Krieg gewonnen hat, und die Menschen vergessen gern, dass der Rest von uns auch noch existiert. Wir sind nichts weiter als ein Ort, durch den man fährt, wenn man anderswohin unterwegs ist. Sind die Leute gezwungen, hier anzuhalten, weil sie was benötigen – Benzin oder Feuerwerkskörper oder einen Grill oder Wassermelonen –, kehren sie in ihre Autos zurück und sagen kopfschüttelnd: »Ist das zu fassen?« Sie halten uns für langsam. Aber wir sind gar nicht so langsam. Wir brauchen einfach nur länger für alles. Wir streifen umher, machen Umwege und reden um den heißen Brei herum, und genau das tue ich im Moment wohl auch.
Aber ich will Ihnen etwas mitteilen, und jetzt kommt es: Zu sagen, ich sei sieben Monate und vier Tage, nachdem meine Eltern geheiratet haben, zur Welt gekommen, ist nur eine Rechenvariante. Eine andere wäre, zu sagen, ich sei sieben Monate und neun Tage, nachdem meine Mama Graceland verlassen hatte, geboren worden. In wahnsinniger Eile war sie nach Hause gerast, weil ihr plötzlich klar geworden war, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Vielleicht hätte sie doch nicht als Backgroundsängerin auf Tour gehen und sich die Haare schwarz färben und die Augen schminken und den strahlenden Lichtern des Rock ’n’ Roll hinterherjagen sollen. Vielleicht wäre sie besser zu Hause geblieben und hätte den Jungen von nebenan geheiratet, den, der sie so sehr liebte, dass er ihr noch am selben Abend, als sie beide ihren Highschoolabschluss von der Leland Howey High in der Tasche hatten, einen Heiratsantrag machte. Aber das hatte sie damals nicht begriffen. Sie war blind dafür gewesen, dass ihr wahres Schicksal direkt vor ihr stand. Sie war achtzehn, und sie musste sich etwas beweisen.
Also verließ Laura Berry Beaufort, und als die Tür hinter ihr zuschlug, erschütterte der Knall Bradley Ainsworths Herz. Sie tourte, und er wartete, wurstelte sich durch im Familienbetrieb, der mit Beton sein Geld verdiente, bis zu jenem Tag … jenem Tag im Spätsommer 1977, als es so heiß war, dass die Luft flimmerte, und er aufblickte und anfangs dachte, der Schweiß in seinen Augen beschere ihm ein Trugbild. Aber nein, sie war es wirklich. Laura, die Liebe seines Lebens, kam über den Rasen auf ihn zu. Das Make-up hatte sie sich aus dem Gesicht gewischt. Die Stiefel waren verschwunden und die Lederjacke auch, das Haar war schlicht zusammengebunden, und sie streckte ihre Arme aus wie eine Schlafwandlerin. Es tue ihr leid, sagte sie. So überaus leid. Sie habe die Welt gesehen, und sie habe genug gesehen. Sie habe Memphis verlassen und sei die Nacht durchgefahren, habe geweint und gebetet und Truck-Stopp-Kaffee getrunken, um durchzuhalten. Wolle er sie immer noch? Oder sei es zu spät?
Statt einer Antwort hob er sie hoch und wirbelte sie herum. Er drehte sich mit ihr um die eigene Achse, und als sie sich noch mal entschuldigen wollte, sagte er, sie solle still sein, denn das Jahr ihres Getrenntseins habe es nie gegeben. Sie sei sein Mädchen, sei es immer gewesen, und jedes weitere Wort erübrige sich. Gleich am nächsten Tag heirateten sie, Lauras Vater stand auf der Kanzel, und die gesamte Gemeinde füllte die Bänke. Der Rest ihres Lebens spulte sich ab wie Seide, ein schönes Ereignis folgte dem anderen, genau so, wie sie es geplant hatten.
Sieben Monate und vier Tage später kam ich. Ich war so groß und kräftig, dass allgemein behauptet wurde, ich hätte meinen Kopf gehoben und Laura und Bradley im Kreißsaal angesehen nach dem Motto: »Ernsthaft? Seid ihr euch da sicher? Ist das die Geschichte, an der wir festhalten wollen?«
Bradley Ainsworth ist ein guter Mann. Er hat meine Mutter bis zu ihrem viel zu frühen Tod gepflegt, als sie an Brustkrebs erkrankte, und er hat alles getan, was man von einem Vater erwarten kann. Ich sehe ihn noch immer vor mir, wie er das Markiergerät über den Fußballplatz der Grundschule schiebt, wie er die Kekse der Pfadfinderinnen isst, die zu verkaufen ich zu schüchtern war, wie er die Stirn runzelt und den jeweiligen Jungen vor einem Date mit mir fragt, wieso er glaubt, sein kleines Mädchen zum Tanz ausführen zu dürfen. Er lebt ein einfaches, schlichtes Leben. Er wählt die Republikaner und nimmt an den Versammlungen der Presbyterianischen Kirche von Beaufort teil. Ich würde ihm niemals wehtun wollen, aber Zahlen lügen nicht, und Fakten sind Fakten, und die Wahrheit kann selbst im Süden nicht auf Dauer verborgen bleiben. Ich habe es schon immer gewusst, und es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Die meisten Menschen, denen ich wehtun könnte, sind tot, außer Bradley, und wer weiß, vielleicht hat die Wahrheit ja auch für ihn etwas Befreiendes. Tief in seinem Herzen muss er es doch auch wissen, und deshalb können wir beide genauso gut einmal tief Luft holen und es laut aussprechen:
Mein wirklicher Vater ist Elvis Presley.
Das ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Es ist nicht nur dem unleugbaren biologischen Tatbestand geschuldet, dass meine Mama bereits schwanger gewesen sein muss, als sie in wilder Fahrt von Memphis nach Beaufort durch die Nacht raste und sich überlegte, wie sie das Baby eines anderen Mannes ihrer gutgläubigen Highschool-Liebe unterjubeln könnte. Ich behaupte das auch nicht allein deshalb, weil mein Bauchgefühl mir immer schon gesagt hat, dass ich in der falschen Familie und am falschen Ort aufgewachsen bin. Und auch nicht etwa, weil immer schon etwas in mir wusste, dass ich zu Größerem bestimmt war, und auch nicht allein aufgrund der Tatsache, dass ich singen kann.
Das kann ich wirklich, glauben Sie mir, wie ein Engel und auch wie ein Teufel.
Aber ich greife vor. Erzähle das Ende, bevor ich den Anfang erzähle.
Also von vorn: Die Enthüllung meiner wahren Identität begann gestern Nachmittag, als ich in die Bar kam, um meinen Scheck abzuholen.
Ich arbeite in einer Kneipe, die Bruiser’s heißt. Warum, weiß ich nicht. Also nicht, dass ich nicht wüsste, warum ich dort arbeite – man bezahlt mich, und die Auftrittsmöglichkeiten für Musiker in einer Stadt wie Beaufort sind begrenzt. Was ich sagen will: Ich weiß nicht, warum sie den Laden Bruiser’s genannt haben. Das klingt nach einer Spelunke, in der sich Biker gegenseitig die Köpfe einschlagen, obwohl es ein nettes kleines Café ist, direkt am Zufluss der Wasserstraße gelegen. Ich spiele draußen auf der Veranda, wo die Shrimps zum Selbstpulen eimerweise serviert werden. Ich spiele Coverversionen von Jimmy Buffet, Joni Mitchell, Chris Isaak und auch ein bisschen was von Van Morrison. Dazwischen hin und wieder was Eigenes, obwohl das dem Besitzer eigentlich nicht gefällt. Dann gehen die Gäste nämlich auf die Toilette oder verlangen die Rechnung.
Jeder, der bei Bruiser’s arbeitet, bekommt freies Essen, bevor seine Schicht beginnt. Fast alle nutzen diese für Gerry, den Besitzer, völlig untypische Großzügigkeit aus, auch wenn wir sehr wohl wissen, dass wir die Reste vom Vorabend bekommen. Die Kellner sitzen mit den Kellnern zusammen, die Köche mit den Köchen, und das Talent des Abends sitzt an einem separaten Tisch, was für eine Band ganz schön sein mag, für eine Solistin wie mich aber kann es ziemlich einsam werden. Ich bringe mir immer was zu lesen mit. Meistens liegt das Buch im Auto für den Donnerstag- und Freitagnachmittag, damit ich einen beschäftigten Eindruck mache, während ich meine Krabben pule, die Zitrone darüber auspresse und zusehe, wie die Sonne über der Bucht untergeht. Es fühlt sich an wie auf der Highschool, aber das ist ja am Ende bei fast allem so.
Wir haben also den gestrigen Tag, und ich bin fast fertig, als ich aufblicke und Gerry mit einem Bier in der Hand auf mich zukommen sehe. Es schäumt sehr, weil die Anlage immer spritzt, wenn das Fass beinahe leer ist. Er hat eine Nachricht für mich.
»Dein Daddy hat für dich angerufen«, sagt Gerry.
»Möchte er zurückgerufen werden?«
»Ne. Er sagte nur, du sollst ihm seine Watstiefel schicken.«
»Seine Watstiefel? Keine Ahnung, wie ich ihm seine Watstiefel schicken soll. Ich weiß nicht mal, was dieser Satz bedeuten soll.«
Gerrys Stirn legt sich in Falten. »Moment mal. Ich hab’s mir aufgeschrieben.«
Er kehrt ins Restaurant zurück und schlürft dabei den Schaum von seinem Bier. Da ich während der Saison jedes Wochenende im Bruiser’s spiele, wird Bradley gewusst haben, dass seine Nachricht mich hier erreicht. Ich schiebe meinen Teller beiseite und lasse den Blick zu dem Grüppchen der Bedienungen wandern, die eine Ebene unter mir sitzen. Hauptsächlich sind es Collegekids, entweder aus der Designschule in Savannah oder aus dem College unten in Charleston. Sie sehen nach altem Geld und neuen Klamotten aus, und es gefällt ihnen, das einfache Leben mal auszuprobieren. Ein paar von ihnen teilen sich ein Ferienhaus unten an der Wasserstraße, verbringen den ganzen Tag dösend am Strand und servieren dann am Abend. So ein einfaches Dasein macht Spaß, solange es nur vorübergehend ist und man weiß, dass man irgendwann nach Hause ins echte Leben zurückkehren kann. Jugendliche wie diese kommen jeden Sommer ins Tiefland, werden mit den Gezeiten an- und wieder weggespült, und früher habe ich jede Saison mit einem oder zweien der Jungs geschlafen. Sie waren jung und hübsch und leicht zu vernaschen, genauso wie ein Haufen Krabben vom Vortag, und ich war damals auch jünger und hübscher.
Julie Mackey, meine Mitbewohnerin für den Großteil meiner Zwanziger, ließ sich jedes Jahr am Memorial Day zum Zeichen des Saisonstarts ein Tattoo stechen. Die Sommerjungs nannte sie »das Buffet«. »Schauen wir mal, was das Buffet zu bieten hat«, forderte sie mich Mitte Mai immer auf, wenn die Bars und die Rettungsschwimmerhäuschen anfingen, Jobs zu vergeben. Wir schlenderten durch die Stadt und hielten Ausschau, was die neue Saison für uns in petto hatte. »Sieht ganz danach aus, als würde ich dieses Jahr einen besonders großen Teller brauchen«, meinte Julie manchmal. Sie sang für eine Coverband, die alles spielte, und konnte knurren wie Janis Joplin. Rau wie Sandpapier, in der Stimme wie im Leben. »Sieht ganz nach einem Nachschlag aus«, sagte sie in den Sommern, in denen das Buffet besonders reichhaltig bestückt war. Immer wenn Julie so daherredete, hatte man das Gefühl, sie würde gleich eine Zigarette wegschnipsen, obwohl ich das Mädchen nie hatte rauchen sehen.
Jetzt ist Julie verheiratet. Sie hat Kinder, und ich frage mich, was sie mit ihren Tattoos gemacht hat, mit der bekifft aussehenden Meeresschildkröte auf ihrer Schulter oder dem Nix auf ihrer Brust. Ihr Knurren ist zu einem zahmen Schnurren geworden, und manchmal laufe ich ihr über den Weg – unvermeidbar in einer Stadt von dieser Größe –, aber es scheint ihr nicht peinlich zu sein, mich zu treffen. Wahrscheinlich sollte es uns beiden ein wenig peinlich sein – ihr wegen dem, was sie mal war, und mir, weil ich es noch immer bin. In den Zwanzigern ist das wilde Leben eine schöne Sache, selbst um die dreißig ist es noch okay, sich so treiben zu lassen, aber jetzt … mit siebenunddreißig immer noch das Buffet abzugrasen? Kommt nicht so gut. Meine Augen schweifen über die männlichen Bedienungen und hinaus auf die Bucht, wo die Segelboote auf den Wellen schaukeln und der Himmel in rosa- und lilafarbenes Licht getaucht ist.
Bradley versucht also, Kontakt zu mir aufzunehmen. Er möchte, dass ich ihm seine Watstiefel schicke, was zum Teufel das auch heißen mag.
Ich hatte in letzter Zeit einige finanzielle Engpässe. Mein Handyvertrag wurde mir gekündigt. Nur vorübergehend, bis zum Ersten des nächsten Monats, oder vielleicht auch bis zum Ersten des übernächsten Monats. Ich vermute, dass Bradley mich angerufen und die Nachricht bekommen hat, dass seine Tochter mit ihren bald vierzig Jahren eine Loserin ist, die in einem Trailer lebt, durch die Strandbars tingelt und mit den falschen Männern schläft. Verbindungsstudenten, Durchreisenden, koksenden Bassisten, fremdgehenden Vertretern, einem Hilfsgeistlichen, der daran zweifelt, dass Gott zuhört. Das sind meine Jungs. Ich weiß nicht, ob mein Mobilfunkanbieter das alles in einer Ansage unterbringt, aber denken wird man es sich dort. Außerdem ist Bradley bestens darüber informiert, dass sein süßes Mädchen am Abgrund taumelt. Ich bin der Grund, weshalb er nicht für den Schulausschuss kandidiert hat, obwohl ihm alle gesagt haben, er soll es tun.
Rätselhaft ist es schon. Bradley ist runter nach Clearwater gefahren, um dort über das Memorial-Day-Wochenende zu angeln. Wenn er seine Watstiefel vergessen hat, was offenbar der Fall ist, warum ist er dann nicht in irgendein Sportgeschäft oder einen Anglerladen da unten gegangen und hat sich ein Paar gekauft? Die verdammten Dinger nach Florida zu schicken, vorausgesetzt, ich finde sie überhaupt, wird ein Vermögen kosten. Allerdings hat Bradley große Füße. Größe 48, die Füße eines Basketballers. Ich lege meine eigenen auf einem Stuhl ab und mustere sie. Größe 35, mit hohem Rist und kurzen Zehen. Klein wie die eines Kindes.
»Was singst du heute Abend?«, ruft mir eine der Bedienungen zu. Der Junge hat offensichtlich schon mittags zu trinken angefangen und einen Sonnenbrand. Ich weiß nicht, warum er mich anspricht. Vermutlich versucht er nur, nett zu sein.
»Weiß ich noch nicht«, rufe ich zurück. Er hat sich in seinem Stuhl so weit nach hinten gelehnt, dass er damit gleich auf die Veranda knallen wird.
»AAE«, sagt er augenzwinkernd. »Alles außer Elvis.«
Woher verdammt noch mal weiß er, dass ich nie Elvis singe? Während ich mit zusammengekniffenen Augen sein Gesicht mustere, frage ich mich, ob er womöglich zu den Wiederholungstätern gehört und ich ihn vom letzten Jahr kennen sollte. Ich glaube nicht, dass ich mit ihm geschlafen habe, aber drauf wetten würde ich auch nicht. Ich habe kein gutes Gedächtnis für Gesichter oder Namen oder die Hauptstädte von Südamerika oder die Abfolge der Präsidenten oder sonst irgendwas, außer Songtexten. Wenn ich einen Song einmal gehört habe, kenne ich jedes Wort, eine sehr nützliche Gabe für eine fahrende Sängerin. Für ein Mädchen, das die Wasserstraße abklappert, von einem Klub zum nächsten zieht und sich nie ganz sicher sein kann, mit welcher Klientel sie es zu tun haben wird. An einem Abend ist es eine Gruppe von Motorradfahrern. Am nächsten sind es Golfer. Dann wieder lande ich in einem Lokal, wo die Leute zum Überwintern aus New York und Pennsylvania hinkommen, jenen Bundesstaaten, in denen keiner daheim zu bleiben scheint. Also muss ich darauf vorbereitet sein, jeden Song zu covern, den sie hören wollen, und bis zu einem gewissen Punkt kann ich das auch.
Aber überall, wo sie mich anheuern, wissen sie, dass ich niemals Elvis spiele. Ich kann es einfach nicht. Warum, weiß ich selbst nicht genau. Wenn ich damit anfange, passiert immer irgendwas. Es schnürt mir die Kehle zu oder ich muss husten oder ich verhaspele mich, habe Mühe, die Texte abzurufen, obwohl ich jede Zeile so gut kenne wie meinen eigenen Namen.
Ich gebe Ihnen ein perfektes Beispiel. Es war an einem Abend vor ziemlich genau einem Jahr, Sommeranfang, ich saß auf dieser Veranda, vielleicht sogar am selben Tisch, und hatte den gleichen wunderschönen Ausblick auf die Wasserstraße. An diesem speziellen Abend trafen zwei merkwürdige Ereignisse zusammen: Erstens kam meine Mutter herein, oder besser gesagt, sie kam heraus. Sie muss ins Bruiser’s gekommen und dann durch den Innenraum hinaus auf die Veranda gegangen sein, die an diesem Abend voller Leute war, weshalb es auch etwas dauerte, bis ich sie entdeckte. Mama schaute so gut wie nie im Bruiser’s vorbei, und wenn, dann niemals ohne Bradley, und schon gar nicht an einem Sommerwochenende, wenn es rammelvoll war. Und – was noch viel seltsamer war – sie kletterte auf einen der Barhocker, die am Geländer standen, und bestellte sich einen Pfirsich-Daiquiri. Wenn sie überhaupt was trank, dann das – aber äußerst selten, nur an Geburtstagen und auf Reisen. Sie liebte diese fruchtigen Brunch-Cocktails mit den tanzenden Blüten und dem Obst obenauf.
Als ich mein Set begann, aufblickte und sie dort ganz allein sitzen sah, wie sie mir mit einem Lächeln zuprostete, geriet ich aus dem Konzept. Natürlich hatte sie mich schon zigmal singen hören, allerdings weitaus häufiger die Kirchen-Cory als die Kneipen-Cory. Ich bin auch noch immer der Meinung, dass ich damit klargekommen wäre, wäre nicht unmittelbar darauf das nächste merkwürdige Ereignis eingetreten. Ich begann mit Van Morrisons Moondance – einem jener seltenen Songs, die jeder Situation angemessen sind, sogar dem Anblick von Laura Berry Ainsworth, die auf einem Barhocker sitzt und an einem Samstagabend allein Daiquiris schlürft –, aber dann brüllte dieser betrunkene Yankee (gibt es überhaupt andere?): »Spiel Blue Suede Shoes!«
Blue Suede Shoes, im Ernst? Das covert keiner, und außerdem ist das Bruiser’s, wie bereits gesagt, nicht die Art von Bar, wo die Leute sich volllaufen lassen und dann um sechs Uhr nachmittags ihre Titelwünsche herausbrüllen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er war laut. Ich konnte nicht so tun, als hätte ich ihn nicht gehört, also fing ich gehorsam mit dem »One for the money, two for the show«-Teil an, ging dann aber zu etwas anderem über. Zu irgend so einem alten Rockabilly-Stück, Jerry Lee Lewis oder so was in der Art. Ich glitt von meinem Barhocker und mischte mich unter die Menge, ging mit meiner Gitarre zwischen den Tischen hindurch, weil die Leute das mögen. Wenn man sich nur ordentlich anstrengt, vergessen die Leute, was man singt, und selbst der Typ, der Blue Suede Shoes hören wollte, schien zufrieden zu sein. Also ging der Kelch an mir vorüber. Ich hatte es vermieden, Elvis zu singen, ohne direkt »AAE« ins Mikro sagen zu müssen, was in Anbetracht dessen, dass ich sonst alles singe, immer komisch und kratzbürstig klingt. Als mein Blick aber auf Mamas Ecke traf, war sie gegangen. Ihr Hocker war leer, nur das Daiquiriglas stand noch auf dem Holzgeländer, mit einem kleinen, rosafarbenen Rest drin, den sie übrig gelassen hatte.
Da ich Mama nur höchst selten etwas trinken sah, erstaunte es mich, dass sie so schnell trank. Später, viel später, als sie mir endlich gestand, wie krank sie war, zählte ich zwei und zwei zusammen und dachte mir, dass sie an jenem Tag, als sie abends allein und unangekündigt ins Bruiser’s kam, um mich zu hören, ihre Diagnose bekommen hatte. Es war nicht nur Brustkrebs, sondern bereits das dritte Stadium und eine seltene Mutation, durch die der ganze Prozess in rasender Geschwindigkeit abläuft. Ein wütender Cajun-Krebs, der einen binnen fünf Monaten von Daiquiris direkt ins Bestattungsinstitut bringt.
Gerry kommt mit einem Notizzettel in der Hand zurück. »Also«, setzt er an, »hier habe ich alles aufgeschrieben, was ich dir von deinem Daddy ausrichten soll. Erstens, ist das Wasser viel rauer als im letzten Jahr. Sie angeln in der Brandung und fahren gar nicht mit dem Boot raus. Deshalb braucht er auch seine Watstiefel.«
Ich nicke.
Gerry nickt ebenfalls. »Er meint, du denkst dir sicherlich, Mist, das kostet bestimmt ein kleines Vermögen, sie da runterzuschicken, aber du sollst bedenken, wie groß seine Füße sind. Große, alte, dumme Füße, die nicht in reguläre Watstiefel passen. Das hat er gesagt. Nicht ich.«
Ich nicke.
Gerry schielt auf seine Notiz. »Er sagt, du sollst raus nach Polawana Island zu seiner Anglerhütte fahren, den Ort kennst du ja, und sie holen. Er meint, sie seien in der Hütte, nicht im Schuppen, das soll ich betonen. Die Hütte also, nicht der Schuppen, verstanden?«
»Verstanden.«
»Geh nicht in den Schuppen.«
»Ich werde nicht in den Schuppen gehen.«
»Weil die Watstiefel in der Hütte sind.«
»Ich denke, das kann ich mir merken.«
»Und du schickst sie ihm per Nachnahme ans Postamt von Clearwater.«
»Jawohl, Sir.«
Er zerknüllt die Notiz in seiner Hand. »Was spielst du heute Abend?«
»Beach Boys. Vielleicht auch ein bisschen Chairmen of the Board und ein paar Songs von den Drifters. Du weißt schon, Sommersongs. Um die Saison einzuläuten. Und den Leuten das zu geben, was sie hören wollen.«
»Gutes Mädchen.« Gerry entfernt sich, aber er dreht sich noch mal um. »Und denk dran«, sagt er. »Sieh in der Hütte nach, nicht im Schuppen.«
»Herrgott noch mal«, sage ich. »Ihr Kerle denkt wohl, ich hätte überhaupt keinen Verstand.«
Am nächsten Tag auf Bradleys anderthalb Hektar großem Grundstück auf Polawana Island steuere ich auf den Schuppen zu. Ich fahre nicht oft raus nach Polawana. Es ist Bradleys Äquivalent für eine Männerhöhle. Hier geht er mit seinen Kumpels angeln, und hierher zog er sich manchmal zurück, wenn der Schmerz darüber, meine Mama dahinschwinden zu sehen, einfach zu viel für ihn wurde. Aber selbst bei den wenigen Malen, die ich hier draußen war, hat der Schuppen mich nie interessiert, soweit ich weiß jedenfalls. Er steht direkt am Wasser und ist nichts weiter als eine kleine Bude aus halb verrottetem Holz, in der Bradley die Sachen für sein Boot aufbewahrt. Als ich die Böschung hinunterlaufe, rutsche ich im Schlamm aus und muss mich am Schilf festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Die Watstiefel habe ich bereits geholt. Sie befanden sich gleich hinter der Tür der Zweiraumhütte, lehnten an der Wand und sahen ein wenig unheimlich aus, wie die Beine eines Mannes, dessen obere Hälfte fehlt. Ich trug sie raus und legte sie auf den Beifahrersitz meines Toyota, dachte nach und schnallte sie dann fest. Eigentlich hätte ich daraufhin gleich wieder losfahren sollen, Aufgabe erledigt, aber die Art und Weise, wie Bradley und Gerry beide betont haben »die Hütte, nicht der Schuppen«, weckte in mir das namenlose, unsinnige Verlagen, dem Schuppen einen Besuch abzustatten. So funktioniert mein Gehirn nun mal. Wenn meine Oma das Haus verließ, pflegte sie zu sagen: »Steck dir keine Bohnen in die Nase«, was offensichtlich scherzhaft gemeint war, denn es gibt für einen vernünftigen Menschen überhaupt keinen Grund, sich Bohnen in die Nase zu stecken. Aber die Worte trafen meine Seele jedes Mal wie ein göttlicher Befehl. Bis zu dem Tag, als ich sieben war und im Ortskrankenhaus landete und am eigenen Leib erfuhr, dass es eine zutiefst unangenehme Erfahrung ist, sich eine Bohne aus der Nasenhöhle extrahieren zu lassen.
Eine weitere zutiefst unangenehme Erfahrung könnte mich auch am Fuße dieses Abhangs erwarten – eine, wie man sie aus der Sendung 20/20 kennt. Oder aus Dateline. Oder Southern Fried Homicide. Ich habe sie alle gesehen, und der Anfang ist bei jeder Serie gleich: ein Mädchen, das es unbedingt wissen will, stochert ganz allein am Arsch der Welt herum, wie ich das jetzt tue. Aber ich gehe trotzdem weiter zum Schuppen und schaue durch das schmutzige, von Spinnweben überzogene Fenster.
Alles, was ich entdecke, ist ein Auto.
Eigentlich sehe ich nur einen Teil von einem Auto, eine Stoßstange. Eine dieser Muscle-Car-Stoßstangen, und sie ist eingehüllt in Luftpolsterfolie. Nicht nur in eine Lage, sondern in mehrere. Ich trete vom Fenster zurück und scheuche eine Spinne aus meinen Haaren.
Ich muss ein paarmal kräftig rütteln, bis ich die Tür loskriege und sie aufschieben kann. Dann sehe ich das ganze Gefährt, es ist auf mich gerichtet. Die Reifen auf der einen Seite sind platt, weshalb es schräg steht, und die mehrmals kreuz und quer mit Klebeband befestigte Luftpolsterfolie hat das, was einmal die sauberen, eleganten Linien des Chassis gewesen sein müssen, in eine klumpige graue Masse verwandelt. Aber dass Kraft in dieser Maschine steckt, lässt sich nicht leugnen. Schließlich ist auch ein verwundeter Tiger immer noch ein Tiger.
Unter gar keinen Umständen haben Bradley und Laura Ainsworth jemals ein solches Auto besessen.
Einen Moment lang weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich versuche, das Auto zu umrunden, aber es ist so groß, dass es den ganzen Schuppen in Beschlag nimmt, und seine rückwärtige Stoßstange stößt gegen die Wand. Ich quetsche mich an der Fahrerseite entlang und streiche mit der Hand über die Luftpolsterfolie, deren Bläschen zur Hälfte geplatzt sind und die überall schmutzig ist. Ich halte Ausschau nach etwas, womit ich das Klebeband durchtrennen könnte, aber der Schuppen scheint nur den Wagen zu beherbergen. Hier gibt es keine Angelutensilien und auch keine Bootsteile. Hat es nie gegeben. Die Erkenntnis, dass meine Mama jahrelang etwas vor mir verborgen gehalten hat, schockiert mich nicht im Geringsten, aber dass Bradley ihr dabei geholfen hat? Das schockiert mich unerklärlicherweise zutiefst.
Oben in der Hütte habe ich ein Messer gesehen. Ein Fischermesser, auf einer Arbeitsfläche neben der Spüle, mit einer langen, gebogenen Schneide, wahrscheinlich sehr scharf. Ich kraxle die Uferböschung hoch und hole es, strecke es, so weit es geht, von mir weg, während ich wieder nach unten rutsche. Bei meinem Glück verliere ich womöglich den Halt, spieße mich selbst auf, und dann rollt mein Körper in den Fluss, wo keiner mich jemals finden wird.
Zurück im Schuppen überlege ich, wo ich am besten anfange.
Ich möchte nicht die Folie durchtrennen und den Autolack zerkratzen, aber durch das Klebeband zu sägen gestaltet sich mühsamer als gedacht, und so beschließe ich, mich Schicht für Schicht vorzutasten. Erst das Klebeband, dann die Luftpolsterfolie, dann die Badetücher darunter. Auf dem ersten steht Hotel California, ein anderes trägt die Aufschrift Super Bowl X Champions Pittsburgh Steelers. Auf dem nächsten heißt es Aloha From Hawaii, geschmückt mit einer großen Orchidee.
Aber als ich diese letzte Schicht Siebziger-Nostalgie abgeschält habe, liegt der vordere Kotflügel der Fahrerseite vor mir, und ich kann zum ersten Mal erkennen, womit ich es zu tun habe. Der Wagen ist schwarz. Glänzend. Sein Kokon hat die Politur so makellos konserviert, wie sie an dem Tag war, als er vom Hof des Autohändlers gerollt ist. Ich zerre am nächsten Stück Luftpolsterfolie. Ein ganzes Stück auf einmal fällt herunter, und die Seite ist frei. Ich lege meine Hand auf die Fahrertür, schicke ein Stoßgebet ins Nichts und öffne sie.
Die Innenverkleidung ist rot. Ganz aus Leder. Überall rotes Leder, bis auf die Stellen, die golden sind. Ohne Patina. Goldglänzend selbst jetzt noch. Ein Styroporbecher steckt in einem der Becherhalter, der Rand mit kirschrotem Lippenstift beschmiert. Weitere Becher liegen im Fußraum der Beifahrerseite, zusammen mit zerknüllten Papiertüten. Eine braun gefleckte Serviette, als hätte sich jemand den Schokoladenmund abgewischt. Und eine Straßenkarte. Eine schlichte alte Tankstellenstraßenkarte wie die, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, die Sorte, die sich unmöglich wieder in acht perfekte Segmente zurückfalten lässt. Die Person, die diesen Wagen zuletzt fuhr, hat es nicht mal versucht. Die Landkarte liegt ausgebreitet über dem roten Ledersitz und berührt den Boden. Eine Sonnenbrille, übergroß und im Pilotenstil, baumelt vom Rückspiegel.
Von unten steigt außerdem ein Geruch auf – nicht muffig, wie man es erwarten würde, auch nicht der elementare, feuchte Modergeruch des Flusses, sondern etwas Subtileres, Raffiniertes. Ein Frauenparfüm, würzig und süß, ein Duft, wie er heute nicht mehr hergestellt wird, vermischt mit einem dunkleren, männlicheren Aroma. Der Pferdestallgeruch von Tabak.
Ich habe eine Zeitkapsel geöffnet.
Ich lasse das Messer in die Uferböschung gesteckt zurück und kämpfe mich wieder hoch zu meinem eigenen Auto. Es ist von einem Muscle-Car so weit entfernt, wie man es sich nur denken kann, ein goldener Camry, und ich springe hinein und fahre zur Exxon-Tankstelle auf St. Mary’s Island. Hier in der Gegend nennen sie alles eine Insel, aber eigentlich sind es mit Brücken verbundene Landzungen, und das Einzige, was diese sogenannten Inseln voneinander trennt, ist Sumpfgebiet. Bei der Tankstelle gleich am Anfang von St. Mary’s gibt es einen Münzfernsprecher, eine richtige Telefonzelle am Straßenrand, vermutlich eine der letzten ihrer Art in Beaufort, wenn nicht auf der ganzen Welt. Sobald man es sich mit seinem Mobilfunkanbieter verscherzt hat, fängt man an, auf solche Dinge zu achten.
In meinem eigenen Becherhalter habe ich immer Kleingeld, und während meine Finger nach den Vierteldollarmünzen tasten, denke ich an den Styroporbecher mit dem perfekten kleinen Abdruck eines Frauenmundes darauf in dem schwarzen Auto. Hat meine Mutter mal solchen Lippenstift getragen? Das kommt mir eher unwahrscheinlich vor. Ich kam 78 zur Welt, irgendwo in diesem Tal zwischen den Hippie- und den Discojahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass damals jemand eine derart schreiende Farbe wie die des knalligen Halbmonds auf dem Becher getragen hat. Keinesfalls hier in Beaufort, wo die Lippen anständiger Leute höchstens eine Schattierung dunkler sind als ihre Haut.
Vielleicht war es Bühnen-Make-up. Ein letzter Rest von Mamas Zeit auf Tournee.
Ich krame sechs Vierteldollarmünzen heraus. Gehe rüber zur Telefonzelle, suche nach den Gelben Seiten, aber natürlich ist das ganze Telefonbuch verschwunden. Einzig der schwarze Plastikumschlag ist noch übrig und flappt am Ende der Kette herum. Also muss ich in die Tankstelle gehen, um mir Hilfe zu holen. Aber auch der Jugendliche an der Kasse hat kein Telefonbuch. Er sucht in seinem iPhone nach den Nummern und beäugt mich skeptisch. Die erste Bitte ist in dieser Gegend absolut naheliegend, denn jeder, der eine Autopanne hat, ruft Leary an, aber die zweite?
Ich weiche seinem Blick aus, greife nach dem Kugelschreiber auf der Theke und schreibe mir beide Nummern auf den Arm. Dann laufe ich zurück zur Telefonzelle.
Leary hebt nach dem ersten Läuten ab und verspricht, sich in zwanzig Minuten mit mir am Schuppen zu treffen. Ich verdrehe meinen Arm, sodass ich auch die anderen Ziffern lesen kann, die ich in der Eile etwas unordentlich notiert habe. Natürlich lande ich im Menü und erfahre, wie ich Tickets kaufen und eine Tour buchen kann, dazu sämtliche Preise und Öffnungszeiten, aber ich drücke die Null und nach ein paar Minuten Love Me Tender habe ich tatsächlich einen echten Menschen an der Strippe.
»Ich glaube, ich habe ein Erinnerungsstück von Elvis entdeckt.«
Die Telefonistin in Graceland bleibt bemerkenswert unbeeindruckt. Der Fairness halber muss man sagen, dass sie wahrscheinlich ständig solche Anrufe bekommen. Von Leuten, die das genaue Abbild von Elvis’ Gesicht in einer Scheibe verbrannten Toasts sehen, von Leuten, die halluzinieren und glauben, der King hätte im Traum zu ihnen gesprochen. Aber als ich der Frau erzähle, dass meine Mutter von 76 bis 77 als Backgroundsängerin mit Elvis auf Tour war, klingt sie gleich ein wenig enthusiastischer und sagt, sie werde einen der Beglaubiger bitten, mich zurückzurufen.
Beglaubiger. Was für ein Begriff.
»Er kann mich nicht zurückrufen«, erkläre ich ihr und recke den Kopf, um einen Blick auf die Straße zu werfen. Dieser ganze Zirkus dauert länger, als ich dachte, und Leary wird jede Minute am Schuppen sein. »Ich habe kein Telefon.«
Mir ist bewusst, dass sich das seltsam anhört, da ich schließlich gerade telefoniere, und mich Glaubwürdigkeitspunkte kostet. Aber sie sagt: »Einen Moment bitte«, ein wenig lahm und desinteressiert, als würde sie nur mal kurz auf die Toilette gehen und mir dann erzählen, es täte ihr wirklich leid, aber sie könne keinen Beglaubiger finden.
Jetzt läuft Jailhouse Rock in der Warteschleife. Ich höre mir alle drei Refrains an, bevor sich eine neue Stimme meldet. Ein Mann. Älter vom Klang her.
»Was haben Sie?«, fragt er.
Was haben Sie. Nicht gerade eine warmherzige Begrüßung. Mag sein, dass die Dame mir nicht geglaubt hat, aber sie hatte wenigstens diesen Höflichkeitssingsang, der allen Menschen im Touristikgewerbe eigen zu sein scheint.
»Was ich habe, ist ein Stutz Blackhawk von 1973«, teile ich ihm mit, und dabei zittert meine Stimme, als müsste ich gleich losheulen. »Ein schwarzes Coupé. Und ich denke, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um den Wagen handelt, den Elvis Presley am Tag seines Todes gefahren hat.«
Das rüttelt ihn auf. Eine Minute lang herrscht Totenstille in der Leitung, und ich genieße sie, dann sagt er: »Und wer, sagten Sie noch mal, sind Sie?«
»Das habe ich noch nicht gesagt«, antworte ich. »Aber meine Mutter war Laura Berry, und sie tourte mit …«
»O mein Gott«, entfuhr es dem Mann. »Großer Gott. Wollen Sie mir etwa sagen, dass Sie Honeys Tochter sind?«
Honey? Ich weiß nicht, wovon dieser alte Trottel spricht, aber jetzt ist mir seine Aufmerksamkeit wenigstens sicher. »Ich habe den Wagen in einem Schuppen …«
»Und wie geht es unserer süßen Honey Bear?«, fragt er. »Ist sie da?«
Deine süße Honey Bear ist tot, denke ich, bringe es aber nicht über mich, die Worte laut auszusprechen. »Wer sind Sie denn?«, frage ich. »Mit wem spreche ich?«
Er sagt, sein Name sei Fred, und rasselt dann jede Menge Informationen herunter. Dass er damals die Tourneen geplant habe und wie er meine Mutter kennengelernt hat. Was für ein hübsches kleines Ding sie gewesen sei, so süß wie ihr Name. Dann lässt er sich darüber aus, dass der Wagen, falls der, von dem ich spreche, tatsächlich der echte McDeal sein sollte – genauso formuliert er es, der echte McDeal –, viel zu kostbar sei, um gefahren zu werden. Sollte es der echte McDeal sein, müsse er mit dem Abschleppwagen nach Memphis gebracht werden.
»Wissen Sie«, sagt Fred, »wenn das, was Sie haben, tatsächlich der Letzte der Blackhawks ist, dann war die einzige Person, die jemals am Steuer dieses speziellen Wagens saß, Mr Elvis Presley selbst. Und aus diesem Grund kann ich nicht zulassen, dass irgendein anderer ihn fährt.«
Ich raube ihm seine Illusionen nur ungern, aber das kann offensichtlich nicht stimmen. Elvis starb in Tennessee, und das Auto steht in South Carolina. Sofern dieser alte Kauz also nicht behauptet, ein Geist habe den Blackhawk von Memphis nach Beaufort gefahren – was ich einem Beglaubiger von Graceland durchaus zutrauen würde –, muss jemand anderer hinterm Steuer gesessen haben. Sehr wahrscheinlich meine Mutter, Laura Berry Ainsworth alias Honey Bear.
»Hat Elvis nicht jede Menge Autos weggegeben?«, frage ich, obwohl ich genau weiß, dass er das getan hat. Ich habe sämtliche Biografien gelesen. Ich habe Studien über diesen Mann angestellt. »Könnte es nicht vielleicht sein, dass er diesen Wagen einer seiner Backgroundsängerinnen geschenkt hat?«
»Nicht den Blackhawk«, erklärt Fred geradeheraus, aber mit unbestreitbarer Verunsicherung. »Das war sein Lieblingsauto.« Dann legt er los, dass ich ihm meine Adresse geben und ihm Fotos schicken müsse, und sollte sich herausstellen, dass es der echte McDeal sei, werde er jemanden mit dem Flugzeug herschicken, damit er ihn sich ansieht. Aber unter gar keinen Umständen dürfe ich den Motor anlassen. Er scheint sich immer noch einzubilden, der Blackhawk hätte sich von allein durch vier Bundesstaaten teleportiert, aber wenigstens hat er aufgehört, nach Honey zu fragen. Ich denke, er ist dahintergekommen, dass ihm die Antwort nicht gefallen würde.
Ich will ihm gerade meine Adresse durchgeben, da sehe ich Leary mit dem Abschleppwagen vorbeifahren. Also erkläre ich Fred, dass ich ihn zurückrufen müsse. Er wird sofort pampig und nennt mich »junge Dame« in jenem Ton, den alte Männer gern an den Tag legen, woraufhin ich aus heiterem Himmel Lust bekomme, mir Bohnen in die Nase zu stecken. Will sagen, ich werde trotzig. Es mag ja sein, dass Elvis seinen Blackhawk unmöglich weggegeben haben kann, aber noch unmöglicher ist es, dass meine Mutter ihn gestohlen hat. Sie sprach selten von Elvis. Erzählte nie von diesem Jahr, in dem sie getourt ist. Soweit ich weiß, behielt sie nur ein Erinnerungsstück. Ein Foto, das sie in einem dunkel verkleideten Raum zeigt, sie trägt einen blauen Satin-Jumpsuit und hat den Arm um ein anderes Mädchen gelegt. Eine Schwarze, die gleichermaßen entrückt wirkt, offensichtlich eine andere Backgroundsängerin. Als ich sie fragte, warum sie diesen einen Schnappschuss behalten, aber alle anderen weggeworfen habe, zeigte sie auf den Hintergrund. In einem Spiegel sieht man das Gesicht eines Mannes im Profil. Mit gesenktem Blick und ein wenig traurig, offenbar ohne sich bewusst zu sein, dass auch er auf dem Foto ist.
»Es ist das beste Foto, das ich von Elvis habe«, sagte Mama.
»Junge Dame, der Wagen gehört nach Graceland, jedenfalls wenn es der sein sollte, von dem Sie es behaupten«, sagt die Stimme am Telefon.
Aber Learys Abschleppwagen verschwindet nun aus meinem Blickfeld, und ich lege auf, froh, dass es ein Münztelefon ist, das bis in alle Ewigkeit klingeln wird, ohne dass es jemand hört, falls Fred zurückruft.
Scheiß auf die Beglaubiger. Wenn dieser Wagen nach Graceland gehört, werde ich diejenige sein, die ihn dorthin bringt.
»O Mann, das ist ja ’n Ding«, staunt Leary.
»Ganz genau. Das hätte ich nicht besser sagen können.«
»Sieh nur, wie riesig die Kühlerhaube ist.«
»Ich weiß. Auf die könnte sich ein Mädchen legen und darauf sterben.«
Leary steckt seinen Kopf durch die Wagentür, die ich offen gelassen habe, und blickt sich um. »Aber drinnen ist es ganz schön eng, was? Auf diesem kleinen Notsitz hätte kaum ein Hund Platz.«
»Sieh dir mal das Radio an«, fordere ich ihn auf. »AM/FM mit einem Acht-Spur-Player. Ich denke, die Verkleidung ist aus vierundzwanzigkarätigem Gold. Deshalb ist sie auch nicht angelaufen. Und jetzt hör dir das an.« Ich drücke auf die Hupe, und schmetternd ertönt der Refrain von Never on a Sunday, so laut, dass die schmutzigen Fenster des Schuppens wackeln.
Leary geht in die Hocke. »Heilige Scheiße.«
Ich mag Leary sehr. Wir waren zusammen auf der Schule, und jedes Mädchen braucht einen Mechanikerfreund aus Highschooltagen. Wann immer ich im Laufe der Jahre in Verlegenheit geriet, war er zur Stelle und half mir, und den Toyota hält er nun schon seit einem Jahrzehnt mit etwas Motoröl und einem Gebet am Laufen. Wir hatten nie was miteinander. Vielleicht hätte er es gewollt. Vielleicht auch nicht.
»Du darfst ihn nicht anlassen.«
»Warum erklärt mir jeder, dass ich ihn nicht anlassen darf?«
Er erhebt sich und geht langsam am Auto entlang, schüttelt dabei den Kopf. »Ich weiß ja nicht, wer dir sonst noch rät, ihn nicht zu starten, aber ich sage es dir, weil das Benzin, wenn er hier wirklich schon so lange steht, wie es aussieht, sich inzwischen zersetzt hat. Und wenn du den Vergaser damit flutest, zerfrisst es ihn, und dann sitzen wir wirklich in der Scheiße.«
Er klingt, als wäre er sich seiner Sache ganz sicher. Das ist eine Seite von Leary, die mir bisher noch nicht aufgefallen ist.
»Und was machen wir jetzt?«
Er zieht eine Braue hoch. »Wir?«
»Was musst du machen? Um ihn wieder zum Laufen zu bringen, meine ich.«
»Das Benzin absaugen, die Zündkerzen erneuern, die Dichtungsringe abschmieren. Wer weiß, vielleicht sind die anderen Flüssigkeitsstände ja noch in Ordnung, die zersetzen sich nicht so leicht wie Benzin. Die Reifen sind platt wie Pfannkuchen, das sieht jeder. Wo kommt dieser Wagen bloß her?«
»Ich weiß auch nicht mehr als du. Ich habe ihn heute erst entdeckt.«
»Und du hast nicht gewusst, dass er hier steht? War das der Wagen von deinem Daddy?«
»Kannst du dir vorstellen, wie Bradley in so einem Auto die Bay Street runterfährt?«
»Nicht wirklich.«
»Dann muss er wohl meiner Mama gehört haben.«
Leary kommt unter der Motorhaube hervor. »Und ich glaube, dass das völliger Blödsinn ist, Cory Beth Ainsworth. Deine Mama war eine Pfarrerstochter.«
»Das mag schon sein, aber das war nicht alles, was sie war.«
»Sie hat zwanzig Jahre lang den Kirchenchor geleitet«, ergänzt Leary, als wäre die Sache damit erledigt. »Und sie hat mich drei Jahre in Folge für das Krippenspiel eingesetzt. Im ersten Jahr als Schafhirten, dann als Weisen aus dem Morgenland und am Ende dann als Josef. So läuft das nämlich.«
Widerspruch wäre zwecklos. Ich bezweifle, dass auch nur eine Handvoll Leute in der Stadt wissen, wo meine Mama in ihrem verlorenen Jahr war. Es ging das Gerücht von einem Bibelcollege in Georgia oder dass sie für eine Gospelschallplatte in Nashville Background gesungen hätte, aber das ist alles so lange her, dass man wahrscheinlich keinen mehr danach fragen könnte. Leary sieht mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle, aber ich brauche ihn viel zu sehr und kann es mir nicht erlauben, ihn zu verärgern.
»Hast du denn das ganze Zeug in deinem Abschleppwagen?«, frage ich ihn. »Oder wenigstens alles Nötige, um ihn irgendwohin zu bringen und ihn anzulassen?«
Leary stößt einen Seufzer aus. »Diese Reifen dürften wahrscheinlich spröde von der Witterung sein, und wenn dem so ist, dann riskierst du, dass sie während der Fahrt platzen. Das darf ich keinesfalls zulassen, also brauchst du mich gar nicht so herausfordernd anzusehen. Und auf gar keinen Fall habe ich vier Reifen auf meinem Laster. Ich wüsste nicht mal, woher man Reifen kriegt, die zu einem solchen Auto passen.«
»Du sagst, sie könnten von der Witterung spröde sein? Könnten?«
Er schiebt sich die Baseballkappe aus der Stirn und mustert mich, als würde er direkt in meinen Kopf sehen und verfolgen, wie die Rädchen dort ineinandergreifen. »Vielleicht haben sie auch einfach nur im Laufe der Jahre die Luft verloren. Die entweicht. Je länger etwas steht, ohne bewegt zu werden, umso schlaffer und weicher wird es, weißt du.«
Ich weiß. »Dann pump sie auf«, sage ich. »Ich riskiere es.«
Grummelnd und das Schlimmste vorhersagend, klettert Leary den Abhang hoch zu seinem Laster und holt seine Werkzeuge. Ich ziehe das Fischermesser aus der Uferböschung und folge ihm nachdenklich. Na ja, denken kann man das nicht gerade nennen. Ich bin ein wenig benommen. Die Frau auf dem Foto, das ich vor langer Zeit entdeckt habe … sie stand halb zur Seite gewandt, die Hand in die Hüfte gestemmt und die Knie irgendwie leicht verdreht. Es war die Pose eines sexy Girls, und die andere Frau stand genauso da, nur dass sie sich zur linken und nicht zur rechten Seite drehte, wodurch der Eindruck entstand, als sei die eine das Spiegelbild der anderen, nur dass eine von ihnen schwarz, die andere weiß war. Die Frau auf diesem Foto sah auf keinen Fall schwanger aus. Sie sah auch nicht so aus, als wäre sie entschlossen, jemandes Mutter oder Chorleiterin zu werden. Sie sah jung aus und hübsch und auch ein wenig anzüglich unter diesem vielen Make-up, die Augen weit aufgerissen zu jenem erschrockenen Blick im Cartoon-Stil der Siebziger. Sie entsprach absolut der Art von Mädchen, die Männer Honey nennen.
Leary kramt noch immer in seinem Werkzeug und flucht leise vor sich hin.
»Möchtest du ein Bier?«, frage ich ihn.
»Hast du eins?«
»Ich kann uns welches holen.«
»Das heißt vermutlich, du hast nicht vor, mich zu bezahlen.«
»Ich werde dich bezahlen, wenigstens die Materialkosten.« Leary nimmt seine Werkzeugkiste und läuft an mir vorbei. Das Grundstück ist groß, weit wie die Prärie, aber er nimmt die Kurve so eng, dass er mich mit seiner Schulter anrempelt, als wollte er etwas in mir anstoßen. Einen vernünftigen Denkprozess wahrscheinlich.
»Dann sorg dafür, dass es ein Sixpack wird«, meint er.
Ich halte viermal an. Zuerst gehe ich zur Bank und löse den Scheck ein, den ich gestern Abend von Gerry bekommen habe. Vierhundertzwölf Dollar, und hätte ich nur einen Funken Anstand in mir, würde ich Leary sofort bei meiner Rückkehr die ganze Summe aushändigen. Aber ich brauche Geld für unterwegs und verteile den Betrag deshalb auf zwei Umschläge, einen mit Learys und einen mit meinem Namen darauf. Dann fahre ich zu dem ordentlichen kleinen Reihenhaus, in dem ich aufgewachsen bin, und hole das Foto von Mama mit ihrer entrückt aussehenden Freundin und Elvis. Ich weiß genau, wo sie es aufbewahrt hat: im Schrank neben dem Fernseher, in dem alle Familienfotoalben stehen, obwohl dieses Foto nicht wie die anderen eingeordnet, kategorisiert und eingeklebt war. Es flog immer lose herum, und ich drehe es um und sehe, dass meine Mutter ein einziges Wort auf die Rückseite geschrieben hat: Wir.
Wir?
Nun, das ist nicht gerade hilfreich. Und sieht meiner Mutter so gar nicht ähnlich. Wenn man irgendeins der anderen Fotos aus einem Album ziehen würde, fände man auf der Rückseite eine ganze Enzyklopädie von Fakten. Wer auf dem Foto ist, an welchem Tag es aufgenommen wurde, wohin wir unterwegs waren oder woher wir kamen, und manchmal sogar einen kleinen Kommentar wie »Lustiger Tag!« oder »Mein großes Mädchen«. Hundert Fotos von mir und Bradley und Mama, und bis zu diesem Morgen hätte ich geschworen, dass das einzige Wir, das ihr alles bedeutete, unsere Familie war. Aber jetzt sehe ich, dass ich damit und vermutlich auch noch mit vielem anderen falschlag. Ich nehme das Foto mit und noch eine Schachtel Eiweißriegel aus der Speisekammer und eine fast volle Flasche Kopfschmerztabletten. Bradley wird sie nicht vermissen. Mama und ich waren die Einzigen, die hier jemals Kopfschmerzen bekamen.
Dann flitze ich weiter zu meinem Trailer, wo ich ein paar Kleidungsstücke und meine Gitarre einpacke, und mein letzter Halt ist die Tankstelle, wo ich Learys Sixpack kaufe. Ich entscheide mich für Stella, da er wirklich ein Meister seines Fachs ist. Der Jugendliche hinter der Theke sieht mich mit verächtlichem Blick an, als wäre er nicht im Geringsten überrascht, dass dieselbe Frau, die sich vor einer Stunde den Streich erlaubt hat, Graceland anzurufen, jetzt mitten am Tag zu trinken anfängt. Er gibt mir das Wechselgeld in lauter Ein-Dollarscheinen, obwohl ich elf Dollar zurückbekomme. Ich finde das aus unerklärlichen Gründen beleidigend.
Scheiß drauf. Er kann mir nichts. Keiner in dieser Stadt kann mir was.
»Also ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe«, berichtet Leary, als ich beim Schuppen ankomme. »Alle vier Reifen haben sich gut aufpumpen lassen. Ich denke, du kannst problemlos damit fahren, solange du nicht allzu schnell fährst. Witterungsmängel zeigen sich nicht immer auf Anhieb, und du möchtest schließlich nicht, dass dir auf der Interstate 95 ein Reifen platzt.«
Ich werfe einen Blick in den Wagen. »Du hast aber nicht versucht, hier drin sauber zu machen, oder?«
»Ich habe was von dem Zeug in eine Tüte gepackt. Mann Mädchen, auf einer von den Servietten war Blut.«
»Blut? Das werde ich brauchen. Ich werde sogar das alles brauchen.«
Er wirft mir einen dieser Leary-Blicke zu, fragt aber nicht weiter nach. »Die restlichen Flüssigkeitsstände im Wagen waren noch ziemlich gut. Selbst die Wischerblätter habe ich überprüft. Die haben das Ding eingepackt wie ein rohes Ei. Wenn ein Auto sonst so lange steht, bilden sich im Motor schon mal Schmierrückstände oder so. Aber ich muss sagen, er sieht … ziemlich gut aus. Besser, als er aussehen dürfte.«
»Also kann ich ihn anwerfen?«
Er nickt. »Er wird röhren. Im Ernst, diese alten Muscle-Cars sind wahnsinnig laut. Dieses Baby hier hat einen großen 425-PS-Motor, und damals gab’s noch kein Abgaskontrollsystem oder was in der Art.«
Das bringt mich zum Nachdenken. »Darf ich den Wagen dann überhaupt fahren?«
»Durch die Inspektion kommt der nicht mehr.« Er sieht mich aus schmalen Augen forschend an, aber Leary gehört zu den Leuten, die einen aus zusammengekniffenen Augen ansehen, auch wenn es gar keinen Grund dafür gibt. Wahrscheinlich blinzelt er genauso in geschlossenen Räumen oder im Dunkeln. Was sexy sein könnte, wenn ein Mädchen auf so was steht. »Sag mir die Wahrheit«, fordert er mich auf. »Was genau hast du mit diesem Wagen vor?«
»Wollen wir nicht ein Bier trinken?«
»Na gut«, erwidert er, und wir setzen uns ans Ufer. Er kippt das erste Bier in zwei, drei Schlucken hinunter und greift dann zu seinem zweiten. Es scheint ihn zu beruhigen. Hier draußen am Wasser ist es wirklich schön, und ich weiß selbst nicht, warum ich kaum hierherkomme. Ich lasse mir Zeit mit meinem Bier, denn mir ist klar geworden, dass ich noch heute Abend aufbrechen muss, bevor mich der Mut verlässt.
»Weißt du, Cory Beth«, sagt Leary und lässt sich dann auf den Rücken fallen und blickt zum Himmel hinauf. »Während du weg warst, habe ich den Wagen gegoogelt, und die Informationen liefen alle aufs Gleiche hinaus. Offenbar gab es nur eine Handvoll von diesen Blackhawks in den Staaten, und ein Mann sammelte mehr davon als alle anderen, ein Mann namens …«
Ich lege mich auch hin. »Du musst mir versprechen, Leary …«
»Also, ich stelle dir keine Fragen, und ich mache dir auch keine Vorschriften«, erklärt er und dreht sich dann herum, um das zweite Bier zu leeren, bevor er nach dem dritten greift. »Ich sage nur, dass ich eine Scheißangst habe, wenn ich mir vorstelle, dass du versuchst, mit diesem Wagen nach Tennessee zu fahren. Also versprich mir, dass du das nicht tun wirst, okay?«
»Ich werde mit diesem Wagen nicht nach Tennessee fahren«, sage ich. »Herrgott, nun hab doch ein wenig Vertrauen in mich. Gerry rechnet damit, dass ich in einer Stunde bei ihm singe.«
»Denn das wäre wirklich ganz dumm von dir, Cory Beth«, mahnt Leary. »Die Straße da draußen kann dir nichts erzählen, was du nicht bereits weißt.«
Der Motor röhrt in der Tat recht zufriedenstellend, und als ich auf die unbefestigte Straße einbiege, fühlt es sich an, als würde die ganze Welt vibrieren. Ich lenke die lange schwarze Motorhaube nach Westen, der untergehenden Sonne entgegen. Leary hat für mich nachgesehen. Von Beaufort nach Memphis sind es 1075 Kilometer, und Google schätzt, dass man zehn Stunden und fünfzehn Minuten für diese Strecke braucht. Aber wenn man einen Wagen mit schlechten Reifen fährt, der es durch keine Inspektion mehr schaffen würde, und sich auf Nebenstraßen vorwärtsbewegt, braucht man vermutlich doppelt so lang. Nach dem Biereinkauf habe ich noch hundertneunundneunzig Dollar, eine Packung Eiweißriegel und eine einzige Flasche Stella Artois, die mir Leary aufgedrängt hat, und in weniger als einer Stunde erwartet Gerry mich bei Bruiser’s. Aber heute Abend muss jemand anders seinen Jimmy Buffet und seine Beach Boys singen. Da draußen schwirrt bestimmt eine ganze Schar ihrer unehelichen Töchter herum. Mädchen mit winzigen Füßen, die von einem Papa träumen und schön singen können, und wir tingeln alle auf der Suche nach Arbeit die Wasserstraße entlang.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.