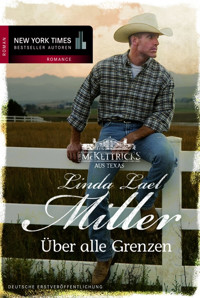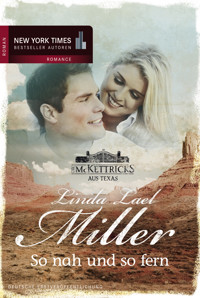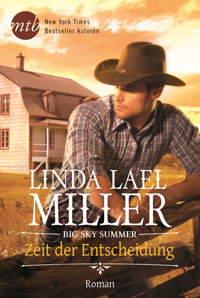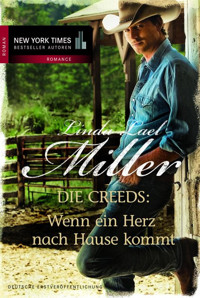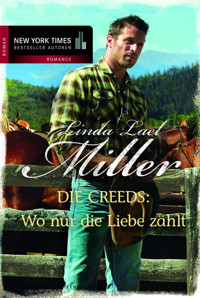6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Orphan-Train-Trilogie - Historical Romance
- Sprache: Deutsch
Aus Liebe bricht sie das Gesetz ...
Wyoming, 1878. Die Lehrerin Caroline Chalmers verhält sich ganz und gar ungebührlich: Sie marschiert am helllichtem Tag schnurstracks in den örtlichen Saloon, um den zwielichtigen Guthrie Hayes um Hilfe zu bitten. Er soll ihren Verlobten aus dem Gefängnis befreien und damit vor dem Galgen retten. Denn Caroline ist von dessen Unschuld überzeugt. Zu spät erkennt sie, wie gefährlich ihr Anliegen wirklich ist - schon bald verliert sich Caroline erst in Guthries Augen und dann in seinen Armen. Und sie fragt sich, wer der eigentliche Schurke ist ...
Weitere historische Liebesroman-Reihen von Linda Lael Miller bei beHEARTBEAT:
Die McKettrick-Cowboys-Trilogie. Die Corbin-Saga. Springwater - Im Westen wartet die Liebe. Die McKenna-Brüder.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Die Orphan-Train-Trilogie
Band 1: Die Chalmers-Schwestern: Lily und der Major
Band 2: Die Chalmers-Schwestern: Emma und der Rebell
Die McKenna-Brüder
Band 1: Wie der Glanz des silbernen Mondes
Band 2: Wie das helle Feuer der Sterne
Die McKettrick-Saga
Band 1: Frei wie der Wind
Band 2: Weit wie der Himmel
Band 3: Wild wie ein Mustang
Die Corbin-Saga
Band 1: Paradies der Liebe
Band 2: Zauber der Herzen
Band 3: Lächeln des Glücks
Band 4: Weg der Hoffnung
Springwater – Im Westen wartet die Liebe
Band 1: Wo das Glück dich erwählt
Band 2: Wo Träume dich verführen
Band 3: Wo Küsse dich bedecken
Band 4: Wo Hoffnung dich wärmt
Über dieses Buch
Aus Liebe bricht sie das Gesetz …
Wyoming, 1878. Die Lehrerin Caroline Chalmers verhält sich ganz und gar ungebührlich: Sie marschiert am helllichtem Tag schnurstracks in den örtlichen Saloon, um den zwielichtigen Guthrie Hayes um Hilfe zu bitten. Er soll ihren Verlobten aus dem Gefängnis befreien und damit vor dem Galgen retten. Denn Caroline ist von dessen Unschuld überzeugt. Zu spät erkennt sie, wie gefährlich ihr Anliegen wirklich ist – schon bald verliert sich Caroline erst in Guthries Augen und dann in seinen Armen. Und sie fragt sich, wer der eigentliche Schurke ist …
Über die Autorin
Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/.
Linda Lael Miller
Die Chalmers-Schwestern: Caroline und der Bandit
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Braun
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1992 by Linda Lael Miller
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Caroline and the Raider«
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1992/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Katharina Woicke
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © Aleta Rafton
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7902-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Lincoln, Nebraska9. Dezember 1865
Der Zug stieß einen schrillen Pfiff aus. Caroline, die spürte, wie ihre sechsjährige Schwester Lily auf dem harten, schmutzigen Sitz neben ihr erschauerte, legte schützend einen Arm um die Schultern des kleinen Mädchens.
Lilys braune Augen waren groß und furchtsam. Emmy, die schon sieben war, saß am Fenster und betrachtete die schneebedeckten Häuser der kleinen Präriestadt, der sie sich näherten. Ihr Haar schimmerte fast kupfern im schwachen Licht der Wintersonne; wie Lilys Haar war es strähnig und zerzaust.
Der Gedanke, dass sie nichts tun konnte, um die Erscheinung ihrer Schwestern und ihre eigene ein wenig zu verbessern, ließ Caroline, die Älteste, fast verzweifeln. Sie besaßen weder eine Haarbürste noch ein Kleid zum Wechseln – die abgetragenen Schuhe, Mäntel und schlichten Kattunkleidchen waren ihnen von den Nonnen im St. Mary’s in Chicago gegeben worden.
Der Zugbegleiter, ein großer, korpulenter Mann ohne die geringste Spur von Güte im Gesicht, kam durch den schmalen Gang. »Das ist Lincoln, Nebraska«, brummte er. »Hier gibt es Farmer und Ladeninhaber und Schmiede.« Vor Caroline, Lily und Emmy blieb er stehen und musterte sie abschätzend. »Ich nehme an, dass hier nur Jungen gebraucht werden«, schloss er.
Caroline zog Lily noch fester an sich und erwiderte furchtlos den Blick des Mannes. Seine Nase war groß und rund wie eine Kartoffel, die Haut von geplatzten roten Äderchen durchzogen. »Mädchen sind genauso gut wie Jungen«, sagte sie mit dem ganzen Mut, den sie mit ihren acht Jahren aufbringen konnte. »Und sie machen viel weniger Arbeit.«
»Steigt aus und stellt euch mit den anderen auf den Bahnsteig«, befahl der große Mann, während die ersten Jungen bereits auf die Tür zustürmten. Sie alle waren unerwünschte Kinder oder Waisen, mit Nummernschildchen an ihren Kleidern und der Hoffnung, von einer der Familien, die am Bahnhof warteten, adoptiert zu werden.
Der Zug kam ratternd zum Halten, eine Wolke dichten Rauchs hüllte die Fenster ein.
»Es wird alles gut«, behauptete Caroline und schaute aufmunternd ihre beiden kleinen Schwestern an, doch sie wusste, dass es eine Lüge war. Aber was hätte sie ihren Schwestern sonst sagen sollen? Sie war die Älteste; es war ihre Aufgabe, sich um ihre Schwestern zu kümmern.
Dicke Schneeflocken fingen sich in Lilys und Emmas zerzausten Haaren, als sie den Zug verließen und auf den Bahnsteig traten.
Caroline, die dicht hinter ihren Schwestern stehenblieb, umfasste aufmunternd ihre Schultern. Seit Mama sie in Chicago in den Waisenzug nach Westen gesetzt hatte, flehte Caroline ihren Herrgott an, dafür zu sorgen, dass sie alle drei zusammenblieben, aber in ihrem Herzen wusste sie, dass Er ihre Gebete nicht erhören würde.
Was das betraf, konnte Caroline sich nicht entsinnen, dass Gott schon einmal eines ihrer Gebete erhört hatte. Manchmal fragte sie sich, warum sie sich überhaupt noch an ihn wandte.
Ein großer Mann mit schwarzem Bart und einem schmuddeligen Wollmantel betrat den Bahnsteig; seine dunklen Augen verengten sich, als er das Grüppchen Waisenkinder betrachtete.
Caroline seufzte vor Erleichterung, als er zwei Jungen auswählte und ging. Vielleicht blieb ihnen ja doch noch etwas mehr Zeit zusammen, bevor sie getrennt wurden. Sie schloss für einen Moment die Augen und kreuzte ihre kalten Finger, die auf Lilys schmalen Schultern lagen.
Eine dicke Frau in einem abgetragenen Kattunkleid und einem wollenen Umhang stapfte schnaufend die Stufen zur Plattform hinauf. Ihre Wangen waren rund und rot, aber in ihrem Blick lag keine Wärme.
»Ich nehme dich«, sagte sie, auf Caroline zeigend.
Caroline schluckte. Nein, flehte sie stumm, ich kann Lily und Emma nicht verlassen. Sie versuchte es ein letztes Mal. Bitte, lieber Gott, sie sind doch noch so klein, und sie brauchen mich so sehr!
In Erinnerung an die Manieren, die ihre Großmutter sie gelehrt hatte, bevor sie vor einem Jahr gestorben war, knickste sie vor der dicken Frau. »Madam, bitte«, sagte sie flehend, »das sind meine Schwestern Emma und Lily, beide gute und starke Mädchen, groß genug, um zu kochen und zu putzen ...«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Nur du«, sagte sie hart.
Jetzt konnte Caroline die Tränen nicht mehr zurückhalten; sie rollten ungehindert über ihre kalten Wangen. Sie hatte gehofft, als Letzte ausgesucht zu werden, wenn sie schon von ihren Schwestern getrennt werden sollte, weil sie die Älteste war und sich bestimmt am besten daran erinnern würde, wo Lily und Emma den Zug verlassen hatten.
Aber Gott schien nicht einmal zu diesem kleinen Zugeständnis bereit.
»Vergesst nicht, was ich euch gesagt habe«, mahnte sie ihre Schwestern nach einer letzten, tränenreichen Umarmung, hockte sich vor Lily hin und nahm deren kleinen Hände. »Und wenn ihr euch einsam fühlt, dann singt das Lied, das Großmutter uns beigebracht hat. Das wird uns dann zusammenfügen.« Sie küsste Lily zärtlich auf die Wange. »Irgendwann finde ich euch wieder«, fügte sie hinzu. »Ganz bestimmt. Ich verspreche es euch.« Dann richtete sie sich auf und wandte sich an Emma. »Sei stark«, bat sie mit erstickter Stimme. »Und vergiss nichts von allem, was wir besprochen haben – bitte, Emma!«
Emma nickte. Tränen rannen über ihre von der eisigen Kälte geröteten Wangen. Ihre Lippen formten die Worte ›Auf Wiedersehen‹, aber kein Ton kam aus ihrer Kehle, und Caroline verstand.
Der Zugbegleiter scheuchte die verbliebenen Kinder in den Waggon zurück, und Caroline folgte ihrer Adoptivmutter mit hängenden Schultern zur Treppe. Sie wagte es nicht, sich noch einmal umzusehen.
»Wenn du mich fragst«, sagte die fremde Frau, »fordern Miss Ethel und Miss Phoebe das Schicksal heraus, indem sie ein fremdes Kind bei sich aufnehmen, nur weil sie Gesellschaft haben wollen ...«
Caroline achtete nicht auf das Gerede der Frau; ihre Trauer war zu tief, ihr Schmerz zu frisch. Erst als der Zug donnernd aus dem Bahnhof fuhr, drehte sie sich noch einmal um – das eiserne Ungeheuer entführte die beiden Menschen, die sie am meisten liebte auf dieser Welt.
Die Frau packte sie unsanft an der Schulter und zog sie mit. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für diese albernen Geschichten«, fuhr sie gereizt fort. »Ich finde wirklich, Miss Phoebe hätte auch selbst kommen können, anstatt mich zu schicken.«
Der Schnee war tief, matschig und mit Pferdemist durchsetzt, und es fiel Caroline schwer, den großen Schritten der Frau zu folgen. Außerdem hatte sie keine Eile, vorwärtszukommen; in Gedanken war sie bei dem Zug, der nach Westen ratterte, und am liebsten wäre sie ihm nachgelaufen.
»Wie heißt du überhaupt?«, wollte die Frau wissen, als sie an einem großen Kolonialwarenladen vorbeikamen und auf ein Hotel zugingen.
»Caroline Chalmers«, antwortete Caroline würdevoll, strich ihren schäbigen alten Mantel glatt und dann ihr langes, schwarzes Haar zurück, das nass vom Schnee war. »Und Sie?«
»Mrs. Artemus T. Phillips«, erwiderte die Frau und machte sich zum ersten Mal die Mühe, Caroline genauer anzusehen. »Du liebe Güte, du bist aber dünn!«, sagte sie kopfschüttelnd. »Wahrscheinlich überstehst du keine Woche mehr.«
Caroline war fest entschlossen, so lange auszuhalten, bis sie Emma und Lily gefunden hatte. Sie hob trotzig ihr Kinn. »Oh doch, das werde ich, darauf können Sie sich verlassen!«
»Sei bloß nicht so schnippisch«, warnte Mrs. Artemus T. Phillips und zerrte Caroline an ihrem vor Kälte erstarrten Ohr um eine Häuserecke. »Ich muss schon sagen, ihr armen Leute begreift einfach nicht, wann ihr dankbar zu sein habt ...«
Caroline zappelte und versuchte, sich Mrs. Phillips Griff zu entziehen, aber die Frau war stark und hielt sie unbarmherzig fest.
Vor einem Haus, das von einem schmiedeeisernen Zaun umgeben war, hielt sie an und stieß das Tor auf. »Hier sind wir schon«, sagte sie in einem Ton, der ihre Erleichterung verriet.
Caroline hob den Kopf, um das Haus anzusehen. Es war ein zweistöckiges Gebäude mit grünen Fensterläden und einem Kamin, aus dem Rauch kräuselte – ein Heim, wie sie es sich immer erträumt hatte.
Durch die ovale Glasscheibe in der Tür glaubte Caroline ein Gesicht zu sehen, und einen Moment später wurde die Tür von einer Frau geöffnet, die braune Haare hatte und ein blassrosa Musselinkleid trug. Um die Schultern hatte sie ein Umhängetuch gelegt, und an ihrem Halsausschnitt steckte eine hübsche Kameebrosche.
Die Frau lächelte Caroline an, und das Mädchen erwiderte das Lächeln, trotz allem.
»Das ist also unser Mädchen«, sagte die Frau, die weder schön noch hässlich war, weder alt noch jung. »Komm herein, Kind.«
Caroline wurde in ein Haus geführt, in dem es angenehm nach Zimt und Lavendel roch.
Eine andere Frau, die das Spiegelbild der ersten hätte sein können – abgesehen davon, dass ihr Kleid blau war – kam die Treppe herunter. »Ist das das Kind?«, fragte sie. Sie musste husten und hielt sich ein spitzenbesetztes Taschentuch vor den Mund. Dann fügte sie, an Mrs. Phillips gewandt, hinzu: »Du hast eine gute Wahl getroffen, Ophelia. Sie ist entzückend.«
Caroline schluckte, trat zurück und schaute die beiden Schwestern aus großen Augen an.
»Ich muss sagen, dass sie ziemlich eigensinnig ist«, beschwerte Ophelia Phillips sich, während sie den Schnee von ihrem dunklen Umhang schüttelte. Trotz ihres abfälligen Geredes über die Armen machte sie selbst keineswegs einen wohlhabenden Eindruck.
»So sollte es auch sein«, entgegnete die Frau, die ihnen die Tür geöffnet hatte, und beugte sich lächelnd zu Caroline vor. »Ich bin Phoebe Maitland«, stellte sie sich vor und deutete dann auf die Frau in dem blauen Kleid. »Und das ist meine Schwester Ethel.«
Caroline fand die beiden Damen sympathisch, und trotz des Abschiedsschmerzes, der ihr das Herz zerriss, war sie froh, dass sie bei ihnen bleiben sollte statt bei der furchteinflößenden Mrs. Phillips. Sie knickste höflich. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Phoebe ... Miss Ethel.«
Die Schwestern lächelten entzückt.
Mrs. Philipps räusperte sich vernehmlich. »Jetzt, wo ich meine Christenpflicht getan habe«, sagte sie, »kann ich ja wohl wieder meinen eigenen Angelegenheiten nachgehen.«
Miss Phoebe dankte Mrs. Phillips herzlich und begleitete sie zur Tür.
»Ich dachte schon, sie würde mich adoptieren«, gestand Caroline Miss Ethel flüsternd.
Miss Ethel lachte. »Nein, mein Kind, beruhige dich. Ophelia ist unsere Nachbarin, und Phoebe hat sie zum Zug geschickt, weil ich mich nicht wohlfühlte und sie mich nicht allein lassen wollte.«
Caroline schaute sich in dem großen, elegant möblierten Raum um. Und das war ganz offensichtlich nur die Eingangshalle! »Ich war noch nie in einem so großen Haus«, gestand sie Miss Ethel leise. »Werde ich es saubermachen müssen?«
In diesem Augenblick kam Miss Phoebe zurück, zitternd vom eisigen Wind, der draußen wehte. »Ophelia fand wieder einmal kein Ende«, erklärte sie, als sie die Eingangstür hinter sich schloss.
»Caroline glaubt, sie müsse unser Haus sauber halten«, berichtete Ethel, und auf ihrer Miene malte sich Bestürzung ab.
Miss Phoebe kam zu dem Mädchen und legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter. »Du liebe Güte, nein«, versicherte sie mit einem gütigen Lächeln. »Du sollst meiner Schwester und mir Gesellschaft leisten, wenn wir zu unserem großen Abenteuer in den Westen reisen.«
Caroline machte große Augen. Vielleicht bestand ja doch noch Hoffnung, dass sie Lily und Emma wiedertraf. »In den Westen?«
»Ja, wir fahren nach Wyoming«, bestätigte Miss Ethel glücklich. »Wir wollen dort ein ganz neues Leben beginnen.«
Caroline hatte noch nie etwas von Wyoming gehört, aber sie vermutete, dass es irgendwo im Westen liegen musste, in jenem weiten, geheimnisvollen Land, das Lily und Emma verschluckt hatte. Plötzlich war sie begierig aufzubrechen.
Miss Phoebe durchquerte mit raschelnden Taftröcken die weite Halle. »Komm Kind«, sagte sie entschieden, »du musst doch Hunger haben, und außerdem siehst du schrecklich aus. Meine Schwester und ich werden zusehen, dass du etwas zu essen bekommst, und dann überlegen wir uns, was wir mit diesen hässlichen Kleidern machen.«
Trotz der traurigen Umstände, in denen sie sich befand, hatte Caroline sich ihren Stolz bewahrt. Ihre Kleider mochten zwar abgetragen sein, aber sie gehörten ihr, und hässlich waren sie nicht, höchstens ein bisschen schäbig. »Ich brauche nichts«, entgegnete sie rasch, obwohl sie Miss Phoebe bereitwillig folgte.
Schließlich betraten sie eine Küche, die größer war, als Caroline sich eine Küche je vorgestellt hätte. Miss Ethel bot ihr einen Platz an dem riesigen Eichentisch an, und Caroline setzte sich.
»Natürlich brauchst du neue Kleider«, sagte Miss Ethel sanft, als sie zu Caroline an den Tisch kam. »Wie schön es sein wird, für dich zu nähen!«
»Du bist jetzt unser Kind«, meinte Miss Phoebe resolut und nahm einen Teller von der Wärmeplatte über dem Ofen. »Meine Schwester und ich werden von jetzt an für dich sorgen.«
Obwohl Caroline sich vorgenommen hatte, nichts zu essen, stürzte sie sich voller Heißhunger auf die Mahlzeit, die Miss Phoebe ihr vorsetzte, begierig, den quälenden Schmerz in ihrem Magen zu vertreiben.
»Armes Kind«, meinte Miss Phoebe später mitleidig, als sie duftenden Tee aus einer Porzellankanne einschenkte. »Sag uns doch, wie es dazu kam, dass du so ganz alleine auf diesem Waisenzug gereist bist?«
Caroline betrachtete düster die Reste der Fleischpastete, des cremigen Kartoffelpürees und der gebutterten Maiskolben. Auch Lily und Emma waren hungrig, aber alles, was sie heute bekommen würden, waren ein Stück Brot und ein verschrumpelter Apfel. Caroline schämte sich plötzlich, gegessen zu haben, während ihre Schwestern Hunger litten.
»Caroline?«, drängte Miss Ethel sanft.
Das Mädchen atmete tief ein und straffte die Schultern. »Ich war nicht allein«, sagte sie, den Tränen wieder nahe. »Meine Schwestern waren bei mir – Lily und Emma.«
Die Maitlandschwestern wechselten einen betrübten Blick.
»Mein Gott!«, flüsterte Miss Ethel. »Wir haben sie von ihren Liebsten getrennt, Phoebe. Sie ist wie ein kleiner Vogel, den man aus dem Nest gerissen hat.«
Miss Phoebe tätschelte Carolines Hand. »Von jetzt an werden wir deine Familie sein, Caroline«, sagte sie tröstend. »Wir reisen nach Westen, wir drei, und richten uns dort ein wunderschönes Zuhause ein.«
Miss Ethel seufzte philosophisch. »Papa nahm uns das Versprechen ab, uns dort um seine Minenanteile zu kümmern«, erzählte sie, hielt inne und lächelte Caroline zärtlich an. »Und da Phoebe gleich nach unserer Ankunft Mr. Gunderson heiraten wird, wäre ich sehr einsam gewesen ohne dich, Caroline.«
Nach dem Tee musste Caroline sich im Salon auf einen Stuhl stellen, und es wurde Maß für neue Kleider genommen. Obwohl sie noch sehr um Lily und Emma trauerte, begann Caroline sich doch schon über ihr eigenes Glück zu freuen.
Optimistisch zu sein fiel ihr nicht schwer. Bald würde sie mit den freundlichen Schwestern, die von jetzt an ihre Familie darstellten, nach Westen reisen und dort irgendwann Lily und Emma wiederfinden. Und dann waren sie alle wieder vereint.
1
Bolton, Wyoming
15. April 1878
Er war der anrüchigst aussehende Mann, den Caroline je gesehen hatte, und doch hing jetzt alles von ihm ab.
Blinzelnd nahm sie ein sauber gefaltetes Tuch aus ihrer Manteltasche und wischte ein Stückchen der schmutzigen Fensterscheibe des Salons sauber, um besser sehen zu können. Aber wenn sich dadurch überhaupt etwas geändert hatte, wirkte Mr. Guthrie Hayes jetzt höchstens noch weniger anziehend als zuvor. Und ganz sicher nicht wie der große Held, als der ihn ihr einer ihrer Schüler mit so viel Begeisterung beschrieben hatte.
Der kräftige Mann, nicht viel größer als Caroline selbst, saß an einem Ecktisch und war in eine Partie Poker vertieft. Zu seinen Füßen lag ein ungepflegter gelber Hund. Mr. Hayes trug Hosen aus grob gewirktem Stoff, ein schlichtes Hemd aus ungefärbter Baumwolle, Hosenträger und einen Lederhut, der aussah, als sei er von einem wütenden Tier zuerst zerzaust und dann wieder ausgespuckt worden. Sein Gesicht war mit Bartstoppeln übersät und eines seiner Augen von einer schwarzen Klappe verdeckt, die ihm ein draufgängerisches Aussehen verlieh.
Von seinem Haar konnte Caroline wegen des Huts nichts sehen, aber sie vermutete stark, dass es viel zu lang war. Seufzend befeuchtete sie ihr Taschentuch und wischte ein größeres Stückchen sauber.
In diesem Augenblick musste einer der Männer an Mr. Hayes' Tisch sie bemerkt und etwas gesagt haben, denn Guthrie Hayes wandte den Kopf und schaute Caroline direkt in die Augen. Ein unerklärlicher Schock durchfuhr sie; sie spürte plötzlich, dass etwas unendlich Schönes und gleichzeitig tödlich Gefährliches von diesem Mann ausging.
Tatsächlich besaß er die Frechheit, sie anzulächeln, ohne dabei die dünne Zigarre, die in seinem Mundwinkel hing, aus dem Mund zu nehmen. Dabei zeigte er seine strahlendweißen Zähne, und Caroline musste zugeben, dass sie das einzige Attribut waren, das sein Aussehen ein wenig verschönte.
Mr. Hayes sagte etwas zu den anderen Männern, legte seine Karten hin und schob seinen Stuhl zurück. Der Hund folgte ihm auf dem Fuß, als er durch die Schwingtüren des Saloons auf die Straße trat.
Caroline wich erschrocken zurück; ihre Finger zitterten, als sie das beschmutzte Taschentuch rasch in ihr Retikül stopfte. Doch obwohl sie zutiefst verängstigt war, straffte sie die Schultern und schob das Kinn vor. Mr. Hayes näherte sich ihr gelassen, die Zigarre noch immer zwischen seinen Zähnen. Im hellen Sonnenschein des Aprilnachmittags erkannte Caroline jetzt, dass seine Augen grün waren und sein Haar, wie auch die Stoppeln seines Bartes, war hellbraun.
Er war eine beeindruckende Erscheinung, trotz seines Äußeren.
»Madam«, sagte er und tippte sich an den Rand seines schäbigen Huts. Ein leichter Anflug eines weichen Südstaatenakzents klang in seiner Stimme mit.
Caroline holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Gott war ihr Zeuge, dass sie nichts mit Kerlen wie Guthrie Hayes zu schaffen haben wollte, aber vielleicht war er Seatons letzte Chance. Sie war bereit, fast alles zu tun, um dem Mann zu helfen, den sie zu heiraten hoffte.
So reichte sie Guthrie Hayes die Hand. »Mein Name ist Caroline Chalmers.«
Ein amüsierter Blick flackerte in Hayes’ grünem Auge auf, als er Caroline langsam von Kopf bis Fuß betrachtete. Seine Belustigung ärgerte sie, gleichzeitig jedoch spürte sie, wie sich unter seiner Musterung eine süße Schwere in ihren Gliedern ausbreitete.
»Was kann ich für Sie tun, Miss Chalmers?« Hinter ihm winselte der gelbe Hund klagend und ließ sich dann zu Füßen seines Herrn im Straßenstaub nieder.
Caroline befeuchtete ihre plötzlich trockenen Lippen, und obwohl ihr Anliegen sehr dringend war, zögerte sie noch, es vorzutragen. »Ist der Hund krank?«, fragte sie.
»Tob?« Hayes lachte, ein tiefes, warmes Lachen, das Carolines Magen traf und dort zerschmolz wie Bienenwachs in der Sonne. »Ach nein. Er ist nur ein bisschen beschwipst – eine schlechte Angewohnheit, die er schon hatte, bevor wir uns begegneten.«
Caroline errötete und trat einen Schritt zurück. Im Saloon klimperte ein Piano, und Kutschen und Wagen rumpelten über die aufgeweichte Straße hinter ihnen. »Tob ist ein seltsamer Name«, sagte sie verwundert. »Warum nennen Sie ihn so?«
Mr. Hayes seufzte schwer. Wahrscheinlich konnte er es nicht erwarten; an den Spieltisch im Hellfire-and-Spit-Saloon zurückzukehren. Er nahm seinen Hut ab, setzte ihn jedoch sogleich wieder auf, und Caroline sah für einen winzigen Moment wirres braunes Haar mit einem goldenen Schimmer.
»Miss Chalmers«, sagte er mit mühsam erzwungener Geduld, »ich bin nicht herausgekommen, um über meinen Hund zu sprechen. Was wollen Sie von mir?«
Caroline errötete noch heftiger, und aus den Augenwinkeln sah sie, dass Hypathia Furvis sie durch das Fenster des Bekleidungsgeschäfts beobachtete. Nun würde noch vor Sonnenuntergang jeder in Bolton wissen, dass die Lehrerin sich mit einem Mann unterhalten hatte, der fast ein Krimineller war.
»Miss Chalmers?«, drängte Mr. Hayes.
»Ist es wahr, dass Sie früher... dass Sie während des Krieges Männer aus Unionsgefängnissen befreit haben?«
Er nahm ein Streichholz aus der Hemdtasche, rieb es an seiner Stiefelsohle und zündete die erloschene Zigarre an. Wolken blauen Rauchs drangen in Carolines Gesicht. »Wer hat das gesagt?«
Caroline hustete. »Einer meiner Schüler«, gab sie zu.
Ein verschmitztes Lächeln spielte um Mr. Hayes’ Lippen. »Ich dachte mir schon, dass Sie wie eine Lehrerin aussehen«, sagte er und musterte ihre schlanke Figur von neuem. »Sie sind ein mageres kleines Ding. Bezahlen sie Ihnen nicht genug, damit Sie anständig essen können?«
Caroline war zutiefst gekränkt. Vielleicht war sie nicht so rundlich und plump, wie es jetzt modern war, aber mager war sie auch nicht. Noch einmal holte sie tief Atem, um ihm zu beweisen, dass sie – wenn auch in bescheidenem Umfang – Busen hatte. »Mein Gehalt ist sehr ordentlich, vielen Dank. Es erlaubt mir sogar, Ihnen eine beträchtliche Summe für Ihre Hilfe anzubieten.«
Hayes zog an seiner Zigarette. »Wie beträchtlich?«
»Zweihundertsechsunddreißig Dollar und siebenundvierzig Cent«, erwiderte Caroline stolz. Sie hatte praktisch von Kindheit an gespart, um dieses – für sie – kleine Vermögen zusammenzubekommen. Und sie liebte Seaton Flynn genug, um jeden einzelnen Penny für seine Freiheit zu opfern.
Hayes pfiff leise durch die Zähne und schüttelte den Kopf. »Das ist eine Menge Geld, Miss Chalmers. Was genau müsste ich tun, um es zu verdienen?«
Caroline schaute sich prüfend um, dann senkte sie ihre Stimme zu einem Flüstern: »Ich möchte, dass Sie meinen ... Freund aus dem Gefängnis befreien.«
Das eine grüne Auge von Mr. Hayes wurde schmal, und er warf den Zigarrenstummel auf die Straße. »Was sagten Sie?«
Caroline biss sich auf die Lippen und wiederholte ihre Bitte noch einmal, diesmal so langsam, als hätte sie einen schwerfälligen Schüler vor sich.
»Ich will verdammt sein!«, fluchte Mr. Hayes und stützte empört die Hände in die Hüften. »Sie verlangen von mir, das Gesetz zu brechen!«
»Psst!«, zischte Caroline, ergriff seinen Arm und zerrte ihn fast in die kleine Gasse zwischen dem Saloon und dem Wells Fargo Büro. Es war nicht auszudenken, was Hypathia daraus machen würde, aber darauf konnte Caroline jetzt keine Rücksicht nehmen. »Sie würden nicht das Gesetz brechen«, beharrte sie, ohne Mr. Hayes’ Arm loszulassen, »sondern Gerechtigkeit üben! Seaton ... Mr. Flynn ist unschuldig. Er ist ungerechterweise beschuldigt worden.« Bei den letzten Worten traten ihr Tränen in die Augen. »Und sie werden ihn hängen, wenn Sie nichts tun!«
Mr. Hayes wurde spürbar nachgiebiger. Sein Hund, der wieder an seiner Seite stand, stupste ihm die Nase in die Kniekehlen. »Ich habe in der Zeitung von dem Fall gelesen«, erwiderte Hayes stirnrunzelnd und rieb sich nachdenklich das Kinn.
Nur ihre Verzweiflung hinderte Caroline daran, ihrer Verwunderung Ausdruck zu geben, dass Mr. Hayes’ des Lesens mächtig war. »Er hat die Postkutsche nicht ausgeraubt«, flüsterte sie eindringlich. »Und ich weiß, dass er den Fahrer nicht erschossen hat! Zu einer solch schändlichen Handlungsweise wäre Mr. Flynn gar nicht fähig.«
Mr. Hayes wirkte skeptisch, aber auch mitfühlend, wofür Caroline ihn am liebsten geohrfeigt hätte. Aber sie nahm sich zusammen.
»Warum sind Sie sich dessen so sicher?«, wollte er wissen.
Caroline seufzte ungeduldig. »Weil er es mir gesagt hat.«
Hayes spreizte die Hände. »Tatsächlich?«, entgegnete er spöttisch. »Na ja, das ändert natürlich alles.«
Caroline weinte jetzt ganz offen, aber das war ihr egal. Praktisch alles, was ihr etwas bedeutete, stand auf dem Spiel. »Wenn Mr. Flynn aus dem Gefängnis fliehen könnte, wäre es ihm möglich, seine Unschuld zu beweisen.«
»Oder für immer zu verschwinden«, entgegnete Hayes kühl. »Flynn wurde des Raubmordes angeklagt, Miss Chalmers, und zum Tod durch Hängen verurteilt. Und daran kann ich nichts ändern.« Er wandte sich zum Gehen, doch Caroline hielt ihn am Ärmel fest.
»Warten Sie«, flehte sie. »Bitte!«
Er drehte sich erneut zu ihr um. »Während des Krieges in ein Yankee-Gefangenenlager einzubrechen, war eine Sache, Miss Chalmers. Aber der Kampf ist jetzt vorbei, und ich habe nicht die Absicht, der Gerechtigkeit in die Quere zu kommen.«
»Gerechtigkeit?«, rief Caroline empört. »Sie werden den falschen Mann aufhängen, Mr. Hayes! Nennen Sie das Gerechtigkeit?«
Hayes schob einen Daumen unter seinen Hosenträger und betrachtete Caroline sinnend. »Sie lieben diesen Galgenvogel, was?«
»Ja«, gab Caroline leise zu. Der Hund zu Mr. Hayes Füßen schien ihre Stimme mit seinem leisen Winseln nachzuahmen.
»Teufel!«, fluchte Mr. Hayes. »Ich hasse es, wenn Frauen weinen.«
Da ihr Taschentuch zu schmutzig war, trocknete Caroline ihre Tränen mit dem Handrücken. »Werden Sie mir helfen?«
»Nein«, entgegnete Mr. Hayes und ging, seinen mageren Hund dicht auf den Fersen.
Caroline brauchte einen Moment, um ihre Fassung wiederzufinden, aber dann folgte sie ihm. Die neugierige Hypathia stand auf dem Bürgersteig vor dem Laden ihrer Tante und beobachtete Caroline mit verschränkten Armen und einem anzüglichen Lächeln.
»Hallo, Caroline!«, rief sie ihr munter zu.
Caroline bedachte sie mit einem gereizten Blick und kehrte zum Fenster des Saloons zurück.
Guthrie Hayes war wieder in sein Kartenspiel vertieft. Während Caroline zusah, schlenderte ein Barmädchen mit wiegenden Hüften zu ihm hinüber. Sie trug ein tiefausgeschnittenes, sehr kurzes Taftkleid, und in der Hand eine Emailleschüssel.
Am Tisch nahm sie die Whiskeyflasche und goss etwas von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in die Schüssel. Sie setzte sie auf den Fußboden, und ihre Strumpfbänder wurden sichtbar, als sie sich bückte. Der Hund schleckte den Whiskey schamlos auf und ließ sich dann mit einem zufriedenen Seufzen zu Mr. Hayes’ Füßen nieder.
Im Moment kümmerte Caroline das seltsame Verhalten des Hundes nicht. Es war das Barmädchen, das sie ärgerte. Während sie sprachlos zuschaute, setzte es sich auf Mr. Hayes’ Schoß und schlang ihm einen Arm um den Nacken.
Für einen Augenblick waren Seaton Flynn und seine verzweifelte Lage für Caroline vergessen.
Die Dirne nahm Mr. Hayes’ Hut ab und setzte ihn auf ihren Kopf, dann beugte sie sich vor und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Caroline klopfte an das Fenster, aber Mr. Hayes’ ungeteilte Aufmerksamkeit galt der Dirne, die lachend auf seinem Schoß hockte.
Ein leises Grinsen breitete sich auf seinen Zügen aus, als er sich anhörte, was immer das Barmädchen zu sagen haben mochte, dann nickte er zustimmend. In diesem Augenblick vergaß Caroline jegliche Sorge um ihren guten Ruf und marschierte entschlossen über den Bürgersteig auf die Schwingtüren zu.
Ohne nachzudenken – hätte sie es getan, wäre ihr Mut sofort verflogen – betrat Caroline das Lokal und ging entschieden auf Mr. Hayes’ Tisch zu.
Das Pianogeklimper brach so unvermittelt ab wie das Klirren der Gläser und das Summen der Unterhaltung.
Alle drehten sich zu Caroline um, als sie mit verschränkten Armen neben Mr. Hayes’ Tisch stehenblieb.
Tob winselte und legte eine Pfote über seine Schnauze. Mr. Hayes schaute zu Caroline auf und grinste, und das Barmädchen, noch immer seinen Hut auf dem Kopf, sah Caroline aus seinen kohlschwarzen umrandeten Augen mit einer Mischung aus Trotz und Verachtung an.
Der Impuls, der Caroline dazu getrieben hatte, den Saloon zu betreten, war verflogen, der Mut hatte sie verlassen. Was sollte sie auch tun – sie konnte ihr Anliegen schließlich nicht vor all diesen Gästen vorbringen; ihr ganzer Plan beruhte auf äußerster Diskretion.
»Mr. Hayes«, sagte sie verlegen, »ich möchte mit Ihnen sprechen. Unter vier Augen bitte.«
Er zog eine Augenbraue hoch und legte seinen Arm um die Taille des Barmädchens, das entzückt zu kichern begann und ihm seinen Hut wieder aufsetzte. »Oh, tatsächlich? Worum geht es denn?«
Caroline spürte, wie ihr Blut in die Wangen schoss. »Sie wissen sehr gut, worum es geht, Mr. Hayes. Sie machen es mir nur unnötig schwer.«
Viel zu sanft für Carolines Geschmack schob er das Mädchen von seinem Schoß und erhob sich. »Ich glaube, ich habe mich vorhin klar genug ausgedrückt, Miss Chalmers«, sagte er gelassen.
Caroline erschrak. Falls er ihre Bitte jetzt vor all diesen Leuten wiederholte, war alles verloren. Vielleicht kam sie dann sogar selbst ins Gefängnis.
Doch er zeigte nur fast freundlich auf die Tür und forderte sie mit dieser stummen Geste auf zu gehen. Caroline wandte sich auf dem Absatz um, raffte ihre Röcke und stürmte mit hochroten Wangen aus dem Saloon.
Sie blieb nicht eher stehen, als bis sie, drei Straßen weiter, das Schulhaus erreicht hatte. Da sie ihre Schüler heimgeschickt hatte, bevor sie den Saloon aufsuchte, war das Gebäude jetzt verlassen, und sie konnte sich dort ganz in Ruhe ausweinen.
Als sie an einer der schmalen Bänke saß und ihren Tränen freien Lauf ließ, wurde ihr bewusst, dass sie heute zum ersten Mal wieder die gleiche Hoffnungslosigkeit empfand wie damals in Nebraska, als sie gezwungen worden war, ihre Schwestern Lily und Emma im Waisenkinderzug zurückzulassen.
Mit Seaton Flynn, einem gutaussehenden jungen Anwalt, der vor zwei Jahren mit der Postkutsche in der Stadt erschienen war, hatte sie gehofft, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, sich ein eigenes kleines Heim aufzubauen. Er hatte sie mit seinem Charme und seinen lachenden braunen Augen mühelos für sich eingenommen.
Da er, ganz im Gegensatz zu Mr. Guthrie Hayes, ein gesundes Gefühl für Anstand und sein äußeres Erscheinungsbild hatte, war es ihm schon bald gelungen, sich eine angesehene Praxis aufzubauen. Obwohl Caroline auch schon Spuren eines kalten, aufbrausenden Charakters bei Seaton entdeckt hatte, war sie doch der Meinung, dass seine guten Eigenschaften diese vorübergehenden Temperamentsausbrüche aufwogen.
Und dann war er beschuldigt worden, eine Postkutsche beraubt und einen Menschen erschossen zu haben. Seaton wurde nach Laramie gebracht, wo ihm der Prozess gemacht und er verurteilt wurde, aber Caroline war überzeugt, dass es sich um einen kolossalen Justizirrtum handelte. Sie liebte Seaton Flynn, und das wäre nicht der Fall gewesen, wenn es sich bei ihm um einen Mörder und Dieb gehandelt hätte. Das hätte sie gespürt.
Als die Tür sich leise krächzend hinter ihr öffnete, glaubte Caroline zunächst, einer ihrer Schüler sei zurückgekehrt, um ein vergessenes Buch zu holen. Rasch wischte sie ihre Tränen ab und setzte ein schwaches Lächeln auf. Aber als sie sich dann umdrehte, sah sie, dass es Guthrie Hayes war, der hinter ihr stand.
Sofort wurde es ihr zu heiß im Raum. Caroline sprang auf und ging zur Wand, um einen langen Zeigestock vom Haken zu nehmen. Ihr Herz klopfte übertrieben schnell, und sie ging von einem Fenster zum anderen, um sie zu öffnen.
Bald gab es nichts mehr zu tun, und sie musste sich Mr. Hayes stellen. »Was wollen Sie?«, fragte sie.
Er lehnte mit dem Rücken am Türrahmen. »Sie haben geweint«, sagte er. »Ist Ihnen noch nie der Gedanke gekommen, dass Flynn Ihrer Tränen nicht wert sein könnte?«
Caroline dachte an die Picknicks und langen Sonntagsnachmittagsspaziergänge mit Seaton, an seine Küsse im Mondschein und ihre Träume von einer Zukunft an seiner Seite. Caroline hatte sich auf den ersten Blick in ihn verliebt, gleich in jenem Augenblick, als sie sich vor der Tür seiner Praxis zum ersten Mal begegnet waren.
»Sie kennen Mr. Flynn nicht«, antwortete sie so ruhig, wie ihr möglich war, und brachte den Zeigestock an seinen Platz zurück. »Und vielleicht darf ich bemerken, dass es sehr brutal von Ihnen ist, hierherzukommen und mich zu quälen.«
Der Stich schien Mr. Hayes nicht zu treffen, und er zuckte nur die Schultern. »Anscheinend kannten die Geschworenen und der Richter ihn auch nicht. Sie haben ihn wegen Mordes verurteilt, unter anderem.«
Caroline war müde, entmutigt und enttäuscht. »Warum sind Sie hergekommen?«, fragte sie scharf.
Er nahm seinen Hut ab und kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Das weiß ich selbst nicht«, gab er zu, »vor allem, wenn man bedenkt, dass ich etwas Besseres zu tun hätte.«
Sogleich dachte Caroline an die Dirne, die sich auf seinen Schoß gesetzt hatte, und war gekränkt. Sie sammelte eine Reihe von Mathematikheften ein und legte sie krachend auf das Pult. »Das ist keine befriedigende Antwort, Mr. Hayes.«
Er lächelte nachsichtig. »Ich scheine diese Unterhaltung immer wieder zum Scheitern zu bringen, kleine Lehrerin.«
Aus einem Grund, den Caroline sich nicht erklären konnte, spielte er mit ihr. Sie bedachte ihn mit einem herablassenden Blick. »Sie bringen ein Leben zum Scheitern«, entgegnete sie kühl.
Er lachte und presste eine Hand an seine Brust, als hätte sie ihm dort einen Messerstich versetzt. Dann löste er sich von der Tür und kam auf Caroline zu, bis er ihr ganz nahe stand.
»Sie sollten etwas weniger großzügig mit Ihren Beleidigungen umgehen«, sagte er mit leiser Stimme, einer Stimme, die ein warmes Prickeln tief in ihrem Innersten auslöste. »Nach allem, was Sie mir sagten, scheine ich Ihre einzige Hoffnung zu sein, Ihren Freund vor dem Strick zu bewahren.«
Caroline trat zurück und zupfte verlegen an den dunklen Strähnen, die sich aus ihrem Knoten gelöst hatten.
Mr. Hayes’ nicht zugedecktes Auge richtete sich bei dieser Bewegung auf ihre Brust, um gleich darauf zu ihrem Gesicht zurückzukehren. Wieder spielte ein leichtes Grinsen um seine Lippen. Caroline wurde ganz schwindelig, und rasch setzte sie sich auf ihren Stuhl am Pult.
»Werden Sie mir helfen oder nicht?«, fragte sie atemlos, als Guthrie Hayes sich über sie beugte und die Hände auf der Tischplatte aufstützte.
»Ich habe mich noch nicht entschieden«, erwiderte er. »Das ist kein Unternehmen, das man leichtfertig eingehen kann, Miss Chalmers. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu bedenken.«
Ganz unvermittelt kam Caroline der Gedanke, dass Mr. Hayes eine sehr viel bessere Erziehung genossen haben musste, als seine Kleidung und allgemeine äußere Erscheinung verrieten. »Aber Sie sagen nicht nein?«
Er schüttelte den Kopf, und Caroline sah an seiner Miene, dass er selbst überrascht darüber war. »Nein. Warum, begreife ich selbst nicht, denn Ihre Idee ist glattweg verrückt. Einer von uns – oder sogar wir beide – könnte im Gefängnis enden, gleich neben ihrem Beau.«
Zu ihrer eigenen Überraschung lächelte Caroline, und Guthrie schien ähnlich erstaunt, denn er zog sich zurück und wirkte alarmiert und sehr verwirrt.
»Danke«, sagte sie.
Mr. Hayes fluchte verhalten, riss seinen Hut vom Kopf und stülpte ihn wieder auf. Dann drohte er Caroline mit dem Zeigefinger. »Ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, kleine Lehrerin! Vergessen Sie das nicht.«
»Nein«, erwiderte Caroline, aber es gelang ihr nicht, den Triumph in ihrer Stimme zu unterdrücken.
Wieder fluchte Mr. Hayes, drehte sich auf dem Absatz um und stürmte aus dem Raum. Noch als er die Tür schloss, fluchte er leise vor sich hin.
Zum ersten Mal seit Seatons Verhaftung wurde es Caroline etwas leichter ums Herz. Sie schloss die Fenster, wusch die Tafel ab, fegte den Fußboden und ging nach Hause.
Miss Ethel, grauhaarig inzwischen, aber von ungebrochener Energie und Lebensfreude, war im Vorgarten, als Caroline nach Hause kam, und suchte die ersten Knospen in ihren geliebten Rosensträuchern. Sie lächelte erfreut, als Caroline summend durch das Gartentor kam.
»Du hast diesen verflixten Mr. Flynn also endlich überwunden!«, sagte die alte Dame mit einem Seufzer der Erleichterung.
»Im Gegenteil«, erwiderte Caroline und fügte mit einem verschwörerischen Flüstern hinzu: »Bald werde ich der ganzen Welt beweisen, dass Seaton nicht schuldig ist.«
Miss Ethels Gesicht erstarrte. »Aber das ist er doch, Liebes«, entgegnete sie. »Hast du vergessen, dass einer der Passagiere der Postkutsche ihn erkannte und identifizierte?«
Caroline ging weiter, obwohl ihre Schritte nicht mehr so beschwingt waren wie vorher. »Es war ein Irrtum«, widersprach sie. »Der wirkliche Räuber ist jemand, der Seaton ähnlich sieht, das ist alles.« Sie drehte sich nicht um, weil sie wusste, dass sie dann sehen würde, wie Miss Ethel den Kopf schüttelte.
Im Salon saß Miss Phoebe auf dem Sofa, trank Tee und plauderte mit einer Nachbarin. Sie neigte den Kopf und hob grüßend die Hand, als Caroline an der offenen Tür vorbeiging.
Miss Phoebe hatte vorgehabt, nach ihrer Ankunft in Bolton, damals vor dreizehn Jahren, einen Mr. Gunderson zu heiraten, aber ein Schoschonenkrieger hatte den zukünftigen Bräutigam erschossen, bevor Miss Phoebe noch mit dem Auspacken fertig gewesen war. Trotz Horden von eifrigen Bewerbern um ihre Hand – wie fast alle Städte im Westen litt auch Bolton unter drastischem Frauenmangel – hatten weder Miss Phoebe noch Miss Ethel je wieder Interesse gezeigt, eine Ehe einzugehen.
In der geräumigen Küche hängte Caroline ihren schlichten marineblauen Mantel an einen Haken neben der Tür und machte sich ein belegtes Brot zurecht. Beim Duft des Hammelbratens, der im Ofen schmorte, war ihr das Wasser im Munde zusammengelaufen.
Als wenig später Miss Phoebe hereinkam, saß Caroline an dem großen Tisch und bereitete ihren Unterricht für den nächsten Tag vor.
»Ist Mrs. Cribben fort?«, fragte Caroline, die diese Dame als entsetzlich langweilig empfand.
»Ja«, erwiderte Miss Phoebe. Ihr Haar war ergraut wie das ihrer Schwester, aber sie war noch immer eine attraktive Frau. »Es wäre nett gewesen, wenn du sie wenigstens begrüßt hättest. Schließlich ist sie die treibende Kraft gewesen, die den Bürgermeister überredete, eine neue Saloonsteuer zu erheben, damit wir neue Textbücher für die Schule kaufen konnten.«
Caroline nickte seufzend. Sie war eine verantwortungsbewusste Lehrerin, und die Angelegenheiten der Schule waren ihre eigenen, aber im Augenblick konnte sie nur an Mr. Guthrie Hayes denken. Er ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Was mochte das Barmädchen ihm nur zugeflüstert haben, um ihn zu einem solchen Grinsen zu veranlassen? Ob die beiden später hinaufgegangen waren, um diese ... diese skandalösen Dinge zu tun, von denen sie gehört hatte?
Ganz unbewusst ballte Caroline die Faust.
Was machte Guthrie Hayes überhaupt in Bolton?
»Caroline«, sagte Miss Phoebe vorwurfsvoll.
Caroline zuckte zusammen. »Entschuldige«, meinte sie errötend. »Was sagtest du?«
»Ich sagte, dass Mrs. Cribben mir erzählte, Hypathia Furvis hätte ihr berichtet, du wärst in diesen ver ... in diesen schrecklichen Saloon gegangen ...« Sie machte eine Pause und erschauerte. »Am helllichten Tag!«
Caroline schluckte und starrte ihre gütige Adoptivmutter betroffen an. Das Blut stieg ihr bis unter die Haarwurzeln. Sie sah keinen Zorn in dem zarten, gutgeschnittenen Gesicht, aber Miss Phoebe wirkte zutiefst enttäuscht. »Dort saß ein Herr, den ich sprechen musste«, erklärte sie lahm.
»Warum?«, wollte Miss Phoebe wissen.
Nur mit der größten Überwindung gelang es Caroline, die Frau zu belügen, die wie eine Mutter zu ihr war. »E-er ist der Vater einer meiner Schüler«, schwindelte sie und wandte den Blick ab. »Calvin war nicht zur Schule gekommen, und ich wollte wissen, warum.«
»Hättest du nicht zu ihm nach Hause gehen können?«
Caroline zwang sich, Miss Phoebe anzusehen. Eine Lüge war eine Lüge, aber hier handelte es sich schließlich um ganz außergewöhnliche Umstände. »Calvin sagte mir, seine Mutter sei sehr krank«, schmückte sie ihre Geschichte noch weiter aus. »Ich wollte die arme Frau nicht stören.«
Miss Phoebe seufzte. »Ich brauche dich wohl nicht daran zu erinnern, Caroline, dass eine Lehrerin sich keinen Makel an ihrem guten Ruf erlauben kann. Wenn etwas davon zur Schulverwaltung vordringt – und das wird es sicher – könntest du deine Stellung verlieren.«
Caroline stellte sich vor, Seatons Frau zu sein und im Triumphzug mit ihm nach Bolton zurückzukehren. Von allen Anklagen freigesprochen, würde Mr. Flynn seine Rechtsanwaltspraxis wieder aufnehmen, und Caroline würde damit beschäftigt sein, Gardinen zu nähen und Kinder zu bekommen. Ihre Stellung in der Schule bereitete ihr dann bestimmt kein Kopfzerbrechen mehr.
»Ich werde vorsichtiger sein«, versprach sie.
Miss Phoebe berührte zärtlich ihre Hand. »Tu das bitte, Liebes.« Sie seufzte, als sie aufstand und zum Schrank ging, um das Porzellan herauszunehmen. »Ich hoffe sehr, dass du dir diesen Anwalt aus dem Kopf schlägst. Es gibt doch wirklich genug nette junge Männer in Bolton, die dich mit Begeisterung heiraten würden.«
Caroline verbarg ein Lächeln, als sie vom Tisch aufstand. »Kleine Angst, Phoebe«, sagte sie beruhigend, »ich werde verheiratet sein, bevor ihr wisst, wie euch geschieht.«
»Wer heiratet?«, fragte Miss Ethel, die gerade hereingekommen war, neugierig.
Caroline lachte. »Ich.«
»Caroline macht nur Spaß«, warf Miss Phoebe ein.
»Ach so«, sagte Miss Ethel, sichtbar enttäuscht. Dann griff sie in ihre Rocktasche. »Es ist ein Brief für dich gekommen, Liebes. Hier ist er.«
Caroline erhielt nur selten Post, und wenn, dann schlug ihr Herz immer schneller. Selbst nach all diesen Jahren hatte sie nie die Hoffnung aufgegeben, einmal etwas von Emma oder Lily zu hören.
Aber der Umschlag trug einen Absender aus Laramie, und Caroline erkannte sofort Seatons elegante Handschrift. Ihre Finger zitterten ein wenig, als sie den Brief öffnete, und in ihrem Magen breitete sich ein unangenehmes Gefühl aus.
Was überhaupt nicht die Reaktion war, die sie erwartet hatte.
Liebe Caroline, hatte er geschrieben, es ist sehr einsam hier, und ich vermisse Dich von ganzem Herzen ... Irgendwie müssen wir einen Weg finden, meine Freilassung zu erreichen ... Ich schwöre Dir, bei allem, was mir heilig ist, dass ich diesen Mann nicht getötet habe ... Wir werden gemeinsam fortgehen, irgendwo anders ein neues Leben beginnen ...
Caroline faltete den Brief und steckte ihn in den Umschlag zurück. In Gedanken stand sie jetzt vor Seaton, schaute in seine ernsten dunklen Augen, berührte sein volles schwarzes Haar und schmiegte sich an seinen großen, schlanken Körper.
Und zum ersten Mal, seit der Albtraum begonnen hatte, verspürte sie eine Spur von Zweifel. War es möglich, dass Seaton log?
»Entschuldigt mich«, sagte sie zu Miss Phoebe und Miss Ethel, die sie mit besorgten Mienen beobachteten, eilte die Hintertreppe hinauf und über den schmalen Korridor zu ihrem Zimmer.
Hinter ihrer verschlossenen Tür presste sie eine Hand auf ihr Herz und atmete tief ein, bis der schreckliche Verdacht verblasste. Seaton Flynn war unschuldig, egal, was die Geschworenen, der Richter oder Guthrie Hayes denken mochten. Er war ebenso ein Opfer wie dieser arme Kutscher, der bei dem Überfall ums Leben gekommen war.
Oder nicht?
Resolut ging Caroline zu ihrem Schreibtisch und nahm die Zeichnung in die Hand, die sie aus dem Gedächtnis von Lily und Emma angefertigt hatte. Eins nach dem anderen, berührte sie die Gesichter ihrer Schwestern und fragte sich wehmütig, wo sie sein mochten und ob es ihnen gut ging und ob sie glücklich waren.
»Er war es nicht«, sagte sie ihren fernen Schwestern, und ihre großen Augen betrachteten sie ernst.
2
Guthrie hielt den Wagen an, als er sein Lager am Fluss der Berge erreichte, befestigte die Bremse und ließ die Zügel sinken. Tob sprang von der Ladefläche und lief aufgeregt zwischen Guthries Füßen herum, als er den braunen Wallach abschirrte und gackernde Hühner in alle Richtungen auseinanderstoben.
Beim Gedanken an Caroline Chalmers Besuch im Hellfire-and-Spit-Saloon grinste Guthrie und schob die schwarze Augenklappe auf den Kopf – er trug sie nur für den Fall, dass es jemanden in Bolton gab, von dem er nicht erkannt werden wollte. Dann brachte er das Pferd zu einer Ansammlung von Bäumen, wo ein Bach vorbeifloss, in dem das Tier trinken konnte. Auch genügend Gras war hier vorhanden, so dass das Pferd auch fressen konnte.
Mit einer langen Leine band er den Wallach an einen Pfosten, den er zu diesem Zweck in die Erde getrieben hatte.
Seine Gedanken waren noch immer bei Caroline, als er ins Lager zurückkehrte, wo Tob ihn freudig bellend begrüßte. Stirnrunzelnd bückte er sich, um den alten Hund zu streicheln. Wenn diese magere Lehrerin herausgefunden hatte, wer er war, konnte es nicht lange dauern, bis die ganze Gegend über ihn Bescheid wusste ...
Er nahm einen Armvoll Feuerholz von dem Stapel, den er vor dem Mineneingang aufgeschichtet hatte, und trug ihn zu dem Ring aus Steinen in der Mitte seines Lagers. Falls die Yankees beabsichtigen, mich für meine Aktionen im Krieg ins Gefängnis zu sperren, dachte er, dann hätten sie es längst getan. Es bestand kein Grund zur Flucht.
Guthries Hände arbeiteten aus langer Gewohnheit völlig unabhängig von seinen Gedanken, als er das Feuer anzündete, seine blaue Kaffeekanne nahm und zum Bach hinunterging, um Wasser zu holen.
Nur wenige Meter von seinem Zelt entfernt befand sich ein kleines Kupferdepot, das er abzubauen gedachte. Guthrie grinste, als er sich bückte, um die Kanne mit Wasser zu füllen. Er war es leid, von Ort zu Ort zu ziehen.
Sobald die Mine Gewinn abzuwerfen begann, würde er sich am Außenrand von Bolton ein Haus bauen – das beste in der ganzen Stadt. Und dann würde er nach Cheyenne zurückkehren und Adabelle Rogers holen, ein Mädchen, das eine gute Ehefrau abgeben würde. Falls sie dann noch frei war natürlich.
Er lächelte zufrieden, als er das frische Wasser zum Lager zurück trug. Adabelle hatte blaue Augen, blondes Haar und einen Körper wie ein Daunenbett, und Guthrie freute sich schon darauf, jede Nacht in ihrer sanften Wärme zu versinken. Mit etwas Glück würden ihm dann bald schon vier oder fünf Kinder entgegenlaufen, wenn er abends von der Minenarbeit nach Hause kam ...
Am Feuer hockend, gab er gemahlenen Kaffee in die Kanne und setzte sie aufs Feuer. Doch sein frohes Lächeln verblasste, als ihm Caroline Chalmers in den Sinn kam, Adabelle verdrängte, und ihn flehend aus ihren großen braunen Augen ansah.
Guthrie stand auf, riss seinen Hut ab und schleuderte ihn zu dem staubigen Zelt, das ganz in der Nähe stand. Oh nein, er würde nicht seine Mine aufs Spiel setzen, Adabelle und all seine Träume, nur weil eine magere Lehrerin seine Hilfe brauchte.
Oder vielleicht doch?
Er strich sich nachdenklich über das Haar und steckte beide Daumen hinter seine Hosenträger. Caroline war so ganz anders als Adabelle, und doch wollten ihr Gesicht, ihre Gestalt und ihre Stimme nicht mehr aus seinen Gedanken weichen. Als sie ihn in der Schule so ganz unerwartet angelächelt hatte, war es ihm für einen Moment so vorgekommen, als schwankte der Boden unter seinen Füßen.
Seufzend legte Guthrie den Kopf in den Nacken und schaute zum Himmel auf. Obwohl die Tage schon länger wurden, blieb nicht mehr viel Licht. Wenn er noch etwas zum Abendessen erlegen wollte, musste er sich beeilen.
Er zog seinen 45er Colt aus dem Halfter und überprüfte die Kammer. Dann, mit Tob an seiner Seite, machte er sich in die Wälder auf.
Zwanzig Minuten später kehrte er mit zwei Schneehühnern zurück. Am Bachufer rupfte er sie und nahm sie aus, dann steckte er sie auf einen Spieß über dem Lagerfeuer. Kurze Zeit darauf erfüllte ein Duft das Lager, der Guthrie das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ.
Während er seinen Kaffee trank, dachte er über Caroline nach. Sie war aufdringlich wie eine Pferdefliege, diese Frau, aber Guthrie hatte den Eindruck, dass sie nicht dumm war, und wenn sie den Anwalt für unschuldig hielt, hatte das für ihn etwas zu bedeuten. Vielleicht war Flynn ja unschuldig. Vielleicht war ein Mann im Begriff zu sterben für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hatte.
Es wurde dunkler, und Guthrie zündete eine Petroleumlampe an, die er an einen der Pfähle hing, zwischen die er eine Wäscheleine gespannt hatte. Tob kam zu ihm und legte den Kopf auf seine Knie, und während Guthrie ihn streichelte, wurde er wieder von der Einsamkeit erfasst, die ihn schon seit Jahren quälte.
Er zwang sich, an Adabelle zu denken, aber wieder war es Caroline, die vor seinem inneren Auge erschien. Ihre schönen Augen blickten ihn flehend an, ihre Unterlippe zitterte.
Guthrie stöhnte. »Verschwinde und lass mich in Ruhe«, murmelte er. Aber sie blieb beim Essen, und sie war noch da, als Guthrie im Bach das Geschirr abwusch. Und sie beherrschte selbst dann noch seine Gedanken, als er in das Zelt kroch und sich bis auf die lange Unterwäsche auszog, um schlafen zu gehen.
Mr. Flynn ist unschuldig, hörte er sie sagen. Er ist ungerechterweise beschuldigt worden. Er sah die Tränen in ihren Augen. Sie werden ihn hängen!
»Vermutlich verdient er es«, knurrte Guthrie, während er sich unruhig von einer Seite auf die andere rollte und an die Zeitungsartikel dachte, die er über den Prozess in Laramie gelesen hatte. Flynn war noch immer dort und erwartete seine Hinrichtung.
Ärgerlich schloss Guthrie die Augen und rechnete damit, noch Stunden wach zu liegen, aber merkwürdigerweise schlief er sofort ein und kehrte nach Nordpennsylvania zurück, hinter den hohen Stacheldrahtzaun von Slaterville, einem provisorischen Gefangenenlager der Yankees ...
Die Bajonettwunde in seiner Seite brannte und schmerzte. In der stinkenden Dunkelheit, die ihn umgab, konnte er andere Männer hören, einige stöhnten, andere weinten, und einige schrien vor Schmerzen oder gefangen in einem Albtraum.
»Guthrie.« Das heisere Flüstern kam von direkt neben ihm, und unwillkürlich verspannte er sich und versuchte, den Kopf von seinem Strohlager zu erheben. Aber die Anstrengung war zu groß.
Eine Hand berührte seine Schulter und rüttelte ihn sanft. »Guthrie, du bist es doch, nicht wahr?«
Trotz allem, trotz der Schmerzen, seiner Hilflosigkeit und des Fiebers, das in ihm brannte, grinste Guthrie. Die Stimme gehörte Jacob McTavish, der ihm fast so etwas wie ein Bruder war. Er und Jacob waren zusammen auf der McTavish Plantage in Virginia aufgewachsen, wo Guthries Vater als Erntearbeiter beschäftigt gewesen war.
Dank der christlichen Einstellung von Jacobs Mutter war Guthrie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen auf der Plantage erzogen worden.
»So, hier versteckst du dich also, du Yankeeliebhaber«, brachte Guthrie mühsam heraus. »Dem letzten Brief von zu Hause nach zu urteilen, halten deine Mama und dein Papa dich für tot.« Jetzt, da seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte er Jacobs große, hagere Gestalt.
»Ich bin so gut wie tot, wenn wir nicht bald von hier verschwinden«, flüsterte Jacob. »Einer der Aufseher, ein Sergeant Pedlow, hat es auf mich abgesehen. Letzte Woche hat er einen Mann aus Tennessee gebrandmarkt.«
Guthrie schloss die Augen vor der Vorstellung und murmelte eine Verwünschung. »Versuch, dem Kerl aus dem Weg zu gehen«, sagte er, als ein Mondstrahl durch eine Ritze in der Wand fiel und seinen Freund in seinen silbernen Schein tauchte. »Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, Jake, aber mein Zustand erlaubt mir leider nicht, über einen Stacheldrahtzaun zu klettern – mit fünfzig Yankeegewehren im Rücken.«
Jacob fuhr sich mit der Hand durch sein rotbraunes Haar. »Ich sah, dass du verwundet warst, als sie dich ins Lager brachten, und habe mir die Baracke gemerkt, in der du untergebracht wurdest. Du hast verdammtes Glück gehabt, dass du nicht in einem ihrer Feldlazarette gelandet bist.«
Ein erstickter Ton kam aus Guthries Kehle, es sollte ein spöttisches Lachen sein, doch es wurde nur ein Schluchzen. Er glaubte noch immer das Blut zu riechen und die Schreie zu vernehmen. »Ich war dort«, antwortete er leise. »Sie behandelten meine Wunde mit Karbolsäure und schickten mich hierher.«
»Du bist bei Gettysburg verwundet worden?«
Guthrie nickte grimmig. »Glaubst du, es stimmt, was die Yankees sagen – dass sie General Lee in die Flucht geschlagen haben und der Krieg fast vorüber ist?«
Jacob zuckte mit den Schultern. »Für dich und für mich ist er vorbei«, erwiderte er, »es sei denn, es gelänge uns zu fliehen. Wenn Sergeant Pedlow seinen Willen durchsetzt, sehe ich mein Zuhause jedenfalls nicht wieder.«
Alles in Guthrie begehrte auf gegen die hilflose Lage, in der er sich befand, aber er besaß nicht einmal die Kraft, sich zu bewegen. »Warum hasst er dich denn so?«
»Was glaubst du? Weil ich ein Rebell bin.«
Guthrie seufzte. »Geh dem Sergeanten aus dem Weg, Jake«, riet er. »Ich werde nachdenken. Vielleicht fällt mir etwas ein.«
»Ich gehe jetzt lieber«, sagte Jacob, und aus seiner Stimme klang die gleiche Mutlosigkeit, die Guthrie selbst empfand. Nachdem er seinem Freund noch einmal kurz die Hand auf die Schulter gelegt hatte, verschwand Jacob in der Dunkelheit.
Guthrie lag still im Stroh und hörte, wie ein Mann sich ganz in der Nähe übergab. Zu dem allgemeinen Geruch nach Schweiß und Leid und verfaulendem Fleisch gesellte sich nun auch noch der durchdringende Gestank von Erbrochenem.
Mrs. McTavish, Jacobs fromme Mutter, hat recht gehabt, dachte Guthrie. Es gab doch so etwas wie eine Hölle, und er befand sich mittendrin.
Am nächsten Morgen hatte sich die Wunde an seiner Seite infiziert, und Guthrie bekam hohes Fieber. Was um ihn herum vorging, nahm er nur verschwommen wahr, aber als er den Schrei draußen hörte, wusste er ganz instinktiv, dass er von Jacob kam.
Wahrscheinlich, weil er verflucht war, wie sein Vater immer behauptet hatte, überlebte Guthrie und erholte sich nach einiger Zeit von seiner Verletzung. Sobald er wieder gehen konnte, machte er sich auf die Suche nach seinem Freund.
Er fand Jacob an der Kläranlage, wo er mit gebeugten Schultern und leeren Augen Kalk in die stinkende Grube schaufelte. Dicke Fliegen umhüllten ihn wie eine schwarze Wolke. Jacobs Lippen bewegten sich nicht, aber seine Augen sagten: Du kommst zu spät. Er schob sein schmutziges Hemd beiseite und zeigte Guthrie ein hässliches Brandmal auf seiner linken Schulter.
Bis zu diesem Augenblick hatte Guthrie nie wirklich Hass auf die Yankees empfunden. Sie waren für ihn grüne Jungen gewesen wie er selbst, die geglaubt hatten, an einem aufregenden Spiel teilzunehmen, bis sie feststellen mussten, dass es tödlich ernst war. »Welcher von ihnen ist Pedlow?«, fragte er und nahm eine Schaufel in die Hand, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen.
Auch Jacob arbeitete weiter. »Es ist der, der am Tor steht und sich mit dem Messer die Fingernägel reinigt.«
Guthrie musterte den Mann verstohlen. Er hatte ungefähr seine Körpergröße, war jedoch älter und kräftiger, und zahllose Pockennarben entstellten seine Züge.
Als hätte er Guthries Blick gespürt, hob Pedlow den Kopf und schaute zu ihm herüber. Die beiden Männer starrten sich eine Weile schweigend an, dann wandte Pedlow sich ab, spuckte in den Schmutz und schlenderte davon.
Drei Tage lang beobachtete Guthrie den Sergeanten, prägte sich seine Gewohnheiten und seinen Dienstplan ein. Guthrie war krank und sehr geschwächt, aber durch eine ironische Laune des Schicksals war Pedlow für ihn der Grund geworden, weiterzuleben und weiterzukämpfen. Wann immer Guthrie erschöpft war und den Mut verlor, brauchte er sich nur vorzustellen, wie der Sergeant das glühende Eisen auf Jacobs Haut gepresst hatte, und schon bezog er neue Kraft daraus.
Endlich wurde Pedlow für den Nachtdienst am Südtor eingeteilt, was Guthrie sehr passend fand, da der Weg in die Freiheit für ihn nur nach Süden führen konnte.
Eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit schlich er sich hinter den Sergeanten und schlug ihn mit einem dicken Stein nieder, den er schon seit Wochen für diese Gelegenheit aufbewahrt hatte. Dann schleppte er Pedlow hinter eine Reihe von Regentonnen und nahm ihm Messer und Uniform ab.
Guthries Hände zitterten, als er blitzschnell seine eigenen blutverschmierten Sachen gegen die blaue Unionsuniform auswechselte und Pedlows Flinte an sich nahm. Als ein halbes Dutzend Soldaten vorbeischlenderte, hielt er sich im Schatten und brummte nur etwas als Antwort auf ihren gleichgültigen Gruß.
Als Pedlow wieder zu sich kam, trat Guthrie mit dem Stiefelabsatz auf seine Kehle und flüsterte warnend: »Es würde mein Gewissen nicht belasten, dir den Hals zu brechen, du gemeiner Hund – also gib mir nicht mehr Grund dazu, als ich ohnehin schon habe.«
Der Yankee gab ein klägliches Geräusch von sich, und Guthrie zerriss sein gelbes Halstuch und knebelte und fesselte Pedlow damit.
Danach marschierte er dreist in die Baracken und weckte Jacob und ein halbes Dutzend anderer Männer, die er für kräftig genug hielt, die Flucht zu überstehen. Als er die Männer aus dem Südtor führte, musste es für jeden Beobachter so aussehen, als begleitete ein Sergeant der Union einen Trupp Gefangener zur Arbeit außerhalb des Lagers.
Obwohl Guthrie und den anderen die Flucht in Wirklichkeit gelungen war, wurde er an dieser Stelle seines Traums immer ins Lager zurückgeschleppt und auf die gleiche Weise gebrandmarkt wie sein Freund Jacob. Die Erfahrung war so realistisch, dass Guthrie mit einem Schrei erwachte, sich aufrichtete und mit wilden Blicken um sich schaute. Tob, der zusammengerollt an seinen Füßen lag, stieß ein leises, mitleidiges Winseln aus.
Guthrie war schweißgebadet. In der Dunkelheit tastete er nach seinem Revolver und umschloss ihn mit zitternder Hand. Er brauchte fast fünf Minuten, um aus dem Damals in das Jetzt zurückzukehren und wieder in einen unruhigen Schlaf zu sinken.
Eine ohrenbetäubende Explosion erschütterte das Schulhaus. Molly Haggart, ein sechsjähriges Mädchen mit schwarzen Zöpfen und kornblumenblauen Augen, sprang erschrocken auf. »Miss Caroline, war das ein Erdschweben?«
Auch Carolines Herz hatte vor Schreck einen Schlag ausgesetzt. »Nein, Molly«, sagte sie laut, damit sie über dem nervösen Kichern der anderen Kinder gehört wurde. »Das war Dynamit. Und das richtige Wort ist Erdbeben.«
»Vielleicht hat jemand die Bank ausgeraubt!«, rief Johnny Wilbin aufgeregt.
»Oder die alte Maitland-Mine ist eingestürzt«, warf Pervis Thatcher ein.
Miss Phoebes und Miss Ethels ererbte Kohlenmine war seit fünf Jahren geschlossen, aber zu ihrer Zeit hatte sie genug Ertrag gebracht, um den alten Damen für den Rest ihrer Tage ein bequemes Leben zu ermöglichen.
»Psst, Kinder«, sage Caroline streng. »Wenn es etwas war, was wir wissen müssen, wird jemand kommen und es uns sagen.«
»Es ist nur Mr. Hayes in seiner Kupfermine«, erklärte Martin Bates, der Junge, der Caroline von Guthrie Hayes’ Eskapaden während des Krieges erzählt und voller Stolz behauptet hatte, Guthrie sei ein guter Freund seines Vaters. »Man kann keine Mine ausbeuten, ohne Dynamit anzuwenden. Mr. Hayes’ Mine liegt unten am Ribbon Creek.«
In Gedanken notierte Caroline sich diese wichtige Information und setzte gelassen ihren Unterricht fort. Danach jedoch, als die Kinder fort waren und sie das Klassenzimmer aufgeräumt und gefegt hatte, eilte sie zum Mietstall und ließ sich ein Pferd und einen kleinen Buggy geben.
Es war halb fünf Uhr nachmittags, als sie Mr. Hayes’ Lager fand. Wütende Hühner stoben gackernd auseinander, und Tob kam bellend auf sie zu gerannt, als Caroline den Wagen abstellte und sich suchend umsah.
Guthrie Hayes war nicht in seiner Mine, wie sie angenommen hatte, sondern stand im Unterhemd vor seinem Waschzuber, die Arme bis zu den Ellbogen im Seifenschaum. Caroline sah ihn an seiner Augenklappe herumzupfen, dann kam er langsamen Schrittes auf sie zu.