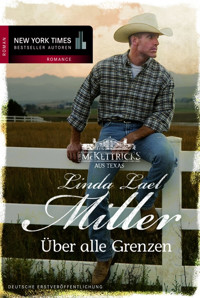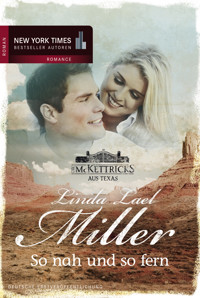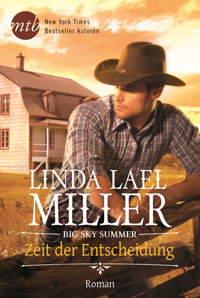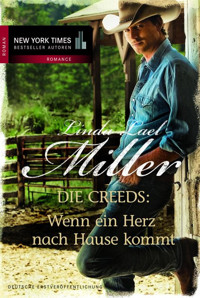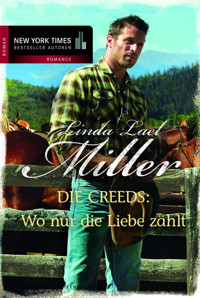6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Orphan-Train-Trilogie - Historical Romance
- Sprache: Deutsch
Er wird vom Gesetz verfolgt. Sie ist die Tugend in Person - bis sie auf ihn trifft ...
Idaho, 1878. Emma Chalmers ist die wohl sittsamste Frau im Örtchen Whitneyville - trotz ihrer ungewöhnlichen Kindheit in einem Bordell. Doch mit der Ankunft von Steven Fairfax gerät das Blut der biederen Bibliothekarin in Wallung. Der gutaussehende Fremde ist bei einer Explosion in einem Saloon verletzt worden und erholt sich nun im Haus von Emmas Ziehmutter Chloe. Schnell kommen sich die beiden näher, bis Emma sich schließlich ganz der Leidenschaft ergibt. Doch über ihrem jungen Glück ziehen dunkle Wolken auf: Der rebellische Steven ist auf der Flucht, und seine Vergangenheit droht, ihn einzuholen ...
Band 3: Die Chalmers-Schwestern - Caroline und der Bandit.
Weitere historische Liebesroman-Reihen von Linda Lael Miller bei beHEARTBEAT:
Die McKettrick-Cowboys-Trilogie. Die Corbin-Saga. Springwater - Im Westen wartet die Liebe. Die McKenna-Brüder.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Die Orphan-Train-Trilogie
Band 1: Die Chalmers-Schwestern: Lily und der Major
Band 3: Die Chalmers-Schwestern: Caroline und der Bandit
Die McKenna-Brüder
Band 1: Wie der Glanz des silbernen Mondes
Band 2: Wie das helle Feuer der Sterne
Die McKettrick-Saga
Band 1: Frei wie der Wind
Band 2: Weit wie der Himmel
Band 3: Wild wie ein Mustang
Die Corbin-Saga
Band 1: Paradies der Liebe
Band 2: Zauber der Herzen
Band 3: Lächeln des Glücks
Springwater – Im Westen wartet die Liebe
Band 1: Wo das Glück dich erwählt
Band 2: Wo Träume dich verführen
Band 3: Wo Küsse dich bedecken
Band 4: Wo Hoffnung dich wärmt
Über dieses Buch
Er wird vom Gesetz verfolgt. Sie ist die Tugend in Person – bis sie auf ihn trifft …
Idaho, 1878. Emma Chalmers ist die wohl sittsamste Frau im Örtchen Whitneyville – trotz ihrer ungewöhnlichen Kindheit in einem Bordell. Doch mit der Ankunft von Steven Fairfax gerät das Blut der biederen Bibliothekarin in Wallung. Der gutaussehende Fremde ist bei einer Explosion in einem Saloon verletzt worden und erholt sich nun im Haus von Emmas Ziehmutter Chloe. Schnell kommen sich die beiden näher, bis Emma sich schließlich ganz der Leidenschaft ergibt. Doch über ihrem jungen Glück ziehen dunkle Wolken auf: Der rebellische Steven ist auf der Flucht, und seine Vergangenheit droht, ihn einzuholen …
Über die Autorin
Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/
Linda Lael Miller
Die Chalmers-Schwestern: Emma und der Rebell
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Braun
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1991 by Linda Lael Miller
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Emma and the Outlaw«
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1992/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Katharina Woicke
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © Aleta Rafton
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7901-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Beaver Crossing, Nebraska10. Dezember 1865
Emma Chalmers stand zwischen den anderen Waisenkindern in der beißenden Kälte auf dem Bahnsteig und wappnete sich gegen die Aussicht, von Lily getrennt zu werden. Die Kleine, die mit sechs ein Jahr jünger war als Emma, klammerte sich an die Röcke ihrer Schwester, die braunen Augen ganz groß vor Angst. Caroline, ihre älteste Schwester, war schon bei einem Halt in Lincoln adoptiert worden, und Lily war damit alles, was Emma noch geblieben war, außer der kleinen Fotografie von ihnen allen, die in ihrer Kitteltasche steckte.
Die hagere kleine Frau, die ihnen gegenüberstand, musterte Emma von Kopf bis Fuß, dann sagte sie zu dem Zugführer: »Ich nehme die kleine Rothaarige hier.«
Vor Schreck brachte Emma kein Wort heraus, ihr Arm schloss sich schützend um Lilys schmale Schultern. »Nehmen Sie meine Schwester auch«, flehte sie. »Bitte, Madam – ich kann Lily nicht allein weiterfahren lassen.«
Die Frau schnalzte verächtlich mit der Zunge. »Ich kann froh sein, wenn ich ein Mädchen bekomme, das mir bei der Hausarbeit hilft«, erwiderte sie. »Mr. Carver würde mir ein blaues Auge schlagen, wenn ich gleich zwei nach Hause brächte.«
Daraufhin hob der Zugführer Lily hoch und trug sie – obwohl sie wie wild strampelte und schrie – von Emma fort und in den Zug. Die Trennung war so brutal, dass Emma sich für einen Moment nicht rühren konnte. Lily war doch noch so klein. Wer würde sich nun um sie kümmern? Wer würde sie vor den frechen Waisenjungen schützen, die sich ein Vergnügen daraus machten, Lily zu ärgern?
Emma rührte sich nicht; sie stand wie angewurzelt auf dem Bahnsteig. Tränen der Verzweiflung in den blauen Augen. Sie wollte protestieren, wollte schreien, so laut sie konnte, aber sie ahnte, dass diese Mrs. Carver sie schlagen würde, falls sie es tat.
»Komm jetzt! Mr. Carver ist im Saloon, und er wird wütend, wenn man ihn warten lässt«, sagte die fremde Frau, die ein verwaschenes Kattunkleid trug, einen zerdrückten Hut und einen Umhang, der aussah, als stammte er vom Trödler. »Ich würde dir nicht raten, Ben zu verärgern. Er wird sehr schnell zornig.«
Ein schriller Pfiff, und aus dem Schornstein der Lokomotive kam zischend Dampf heraus. Emma drehte sich um und versuchte, Lily an einem der Fenster des Passagierwagens zu sehen, aber sie konnte sie nirgendwo entdecken.
Mit hängenden Schultern folgte sie Mrs. Carver über die schneebedeckten, rutschigen Stufen, die vom Bahnsteig hinunterführten. Die eisige Kälte drang durch ihr dünnes Kleid und ihren Mantel, aber das spürte Emma nicht; sie fühlte nichts als den herzzerreißenden Schmerz, der ihr in seiner Intensität fast den Atem raubte.
»Haben Sie schon wieder ein Mädchen adoptiert, Molly?«
Emma schaute an Mrs. Carver vorbei und bemerkte eine elegant gekleidete Frau in einem grünen Samtumhang und einem federbesetzten Hut.
»Und wenn es so wäre, Chloe Reese?«, entgegnete Mrs. Carver schnippisch und schob sich vor Emma, als könnte sie das Mädchen so vor den Blicken der anderen verbergen.
Doch die schöne, elegante Frau griff an Mrs. Carver vorbei und strich Emma über das Haar, in dem sich die dicken Schneeflocken verfangen hatten. »So ein hübsches kleines Mädchen.«
»Sie sieht jedenfalls kräftig genug aus, um zu arbeiten«, versetzte Molly mürrisch.
Wieder ertönte ein schriller Pfiff, und der Ton schnitt wie ein Messer in Emmas Herz. Sie drehte sich noch einmal um, und diesmal sah sie Lilys blasses Gesicht an einem der Fenster. Das kleine Mädchen presste die Nase gegen die schmutzige Scheibe und hielt verzweifelt Ausschau nach Emma.
»Die arme kleine Alice, die du dir beim letzten Mal geholt hast, hast du anscheinend schon verbraucht«, sagte Miss Reese in vorwurfsvollem Ton, während sie ihre Handtasche öffnete. Molly Carver erwiderte nichts darauf, aber Emma sah, dass sie beide Hände zu Fäusten ballte. »Nimm sie nicht mit nach Hause, Molly«, fuhr Chloe etwas sanfter fort. »Du weißt doch, was Benjamin ihr antun wird!«
Emma hatte das Gefühl, dass eine kalte Hand über ihren Rücken strich. Schaudernd dachte sie an den Soldaten, der bei ihrer Mutter wohnte und wie er sie immer auf dem Schoß hatte halten wollen, wenn keiner in der Nähe gewesen war. Emma spürte, dass etwas Wichtiges vorging zwischen diesen beiden fremden Frauen, die so verschieden voneinander waren.
Emma riss erstaunt die Augen auf, als sie Miss Reese einen Geldschein aus ihrer mit Goldborten besetzten Tasche nehmen sah. »Hier, Molly. Nimm das und sag deinem Mann, es wären diesmal keine guten Waisenkinder dabei gewesen.«
Mollys Hand zitterte, als sie nach dem Geld griff. »Willst du eine Hure aus ihr machen?«
Emma hielt den Atem an. Sie hatte gehört, wie ihre Mutter von einigen Männern so bezeichnet wurde, obwohl sie alle Kathleen doch recht gern zu haben schienen. Sie wusste, dass das Wort etwas Schlechtes zu bedeuten hatte.
Chloe Reeses smaragdgrüne Augen glitten prüfend über Emmas kleine Gestalt, und sie lächelte sanft. »Ich glaube nicht«, sagte sie leise. »Eigentlich habe ich mir schon immer ein kleines Mädchen für mich selbst gewünscht.«
Mollys abgetragene Schuhe knirschten auf dem Schnee, als sie sich, Chloes Geld in der Hand, zum Gehen wandte.
»Komm jetzt«, forderte Chloe Emma freundlich auf. »Wir werden zusehen, dass du etwas zu essen und etwas Anständiges zum Anziehen bekommst. Ich bin überzeugt, dass du ein sehr hübsches Mädchen sein wirst, wenn wir dich umgezogen und gekämmt haben.«
Hinter ihnen setzte sich der Zug ratternd in Bewegung.
Mit Tränen in den Augen blieb Emma stehen, um ihrer Schwester zuzuwinken. Lily, die sie endlich unter den vielen Menschen entdeckt hatte, winkte zurück.
»War das deine Freundin?«, fragte Chloe, als sie Emma zu einem hübschen zweisitzigen Wagen führte.
Emma konnte nichts erwidern. Ihre Kehle war wie zugeschnürt angesichts des schrecklichen Verlusts, den sie erlitten hatte. Zuerst Caroline, und nun Lily. Sicher musste Lily schon wieder – sie hatte die peinliche Angewohnheit, immer im unpassendsten Moment auf die Toilette zu müssen –, und diese ungezogenen Bengel im Zug würden sie dann wieder ärgern.
»Sei nicht traurig«, sagte Chloe, die selbst an diesem kalten Dezembertag einen angenehmen Blumenduft um sich verbreitete. »Du wirst andere Freundinnen finden, wenn wir in Whitneyville sind. Es liegt in Idaho, meine Kleine.«
Emma saß verwirrt und fröstelnd neben ihrer Wohltäterin im Wagen und hoffte inbrünstig, dass sich irgendjemand irgendwo um Lily kümmern würde. Sie war doch noch so klein und bisher noch nie allein gewesen ...
»Sehr gesprächig bist du nicht«, bemerkte Chloe, als sie die Zügel auf den Pferderücken klatschen ließ und das Tier sich in Bewegung setzte.
Traurig dachte Emma an die unzähligen Gelegenheiten, bei denen Mama sie auf den Mund geschlagen hatte, weil sie zu viel geredet hatte. »Nein, Madam«, erwiderte sie, ihre Stimme rau vor ungeweinten Tränen. »Grandma sagte immer, ich könnte sogar eine Vogelscheuche aus der Ruhe bringen.«
Chloe lachte schallend, was nicht sehr damenhaft klang, aber Emma hatte längst erraten, dass Chloe keine Dame war. »Du hattest also eine Großmutter? Wieso warst du dann im Waisenkinderzug, wenn du Familie hast?«
Die Frage schmerzte. Emma straffte ihre Schultern und fuhr sich mit dem Mantelärmel über Augen und Nase. »Grandma starb im letzten Winter. Danach lernte Mama einen Soldaten kennen, und der wollte uns nicht. Er verlangte von ihr, dass sie uns in den Zug setzte, und das hat sie getan.«
Chloe bemühte sich, ihr Mitleid zu verbergen, was sie in Emmas Augen noch viel sympathischer machte. »Uns?«, wiederholte sie leise. »Wie viele von euch waren denn auf dem Zug?«
»Drei«, antwortete Emma verzagt. »Caroline wurde gestern adoptiert, in Lincoln. Lily ist noch im Zug.«
»Ist Lily älter als du?«
Emma schüttelte den Kopf. »Lily ist erst sechs, und ich bin sieben.« Nervös suchte sie den Zettel, den die Frau in dem Waisenhaus in Chicago an ihren Mantel geheftet hatte und auf dem die Nummer Zweiunddreißig stand. Emma riss ihn ab, zerknüllte ihn und warf ihn in den schmutzigen Schnee am Straßenrand.
»Lieber Gott«, murmelte Chloe, mehr zu sich selbst, als zu Emma. »Was müssen das für Leute sein, die kleine Kinder in den Westen schicken, damit sie Männern wie Benjamin Carver zum Opfer fallen?«
Emma schwieg, weil sie wusste, dass keine Antwort von ihr erwartet wurde – sie hätte auch keine darauf gehabt. Sie konnte nun wieder den Zug in der Ferne rattern hören und hätte am liebsten laut geschrien.
Die Geschäfte der betriebsamen Prärieansiedlung befanden sich alle auf einer Seite der schlammigen schmalen Straße, die durch Beaver Crossing führte. Im Vorbeifahren betrachtete Emma die ausgestellten Waren, die Hüte und Kleider, aber in Wirklichkeit schaute sie durch sie hindurch und sah nur ein kleines Mädchen mit blondem Haar und großen, ängstlichen Augen, das ganz allein in einem Zug nach Westen saß.
»Es wird ihr nichts passieren«, sagte Chloe beruhigend und nahm die Zügel in eine Hand, um Emma die andere auf die Schulter zu legen. »Der Herrgott passt auf die Kinder auf. Hat er nicht auch dafür gesorgt, dass ich zufällig am Bahnhof war, um eines meiner Mädchen zu verabschieden, als du ankamst?«
Emma konnte weder Chloes Logik folgen noch der des Herrgotts, aber sie schaute ihre Wohltäterin mit argwöhnischem Interesse an. »Haben Sie noch andere Mädchen außer mir?«
Chloe lächelte und brachte den Buggy vor einem großen Haus zum Halten. Die Worte auf dem vergoldeten Schild über der Tür konnte Emma nicht lesen, aber sie war ein Mädchen aus der Stadt und erriet, dass es sich um ein Hotel handeln musste. »Ja, ich habe noch andere Mädchen«, antwortete Chloe. »Aber sie sind nicht meine Töchter, wie du es von jetzt an sein wirst.« Dann brach sie ab. »Du lieber Himmel, ich weiß ja nicht einmal, wie du heißt!«
»Emma«, sagte das kleine Mädchen höflich. »Emma Chalmers.«
Chloe reichte ihr eine behandschuhte Hand. »Ich freue mich, dich kennenzulernen, Emma Chalmers. Ich bin Chloe Reese, falls du es vorhin nicht gehört haben solltest.« Sie befestigte die Zügel geschickt an der Bremsvorrichtung des Buggys, raffte mit einer Hand ihre Röcke und ihren Umhang und kletterte vom Wagen. »Komm, Emma. Du bist viel zu dünn. Es wird Zeit, dass du etwas Gutes zu essen bekommt.«
Emmas Kehle war wie zugeschnürt, sie wusste, dass sie nichts herunterbringen würde beim Gedanken, dass Lily den ganzen Tag nichts anderes zu essen und zu trinken bekam, als einen verschrumpelten Apfel und ein Glas kalten Tee. »Ich ... ich habe keinen Hunger«, flüsterte sie, als sie vom Buggy kletterte und auf die Straße trat.
Ihre Retterin berührte Emmas kalte Wange. »Du möchtest deine Schwestern bestimmt gern wiederfinden?«
Emma nickte. »O ja, Madam. Ich habe Caroline versprochen, mich an alles Wichtige zu erinnern ...«
»Und dafür musst du gesund und kräftig bleiben, nicht wahr?«, fuhr Chloe lächelnd fort.
Emma dachte über ihre Worte nach, dann schluckte sie und nickte zustimmend. Sie konnte Lilys Los nicht erleichtern, indem sie selbst hungerte. »Ja, Madam«, sagte sie leise.
Chloe führte sie in das Hotel, und kurz darauf saßen sie an einem Tisch, der mit einem schneeweißen Tuch gedeckt war. Chloe zog ihre Handschuhe aus, legte sie beiseite und lächelte Emma an. »So, und jetzt sag mir, was du am liebsten tust.«
Ein köstlicher Duft drang aus der Küche, als eine Frau mit einem Block und einem Stift in der Hand an ihren Tisch trat. Und da wurde Emma erst bewusst, wie hungrig sie war.
»Essen«, beantwortete sie Chloes Frage eifrig.
Chloe lachte. »Und was sonst noch? Zeichnest du? Oder reitest du gern?«
Emma schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht viel – außer fegen und singen und auf Lily aufpassen, damit ihr nichts geschieht.«
Ein trauriger Ausdruck huschte über Chloes hübsches Gesicht, aber das Bestellen lenkte sie für einen Moment ab. Sie forderte die Kellnerin auf, zweimal Hühnchen zu bringen, Kaffee für sie selbst und ein großes Glas Milch für Emma.
Als das Essen kam, konnte Emma es lange Zeit nur stumm anstarren und daran denken, wie Lilys braune Augen beim Anblick einer solchen Festmahlzeit aufgeleuchtet hätten. Und Caroline hätte sich bestimmt mit ihnen um die Schenkel gestritten …
Emmas Hand zitterte, als sie die Gabel in die Hand nahm. Ihre Mutter und den Soldaten vermisste sie nicht, aber was sollte sie ohne ihre Schwestern tun?
1
Whitneyville, Idaho, 15. April 1878
Das schrille Pfeifen des Zugs vergrößerte Emmas Verzweiflung noch, als sie bei den letzten Zeilen von Anna Karenina angekommen war, und mit Tränen in den Augen klappte sie das Buch zu. Dann trocknete sie hastig ihre Tränen und strich den Rock ihres braunen Satinkleids glatt.
Einen Stapel frischbedruckter Plakate unter dem Arm, ging sie zur Tür. Die Leihbücherei war leer, aber Emma machte sich nicht die Mühe abzuschließen, denn niemand, den sie kannte, wäre so tief gesunken, ein Buch zu stehlen.
Für einen kurzen Moment sah sie ihre schlanke Silhouette im blitzsauberen Fenster des Krämerladens, dann beschleunigte sie ihren Schritt, weil sie die Erfahrung gemacht hatte, dass einige der Zugführer und Postkutschenfahrer ihr aus dem Weg gingen, wenn sie es konnten.
Als sie am Yellow Belly Saloon mit der schiefen Veranda und dem abblätternden Fassadenanstrich vorbeikam, drang der aufdringliche Geruch von Whiskey, Bier und Schweiß zu ihr hinaus. Emma ging noch schneller und stürmte schließlich recht undamenhaft mit großen Schritten und gerafften Röcken über die schmutzige Straße.
Der Bahnhofsvorplatz war mit ankommenden und abreisenden Passagieren überfüllt. Schweine, Pferde und Hühner in Kisten warteten darauf, in den Zug verfrachtet zu werden.
So unauffällig wie möglich drängte Emma sich durch die Menschen und hielt mit geübtem Auge Ausschau nach dem Zugführer. Ein korpulenter Mann mit gerötetem Gesicht und vollem weißem Haar stand halb verborgen hinter einer Ladung Konservendosen, die für Whitneyvilles Kolonialwarenladen bestimmt waren.
Emma näherte sich ihm und räusperte sich. »Einen schönen guten Tag, Mr. Lathrop«, begann sie höflich.
Der Mann nickte ihr zu. »Miss Emma.« Seine braunen Augen blickten freundlich und eine Spur bedauernd. »Ich fürchte, heute habe ich keine Nachricht für Sie. Es sieht fast so aus, als gäbe es keinen Menschen in diesem Teil des Landes, der etwas über ihre Schwestern weiß.«
Obwohl sie mit dieser Antwort gerechnet hatte – seit fast vierzehn Jahren bekam sie keine andere – wurde Emma für einen Moment von tiefster Niedergeschlagenheit erfasst. »Wenn Sie bitte trotzdem auf jeder Station einen dieser Zettel aufhängen würden …«
Mr. Lathrop nahm eines der bedruckten Blätter und betrachtete es prüfend.
BELOHNUNG! 500 DOLLAR IN BAR!Für jede Information, die dazu beitragen könnteMISS CAROLINE CHALMERS(dunkle Augen, dunkles Haar)undMISS LILY CHALMERS(braune Augen, blondes Haar)zu finden.Bitte setzen Sie sich mit MISS EMMA CHALMERSbei der Whitneyville Lending Library in Whitneyville,Idaho, in Verbindung.
»Vielleicht hätte ich noch ›Danke‹ daruntersetzen sollen«, bemerkte Emma besorgt, als sie über Mr. Lathrops breite Schulter hinweg noch einmal ihre Nachricht las.
Der Zugführer lächelte. »Es kommt klar genug zum Ausdruck, dass Sie für jede Hilfe dankbar wären, Miss Emma.«
»Manchmal kommt es mir so sinnlos vor, so hoffnungslos«, erwiderte sie seufzend. »Genau wie der Schluss von Anna Karenina. Haben Sie das Buch gelesen, Mr. Lathrop?«
»Nicht, dass ich wüsste, Miss Emma«, erwiderte er verblüfft. »Wissen Sie, wenn man sein Leben auf den Eisenbahnschienen verbringt, kommt man nicht zum Lesen.«
Emma nickte. »Das kann ich mir vorstellen. Die Fahrtgeräusche müssen doch sehr störend sein.«
Es war Mr. Lathrops Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Tiere und Menschen ihre Plätze in seinem Zug fanden. Deshalb verließ er Emma, nachdem er sich freundlich von ihr verabschiedet hatte. Jedes Weihnachten schenkte Emma ihm ein Paar selbstgestrickte Socken und eine Schachtel Walnusspralinen, aber jetzt fragte sie sich, ob das eine ausreichende Belohnung für einen Mann sein mochte, der sich mit solcher Beharrlichkeit bemühte, ihr zu helfen.
Sie blieb noch eine Weile stehen und betrachtete die ein- und aussteigenden Passagiere, denn die Hoffnung, einmal eine ihrer Schwestern unter ihnen zu erblicken, hatte sie nie ganz aufgegeben. Als sie schließlich enttäuscht weiterging, wäre sie fast gegen eine Rampe gelaufen – und gegen den Mann und das Pferd, die die Rampe hinunterkamen.
Mit einem erschrockenen Ausruf sprang Emma zurück, und der Mann im Sattel tippte lächelnd an den Rand seines ausgebeulten Huts. Er sah aus wie ein heruntergekommener Cowboy, nichts an ihm erinnerte an einen Gentleman, und doch verspürte Emma ein gar nicht unangenehmes Prickeln im Magen, als sie den Blick des Mannes erwiderte.
»Passen Sie doch auf!«, sagte sie entrüstet.
Mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung zügelte der Mann das nervöse Pferd und führte es auf die schlammbedeckte Straße. Er schien es amüsant zu finden, dass Emma Anstoß an seinem Verhalten genommen hatte, denn er grinste sie frech an. Strahlend weiße Zähne blitzten in einem sonnengebräunten, stoppelbärtigen Gesicht.
Dann machte er eine angedeutete Verbeugung vor ihr. »Ich bitte vielmals um Verzeihung, Mylady«, sagte er spöttisch, bevor er lachend weiterritt.
Emma strich sich übers Haar, raffte seufzend ihre Röcke und machte sich auf den Heimweg. Anscheinend bemühte sich heutzutage niemand mehr um gute Manieren!
Weil irgendetwas an diesem Reiter sie verstört hatte, zwang Emma sich, wieder an ihre Schwestern und die Suche nach ihnen zu denken. Selbst wenn ich Caroline oder Lily einmal gegenüberstehen sollte, überlegte sie bedrückt, würde ich sie vielleicht nicht mehr erkennen. Menschen veränderten sich in dreizehn Jahren. Beide Schwestern würden heute erwachsene Frauen sein ...
Emmas Stimmung wurde erst wieder etwas fröhlicher, als sie an der First Territorial Bank vorbeikam und durch das Fenster Fulton Whitney sah, der seit einiger Zeit beabsichtigte, ihr Mann zu werden. Er war groß, blond und sah gut aus in seinem dreiteiligen grauen Nadelstreifenanzug und dem blütenweißen Hemd.
Als Emma ihm zuwinkte, lächelte er abwesend, und sie ging weiter, weil sie wusste, dass Fulton es missbilligen würde, wenn sie die Bank betrat, um mit ihm zu sprechen. Geschäft ist Geschäft, pflegte er zu sagen, und Emma gehöre zu einem anderen Teil seines Lebens.
Im Weitergehen runzelte sie die Stirn. Wie oft kam sie sich bei Fulton wie ein Strohhut vor, der für den Winter in den Schrank verbannt worden war, und es beunruhigte sie, dass ihr Herz nie schneller schlug, wenn sie ihn sah.
Sie schaute sich nach beiden Seiten um, raffte ihre Röcke und überquerte die Straße, um nicht wieder am Yellow Belly Saloon vorbeigehen zu müssen. Es war viel angenehmer, das glitzernde blaue Wasser des Crystal Lake zu betrachten, der kaum einen Steinwurf weit von der Hauptstraße entfernt begann.
Fulton war der festen Überzeugung, dass dieser große schöne See Whitneyville eine glänzende Zukunft als Ferienort sicherte, und er hatte sein Geld entsprechend investiert. Aus dem gleichen Grund hatte auch Chloe sich für diese Stadt entschieden.
Als Emma die Leihbücherei betrat, hörte sie fröhliche Musik aus dem Stardust Saloon. Wie üblich war die Bücherei leer. Emma stellte gerade Anna Karenina ins Regal zurück, als eine gewaltige Explosion die Wände erschütterte und die Glasscheiben in den Fenstern klirren ließ.
Mit aufgeregt klopfendem Herzen lief sie zur Tür, um zu sehen, was passiert war. Eine derartige Explosion konnte nur das Ende der Welt bedeuten. Fast erwartete Emma, den Herrgott und seine Engel auf einer Wolke herabschweben zu sehen, um das Jüngste Gericht abzuhalten, und sie fragte sich entsetzt, ob sie in den Himmel kommen würde oder in der Hölle brennen musste.
Aber keine Wolke war zu sehen, vom Herrgott keine Spur, was Emma sehr erleichterte. Denn manche behaupteten, dass sie eine Sünderin war wie Chloe, und für Sünder gab es bekanntlich keinen Platz im Himmel.
Menschen rannten über die Straße, erregte Schreie durchschnitten die Luft. Die Feuerglocke bimmelte, und Emma nahm den beißenden Geruch von Rauch wahr.
Sie war noch keine drei Schritte weit gegangen, als sie sah, dass der Yellow Belly Saloon nur noch eine Ruine war. Die Vorderseite des Gebäudes war ganz verschwunden, und im Inneren des Saloons hingen Männer reglos über ihren Tischen – wie Puppen in einem Puppenhaus. Und das Feuer, das sich mit jedem Augenblick noch mehr auszubreiten schien!
Trotz der wie wild bimmelnden Glocke war der Wagen der Feuerwehr nirgendwo zu sehen. Vorsichtig näherte Emma sich dem Schauplatz der Tragödie, an dem einige Männer bereits damit beschäftigt waren, Verwundete herauszuschleppen.
»Zurück!«, schrie Doc Waverley, der für seine Ungeduld bekannt war. »Verdammt, lass diesen armen Kerlen Luft zum Atmen!«
Emma errötete, rührte sich jedoch nicht vom Fleck, als könne sie den Verletzten schon allein durch ihre Anwesenheit helfen. Und da kamen auch schon Chloe und ihre Mädchen mit flatternden Satinröcken aus dem Stardust Saloon gerannt.
»Was ist passiert, Doc?«, wollte Ethan Peters, der Herausgeber des Whitneyville Orator, wissen.
»Keine Ahnung«, brummte der alte Mann, der fast seit den Gründerjahren der Arzt in Whitneyville war. »Stehen Sie uns nicht im Weg. Sobald jemand weiß, was geschehen ist, werden Sie es schon erfahren.«
Emma biss sich auf die Lippen, als einige der Männer in den Stardust Saloon getragen wurden. Sie hätte gern geholfen, aber auch heute noch, mit zwanzig Jahren, wagte Emma Chloes Anordnung, dass sie den Saloon unter gar keinen Umständen betreten dürfe, nicht zu brechen.
So wartete sie auf dem Bürgersteig, bis die erste Aufregung abgeklungen und das Feuer gelöscht war. Dann ging sie in die Bücherei zurück, wo sie bis zum Öffnungsschluss blieb. Sie listete Bücher auf und las ein paar Seiten aus Little Women, wann immer sie Zeit dazu fand. Die Leute kamen und gingen den ganzen Nachmittag lang, aber keiner schien mehr über die Tragödie im Yellow Belly Saloon zu wissen als sie selbst.
Um Punkt fünf schloss sie die Bibliothek ab und ging nach Hause. Der einzige Mensch außer dem Arzt, der Bescheid wissen musste, war Chloe.
Ein feiner Schweißfilm bedeckte Steven Fairfax’ Körper, als er zu sich kam. Er sah eine Wand mit einer geblümten Tapete und ein Fenster mit weißen Spitzenvorhängen. Er versuchte, sich aufzurichten, aber der Schmerz, der ihm wie eine gewaltige Faust den Brustkasten zusammenpresste, hinderte ihn daran.
Mit einem gemurmelten Fluch sank Steven zurück und tastete an seiner Hüfte nach dem 45er Colt, den er immer bei sich trug. Aber jetzt war er fort, zusammen mit dem Halfter und der Patronentasche.
Er wollte laut dagegen protestieren, aber er beherrschte sich, denn noch wusste er nicht, wo er sich befand und was ihm zugestoßen war. Und die Möglichkeit, dass Macon, sein Halbbruder, ihn doch endlich gefunden hatte, war nicht auszuschließen.
Keuchend vor Schmerz und Anstrengung begann er nachzudenken, und ganz langsam kamen ihm die Ereignisse des Tages wieder in Erinnerung.
Er war mit dem Zug in die Stadt gekommen, hatte sein Pferd im Mietstall untergebracht und sich auf die Suche nach einem Ort gemacht, wo er etwas trinken und sich vom Reisestaub befreien konnte. Weil ihm der Name gefiel, hatte er dieses hässliche Loch namens Yellow Belly Saloon aufgesucht, obwohl der Stardust Saloon sehr viel einladender gewirkt hatte. Aber für einen Besuch dort war er sich zu schmutzig vorgekommen.
Er hatte Whiskey bestellt und allein an einem Tisch Platz genommen, seiner Regel getreu, immer mit dem Rücken an der Wand zu sitzen, damit sich niemand von hinten anschleichen konnte. Diese Lektion hatte er im Krieg gelernt, und er war damit bis jetzt immer bestens gefahren.
Steven hatte erst ein, zwei Schluck von seinem Whiskey getrunken, als ein Betrunkener grölend durch den Hintereingang kam. Niemand, nicht einmal Steven, hatte ihm große Beachtung geschenkt.
Erst als der Mann auf einen Tisch stieg und ein Geburtstagslied zu singen begann, wurde Steven aufmerksam und sah, dass der Kerl eine Stange Dynamit in der Hand hielt. »Heute ist mein Geburtstag«, hatte er verkündet und dann zur Bestürzung aller Anwesenden ein Streichholz an seinem Stiefel angezündet und es an die Lunte gehalten. Als die Männer in seiner Nähe reagierten und sich auf ihn stürzten, pustete er grinsend auf die Flamme, als handelte es sich um eine Kerze auf einem Geburtstagskuchen.
Einem der Männer gelang es, ihm das Dynamit zu entreißen und es fortzuschleudern, aber an mehr als das und die ohrenbetäubende Explosion, die folgte, erinnerte sich Steven nicht.
Er musste dringend herausfinden, wo er war.
»Hallo?«, rief er probeweise. »Ist jemand da?«
Niemand antwortete auf seinen Ruf, und Steven versuchte, sich auf die Seite zu drehen, um besser sehen zu können. Aber der Schmerz war zu groß und zwang ihn wieder auf den Rücken.
Er kämpfte gerade gegen eine drohende Ohnmacht an, als sich die Tür öffnete und ein Fremder eintrat. Unter anderen Umständen hätte Steven seinen Colt gezogen, aber so tastete seine Hand nur hilflos über das Bett.
»Beruhigen Sie sich, mein Junge«, sagte der alte Mann, und jetzt sah Steven, dass er eine Arzttasche trug. »Ich bin hier, um Ihnen zu helfen.«
»Wo ist mein 45er?«, keuchte Steven.
Der Arzt zuckte mit den Schultern. »Vermutlich da, wo Chloe alle Waffen aufbewahrt«, antwortete er. »Sie brauchen ihn hier nicht. Wie heißen Sie, mein Junge?«
Steven zerbrach sich den Kopf nach einem falschen Namen, aber es fiel ihm keiner ein. Sein Verstand war wie eingerostet. »Steven Fairfax«, sagte er schließlich. »Und ich bin kein Junge, verdammt. Ich habe im Krieg gekämpft, genau wie Sie wahrscheinlich.«
Seine gereizten Worte brachten den Arzt zum Lächeln. »Ich bin Dr. Waverly«, stellte er sich vor, »aber Sie können mich Doc nennen. Haben Sie starke Schmerzen?«
Steven maß ihn mit einem ärgerlichen Blick. »Gehen Sie zum Teufel, Sie verdammter Yankee – ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie besser gefühlt!« Der Arzt lachte nur. »Sparen Sie sich das Rebellengeschrei, Johnny. Der Krieg ist lange vorbei.« Er zog eine Spritze auf und hielt sie ins Licht. »Was bringt Sie nach Whitneyville?«
»Ich bin auf der Durchreise«, knurrte Steven. »Bleiben Sie mir mit der Nadel vom Leib!«
Wieder lächelte der Arzt. »Tut mir leid, Rebell, hier gebe ich die Befehle. Sie haben Glück, dass ich auf Ihrer Seite bin.«
Stevens Hemd war so zerfetzt, dass der Arzt keine Schwierigkeiten hatte, eine Stelle für den Einstich zu finden. Und Stevens Schmerzen erlaubten ihm keine Gegenwehr.
»Nur ein bisschen Morphium«, sagte Doc Waverly. »Wir müssen Sie drehen und Ihre Rippen verbinden, ganz zu schweigen von den anderen Wunden, die genäht werden müssen. Glauben Sie mir, es wird leichter sein, wenn Sie schlafen.«
Steven hatte das Gefühl zu schweben; das Morphium tat seine Wirkung. Eine Weile spürte er noch einen dumpfen Schmerz, dann war auch das vorbei.
Sein drogenbetäubtes Gehirn führte ihn in die Vergangenheit zurück, und er war plötzlich in Fairhaven in der Nähe von New Orleans im Haus seines Vaters, und er war wieder ein kleiner Junge.
Er und Maman saßen in einer Kutsche und bewunderten das prächtige weiße Haus aus der Entfernung. Es war von ausgedehnten Rasenflächen umgeben und hatte einen Brunnen, dessen sprudelndes Wasser im hellen Sonnenschein wie Diamanten funkelten.
»Eines Tages wirst du hier leben, wohin du gehörst«, sagte Maman mit ihrem melodischen französischen Akzent, und leichte Traurigkeit klang in ihrer Stimme mit. »Auch du wirst ein Fairfax sein und dich nicht mehr Dupris nennen müssen.«
In diesem Augenblick erfuhr Steven den ersten wirklichen Hunger seines Lebens, aber es war kein Hunger, der mit einem guten Essen befriedigt werden konnte. Er war geistiger Natur – fast so, als schaute man vom tiefsten Abgrund der Hölle zum Himmel auf.
Wie es Träume so an sich haben, fühlte sich Steven nun ganz unvermittelt an einen anderen Zeitpunkt versetzt, den Tag der Beerdigung seines Vaters. Er stand hinter dem hohen Eisenzaun und schaute zu, wie Beau Fairfax’ Sarg in ein steinernes Mausoleum getragen wurde. Sein Vater hatte Steven nie anerkannt, aber der alte Cyrus, Patriarch der aussterbenden Familie, sah ihn am Zaun stehen und kam zu ihm herüber.
»Bist du Moniques Junge?«, fragte er.
Damals war Steven schon sechzehn Jahre alt und besuchte das St. Matthews Internat für Jungen. »Ja, Sir«, antwortete er seinem Großvater.
»Es tat mir sehr leid, als ich hörte, dass Monique dem Fieber erlegen ist.«
Steven verhärtete sich gegen die Erinnerung daran. New Orleans war belagert von Unionstruppen, seine Mutter tot, und nichts war mehr wie früher. »Danke, Sir«, sagte er leise.
»Ich möchte, dass du mich nach Fairhaven begleitest. Dein Vater hat dich in seinem Testament bedacht.«
Steven schüttelte den Kopf. »Ich will nichts von ihm.«
»Hast du etwa vor, dich an den feindlichen Linien vorbeizustehlen und dich zu General Lee zu gesellen, mein Junge?«
Die Frage überraschte Steven, vielleicht, weil es genau das war, was er beabsichtigte. Während er noch zwischen Lüge und Wahrheit zögerte, erkannte Cyrus Fairfax, was er wissen wollte.
»Sei nicht albern, Steven. Überlass diesen Kampf denen, die ans Kämpfen gewöhnt sind.«
Steven war nicht übermäßig groß mit seinen ein Meter fünfundfünfzig, aber dafür kräftig und ein geschickter Fechter, seit zwei Jahren der anerkannte Champion seiner Schule. Nun strich er mit einer arroganten Geste sein halblanges braunes Haar zurück, und seine Augen funkelten mit dem Temperament, das seine französische Mutter ihm vererbt hatte. »Ich nehme es mit jedem Yankee auf!«, prahlte er.
Cyrus nickte schmunzelnd. »Ja, das glaubst du wahrscheinlich sogar. Aber sag mir doch, wenn die Blauröcke dir nicht willkommen sind in New Orleans, wie kommt es dann, dass du sie nicht längst davongejagt hast?«
Steven spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss. »Ich hätte es getan, wenn Pater O’Shay nicht immer nach dem Fechtunterricht die Degen weggeschlossen hätte.«
Cyrus lachte. »Komm mit nach Fairhaven«, wiederholte er. »Dort kannst du kämpfen, soviel du willst. Dein Halbbruder Macon wird dir sicher erst ein paarmal eine blutige Nase verpassen, aber du wirst schon mit ihm fertig werden, wenn du dir erst eine Strategie zurechtgelegt hast.« Er beugte sich über den Zaun, der sie voneinander trennte. »Macon ist hinterlistig, weißt du. Du solltest ihm nie den Rücken zukehren.«
Steven war so neugierig geworden, dass er am nächsten Tag ohne Widerrede einstieg, als eine Kutsche nach St. Matthew’s kam, um ihn abzuholen. Obwohl er sich einredete, er tue es nur, um seine Lateinstunde zu verpassen, war ihm insgeheim doch bewusst, dass es ihm nur darum ging, Fairhaven und seinen Halbbruder kennenzulernen.
Tatsächlich stellte sich bald heraus, dass Macon ein Halunke und ein Feigling war, der nicht einmal dagegen protestierte, dass die Yankees den großen Ballsaal in Fairhaven für ihre Kommandozentrale beschlagnahmten. Steven war danach nur noch zwei Monate geblieben. Dann nahm er das Pferd, das Cyrus ihm geschenkt hatte, stahl eine Yankeeuniform von der Wäscheleine und ritt davon.
Kaum war er außer Reichweite der feindlichen Belagerungstruppen, riss er sich die Uniform vom Körper, als verbrenne sie ihm die Haut, und zog seine eigenen Sachen an. Eine Woche später war er bereits Gefreiter in General Lees Armee ...
»Hören Sie mich, Mister? Können Sie mich hören?«
Steven kam allmählich wieder zu sich. Als er die Augen öffnete, erblickte er eine stark geschminkte, nicht mehr ganz junge Frau, die sich besorgt über ihn beugte. Sie hatte ein immer noch schönes Gesicht, doch ihr dichtes, aufgestecktes Haar hatte einen unnatürlichen Rotton.
»Du lieber Himmel, wahrscheinlich wäre Ihnen ein Bad lieber als alles andere«, sagte die Frau freundlich. »Aber der Arzt meinte, etwas zu essen wäre besser, deshalb habe ich Ihnen einen Teller von Daisys guter Hühnersuppe gebracht.«
Steven starrte verwirrt auf das Tablett in ihren Händen, dann blickte er sich um. Hier in diesem Zimmer war die Tapete anders. »Wo bin ich?«, fragte er scharf und richtete sich ein bisschen auf. Obwohl es nicht leicht war, war es ihm wenigstens nicht mehr unmöglich.
»In meinem Haus«, antwortete die Frau. »Ich bin Chloe Reese, und Doc sagte, Sie seien Steven Fairfax. Sie brauchen sich also nicht vorzustellen.«
»Das erleichtert mich ungemein«, bemerkte Steven mit mildem Spott. Sein Magen knurrte; er wollte essen.
Chloe lächelte. »Sie können ruhig ein bisschen freundlicher sein. Wenn meine Mädchen und ich nicht gewesen wären, lägen Sie jetzt in irgendeiner Scheune statt in diesem bequemen Bett.«
Steven nahm das Tablett und begann zu essen, und erst da bemerkte er, dass er einen Verband um Rippen und Bauch hatte und dass auch seine Arme verbunden waren. »Verdammt«, knurrte er und fragte sich, wie lange es dauern würde, bis er diese Stadt verlassen konnte. Vielleicht war Macon ihm schon hierher gefolgt.
»Wo ist meine Waffe?«, fragte er, und weil er gerade begonnen hatte zu essen, sprach er mit vollem Mund.
»Sie haben wahrhaftig nicht die Manieren, die man von einem Südstaatler erwarten könnte«, bemerkte Chloe. »Ich habe Ihren Colt unten eingeschlossen. Ich dulde keine Schießwaffen in meinem Haus.«
Während Steven weiter aß, dachte er nach. Er konnte Chloe nicht sagen, dass er in Gefahr war, denn dann hätte sie vielleicht erraten, dass er gesucht wurde, und wenn sich jemand die Plakate im Büro des Marshals ansah, hängten sie ihn vielleicht noch auf. Unglücklicherweise hatte er dem Arzt seinen richtigen Namen angegeben. »Wissen Sie, Madam«, sagte er vorsichtig, »ich bin ein Gesetzesvertreter, und deshalb brauche ich meine Waffe.«
»So?«, entgegnete Chloe. »Und wo ist Ihr Abzeichen?«
Steven dachte blitzschnell nach. Für einen Fairfax war er ein sehr schlechter Lügner. »Ich muss es bei der Explosion verloren haben.«
Chloe wirkte nicht überzeugt. »Ich lasse Sie trotzdem nicht mit der Waffe in der Hand hier im Bett liegen, Mr. Fairfax. Sie befinden sich in einem anständigen Haus.«
Steven hatte sein Dinner beendet, und Chloe stand auf, um ihm das Tablett abzunehmen. »Wie spät ist es?«, erkundigte er sich.
»Halb sieben Uhr abends«, antwortete sie kurz. Sie deutete auf einen Stuhl, wo die Reste von Stevens langem Trenchcoat lagen. »Was wir an Ihnen und in Ihrer Nähe gefunden haben, befindet sich in den Manteltaschen. Es war kein Dienstabzeichen dabei.«
Damit ging sie hinaus und schloss die Tür hinter sich.
Steven lag im flackernden Licht der Petroleumlampe und überlegte, wie er sich verteidigen konnte, falls Macon ihn in diesem Zimmer – und so hilflos – fand.
Fulton legte eine Hand auf Emmas Knie, aber sie schob sie fort.
»Du liebe Güte, Emma«, beschwerte Fulton sich, »wir sind fast verheiratet!«
»Aber eben nur fast«, entgegnete Emma steif und beugte sich wieder über ihre Stickarbeit. »Und wenn du deine Hände nicht bei dir behältst, kannst du gehen.«
Fulton stieß einen übertriebenen Seufzer aus. »Man sollte meinen, ein Mädchen, das im gleichen Haus lebt wie Chloe Reese, würde wenigstens etwas lernen.«
Emmas blaue Augen waren dunkel vor Ärger, als sie ihren Blick auf Fulton richtete. »Wie bitte, Fulton?«
»Nun ja, ich meinte bloß ...«
»Ich weiß, was du meintest, Fulton.«
»Ein Mann hat ein Recht auf einen Kuss, wenn er bereit ist, sich für den Rest seines Lebens an eine Frau zu binden!«
Emma musterte ihn aus schmalen Augen und dachte, dass er nicht der einzige war, der sich für sein ganzes Leben band. Aber bevor sie etwas sagen konnte, packte Fulton sie und presste seinen Mund auf ihre Lippen.
Emma wehrte sich verärgert und fragte sich, warum in den Romanen Küsse immer als etwas so Wunderbares beschrieben wurden. Als sie merkte, dass sie sich nicht befreien konnte, stach sie ihre Nadel Fulton in die Hand.
Er wich mit einem Aufschrei zurück und klatschte auf seine Hand, als hätte er dort einen Floh entdeckt. »Verfluchtes Frauenzimmer!«, brüllte er.
Ruhig nahm Emma ihre Stickarbeit wieder auf. Es war nicht gut, einem Mann zu viele Freiheiten zu gestatten. »Gute Nacht, Fulton«, meinte sie kühl.
Er stand auf. »Willst du nicht wenigstens so freundlich sein, mich zum Tor zu begleiten?«, brummte er.
Emma dachte daran, dass sie durch eine Heirat mit Fulton eine geachtete Stellung in der Gesellschaft erreichen würde, unterdrückte ein Seufzen und stand auf. Arm in Arm gingen sie zum Tor hinaus.
Die sternenklare Nacht und die kühle Brise, die vom nahen See herüberkam, stimmten Emma romantischer. Sie richtete sich auf die Zehenspitzen auf und küsste Fulton auf die Wange.
Er lächelte erfreut.
Reumütig berührte Emma seine verletzte Hand. »Es tut mir leid, dass ich dich gestochen habe«, sagte sie.
Fulton nahm ihre Hand an seine Lippen und hauchte einen Kuss auf ihre Fingerspitzen, aber das leise Kitzeln, das die Berührung in Emma auslöste, hatte nichts mit den köstlichen Dingen zu tun, die in den Romanen beschrieben wurden, die sie las. Und auch Fultons Worte waren alles andere als poetisch. »Ein Mann hat gewisse Bedürfnisse, Emma«, sagte er. »Ich hoffe, dass du im Ehebett nicht ganz so zurückhaltend sein wirst.«
Sie verzichtete darauf, ihm zu erwidern, dass sie offiziell noch gar nicht verlobt waren, bedachte ihn nur mit einem kühlen Lächeln und sagte: »Gute Nacht.«
Fulton verabschiedete sich mürrisch, und Emma ging rasch ins Haus zurück, um Chloe zu suchen.
Sie fand ihre Adoptivmutter im kleineren der beiden Salons, wo sie verträumt den zarten Klängen einer Spieldose lauschte. Als sie Emma sah, klappte sie den Kasten zu und sagte lächelnd: »Hallo, Liebes. Ist Fulton schon fort?«
»Ja.«
»Na endlich. Ich begreife wirklich nicht, was du an diesem Menschen findest.«
Emma war an Chloes freimütige Art gewöhnt, und deshalb nahm sie keinen Anstoß an ihrer Bemerkung. »Er ist ein Gentleman«, erwiderte sie, denn sie wollte nicht zugeben, dass sie Fulton oft selbst ein bisschen fade und langweilig fand. »Aber erzähl mir jetzt, was im Saloon passiert ist. Bisher habe ich nichts darüber erfahren können.«
Chloe seufzte. »Der alte Freddy Fiddengate hat seinen Geburtstag mit einer Stange Dynamit statt mit einem Kuchen gefeiert.«
Emma schlug erschrocken die Hand vor den Mund. »Ist jemand ums Leben gekommen bei der Explosion?«
»Nein, aber oben liegt ein Mann, der ziemlich schwer verletzt ist. Der Doc sagte, er hätte mehrere gebrochene Rippen und einige schlimme Schnitte von Glassplittern.«
Es schauderte Emma bei dem Gedanken, dass irgendein armer verletzter Mensch leidend in einem von Chloes Gästezimmern lag.
»Charlie Simmons hat ein Bein gebrochen«, setzte Chloe ihren Bericht fort, »und Philo DeAngelo verlor zwei Zehen. Alle anderen waren nur bewusstlos geworden.«
Emma berührte Chloes Hand. »Du musst müde sein«, sagte sie sanft. »Warum gehst du nicht ins Bett? Ich bringe dir dann ein Glas heiße Milch.«
Chloe verzog das Gesicht. »Du weißt, dass ich das Zeug nicht ausstehen kann. Außerdem muss ich ins Stardust hinübergehen und mich um meine Mädchen kümmern, Emma.«
Aus Erfahrung wusste Emma, dass Chloe sich nicht überreden ließ, wenn sie etwas nicht wollte. »Na schön, dann geh nur«, sagte sie seufzend. »Ich kann die heiße Milch auch selbst trinken.«
Chloe stand auf. »Du bist langweilig wie eine zahnlose alte Frau, Emma«, bemerkte sie kopfschüttelnd. »Statt hier herumzusitzen, solltest du draußen im Mondschein sein und dich von einem hübschen jungen Mann küssen lassen. Und damit meine ich keineswegs diesen biederen Bankier.«
»Ich habe gar kein Verlangen danach, geküsst zu werden«, entgegnete Emma ungehalten und ging zur Treppe.
»Das ist dein Problem«, rief Chloe ihr nach. »Weißt du was? Ich glaube, du versuchst nur, der Welt zu zeigen, dass du nicht so bist wie ich.«
Emma blieb auf der Treppe stehen. Trotz der Tatsache, dass Chloe ein gutgehendes Bordell führte, gab es keinen gütigeren Menschen als sie. »Mir ist egal, was die Leute denken«, erwiderte sie schnell, doch sie wusste, dass es eine Lüge war, und Chloe wusste es auch.
2
Nur eine Kerze erhellte Emmas geräumiges Zimmer, als sie sich auszog, um ins Bett zu gehen. Eine Petroleumlampe hätte besseres Licht gegeben, aber Emma kam sich im sanften Schein der Kerze fast wie Jane Eyre vor, und es fiel ihr nicht schwer, sich vorzustellen, dass Mr. Rochester in der Halle auf sie wartete.
Nachdem sie ihren Morgenrock angezogen hatte, nahm sie den bronzenen Kerzenständer und verließ ihr Zimmer, um nach dem verletzten Mann zu sehen, den Chloe aufgenommen hatte.
Auf dem Korridor blieb sie lauschend stehen, aber es war nichts zu hören, und so öffnete sie die ihrem Zimmer gegenüberliegende Tür und trat leise ein.
Im Bett konnte sie vage Umrisse einer Gestalt erkennen, aber es war kein Atmen zu hören und auch kein Schnarchen, was Emma als sehr beunruhigend empfand. Angeblich schnarchten Männer, wenn sie schliefen. Zumindest hatte Chloe das behauptet.
Auf leisen Sohlen näherte Emma sich dem Bett. »Sir?«, flüsterte sie, um den verwundeten Mann nicht zu erschrecken. »Sir – sind Sie wach?«
Der Patient rührte sich nicht und gab keinen Ton von sich.
Emma beugte sich über die reglose Gestalt, um den Mann besser betrachten zu können, und da passierte etwas, womit sie nicht gerechnet hätte: Die Flamme der Kerze streifte die Mullbinden, mit denen die Brust des Mannes verbunden war, und sie fingen Feuer.
Zuerst war Emma zu entsetzt, um zu reagieren. Es dauerte lange, viel zu lange, bis sie sich wenigstens wieder so weit in der Gewalt hatte, dass sie die Kerze fortstellte. Doch da hatte das Unglück schon seinen Lauf genommen.
Der Mann erwachte fluchend, und das löste Emmas Starre endgültig. Mit beiden Händen versuchte sie die Flammen auszuschlagen.
Der Fremde schrie auf vor Schmerz und fuhr sie dann an: »Bevor Sie mich totschlagen, lassen Sie es lieber brennen, verdammt noch mal!«
Doch Emma schlug weiter auf die Verbände ein, bis auch der letzte glimmende Funken erloschen war. Dann erst zündete sie die Petroleumlampe an, in deren Schein sie einen gutaussehenden Mann Anfang Dreißig sah, dessen Rippen und Arme mit weißen Tüchern verbunden waren.
Es war der Mann, dem Emma am Nachmittag am Bahnhof begegnet war! Eine seltsame Erregung erfasste sie bei seinem Anblick, und sie sagte rasch: »Es tut mir so leid ...« Doch der Mann schien für Entschuldigungen nicht empfänglich zu sein. Seine braungrünen Augen blitzten zornig, als er sich zu einer sitzenden Stellung aufrichtete, und selbst im schwachen Lampenschein konnte Emma sehen, dass er vor Schmerz ganz blass geworden war. »Ich kannte mal jemanden wie Sie. Er war Wächter in einem Yankee-Gefangenenlager«, sagte er grollend.
Emma beschloss, seine Bemerkung zu ignorieren, zog ihren Morgenmantel noch fester um die Schultern und setzte sich auf einen Stuhl. »Ich fürchte, diese Verbände müssen gewechselt werden«, sagte sie. »Da Doc Waverly im Allgemeinen nur tagsüber nüchtern ist, tue ich es lieber selbst.«
Der Mann bedachte sie mit einem argwöhnischen Blick.
Emma seufzte. »Ich habe gesagt, dass es mir leid tut, oder?«
Er schaute sie aus schmalen Augen an. »Wer sind Sie?«
»Emma Chalmers. Wir sind uns heute schon einmal begegnet. Aber wer sind Sie?«
Er strich sein verschwitztes braunes Haar zurück. »Steven Fairfax.«
»Wie geht es Ihnen, Mr. Fairfax?«
»Wunderbar, was haben Sie denn geglaubt?«, entgegnete er spöttisch. »Ich gehe in diesen verdammten Saloon, weil ich etwas trinken will und ... und werde fast in der Mitte auseinandergerissen, weil irgendein Verrückter seinen Geburtstag feiert. Dann kommen Sie herein und legen Feuer an meine Verbände ...«
»Ach, hören Sie auf, sich zu beschweren«, unterbrach Emma ihn ungeduldig. »Sie sind nicht der erste Mensch, der in eine Explosion geraten ist. Lassen Sie mich den Verband entfernen.«
Fairfax musterte sie stirnrunzelnd und zog das Laken bis unter das Kinn. »Ich warte lieber, bis der Doktor wieder nüchtern ist.«
»Kommt nicht in Frage«, widersprach Emma entschieden und stand auf. »Ich bin gleich wieder da.«
Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, brachte sie mehrere Laken aus ihrem eigenen Schrank mit, außerdem eine Schere, Mull und die Flasche Laudanum, die Doc Waverley ihr für ihre Menstruationsbeschwerden gegeben hatte.
Steves Blick ignorierend, stellte sie die Medizin auf den Nachttisch und breitete die anderen Dinge am Fußende aus. Dann begann sie vorsichtig die Verbände aufzuschneiden, was Mr. Fairfax in misstrauischem Schweigen über sich ergehen ließ.
Dort, wo Doc genäht hatte, wies die Brust des Mannes mehr Einstiche auf als das Stickmuster, das Emma im vergangenen Monat angefertigt hatte. Seine Wunden schienen sich entzündet zu haben, was kein Wunder war, da Doc Waverley darauf verzichtet hatte, sie zu reinigen, bevor er sie nähte.
Als Emma alle Verbände außer der Bandage um seine Rippen entfernt hatte, trat sie zurück. »Sie müssen gewaschen werden, bevor wir weitermachen, Mr. Fairfax. Sonst könnte sich die Wunde infizieren.«
Zu ihrem Erstaunen betrachtete der störrische Fremde sie jetzt ganz anders – seine haselnussbraunen Augen zwinkerten, und seine Stimme klang viel leiser, beinahe sanft. »Wie viel kostet das? Das Waschen, meine ich?«
Emma runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht ...?«
Fairfax lächelte. Wenn er so lächelte, wirkte er schon eher wie ein Gentleman statt wie ein heruntergekommener Cowboy. »Sie wissen, was ich meine.«
Emma hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. »Tut mir leid«, sagte sie, schon auf dem Weg zur Tür. »Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, was Sie meinen.« Sie ging hinaus und kam kurz darauf mit einer Schüssel heißem Wasser, Seife, Waschlappen und Handtüchern zurück.
»Sie machen mir eine Menge Arbeit, Mr. Fairfax.«
»Steven«, berichtigte er sie lächelnd.
Emma schaute ihn verwirrt an. »Steven.«
»Darf ich Sie Emma nennen?«
»Nein«, entgegnete sie, weil ihr ein bisschen unbehaglich zumute wurde bei seinem vertraulichen Ton. »Sie dürfen es nicht. Es wäre nicht korrekt.«
Steven grinste, als hätte sie einen Witz gemacht. »Nicht korrekt?«, wiederholte er lachend.
Emma gab Seife auf den Waschlappen und begann Steven zu säubern, wobei sie es vermied, ihn an irgendeiner anderen Stelle als an seiner Brust und seinen Armen zu berühren.
»Dort in meiner Manteltasche ist Geld«, bemerkte er, als Emma die Seife abwusch.
»Gut«, erwiderte sie abwesend. »Sie werden sich neue Kleider kaufen müssen. Ich kann es morgen, wenn ich aus der Leihbücherei nach Hause komme, für Sie erledigen.«
Steven musterte sie prüfend. »Wie lange arbeiten Sie schon hier?«
»Ich arbeite nicht hier – ich bin die Stadtbibliothekarin. In diesem Haus lebe ich nur.«
Steven stieß ein heiseres Gelächter aus. »Bibliothekarin? Das ist ja etwas ganz Neues!«
Emma zerriss ein Laken. »Neu? Was ist daran neu?«
»Hören Sie – wenn Sie mit dem Verbinden fertig sind, könnte ich ein bisschen Trost gebrauchen.«
Emma stand über ihre Arbeit gebeugt und verband sorgfältig seinen linken Arm. »Wir haben unten Whiskey, aber von dem Laudanum werden Sie auch einschlafen. Ich könnte Ihnen natürlich etwas vorlesen, wenn Sie wollen ...«
»Vorlesen? Sagen Sie, was für ein Ort ist das hier?«
»Ein Zuhause, Mr. Fairfax«, antwortete Emma, während sie den Verband an seinem anderen Arm befestigte.
»Sie leben hier?«
»Natürlich. Warum würde ich wohl sonst im Morgenmantel und Nachthemd durch das Haus laufen?«
Steven schützte Verwirrung vor. »Ja ... und warum sonst hätten Sie einen unschuldigen Mann verbrennen wollen?«
»Sie scheinen ein sehr nachtragender Mensch zu sein, Mr. Fairfax.«
»Steven.«
»Also gut – Steven.« Sie gab etwas von dem Laudanum auf einen Löffel und reichte es ihm.
»Sie halten mich doch nicht zum Narren, oder?«, fragte er, als er die Medizin geschluckt hatte.
»Warum sollte ich Sie zum Narren halten?«, entgegnete Emma gekränkt.
Er schüttelte den Kopf. »Dann sind Sie anscheinend wirklich Bibliothekarin!«, sagte er verblüfft und begann dann laut zu lachen.
Emma dachte, dass er verrückt sein musste. Vielleicht war er sogar aus einem Irrenhaus entflohen. Vorsichtshalber trat sie zurück und entfernte sich aus seiner Reichweite.
Steven bemühte sich, mit dem Lachen aufzuhören, aber es schien ihm schwerzufallen. »Was ist mit der Frau, die vorhin hier war? Was ist sie denn – Lehrerin?«
Und nun begriff Emma endlich, was Steven gedacht hatte – er musste Chloe in ihrer »Arbeitskleidung« gesehen haben. Emma straffte die Schultern, richtete sich in ihrer vollen Größe von einem Meter siebzig auf und maß ihn mit einem strafenden Blick. »Wenn Sie nicht so schwer verletzt wären«, sagte sie empört, »hätten Sie jetzt eine Ohrfeige verdient!«
Das Laudanum begann zu wirken, Mr. Fairfax gähnte. »Sie haben bereits meine Verbände angezündet und dann auch noch versucht mich totzuschlagen. Im Vergleich dazu wäre eine Ohrfeige das reinste Streicheln.«
Nun wurde Emma wirklich wütend. »Keine Angst, Mr. Fairfax«, fuhr sie ihn an. »In Zukunft werden Sie vor mir sicher sein.«
»Sehr beruhigend.«
Emma ging auf die Tür zu, aber aus Pflichtbewusstsein blieb sie noch einmal stehen. »Brauchen Sie einen Nachttopf?«
»Ja«, antwortete Steven kurz.
Emma kehrte zu Steven zurück und zog einen Nachttopf unter dem Bett hervor, den sie ihm recht unsanft in die Hände drückte. »Gute Nacht, Mr. Fairfax«, sagte sie, löschte die Petroleumlampe und verließ den Raum.
Steven biss vor Schmerz die Zähne zusammen, als er den Topf auf den Fußboden stellte. Dann ließ er sich erschöpft in die Kissen sinken.
Emma.
Er lächelte, als ihm bewusst wurde, wie dumm er sich verhalten hatte. Chloes wegen hatte er geglaubt, sich in einem Bordell zu befinden, und Emma für eines ihrer Mädchen gehalten. Aber das war nicht der Fall, Emma war Bibliothekarin, und Steven hatte sogar den Eindruck, dass sie noch unberührt war.
Darüber war er froh, obwohl ein Teil seines Wesens jetzt gern den zärtlichen Trost einer Hure in Anspruch genommen hätte.
Mit geschlossenen Augen rief er sich ins Gedächtnis, wie sie ihn gewaschen hatte, und stellte zu seiner Verblüffung fest, dass schon der bloße Gedanken daran eine starke Erregung in ihm auslöste.
Er war überrascht, als sich die Tür einen Spalt breit öffnete und er Emmas Stimme hört. »Mr. Fairfax ...?«
»Ja?«
»Ich ... ich wollte Sie nur fragen, ob Sie Schmerzen haben.«
»Ja«, gab er ehrlich zu.
Der schmale Spalt, durch den das Licht fiel, verbreiterte sich. »Hat das Laudanum nicht geholfen?«
Emmas Besorgnis rührte Steven, und so sagte er wahrheitsgemäß. »Es hat noch keine Zeit gehabt zu wirken, Miss Emma.«
Nun kam sie herein, diesmal mit einer Petroleumlampe, und Steven wurde ganz übel bei der Vorstellung, was sie damit alles anrichten könnte.
Aber sie stellte die Lampe auf den Nachttisch und setzte sich auf einen Stuhl. Steven sah, dass sie ein Buch in der Hand hielt.
»Es tut mir leid, dass ich vorhin so unfreundlich war«, sagte sie schüchtern.
Steven musste lachen, als er ihre ernste Miene sah, und dachte, dass er zu gern die Wildkatze in ihr geweckt hätte, die mit Sicherheit in ihr steckte und die sie vor der Welt und vielleicht sogar vor sich selbst verbarg.
»Mir tut auch leid, was ich gesagt habe«, entgegnete er, bemüht, seine Belustigung zu verbergen.
»Ich dachte, Sie möchten vielleicht, dass ich Ihnen etwas vorlese.«
Steven unterdrückte ein Schmunzeln. »Das ist sehr nett von Ihnen, Miss Emma. Was haben Sie mir als Lektüre mitgebracht?«
Der Lampenschein fiel auf ihre offenen, klaren Züge, ihre sanfte Stimme klang warm und ein bisschen heiser, und für einen flüchtigen Moment wünschte Steven, er hätte mit seinem ersten Urteil über sie rechtbehalten ...
»Little Women – mein Lieblingsbuch«, erwiderte sie lächelnd. »Ich habe es schon unzählige Male gelesen.«
Steven hatte von dem Buch gehört, aber es hatte ihn nie interessiert. Natürlich sagte er nichts dergleichen, denn er merkte allmählich, dass Emma sehr verwundbar war und wollte sie nicht verletzen. »Warum gefällt es Ihnen so gut?«, fragte er.
Sie schien zu überlegen. »Vielleicht, weil es von vier Schwestern handelt«, sagte sie dann leise. »Meg, Amy, Jo und Beth.«
Klingt wirklich ungeheuer aufregend, dachte Steven, aber er behielt seinen Spott für sich. Selbst wenn er kein Interesse für irgendwelche kleinen Frauen aufbringen konnte, wollte er doch Emmas Stimme hören.
Sie schlug das abgegriffene Buch auf, räusperte sich und begann ihm vorzulesen.
»Ich habe noch nie jemanden gekannt, der seine Mutter ›Marmee‹ nannte«, warf Steven ein, als Emma das erste Kapitel beendet hatte und für einen Moment schwieg.
»Das ist im Osten nichts Ungewöhnliches«, erwiderte sie.
Steven nickte. Auch er selbst hatte seine Mutter nicht »Mom« genannt, sondern stets das französische »Maman« benutzt. Und obwohl er es nie zugegeben hätte, war er plötzlich begierig, das nächste Kapitel zu hören.
»Haben Sie Schwestern?«, fragte Emma leise, und Steven sah, dass ein trauriger Ausdruck in ihre schönen Augen trat.
Gern hätte er sie tröstend an sich gezogen, aber das wagte er noch nicht. »Nein, aber ich habe einen Bruder«, erwiderte er kurz, weil er nicht über Macon sprechen wollte. Oder über Nathaniel, einen Cousin, der nach Fairhaven gekommen war, nachdem er seine Eltern verloren hatte, und der noch so jung war, dass Steven ihn fast nicht kannte. Nat war erst geboren worden, als Steven schon bei der Armee war.
Emma seufzte wehmütig. Sie wirkte sehr jung und verletzlich in ihrem Morgenmantel und mit dem dicken rotblonden Zopf, der ihr auf die Schultern fiel. Steven fragte sich beschämt, wie er sie je für eine Prostituierte hatte halten können.
Irgendwie ahnte er, dass sie sehr allein auf dieser Welt war, und das tat ihm weh und schmerzte fast mehr als seine Verletzungen. »Ich bin froh, dass Sie zurückgekommen sind, um mich ein bisschen aufzuheitern, Miss Emma«, meinte er weich.
Sie lächelte abwesend und stand auf. »Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Steven«, sagte sie. Dann war sie fort, und im Raum war es wieder dunkel.
Als sie wieder in ihrem eigenen Zimmer war, löschte Emma die Lampe, legte das Buch daneben und kroch ins Bett. Wie immer, wenn sie Little Women gelesen hatte, dachte sie an ihre Schwestern – an Lily und Caroline. Aber schon nach wenigen Minuten drängte sich Steven in ihr Bewusstsein, und obwohl ihr klar war, wie unpassend derartige Gedanken waren, konnte sie nicht umhin, sich voller Bewunderung seine kräftige Gestalt ins Gedächtnis zu rufen, seine muskulösen, von der Sonne gebräunten Arme und seine breiten Schultern ...
Nein! Emma zog die Decke höher und zwang sich, an Fulton zu denken, der nun schon seit Monaten um sie warb. Es war verrückt, ihre Zeit mit Gedanken an Steven zu verschwenden, und im Übrigen hatte sie überhaupt kein Recht, einen Mann wie ihn zu waschen und zu verbinden.
Andererseits jedoch hatte sie Fultons Arme noch nie entblößt gesehen, und erst recht nicht seine Brust, so dass sie keine Vergleiche anstellen konnte. Ihre Wangen brannten vor Verlegenheit, als sie versuchte, sich ihren Verlobten nackt vorzustellen.
Aber sie wusste – auch ohne ihre blühende Phantasie zu beanspruchen –, dass die Haut ihres Verlobten ganz weiß sein würde und sein Körper vermutlich so weich, dass er sich anfühlte wie der einer Frau, wenn man ihn berührte ...
Mit einem Stöhnen der Verzweiflung drehte Emma sich auf die Seite und zog die Decke über ihren Kopf. Steven Fairfax war nichts als ein Vagabund, ein Tramp, nach dem vielleicht sogar gefahndet wurde, und es war sehr undamenhaft von ihr gewesen, ihn zu waschen.
Aber er wollte ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Sie dachte an sein Lächeln, dem es trotz der Schmerzen, die er auszustehen hatte, nie an Humor fehlte, und an seinen weichen Südstaatenakzent, der sie an warme Sommernächte denken ließ, an blühende Magnolien und ...
Ärgerlich über sich selbst stand Emma auf und trat ans Fenster, um auf den dunklen See hinauszuschauen. Seufzend lehnte sie die Stirn an das kühle Glas und fragte sich, was es sein mochte, was sie an Steven Fairfax so beunruhigte.
Am nächsten Morgen ging Emma noch vor dem Frühstück zu Steven, um zu sehen, wie er sich fühlte.
Er lächelte erfreut, und obwohl er dringend eine Rasur benötigt hätte und sein Haar schmutzig und zerzaust war, machte Emmas Herz bei seinem Anblick einen kleinen Sprung.
»Ich könnte Ihnen etwas zum Frühstück bringen, wenn Sie möchten«, sagte sie, von einer unerklärlichen Scheu erfasst.
Steven schüttelte den Kopf. Der prüfende Blick, mit dem er sie betrachtete, schien eine glühende Spur auf ihrem Körper zu hinterlassen. »Danke, aber ich esse nie vor Mittag.«