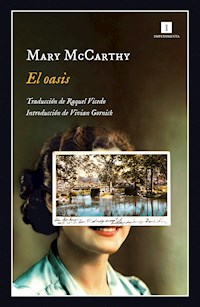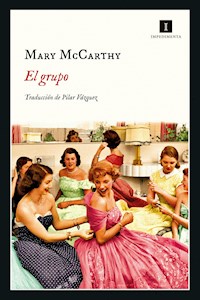10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ebersbach & simon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitreise ins Manhattan der schillernden 30er Jahre: Die Clique – acht bestens ausgebildete junge Frauen, die sich nach Abschluss ihres Studiums am vornehmen Vassar-College hoffnungsfroh ins Leben stürzen, um ihre Träume zu verwirklichen. Begabt, leidenschaftlich und lebenshungrig sind sie alle, doch ihre Lebenswege sind ganz unterschiedlich. Auf der Suche nach sich selbst, nach Abenteuer, Sex und der großen Liebe durchleben Lakey, Libby, Kay & Co Krisen und Konflikte, üben den Spagat zwischen Kindern und Karriere und kämpfen um Freiheit und Eigenständigkeit. Was aus ihnen und ihren Träumen wird, erzählt Mary McCarthy meisterhaft – authentisch, bewegend und blitzgescheit. Ein grandioses Porträt der 30er Jahre in New York und ein fulminanter Frauen-Roman, der Candace Bushnell zu ihrem Bestseller Sex and the City inspirierte und der bis heute begeistert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mary McCarthy
DIE CLIQUE
Mit einem Vorwort von Candace Bushnell
Aus dem Amerikanischen vonUrsula von Zedlitz
Inhalt
VORWORT
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
Über den Autor
VORWORT
von Candace Bushnell
Ich war noch ein Teenager, als meine Mutter mir empfahl, Die Clique zu lesen. Sie wusste, dass ich Schriftstellerin werden wollte, und gab mir häufig Bücher von zeitgenössischen Autoren, wobei »zeitgenössisch« in diesem Fall heißt: Anfang 19. Jahrhundert bis etwa Mitte der Siebzigerjahre. Flannery O’Connor, Anaïs Nin, Edith Wharton, Ayn Rand. Und Mary McCarthy. Ich verschlang O’Connor, Nin, Wharton und Rand. Mit McCarthy tat ich mich schwer. Ihre Heldinnen überzeugten mich nicht, was keineswegs überrascht, wenn ich heute zurückschaue. Fast alle bedeutenden literarischen Werke erreichen Jugendliche nicht, weil diese nicht über die notwendige Lebenserfahrung verfügen, um die Enttäuschungen und Frustrationen der Erwachsenen nachempfinden zu können. Und so legte ich Die Clique beiseite. Es sollte 18 Jahre dauern, bis ich sie wieder hervorholte.
Für meine Mutter indes war Die Clique das prägende Buch ihrer Generation: Sie war Jahrgang 1930 und die Erste überhaupt in unserer Familie, die ein College besucht hatte – Mount Holyoke, eins der renommierten Seven Sisters Colleges, zu denen auch Vassar und Smith gehören. Die Clique erschien 1963 in den USA, mitten in einer Zeit tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels: John F. Kennedy war gerade ermordet worden, die Hippies predigten die freie Liebe, und der Vietnam Krieg tobte bereits seit vier Jahren. Der Mythos der friedlichen, familienorientierten Fünfzigerjahre, als die heitere Hausfrau mit Schürze und Stöckelschuhen ihren adretten Göttergatten noch mit einem Cocktail auf der Schwelle empfangen hatte, geriet zunehmend ins Wanken. Soeben war das Buch The Feminine Mystique (USA 1963, dt. Der Weiblichkeitswahn, 1966) von Betty Friedan erschienen, basierend auf der Auswertung eines Fragebogens, den Friedan auf der Feier zum 15-jährigen Examens-Jubiläum des Smith Colleges an zweihundert ihrer ehemaligen Studienkolleginnen verteilt hatte. Das Ergebnis bewies, dass viele Frauen unzufrieden waren mit ihrem Leben und den durch Ehe und Mutterschaft erheblich eingeschränkten Entfaltungsmöglichkeiten, was Friedan als »das Problem, das keinen Namen hat« bezeichnete. Der Zeitpunkt für die Publikation der Clique hätte perfekter nicht sein können: Wie die realen Frauen aus Friedans Buch litten auch die acht Heldinnen aus der Clique unter dem »Problem, das keinen Namen hat«. Die Frauen-Generation der Sechzigerjahre identifizierte sich mit ihnen und so konnte sich Die Clique zwei Jahre lang auf der Bestseller-Liste der New York Times behaupten.
Wenn ich heute zurückschaue, drängt sich mir die Frage auf, ob meine Mutter und ihre Freundinnen durch die Lektüre der Clique mit ihrer eigenen latenten Unzufriedenheit über ihr Hausfrauendasein konfrontiert wurden. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass meine Mutter und ihre beste Freundin zwei Jahre nach Erscheinen des Buches ihre eigene Firma gründeten, sehr zum Unwillen ihrer Ehemänner. Auch wenn man einem solchen Schritt heute keine besondere Bedeutung mehr beimessen würde, in unserem Haushalt galt dies damals als regelrechte Revolution. Doch meine Mutter blieb unerbittlich, und genau zur selben Zeit, im Alter von acht Jahren, beschloss ich, Schriftstellerin zu werden.
Mitte der Neunzigerjahre, als ich die Sex and the City-Kolumnen für den New York Observer schrieb, brachte meine Agentin den Vertrag für meinen ersten Roman unter Dach und Fach. Als ich meiner ehemaligen Herausgeberin davon erzählte – eine der wenigen Frauen, die beim Observer gearbeitet hatten –, schlug sie spontan vor: »Du solltest die moderne Version von Die Clique schreiben!« Auf dem Heimweg kaufte ich mir eine Ausgabe des Buches und las es innerhalb von zwei Tagen nochmals durch. Das, was mit siebzehn keinerlei Sinn für mich gemacht hatte, kam jetzt, mit fünfunddreißig, einer erstaunlichen Offenbarung gleich. Hier fanden sich authentische, klar konturierte Charaktere, mit denen man sich identifizieren konnte: idealistische junge Frauen Anfang zwanzig, die mit den ungeahnten Nöten und Wonnen des »wahren Lebens« konfrontiert wurden. Auch wenn freilich jede Generation von Frauen für sich in Anspruch nimmt, vor völlig neuen Herausforderungen zu stehen, die sich aus ihrem Status als moderne Frauen in der Gesellschaft ergeben, so zeigt uns Die Clique doch, dass sich insgesamt nicht viel verändert hat: Sex vor der Ehe, unzuverlässige Männer, der Spagat zwischen Familie und Beruf – all diese Themen beschäftigten uns noch immer. Wenn man das Buch heute liest, könnte man sich tatsächlich fragen, ob nicht der größte Unterschied zwischen den Frauen von heute und den Frauen vor siebzig Jahren in dem Begriff »Wahlfreiheit« liegt – ein Begriff, der uns glauben macht, wir besäßen bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle über unser Leben, ja, wir hätten gar »das Problem, das keinen Namen hat« gelöst. McCarthys Protagonistinnen in der Clique haben diese Wahlfreiheit nicht.
Und so beginnt denn der Roman auch folgerichtig mit einer unheilvollen Hochzeit, auf der sich die unbeschwerten Kommilitoninnen der Braut voller Idealismus und Zuversicht tummeln, und kreist anschließend relativ rasch um gescheiterte Ambitionen, schlechten Sex (der Ehemann einer Heldin sagt regelmäßig das Einmaleins auf, um seinen Samenerguss zu verzögern), um die Anforderungen der Kindererziehung, den Ehrgeiz, mit den anderen mitzuhalten und nicht zuletzt um die Unzuverlässigkeit der Männer – so lässt sich etwa zu Beginn der Geschichte eine der Heldinnen ein Diaphragma anpassen, woraufhin sie von ihrem Liebhaber sitzen gelassen wird.
Geht man von der Aufmerksamkeit aus, die heutzutage den Geschlechterbeziehungen beigemessen wird, könnte man versucht sein, Die Clique als Wegbereiter der aktuellen chick lit, der anspruchslosen Frauen-Unterhaltungsliteratur, zu bezeichnen. Das trifft jedoch keineswegs zu. Obwohl McCarthys Frauen alles daran setzen, den richtigen Mann zu finden, ist dieses Thema doch eher ein Nebenschauplatz für einen weitaus bedeutenderen Konflikt. Als Absolventinnen des Vassar Colleges sind die Mitglieder der Clique nämlich davon überzeugt, dass sie die Welt verändern werden. Doch dann müssen sie nicht nur erkennen, dass sie die Welt nicht verändern können, sondern dass ihr Überleben vielmehr nach wie vor von der eigenen Akzeptanz abhängt, dem »anderen Geschlecht« anzugehören.
Als Feministin und hochpolitischer Mensch war McCarthy davon überzeugt, dass ein Roman keineswegs nur der bloßen Unterhaltung dienen sollte. In einem Beitrag, der 1981 in der New York Times erschien, schrieb McCarthy, dass sich der klassische Roman »infolge von Ideen und öffentlichen Debatten über gesellschaftspolitische Themen, Politik und Religion, über den Freihandel oder die Frauenfrage, die amerikanische Weltmachtstellung, politische und gesellschaftliche Reformen etc. entwickelt und an Bedeutung gewonnen hat. Ein seriöser Roman muss sich zwingend mit solchen aktuellen Fragen und ihrer Bedeutung in Hinblick auf Macht, Geld, Sex und Gesellschaft auseinandersetzen.«
McCarthys Entschlossenheit, das Leben so zu akzeptieren, wie es war, entgegen der Wunschvorstellung davon, wie es hätte sein sollen, ist zweifellos auf ihre eigene schwierige Kindheit und Jugend zurückzuführen. Nachdem beide Eltern 1918 einer verheerenden Grippeepidemie zum Opfer gefallen waren, blieb die erst Sechsjährige als Vollwaise zurück und wuchs bei streng katholischen Verwandten auf, wo sie mit harter Hand erzogen und missbraucht wurde. Ihre Unschuld verlor sie mit vierzehn und fortan stand fest, dass sie Ehe und Sex niemals als angenehm oder gar lustvoll empfinden würde. In ihrem Buch Intellectual Memoirs (USA 1992; dt.: Memoiren einer Intellektuellen, 1997) beschreibt sie ihren zweiten Ehemann, den Kritiker Edmund Wilson, als »keuchenden, fetten, alten Mann mit Mundgeruch.« Sie behauptet, ihn nie geliebt und in die Ehe nur eingewilligt zu haben »zur Strafe dafür, mit ihm ins Bett gegangen zu sein.«
Auch wenn sich der Groll aus diesen Zeilen nur unschwer herauslesen lässt, zeigen sie zugleich doch McCarthys Scharfsinn, Sarkasmus und tiefschwarzen Humor, welche sie glänzend einzusetzen verstand, um tiefe Verbitterung in Satire zu verwandeln. In Die Clique wird ein Mann beschrieben, der »durch und durch nichts taugte, aber das waren natürlich gerade die Männer, die anständigen Frauen das Herz brachen.« Später erkennt Priss, eine der Heldinnen, dass in ihrem Mann »etwas steckte, dem sie misstraute, und das sie sich nicht anders erklären konnte als damit, dass er Republikaner war.« Indessen befällt Polly, eine weitere Heldin, mit sechsundzwanzig die Angst vor dem Alter, denn »schon jetzt behandelten einige ihrer Freundinnen sie wie eine Trouvaille aus einem Trödelladen – wie ein leicht beschädigtes Stück antiken Porzellans.«
McCarthy übt sich also nicht gerade in Zurückhaltung in Bezug auf ihren Plot und ihre Protagonisten. Leser, die vor allem Wert auf »sympathische Charaktere« legen, werden vermutlich eine gewisse Irritation empfinden angesichts der Tatsache, dass die Heldinnen der Clique ausnahmslos alle mit Fehlern behaftet sind: Sie sind je nachdem vom Ehrgeiz zerfressen, verwirrt, teilnahmslos, leiden unter Angststörungen, sind arrogant oder zickig; McCarthy entwirft die Persönlichkeit ihrer Protagonisten nicht, damit sie dem Leser gefallen, noch lässt sie sich dazu herab, sie von ihrem Schicksal zu erlösen. Vielmehr entwickelt sich das Leben ihrer Charaktere mit logischer und absolut realistischer Konsequenz.
Seit mir vor rund 15 Jahren Die Clique wieder in die Hände gefallen ist, habe ich das Buch wohl an die zehn Mal gelesen. Es ist ein grandioses Buch, nicht nur wegen des hinreißend spöttischen Stils, sondern auch wegen der großartigen Erzähltechnik, der glänzenden Monologe und scharfsinnigen Schilderungen. Jedes Mal, wenn ich das Buch lese, werde ich von Ehrfurcht ergriffen angesichts McCarthys schriftstellerischer Qualitäten. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nie ein Buch wie Die Clique zustande bringen werde, aber Mary McCarthy wird mich immer inspirieren.
Aus dem Amerikanischen von Sophia Sonntag
ERSTES KAPITEL
Im Juni 1933, eine Woche nach dem College-Abschluss, wurde Kay Leiland Strong, Vassar Jahrgang 1933, mit Harald Petersen, Reed Jahrgang 1927, in der Kapelle der episkopalischen St.-George-Kirche, die Pfarrer Karl F. Reiland unterstand, getraut. Sie war die Erste aus ihrem Jahrgang, die heiratete. Die Bäume draußen auf dem Stuyvesant Square waren dicht belaubt und die Hochzeitsgäste, die zu zweien und dreien in Taxis vorfuhren, konnten den Lärm der Kinder hören, die in den Anlagen am Stuyvesant-Denkmal spielten. Während sie den Fahrer bezahlten und sich die Handschuhe glatt strichen, sahen sich die jungen Frauen, Kays Studienkolleginnen, neugierig um, als seien sie in einer völlig fremden Stadt. Sie waren erst jetzt dabei, New York zu entdecken, obwohl manche von ihnen seit ihrer Geburt hier lebten, in langweiligen, klassizistischen Häusern mit viel zu viel Platz in einer der Achtziger Straßen oder in einer der eleganten Etagenwohnungen an der Park Avenue. Darum faszinierten sie solche abgelegenen Winkel wie dieser hier mit seinen Grünflächen und dem Quäker-Gemeindehaus aus rotem Backstein, das mit blanken Messingbeschlägen und weißem Stuck direkt neben die weinrote Kirche gebaut war. Sonntags bummelten sie mit ihren Verehrern über die Brooklyn-Bridge und erforschten die verschlafenen Brooklyn Heights. Sie durchstreiften die vornehme Wohngegend von Murray Hill und die malerischen Viertel MacDougal Alley, Patchin Place und Washington Mews mit den vielen Künstler-Ateliers. Sie entzückten sich am Plaza Hotel und seinem Springbrunnen, an den grünen Markisen des Savoy Plaza, an den Pferdedroschken und bejahrten Kutschern, die dort wie auf einer französischen Place darauf warteten, sie zu einer Fahrt durch den abendlichen Central Park zu animieren.
An jenem Morgen war ihnen recht abenteuerlich zumute, als sie behutsam in der stillen, fast leeren Kirche Platz nahmen. Eine Hochzeit, zu der die Braut persönlich und mündlich einlud, ohne dass ein Verwandter oder eine ältere, mit der Familie befreundete Person sich einschaltete, hatten sie noch nicht erlebt. Auch die Flitterwochen sollten, wie man hörte, ausfallen, weil Harald (er gebrauchte diese alte skandinavische Schreibweise) als Inspizient bei einer Theaterinszenierung tätig war und, wie gewöhnlich, auch heute Abend zur Stelle sein musste, um die Schauspieler abzurufen. Das fanden die Mädchen schrecklich aufregend, und das rechtfertigte natürlich auch die eigentümlichen Begleitumstände der Hochzeit: Kay und Harald waren eben viel zu beschäftigt und zu dynamisch, als dass sie sich durch Konventionen hätten behindern lassen. Im September wollte Kay bei Macy’s, dem großen Warenhaus, anfangen, um sich gemeinsam mit anderen ausgesuchten Studentinnen mit den verschiedenen Verkaufstechniken vertraut zu machen. Weil sie aber den Sommer über nicht herumsitzen und auf ihren Einstellungstermin warten wollte, hatte sie sich bereits für einen Schreibmaschinenkurs in einer Handelsschule gemeldet, der ihr nach Haralds Meinung einen Vorsprung gegenüber den anderen Lehrlingen geben würde. Und laut Helena Davison, Kays Zimmergenossin aus ihrem Juniorenjahr, war das Brautpaar, das noch kein einziges Stück Wäsche oder Silber besaß, für den Sommer in eine möblierte Wohnung in einem hübschen Block in den östlichen Fünfziger Straßen gezogen. Ja, die beiden hatten (wie Helena soeben mit eigenen Augen festgestellt hatte) die vergangene Woche, seit dem Examen, auf den in der Untermiete enthaltenen Bettlaken der eigentlichen Wohnungsinhaber geschlafen!
Das war echt Kay, meinten die Mädchen gerührt, als die Geschichte in den Kirchenbänken die Runde machte. Sie fanden, Kay habe sich durch einen Kurs in Verhaltenslehre bei der alten Miss Washborn (die ihr Gehirn testamentarisch einem Forschungsinstitut vermacht hatte) sowie durch die Regiearbeit unter Hallie Flanagan erstaunlich verändert: Aus einem scheuen, hübschen, etwas fülligen Mädchen aus dem Westen mit glänzender schwarzer Lockenpracht und dem Teint einer Wildrose, einer eifrigen Hockeyspielerin und Chorsängerin, die stramm sitzende Büstenhalter trug und zu starken Menstruationen neigte, war eine magere, zielstrebige, bestimmt auftretende junge Frau geworden, die in blauen Arbeiterhosen, baumwollenen Sporthemden und Tennisschuhen herumlief, Farbspritzer im ungewaschenen Haar, Nikotinflecken an den Fingern, die nonchalant von Maltechniken, von Triebleben und Nymphomanie sprach, die ihre Vorgesetzten beim Vornamen und ihre Freundinnen mit schmetternder Stimme beim Nachnamen nannte – »Eastlake«, »Renfrew«, »MacAusland« – und voreheliche Erfahrung und Partnerwahl nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten empfahl. Liebe, erklärte sie, sei eine Illusion.
Die Mitglieder ihrer Clique, die jetzt alle sieben in der Kirche zugegen waren, hatten Kays Entwicklung beunruhigend gefunden, nannten sie jedoch nachsichtig eine »Phase«. Gewiss, Hunde, die bellen, beißen nicht, vergewisserten sie sich immer wieder bei ihren nächtlichen Zusammenkünften in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer im Südturm der Main Hall, wenn Kay noch Kulissen malte oder mit Lester an der Bühnenbeleuchtung arbeitete. Aber sie befürchteten, dass die Gute von einem, der sie nicht so genau kannte, beim Wort genommen werden könnte. Über Harald zerbrachen sie sich lange den Kopf. Kay hatte ihn im vergangenen Jahr an einer Sommerbühne in Stamford kennengelernt, wo sie als Volontärin arbeitete und Männer und Frauen im selben Gebäude untergebracht waren. Sie behauptete, er wolle sie heiraten, aber aus seinen Briefen war das nach Ansicht der Clique nicht zu ersehen. In ihren Augen waren das keine Liebesbriefe, sondern lediglich Berichte über persönliche Erfolge bei Theaterberühmtheiten – was Edna Ferber in seiner Gegenwart zu George Kaufman geäußert, wie Gilbert Miller ihn zu sich gebeten und ein weiblicher Star ihn angefleht habe, ihr im Bett aus seinem Stück vorzulesen. Die Briefe schlossen mit einem knappen »Betrachte Dich als geküsst« oder nur »B. D. A. G.« – sonst nichts. Von einem jungen Mann ihrer Kreise wären solche Briefe als beleidigend angesehen worden, aber es war ihnen von Haus aus eingeprägt worden, dass es falsch sei, aufgrund der eigenen begrenzten Erfahrung generelle Urteile zu fällen. Immerhin merkten sie, dass Kay ihres Haralds nicht so sicher war, wie sie tat. Manchmal schrieb er wochenlang nicht, und die Arme tappte im Dunkeln. Polly Andrews, die mit Kay den Briefkasten teilte, konnte sich dafür verbürgen. Bis zu dem Essen ihres Jahrgangs vor zehn Tagen glaubten die Mädchen, dass Kays viel diskutierte Verlobung im Grunde gar nicht existierte. Sie hatten sogar daran gedacht, jemand Erfahreneren zurate zu ziehen, eine der Professorinnen oder den College-Psychiater, kurzum, jemand, bei dem Kay sich vielleicht aussprechen könnte. Dann aber wandelte sich ihre Angst in wohlige Heiterkeit; an jenem Abend nämlich, da Kay um die lange Tafel lief, womit man nach altem Brauch dem ganzen Jahrgang seine Verlobung kundtat, und zwischen ihren heftig wogenden Brüsten einen komischen mexikanischen Silberring hervorzog. Da klatschten sie lächelnd und zwinkernd Beifall, als wollten sie sagen, sie hätten es längst gewusst. Mit Worten, die dem gesellschaftlichen Ereignis sehr viel angemessener waren, versicherten sie ihren Eltern, welche zu den Prüfungsfeierlichkeiten gekommen waren, dass die Verlobung seit Langem bestehe und dass Harald »schrecklich nett« und »schrecklich verliebt« in Kay sei. Jetzt, in der Kirche, zupften sie ihre Pelzkrägen zurecht und nickten einander überlegen lächelnd zu: wie ausgewachsene Edelpelztierchen. Sie hatten recht gehabt, Kays Schroffheit war nur eine Phase gewesen. Eins zu null für den Rest der Clique, dass ausgerechnet diese Rebellin und Spötterin als Erste vor dem Traualtar stand.
»Wer hätte das gedacht!«, bemerkte vorlaut Pokey, Mary Prothero, ein dickes, lustiges New Yorker Society-Girl, mit runden roten Backen und messingblondem Haar, die ihren Vater, einen passionierten Segler, kopierte und den Jargon der Herzensbrecher aus der McKinley-Zeit bevorzugte. Sie war das Sorgenkind der Clique, sehr reich und sehr faul. In allen Fächern benötigte sie Nachhilfestunden, sie mogelte bei den Prüfungen, fuhr heimlich übers Wochenende fort, stahl Bibliotheksbücher, kannte weder Bedenken noch moralische Hemmungen, interessierte sich nur für Tiere und Jagdbälle und wollte, wie im Jahresbericht zu lesen stand, Tierärztin werden. Gutmütig, wie sie war, hatte sie sich von den Freundinnen zu Kays Trauung schleppen lassen, wie sie sich früher auch zu College-Versammlungen schleppen ließ, wenn man sie durch Steinwürfe an ihr Fenster aufweckte, ihr den verknitterten Talar über den Kopf zog und das Barett aufstülpte. Nachdem man sie nun glücklich in der Kirche hatte, würde man sie im Lauf des Tages zu Tiffany bugsieren, damit Kay wenigstens ein wirklich vorzeigbares Hochzeitsgeschenk bekam. Pokey würde von selbst nicht auf den Gedanken kommen, denn für sie gehörten Hochzeitsgeschenke, Sicherheitspersonal, Brautjungfern, Geschwader von Limousinen, Empfänge bei Sherry’s oder im Colony Club zur Bürde der Privilegierten. Wenn man schon nicht zur Gesellschaft gehörte, wozu dann das Brimborium? Sie selbst, verkündete sie, hasse Anproben und Debütantinnenbälle, und mit demselben Gefühl sehe sie ihrer Hochzeit entgegen, zu der es ja zweifellos kommen werde, da sie, dank Papas Geld, unter den Verehrern nur zu wählen brauche. All das brachte sie während der Taxifahrt in ihrem enervierenden Salongeschnatter vor, bis sich an einem Rotlicht der Fahrer neugierig nach ihr umdrehte, nach ihr, die in blauseidenem Ripskostüm und Zobeln dasaß und ihrerseits ein brillantbesetztes Lorgnon vor die kurzsichtigen saphirblauen Augen hielt, ihn beäugte und mit seinem Foto über der Windschutzscheibe verglich, um mit lauter Flüsterstimme ihren Freundinnen zu verkünden: »Das ist nicht derselbe Mann!«
»Sehen sie nicht goldig aus?«, hauchte Dottie Renfrew aus Boston, um Pokey zum Schweigen zu bringen, als Harald und Kay nun, begleitet von Helena Davison, Kays Ex-Zimmergefährtin aus Cleveland, und einem fahlen, blonden, schnurrbärtigen Jüngling, aus der Sakristei kamen und ihre Plätze vor dem Vikar einnahmen. Pokey hob das Lorgnon an die Augen, die sie greisenhaft zukniff. Sie sah Harald zum ersten Mal, denn während seines einzigen Wochenendbesuchs im College war sie bei Freundinnen zur Jagd gewesen. »Nicht übel«, bemerkte sie, »bis auf die Schuhe.«
Der Bräutigam war ein magerer, nervös angespannter junger Mann mit glattem schwarzem Haar und einer sehr guten, drahtigen Fechterfigur. Er trug einen blauen Anzug, ein weißes Hemd, braune Wildlederschuhe und eine dunkelrote Krawatte. Pokeys kritischer Blick schweifte jetzt zu Kay, die ein blassbraunes, dünnes Seidenkleid mit großem weißem Seidenbatistkragen anhatte und dazu einen breitrandigen, margeritenbekränzten schwarzen Tafthut trug. Um eines der gebräunten Handgelenke schlang sich ein goldenes Armband, das von ihrer Großmutter stammte. Sie hielt einen Strauß von Feldmargeriten und Maiglöckchen in der Hand. Mit ihren glühenden Wangen, ihren glänzenden schwarzen Locken und den goldbraunen Augen wirkte sie wie eine Dorfschönheit auf einer alten kolorierten Postkarte. Ihre Strumpfnähte saßen schief und die Fersen ihrer schwarzen Wildlederschuhe waren blankgewetzt. Pokeys Gesicht verfinsterte sich. »Mein Gott, weiß sie denn nicht«, lamentierte sie, »dass Schwarz auf einer Hochzeit Unglück bringt?« – »Halt den Mund!«, knurrte es wütend von der anderen Seite. Pokey sah sich gekränkt zu der neben ihr sitzenden Elinor Eastlake aus Lake Forest um, der schweigsamen, brünetten Schönheit der Clique, die sie aus grünen Mandelaugen mordlustig anstarrte. »Aber Lakey!«, ereiferte sich Pokey. Dieses Mädchen aus Chicago, ohne Makel, intellektuell, hochmütig und fast so reich wie Pokey, war die Einzige aus der Clique, die ihr imponierte. Denn trotz all ihrer Gutmütigkeit war Pokey selbstverständlich ein Snob. Für sie war klar, dass von den vielen Vassar-Freundinnen nur Lakey erwarten konnte, zu ihrer Trauung eingeladen zu werden – und umgekehrt; die anderen würde man bloß zum Empfang bitten. »Idiotin!«, zischte die Madonna aus Lake Forest durch ihre perlweißen Zähne. Pokey rollte die Augen. »Übergeschnappt«, bemerkte sie zu Dottie Renfrew. Beide Mädchen schielten amüsiert auf Elinors hochmütiges Profil. Der klassisch geschnittene, feine weiße Nasenflügel bebte schmerzlich.
Für Elinor war diese Trauung eine Qual. Sie war ein einziger greller Missklang: Kays Kleid, Haralds Schuhe und Krawatte, der nackte Altar und die wenigen Gäste auf Seiten des Bräutigams (ein Ehepaar und ein Junggeselle), kein Mensch aus der Verwandtschaft. Die intelligente und krankhaft sensible Elinor schrie innerlich vor Mitleid mit den derart gedemütigten Hauptbeteiligten. Das wechselseitige Gezwitscher aus »furchtbar nett« und »wie aufregend«, welches statt eines Hochzeitsmarsches das Paar begrüßte, konnte sie sich nur als Heuchelei erklären. Elinor war stets fest von der Heuchelei anderer überzeugt, da sie einfach nicht glauben konnte, dass den anderen mehr entging als ihr. Auch jetzt nahm sie an, dass die Mädchen um sie herum sehen mussten, was sie selber sah, und sich – wie auch Kay und Harald – zutiefst beschämt fühlen mussten.
Der Vikar zog mit einem Hüsteln die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf sich. »Vortreten!«, herrschte er das junge Paar an, und das klang, wie Lakey später bemerkte, mehr nach Autobusschaffner als nach Pfarrer. Der frisch ausrasierte Nacken des Bräutigams rötete sich. In dem geweihten Raum wurden sich Kays Freundinnen plötzlich der Tatsache bewusst, dass Kay erklärte Atheistin (auf wissenschaftlicher Grundlage) war; jede von ihnen bewegte der gleiche Gedanke: Was hatte sich bei der Besprechung mit dem Pfarrer abgespielt? War Harald praktizierender Christ? Kaum. Wie hatten die beiden es dann fertiggebracht, sich in einer so erzkonservativen Kirche trauen zu lassen? Dottie Renfrew, ein gläubiges Mitglied der Episkopalkirche, zog ihren Pelzkragen enger um den empfindlichen Hals; sie erschauerte. Am Ende wohnte sie gar einem Sakrileg bei. Sie wusste genau, dass Kay, die stolze Tochter eines Agnostikers – eines Arztes – und einer mormonischen Mutter, nicht einmal getauft war. Kay war, wie die Clique ebenfalls wusste, auch nicht gerade sehr wahrheitsliebend; ob sie den Pfarrer angelogen hatte? Wäre die Trauung dann etwa ungültig? Eine leichte Röte zeigte sich auf Dotties Schlüsselbein über dem v-förmigen Ausschnitt ihrer handgearbeiteten Crêpe-de-Chine-Bluse, ihre erschrockenen braunen Augen blickten forschend auf die Freundinnen, ihre allergische Haut zeigte Flecken. Was jetzt kam, wusste sie auswendig. »Wenn jemand berechtigte Einwände vorzubringen hat, wonach diese beiden vor dem Gesetz nicht verbunden werden dürfen, so spreche er jetzt oder schweige für immer.« Die Stimme des Priesters hielt fragend inne, sein Blick schweifte prüfend über die Kirchenbänke. Dottie schloss die Augen und betete, sie empfand die Totenstille in der Kapelle beinahe körperlich. Ob Gott oder Dr. Leverett, sein Pfarrer, wirklich wünschte, dass sie Einspruch erhebe? Sie betete, sie möchten es nicht wünschen. Die Gelegenheit war vorbei, als sie wieder die Stimme des Pfarrers vernahm, laut und feierlich, fast wie in Verdammung des Paares, dem er sich jetzt zuwandte. »Und so fordere und verlange ich von euch beiden, mir zu antworten, wie ihr antworten werdet, wenn einst aller Herzen Geheimnisse offenbar werden. Wenn einem von euch ein Hindernis bekannt ist, dessentwegen ihr vor dem Gesetz nicht den Bund der Ehe eingehen könnt, so sage er es jetzt. Denn seid euch gewiss, wenn Personen unter Umständen miteinander verbunden werden, die Gottes Wort nicht erlaubt, dann sind sie nicht rechtens verheiratet.«
Man hätte das Fallen einer Nadel hören können, wie die Mädchen später einmütig bezeugten. Jede von ihnen hielt den Atem an. Dotties religiöse Skrupel waren einer neuen Besorgnis gewichen, welche die ganze Clique teilte. Das gemeinsame Wissen, dass Kay mit Harald »gelebt« hatte, erfüllte plötzlich alle mit einem Gefühl des Verbotenen. Sie blickten sich verstohlen in der Kirche um und stellten zum x-ten Male fest, dass weder Eltern noch irgendwelche älteren Personen anwesend waren. Das Abweichen vom Herkömmlichen, vor dem Gottesdienst noch so »herrlich«, kam ihnen jetzt unheimlich und unheilvoll vor. Sogar Elinor Eastlake, die sich voll Verachtung klarmachte, dass Unzucht nicht zu den Hindernissen gehörte, auf die im Gottesdienst angespielt worden war, erwartete beinahe, dass ein Unbekannter sich erheben und der Zeremonie Einhalt gebieten werde. Für sie bestand gegen die Ehe ein Hindernis seelischer Art: sie hielt Kay für eine rohe, gewissenlose, dumme Person, die Harald nur aus Ehrgeiz heiratete.
Alle Anwesenden glaubten jetzt, aus den Pausen und Betonungen in der Rede des Vikars etwas Ungewöhnliches heraushören zu können. Noch nie war ihnen das »dann sind sie nicht rechtens verheiratet« so nachdrücklich entgegen geschleudert worden. Ein hübscher, verlebt aussehender junger Mann mit kastanienbraunem Haar, der neben dem Bräutigam stand, ballte plötzlich die Faust und murrte vor sich hin. Er roch fürchterlich nach Alkohol und wirkte nervös. Während der ganzen Zeremonie hatte er die wohlgeformten kräftigen Hände geballt und wieder gestreckt und sich auf die schön geschnitten Lippen gebissen. »Er ist Maler, gerade erst geschieden«, flüsterte zu Elinors Rechten die hellblonde Polly Andrews, die zwar zu den Stillen gehörte, aber stets alles wusste. Elinor beugte sich vor und erhaschte auch sofort seinen Blick. Da ist jemand, dachte sie, der sich ebenso angewidert und unbehaglich fühlt wie sie. In seinem Blick lag tiefe, bittere Ironie, und dann zwinkerte er unmissverständlich zum Altar hinüber. Der Vikar, beim Hauptteil des Gottesdienstes angelangt, hatte es plötzlich sehr eilig, als sei ihm jetzt erst eingefallen, dass er noch einen Termin habe und daher mit diesem Paar so rasch wie möglich fertig werden wolle. Man merkte ihm geradezu an, dass es sich hier nur um eine Zehn-Dollar-Trauung handelte. Kay unter ihrem großen Hut schien von allem nichts zu spüren, aber Haralds Ohren und Hals hatten sich stärker gerötet, und seine Antworten, die er mit einer gewissen schauspielerischen Bravour gab, waren betont langsam und zwangen den Geistlichen wieder zu einem der feierlichen Handlung angemessenen Tonfall.
Das Paar neben dem Bräutigam lächelte verständnisvoll, als kenne es Haralds Schwächen, aber die Mädchen in ihren Bänken waren über die Ungezogenheit des Geistlichen empört und genossen den Sieg, den Harald in ihren Augen errungen hatte. Sie hatten vor, ihm dies bei der Gratulationsrunde auch zu sagen. Einige nahmen sich vor, mit ihren Müttern darüber zu sprechen, damit diese bei Dr. Reiland Beschwerde führten. Die Fähigkeit, sich zu entrüsten, das Vorrecht ihrer Klasse, war durch ihre Erziehung gleichsam in umgekehrte Bahnen gelenkt worden. Die Tatsache, dass Kay und Harald arm wie Kirchenmäuse leben würden, war keine Entschuldigung dafür, so dachten sie in ihrer Loyalität, dass der Geistliche sich so benahm, noch dazu in einer Zeit, da alle sich einschränken mussten. Sogar ein Mädchen aus ihren Kreisen hatte ein Stipendium in Anspruch nehmen müssen, um ihr Studium beenden zu können, und keiner dachte deswegen etwa schlechter von ihr. Polly Andrews blieb trotzdem eine ihrer liebsten Freundinnen. Sie waren, das konnten sie dem Geistlichen versichern, aus ganz anderem Holz als die Mädchen des vorigen Jahrzehnts: Unter ihnen war keine, die nicht vorhatte, im kommenden Herbst zu arbeiten, und sei es als Volontärin. Libby MacAusland hatte eine Zusage von einem Verleger. Helena Davison, deren Eltern in Cincinnati, ach nein, in Cleveland von den Zinsen ihres Einkommens lebten, wollte Lehrerin werden – sie hatte sich bereits einen Job in einer privaten Vorschule gesichert. Polly Andrews – Hut ab vor ihr – würde als Laborantin im Medical Center tätig sein. Dottie Renfrew war für das Amt einer Fürsorgerin bei einer Bostoner Behörde ausersehen. Lakey ging nach Paris, wo sie Kunstgeschichte studieren und sich auf einen höheren akademischen Grad vorbereiten wollte. Pokey Prothero, die zur Abschlussprüfung ein Flugzeug bekommen hatte, machte gerade ihren Pilotenschein, um jede Woche für drei Tage zur Cornell Agricultural School zu fliegen. Und zu guter Letzt hatte die kleine Priss Hartshorn, die Streberin der Clique, gestern gleichzeitig ihre Verlobung mit einem jungen Arzt mitgeteilt und dass sie einen Job bei der National Recovery Administration bekommen habe. Nicht schlecht, fanden sie, für eine Clique, die mit dem Stigma der Hochnäsigkeit durch das College gegangen war. Und auch sonst, in Kays weiterem Freundeskreis, gab es eine ganze Reihe Mädchen aus besten Familien, die eine Laufbahn im Geschäftsleben, in der Anthropologie oder Medizin anstrebten, nicht etwa weil sie es nötig hatten, sondern weil sie sich imstande fühlten, zum weiteren Aufstieg Amerikas beizutragen. Die Clique fürchtete sich auch nicht davor, als radikal zu gelten. Sie erkannte das Gute an, das Roosevelt leistete, was immer ihre Mütter und Väter auch sagen mochten. Sie fiel nicht auf Parteiprogramme herein und fand, man solle den Demokraten eine Chance geben, damit sie zeigen könnten, was sie auf dem Kasten hätten. Erfahrung war nur eine Frage des Durch-Fehler-klug-Werdens. Selbst die Konservativsten der Clique gaben schließlich zu, dass ein ehrlicher Sozialist ein Recht darauf habe, gehört zu werden.
Das schlimmste Schicksal aber wäre, befanden sie einmütig, so konventionell und ängstlich zu werden wie ihre Eltern. Nicht eine würde, wenn es sich vermeiden ließ, einen Börsenmakler, einen Bankier oder einen eiskalten Firmensyndikus heiraten, wie das so viele aus der Generation ihrer Mütter getan hatten. Lieber würden sie entsetzlich arm sein und sich von billigem Seelachs ernähren, als so einen öden, versoffenen Jüngling mit rotgeäderten Augen aus dem eigenen Milieu heiraten, der an der Börse arbeitete und sich nur für Squash und Trinkgelage im Racquet Club mit alten Studienfreunden aus Yale oder Princeton interessierte. Da täte man besser daran – jawohl, erklärten sie ohne Scheu, obgleich Mama leise lächelte –, einen Juden zu heiraten, wenn man ihn liebte. Manche Juden waren äußerst interessant und kultiviert, wenn sie auch schrecklich ehrgeizig waren und wie Pech und Schwefel zusammenhielten, wie man gerade in Vassar nur zu gut beobachten konnte: Wenn man sie kannte, so musste man auch ihre Freunde kennenlernen.
In einer Hinsicht allerdings machte sich die Clique ehrliche Sorgen um Kay. Es war irgendwie schade, dass ein so begabter Mensch wie Harald, der obendrein eine gute Erziehung besaß, sich ausgerechnet dem Theater zuwenden musste statt der Medizin, der Architektur oder der Museumsarbeit, wo das Fortkommen leichter war. Wenn man Kay reden hörte, war das Theater eine ziemliche Mördergrube, obgleich natürlich auch einige Leute aus guter Familie dazugehörten, wie Katherine Cornell, Walter Hampden (eine Nichte von ihm war im Abschlussjahrgang 1932) und John Mason Brown, der alljährlich in Mutters Club einen Vortrag hielt. Harald hatte kurze Zeit an der Yale Drama School unter Professor Baker studiert, doch dann kam die Wirtschaftskrise, und er hatte nach New York gehen müssen, um als Inspizient zu arbeiten, statt Stücke zu schreiben. Das war natürlich genauso, als diene man sich in einer Fabrik von der Pike hoch, wie das so viele Jungens aus guter Familie taten, und wahrscheinlich bestand kein Unterschied zwischen einer Theatergarderobe, wo lauter Männer im Unterhemd vor dem Spiegel saßen und sich schminkten, und einem Hochofen oder Kohlenbergwerk, wo die Männer ebenfalls im Unterhemd arbeiteten. Helena Davison hatte erzählt, dass Harald während des Gastspiels seiner Truppe in Cleveland seine Zeit damit verbracht habe, mit den Bühnenarbeitern und Beleuchtern Poker zu spielen, weil sie die Nettesten der ganzen Truppe seien; und Helenas Vater selbst hatte ihm nach dem Besuch des Stücks recht gegeben.
Mr. Davison war ein Original und demokratischer als die meisten Väter, weil er aus dem Westen stammte und sich mehr oder weniger aus eigener Kraft emporgearbeitet hatte. Immerhin, heutzutage, bei dieser Wirtschaftskrise, konnte sich keiner leisten, auf andere herabzusehen. Connie Storeys Verlobter, der Journalist werden wollte, arbeitete jetzt als Laufbursche bei Fortune, und Connies Eltern nahmen es, statt laut zu protestieren, sehr gelassen hin und schickten ihre Tochter nun in einen Kochkurs. Viele akademisch gebildete Architekten waren in Fabriken gegangen, um sich mit den Problemen der Formgestaltung vertraut zu machen, statt Häuser für reiche Leute zu bauen. Man denke an Russel Wright, den heute alle Welt bewunderte; er verwendete Industriestoffe wie das fabelhafte Aluminium für Gebrauchsgegenstände, z. B. Käseplatten und Wasserkaraffen. Kays erstes Hochzeitsgeschenk, das sie sich selbst ausgesucht hatte, war ein Russel-Wright-Cocktailshaker aus Eichensperrholz und Aluminium in Form eines Wolkenkratzers – er war federleicht und lief natürlich nicht an – mit einem dazu passenden Tablett und zwölf runden Becherchen. Hauptsache war schließlich, dass Harald ein geborener Gentleman war – obgleich er in seinen Briefen gern angab, aber wohl nur, um Kay zu imponieren, die selbst gern mit Namen um sich warf, mit den Butlern ihrer Freundinnen angab und den armen Harald als Yale-Studenten vorstellte, obgleich er doch nur die Yale Drama School in New Haven besucht hatte … Das war ein Zug an Kay, den die Clique nach Möglichkeit übersah, der Lakey jedoch rasend machte: ein Mangel an Differenzierungsvermögen und Rücksicht auf andere. Für die feineren gesellschaftlichen Unterschiede fehlte Kay einfach das Organ. Andauernd rannte sie in fremde Zimmer, wühlte dort zwischen den Sachen auf dem Schreibtisch herum und hielt den Bewohnern, wenn diese dagegen protestierten, vor, sie litten unter Hemmungen. Sie hatte auch auf dem Wahrheitsspiel bestanden, bei dem jede eine Liste anfertigen musste, auf der sie die anderen in der Reihenfolge ihrer Sympathie aufführte. Die Listen wurden dann untereinander verglichen. Sie hatte jedoch nicht bedacht, dass auf jeder Liste eine die Letzte sein musste, und wenn es dann Tränen gab, war Kay ehrlich erstaunt. Sie fände nichts dabei, die Wahrheit über sich zu erfahren. Allerdings hörte sie diese nie, weil die anderen viel zu taktvoll waren, Kay als Letzte auf ihre Liste zu setzen, so gern sie es manchmal getan hätten. Denn Kay war mehr oder weniger eine Außenseiterin, und das wollte niemand sie fühlen lassen. Man setzte lieber Libby MacAusland oder Polly Andrews an die letzte Stelle, jedenfalls ein Mädchen, das man zeitlebens kannte oder mit dem man zur Schule gegangen war. Freilich versetzte es Kay einen ziemlichen Schock, als sie sich nicht an erster Stelle auf Lakeys Liste fand. Sie war in Lakey vernarrt und nannte sie immer ihre beste Freundin. Doch sie ahnte nicht, dass die Clique wegen der Osterferien mit Lakey einen Kampf ausgefochten hatte. Man hatte Strohhalme gezogen, um auszulosen, wer Kay für die Ferien einladen sollte, und als das Los auf Lakey fiel, wollte sie kneifen. Sie waren über sie hergefallen und hatten ihr mangelnden Sportsgeist vorgeworfen, was ja auch stimmte. Schließlich und endlich hatte sie ja Kay zu der ursprünglichen Sechser-Clique gebracht, als ihnen noch zwei Mitglieder fehlten, um den Südturm für sich zu bekommen. Es war Lakeys Idee gewesen, Kay und Helena Davison aufzufordern, sich mit ihnen zusammenzutun und die beiden kleinen Einzelzimmer zu beziehen.
Wenn man jemand ausnutzen will, muss man ihn hinnehmen, wie er ist. Aber »ausnutzen« war sowieso nicht das richtige Wort. Sie alle mochten Kay und Helena, auch Lakey, die Kay in ihrem zweiten Jahr kennengelernt hatte, als beide wegen ihrer Schönheit, Popularität und guten Noten in die erlauchte Gesellschaft der Daisy Chain gewählt wurden. Sie hatte immer zu Kay gehalten, weil Kay, wie sie sagte, sich formen ließ und bildungsfähig war. Jetzt wollte sie herausgefunden haben, dass Kay auf tönernen Füßen stand, was eigentlich unlogisch war, denn ließ Ton sich etwa nicht formen? Aber Lakey war unlogisch, darin bestand ihr Charme. Sie konnte ein fürchterlicher Snob sein und dann wieder das genaue Gegenteil. Heute Morgen zum Beispiel machte sie ein finsteres Gesicht, weil Kay sich ihrer Meinung nach in aller Stille auf dem Standesamt hätte trauen lassen sollen, statt von Harald, dem das nicht in die Wiege gelegt worden war, zu verlangen, dass er eine Hochzeit in J. P. Morgans Kirche durchsteht. Zu Kay hatte sie selbstverständlich kein Wort davon gesagt, weil sie erwartete, Kay werde das selber merken. Doch gerade dazu war die sture, ungehobelte, leichtfertige Kay, die sie alle trotz ihrer Fehler liebten, außerstande. Lakey hatte oft die merkwürdigsten Vorstellungen von anderen Menschen. Seit vorigem Herbst war sie von der fixen Idee besessen, dass Kay sich aus Gründen des Prestiges der Clique aufgedrängt habe. Das war nun keineswegs der Fall und passte ja wohl auch kaum zu einem derart unkonventionellen Mädchen, das nicht einmal die eigenen Eltern zu ihrer Hochzeit einlud, obwohl ihr Vater in Salt Lake City ein angesehener Mann war.
Gewiss, Kay hatte versucht, das Stadthaus der Protheros für den Empfang zu bekommen, sich aber ohne Groll damit abgefunden, als Pokey laut jammernd erklärte, das Haus sei im Sommer geschlossen und ihr Vater werde die paar Male, die er in der Stadt übernachte, vom Hausmeisterehepaar versorgt. Arme Kay! Einige der Mädchen fanden, Pokey hätte sich ein bisschen großzügiger zeigen und ihr eine Gästekarte für den Colony Club anbieten können. Ja, in dieser Hinsicht hatten alle ein etwas schlechtes Gewissen. Jede von ihnen verfügte, wie die anderen wohl wussten, über ein Haus, eine große Wohnung, einen Club (und sei es nur der Cosmopolitan) oder notfalls über das Junggesellenheim eines Cousins oder Bruders, das man Kay hätte anbieten können. Aber das hätte Punsch, Champagner, eine Torte von Sherry’s oder Henri’s und Servicepersonal bedeutet – und ehe man sich’s versah, war man es selber, der die Hochzeit ausrichtete und einen Vater oder Bruder als Brautführer lieferte. In heutiger Zeit musste man, wie Mama erschöpft zu sagen pflegte, aus reinem Selbstschutz vorsichtig sein; es traten so viele Anforderungen an einen heran. Zum Glück hatte Kay beschlossen, mit Harald zusammen das Hochzeitsfrühstück selbst zu geben, und zwar in dem alten Brevoort-Hotel in der 8th Street, was so viel netter und passender war.
Dottie Renfrew und Elinor Eastlake verließen gemeinsam die Kirche und traten hinaus in die Sonne. Der Ring war nicht gesegnet worden. Dottie runzelte die Stirn und räusperte sich: »Glaubst du«, wagte sie sich mit ihrer Bassstimme vor, »dass sie nicht doch irgendjemand als Brautführer hätte finden können? War da nicht ein Vetter in Montclair?« Elinor zuckte die Achseln. »Das hat nicht geklappt«, erwiderte sie.
Libby MacAusland, Studentin der Anglistik aus Pittsfield, trat jetzt hinzu. »Was gibt’s, was ist los? Auseinander, ihr Mädels!« Sie war eine große, hübsche Blondine, die ihre braunen Augen fortwährend aufriss, ihren Schwanenhals neugierig reckte und von einer etwas aufdringlichen Freundlichkeit war. In ihrem ersten Semester war sie Klassensprecherin gewesen, und um ein Haar wäre sie Präsidentin der Studentenschaft geworden. Dottie legte eine warnende Hand auf Lakeys seidenen Ellenbogen; Libby war bekanntlich eine hemmungslose Klatschbase und Schwätzerin. Lakey schüttelte Dotties Hand mit einer leichten Bewegung ab, sie hasste jede körperliche Berührung. »Dottie fragte gerade«, sagte sie mit Nachdruck, »ob es da nicht einen Cousin in Montclair gab?« Ein kaum merkliches Lächeln lag auf dem Grund ihrer grünen Augen, deren Iris ein eigentümlicher dunkelblauer Ring umrandete, ein Merkmal ihres Indianerbluts. Sie hielt nach einem Taxi Ausschau. Libby spielte übertrieben die Nachdenkliche und tippte mit einem Finger an die Mitte ihrer Stirn. »Ich glaube, es gibt tatsächlich einen«, stellte sie fest und nickte dreimal hintereinander. Lakey hob die Hand, um ein Taxi heranzuwinken. »Kay hat ihren Cousin verschwiegen, weil sie hoffte, eine von uns würde ihr etwas Besseres liefern.« – »Aber Lakey!«, hauchte Dottie und schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. »Wirklich, Lakey«, kicherte Libby, »nur du kannst auf so was kommen.« Sie zögerte. »Wenn Kay tatsächlich einen Brautführer haben wollte, so hätte sie schließlich nur ein Wort zu sagen brauchen. Mein Vater oder mein Bruder hätten gern, jeder von uns hätte gern …« Ihre Stimme brach ab. Ihr schmaler Körper schwang sich in das Taxi, wo sie sich auf den Klappsitz setzte und mit grüblerischem Blick, das Kinn in die Hand gestützt, ihre Freundinnen betrachtete. Ihre Bewegungen waren rasch und unruhig – sie selbst sah sich als ein hochgezüchtetes, stürmisches Wesen, wie ein Araberhengst auf einem naiven englischen Jagdstich. »Glaubst du wirklich?«, wiederholte sie eindringlich und biss sich auf die Oberlippe. Aber Lakey sagte kein Wort mehr. Sie begnügte sich meist mit Andeutungen, weswegen man sie auch die Mona Lisa des Raucherzimmers genannt hatte.
Dottie Renfrew war bekümmert. Ihre behandschuhten Finger zerrten unentwegt an der Perlenkette, die sie zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag bekommen hatte. Ihr Gewissen bedrängte sie, was sich bei ihr gewohnheitsmäßig in einem leisen Hüsteln äußerte, das wiederum ihre Eltern so besorgt stimmte, dass sie Dottie zweimal im Jahr, zu Weihnachten und zu Ostern, nach Florida schickten.
»Lakey«, sagte Dottie ernst, ohne Libby zu beachten, »eine von uns hätte das übernehmen müssen, findest du nicht auch?« Libby MacAusland rutschte mit unruhigen Blicken auf dem Klappsitz herum. Beide Mädchen starrten auf Elinors ovales, unbewegtes Gesicht. Elinors Augen wurden schmal, sie griff an ihren blauschwarzen Nackenknoten und steckte eine Haarnadel fest. »Nein«, sagte sie verächtlich, »das wäre ein Eingeständnis von Schwäche gewesen.«
Libby traten die Augen aus dem Kopf. »Wie hart du sein kannst«, sagte sie bewundernd. »Und dennoch betet Kay dich an«, sinnierte Dottie. »Früher mochtest du sie am liebsten, Lakey. Im Grunde deines Herzens ist es, glaube ich, wohl noch heute so.« Lakey lächelte über das Klischee. »Mag sein«, sagte sie und zündete sich eine Zigarette an. Gegenwärtig mochte sie Mädchen wie Dottie, die eindeutig waren, wie ein Bild, das sich einem bestimmten Stil oder einer Schule zuordnen ließ. Die Mädchen, denen Lakey ihre Gunst schenkte, konnten sich meist nicht erklären, was ihr an ihnen gefiel. Sie empfanden mit einer gewissen Demut, dass sie völlig anders waren als Lakey. Untereinander sprachen sie oft über sie, wie etwa Spielzeuge über ihren Besitzer, und kamen zu dem Schluss, dass sie furchtbar unmenschlich sei. Aber das steigerte ihren Respekt für sie. Außerdem war Lakey sehr unbeständig, weswegen sie eine große Seelentiefe bei ihr vermuteten. Als das Taxi jetzt von der 9th Street in Richtung Fifth Avenue fuhr, fasste Lakey wieder einen ihrer plötzlichen Entschlüsse. »Ich möchte aussteigen«, befahl sie mit ihrer leisen, klaren, wohlklingenden Stimme. Der Fahrer hielt sofort, wandte sich um und sah zu, wie sie ausstieg, trotz ihrer Zerbrechlichkeit recht hoheitsvoll, in einem hochgeschlossenen schwarzen Taftkostüm mit weißem Seidenschal, einem kleinen melonenförmigen Hut und schwarzen Schuhen mit sehr hohen Absätzen. »Nun fahren Sie schon«, rief sie ungeduldig über die Schulter, als das Taxi noch immer hielt.
Die beiden Mädchen im Wagen sahen sich fragend an. Libby MacAusland streckte ihren Goldkopf, den ein Blumenhut zierte, aus dem Fenster. »Kommst du nicht mit?«, rief sie. Sie bekam keine Antwort. Sie sahen die aufrechte kleine Gestalt durch die Sonne auf den University Place zugehen. »Folgen Sie ihr«, sagte Libby zu dem Fahrer. »Dann muss ich um den Block herumfahren, meine Dame.« Das Taxi bog in die Fifth Avenue ein und fuhr am Brevoort vorbei, wo die übrigen Hochzeitsgäste gerade eintrafen. Es fuhr weiter die 8th Street hinauf und zurück zum University Place. Doch von Lakey war weit und breit nichts mehr zu sehen. Sie war verschwunden.
»Na so was!«, rief Libby. »Habe ich etwas Dummes gesagt?« – »Fahren Sie noch mal um den Block«, fiel Dottie ruhig ein. Vor dem Brevoort stiegen Kay und Harald gerade aus einem Taxi, die beiden erschrockenen Mädchen bemerkten sie nicht. »Ob sie sich plötzlich entschlossen hat, den Empfang sausen zu lassen?«, fuhr Libby fort, als das Taxi zum zweiten Mal erfolglos um den Block gefahren war. »Ich muss wirklich sagen, sie schien ja von Kay überhaupt nichts mehr wissen zu wollen.« Das Taxi hielt vor dem Hotel. »Was machen wir nun?«, fragte Libby. Dottie öffnete ihre Handtasche und reichte dem Fahrer einen Schein. »Lakey tut, was sie für richtig hält«, sagte sie beim Aussteigen energisch zu Libby. »Wir erzählen einfach, dass ihr in der Kirche schlecht geworden ist.« Libbys hübsches, knochiges Gesicht zeigte Enttäuschung, sie hatte sich schon auf einen Skandal gefreut.
In einem Extrazimmer des Hotels standen Kay und Harald auf einem verblassten geblümten Teppich und nahmen die Glückwünsche ihrer Freunde entgegen. Man reichte einen Punsch, über den die Gäste in Entzücken ausbrachen: »Was ist es?« – »Einfach köstlich.« – »Wie bist du darauf gekommen?« Und so weiter. Kay gab jedem das Rezept. Die Grundlage bestand aus einem Drittel Jersey-Apfelschnaps, einem Drittel Ahornsirup und einem Drittel Zitronensaft, dem White-Rock-Whiskey beigefügt war. Harald hatte den Apfelschnaps von einem befreundeten Schauspieler bekommen, der ihn seinerseits von einem Bauern bei Flemington bezog. Der Punsch war die Abwandlung eines Cocktails, der Applejack Rabbit hieß. Das Rezept war ein Eisbrecher. Genau das hatte Kay sich von ihm erhofft, wie sie Helena Davison zuflüsterte. Jeder kostete ihn prüfend und stimmte mit den anderen darin überein, dass das Besondere daran der Ahornsirup sei. Ein großer Mann mit strubbeligem Haar, der beim Radio tätig war, machte Witze über Jersey Lightning und erklärte dem gutaussehenden jungen Mann mit der gestrickten grünen Krawatte, das Zeug habe es in sich. Man sprach über Apfelschnaps im Allgemeinen und dass er die Menschen streitsüchtig mache. Die Mädchen lauschten gebannt, bis zum heutigen Tage hatte keine von ihnen je Apfelschnaps getrunken. Harald erzählte von einem Drugstore in der 59th Street, wo man rezeptpflichtigen Whiskey ohne Rezept bekomme. Polly Andrews besorgte sich vom Kellner einen Bleistift, um sich die Adresse aufzuschreiben. Im Sommer wollte sie in Tante Julias Wohnung allein hausen und brauchte deshalb gute Tipps. Dann erzählte Harald von einem Likör, der Anisette hieß. Ein Italiener vom Theaterorchester hatte ihm beigebracht, wie man ihn aus reinem Alkohol, Wasser und Anisöl, das ihm eine milchige Farbe wie Pernod verlieh, herstellte. Dann erzählte er von einem armenischen Restaurant, wo es zum Nachtisch ein Gelee aus Rosenblättern gab, und verbreitete sich über die Unterschiede zwischen türkischer, armenischer und syrischer Küche. »Wo hast du nur diesen Mann aufgetrieben?«, riefen die Mädchen wie aus einem Munde.
In der Pause, die nun eintrat, leerte der junge Mann mit der gestrickten Krawatte ein Glas Punsch und trat zu Dottie Renfrew. »Wo ist die dunkle Schönheit?«, erkundigte er sich in vertraulichem Tonfall. Auch Dottie senkte die Stimme und blickte nervös in die andere Ecke des Speisesaals, wo Libby MacAusland mit Zweien aus der Clique tuschelte. »Ihr wurde in der Kirche schlecht«, murmelte sie. »Ich habe es gerade Kay und Harald gesagt. Wir haben sie in ihr Hotel geschickt, damit sie sich hinlegen kann.« Der junge Mann zog eine Augenbraue hoch. »Das ist ja schrecklich«, bemerkte er. Kay drehte sich hastig um, der Spott in der Stimme des jungen Mannes war nicht zu überhören. Dottie errötete. Sie suchte tapfer nach einem neuen Gesprächsthema. »Sind Sie auch beim Theater?« Der junge Mann lehnte sich an die Wand und legte den Kopf in den Nacken. »Nein«, sagte er. »Aber Ihre Frage ist durchaus verständlich. Ich bin bei der Wohlfahrt.« Dottie musterte ihn ernst. Ihr fiel jetzt ein, dass Polly gesagt hatte, er sei Maler, und sie merkte, dass er sie aufzog. Er sah ganz wie ein Künstler aus – schön wie eine römische Statue, nur etwas verbraucht und ramponiert. Die Wangen waren schon ziemlich schlaff und zu beiden Seiten der makellosen, geraden, kräftigen Nase zogen sich düstere Furchen. Sie wartete. »Ich male Plakate für die Internationale Friedensliga der Frauen«, erläuterte er. Dottie lachte und erwiderte: »Das ist doch keine Wohlfahrtsarbeit.« – »Im übertragenen Sinne schon«, sagte er und sah sie prüfend an. »Vincent Club, Junior League, Hilfswerk für ledige Mütter«, zählte er auf. »Ich heiße Brown. Ich stamme aus Marblehead. Ich bin ein indirekter Abkömmling von Nathaniel Hawthorne. Mein Vater hat eine Gemischtwarenhandlung. Ein College habe ich nicht besucht. Ich stamme nicht aus diesen Kreisen, mein Fräulein.« Dottie sah ihn nur schweigend und mitfühlend an. Sie fand ihn jetzt überaus anziehend. »Ich bin ein Ex-Exilierter«, fuhr er fort. »Seit dem Dollarsturz bewohne ich ein möbliertes Zimmer in der Perry Street, neben dem Zimmer des Bräutigams, male Plakate für die Damen und auch ein paar Sachen für die Industrie. »Für Jungens«, wie die Mädchen das nennen, befindet sich am Ende des Ganges, und im begehbaren Schrank steht ein elektrischer Grill. Daher müssen Sie entschuldigen, wenn ich nach Spiegeleiern mit Speck rieche.«
Dotties biberbraune Augen blinzelten vorwurfsvoll. Seine Redeweise verriet ihr, dass er stolz und verbittert war. Dass er ein Gentleman war, bewiesen seine noblen Gesichtszüge und sein tadellos geschnittener, wenn auch abgetragener Tweedanzug. »Harald will jetzt höher hinaus«, sagte Mr. Brown. »Eine Wohnung auf der eleganten East Side – über einem Schnapsladen und einer billigen Reinigungsanstalt, habe ich gehört. Wir trafen uns wie zwei Fahrstühle, die aneinander vorbeifahren – um einen modernen Vergleich zu wählen: Der eine geht aufwärts, der andere abwärts.« Dann fuhr er stirnrunzelnd fort: »Gestern wurde ich in Foley Square von einem schönen Geschöpf namens Betty aus Morristown, New Jersey, geschieden.« Er beugte sich leicht vor. »Wir verbrachten zur Feier des Tages die vergangene Nacht in meinem Zimmer. Heißt irgendeine von euch etwa Betty?« Dottie überlegte. »Da wäre Libby», sagte sie. »Nein, keine Libby, Beth oder Betsy. Die Namen, die ihr Mädchen von heute habt, gefallen mir nicht. Aber was ist mit der dunklen Schönheit? Wie heißt denn die?«
In diesem Augenblick tat sich die Tür auf und Elinor Eastlake wurde von einem Kellner hereingeführt, dem sie mit schwarz behandschuhter Hand zwei braun eingewickelte Pakete übergab. Sie schien völlig gelassen. »Sie heißt Elinor«, flüsterte Dottie. »Wir nennen sie Lakey, weil sie mit Nachnamen Eastlake heißt und aus Lake Forest bei Chicago stammt.« – »Vielen Dank«, sagte Mr. Brown, der jedoch keine Anstalten traf, sich von Dotties Seite zu entfernen, sondern fortfuhr, mit gedämpfter Stimme aus dem Mundwinkel heraus schnöde Bemerkungen über die Hochzeitsgesellschaft zu machen.
Harald hatte Lakeys Hand ergriffen und hin und her geschwenkt, während er einen Schritt zurücktrat, um ihr Kleid, ein Patou-Modell, zu bewundern. Seine raschen, geschmeidigen Bewegungen standen in eigentümlichem Gegensatz zu seinem länglichen Kopf und seiner feierlichen Miene. Es war, als gehöre dieser Denkapparat gar nicht zu ihm, sondern sei ihm bei einer Maskerade aufgesetzt worden. Harald war, wie die Mädchen aus seinen Briefen wussten, ein unerhört egozentrischer Mensch, und wenn er von seiner Karriere sprach, wie eben jetzt zu Lakey, so tat er das mit einem sachlichen, unpersönlichen Eifer, als handele es sich um die Abrüstung oder das Haushaltsdefizit. Dennoch wirkte er auf Frauen, wie die Mädchen ebenfalls aus seinen Briefen wussten, sehr anziehend. Auch die Clique bescheinigte ihm einen gewissen Sex-Appeal, wie ihn manchmal auch einfache Lehrer oder Geistliche haben. Dazu kam noch etwas Undefinierbares, ein dynamischer Schwung, sodass Dottie sich sogar jetzt noch fragte, wie Kay ihn zu einem Antrag gebracht hatte. Die Möglichkeit, dass Kay vielleicht enceinte sei, hatte sie im Stillen öfters erwogen, obwohl Kay behauptete, genau zu wissen, wie man sich vorsah, und bei Harald auf der Toilette eine Scheidendusche, einen Irrigator, deponiert hatte.
»Kennen Sie Kay schon lange?«, fragte Dottie neugierig. Sie musste unwillkürlich an die Toilette am Ende des Ganges denken. »Lange genug«, erwiderte Mr. Brown. Das war so grausam direkt, dass Dottie zusammenzuckte, als würde es über sie auf ihrem eigenen Hochzeitsempfang gesagt. »Ich mag Mädchen mit dicken Beinen nicht«, erläuterte er und lächelte beruhigend. Dotties Beine und die schmalen, elegant beschuhten Füße waren das Hübscheste an ihr. Dottie war illoyal genug, gemeinsam mit ihm Kays Beine zu mustern, die tatsächlich recht stämmig waren. »Ein Zeichen bäuerlicher Vorfahren«, sagte er und hob den Finger. »Der Schwerpunkt liegt zu tief – das bedeutet Eigensinn und Dickfelligkeit.« Er studierte Kays Figur, die sich unter dem dünnen Kleid abzeichnete. Wie gewöhnlich trug sie keinen Hüfthalter. »Ein Anflug von Steatopygie.« – »Wie bitte?«, flüsterte Dottie. »Übermäßige Fettansammlung am Gesäß. Ich hole Ihnen etwas zu trinken.« Dottie war entzückt und entsetzt, sie hatte noch nie eine so gewagte Unterhaltung geführt.
»Sie und Ihre mondänen Freundinnen«, fuhr er fort, »sind für ihre Funktionen besser ausgerüstet. Volle, tief angesetzte Brüste« – er sah sich nach allen Seiten um –, »wie geschaffen zum Tragen von Perlen und Bouclé-Pullovern, von gerüschten und gefältelten Crêpe-de-Chine-Blusen. Schmale Taillen. Schlanke Beine. Als ein Mann des vorigen Jahrzehnts bevorzugte ich die knabenhafte Figur, Erinnerungen an den Sommer in Marblehead: ein Mädchen in einer Badekappe, zum Kopfsprung vom Zweimeterbrett bereit. Magere Frauen sind sinnlicher, eine wissenschaftliche Tatsache – die Nervenenden sitzen dichter an der Oberfläche.« Seine grauen Augen verengten sich unter den schweren Lidern, als würde er einschlafen. »Aber die Dicke gefällt mir trotzdem«, sagte er unvermittelt, mit einem Blick auf Pokey Prothero. »Ein feuchtes Weib, Perlmutthaut, mit Austern gepäppelt. Mann oh Mann! Geld, Geld und nochmals Geld! Meine sexuellen Probleme sind in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Ich hasse mittellose Frauen, bin aber selbst ein Bohemien. Unmögliche Kombination.«
Zu Dotties Erleichterung erschienen jetzt die Kellner mit dem Frühstück – Landeier. Kay scheuchte alle zu Tisch. Sie setzte den Brautführer an ihre rechte Seite, einen sehr schweigsamen Menschen, der beim Wall Street Journal arbeitete (Anzeigenabteilung), und Helena Davison an Haralds rechte Seite, aber dann gab es nur noch Konfusion. Dottie stand verlassen am Ende der Tafel, zwischen Libby, die sie nicht ausstehen konnte, und der Frau des Radioreporters, die Kleider für Russeks entwarf (und natürlich links von Harald hätte sitzen müssen). Die Anwesenheit so vieler Mädchen machte die Tischordnung schwierig, aber mit etwas Sorgfalt hätte die Gastgeberin es immerhin so einrichten können, dass nicht alle Langweiler zusammensaßen. Doch die Frau des Radiomenschen, eine lebhafte Bohnenstange, ausstaffiert mit Federschmuck und Accessoires aus Jettsteinen wie ein Filmvamp, schien mit ihren Tischnachbarn völlig zufrieden zu sein: Als ehemalige Angehörige der Universität Idaho, Abschlussjahrgang 1928, liebe sie solche Veranstaltungen. Sie kenne Harald schon seit Kindesbeinen, verkündete sie, und seine Eltern ebenfalls, obschon sie diese lange nicht mehr gesehen habe. Haralds Vater sei damals Direktor des Gymnasiums in Boise gewesen, das sie und Harald vor unzähligen Jahren besucht hätten. »Ist Kay nicht ein Schatz?«, fragte sie Dottie sofort. »Furchtbar nett«, antwortete Dottie mit Wärme. Ihre Nachbarin war das, was man früher »peppig« nannte. Dottie musste in Gedanken wieder einmal ihrer Englischlehrerin recht geben, die immer behauptet hatte, es sei klüger, nicht im Jargon zu sprechen, denn das verrate das Alter.
»Wo sind eigentlich die Eltern der Braut abgeblieben?«, fragte die Frau jetzt mit gedämpfter Stimme. »Abgeblieben?«, wiederholte Dottie verständnislos. Was meinte diese Person nur? »Warum kreuzen die nicht zur Hochzeit auf?« – »Oh«, sagte Dottie hüstelnd. »Ich glaube, sie haben Kay und Harald einen Scheck geschickt«, murmelte sie. »Statt das Geld für die Reise auszugeben, verstehen Sie?« Die Frau nickte. »Das meinte auch Dave – mein Mann. ›Sie haben sicherlich einen Scheck geschickt‹, sagte er.« – »Ist ja auch viel praktischer«, meinte Dottie. »Finden Sie nicht auch?« – »Bestimmt«, sagte die Frau. »Aber ich bin ja fürs Gemütvolle – ich hab’ in Weiß geheiratet … Übrigens hatte ich Harald angeboten, die Hochzeit bei uns zu feiern. Wir hätten einen Pfarrer aufgetrieben und Dave hätte ein paar Bilder machen können für die Alten daheim. Aber bis ich mit meinem Vorschlag kam, hatte Kay bereits alles arrangiert.« Sie hielt fragend inne und sah Dottie forschend an, die um eine Antwort einigermaßen verlegen war und taktvoll mit einem Scherz auswich: Kays Pläne seien unabänderlich wie die Gesetze der Meder und Perser. »Wer war das noch«, fuhr sie zwinkernd fort, »der gesagt hat, dass seine Frau von eiserner Willkür sei? Mein Vater zitiert das immer, wenn er Mama nachgeben muss.« – »Zum Schießen«, sagte die Nachbarin. »Harald ist ein prima Kerl«, fügte sie dann in ernstem und nachdenklichem Ton hinzu, »aber auch leicht verletzbar, was man vielleicht gar nicht denkt.« Sie sah Dottie durchdringend an und ihre Pfauenfedern nickten kampflustig, als sie nun ein Glas Punsch hinunterkippte.
Auf der anderen Seite des Tisches, links von Kay, fing der Abkömmling von Hawthorne, der sich gerade mit Priss Hartshorn unterhielt, Dotties bekümmerten Blick auf und zwinkerte ihr zu. Dottie, die nicht wusste, was sie sonst tun sollte, zwinkerte forsch zurück. Sie hätte nie geglaubt, dass sie der Typ sei, den Männern zuzuzwinkern. Infolge ihrer schwachen Gesundheit, die ihr als Kind nicht erlaubte, die Schule zu besuchen, war sie die Älteste der Clique, fast dreiundzwanzig, und sie wusste, dass sie ein bisschen altjüngferlich wirkte. Die Clique neckte sie wegen ihrer Förmlichkeit, ihrer festgefahrenen Gewohnheiten, ihrer wollenen Schals und ihrer Arzneien und wegen des langen Nerzmantels, den sie gegen die Kälte auf dem Schulgelände trug. Aber Dottie hatte viel Humor und machte sich mit den anderen über sich selbst lustig. Ihre Verehrer behandelten sie immer mit großem Respekt, sie gehörte zu den Mädchen, die von anderer Leute Brüdern ausgeführt werden, und sie hatte an jedem Finger einen der blassen Jünglinge, die an der Harvard Graduate School Archäologie, Musikgeschichte oder Architektur studierten. Sie las der Clique Auszüge aus deren Briefen vor – Beschreibungen von Konzerten oder von möblierten Wohnungen im Südwesten – und bekannte im Wahrheitsspiel, dass sie zwei Heiratsanträge bekommen hatte. Sie habe schöne Augen, sagten ihr alle, und blitzweiße Zähne, auch hübsches, allerdings dünnes Haar. Ihre Nase war ziemlich lang und spitz, eine typische neuenglische Nase, und ihre Augenbrauen waren schwarz und etwas stark. Sie ähnelte dem Porträt Copleys von einer ihrer Vorfahrinnen, das zu Hause in der Halle hing. Sie hatte etwas übrig für gesellige Vergnügungen und war, so argwöhnte sie, ziemlich sinnlich. Sie liebte Tanz und Gesang und summte ständig Schlagerfetzen vor sich hin. Doch nie hatte einer auch nur den Versuch gemacht, ihr zu nahe zu treten. Manche der Mädchen konnten das kaum glauben, aber es stimmte. Seltsamerweise hätte es sie nicht einmal schockiert. So komisch die anderen es auch fanden – D. H. Lawrence gehörte zu ihren Lieblingsschriftstellern: Er besaß ein so tiefes Verständnis für Tiere und für die natürliche Seite des Lebens.
Sie und ihre Mutter hatten sich nach einem langen Gespräch darauf geeinigt, dass man, wenn man in einen netten jungen Mann verliebt oder mit ihm verlobt war, vorsorglich einmal mit ihm schlafen solle, um sich zu vergewissern, dass man auch wirklich harmoniere. Ihre Mutter, die sehr jugendlich und sehr modern war, wusste von einigen traurigen Fällen in ihrem Freundeskreis, in denen Mann und Frau da unten einfach nicht zusammenpassten und nie hätten heiraten dürfen. Da Dottie nichts von Scheidung hielt, fand sie es sehr wichtig, dass in diesem Punkt eine Ehe von vornherein stimme. Der Gedanke an eine Defloration, über die die Mädchen im Raucherzimmer ständig witzelten, flößte ihr jedoch Angst ein. Kay hatte mit Harald Schreckliches durchgemacht. Fünfmal, so behauptete sie, bis es endlich klappte, und das trotz Basketball und dem vielen Reiten. Ihre Mutter hatte gesagt, man könne unter Umständen das Hymen auch operativ entfernen lassen, wie es angeblich in ausländischen Königshäusern üblich sei. Vielleicht aber schaffte ein sehr rücksichtsvoller Liebhaber es auch schmerzlos, und aus diesem Grunde wäre es wohl besser, einen älteren Mann mit Erfahrung zu heiraten.
Der Brautführer brachte einen Toast aus. Dottie sah auf und bemerkte, dass Dick Browns hellgraue Augen wieder auf ihr ruhten. Er hob sein Glas und prostete ihr feierlich zu. Dottie prostete zurück. »Ist es nicht herrlich?«, rief Libby MacAusland. Sie reckte den langen Hals, wiegte den Kopf und lachte auf ihre schmachtende Art. »So viel netter«, girrten die Stimmen, »keine Gratulationscour, keine Förmlichkeiten, keine älteren Leute.« – »Genau wie ich es mir auch wünschen würde«, verkündete Libby. »Eine Hochzeit nur unter jungen Leuten.«
Sie stieß einen Schrei des Entzückens aus, als eine Omelette Surprise hereingetragen wurde. Die gebackene Eischneekruste dampfte noch ein wenig. »Omelette Surprise!« Libby ließ sich wie ein Sack auf ihren Stuhl zurückfallen. »Kinder!«, sagte sie feierlich und deutete auf die große Eisbombe mit den leicht gebräunten Eischneebergen, die jetzt vor Kay hingestellt wurde. »Seht doch bloß! Kindheitsträume, die in Erfüllung gehen. Der Inbegriff jeder Kindergesellschaft im ganzen weiten Amerika. Lackschühchen und Organdykleidchen und ein schüchterner Junge im Etonkragen, der einen zum Tanz auffordert. So aufgeregt bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich das nicht mehr gesehen. Für mich ist das der Mount Whitney, der Fudschijama.« Die Mädchen lächelten einander nachsichtig zu. Aber ehe Libby zu ihrer Eloge angesetzt hatte, waren auch sie entzückt gewesen. Ein Seufzer der Erwartung ertönte, als jetzt der heiße Eischaum unter Kays Messer zusammenfiel. Die beiden Kellner, die an der Wand lehnten, sahen mürrisch drein. So gut war das Dessert nun auch wieder nicht. Der Eischaum war ungleich gebacken, stellenweise noch weiß, stellenweise schon verkohlt, was ihm einen unangenehmen Geschmack verlieh. Unter der Schicht von Eiscreme war der Biskuit altbacken und feucht. Aber aus Liebe zu Kay ließen sich alle noch einmal auftun. Die Omelette Surprise war genau das, was jede einzelne aus der Clique sich an Kays Stelle gern hätte einfallen lassen – ungeheuer originell für eine Hochzeit, aber wenn man es bedachte, genau das Richtige. Sie interessierten sich alle außerordentlich fürs Kochen und waren ganz und gar nicht einverstanden mit den fantasielosen Braten, Koteletts und fertigen Süßspeisen, die ihre Mütter vom Caterer kommen ließen. Sie würden neue Zusammenstellungen und ausländische Rezepte ausprobieren: flaumige Omelettes und Soufflés, interessante Sachen in Aspik und nur ein einziges warmes Gericht in einer feuerfesten Form, frischen grünen Salat dazu und keine Suppe.